
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
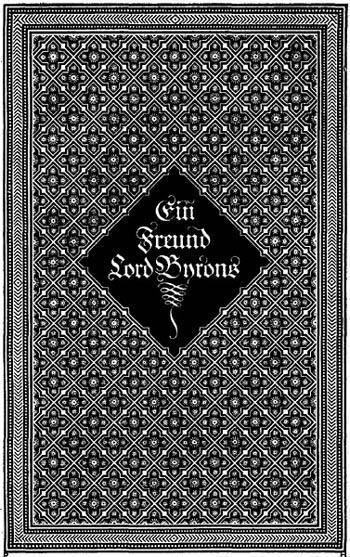
But there are wanderers o'er eternity –
Byron
Wie der erste Atemzug eines aus tiefer Ohnmacht Erwachenden strich der Lufthauch durch die Veranda in das Gartenzimmer des Bungalow, wo er die feinen Stirnhaare eines jungen Mädchens wie Spinngewebe flattern ließ – das Einzige, das er weit und breit bewegte. Erst der zweite Hauch versetzte die silbernen Blätter des Pipalbaumes links von der Treppe in ein leises Zittern, das dem Auge als ein blendendes Flimmern, dem Ohr als das plötzliche Niederrieseln eines Regenschauers bemerkbar war. Erst er wurde auch als Kühlung verspürt von dem lesenden Mädchen, dem er einen kleinen Seufzer der Erfrischung entlockte und bis zu einer unwillkürlichen Bewegung belebte, die den Bambusstuhl, in dem sie zurücklehnte, leise erknarren ließ.
Ihr Gegenüber aber, ein vierschrötiger Mann, dessen Stirn nur wenig Haare dem Windhauch zum Spiele bot, während der reichlich vorhandene, graugesprenkelte Bart zu borstig war, um sich dazu herzugeben, schien jetzt auch so weit belebt zu werden, daß er zu einem vorübergehenden körperlichen Bewußtsein gelangte. Denn ohne noch den Blick von den Palmblattstreifen wegzuwenden, die einen kleinen länglichen Stoß vor ihm auf dem Tische bildeten, ergriff er mit der rechten Hand ein daneben liegendes Seidentuch und rieb sich damit die bucklige und etwas hervorstehende Stirn und den kurzen Hals. Das offenstehende, ungestärkte Hemd ließ diesen Hals unbedeckt, dessen hellere Farbe, die gerade unter dem Nackenhaar einer kräftigen Ziegelsteinröte wich, deutlich genug verriet, daß der eifrige Leser nicht sehr lange unter diesem Himmelsstrich geweilt hatte: die indische Sonne hatte noch nicht vermocht, den Unterschied zwischen dem Teil der Haut, der immer frei der Luft ausgesetzt gewesen war, und dem anderen, der durch die in Europa übliche Halsbinde geschützt gewesen, hinlänglich auszugleichen.
Wenn nun auch dieser Gelehrte keinen Bruchteil einer Sekunde seinen Blick von dem eigentümlichen Manuskript erhob: so ließ hingegen das Mädchen das kleine, in grünen Maroquin gebundene Buch, in dem sie bis jetzt gelesen hatte, in den Schoß sinken, und ihr Blick schweifte frei über Garten und Gegend hinaus.
Das feine Akazienlaub, die Wedel der Farnbäume und die weichen Fahnen der mächtigen Bambussträucher bewegten sich jetzt fortwährend leise und wohlig; der See aber, nach dem der Garten mählich sich hinunter neigte, lag so tief, daß nicht ein Hauch seine Spiegelfläche trübte. Über dieser erhob sich nach dem Hintergrund zu das Land in fleischfarbenen Tönen, bis es ohne merklichen Übergang zum Gebirge wurde, das wie ein Haufen von aufgepufften, silbergrauen, rosigen und lilafarbigen Seidenstoffen in die blasse Luft emporwuchs. Das ganze rechte Seeufer war von oben bis unten ein ungeheurer Burgpalast, der hinter dem Schleier der vibrierenden Hitze, in die alles auflösende und vergeistigende Glut getaucht, mit seinem Spiegelbilde zusammenschmolz und so, gleichsam frei schwebend, eher das phantastische Traumbild eines trunkenen Architekten, denn ein wirklicher von Menschen bewohnter Bau zu sein schien; – den roten Sandsteinfelsen unmerkbar entwachsend, entfaltete sich ein verwirrendes und doch entzückendes Durcheinander von zinnengekrönten Basteien, Freitreppen, Terrassen, Mauern, Erkern und Säulenhallen – bis schließlich das Ganze sich zerteilte in einen Wald von Pavillons, Türmen, Kuppeln und wunderbaren Zwitterformen beider: gedrückte, zwiebelförmige und hochgestreckte, ananasartige Kuppeln und vielstufige, pagodenartige Pyramiden.
Dies war das hell in hell gemalte Bild, das von der nach der Veranda zu fast offenen Wand des Zimmers eingerahmt wurde. An den beiden Seitenwänden hing je ein dunkles: links ein Porträt von Lord Byron, mit der bekannten Drehung des kleinen, kraushaarigen Kopfes in dem zurückgeschlagenen Kragen und mit den ebenso bekannten quer über das Wams gezogenen Mantelfalten. Ihm gegenüber sah man einen jungen Mann in goldbetreßter blauer Jacke, welche Brust und Ärmel des scharlachgestickten Hemdes unbedeckt ließ und nur gerade bis zu der kirschroten seidenen Schärpe reichte, in der zwei mit Silber verzierte Terzerole steckten; die weißen Fustanellen wurden von dem Rahmen abgeschnitten. Das Gesicht war von den großen orientalisch tiefdunklen Augen beherrscht; ein spärlicher Schnurrbart kräuselte sich auf der Oberlippe, und unter dem Fez fiel das Haar in schweren, wie in Ebenholz geschnitzten Massen auf die Schulter hinab. Hinter ihm ragten lilagraue Felsengipfel in eine braune, von einem Zickzackblitz durchstrichene Wolke hinauf.
In dieser Gegenüberstellung mutete er als ein Geschöpf des edlen Lords an – etwa als der Korsar – um so mehr als zu beiden Seiten je eine Byronsche Heroine – rechts Haidée, links Gulnare – in »illuminierten« Kupferstichen angebracht war.
Endlich erwachte nun auch der Mann, der bis jetzt die Nase in die Palmblätter gesteckt hatte, zu einem deutlichen und dauernden Bewußtsein davon, daß er nicht etwa nur in der Eigenschaft eines Entzifferers altindischer Texte existierte. Er wiederholte – nur noch gründlicher – jene Prozedur mit dem seidenen Tuch, das dann benutzt wurde, um die eulenäugigen Gläser der großen Hornbrille zu putzen. Dann wurde diese nicht mehr auf die Nase gesetzt, sondern durfte auf dem Blätterstoß ruhen, und die zu ihr gehörenden Augen sahen sich unbewaffnet um, wie um sich zu orientieren, wo sie sich eigentlich jetzt befänden. Da alles draußen für sie nur ein leuchtender Nebel war, wandten sie sich natürlicherweise an die nahen Gegenstände, zunächst an die beiden Bilder, die jene Frage vollkommen beantworteten, und blieben dann mit einem liebevollen Lächeln am Gesicht des jungen Mädchens haften, dessen Blick noch immer durch die Veranda hinausschweifte.
– Es steht hier geschrieben, daß die Kuh mittelst der Augen sieht, der Mensch mittelst der Vernunft, der Brahmane mittelst des Veda, und leider muß ich hinzufügen: der deutsche Professor mittelst der Brille. Aber auch ohne eine solche glaube ich sehen zu können, daß der Raja-Palast deine Gedanken besser zu fesseln weiß als die Poesie unseres Freundes und Wirtes.
Das Lächeln der jungen Dame, das bereitwillig den Brillenscherz honoriert hatte, wurde bei den letzten Worten sarkastisch.
Sie nahm den kleinen Maroquinband, der ihr in den Schoß gesunken war, wieder zur Hand und blätterte darin.
– Die Poesie unseres Wirtes! Ja, zum Beispiel: » Lines written to a lady who after presenting the autor with a ribbon from her bosom asked him what he would do with it.
Das drollige Schmollmündchen, das sie zog, und der sehr gelungene travestierende Ton, in dem sie den Titel vortrug, brachte ein Lächeln ins Gesicht des Gelehrten, das offenbar nur selten die ernsten Falten verließ.
– Was er damit machen wollte! Ich weiß nicht, ob es dich interessiert, Vater – mich interessiert es nicht, und besonders nicht hier. Mir scheint, es gehöre eine andere Art Poesie dazu, um es mit jenem Gedicht im Stein drüben aufzunehmen. Wenn es so aus dem Dunst heraustritt, wenn es gleichsam anfängt aufzuleben – ein Erker hier, ein Pavillon dort hervorlugt, so wie jetzt, dann ist mir immer, als ob der Palast mir etwas zu sagen hätte.
– Ja, freilich Amanda, nickte der Vater mit dem nachsichtigen Lächeln, das einem ernsten Forscher ziemt, wenn er wohlwollend auf die Phantasien eines Kindes eingeht: – so ein alter Rajputaner-Palast könnte wohl etwas zu erzählen haben.
– Das wollt' ich meinen! Und zwar von einer Zeit, wo alles größer war als jetzt – schrecklicher, aber auch herrlicher – der Haß blutiger, die Liebe unausschöpflicher. – –
Sie erhob sich mit einer energischen Bewegung.
– Ja, du lächelst, Vater, aber das würde ich singen, wenn ich ein Dichter wäre und jener Märchenbau mir Rede stände – wie er dem Dichterauge wohl tun mag.
Dabei schlug sie mit einer kleinen, weichen Hand, die gar nichts Heldenhaftes an sich hatte, auf das grüne Bändchen, als ob sie sagen wollte: »Aber von solchen Offenbarungen keine Spur auf diesen Blättern! Wie sollten sie mich denn jetzt fesseln können?«
Der Vater lächelte bei diesen Worten sinnend in sich hinein und strich sich behutsam den Bart.
– Ja, Amanda, sagte er dann, einen solchen Blick rückwärts in die Vergangenheit der Dinge soll es wohl geben, wenn man diesen Palmblättern glauben will, die ich gerade jetzt studiere, – aber nicht dem Dichter sei er gegeben.
– Wem denn? fragte das Mädchen mit einem schnellen Blick.
– Dem Heiligen.
Amanda hatte ein Paar eigentümliche Augenbrauen. Sie setzten sicher genug an, hörten aber plötzlich dort auf, wo die Wölbung des Lides die Stirn erreichte, als ob sie fänden, daß es nun genug sei, und jedes längliche Hinschmachten verschmähten: braune Gedankenstriche über den Tiefen der Augenwinkel. Diese Gedankenstriche rückten jetzt einander näher, die Stirn runzelte sich über der breiten Nasenwurzel, und ein spöttisches Lächeln kräuselte die Lippen, was diese sehr drollig kleidete, denn es paßte wenig zu ihren sanft geschwungenen Linien und weichen Formen.
– Dem Heiligen! – Nun, dann wird freilich Sir Trevelyan es wohl bleiben lassen, jener Sphinx drüben ihre Geheimnisse abzufragen, und er möge immerhin fortfahren, den Weltschmerz seines berühmten Freundes Lord Byron zu verwässern oder vielleicht noch besser auf big game zu pirschen, wie heute! –
Der Indologe hörte aus dem Klang ihrer Stimme eine ihm unverständliche Erregung heraus. Er zog aus einem Schildkrötenfutteral eine weniger eulenäugige Brille heraus als die zum Lesen benutzte, setzte sie mit der ihm eigenen bedächtigen Würde aller Bewegungen auf die breite, hervorspringende Nase und schien die Landschaft zu genießen, während der Blick in Wirklichkeit nicht weiter kam als bis zu dem anmutigen Profil der Tochter, die jetzt an dem Türpfosten der Veranda lehnte. Aber der herbe Zug um die zusammengepreßten Lippen und das gerade bemerkbare schmerzliche Runzeln der freien, breiten Stirn, die ein klein wenig an eine Kinderstirn bei aufziehendem Tränenwetter erinnerte, wollte nichts von ihren Geheimnissen diesem Gelehrten-Blick verraten, dem die Striche und Punkte einer alten Palmhandschrift jedenfalls leichter zu entziffern waren als alle Grübchen, Fältchen und Runzelchen eines Frauengesichtes.
So nahm er denn etwas enttäuscht mit der Landschaft vorlieb, und um einer gewissen Verlegenheit ein Ende zu machen bemerkte er, man sehe jetzt den NullahNullah: eingeschnittenes Bett eines Wasserlaufes. drüben ganz deutlich.
Amanda wandte mit diesem Ausruf den Blick nach dem Hintergrund, wo nun ein schmaler, blasser Schatten sichtbar war, der von dem Ende des Sees sich in geknickten Linien landeinwärts zog, bis er, immer schwächer werdend, in der Blässe des Gebirges verschwand.
– Ja, es muß also recht spät sein, bemerkte der Vater, dem dieser Zug der Landschaft offenbar statt des Zeigers seiner Uhr diente, die er in diesem westenlosen Zustand nicht bei sich trug. – Sir Edmund meinte, er würde viel früher von diesem Jagdausflug zurück sein. –
– Wenn er sich nur nicht verirrt hat! Es ist eine wilde Gegend, und noch wilder sind seine Begleiter. Der Rajput mit dem hinter das Ohr gestrichenen Bart – –
– Chandra Singh meinst du? – Ja?
– Bisweilen sieht er Sir Trevelyan mit einem so tückisch-scheelen Blick an.
– Wirklich? – Das tut er? – Hm – Kala Rama sagte mir – –
Er hielt inne mit einer verlegenen Miene und einem sehr mißlungenen Versuch zu tun, als ob er über die Landschaft ganz vergäße, was er sagen wollte.
– Hm – ja ... Wundervoll wie deutlich man heute den Nullah sieht. Dort stellen sie also jetzt dem Panther nach – nicht wahr? Es war im oberen Teil des Nullah?
– Jawohl ... Aber was hat denn der Minister gesagt? Wenn es in ganz Indien einen Eingeborenen gibt, der keine lose Rede führt, dann ist es Kala Rama.
– Ach so, ja ... Kala Rama – – seine Exzellenz – ja ...
Der ertappte Vater hatte sich zu spät entsonnen, daß es sich um etwas handelte, was er am liebsten mit seiner jungen Tochter nicht besprochen hätte; es gab aber offenbar kein Entwischen mehr. Wenn Amanda auf diese Weise fragte, dann wollte sie Antwort haben.
– Ja, er sagte mir – wir sprachen von den Rajputen und ihrem leidenschaftlichen Wesen – und ich weiß eigentlich nicht warum, jetzt, wo ich daran denke, kommt es mir vor, als ob er vielleicht eine bestimmte Absicht mit dieser Vertraulichkeit hätte – –
– Sicher hatte er eine Absicht. – Aber womit? Was hat er dir denn anvertraut, das ich so aus dir herauspressen muß?
– Daß eben dieser Chandra Singh eine leidenschaftliche Liebe zu der Rani hat – die sogar vielleicht nicht ohne Aufmunterung und Entgegenkommen geblieben ist.
Der Indologe machte diese vertrauliche Mitteilung mit einer etwas verschämten Miene, wie sie einem deutschen Gelehrten und Vater geziemt, wenn er durch die Tücke der Verhältnisse gezwungen wird, mit seiner jungen Tochter über so heikle Sachen, wie die Liebe eines Mannes zu einer verheirateten Frau und gar zu einer Fürstin, zu sprechen.
Aber dieses romantische Palastgeheimnis schien das Mädchen herzlich kalt zu lassen und kaum einmal ihre Neugier zu erregen, so gleichgültig kam ihr fragendes »Nun ja?«
– Die Rani soll ja eine sehr schöne Erscheinung sein, eine Art Urvasi, wie die blühenden Verse Kalidasas sie uns beschreiben, wenn auch kaum so lieblich. Ich bin recht neugierig, ob man sie morgen Abend, beim Gartenfest des Raja bewundern darf – wahrscheinlich nur die Augen, die allerdings ganz besonders gerühmt werden. Du wirst sie ja freilich schon früher und zwanglos zu sehen bekommen. Wann solltest du hinüber, um ihr deine Aufwartung zu machen?
– Mein Besuch ist für die letzte Stunde vor Sonnenuntergang festgesetzt, wenn es etwas kühler wird. So! diese Hindu-Venus hat es dem bärtigen Rajputen angetan? Und was hat das mit Sir Trevelyan zu tun?
– Hm, ja ... wie du soeben von Chandra Singhs schielendem Blick sprachst – »einen tückisch-scheelen Blick« war, glaub' ich, der Ausdruck, den du gebrauchtest? fügte er mit der peinlichen Akribie des Textkritikers fragend hinzu.
– Jedenfalls war es genau meine Meinung.
– Ja – hm – da kam mir der Gedanke – wie einem manchmal so etwas durch den Kopf blitzt – wenn nun der Rajput in Sir Edmund einen Rivalen erblickt – –
– Nun ja – – nicht daß ich meine, daß unser Freund selber – Gott bewahre! – Aber er ist ein hübscher, sogar ein schöner Mann, eine interessante Erscheinung – er gefällt den Frauen sehr, glaube ich – so daß es wohl möglich wäre, daß Chandra Singh – ganz ohne wirklich gegebene Veranlassung seitens unseres lieben Wirtes – – –
Die Verlegenheit des braven Gelehrten stieg von Wort zu Wort, je tiefer er in die Materie hineinkam, um so mehr fühlte er, wie wenig es seiner, des Professors, Dr. phil. Carl Eichstädt, rühmlichst bekannten Indologen, Herausgebers des Manava-Dharma-Sastra, korrespondierenden Mitglieds verschiedener englischer, französischer und italienischer wissenschaftlicher Gesellschaften, würdig war, hier zu sitzen und Möglichkeiten eines Liebesabenteuers zu erörtern, wenn auch eines indischen Liebesabenteuers. Ja, wenn Chandra Singh und die Fürstin vor drei- bis viertausend Jahren gelebt hätten und ihre Erotik eine Episode im Mahabharatam gebildet hätte, dann wäre die Sache eine andere – aber so!
Diese Verlegenheit hatte die für seine eigene Seelenruhe wohltätige Wirkung, zu verhindern, daß er die tödliche Blässe gewahrte, die plötzlich wie durch einen eisigen Hauch über das Gesicht des Mädchens hingeweht wurde. Er bemerkte erst die letzten Spuren davon, als sie ihn jetzt atemlos unterbrach: –
– Mein Gott, dann ginge es ihm ans Leben!
Der Herausgeber des Manava-Dharma-Sastra schrak unwillkürlich zusammen, als ob ein Schutz ihn aus einer textkritischen Untersuchung aufgescheucht hätte. Wiewohl die Prämissen für diese alarmierende Schlußfolgerung in seinen eigenen Auseinandersetzungen alle gegeben waren, kam ihm diese doch völlig überraschend. Kein Wunder, daß ein zartes Wesen wie seine Amanda nicht gerade rosig aussah bei dem Gedanken an Mord und Totschlag, der einem Manne drohte, dessen gastliches Dach ihnen schon seit Monaten europäische Bequemlichkeit im fernen Osten bot!
So beeilte er sich denn, diese – wie er meinte – recht unbegründete Furcht einer romantischen Mädchenphantasie durch triftige Gründe zu verbannen: –
– Nun, so schlimm wird es wohl nicht sein, liebes Kind! Freund Trevelyan ist ja nicht derjenige, der blind in eine Falle geht. Ich denke, der ist » a match for the Rajput«, wie er sagen würde, und mit Recht. Denke doch daran, daß er kaum zwanzig Jahre alt mit einem dreisten Kaper in den ostindischen Wassern kreuzte. Und nun gar später, wo er mit Lord Byron in Griechenland war und sich monatelang gegen die Türken in einer Höhle von Parnaß verteidigte, an der Spitze einer Hand voll griechischer Rebellen –
– Rebellen, Vater! Nennst du jene Freiheitshelden »Rebellen?«
Der plötzliche Blink in den goldigbraunen Augen des Mädchens zeugte von einer feurigen Seele, die lebhaft und entschieden Partei ergreift. Ein scharfer Beobachter würde freilich geargwohnt haben, daß ihre Entrüstung über den despektierlichen Ausdruck ihr ein willkommener Bundesgenosse war, um das Gespräch von einem ihr peinlichen Gebiete in ein ungefährliches hinüberzuleiten.
Aber der gute Vater, dessen gerader Gelehrtenverstand gewohnt war, sich an den Text zu halten und nichts dahinter zu suchen, nahm ihren Ausbruch ernst und verteidigte sich in gutem Glauben:
– Nun, du weißt doch, Amanda, ich war immer ein begeisterter Philhellene. Somit kann der beanstandete Ausdruck in meinem Mund nicht böse gemeint sein. Um aber eine solche Anwendung philologisch mit einer klassischen Autorität zu belegen, verweise ich auf ein Gedicht von Lord Byron selbst, das du mir kürzlich vorgelesen hast und wo dieser Ausdruck gerade auf dieselben Leute verwendet wurde.
– O, ich weiß schon, was du meinst.
Amanda legte die gefalteten Hände hinter den Haarknoten des Nackens, den sie an den Türpfosten zurücklehnte, und indem sie unwillkürlich die Augen verschloß, eher als ob sie sich in eigene ferne Erinnerungsbilder vertiefte denn als ob sie Poesie memorierte, trug sie die Byronschen Verse vor:
But some are dead, and some are gone,
And some are scatter'd and alone,
And some are rebels on the hills
That look along Epirus' valleys,
Where freedom still at moments ralleys
And pays in blood oppressions ills,
And some all restlessly at home,
But never more, oh! never we
Shall meet to revel and to roam.
Die Byronschen Verse lauten in Prosaübersetzung (da eine poetische unmöglich ist): Doch Einige sind gestorben, und Einige sind davon gegangen, und Einige sind versprengt und einsam, und Einige sind Rebellen im Gebirge, das auf die Täler von Epirus hinunterblickt, wo die Freiheit noch bisweilen sich schart und die Greuel der Tyrannei blutig vergilt. Und Einige sind in einem fernen Land, und Einige sind rastlos zu Hause. Doch nimmermehr, ach nimmermehr werden wir uns wieder treffen zum fröhlichen Umherschweifen
Wenn der schon vor zehn Jahren verewigte Dichter, dessen Züge so lebenswahr von der Wand auf sie herunterblickten, dort in dem Bambusstuhl gesessen, in dem sein Freund und Kamerad, Sir Trevelyan, sich jetzt so oft streckte, und seinen eigenen Versen gelauscht hätte, wie sie den Lippen des jungen Mädchens entströmten: – er hätte sich sicherlich nicht darein gefunden, daß ein paar literarische Berater sie ihm aus dem Gedicht strichen, dessen stimmungsschweren Zusatz zur Einleitung sie hätten bilden sollen. Und er hätte gewiß diesen Freund und Kameraden gefragt, ob er denn auch wisse, daß sein Bungalowdach ein Frauenwesen beschatte, dessen zartbesaitete Seele in Harmonie mit den verborgensten Reizen des Rhythmus zittere und die intimsten Nuancen des dichterischen Ausdruckes wiedertöne – eines jener seltenen Wesen, denen die Natur das ausgesuchte, aber gefährliche Wiegengeschenk gab, mit dem intensivsten Genuß das köstlichste und flüchtigste Aroma der Schönheit zu kosten, und dem deshalb auch das Schicksal beides bereit hält: den Becher der Verzücktheit und den Kelch der Qual, beide überschäumend voll, beide bis auf die Neige auszuschlürfen.
So hätte der Dichter, seltsam bewegt durch den Melodiefluß seiner Verse von diesen jungfräulichen Lippen, erstaunt gefragt.
Der Professor, dessen ästhetischer Sinn nur mäßig entwickelt war, blieb auch nicht ganz unbewegt: –
– Ja, das war, was ich meinte – hübsch, wirklich sehr hübsch.
– Ach, das ist ein wahres Labsal, ihn selbst zu hören nach all der lahmen Nachahmung in Sir Trevelyans Gedichtsammlung!
– Sind Sir Edmunds Gedichte wirklich so schlecht? Du weißt, ich habe wenig Sinn für die modernen Dichter – Goethe und Schiller natürlich ausgenommen – und ich traue mir kein Urteil zu; aber ich las gestern etwas, das mir doch nicht so übel schien.
– Verlaß dich darauf, Vater: es ist trauriges Zeug alles miteinander – antwortete die strenge Richterin. Und indem sie zu ihm trat und ihren Arm ihm um die Schulter legte, beugte sie sich vor und betrachtete aufmerksam eines der beschriebenen Palmblätter.
– Was hast du aber dort gelesen? Etwas Altes natürlich und sicher etwas Schönes und sehr Merkwürdiges, nach dem was du vorher sagtest. Aber ich verstehe kein Wort.
– Das ist nicht Sanskrit, Amanda, das hier ist Pali, die heilige Sprache der Buddhisten. Es ist ein Manuskript der alten ehrwürdigen Jatakas.
– Jataka? was ist denn das?
– Das Wort bedeutet Wiedergeburtsgeschichten. In Wirklichkeit sind es Volksmärchen, Fabeln, Legenden, manchmal fast Novellen. Sie haben aber alle das gemeinsame Merkmal, dem sie auch ihren Titel verdanken, daß sie sämtlich von den früheren legendarischen Lebensläufen des Buddha handeln, oder wenigstens davon zu handeln vorgeben, denn oft ist diese Beziehung freilich offenbar nur ein Vorwand, um eine beliebte Geschichte anzubringen. Zum Beispiel, wenn er in einer Kaufmannsfamilie geboren wird, führt er seine Karawane heil durch die von Dämonen erfüllte Wüste, wo andere zugrunde gehen; – als Hirsch opfert er sein eigenes Leben, um das Rudel zu retten. Diese Geschichten werden immer an irgendein Erlebnis geknüpft, das dem Buddha Veranlassung gibt, jene Begebenheit aus der Vergangenheit zu berichten, worauf er dann zuletzt »den Jataka sammelt«, wie es heißt, indem er die Personen der beiden Begebenheiten identifiziert und etwa sagt: Sariputta war damals der weise Brahmane, Ananda war der Minister, aber der König von Benares war ich selber – oder ähnlich.
– Wie eigenartig ist das! Sagte ich nicht, daß es etwas Schönes sein müsse? Und wie wundervoll paßt das hier zu jenen Bergen draußen aus Amethysten und Topasen und Perlmutter, in deren Tälern so ausgezeichnet ein selbstaufopfernder Hirsch umhergehen könnte; und zur Wüste, deren orangefarbige Dünen mit der Palmenfranze dort jenseits des Sees anfangen – eines Kristallsees, der gewiß voll von redenden Fischen ist – und zum Palast, worin der König von Benares so prächtig wohnen könnte. Hör' einmal, nun mußt du ein guter Vater sein und mir einen dieser Jatakas vorlesen. Nichts könnte besser sein um die Luft zu reinigen: – echten Blumenduft nach diesem falschen Parfüm.
Lächelnd und kopfschüttelnd blätterte der Vater in dem Manuskript – erfreut über die Teilnahme, die seine Tochter den alten indischen Legenden entgegenbrachte, und verwundert über die fast drollige Unversöhnlichkeit, womit sie die Gedichte ihres Wirtes verfolgte.
– Ich bin ganz Ohr, meldete Amanda, die sich wieder in ihren Bambusstuhl zurechtgesetzt hatte, den Blick auf jenen Nullah geheftet, dessen dunkelblauer Schatten seinen Zickzackweg durch das rote Hügelland grub.
– Ja, hier ist eine, die sehr charakteristisch und hübsch ist. Zuerst wird erzählt, wie die Ordensbrüder, als sie abends in der Wihara – der Klosterhalle – versammelt sind, von einem Mönche sprechen, der sich von Leidenschaft zu einem falschen Weibe hat besiegen lassen. Dann tritt der Buddha selber herein und fragt sie, wovon sie sich soeben unterhielten, und sie erzählen es ihm. »Nicht heute, ihr Mönche«, sagt er dann, »hat Bruder Revata sich zum erstenmal im Netze der Sinnenlust fangen lassen, sondern schon einmal hat er das getan.« Und er lüftete den Schleier, der einen früheren Lebenslauf verdeckt.
Amanda richtete sich plötzlich im Stuhle auf und mit halb geöffneten Lippen, tief atmend, blickte sie ihn traumhaft mit einem fast visionären Blick an.
– Ei, ei, Amanda, was siehst du mich mit solchen »großaufgeblühten Augen« an? wie Dandin, der alte feine Novellist, sagen würde.
– »Und er lüftete den Schleier« – es klingt so seltsam, so feierlich ... nein, ich kann es gar nicht sagen, wie ich es meine, wie diese Worte so wunderlich – – –
Sie sank in den Stuhl zurück. Ihr Blick suchte nicht mehr das Weite, er schien sich nach innen zu wenden.
– Du fühlst dich doch nicht unwohl, Kind? fragte der Vater besorgt. – Vielleicht war dir die Hitze zu stark? Willst du dich nicht lieber hinlegen?
– Nein, nein, Vater! Lies nur! Laß den Meister den Schleier lüften!
– »Zu der Zelt, als Brahmadatta in Benares herrschte«, fing der Professor wieder zu lesen an, »wurde der Bodhisatwa – das ist der spätere Buddha – als Sohn eines reichen Kaufmanns wiedergeboren – – –«
Er schwieg plötzlich und lauschte.
Aus der Vorlesung sollte offenbar diesmal nichts werden.