
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Wie «G» ( S. 1) u. d. übr. 12 Initialen
it dem «Wasser als Werkmeister» müßte eine rein fachliche Arbeit, die dem Gedankengang dieses Kapitels folgen wollte, sich vorab beschäftigen. Sie hätte das Wasser ebenso als die über alle Vorstellung riesenhafte Gewalt, wie auch als die wunderbar kunstvolle Kraft zu schildern, durch welche in unberechenbaren Zeiträumen «das Antlitz der Erde» und damit auch unser herrliches Grindelwald geformt worden ist. Welch schwache Epigonen jener Fluten sind die heutigen Gewässer, die uns hier beschäftigen! Gleichwohl können auch diese soviel Macht entfalten, daß wir die Volkssprache bei ihnen gleich mit dem Ausdruck der Furcht einsetzen sehen. Man denke an den Bëësibach 1 und zugleich an zeitweis harmlose Wässerchen, die unter freundlicherem Namen in noch viel schlimmerem Gebaren den Menschen in Schrecken und Staunen, in Schaden und Lebensgefahr setzen können. Gräßliche Verwüstungen stiftete erst noch am 3. August 1906 der Wasserlauf, der in seiner obersten Partie der Abbach, in der mittleren Wannengrăben, in der 34 untersten Schwẹndibach 2 heißt. Er erwahrte zwischen Bachsbort und Anggistalden 3 längst gehegte Befürchtungen, bedrohte neuerdings die Berghalde bei Wägispach, hinterließ furchtbare Ausfressungen bei Zwissenbächen (d. i. zwischen Wăgispach und Wannengraben) bis hinauf zum Fall des Abbach, wirkte verheerend bis hinauf zur Holzmattenalp. Und was geschah, ist nur ein Vorgeschmack dessen, was noch bevorsteht. Überall sind die steilen Böschungen unterfressen, zerspalten, zum Einsturz bereit; überall harren kleinere und größere Felsblöcke des letzten Stoßes, um sich zu ihren Brüdern im Schwendiboden zu gesellen, welche dort, mit dem Faulschieferbrei verbacken, mühsam erobertes Kulturland überdeckten, Landstraße und Eisenbahn mehrere Tage unterbrachen und die Lütschine zurückstauten. 4 Vorsorglich beschloß darum die Einwohnergemeinde am 29. Juni 1907 die vom Bezirksingenieur planierte Abbachverbauung mit Staats- und Bundeshülfe.
Die empörten Wasser wetteiferten an jenem Nachmittage in Wildheit mit dem Mï̦libach, dem Horbach, dem Bärgel. Als breiiger Schlammstrom wälzte sich das Wueggị̆sch (Ueggisch) daher, und es mehrte sich die Zahl der schon vorhandenen Erdschlipfe. Wie mancher Bru̦u̦ch, mancher Ritt, manches Rittli, viele treppenartig abgestufte Rä̆tse̥lli (die Rä̆tse̥lla ist der Anfang eines Erdbruch, der aber mitten im Entstehen si ch umhi ersetzd) entstanden neu. Oder es trat an deren Stelle eine Geröllhalde: eine Rĭ̦se̥ta, wa Steina ahag’rĭ̦se n ṣịin oder nachträglich noch aharịịsen. 5 So üben kleine Ursachen große Wirkungen. Dies geschieht zunächst, wo nicht im Einzugsgebiet eines Wildbachs der Wald einen großen Teil des Regens mittelst Kronen und Stämmen der Bäume auffängt und einen andern im durchlüfteten Wurzelbereich wie in einem Schwamm aufsaugt. Es geschieht ferner oberhalb der Waldgrenze, wo man das zähe und oft undurchdringlich verflochtene Gestrüpp der Legföhren stört, und wo man besonders den buschigen Polstern der Alpenrosen und Beerensträucher, die als Überzug steiler Böschungen wild abstürzende Wasserfluten so trefflich abwehren, den Krieg erklärt. 6 Letzteres tut man teils grundsätzlich, weil die Bärgrosen den Boden versäuern helfen und Futterkräutern den Platz versperren, teils und weit häufiger gedankenlos durch jene kindische Sammelwut und Renommiersucht, womit Vereinsbummler 35 die anlockenden Blüten samt Zweigen sozusagen in Wĕde̥llen (Reisbündeln) oder auch körbchenweise pflücken, um sie dem raschen Verderben anheimzugeben.
Schon der einzelne Tropfen reißt an kahler, steiler Fläche Erde und Sand mit und entzieht damit selbst großen Felsblöcken den nötigen Halt; 7 was vermögen erst deren vereinigte Millionen mit ihrer reißenden, stoßenden und wälzenden Kraft, die mit der Masse in unglaublich anwachsender Proportion steigt! 8
Der historisch Bewanderte denkt hier an Wassergrößen 9 wie die von 1608-11, welche einen Teil des Dorfes Mettenberg vernichtete; 10 von 1629, 11 1755, 1763, 1783, 1794, 1831, 1843, 1869, 1874. Alle fielen, dem Wesen der Wild- und Gletscherbäche gemäß, auf den Hochsommer mit Hitzegraden bis auf 35, wie an jenem 3. August 1906 und waren häufig, wie damals, von Hagelschlag begleitet.
Ruhig, in idyllischem Frieden, führte am besagten Tag das Bä̆renhartsbächli 12 inmitten der wütenden Nachbarn sein spiegelhelles, blaues Wässerchen durch seine kleine Felsspalte der Lütschine zu — welch ein versöhnender Anblick! Er erinnerte an die «Augen» der «lächelnden» Seen des Bödeli; und wieder dachte man an das «Bächlein froh», das «murmelnd» zum Plaudern einzuladen scheint und doch immer «nicht Zeit» dazu hat; zuletzt aber erfüllte die unverwüstliche Reinheit des doch so wehrlos schwachen, gleichsam «zarten» Wässerleins die Seele des Beschauers mit einem Eindruck, dem die fromme Scheu eines alten Persers vor dem geheimnisvollen Element verwandt gewesen sein muß. Beinahe scheint es denn auch, als lebte im Volksgemüt noch etwas von jener Ehrfurcht, die dem Wasser als der unentbehrlichsten aller Himmelsgaben jede menschliche Unreinheit ferne hält und zugleich nur ihm anvertraut, was nirgends auffindbar allem Bereich des Lebenden entzogen werden soll. Dem von einem Mï̦libach und Bärgel weggerissenen Erdreich ghịịd mu̦ oder rị̈ehrd mu̦ allerdings auch jeglichen lästigen Hausabfall nach: das măg er o ch grăd haan! In das saubere Wässerlein jenes Bärenhartsbächli oder Hẹllergräbli dagegen gehört z. B. die Nähnadel für das Häxe npï̦nte̥lli, von welchem an seinem Ort zu reden ist. Ebenso geheimnisvoll klingt die Rede: Wär i n d’s Wasser spï̦wd, spï̦wd dem lieben Gott in d’Oï̆gen. (Damit ist zugleich gesagt: der Speichel, die Spu̦wwe̥lla, soll mit 36 seiner mystisch wie physiologisch anerkannten Heilkraft 13 nicht verunehrt werden.)
Wenn nicht in dieser, so doch in einer andern Art der Geistesrichtung wird einst der Respekt vor der Gabe des Wassers wieder im Kurse steigen, wenn keine Wasserbïelen 14 mehr, keine Wasserwendi (Itramen), kei ns Wasserschalten, keine Zŭ̦be nweid (hinter Bußalp) schon mit dem Namen auf den Reichtum dieses Elementes deuten kann. Wenn einst eine allgemeine Wassernot im entgegengesetzten Sinn zu der eingangs beschriebenen die Menschen zwingt, durch ingeniöse Erfindungen das vom Erdinnern verschluckte 15 Wasser ihm abzuerobern, dann werden sie lehrren mid dem Wasser hụụsen wie mid Nï̦wenburger (Neuenburgerwein). Einen Ausblick in solche Zukunft gewähren Bergwirtschaften, wo man «genug» in einem andern als dem gewöhnlichen Sinn, eben grị̈ị̈se̥lli ch gnueg 16 mues d’s Wasser zuehi ferggen; z. B. auf dem Faulhorn, wo es zum gerade unbeschäftigten Gasthausknecht etwa heißt: gang reich en Hu̦tta volli Wasser, um mit dem bekanntlich recht unausgiebigen Schmelzprodukt des Eises oder Schnees die gewaltigen Kufen nachzufüllen. Wie dann erst, wenn eine allgemeine Trëchchni Namen wie im Dï̦rrenbärg und Dï̦rrenbärgli, Dï̦rrenégg, Dï̦rslĭ̦chchren («Dürslüchern» 1275) 17 hụụffe nswịịs zu mehren Grund hat!
Einstweilen nun speist die lang andauernde Schmelze des in der Regel reichen Gebirgsschnees noch eine schöne Zahl oberflächlicher Stauwässerchen, die den Boden schlï̦pfriga machen und sogar zum friesen (Öffnen von Abzugsgräben) zwingen, und murmelnder Quellen. Manch ein Ort könnte den Namen uf dem Ursprung 18 tragen und dabei freilich auch Reichtum oder Armut an Wasser veranschaulichen, wie deren Stufenleiter sich in den folgenden Bezeichnungen spiegelt. Gar oft muß der Tropf (Tropfen) 19 genügen: we nn’s nu̦mmḁ n gẹng trë̆pfled! Bloß «tröpfflecht» 20 fließt auch der Traan sowohl im direkten als im angewandten Sinn der «Träne», deren ursprüngliche Mehrzahlbedeutung mit Trään und im angewandten Sinn wohl auch durch Oị̈ge nwasser wiedergegeben wird. Wie spärlich fällt erst das Trääne̥lli aus! Doch darf das 37 Trääne̥lli Ggaffee, wie auch das Trë̆pfe̥lli dieses edlen Naß wohl ungestraft im Umsehen zum tolle n Tropf, ja zum Schlï̦̆he̥lli (Schlücklein) anwachsen, da ja selbst die berüchtigten sieben Tassen gegen das Quantumsbedürfnis des «Weinschlauch» («Weinschwelg») im altes «Narrenschiff» ein Nichts bedeuten. 21 Ebenso unmerklich wird aus dem Schlï̦̆he̥lli oder Spru̦tz oder gleichbedeutend: der Ggŭ̦tz ( S. 60); es ist éi n tuen, wä̆ders (welches von beiden — nämlich gesagt werde.) Noch ausgiebiger ist die Zŭ̦ba. Gang reich mer grăd e̥s Glas Wasser an der Zŭ̦ben! befiehlt, wer den Labetrunk in bester Reinheit und Frische gleich von der Brunnenröhre weg haben will. E n Zuba lached, wer von ganzem Herzen und aus vollem Munde lacht; wer letzteres in rasch wiederholten Ansätzen tut, lached e n Tschŏllen. (Zï̦̆blen oder wasse̥ren: urinieren.) — Munter plätschert oder «plaudert» es hier; dort plŏde̥rred es in mächtigem Wall, und unversehens wätschged (quietscht oder gurgelt) der Schuh des allzu neugierig Vorgedrungenen in einer Schweizi: durchnäßten Stelle an wasserzügigem Hang, oder gar in einem Gli̦ngen (einem Glu̦nten, einer Pfütze), wie ein regennasser, schlechter Weg sie bietet.
Der Wortgeichichte gemäß 22 heißt die Quelle auch Brunnen. Nịịd wan Brunnen sollte nach weitverbreiteter Fabel 23 ein Interlakner Kundschafter in «Lauterbrunnen» angetroffen haben, wie sein in Zweilütschinen sich trennender Gefährte in «Grindelwald» nịịd wan Grind 24 old Wald. Daß jedoch «Lauterbrunnen» als der bekannte Ortsname nicht anders zu deuten ist als der lụụter Brunnen zu Ällouinen mit seinem weit und breit hochgeschätzten, spiegelhellen Wasser, ist anderwärts erörtert. Man ging ja ehemals auch «in den Lauterbrunnen» 24a wie «in den Grindelwald». Daneben gibt es genug der trüben Quellen, und nicht wenige sollen ja trueble̥tu̦ sein. Der im gälwen Brunnen an Bachalp enthaltene Schwefel könnte bei leichterem Zugang das Schillingsbad 25 im ehemaligen Schillingsdorf (Burglauenen) ersetzen, welches uns noch z. B. 1682 als «das Bad im Tschingelberg» 26 begegnet. Dasselbe ist längst eingegangen, wie auch der Name uf dem Badrein 27 bloß noch historische Bedeutung hat. Grindelwald besitzt Wannenbäder bloß in Gasthäusern; und die wenigen Gelegenheiten zu Flußbädern werden um so weniger ausgenützt, da dem Älpler, dem Wald- und Feldarbeiter häufig genug der unabgewehrte Schnee und Regen die mehr oder weniger willkommenen Dienste einer Douche 38 leistet. So kommt es, daß nicht einmal das Verbum «baden» sich seines gewöhnlichen Sinnes erfreut. Während im Seeland einer, der sich nicht sofort mit dem ganzen Leib ins Wasser wagt, gehöhnt wird, «är tüej d’Zeejje n tröchne n», băded man in Grindelwald und anderwärts schon, wenn man sich ein Fußbad angedeihen läßt; das Baden des ganzen Leibes aber rückt bereits zum schwimmen vor, und Badhosen nennen sich selbstbewußt Schwimmhŏsi.
Dafür macht aber auch kein Grindelwaldner Modebad «arm am Beutel, krank am Herzen», «und kein gekünstelt Saur beschleunigt unser Grab.» 28 Gedeihlicher sind gewiß die innerlich und äußerlich angewandten «Brunnenkuren» an den Brunnen zweiter Art: dem vor Stall und Haus (nur bei bester Gelegenheit auch ins Bauernhaus) geleiteten und im langen Behälter: Trog ( S. 40) angesammelten Wasserzufluß.
Nicht durchweg läßt sich entscheiden, ob in den folgenden Eigennamen diese letztern oder jene erste Bedeutung zu verstehen sei. Ein «Buri zum Brunnen» kommt 1349 vor. Auf der Haslerseite der großen Scheidegg findet sich die Stelle bi’m chaalten Brunnen, wonach sich ein Alprevier benennt. Eine andere «Alpe, genennet Brünnen», 29 erscheint 1364. Als «Brünnen» figurieren ferner zwei Bru̦nni; 30 ein anderes Heimwesen heißt das Bru̦nnihụụs. Ein hoher Fels am Mettenberg, das Brunnhŏren, gießt in schönen Wasserfällen einige Bäche auf den untern Gletscher hinab. Eine neue Verkleinerungsform stammt aus 1776: «ob dem tschingel in den bründlinen». 31 Als Grundwort steckt «Brunnen» in Trŭ̦ffersbrunnen, 32 Chrachchenbrunnen (Wasserläufchen unterhalb der Nellenbalm), Fŭhrenbrunnen. Von Wassermolchen wimmelt es lustig im Mŏlibrï̦nne̥lli bei der Flị̈elenegg am Mettenberg.
Der Fŭ̦hrenbrunnen ist ein Zeitbrunnen. Där geid all Winter e n Schutz ab (steht eine Zeitlang ab), um gegen Mitte März umhiz’choon. Regelmäßig fließen allsommerlich die Meibrunnen bloß vom Mai an bis gegen Ende August. So der Heidenbrunnen beim untern Gletscher; so im Lauterbrunnental der Schmadribrunnen, der Rosenbach, der Trümmelbach, der Gras- oder Krautbrunnen; so auf Engstlenalp der «Wunderbrunnen», welcher wie äxtra dem Vieh zu liebe im Sommer alle Tage von etwa vier Uhr abends bis acht Uhr morgens (den beiden Melkzeiten) loifd. 33 Hungerbrunnen endlich 39 stehen mit ihrem periodischen Fließen und Stocken in augenfälliger Verbindung mit Trockenheit und Mißwachs. Des zeitweiligen abgaan (Abstehens) ist man gewohnt bei dem danach benannten Abbach. Alle daherigen Berechnungen dagegen täuscht der Nährling der Doldislouinen: der Lụ̆gibach. Am Winter gar nicht fließend, versagt er oft zu unerwarteter Zeit auch im Sommer, um hinwieder, wie über Nacht, zum starken Bache zu werden.
Meist aber «sind die Felsen anzusehen wie steinige, unverweßliche Brunnen-Stöck, die immerdar und zu allen Zeiten munter Wasser ausschenken». 34 Dasselbe mundet freilich verschieden. Erdige Minerallösungen besonders der Moränen würzen es samt dem darin getränkten Brot zum epikuräischen Mahle, 35 indes die Granit- und Gneißalpen fades, schlëëds Rieselwasser spenden; dasselbe eignet sich dagegen wegen seiner Reinheit und Weichheit vorzüglich für die Küche. Die Bewohner der ụụßendị̈ị̈r chigen Ort (peripherisch gelegenen Gemeindeteile), denen das Reservoir auf Duft und das Hydrantensystem des Dorfbezirks nicht zugute kommen können, sind indes zufrieden, wenn ihnen für eine neuerdings erforderte Brunne nlleiti der Wasserschmeck eine nur irgendwie benutzbare und nicht allzu entfernte Quelle entdeckt. In der Wissenschaft dieses Quellenforschers finden sich uralte Mystik und neue Physiologie 36 in merkwürdiger Weise zusammen. Sein Hauptinstrument ist die Wasserschmeckrueta oder Glï̦cksrueta aus der vorlängst als wunderbar erkannten Wi̦i̦ßhăslen; der gläserne Behälter am dünnern Ende birgt (angeblich oder noch besser wirklich) Chä̆chsilber. Beim intensiv magnetisch Veranlagten gehört zur Hasel in der einen noch e n silbrigi Sackuhr auf der andern Hand. Diese Uhr wird sich über der verheißungsvollen Stelle um sich selbst herumdrehen. Ist das Orakel erteilt, so gilt es nun, und zwar im ụụfgäände n Maan, den Brunnen ụụfz’fassen, d’Brunnstuba z’machen. Wo nicht der hohe Holzpreis zu eisernen Röhren rät, liefert der Dịịhelbohrer hölzerne Dịịchla, mittelst deren d’s Wasser zuehi g’leid (gelegt) wird. Der meist sehr unebene und felsige Boden mit wenig Erde macht es erklärlich, daß man bei dieser anstrengenden Arbeit das Ziehen des Leitgrabens bis zum Brunnenplatz «hinzu» und das sorgfältig geschlossene «Einlegen» der Deichel: also das zuehilĕgen (nicht etwa hinzuleiten) 37 hervorhebt. Natürlich hat man den Brunnen gerne möglichst nah bei Haus und Stall; und auch unser einsames Brünnelchen, 40 nach welchen Kinder scheuern gehn, gehörte einst zum geschliffenen Stählisboden-Scheuerchen. Zur Staffage der Alp dagegen gehört, wie eins der Arvenbilder unter « Wald» zu sehen gibt, auch der Tränkebrunnen uf der Wịịti.

Einsames Brünnelchen.
Für den Brunne nstock, dessen Haupttugend ja doch eine möglichst reiche Wasserspende ist, gibt sich erst recht 38 der bäuerliche Oberländer nicht die Mühe, mit der sich die kunstsinnige Bundesstadt zur «Brunnenstadt» herausputzt. Mit Vergnügen sieht er es dagegen, wenn die Natur im «Brunnenstock» der Sustengruppe 39 gleichsam oder (wie zu Oberhofen) im neu ergrünenden Pappelstock wirklich einen schönern Ersatz seiner Arbeit herstellt. Ebenso besteht der Trog, Brunne ntrog in der Regel einfach aus einem großen, langen Fichtenstamm, in welchen die größere vordere Abteilung und das kleinere Sŭ̦deltrï̦̆gli einfach eingemeißelt werden. Auch so gilt er als Hauptbestandteil des Brunnens. Anhi ze’m Troog eilt ein Dutzendmal im Tag die geschäftige Hausfrau, der im Stall tätige Sohn, legt die schmucklose Staagla (Astgabel, die «Brunne ngri̦ppele n» des Emmentals) oder das eigens gefertigte Chrị̈ị̈z unter den Röhrenauslauf: die Zu̦ba und stelld under (nämlich das Wassergefäß). Auf der Alp sieht man in toter Zeit die Tröge umgestürzt: umg’wë̆lpd oder d’s under ụụf daar’taan. Ohne solche Vorsicht würden die so mühsam zur Stelle geschafften Riesenmöbel durch Schneeschmelze und Frost bald ruiniert.
Gerade die künstlerische Anspruchslosigkeit des Älplerbrunnens oder auch des kleinen, hausfernen Brï̦̆ne̥lli trägt vieles zum Reiz einer sonst vielleicht einförmigen Landschaft bei.
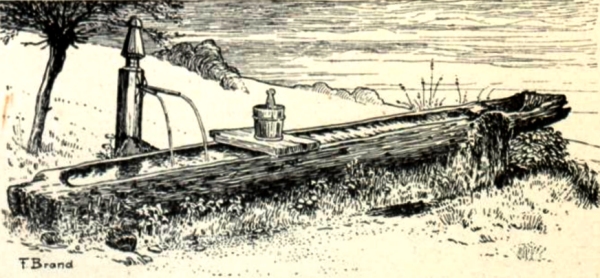
Im Graben.
Die prächtig geschwungene Parabel des Auslaufs aber stellt uns im kleinsten einen der Wasserfälle des Alpenlandes vor. Welch eigenartiges, sozusagen persönliches Leben in diesen Fallbächen! (Vgl. bereits S. 15.) Wir dürfen hier nicht verweilen bei dem feinen und zarten Schleierfall des Staubbachs mit seiner zu eigentlichem Studieren auffordernden Anlage; 40 41 nicht bei dem die Sinne so unsagbar übernehmenden Donnern und Tosen der Handeck; 41 nicht bei den malerischen Stufenfällen des Gießbachs 42 und Reichenbachs; nicht bei dem korkzieherartig in die Malmwand sich einschneidenden Trümmelbach, 43 noch bei der großartigen Wassersinfonie des Kientals, 44 dessen Tschingelfälle ihresgleichen in der Schweiz nicht haben. 45 Auch würde ihre Beschreibung erst recht die Bescheidenheit der Wasserstürze Grindelwald hervorstellen. Die Namen der letztern lauten zum Teil demgemäß. So ist der Jumpfre nspru̦tz ein humoristisch herabgesetzter Miniaturfall zwischen Schwendi und Burglauenen. Ein anderer Fall heißt der Schụụr (Regenschauer). Der Gießen erinnert an den «Hị̈enderggu̦tz» ( S. 60). Raaslochtiger stürzt, wie die Verheerungen in der Tschingelei im Jahr 1874 überflüssig bewiesen, der Fallbach 46 aus beträchtlicher Höhe. In recht schönem Bogen wälzt sich während der Schneeschmelze der Mï̦libachfall 47 in mäßigere Tiefe. Wie wenig jedoch sonst die Wassermasse alleinig ’s e̥s machd, wie vielmehr auch hier wie auf menschlichen Gebieten große Tätigkeitsentfaltung mit kleinen Mitteln am anziehendsten zum Gemüte spricht, beweisen die geradezu reizvollen kleinen Fällchen des Lütschentals im Mai und Juni. Sie erinnern mit den einzelnen feinen Silberäderchen, in welche sich das spärliche Wasser immer wieder in unerschöpflich mannigfaltigen Gruppierungen zerteilt, an das unbeschreiblich liebliche Kleinwerk des Beatenbachs an der Merligenstraße. Auch den 42 schlichten Mann des Volkes spricht am ehesten das an, was ihn an sein eigenes intelligentes Tun erinnert. Einem Grafen von Planta, der den Staubbach in seiner mächtigsten Sturzmasse des Vorsommers anstaunte, klopfte ein treuherziges Lauterbrunnermännchen auf die Schulter: Ich weiß Ihnen noch etwas viel Schüneres! Er führte ihn vor den eben fertig gewordenen Springbrunnen im Lauterbrunner-Pfarrgarten, der seinen Strahl einen Meter hoch steigen ließ und rief triumphierend: Achtid, Heer! Där dert g’hịjd nu̦mmḁn ahi, und ahig’hịjen chan am End d’s Lied’s alls. Aber däär da g’hịjd uehi un d ist doch nu̦mmḁ n toods Wasser! 48 — Immer ist indessen auch solches ahig’hịjen ein rechtes Schauspiel für das Auge, sonderlich wo es in schönem Schwunge des perlenden Elements zum ụsig’hịjen aus der verborgenen Wiege der Flußgötter 49 sich gestaltet. Besonders überraschend zeigt sich dieses plötzliche und im Frühling auch mächtige Herausfallen aus der Felswand ohne irgendwelche auffindbare Herkunft am Bär gbach 50 Burglauenens.
Nicht imposant, wohl aber anmutig, schickt der sprudelnde Quell der Niederung, schickt der Gletscherbach sich an, aus seiner Verborgenheit hervorzutreten: ụụsz’choon. In stolzer, jugendlicher Selbständigkeit alsdann schlägt das Wässerchen seinen Weg ein: sein Rinnsal, seine Runse, seinen Bachru̦u̦s, seine « royse», sein Rụ̈ụ̈schli (Biel), seine Rütscha (zimbrisch). Die «Rüsch», 51 die «Rüse» 52 oder die «Rụ̈ụ̈ß» (Reuß) der heutigen Aussprache gehört eben dahin. (Vgl. «der Rin des waßers» 53 1497.) Vom Tödi zieht sich die «Schneerose» herunter, vom Roosenhŏren 54 die Rosenegg und die Rose nloui mit deren heute so reizvoller Umgebung am Nordwestfuß des Wetterhorns. Das Hasli hat auch seinen Ru̦u̦s als Ortschaft, wie Grindelwald sein 1363 verzeichnetes «gut ze Rusach» 55 seinen Rụụs, das Rụụsbë̆de̥lli und das Rụụsbächli. ( «Ru̦u̦s» und «Rụụs» wechseln wie «Lu̦u̦s» und «Lụụs»; vgl. «Ịịsch».) — In lustig tanzenden Wellen, in hundertgestaltigen Wirbeln prallt der Flußlauf — er stichd an — gegen Blöcke, Klippen, Sand und Kiesbänke. Zumal die Lütschine gruppiert in ihrem Oberlauf solche Hindernisse zu bisweilen hübschen, kleinen Inselchen, in älterer Sprache Ise̥ltinen. In noch kleinerm Maße tun dies ihre Seitenbäche des Faulhorngehänges; nur erinnern hier solche Gebilde allzusehr an das anfangs geschilderte ịị nschrịịßen (Unterfressen der 43 Ufer), zwägbrächen und uberghịjen solcher Bergbäche, wie zumal des Bärgel, dieses nịịdraatsen oder nịịdraatsigen (nichtsnutzigen) 56 Pịịrstels par excellence. — Eine besondere Erscheinungsform zeigen die Găde nllï̦chcher: Spalten, gebildet durch so starkes Zerreißen und Verwerfen von Gebirgsmassen, daß man oft in der einen Felswand die Vertiefung sieht, in welcher der Höcker der andern Wand steckte.
Nicht wenig beteiligt sich die Mundart an der uralten Geltung von Wasserzügen als Grenzlinien. Schon die «First, wo das Schneewasser abrinnt», die Kammlinie der «Schneeschmelze» als Wasserscheide gibt auch eine naheliegende Eigentumsgrenze ab. Hieran erinnert die Wasserwendi. Am Eiger figuriert bereits 1252 der Marbach eben als Marchbach. 57 Gar manches Gut, auch mancher Güterkomplex, liegt «zwischen den Bächen» des und des Namens, der im nachbarlichen Verkehr keiner Erwähnung bedarf. Das gut mundartliche zwisse’n Bächen (vgl. «i’ n Mëëse̥rren» = in den Mösern u. dgl.) bedeutet eine Örtlichkeit über Wagispach ( S. 34). Ferner gibt es auf dem Oberläger Scheidegg ein langes Quertal, welches noch 1787 als «Zwischbächtal» 58 erscheint, in heutiger Dekomposition aber (vgl. S. 34) z’Wĭ̦schbääch geheißen wird. D’Chï̦eh sị n z’Wischbääch; i ch mues ga n Wischbääch inhi. Ein solches z’Wischbääch liegt auch im Bachläger. Das klösterliche Urkundenlatein übersetzte die Bezeichnung mit « inter amnes». Die Mundart legte sich dies zunächst zurecht als «Intramen» (1682, 1787), «hinder Indram» (1668) 59 und unter Umdeutung des später zu besprechenden «hinder»: «in der Intramen» (1671), alles mit echt deutscher Betonung der ersten Silbe. Später fällt das n aus; man schreibt und spricht «an ytrammen», «der Berg Itram» (1808), «der Gebirgsstoß Itram.» 60 Man verstund darunter zunächst das Revier, welches heute tautologisch als Ịtrame n zwisse’n Gräbnen, d. i. als die zwischen Wärgistalbach und Mählboïmgrăben gelegene Osthälfte der gesamten Bergschaft Itramen an Nordabhang und Fuß des Männlichen und Tschuggen benannt wird.
Nicht jede Bergschaft wird so augenfällig und namensgemäß durch Marchbäche abgegrenzt. Am wenigsten ist dies hinder Scheitegg der 44 Fall. Hier stellt auch bloß der Spịịherbach, der den Reichenbach nährt, einen bedeutendern Wasserzug des Oberlägers dar. Dieses gemahnt im übrigen da und dort an die so verhängnisvoll entwaldete Grindelalp. Die Gräben derselben mit ihren verrutschten Einhängen reden von der nagenden Tätigkeit des Wassers in dem weichen Schiefergestein, das so leicht verwittert, abrutscht und massenhaftes Geschiebe liefert. Wasserreich ist dagegen das Oberläger der Bachalp. Uf Baach treffen wir denn auch 1372 einen «Ulrich zem Bache, genannt der Lango». Heute alpen dort die Baacher, und zwar im Hochsommer im Bachlä̆ger als der obersten Stafel. Ein Komplex von kleinen Vorsaßlinen ist Nĭ̦derbaach.
Gegenüber den prosaisch klingenden Namen der Wuer, am Wuer, 61 das Wuerli tragen einige der hier im Vogelflug überschauten fließenden Gewässerchen Bezeichnungen, welche die Phantasie anregen. An den Ällouinenbach erinnern der Wätterloui- und der Gu̦tzbach, beide von der Wätterlouinen und dem Hị̈enderggu̦tz am Wetterhorn gespiesen. An den Bärgelbach oder Bärgel (vgl. «Walther von Bergeln») 1302 und «Chuonrat ze Bergeln» (1345) klingt der Bär gbach an (vgl. «Bä̆r gbluest» svw. Alpenrose). Den Reichtum dieses Gewässers im März und April und seinen Rückgang im Mai kennzeichnet die Rede: Was der Merzen inhitued, tued der Meien e̥m ụsi. Wasserstürze wie er bilden der Fall-, der Zuben-, der Abbach. Der Geidelbach verzettelt sein Wasser gleichsam wie in übermütigem Knabenspiel: er tued’s ḁ lsó vergeide̥llen (oder versï̦wwen). An einem dem Gguntel ( S. 180) ähnlichen Feldstück fließt der Gu̦ntelbach vorbei; ähnlich erklären sich der Geere nweid-, Pfannen-, Wannen-, Chellenbach. Keiner Erläuterung bedürfen Namen wie Wärgistal, Bueßalp-, Schwendi-, Mĭ̦li-, Spị̈ị̈herbach u. a.; bloß zu den beiden Schuelbächlinen ist zu bemerken, daß an ihnen die vormaligen Schulhäuser von Itramen und Bußalp lagen. Historische und sagenhafte Erinnerungen erwecken ebenso der Wartenbärggrăben, das Martibächli, das Bärenhartsbächli oder -grä̆bli, auch Hẹllerbächli oder -gräbli geheißen. Ein an ihm gelegenes Wiesenstück sei nach einer Pestzeit um einen «Heller» verkauft worden; ein anderes, um eine Tasse Kaffee erworbenes Stück habe dem nämlichen Bächlein zum Namen Ggaffeegrä̆bli verholfen. Diese Sage erinnert an die angeblich ähnlich verhandelte Angstermatta, ein schönes Gut zu Itramen, und an den um ein «Fürter n» (Vortuch, Schürze) verkauften, weil durch den schwarzen Tod verödeten Hof Fürten zu Sumiswald. 62 Im 45 Schwị̆ck (in aller Eile) fließt das Schwi̦ckbächli einher. Lụụterbach heißen Zuflüsse der schwarzen und der weißen Lütschine. Hell wie den «lautern», liebt man auch einen Wäschbach wie den an Grindel. Wie der Bärgel färben der Schwarzenbach und das Schwarzbächli mit ihrem Tonschiefergehalt die Schwarzlï̦tschina (vom obern Gletscher bis Mettenberg) und durch sie die schwarz Lï̦tschina (bis Zweilütschinen 63 ) im Vorsommer kohlschwarz. Die «weiße Lütschine» ist, wie der Wịịßbach am Wetterhorn, zunächst nur im Gegensatze zu «schwarz» benannt, etwa wie man von «weißem Wein» im Gegensatze zum «schwarzen» ( vino nero) oder «roten» spricht, oder wie man Weiß- und Schwarzbrot unterscheidet. Eine positive Bezeichnung weißer Farbe liegt dagegen in der des Milchbachs, nach welchem das Chalet Milchbach unter dem durch Leitern überbrückten Milchbachlooch benannt ist. Immerhin kann auch jenes «weiß» insofern absolut gedeutet werden, als beide Gletscherabflüsse aus den Gletscherunterlagen und Gurgellöchern Steinstaub entführen, der sie zu gewissen Zeiten prächtig weißgrün färbt. Nach mitgeführtem Ton nennt sich der Rootbach, gleichwie der Lehm die Zusammensetzungen mit älw, Äl w, Äll in Ällflueh, Ällouinen, Oberäll veranlaßte. Sand führt in auffälliger Menge der Sampach (1275: Sambach); Tuff setzt der Tuffbach ab. Die in der Nähe des «Moos» gelegene sumpfige, zum Teil nun entwässerte Fläche (in alter Sprache das horaw, horo, hor, 64 wonach auch Horw, Horben, Horgen sich benennen) entläßt den Horbach. 65 Die an ihm gelegene Örtlichkeit erscheint seit 1275 sehr häufig urkundlich. Auch die Lï̦tschina selber scheint, wie im Siedlungskapitel näher dargelegt wird, nach ähnlichen Motiv benannt zu sein. Ort und Art ihrer ehemaligen Mündung — wo und wie sie ụụsg’lï̦̆ffen oder ịị ng’lï̦̆ffen ist — rechtfertigt diese Vermutung vollauf. Hat doch die Lütschine, nachdem sie dem Lombach des Habkerngebietes durch Aufhäufung eines Schuttkegels den vormals éinen See zwischen Meiringen und Uttigen in die beiden jetzigen scheiden geholfen, das derart geschaffene Bödeli zeitweilig gänzlich unter Wasser gesetzt. Regellos ergoß sie sich noch 1760 66 in beide Seen, bis eine kunstgerechte Regulierung die Lütschine in den Brienzersee, den Lombach in den Thunersee leitete. Das gegenseitige Ausweichen der beiden vor neuer Begegnung bietet von der Schynigen Platte aus einen Anblick, dessen Eindruck noch durch zwei auf kleinem Raum sich abspielende Gegensätze vergrößert wird. Der eine besteht in der Raschheit der zeitweilig stark getrübten Flußeinläufe und der Ruhe der sie aufnehmenden 46 Seespiegel; der andere in den Gegenläufen der scheinbar heftig aufwärtsstürmenden Lütschine und der gemächlich sich zur Abwärtsbewegung anschickenden Aare. Diesen Gegensätzen auf schmalem Raum stellt der Geschichtskundige einen solchen in der langen Zeit entgegen. Welchen Garten, von fleißigen Händen bebaut, stellt heute das Bödeli dar — wie traurig sah es in jener Verwilderung aus, bis die Herren von Weißenburg und Unterseen, sowie angeblich die Klosterleute von Interlaken eine allmähliche Regelung anbahnten! 67
An wirkungsvollen Gegensätzen zwischen lauten und stillen Wassern ist Grindelwald auch innerhalb seiner Grenzen nicht arm. Es hat seine ungestümen Bäche und deren raaßlochten Sammelfluß, welche bei jeglicher Enge ihren Gischt unter Schäumen, Brausen, Tosen, Toben an die erlenbestandenen Ufer werfen, in Stromschnellen zornig die Hindernisse der Querriegel nehmen, im sommerlichen Föhnsturm ihre milchig trüben Fluten daherwälzen und schäumende Wellen empört an mitgewälzten ofengroßen Schëpfen sich brechen lassen. Aber es hat auch seinen unbeschreibbar lieblichen Bachsee. Welchen Eindruck er selbst auf die Einheimischen macht, beweist die Sage, wonach er als unterirdischer Abfluß unter den örtlichen Ausläufern des Rötihorns hindurch den Tuffbach entlassen soll: diesen hübschen und muntern, im blendend weißen Schaum seines eiligen Laufes so reizenden Quellbach. In Wahrheit hat der See am Mühlebach einen offensichtlichen und zwar reichen Abfluß; und diesem halten eine Menge Quellen und kleiner Schmelzbäche die lebhaft züngelnde Waage. Das erhält dem Wasserspiegel eine Klarheit, welche von der gewöhnlichen düstern Färbung der Alpseen aufs anmutigste absticht. Wie in diesem Schwarzblau die gegenüber blinkenden Schneehäupter von Wetterhorn bis Eiger sich spiegeln! Und dies Leben am Ufergelände! In seinen Untiefen badet sich am heißen Tage das Alpvieh die Füße, zum belustigenden Anblick des Faulhornwanderers. Wie vermißt der das einstige Ruderschiffchen, auf dem sich eine halbtägige «Sommerfrische» beschaffen ließe! Dies wäre heute um so eher möglich, da der See für die Bedürfnisse des Grindelwaldner Elektrizitätswerkes eine wesentliche Vergrößerung und durch eine Stauwehr eine Vertiefung bis auf zwölf Meter erfahren hat. Es ist dies eine Verkehrseinrichtung, welche einmal die Natur nicht verhunzt, sondern ihr nachgeholfen hat. Grindelwald hat keinen Staubbach, aber es hat einen Bachsee.

Der Hagelsee am 1. August 1906.
Welch ein Gegensatz zu seiner heitern Anmut die zwei «unheimlichen» Miniaturseelein des weltabgeschiedenen Reviers zwischen Faulhorn und 48 Gießbach! Was zwar vom ganzjährigen Bedecktsein beider Seewlinen mit schwimmenden Eißmassen erzählt wird, widerlegte sich z. B. am 14. August 1905 durch das klare Stahlblau des Hagelsees. (Vergleiche dagegen unser Bild von 1906; wie würde erst ein solches vom 1. Aurgust 1907 aussehen!) Prächtig spiegelte sich damals in diesem dunklen Auge das senkrechte, zackige Felsgestell des Widderfeldgrates. Dagegen teilt das Häxe nseewli den düstern alpinen Charakter des Wildseewli am Schwarzhorn, des Burgseewli auf Bußalp, des graaue n Seewli auf Mürren, während hinwieder der Sägistalsee sich dem reizenden Oberhornseewli am obern Steinberg vergleicht. Zu den Seewwen zählen sich auch noch Wässerchen wie das auf dem Seelihü̦̆bel zwischen Männlichen und Alpiglen, während ähnliche Stellen auf der großen Scheidegg und am Fuß des obern Gletschers, wo ebenfalls Schmelz- und Sickerwasser si ch seewwen (sich stauen), sich mit den Namen Wịjer begnügen. Auch an diesem kann ja die Vorstellung des außerordentlich Anmutigen haften. Man denke an den Chŏlwịjer zwischen Hertenbühl und Waldspitz, aus dessen tatsächlich kohlschwarzem Tonschieferwasser die hohen Tannen der Umrandung, aber auch selbst die Spitze des Eiger äußerst wirkungsvoll herausschauen.
Verächtlich klingen erst Bezeichnungen wie das sol (Sumpf; vgl. Sulalp und Sulegg, Suldtal), wie der Glu̦nten (unterbernisch: die Gglungge n, d. i. Pfütze). — Der groß Glu̦nten ist eine beliebte Litotes für den Atlantschen Ozean. Umgekehrt aber kann schon e̥s Glu̦nte̥lli eine sehr beträchtliche Masse bezeichnen. Eine Grindelwaldner Sentenz lautet: We nn mu̦ nid hụụsed, su̦ mag mu̦ den grëësten Glu̦nten ụụsg’schëpfen, und das Ende der Ökonomie ist ein nie völlig erledigtes Glu̦nte̥lli Schulden.
Das «Meer» mit dem heute übernehmenden Eindruck seines Wortklanges bedeutete aber ursprünglich — wie schon das verwandte «Moor» lehrt — wirklich nichts anderes als «Glunten»; 68 und der ähnliche Ursinn von «See», s. v. w. Sumpfgelände klingt nach im tirolischen sea für Sumpf. 69 Und tatsächlich sind viele unserer Hochseen, statt deren Untiefen die Phantasie sich so gerne geheimnisvolle Urtiefen erträumt, ganz seichte Wasserschalen mit zerklüftetem Felsengrunde, eben groß genug als Spülbecken und Läuterungskessel der Bergbäche. 70 Eine andere vollstümliche Vorstellung läßt die Seen ganze Berge durchgraben und an deren Fuß plötzlich Flüsse entlassen. 71 Wie der Bachsee den Tuffbach diesseits des Rötihorns der Lütschine entgegengesandt ( S. 46), so hätte auch das Hŏhnịịsch, dieser sonderbar anmutende Hängegletscher über 49 Wärgistal, vom Kallifirn her den Eiger durchwachsen. Es ist der oberflächliche Quellenreichtum der Kalk- und Tonschieferalpen, der einen unermeßlichen Wasservorrat in der Tiefe vortäuscht und solch ungeheuerlichen Vorstellungen Raum gibt. Ihre scheinbar anschauliche Bestätigung aber bieten Seen, deren stark zerklüfteter Kalkboden das Wasser in schwachen Wirbeln einschluckt, die dadurch gebildeten Trichter in unterirdischen Spalten und Kanälen sich fortsetzen und oft in großer Entfernung wieder zutage treten läßt. 72 Ein solcher See ohne sichtbaren Abfluß heißt «Faulensee», und eine Häusergruppe Fụle nsee 73 gibt es unterhalb der Schonegg. Fehlt zudem noch der sichtbare Zufluß, so redet der Volksmund von einem toote n See und gestaltet sich solchen noch unheimlicher durch die Umdeutung auf einen Toote nsee, 74 als das nasse Grab verunglückter Berggänger.
Ein solcher «Totensee» gehört immer noch dem Hasli an; der Grindelwaldner Faulensee dagegen existiert heute bloß dem Namen nach. Das nämliche ist der Fall bei den Häusernamen bi’m See, bi’r Seeblatten, bi’m Seegăden, im Seebŏden zu Burglauenen. 75 Vgl. das Gut «zem Sewe» 1354, 76 NN. «am See» 1670. Ein wirklicher See wurde dort gebildet durch den Absturz der Bußalpburg, welcher Schillingsdorf verheerte und die Lütschine staute. Er hat bestanden, bis sich das Wasser durch den Trümmerhaufen einen Abzugskanal ausfraß und dem Gefälle beim Stalden zueilte.
Eine dunkle Andeutung von einem einstigen See gibt auch der Name z’Amtsseewwen am Wetterhorn.
Den Burglauenensee ersetzt nun eine ausgedehnte tafelebene, frischgrüne Wiesenfläche. Nicht so vorteilhaft tritt an die Stelle unzähliger Nischenseen des zerrissenen Berggeländes das saure Riedgras und der Făx, unterbrochen durch Steingeröll und durch Pfützen, auf denen etwa die Brunne nsịịda und der « Crocus Martis» 77 gedeihen. Nach letzterem ist der root Brunnen in der Tiefe eines kleinen Teiches auf der obersten Höhe der großen Scheidegg benannt. Er erinnert an die roten Algen, welche zeitweilig das «Burgunderblut» des Murtensees erzeugen.
Dem Schicksal solcher ausgetrockneten Seen werden einmal auch die lieblichen «Augen des Oberlandes», der Thuner- und Brienzersee, erliegen. Einstweilen aber erfreuen diese kurzweg so geheißenen Seewwa auch den Grindelwaldner, wenn er auf einem der staatlichen Tämpfer ihr g’grị̈be̥lleds (sich kräuselndes) Wasser durchschneidet. Dann erinnert 50 er sich wohl der Zeit, da die Großeltern bis Neuhaus pilgerten, um allenfalls auf schwankem Kahne — dem Wasserschlitten — Thun zu erreichen. Das mochte ihnen wohl bei stürmischem See gelegentlich so vorkommen, als würden sie mit dem Gweren Enti 78 uber d’s Wältmeer weidligen.
1
Gut mundartlich hieße er «der bees Bach». Allein es ist hier die bei «Simelihorn» (
S. 6) besprochene halbe Verschriftdeutschung sogar in die Mundart vorgedrungen. Eine ähnliche Erscheinung zeigt z. B. «Zinal» statt
tschenal ans
canalis. (Jegerlehner «Eivisch».
2
CD 2.
3
CD 1.
4
Vgl.
Str. im
EvG. 1906, 63.
5
Rîsen, hier svw. «fallen» (vgl. die
loubrise Laubfall, Laubfallzeit, Herbst, Oktober) kann auch unser «steigen» bedeuten (vgl. Reis und Guttannerisches «errisen» (ĭ̦: sichtbar gekeimt, aufgegangen, «errunne»), gleich wie altes «steigen» eine Auf- und Abwärtsbewegung in sich schließt. Die
oi-Stufe «reisen» gehört hiezu als 1. bereit stellen und 2. sich selbst (zu einer «Reise») anschicken.
6
Neum. 474.
7
Wass. 2.
8
Die lebendige Kraft wächst bei Erhöhung des Wasserstandes von ¼ zu ½ m Höhe um fast das Zehnfache, von ¼ zu 1 m um das 75fache, von ¼ zu 2 m um das 427fache. (An Hand von
Wass. 9.)
9
Vgl.
Osenbr. 6, 74-77.
10
GlM. 19.
11
Blätter 2, 231.
12
G 2. 3.
13
Vgl. Ev. Joh. 9, 6.
14
F 3.
15
Berd. 2, 54 f.
Neum. 88.
16
Wobei nicht das Vollmaß des Vorrats, sondern das der Mühsal «erreicht» wird; vgl. lat.
nanciscor (
Kluge 135).
17
Font. 3. 145.
18
A 2. Vgl. den «Ursprung» bei Spiez u. anderwärts.
19
Wie «das Trouf» und «die Traufe», sind auch «Tropf» und «Tropfen» ursprünglich gleichbedeutende Schwesterformen. Doch braucht schon das Ahd. «Tropf» nur in der Redendsart
ni drof (ganz und gar nichts oder nicht:
Graff. 5, 29). Im Unterbernischen wie Schriftdeutschen unterscheidet sich vom Tropfen (
gutta) der Tropf als bedauernswerter Mensch.
20
Rebm. 89.
21
Slûch und
slûchen (
mhd. WB. 2, 2, 415), schli-n-gen, Schluck und schlucken, schluchzen sind Stufen einer Stammauslautsteigerung mit unvollständiger Differenzierung.
22
Lf. 44-47.
23
BOB. 2.
24
S. 9.
24a
Ch. 1674.
25
ÄFG. XXXIX.
26
Ch. 1682.
27
B 1/2.
28
Haller, ungeschickt nachgeahmt von
Kyburtz A 28.
29
Font. 8, 600.
30
D 3; G 2.
31
In den Mund mehrerer, selbst älterer Grindelwaldner paßt auch diese, wie gelegentlich andere Rundungen, oft sogar in überfliegender Analogie; vgl. z. B. «Fürst» statt «First».
32
F 3.
33
Meisner AR. 1812, 79 f.;
Wyß 421;
Rebm. 104 f.;
Grun. 1, 17 ff.; 3, 18-5;
Stumpf 218
b;
SAC. 19, 430; Stumpfs Karte;
Tschudi 218.
34
Kyburtz A 7.
35
Cool. JS. 204 nach Gesners Pilatusreise.
36
Vgl. Prof. Albert Heim im
Berd. 4, 255-262.
37
Man müßte in diesem Fall ja auch «zuehi’gleited» statt «zuehig’leid» sagen.
38
Vgl.
Lf. 44.
39
Stud. T. 82. 88.
40
Baltz. 1, 80; Meisner AR. 1811, 109; 1819, 333;
JG. Jacob 2, 124;
König 21;
Wyß 481-500;
Grun. 1, 104 f.
41
Prächtig geschildert von
Wyß (796);
Baltz. 1, 150.
42
Baltz. 1, 130;
Wyß in AR. 1811, 28. Über Lehrer Kehrli:
Faulh. 25 ff.
43
Baltz. 1, 80.
44
Ebd. 89.
45
Ebd. 84. 88f.
46
B 1. 2.
47
G 1.
48
Nach
König 22 f.
49
Wyß 20.
50
A 1. 2.
51
Rebm. 483.
52
Habsb. 1, 201.
53
Strettl. 183.
54
In Meiringen schreibt man den Namen Rosenhorn der Wirkung des Alpenglühens zu — mit gleich gutem volkethymologischem Recht, wie die Monte Rosa-Gruppe ihren schönen Namen trägt.
55
Font. 8, 536.
56
«Rat» im Sinn der Zusanmensetzung «Hausrat», «Vorrat» u. dgl. bildete (in der Genitivform) zunächst mit «nichts» die Wortgruppe «niid Raats» in einem Satze wie: er gewährt «nichts» des (von ihm erwarteten Succurses oder) Rats. (Vgl. i wott nüüt «des Züügs».) Auch diese Wortgruppe half die Großzahl der Adverbien bilden, die nach und nach in die adjektivische Fügung hineingezogen wurden.
57
Font. 2, 352; vgl.
Habsb. 1, 192.
58
Höpfn. M. 13.
59
Ch. 1668
23/
10.
60
GlM. 168;
Alpina 3, 201. 223.
61
G 2.
62
Richtige Deutung als Mehrzahl von «Furt»:
Lf. 51.
63
Die Verwechslung beider provozierte «Berichtigungen» wie z. B. in
Habsb. 1, 480, Anm. 1.
64
Graff. 4, 1000;
mhd. WB. 1, 710.
65
H 2. 3.
66
Grun. 1, 98, 125.
67
Blösch L. 8.
68
Vgl.
Kluge 252.
69
Lus. 73.
70
Tschudi 12, 22. 208. 211;
Brückn. 340.
71
Cool. JS. 258 f.
72
Tschudi 211.
73
G 2.
74
Bähler 27;
AR. 1813, 103.
75
B 1.
76
Font. 8, 62.
77
Wyss 695 nach Scheuchzers Naturgeschichte 1, 312 ff.
78
Gw. Rs. 1.
Die zwei Lütschinen, die in Zweilütschinen sich nach eiligem Laufe vereinigen, taten dies nach beliebter Volksüberlieferung einst ebendort in gefrornem Zustand: die Flüsse waren Eisströme, ihre Wellen «eherne Fluten». 1 Gefroren sind heute bloß noch die stark reduzierten Anfangsstücke beider Flüsse: der ober und der under Gletscher von Grindelwald; und diese fließen ebenfalls ganz nach der Art des Flusses. Nur das Tempo ist ein anderes: der Gletscher kommt acht bis zehn millionenmal langsamer vorwärts als das Wasser. Seine sehr ungleichen Geschwindigkeiten kommen in einem Durchschnitt zusammen, welcher etwa dem Lauf der Stundenzeigerspitze einer gewöhnlichen Taschenuhr entspricht. 2 Die Bewegung ist also unmerklich: d’Gletschra wăxe n wie d’s Chrụụd. Der untere Gletscher bedarf demnach zu seiner Gesamterneuerung etwa zwanzig Jahre. 3 Dieses langsame Fließen, d. i. gegenseitige Verschieben der Einzelteile, läßt um so mehr das andere Moment der Doppelbewegung jedes Flusses ins Spiel treten: das Gleiten oder Rutschen des gesamten Gletscherleibes über seinen Untergrund hin. 4 An diesem Leib ist, wie beim Fluß, die Bewegung nicht überall dieselbe. Unterhalb des Firns, der dieses «Stromes Mutterhaus» darstellt, ist, wie nahe der Quelle, die Bewegung am raschesten; 5 ebenso ist sie’s auf der mittleren Längslinie der Oberfläche. Was die Zeit betrifft, so ist die Geschwindigkeit beider im Vorsommer am größten, dagegen im Winter so gering, daß die Grindelwaldner sie, wie begreiflich, gleich Null schätzen: 6 der Gletscher g’steid im Winter.
Mit Stromschnellen und trägen Flußweiten vergleichen sich die Engen und Ausweitungen des Gletscherzuges, mit den Chrï̦mpen des Flusses die Umbiegungen des Eisstroms. Der hübsche Anblick einer Flußserpentine wiederholt sich z. B. auf dem Schulweg gegen das Moos im Blick auf die kühn geschwungene Schlangenlinie des obern Gletschers. An hu̦ppen (konvexen) Rand dieser Umbiegungen, besonders wo diese 51 mit Gefällsbrüchen verbunden sind, türmen sich gleichsam gefrorne Spritzwellen in dem fast abenteuerlich aussehenden Gewirr von séracs — Zĭ̦gerstë̆cken — auf, welche heute das Sehenswürdigste am obern Gletscher ausmachen.
Die interessanteste Parallele aber besteht in den Perioden des Hoch- und Tiefstandes. Daß es auch am Gletscher solche gebe, wurde zwar noch 1778 7 als einfältiger Aberglaube verlacht; allein es war doch ein fünfzehnjähriger Grindelwaldner Hirtenknabe, der bereits seit 1773 durch Hinlegen großer Steine den ihm auffälligen Anschein zum Augenschein zu erheben suchte. Heute nun weiß es jedes Kind: der Gletscher stoßd oder är großed, und: der Gletscher schwịịnd; um so und so viel hed er g’schwĭ̦nen; er «schweint» 8 und ruckt hinter sich; 9 är geid vordertsi ch und geid umhi z’ru̦gg. Ein treffendes altes Bild drückt das so aus: är hed d’Năsa im Bŏden; d. h. sein Vorderende berührt im Vorrücken unmittelbar «den Steindamm» (die Endmoräne); und dann wieder hed er d’Năsa im Luft: er zieht sich von der Endmoräne nach oben zurück. Das Mittragen neuen Geschiebes beim Vorstoß und dessen Ablagern beim Abschmelzen der Zunge wird etwa mit der Rede bezeichnet: e̥s tued den Boden vor e nwägg stoßen.
Daß damit auch je und je mannigfache Schädigung verbunden war wie bei den Wassergrößen, erzählt schon
Rebmann
10
1602 und 1620:
Der Gletscher
Hat ganz bedeckt dasselbig Ort,
Mit Häusern muß man rücken fort;
Stoßt vor ihm weg das Erdterich,
Bäum, Häuser, Velsen wunderlich.
Der Grindelwaldner würde sagen: är hed alls vorwägg verherged. (Man vergleiche auf unserm Bild vom Jahr 1642 die Stelle bei D.) Schon 1096 mußte «wägen des Gletschers und Wassergefahr die Kilchen ab dem Burgbiel abgebrochen werden», damit sie nicht das spätere Schicksal der Petronellenkapelle (s. im Kirchenkapitel) am untern Gletscher erfahre. Der nämliche Eisstrom vernichtete (wohl um 1850) auch einen schönen Erlenwald in der Umgebung des jetzigen Chalet Schläppi oder Wyß. 11
52 Auch vom obern Gletscher wissen ältere Leute zu berichten, wie man um 1850 von der Halsegg ä̆be ns Wägs über das Eis schreiten konnte. Solcher Vorstoß galt damals als Naturwunder, zu welchem wenige, aber dafür ernst forschende Fremde pilgerten. 1847 «waren die Gletscher viel größer und schöner und die Gasthöfe viel kleiner», bemerkt launig Lienz Liebis Cronegg. 12
Früh auch schon wurde man auf das Periodische dieser Vorstöße und Rückzüge aufmerksam. Daß jene und diese gẹng sĭ̦be n Jahr andauern, war die erste 13 darüber aufgestellte Hypothese, die noch jetzt um dieser Zahl willen eine gewisse volkstümliche Geltung besitzt. Die regelmäßigen genauen Messungen am untern Grindelwaldgletscher durch die Sekundarlehrer Stump und Beck unter Autorität des Geologieprofessors Baltzer in Bern haben seither ein viel verwickelteres System kurzer und langer Perioden aufgedeckt. Es gibt deren bereits jahreszeitliche: der seit 1850 allgemeine Rückgang wird unterbrochen durch kleine Vorstöße infolge ungleicher Entladung der Firnvermehrungen. Diese können in regnerischen Sommern, wie 1897, schon im August eintreten, nach warmen wie 1895 sich bis in den November verschieben und schwankten in den Sommern 1894 bis 1897 zwischen 14 und 15 Meter. Klein sind die winterlichen Vorstöße. 14
Auffälliger, und an den so tief in die Kulturregion hinunterreichenden Grindelwaldgletschern auch besonders leicht zu beobachten, waren eine Zeitlang die Vorstöße und Rückzüge in den «Brücknerschen Perioden» von 34,8 Jahren, welche nach neuester Hypothese 15 mit den Zuständen der Sonnenathmosphäre in Beziehung gebracht werden wollen. In feuchten (niederschlagsreichen) Jahresreihen vermag die Zunge die Menge der Regen- und Schneezufuhr nicht zu bigwẹltigen, und in kalten nimmt die Kraft zur Bewältigung ab: der Gletscher großed umhi, er chunnd de̥s aha, er ri̦ckt fï̦rha. In warmen und trockenen Jahresreihen schwịịnd der Gletscher.
So lautet das große summarische Gesetz, dem auch die beiden Grindelwaldner bis vor einem Dutzend Jahren so ziemlich gefügig sich unterordneten. Im Jahr 1818 z. B. stieg der untere Gletscher auf 983, im Jahr 1870 auf 1080 m/M. hinunter. Als aber mit 1899 ein neuer allgemeiner Vorstoß sich einstellen sollte, hein die beed Lei g’loïgned (versagt) und mit samt den übrigen Schweizergletschern einen so entschiedenen Rückzug auf unberechenbare Zeit angetreten, daß sie 53 bereits jetzt bloße Ruinen ihrer einstigen Herrlichkeit darstellen. Allerdings wies 1903 der obere Gletscher, wahrscheinlich infolge eines lokalen Felssturzes und daheriger Schuttablagerung, auf dem linken Flügel einen Zuwachs um achtzehn Meter auf und überbot damit noch den Lötschengletscher mit dessen neun Metern zwischen 1892 und 1905. Allein 1904 schwand der obere Gletscher um zwölf, 1905 um 32 Meter. Der untere Gletscher aber hat 1905 um sechzig, 1906 wieder um dreißig und damit seit 1895 um volle 311 Meter, seit 1850 um mehr als einen Kilometer abgenommen. 16 Er sieht aber auch danach aus! Gewachsen ist dagegen i. J. 1906 der Eigergletscher um 34 m.
Über der Brückner’schen steht eben noch eine höhere, in ihrem Wesen bisher unerforschte Periodizität, und überdies ist jeder Gletscher ein eigenes Individuum für sich, mit eigenen Gesetzen und eigener Lebensgeschichte. Die kann unter Umständen verhältnismäßig kurz ausfallen. So ist der Rose nllouigletscher wahrscheinlich erst in neuerer Zeit entstanden 17 und ist schon 1814 stark zurückgegangen. 18 Dafür hieß er mit Recht einst «der schönste aller Gletscher» 19 — ein glänzendes Meteor, das rasch für immer dahinfährt.
So wenig wir hierüber Näheres wissen, so gute Kunde besitzen wir über die beiden Grindelwaldgletscher. Im dreizehnten Jahrhundert scheinen sie viel weiter als jetzt heruntergereicht zu haben. 20 Dagegen waren sie 1540 zwischen den nördlichen Abhängen des Wetterhorns, Mettenbergs und Eigers ganz verschwunden, 21 und 1561 habe auf dem Boden des untern Gletschers «ein Arvenwald» (!) gestanden. 22 Ja, von einer Gletschergruppe war überhaupt während der schneearmen Winter und warmen Sommer zwischen 1539 und 1563 keine Rede; das Ịịschmeer reichte noch nicht über die obern Flühe hinunter. Dafür kamen 1565 bis 1580 so ungeheure Schneelasten, daß sie selbst bewohnte Täler sperrten und viele Häuser mit Menschen erdrückten. 23 Die drängten nun auch die Firnlast durch die bloß fünf bis zwanzig Meter breite, schattige, feuchte und kalte Schluecht rasch ins Kulturgebiet hinunter, die bereits erwähnten und noch weitere Verheerungen anrichtend. Der höchste Gletscherstand erreichte 1600 den Burgbị̈elschopf und langte um Handwurfsweite an den Schi̦ssellouinengrăben. Der Wald am Fuß des Challi war vom Eis bedeckt 24 bis zum Rückzug von 1602. Nach demselben aber galt es für die Mättenbärger, ihre Güter am Fuß des Berges durch große Dämme vor der Wucht der Schmelzwasser 54 zu schützen. 25 Die Lütschine ihrerseits, vom Gletscher verschwellt, hatte ihr altes Bett verloren und lief durch den Ällouinenbŏden aus. «Die ganz Gmeind wollt helfen schwĕlen, aber es half nichts. Man mußt die Kälter (G’chälter, Gehälter, Gebäude) abraumen ( abrụụmen): vier Häuser und viel andere Kälter. Das Wasser trug den ganzen Boden wäg.» 26 Noch 1642 mußten Wohnungen dem Gletscher weichen. (S. Abbildung.) Erst 1661-1686 war die Abnahme bedeutend.
So der under oder der ụụßer Gletscher, welcher in der zum Tal «hinaus» führenden Wegrichtung liegt. Mit ihn wetteiferte der ober oder der innder Gletscher. «Im Jahr 1600 ist der ynder Gletscher bei der undren Bärgelbrï̦̆gg in den Bärgelbach getroled ( ’trooled oder g’hịjd), und hat man müssen zwei Häuser und fünf Scheunen abraumen; die Plätz hat der Gletscher auch eingenommen.» 27 1777 verspäteten beide Gletscher die Kornernte um etliche Wochen. 28
Schon diese spärliche Auswahl von Notizen, die wir uns erlauben dürfen, spricht von der «Trägheit» 29 unserer beiden Gletscher, die sie übrigens mit denen der gesamten Finsteraarhorngruppe teilen. Zunächst erklärt sich dies daraus, daß die Montblancgruppe sich quer in den Weg der südwestlichen Winde stellt und den größten Teil der Luftfeuchtigkeit samt deren Niederschlägen vorweg abfängt. Ähnliche Feuchtigkeitsschirme sind die bernischen Alpen für die östlichen, und so verzögern sich schon die Brückner’schen Perioden von Westen her für Grindelwalds Gletscher um fünf, für die Tauern um zwanzig Jahre. 30 Auch schwächen sich die Vorstöße nach Osten immer mehr ab. Sodann können Talgletscher, wie unsere beiden, in so großen und flachen Firnmulden wie dem Ịịschmeer ein gewaltiges Material aufspeichern und drücken es erst stoßweise talwärts, wenn der Eisstrom sich in seinem Laufe plötzlich eingeschnürt — ịị ng’gï̦rtẹta — oder gestaut — g’seewweta ( S. 48) sieht. Dazu hilft am obern und untern Gletscher die Länge der Zungen (2700 und 5000 m), die Firnneigung (28° und 32°), der Stauwinkel (27° und 32°) und der daraus sich ergebende Empfindlichkeitsgrad (1,8 und 1,1 gegen 4,7 der Montblancgletscher) 31 mit.
So hat der Eisstrom Anteil an wesentlichen Eigenschaften des Wasserstroms. Mit andern erinnert er an tierische Wesen. Er «atmet»: ziehd den Aaten. 32 Das tut er allerdings wieder in recht schwerfälliger Weise. Im Winter 1832 wurden das Eismeer, der Viescherfirn, das Gletscherfeld zwischen Stieregg, Zäsenberg, Bänisegg und Challi zu so ungeheuren Hügeln aufgetrieben, daß selbst der Zäsenberghirte 56 sich in dem schrecklichen Gewirr nicht mehr zurechtfand. 33 Diese Höckerbildung findet besonders statt zwischen einengenden Felsen, die eine Ausdehnung der Eismasse in waagrechter Richtung hindern. Solches «atmen» beruht auf der Bildungsweise des Gletschereises, die dieses vom Wassereis in manchen Eigenschaften ferne hält.

Der «grosse» oder untere Gletscher im Jahr 1642 nach Merian.
In Höhen zwischen 3200 und 2700 m 34 wird der dort sehr trockene Schnee zu «Firn», wie die geschulte, wenigstens in Grindelwald aber nicht die gut volkstümliche Sprache sich ausdrückt. 35 Letztere kennt auch das Bild der «Zunge» nicht, sondern benennt die ganze, von Auge schwer zu unterscheidende Masse eines gefrornen Schneefeldes einfach als Gletscher. In dessen obersten Partien also legen sich die zu zierlichen Sternchen geordneten Nadeln des frischgefallenen Schnees, wo sie Anhalt finden, in hübschen Gruppen an. Hinreichende Tageswärme aber führt sie in Schmelzwasserrinnen ab und schmelzt sie zu runden, harten, blendendweißen Körnchen ein. Die dabei mit eingeschlossene Luft bildet oben runde, unten spitze Luftbläschen. Das an jedem Sonnentag neu entstehende Schmelzwasser backt über Nacht mit den intakt gebliebenen Körnchen zu einer steinharten Eismasse zusammen, um am Tage wieder grï̦msche̥llig auseinanderzufallen. So häuft sich Schneelage auf Schneelage, um in flachen Mulden wie am Ịịschmeer (Grindelwaldner-Eismeer) sich zu einer Masse von vielleicht vierzig bis fünfzig Meter Höhe 36 aufzuhäufen. Nicht bloß der fär ndrig Schnee (« les neiges d’antan»), sondern ein vieljähriger «Firn» fristet da seine wirkliche Existenz. Mit dem Alter de Eises aber und dem Druck der neuen Massen wachsen die festesten Körnchen auf Kosten der andern, von ihnen angesogenen, zu immer größern Körpern bis zum Umfang einer Faust an. Zugleich werden die Luftbläschen immer vollständiger aus dem innern der Masse ausgequetscht und entweichen wohl stellenweise durch eine Art «Luftpfeifen» 37 — der Gletscher pfịịffed —, hauptsächlich jedoch durch die Spalten. So wird das Gletschereis etwa elfmal schwerer als der Neuschnee. 38 Die Körner greifen ohne Zwschenräume gelenkartig ineinander über. Daher das wasserhelle Aussehen und das prachtvolle Blau dicker, reiner Lagen. Dieses entzückt nicht bloß das Auge in den natürlichen und mehr noch in den künstlich erweiterten und verlängerten Grotten; es verlockte ehedem auch zur Auffassung des Gletschereises als «Genäsmittel» gegen allerlei Krankheiten. Daher blühte zur Zeit des großen Haller und unter seiner Ägide eine förmliche 57 Gletscherspiritus-Industrie. 39 Doch warnten schon seit Josias Simler 40 alle Alpenwanderer vor Schnee- und Gletscherwasser, dessen unbekömmliche Beimengungen nicht durch einen minimen Alkoholzuguß niedergeschlagen worden. Auch der Älpler weiß wenigstens: Gletscherwasser machd huestig; und er trinkt es nicht, bis er es über einen besonnten Fels hat rinnen lassen. 41
Die Nacht und der Winter backen auch die großen Gletscherkörner wieder zu einer festen Masse zusammen. Drum ist im Vorsommer die Gletscherfläche rauh und tief gefurcht. Dann aber dringt die Tageswärme tief und tiefer ein und sprengt die starre Hülle des «Reifriesen». Unter Gewaltanwendung suchen dann jeweils in der Nacht die ungleich erwärmten Teile in ihre alte Lage zu kommen. Der Gletscher chroosed und chrachched! Das knackt und knallt, das donnert und erweckt ein vielfaches Echo an den nahen Felsen. Aber auch am Tage können sich derlei schreckhafte Szenen ereignen. Hier ein anhaltendes, tiefsingendes Getöse, dort ein betäubender Donner, und Felsstücke rollen übereinander; Schründe verschließen sich und spritzen das ausgequetschte Wasser haushoch; Flinten, Bergpipfel, Waidsäcke werden am Boden lebendig; die Gletschermasse rückt um einige Schritte vor. 42 So öffnen sich am Platz der vorjährigen, 43 durch Winterschnee ausgefüllten Chlecken (Klüfte) oder Späälten (Spalten) deren neue, zehn bis zwanzig Schuh breit, unter Umständen sich zu dreifacher Breite auswachsend, wobei die Kanten für den Fuß gefährlich sich abrunden. Sie dringen im Bereich der Mittellinie des Gletscherstromes wohl bis auf einen Drittel, am Rande bis zur Sohle ein und können so eine Tiefe von mehr als fünfzig Metern erreichen. 44 Mit neuen sommerlichen Schneedecken dem Auge des nicht sehr erfahrenen Gletscherwanderers trügerisch entzogen, können sie zu Katastrophen führen wie der vom Hallerstein erzählten ( S. 32). Denn fast einzig in ihrer Art ist die Selbstrettung des Christian Bohren (1755-1817) auf dem obern Gletscher am 7. Juli 1787. 45
Auch in der Spaltenbildung, welche als Vergrößerung der feinen Zwischenräume zwischen den Gletscherkörnern 46 aufzufassen ist, zeigt das Gletschereis abermals seine Eigenschaft als Wasser. Ebenfalls eine flüssige Masse, nur zäher ( S. 50), verliert auch jenes bei Schub und Zug seinen 58 innern Zusammenhang, 47 und es entstehen eben Späält senkelgrad zur Zugrichtung: im Wịịhel zu derselben. Tritt daher der Gletscher aus einer Talenge in eine Talweite, so reißt durch Außeinanderfließen der Zusammenhang seitlich und es entstehen Längsspalten: d’s Ịịsch spaalted si ch der Lẹngi naa ch. Bietet das Gletscherende die Form eines Löffels oder einer Muschel, so bilden sich fächerartig verlaufende Längsklüfte, welche nach aufwärts rechts und links in die Randspalten übergeben. Die letzteren springen ụụf, weil der Eisstrom sich in der Mitte rascher bewegt als am Rand ( S. 50), und treten unter ungefähr fünfundvierzig Grad in den Gletscherkörper ein. Gerät dieser auf einen Hang, so bricht er, er zerhi̦jd, weil die Oberfläche viel rascher fließt als der Grund ( S. 50), und reißt große Querspalten: der Gletscher spalted ĭ̦ ntwä̆rist oder ĭ̦ ntrémis. Muß aber infolge einer Umbiegung des Stromes der Grund sich am weitesten dehnen, so gibt es während der Nacht die so besonders häufigen Unter- oder Grundspalten, die sich im Körper des Eises schließen. Der unerschrockene Hugi ( S. 21) hat eine solche untersucht, 48 wie er auch 49 von den schrecktlich zerklüfteten Massen des Grindelwaldner Vieschergrates 50 nach einem Besuch vom Januar 1832 wahrhaft dramatisch erzählt.
Aus der geringen Wärme von 0,2-1,5 Grad zu schließen, welche der hochsommerliche Gletscherbach am Gletschertor aufweist, wäre es erst recht innen im Gletscher schreckli ch chaald. Das anfängliche Kältegefühl wird jedoch bald überwogen durch die Empfindung außerordentliher Trockenheit 51 der hier gefangenen Luft, die eben nur wenig Feuchtigkeit in Gasform zu erhalten vermag. Diese trocken-kalte Spaltenluft erhielt alten Grindelwaldnern ihre Schinken 52 und Jägern ihr Wildpret 53 über den ganzen Sommer frisch und ohne üblen Beigechmack ( ohni en andre Bitz, e n Chu̦st oder Abchu̦st, e n Mang). Unserer Zeit des raschen Konsums in der Fremdensaison erscheint nun freilich solche Konservierungsart ebenso befremdlich wie die Kunde, daß Gletscherspalten Verunglückte ein Jahrhundert lang unversehrt 54 und die Hüte eines eingesunkenen Hutmachers unentstellt 55 gelassen haben.
Einmal aber gibt der Gletscher doch, was er an Fremdkörpern in seinen Riesenleib aufgenommen, wieder ab. Der Gletscher butzd si ch. 56 Das ist allerdings keineswegs 57 auf irgendwelche «innere Regsamkeit» 58 oder gar ein «Wachsen von innen heraus» 59 zurückzuführen, 59 so volkstümlich diese Vorstellung auch geblieben ist. Es beruht einfach auf der Abschmelzung durch Wärme, welche besonders in den Föhnzeiten am gesamten Gletscherleibe zehrt. Im Innern desselben wirkt die Druckwärme. An der Unterfläche nagt die Wärme des Erdbodens, auf welchem der Riesenkörper bloß mittelst isolierter Felsstützen aufruht — ähnlich dem nächtlich Wachenden, der nur an wenigen Punkten seines Leibes sich stützt, wenn er e n chlịị n wollt ablĭ̦gen. Besonders aber wird die Oberfläche in ihrer ganzen Länge von oben nach unten in steigendem Maß angegriffen, so daß sie am Talende mit der Unterfläche einen Winkel von beiläufig 3° bildet. 60 Besonders wirksam ist die Wärmerückstrahlung der Uferwände, an welcher ja auch das Eis durch Chle̦ck ( S. 57) vom Ufergestein gelöst wird. Ihr ist ebenso die Erhöhung der mittlern Längslinie des Gletschers zuzuschreiben; derselbe gleicht einer gutgebauten Straße: der Querschnitt ist obennaha hu̦ppa (konvex).
Eine wirkliche «Selbstreinigung» wäre aber auch bloß eine solche, die der Ausscheidung schädlicher Stoffe aus dem Menschenleibe gliche: auf der Haut setzen sich diese ab in allerlei unanmutiger Gestalt. So tragen mit Ausnahme des allzeit saubern Rosenlauigletschers (und des hochnordischen Inlandeises 61 ) alle Eisströme, wenn nicht der blinkende Schnee sie deckt, ihre häßlichen Unreinigkeiten geradezu zur Schau. Es gehörte darum ehemals zur ständigen Neckerei unter dem Gasthauspersonal Grindelwalds, «grüne» Neulinge mittelst eines Tributs sich von der Verpflichtung loskaufen zu lassen, im Frühling in u nb’schlăg’ne n Schuehne n mid Zï̦berli und Rịịsbï̦rsten und Seiffen den obren Gletscher oben aha (von oben herunter) z’butzen oder z’wäschen. 62
Den schriftdeutsch gewordenen Ausdruck «Moräne» ersetzt sich die Mundart durch Gletscher-Ggŭ̦fer oder das Ggŭ̦fer 63 schlechtweg, womit überhaupt Sandflächen und Geröllpartien jeder Art bezeichnet werden. (Man denke zur Erklärung an emmentalisches «gü̦̆fere n» s. v. w. storren, stochern.) Doch unterscheidet man z. B. das Gletschersand als ausbeutungsfähig zermahlene Endmoräne am obern Gletscher vom Ggŭ̦fer als Steingeröll und nennt in solchem Sinn eine «steinalte» kleine Frau e̥s ggŭ̦feralts Wịịbli. Ggufer ist also verwandt mit Ggool (Schutt, Trümmergestein). Der zeitlich erste Geologe Grindelwalds, 60 Professor Kuhn, nannte 64 (1786) die Mittelmoränen «Guferlinien». Bei dieser Begriffsbeschränkung wurde dann der keltisch-romanische Name gandas (Felsbruch, besonders eine mit zerklüfteten Felsstücken überschüttete Gegend) 65 wie er in Gantfluh und Gantdossen, Gantrisch und «das Hohgant» 66 wiederkehrt, zur Bezeichnung der Seitenmoränen oder auch der Endmoränen herangezogen. Der Grindelwaldner nennt die kleine Seitenmoräne die Gande̥rra, was unmittelbar mit dem tessinischen Dorfnamen Gandria zusammenstimmt. Wenn aber der Lötschentaler im Hochsommer mit seinem Vieh «uber alli Gänder» (Felsgräte) fährt, so ist hierin nicht der schon verwitterte, sondern der noch als Ganzes gedachte Grat zu erblicken, wie er an die ebenfalls ursprünglich romanische 67 «Kante» erinnert. Nur so erklärt sich auch die Form «Gandecke» für die End- 68 und die Seitenmoräne, 69 den «Seitenschutt» oder die umgedeutete «Randdecke». 70 Die Bezeichnung «Egg» in solchem Sinne wird in klassischer Weise illustriert an der riesigen Seitenmoräne des obern Gletschers: der Halsegg über dem Hals (Tobel, S. 9).
Nach dem zeitweilig reichen Moränenbeschlag ist direkt das Dräckgletscherli am Schwarzhorn benannt; mit seinem schönern Namen d’s blaau Gletscherli aber erinnert es doch an das Ultramarin des Rosenlauigletschers. 71
Vom Wetterhorn herunter hängt auch der Gu̦tzgletscher oder, ebenfalls halb verächtlich benannt, der Hï̦enderggu̦tz, in éin weithin sichtbares Firnfeld sich teilend mit der imposanten Wätterlouinen. Zwischen dieser und Rosenlaui hängt nach der Haslerseite hinunter das Schwarzwaldgletscherli, ebenfalls — gleich dem Hŏhnịịsch am Eiger ( S. 48) — als Hängegletscher, dessen herunterfallendes Eis als «regenerierter Gletscher» en miniature das Alpĭ̦glengletscherli unterhält. Wieder auf Grindelwaldner Seite bildet der Chrĭ̦nnengletscher eine kleine Einbuchtung des Grindelwaldfirns, dessen Hauptentladung aber der ober Gletscher (Grindelwalds) ist. Der Lụteraargletscher ist eben noch als Grenznachbar zu nennen.
Der Grindelwaldfirn hieß früher (in Ersetzung des Namens «Firn» 72 S. 56) auch etwa Ịịschmeer. 73 Schon 1820 aber finden wir diesen vollmundigen Konkurrenten der mer de glace im Mount-Blanc-Massiv auf das Firnbereich des untern (Grindelwald-) Gletschers beschränkt. Es hieß sonst auch etwa «unteres Eismeer» im Gegensatze zum Grindelwaldner 61 Vieschergletschrer 74 oder Viescherfirn. Der Kallifirn und der kleine Zäsenberggletscher (Gletscheralp), anderseits der Gletscherbärg (der Mettenberg als Schafalp) hängen mit ihm zusammen. Haben wir noch an der Eiger-Westseite den Eigergletscher bemerkt, so schauen wir über den Mättenberg hinüber nach dem kleinen Wechselgletscher, dem Schreck-, Kasten-, Nässifirn. Damit sind wir wieder in die Nachbarschaft der «beiden Gletscher» Grindelwalds gelangt, von denen sogar jeder für sich die Benennung «der» Gletscher usurpiert. Ehemals war dies der untere oder der «große» Gletscher ( S. 55). Die Weganlage des Wirths Christen Burgener (1822-24) 75 machte ihn zum «Gletscher der Damen und Stutzer», 76 und sein Besuch galt als der Glanz und Höhepunkt einer Schweizerreise. 77 Als «der Gletscher» wurde er unzähligemal beschrieben und gemalt, 78 und selbst Einheimischen heißt bis zur Stunde die an ihm liegende Örtlichkeit bi’m Gletscher. 79 Auch dieser Weltruhm ist vergangen ( S. 53), und dem heutigen Touristenstrom ist nun der obere Grindelwaldgletscher «der Gletscher». Zu ihm fährt oder pilgert man auf dem Gletschersträäßli; und gleichwohl kann einer des Tages zwanzigmal zur Beantwortung der Frage kommen: Wie weit ist’s noch zum Gletscher? Est-ce bien là le chemin «du» glacier? Please is that the way to «the Gletscher»?
Inmitten dieser universellen Einseitigkeit bewahrt sich der Grindelwaldner die gebührende Allseitigkeit des Begriffs «Gletscher». Wie sollte er’s auch nicht, wo das so eigenartige Gesamtbild der Bergriesen, Firnfelder und Gletschertäler als Umrahmung dieser gottgesegneten Talschaft sich ihm Tag um Tag vor Augen stellt! «Gletscherberge» sind ihm die Hüter seines Tales. 80 Da liegt
Ein Kind in der Wiege; die Wache, die halten
Ringsum die bepanzerten Riesengestalten.
81
So dichtete der Gletscherpfarrer in den «Gletscherfahrten», zu den Zeiten des Wirtes Gletscherfritzi unternommen mit Gletscherführern wie Bŏhre n-Peterli, dem Gletscherwolf ( S. 23), 82 mit Jossi, der Gletscherschatz, 83 mit Almer Ue̥lli, der Bärgchatz, wohl auch in Begleit von Gletscherschï̦tzen.
62 Will der Grindelwaldner den Begriff des Gletschers einseitig fassen, so tut er’s vom Gesichtspunkt des Schafhirten aus, welcher d’Bänzen gan Gletscher inhi tued, gan Gletscher inhi na ch d’Bänzen geid, d’Bänze n z’Gletscher sï̦mmred, z’Gletscher den Bänze n z’läcken gi bd. Oder eine Hülfskolonne hat man 1695 nach Verunglückten «gan gletscher geschikt». 84 In diesem artikellosen «găn» und «ze ist Gletscher» vom geographischen Begriffskreis losgelöst und schwebt zwischen Einzelding und Stoff. Ja ganz in den Begriff des letztern ist er übergegangen, wenn Fuhrleute Eisquadern vom obern Gletscher nach den Wirtschaften des Dorfes verbringen: Gletscher ahifïehren; oder wenn man auf der ehemaligen Eisbahn 85 vom unteren Gletscher her Gletscher uehig’fïehrd heed; wenn man auf eine entzündete Wunde Gletscher ụụfleid oder bei Brucheinklemmungen Gletscher schlïckd. Sachlich und sprachlich wird damit das Wort seiner ursprünglichen Bedeutung zurückgegeben, in welcher es im 14. Jahrhundert aus französischem glacier übernommen worden war, 86 um zunächst (1523 bei Ägidius Tschudi und 1544 bei Sebastian Münster) das Matterjoch zu bezeichnen. 87 Es ist dies eine Art Entlehnung erster Stufe, einem älteren Sprachstand entsprechend. Wie die Entlehnung heute lauten würde, zeigt d’s Glassi, wie die Einheimischen das Hôtel du glacier in Grindelwald benennen. « Glacier» seinerseits setzt ein mittellateinisches « glaciarium» (Eisfeld) voraus, welchem « glacies» ( glace, Eis) zugrunde liegt. Aber auch das hieraus entlehnte Gletsch war eine Zeitlang gleichbedeutend mit «Gletscher». Noch heißt so das Hoteldörfchen am Fuß des Rhonegletschers, und in der Cronegg von 1593 ist dreimal nacheinander vom obern Gletscher als dem Gletsch die Rede. «Da ist der Gletsch so groß gsin, daß er in den Bergelbach trolet» (ist). Beide Ausdrücke besagen demnach zunächst dasselbe, was die Ịịscha (s̆s̆) und in Mehrzahl die Ịịschi (s̆s̆): der und die Eiszapfen, und was die Ịịsche̥rra (s̆): das Eisfeld. Jene Ịịschi erfreuen das Auge mit ihren prachtvollen Nachbildungen von Orgelpfeifenprospekten z. B. an den Engischëpfen der Ortweidflueh oder am winterlichen Staubbach. Eine Ịịsche̥rra aber, oder eine Schụụra ist dem Grindelwaldnerkind jedes noch so kleine Eisfeldchen, jeder Schụụristein, die zum schụụren (glitschen) einladen; und wenn es nicht hie und da e n Zu̦ck gi bd (einen Fall), sụ is’ ’s o ch gaar nịịd mid’rḁ. An die Eisbahn für Fremde freilich: die kunstreich hergerichtete und mittelst Hydranten betriebsfähig erhaltene Ịịschbahn, darf jener profane Name nicht heranlangen. Er ist dessen so wenig würdig, wie das schụụren mit 63 dem schlịịfschuehnen 88 oder gar etwa mit dem Spezialsport der Engländer ( Hockey, Curling) sich vergleichen darf. Im gletschrige n Tẹllti 89 versteht man sich aber auf das Eis aller Arten gleich gut: das dichte Wassereis, das schwammige Grundeis, das Schneeeis des Firns und das des Gletschers, so unterschiedslos man gelegentlich alle einfach als Gletscher bezeichnet.

D’s Almis Christelli
Führer und Schliiffschuehprofässer.
Doch knüpft sich an den Hauptgebrauch des Namens immer wieder die Vorstellung des Belebten, welches irgendwie in den Bereich des Menschlichen hineinragt. Tut dies in derb-komischer Weise die Gletscherflo ( Desoria glacialis), 90 so klingt hinwieder wie eine Idylle «aus alten Zeiten» die Kunde, mu̦ heig albḁ chënnen mid ei’m Ärmli a n d’s Ịịsch a nstotzen (sich lehnen) u nd mid dem andren Ärdberre̥ni g’winnen. 91 So schließen sich Glieder aus allen drei Naturreichen zu einem Gebilde voll reichen Lebens. Ja, auch der scheinbar starre, ungeschlachte, «gefrorne Reifriese» selber nimmt Anteil an menschenähnlichem Tun. Seine Kinderchen, die Bächlein der Ober- und Unterfläche, schlüpfen, gelockt von der Sonne oder der Bodenwärme, aus zahllosen eisigen Betten hervor, sammeln sich in Scharen an den hoch und weit aufgetanen Gletschertor; und in hellem Jugendmute, ja in tollem Übermut eilt die vereinte Schar zu Tale, mächtige Felsstücke gegeneinander schmetternd. Allein auch dies anscheinende Riesenkinderspiel ist ernste, große Arbeit. Mit ihr tränkt das Alpengebirge, die Brunnstube Europas, die Niederung durch seine «Gletschermilch» gerade in den Zeiten höchster Hitze und Trockenheit am reichlichsten; und die verflüssigten «weißen Kohlen», deren Stoßkraft sich in elektrischen Starkstrom umsetzt, bergen in sich den künftigen Hauptreichtum unseres Landes.
1
Tschudi 4.
2
Neum. 542.
3
Hugi 86.
4
Zirkel 3, 428.
5
Vgl. Heim’s Gesetze bei
Heß 40.
6
Krehbiel 79 f.
7
Reise 2, 24.
8
Altm. 33 sagt «abgeschwinnen», mit Wechsel zwischen Nasal- und i-Klasse; vgl. das umgekehrte zürch. «g’schune» = geschienen. Schriftdeutschelndes «schweinen» für schwinden fließt etwa noch in das einheimische «Halblein» über. «Die Fremden fangen an zu schweinen», bemerkte ein Träger bedauernd beim Abflauen einer Saison, worauf ein Berliner unter entrüstetem Protest: «dat is eene Jemeenheed!» sofort den Koffer packte. (
EvG. 1904.)
9
Cronegg 1602.
10
488.
11
UGwGl. 9.
12
GlM. 18.
13
Altm. 22;
Grun. 3, 156;
Grube 2, 110. Auch Scheuchzer erwog sie z. B. in seiner vierten Bergreise 1705. (
Krehbiel 3.)
14
Vgl.
Heß 258 nach
UGwGl.
15
Berd. 1, 39 f.; 2, 70 ff.;
Heß 58.
16
SAC. 40, 230 f., und danach Alpenhorn 1906, 100;
GlM. 129 ff.;
Brückn. 247.
17
Tschudi 445.
18
König 39.
19
Ebd.
20
Tat. 26.
21
GlM. 130.
22
Wyß 660.
23
Hugi 48.
24
GlM. 130. 167.
25
Wyß 636.
26
GlM. 117.
27
GlM. 167.
28
Höpfn. M. 4.
29
Heß 264. 273.
30
Ebd.
31
Ebd. 267.
32
Vgl,
Krehbiel 88 nach Hugis «Winterreise ins Eismeer» 25.
33
Hugi 98; Abbildung in Scheuchzers
Itinera Alpina 482.
34
Zirkel 3, 426.
35
Vgl.
Täuber 71. Zur Sache vgl. «Firnmulde und Gletscherzunge am obern Grindelwaldgletscher» im
AM.
36
Hugi 70;
Studer P. 213.
37
Heß 166.
38
Nach Richthofen.
39
Grun. 1, 84; 3, 178 f.;
Wyß 652.
40
Cool. JS. 267 f.
41
Altm. 72;
Täuber 79;
Alpz. Mai 1906.
42
Wyß 659 nach Ortspfarrer Lehmann (1805-18);
Höpfn. M. 129 f. von Professor Kuhn;
Krehbiel 80 ff.
43
Hugi 81.
44
Vgl.
Murray LXXII;
Cool JS. 218 an Hand von Strabo 4, 6, 6.
45
Wyß 653 f. nach dem Wochenblatt von Bern vom 4. Aug. 1787;
GlM. 15 mit der Berichtigung 66 f., wonach der Spalt nicht 64 Fuß (oder gar, nach
Neum. 547: 120 Meter), sondern 25 Fuß tief gewesen;
Osenbr. 6, 20-24. Eine ähnliche Rettung erzählt
Tschudi 333.
46
Zirkel a. a. O.
47
Heß 150.
48
Ebd. 150 f.;
Brückn. 249;
AM.
49
Hugi 56.
50
Vgl.
ÄFG. 121.
51
Tschudi 354;
Rohrdorf 9.
52
König 31.
53
Rebm. 152. 488.
54
Grun. 3, 280;
Reise 1, 364.
55
Altm. 85.
56
Ebd. 80;
Murray LXXIII.
57
Grun. 3, 158;
Höpfn. M. 135.
58
Hugi 100 ff.; vgl.
Krehbiel 78.
59
Naturw. IV (1821), 76 ff.
60
Neum. 541.
61
Heß 108 f.
62
Etwa, wie Schulknaben neu eintretende Kameraden zu veranlassen suchen, sich mit Näh- und Stricknadeln in der Mädchenarbeitsschule einzufinden, und was der ähnlichen Spässe mehr sind. — In Basel müssen alte Jungfern die Münstertürme, in Egypten die Pyramiden abstauben.
63
Bei
Rohrdorf (8, 28) und
Hugi (108) lesen wir «die Gufer».
64
Höpfn. M. 28 f.; danach auch
Zschokke (41),
Hugi (106),
Täuber (75).
65
Stud. P. 33;
SAC. 18, 109;
schwz. Id. 1, 157.
66
Stud. P. 38.
67
Kluge 184.
68
Zschokke 40.
69
Hugi 106;
Täuber 75.
70
Hugi 106.
71
Vgl. das liebliche und zu seiner Zeit auch großartige Bild von J. Biedermann (1765-1830) im
AM.
72
Altm. 42 ff.
73
Rohrd. 7.
74
ÄFG. 124.
75
Wäber 229.
76
Wyß 660.
77
BOB. 73.
78
Grun. 1, 81; Gemälde von Aberli (1723-85) im
AM.; sechs Bilder in den
tableaux pittoresques von
De Laborde und
De Zurlauben 1777-80; die schöne Karte zu
UGwGl.
79
G 4.
80
Vgl. den
Prospectus montium glacialium Grindelianorum von Felix Meyer in Scheuchzers
Itinera alpina und
Vues de la vallée et des glaciers de Gw. von Architekt Sprünglin in Bern (
AM.)
81
Str. BO. 52.
82
GlM. 15;
Neue AP. 1882.
83
Schweiz 1900, 89.
84
Cronegg
GlM. 170.
85
F 4.
86
Kluge 141.
87
Krehbiel 1.
88
Theorie desselben: Brücker in Naturf. 1890, XIX f.
89
Str. Sänger 219.
90
Hugi 105;
Tschudi 6, 428-430;
Haacke 588.
91
Wyß 662;
König 32.
Als Hängegletscher führten wir vorhin u. a. das Hŏhnịịsch, den Gu̦tzgletscher und die Wätterlouina auf. Fügen wir die heutige englische und französische Bezeichnung « cascade», die sonst nur dem Wasserfall galt, hinzu, so haben wir den großen Bedeutungskreis des Wortes «Lawine» angedeutet. Voll entfaltet er sich, wenn wir uns zunächst über das Wort selber klar werden.
Man sagt heute, wie Wätterlouina, auch Wätterlouine nwang, aber neben Wätterlouine nschnee (überhaupt: Louine nschnee) auch Wätterlouischnee (überhaupt: Louischnee), wie noch knapp in die heutige Sprache auch gutes altes «Wätterloui» 1 hineinreicht. Man sagt z’Ällouinen oder echt grindelwaldnisch z’Älloinen und schrieb z. B. 1851 «auf Allouinen» oder «Allouenen» und schon 1575 «zu ällauwinen», «gan Ällauwinen», aber im nämlichen Jahr: «die ällauenmatten». Man sagt: Burgloúinen, z’Burglouinen, ụf Burglouinen, wie Lauterbrunner Örtlichkeiten «Trachsel- und Sichellouinen» heißen; aber man schrieb 1671 «an der Burglauenen» und noch 1808 auch «an Burglowen». Man schrieb 1618 und noch 1808 «ein Schneelauwena», 1572 und 1618 «ein Schneelauwne», 1575 «die Schißellauwna» und 1572 «ein lauwna», 1749 «die Mederlauwina» und 1739 «dei Lowina», 1610 «ein Schneeluwena». Als ausdrückliche Mehrzahlformen begegnen uns: 1808 loueni, louwini, 1770 lowini, 1776 lauwini, 1572 louwene, 1528 Louwinan, aber 1805 auch: vil louwen. Schon diese Auswahl aus unzähligen Belegen zeigt, wie die Sprache einer reinlichen 2 Scheidung zwischen der Einzahl Loui und der Mehrzahl Loue̥ni zustrebte. (Analog den Formen «Lütschi» und «Lütschinen»: S. 45.) Heute wird diese Scheidung mehr und mehr wieder aufgegeben. Man bekommt allerdings noch zu hören: es schnịjd wie us ’ner Loui; d’Loui chunnd; der Louizụụg. Unveraltet klingt bis heute das poetische Rŏse nlloui. Noch stürzt unterhalb Mürren der «Louibach» zu Tal, und ein Schneeberg, «gnent der Lauer», 3 liegt bei Frutigen. Die Loui verkleinert sich zum Loue̥lli mit der Mehrzahl Loue̥llle̥ni. Im Unterland besteht die gewöhnliche Ein- und Mehrzahlform «die Loue̥le n» (’s Louele nwäldli); seltener hört man daneben «die Loui», und der aus Gotthelf 4 so bekannte «Löije n» ist eine sehr steile, wegen beständiger Erdschlipfe längst aufgegebene Straße. Als Verbum hört man im Unterland: 65 «es louelet.» Allein in Grindelwald klingt nun moderner: es hed g’schnịjd wie ne n Louina, und man erzählt: d’Louina ist uber d’Flue ụsa ghịjd.
Die Sprache scheint uns also hier eine ihrer zahlreichen Numerusverschiebungen zu zeigen; ja diese könnte eine solche zweiten Grades heißen, wenn nicht die «lowa» oder die «lauw» der Cronegg von 1805 und 1808 eine vereinzelt gebliebene Einzahl zu «Louwi» als vermeintlicher Mehrzahl wäre.
Nun bedeutet aber bereits althochdeutsches 5 lewina einen Waldstrom, und ihm stehen gleichsinnig die Formen lowin und leina zur Seite; daneben besteht ein liwa (Regenguß). 6 Die ganze Gruppe stellt sich augenscheinlich 7 zu « lâwer» der laue, lao lau, die lâwi Lauheit, lâwen lau werden. 8 Zu leew lau stellt sich unmittelbar lịwwen, unterbernisch löije n: «lau und träg» sich gehen lassen, ausspannen, ruhen. Bairisches läuen aber ist auftauen, und läuen als Dingwort: 1. Tauwetter, 2. Masse von erweichtem Schnee, 3. Lawine. 9 Daneben gibt es ein tirolisches «Lähnen», «Schneelähnen». 10 Bei dem im 18. Jahrhundert schriftdeutsch gemodelten «Lawine» dagegen ist an lateinisches labi (gleiten) gedacht, welches denn auch gut zu dem Allgemeinbegriff paßt: Sturz aus eigener Naturkraft, durch welchen eine bedeutende Last (Schnee, Gletscher, Erde, Felstrümmer) von Anhöhen herunter getragen wird. 10a Solche Deutung aus « labi» lehnt sich an die des französischen avalanche oder avalange aus mittelalterlichem advallare (zu Tal stürzen); vergleiche avalenz, alenz (Herabgestürztes) im Wallis, wozu sich 10b auch «Aletsch» stellt. Poetisch wahr ist die Deutung nach der «wütenden, starken und schnellen Löwin» durch Philippus Camerarius und durch Schillers schöne Verse: «Und willst du die schlafende Löwin nicht wecken, so wandle still durch die Straße der Schrecken.»
Die durch unsere Belege erhärtete Deutung aus «lau» gilt also erst in abgeleiteter Weise auch von Stei nlouinen und anderm Wueggisch ( S. 34), sowie von Dräcke̥rren (fliegenden Erdschlipfen), wie sie zuweilen im Oberland 11 das Gefolge von Schneebrüchen bilden. An diese letzteren ist aber in der Regel bei «Louina» und «Lawine» einzig gedacht. Nur beteiligt sich die Mundart nicht an der üblichen Unterscheidung von Staub-, Grund-, Gletscher-, Rutschlawinen; 12 ja das Grindelwaldnische kennt auch nur indirekt den sonst so geläufigen Ausdruck «Sueggischnee». 66 Das ist firnartiger Schnee, welcher selbst an sehr steilen Hängen besonders mit unebener und von Vegetation bedeckter Fläche nur langsam rutscht, 13 weil er in beständigem Wechsel von Auftauen und Zufrieren bald stückweis vom Boden gelöst, bald wieder in engen Zusammenschluß gebracht wird. Dem Grindelwaldner ist sueggen in allgemeinerm Sinn so viel wie langsam machen; der Sueggi ist ein langsamer Mensch, dessen Wahlspruch «Eile mit Weile» oder «mid Sueggismueßen» lautet. Der «Schneetsch» 14 ist ihm unbekannt. Höchstens unterscheidet er (in den einen und selben Louizügen) von den Staublawinen des Neuschnees, die bei niedriger Temperatur staubförmig zu Tal fahren, die Schlag-, Grund- oder Pflatschloue̥ni, welde zur Zeit der Schneeschmelze sehr wasserreich, plü̦̆drigŭ̦, abstürzen. In gewöhnlicher Rede aber heißt es einfach: e̥s gi bd e n Louina, we nn’s de n Schnee dahar rị̈ehrd. Wenn die Zeit dazu gekommen ist: das tued denn albḁn 15 dä n Llouischnee nid leid ahibrätschen! Oder: das rị̈ehrd die Loue̥ni da leid ụsi!
Solche Unbeteiligtheit an den Unterscheidungen der Büchersprache beweist natürlich nicht etwa, daß der Grindelwaldner sich schlecht auf diese «flatternden Schneemäntel der Lawinen» 16 verstehe. Er beobachtet nur ohne Aufsehen, wie bisweilen (z. B. 1905) schon im Vorwinter, dann aber besonders im Januar bis April zahllose kleine Staublawinchen aus losen Schneelagen plötzlich wie Schleier an den Felswänden hangen, sich auf einem Rasenbande wieder sammeln und, aufsprudelnd, sich noch über eine Galerie hinunterstürzen, wo gewöhnlich ein eigener Trichter oder Kessel sie aufnimmt. 17 Wer diese herrlichen Schauspiele zu beschreiben imstande wäre! Diese breiten Silberströme, die bald in ein Dutzend einzelner Flüsse sich spalten, bald wieder zu einem mächtigen Laufe sich zusammenfinden, um schließlich wie ein hochaufspritzender Gischt auf steiler schimmernder Halde sich anzusammeln! So stürzt es bisweilen Schlag auf Schlag von den Gräten des Eigers, von den Nischen des Mettenbergs, von den Kesseln des Wetterhorns.
Nach langer Winterszeit ein Tag
Mit ächten Frühlingsmienen,
Mit Lauluft bis zum höchsten Grat,
Ein Festtag der Lawinen:
Das kracht und stürzt hernieder
Allorten immer wieder!
Die weite Bergwelt bebt
Und jede Fluhwand lebt.
Föhnwolken hüllen schwellend ein
Die Firnen und den Himmel.
Am Mettenberg, am Wetterhorn,
Am Eiger, welch Gewimmel
Von stäubenden Kaskaden,
Als wollt’ sich heut entladen
Ein jeder Berg der Last
In
einer heißen Hast.
67 Ein Niederbruch den andern löst,
Es gleiten weite Gänge.
Das wogt und wuchtet, stemmt und stößt!
Ein wirbelndes Gedränge
Durch alle Runsen wettert.
Das hallt und prallt und schmettert
Und schüttet sich hochauf
Zum Wall im letzten Lauf.
(Aus «Lawinentag» von Straßer.)
Und mit welchem Getöse! Wie das aber im Eiger tŏned u nd toosed, u nd tued u nd machd! Es chroosed u nd tonnd’red! «So ein Lawin im gebirg anbricht, gibt es ein gethön als ein Donderklapf oder erdbidem», 18 wie aus dem Innersten des Berges heraus. Man übersetze sich das Getöse einer Tachlouinen, wenn diese in stiller Nacht von den Ziegeln oder Halbschindeln eines der neuern Grindelwaldnerhäuser abrutscht, erst noch ins Hundertfache! Dann hat man eine annähernde Vorstellung jetzt vom Donnergepolter, jetzt vom anhaltenden Dröhnen und Rollen bei lauer Witterung, jetzt vom minutenlang ununterbrochenen dumpfen Grollen zur Nachtzeit und den Tag über. Es braucht hiezu nicht die Gletscherlawine von der Altels zu sein, die am 11. September 1895 mit einer Geschwindigkeit von 120 Meter niederfuhr und 4-5 Millionen Kubikmeter Eismasse 1500 Meter tief beförderte, 19 oder den noch furchtbarern Bruch des Gétroz am 25. Mai 1595. 19a Schon das relativ kleine Hŏhnịịsch ist ḁ lsó großes, daß, we nn’s ei ns abaghịjti, an Holzmatten und Bueßalp uehi kein einzigi Hï̦tta ganzi blĭ̦bi. Selbst so kleine, fein gezeichnete Furchen zurücklassende Firnlawinen und so kleine Gletscherbrüche wie der Ggu̦tz ( S. 60) erregen die Aufmerksamkeit auch der Einheimischen. Und dies erst abgesehen davon, daß der Ggu̦tz das sommerliche Wetterzeichen der Burglauener und Lütschentaler ist: ah, jetz i̦s’s ụụs mid dem schëënne n Wätter! Viel bedeutender ist freilich ihre Nachbarin zur Rechten: die Wätterlouina, dies «Prachtexemplar von Staublawine». 20 Noch gedenken wir eines Losbruchs wie an dem prächtig warmen Nachmittag (2 Uhr 20) des 28. Oktober 1906. Ein Krachen wie eines Blitzes von heiterm Himmel! Wir schauen um und gewahren mitten in vollem Anzug eine Staubwolke von nie gesehener Breite; ihre Wirbel überschlagen, überstürzen sich und jagen über die ganze Alp des Lauchbühls hin, verhüllen die ganze Breite des schneelosen Scheidegggrats; und wie sie sich verziehen, zaubert die Sonne 68 die ersten Farben des Regenbogens über das grüne Gefilde. Solche Schauspiele wetteifern an Pracht, nur nicht an Häufigkeit und berechenbarer Regelmäßigkeit mit der Gießengletscherlouine an der Jungfrau, wie man sie von der Wengernalp aus schauen muß.
Nirgends deutlicher auch sieht, wer zu rechter Zeit anhi g’sehd, wie eine Lawine z’wäg geid, z’wäg brichd, z’wäg ghi̦jd, oder wie n e̥s e̥ n Loui z’wä̆glaad. Bekanntlich vermag ein einziger Fußtritt auf geneigtem Schneefeld, das der leise Föhn gelockert hat, dieses z’e ntgänzen und e n Louina aa nz’stächchen. Diese wird im Fall auf nächster Halde en Brochcha oder e n Jätta losstächchen und so in allmählich hundertfach vermehrtem Maß zu Tale fahren. Jede Lawine gerät zuerst in langsames, schwerfälliges rï̦tschen. Am Rand der Felsenmauer stürzt die gebrochene Masse langsam hinab, und sodann fließt sie: eine wundervolle Cascade von glänzendem Silberstaub ( S. 66) wirft sich in hohem Wirbel hinaus. 21 Die Klumpen der Grundlawinen keilen sich beim Anprall unten im Tale zusammen und vereisen augenblicklich durch den gewaltigen Druck. 22 Die Flocken der Staublawine dagegen stị̈ị̈ben und deuten mit der Gewalt ihrer Zerstäubung auf kalten Nordwind, welcher in der Höhe im Spi̦i̦l ist. Der Staub der Wätterlouine n kann eine Stunde weit an die Fenster der Wohnungen prallen, der Luftdruck kann Scheiben zertrümmern und mächtige Tore zuschmettern.
Der Lawinenreichtum unserer Talschaft spiegelt sich wenigstens einigermaßen in den Eigennamen der Züge ab, welche die Schnee- und Eis- oder auch Felsstürze gewöhnlich, wenn auch zuweilen erst nach Jahrzehnten wieder neu, ausfegen und darum nach sich benennen.
Da haben wir als Nachbarin des «wildlieblichen» 23 Alpentals Rose nloui: d’s Ganze nlouinen am Schwarzwald, und ebenfalls am Wetterhorn die Gu̦tz- und Wätterlouina. Ebendort heißt ze’ n ’brŏchchete n Schneewwen eine lawinenreiche Stelle. «Zwisse n Louenen» und «an der Louenen» 24 gemahnt an Ortschaften wie (an der) Lauenen bei Saanen, oder auch an das uralte 25 Dörfchen Sundlauenen, dessen geographisch gefestigte Form einen Grindelwaldner Schriftgelehrten zu der Reklamation veranlaßte: warum sä̆gid ie̥r jetze Sungglouinen un d nid Sundlouinen? 26 (Alte Formen lauten wirklich «Sunglaueln» und « Sunglaun villa». 27 ) Besonders jedoch ist hier abermals Burglauenen im weitern Sinn (als Schulkreis) 69 und im engern (mit Ausschluß von Tschingelberg links der Lütschine) zu nennen. Die «Lauenen» sind hier als die Felstrümmer der «Burg» zu verstehen, welche das vormalige Schillingsdorf zerstörten. Es gibt ferner ein Loue̥lli, 28 eine Louine nweid 29 und ein Louischị̈ị̈rli. 30 «Im lẹnge n Zụụg» heißt ein Strich, der vom obern Gletscher über die Halsegg herein an den Mettenberg reicht. Am letztern ziehen sich auch hinunter: die zwei Schmallouinen. (Vergl. die «Schmalloui» im Urbachtal.) Westlich von ihnen streicht von der giebelartig aufgesetzten Spitze des Mettenbergs bis zu dessen Fuß herab, den Berg halbierend, die Breitlouina. (So heißt auch eine Station der Schynigenplatte-Bahn; vergl. die Guttannen-Spreitloui.) Es folgt die Doppelreihe der Lawinenzüge, welche die ehemalige oder noch wirkliche Zunge des untern Gletschers speisen. Von der Widderbodmi herunter streicht gegen das Chalet Inäbnit (Marmorbruch) die Toldislouina. Es folgen südwärts die Fliëlouina und die Hëëje nfliëlouina. Von der Hohturnenlamm herab fegt die Stä̆glouina am Bäreggweg. Mit diesen, sowie den Hohturne n-, Chessibach-, Mëder- und Brunnhore nlouinen sind die Schneestürze am Mettenberg keineswegs erschöpft; vielmehr scheint dieser zu gewissen Zeiten sich in unzählbare Lawinen auflösen zu wollen. Zwischen den Hïre̥llinen und dem turmartigen Felsengerüst des Wildschlosses hervor donnert die Schloß- oder Bohne̥rre nlouina zuweilen in majestätischen Cascaden über abschüssige Kalkplatten auf den Austritt des untern Gletschers aus dem Eismeer herunter. Weniger häufig nennt man die zwischen Wildschloß und Challi sich lösende Denndlerlouina; um so häufiger die Schï̦ssellouina. In genauerer Rede ist letzterer die Sturzrinne, durch welche jene von der Nordseite der Hïre̥llinen in das Sammelbecken der Schï̦̆ßle n (Schüssel) fällt. Bei sehr viel Schnee aber überspringt der Sturz diesen Ruhepunkt und fällt mit gewaltigem Krachen gleich auf’s Niveau der Lütschine herab. Dann heißt’s auch da, wo man sonst der Louine n si ch nịịd meh achted: aha, d’Schï̦̆ßle̥rra chund! Es folgt westwärts die Häusergruppe Ällouinen 31 (vergl. «Walter zu Ellowinen» 1400) 32 mit dem Ällouinenbach. Vom Männlichen herunter fällt die Buechiwangloui, sowie jenseits die Tu̦plouina, wie früher 33 der Männlichen selber hieß. Als Grenze zwischen Grindelwald (Tschingelberg) und Lütschental fällt der Horlouigrăben hinunter.
Sein westlicher Nachbar ist die «Ahorne nwangloui», welche das Unglück von 1905 ( S. 71) angerichtet hat und damit in unserem Abschnitt 70 die Reihe der in ungewohnter Richtung eingeschlagenen, 34 darum oft verheerenden Lawinenzüge eröffnet. Solche «Tücke» erklärt sich daraus, daß bei häufig sich folgenden Stürzen ein neuer die gewohnte Bahn gesperrt findet. Dadurch werden Straßen und Bahnen verlouined, 35 Flüsse gestaut und flache Gelände unter Wasser gesetzt. Wälder müssen als Schlachtfelder 36 herhalten. Entweder werden sie fortgerissen, wie 1780 durch eine Grundlawine, welche von der obern Sulz bis über den Judenwang hinaufschlug; oder sie werden, wie am 11. Dezember 1809, durch den Luftdruck einer Staublawine teils entwurzelt, teils umgedrückt. 37 Großer Waldschaden entsteht auch durch Verbreiterung oder Verlängerung bestehender Louigassen. Welch Unheil erst, das Gebäuden, Tieren, Menschen droht!
Mit Besorgnis sagt daher der Erfahrne, wenn der ni̦w Schnee tued ab dem alten abschießen und der alt herta, der ni̦w pflătschiga ist: e̥s ist jetz g’fährli ch fị̈r D’Loueni! (Es ist Gefahr da, daß Lawinen, und zwar verheerende, kommen.) Und manch ein Mütterchen betet laut, und mancher wetterharte Mann spricht es im Herzen nach:
Der Herr im Himmel iis bewahr
Vor Steischlag u vor Louig’fahr!
Daß Lauterbrunnern grade zur Heuerntezeit der «Höwhund» die Wiesen verheeren kann, und daß sehr häufig im jungen Waldaufwuchs eine Lawine hier grotzned oder Grotzle̥ni abrị̈ehrd, dort chlịịnni Tschụgge̥rleni abrị̈ehrd, dessen versieht man sich alle Jahre. Seltener und dafür schreckhafter ist es, wenn die Lawine e̥s Hụụs zerstooßd und die Trümmer ineinander gï̦ï̦rted (in einen wirren Haufen zusammenwirft). Noch steht in frischem Angedenken die Zerstörung des Berggasthauses auf Bäregg am 4. März 1906, wo die Mĕder-, Stä̆g- und Toldislauenen in schauerlich schönem Schauspiel ihre Kräfte maßen. Nicht geringer war der Schaden, von welchem die Aufschrift an einem Speicher im Hŏhle nwang Kunde gibt: «Im 1739 jar das bei Louina zwelf Spichera nam. Walthard Bohren und Els-beth Inäbnit. Jar 1739.» Daß auch andere Speicher und Scheunen, sowie Weidhütten und Alphütten «samt Keßeni und andrem alpzeig» in großer Zahl zerstört wurden, meldet die Chronik zwischen 1610 und 1905 nicht weniger als zehnmal. Alles ist freilich wenig gegen das Lawinenunheil, welches 1808 im ganzen Oberland und Urnerland wütete und Obermaad bei Gadmen zerstörte. 38 Wie häufig ist aber auch unter dem Weidevieh und sonderlich und’r de n 71 Schaaffen ne n Louina zwä̆ggangen! Ganze Scharen wurden weggerafft; so 1750 am Wetterhorn 80, 1827 bei Biel (Wallis) 93, 1878 am Eiger 50 Tiere. Von verschütteten Grindelwaldner Hirten vernehmen wir viermal, von einem Gemsjäger einmal (1861); aber neun Grindelwaldner Hausbewohner miteinander forderte das Unglücksjahr 1808. Den Kopf eines Jünglings schleuderte eine Lawine zwanzig Schritte vom Rumpfe weg. Die letzte traurige Erinnerung dieser Art knüpft sich an den 22. Mai 1906, den Unglückstag der Familie Burgener in Mättenbärg.
Zum Glücke kommen auch wunderbare Rettungen vor. Unmittelbar über dem Haus in der Toldislouenen hielt am 20. März 1907 die gleichbenannte Lawine still. Einer, welchen d’Louina dahaar g’rïehrd g’hä̆ben heed, konnte sich 1572 retten, indem er mid dem Hĕgel ụụf- un d abg’hĕgled heed. Ein Begleiter Hugis, der Bohnerenhirt Roth, welcher zweimal nacheinander i n d’Louina choon ist, arbeitete sich mit unermüdeter Geistesgegenwart heraus, kletterte ungesäumt wieder bergan und half rüstig seinen erstaunten Brüdern die versprengten Schafe suchen. 39 Ähnliche Geistesgegenwart bewies der Bergführer von Almen im Lütschental. Ihm riß kurz nach der Mitternacht des 18./19. März 1905 die von der Rittenfelswand am Männlichen zwägbrochni Ahore nwangloui das Wohngebäude von der unversehrt bleibenden Scheune weg. Es wurde gänzlich under g’machd und ịị nbsetzd (zerstört und mit Trümmern bedeckt). In der Höhe liegendes Windfallholz hatte den gewöhnlichen und schadlosen Louizụụg versperrt. Die gegen das Häuschen abgelenkte Loui (wie man im Lütschental noch heute meistens sagt) grub den Hausbrunnen ab und gab gerade damit dem krank liegenden und auf Tee wartenden Hausvater ein paar Sekunden Frist zu der Überlegung: Also kommt die Lawine diesmal über uns. Rasch auf! Geweckt erst den ältesten Sohn im Hinterstübchen, dann mit seiner Hülfe die übrigen Kinder bis hinab zum zweijährigen oben in der Loïben (Obergemach) und unten in der Stube! Alle in Reih und Glied an die Wand gestellt, um in der Finsternis — denn schon hatte der Luftstoß die Lampe gelöscht — nach allen tasten zu können! Da kracht’s. Vornüber stürzt das Haus, die Fenster splittern, die Decke bricht herab, Ofen und Ofenwand poltern. Alles in einem Augenblick, und Totenstille herrscht. Da ruft der Vater Namen um Namen ab, und alle geben Antwort! Auch die Mutter, welche vom einstürzenden obren Soller 72 (Zimmerdecke) schwer, doch nicht gerährlich getroffen worden; auch das eingeklemmte, aber unversehrt gebliebene Bübchen.
So hatte schon 1881 gegenüber im Tal ein Bergsturz ein Haus zertrümmert, die neunköpfige Familie verschont. 40
Nur teilweise entrannen die Betroffenen der Katastrophe, welche zu unbekannter Zeit Ällauenen verheerte und derjenigen, welche am Abend des 12. Dezember 1808 die drei Häuser der Schärmatten über Burglauenen wegfegte. Heinrich Rubi hütete die sechs Kleinen seines Bruders, der dran war, vom Sengg her Vieh zur Winterung in das Braawimaad zu führen. Plötzlich flog, durch einen Schneesturz von Winteregg und Burghoren getroffen, das Haus samt Insaßen dreihundert Schritte weit, einige Trümmer noch siebenhundert Schritte tiefer. Der Oheim, rasch wieder zur Besinnung gelangt, tappt im Schnee umher, erwischt hier ein Bein, dort einen Arm und verbringt alle sechs Kinder für die kalte Nacht in einem Strewwichromen. 41
Was läßt sich tun, um solch schrecklichen Katastrophen vorzubeugen? Die Lawinen zum verfrühten (abortiven) Absturz veranlassen zu wollen, 42 wäre vorderhand ein aussichtsloses Unternehmen. Praktischer sind die «Pfịịl» des Simmentals, 43 das «G’mụ̈ụ̈r» des Wallis, 44 besonders aber die Pfahlreihen aus Holz oder Eisen, die hölzernen Schneebrücken, die Schneemauern und Terassierungen. Solche großartige und wirksarme Verbauungen werden oft auf größern Flächen im obersten Anbruchgebiet der Lawinen mit vielen Kosten — unter eidgenössischer und kantonaler Hülfe — errichtet. In Verbindung damit werden die obersten Baum- und Strauchbestände sorgfältig geschont und durch Schutzwaldungen aus Legföhren, Trooslen (Alpenerlen), Arven vermehrt. Bannwald im alten Sinne kennt man nicht mehr. Anstatt der in ihnen gehandhabten Axt wird nun die Sense des Wildheuers und der Zahn des Trị̈echts (der Ziegen und Schafe) von all den Stellen energisch ferngehalten, wo ein widerstandsfähiger, ausdauernder und sich selbst allmählig verjüngender Holzwuchs das erste Abgleiten des Schnees zu verhindern vermag.
1
Str. BO. 77.
2
Bei
Rebmann (158), Altmann (85),
Gruner (1, 74) auch durch geführten.
3
Rebm. 490.
4
Alte Geschichte.
5
Graff. 2, 297.
6
Ebd. 296.
7
Wie schon Scherz’ Glossarium 885 ableitete.
8
Graff. 2, 294.
9
Kluge 229.
10
Wyß 687;
Brückn. 541. Adelungs Ableitung aus lat.
labi (gleiten) paßt bloß zu
labina, rätisch und tessinisch
lavina, lavigne und neudeutschem «Lawine».
10a
Wyß 687.
10b
Gatschet 63.
11
Kasth. 23, 43.
12
Ebd. B. 63 ff.
13
Vgl. ebd. 2, 135.
14
Berner Volksfreund 1899, 61.
15
Jeweils. Bernisches
alben und
albeds, zürcherisches «amig» und «amigs», baslerisches «als» ... vereinigen sich in «allmals».
16
Tschudi 946.
17
Ebd. 204 f.
18
Stumpf 285.
19
Brückn. 242;
Heß 303. Ähnlich der Weißhorngletscher-Einsturz auf Randa:
Naturw. 1820, 62-64. 69.
19a
Cool. JS. CXXL f.;
Stumpf 672 (1606).
20
Gruner.
21
Brückn. 241;
Stud. P. 196;
BOB. 88;
Wanderb. 211-14, 99.
22
Brückn. 242.
23
So
Roth 115 mit glücklichem Ersatz für das abgedroschene «romantisch».
24
C 3.
25
Dumermuth.
26
Rebm. 476.
27
Schöpf 1, 117.
28
C 4.
29
C 4.
30
C 4.
31
F 4.
32
Reg. 82.
33
Spruchbrief von 1393.
34
Tschudi 205.
35
«Verlouwinet»: Ämterbücher Interlaken A 39.
36
Berlepsch 80.
37
Nicht «geköpft» (
König 35.)
38
GlM. 177 f.;
AR. 1814, 260.
39
Hugi, Alpenreise 214;
Stud. P. 210.
40
Nach
Straßers Hülferuf in eigener Broschüre und im
EvG.
41
Wyß 433-5;
GlM. 178.
42
Alpina 1906.
43
Kasth. AR. 1816, 198.
44
Goms 48.
Durch Lawinen erfährt die Hälfte des Hochgebirgsschnees ihre Abfuhr. 1 So viel entziehen jene dem Föhn und der Sonne, um in einem der schönsten Schauspiele dem scheidenden weißen Mann einen «großen 73 Abgang» zu bereiten. Eigenartig schön aber ist, wie sein Gehen, auch sein Kommen: sein allmähliches Sichherunterlassen von Berg zu Tal. Ein Blick aus der Höhe hinüber nach dem Silberhŏren! nach dem Schneehŏren und auf den «Heigers Schneebärg» der alten Geographie ( S. 4), auf die Kappe des «Weißmönchs» und nach dem Scheitel des wịịßen Eiger! Nun nach dem Grat hinüber, ä̆ned dessen das «Hasle im Weißland» ebenfalls zu den blinkenden Zinnen seiner Randgebirge aufschaut. Wohl, nun wird auch das Tal sein winterliches Geschenk empfangen: der Wịịß wollt zue n ï̦s z’Dorf choon!
Und er kommt — e̥s schnịjd! In großen Flocken, in Schneefleïgen schwebt es hernieder, ja e̥s schnịjd Wäschtị̈eher! Millionen weißer Täubchen kommen, sagt etwa der Städter. Der Älpler wird eher an die Bänzen («Schäfchen») der Distelköpfe erinnert, welche beim Fliegenlassen ihrer Samenträger de n Schnee abschï̦tten oder si ch flĭ̦de̥rren und damit auf Spätschnee deuten: aha, e̥s wollt aber no ch chon ga n shnịjen! Wer weiß, ob wir nicht, wie im Herbst 1905, vor der Zeit die Alp verlassen müssen, wịịl’s abschnịjd!
Lieber sieht auch der Bergbewohner nach einem so schönen Herbste wie dem von 1906 gleich einen tüchtigen November- oder Dezemberschnee, der liegen bleibt. Welch ein Schauspiel, ein solch ruhiges schnịje n schë̆ë̆n grad ăha während eines ganzen Tages! Ein Schneefall, dessen Reichtum Gewähr bietet, daß er nun den ganzen Winter auch im Tale hafte, daß es also ịị nschnịjd. Da weiß mu̦ doch ẹntlige n, waraa n mŭ̦ ist! und Groß und Klein freut sich der ersehnten Gabe. Voll zierlichen Übermuts haschen und schnappen Mädchen auf dem Schulweg mit spielend geöffnetem Mund nach Flocken, wie die so bezaubernd unverbildet gebliebene Patrizierstochter «Räge ntropfe n chü̦̆stet». 2 Die Buben, nachdem sie nach Herzenslust im weichen Bette si ch g’wăled hein u nd trooled sịịn, schon um dem Alltagsgewand eine langentbehrte wohltätige Säuberung angedeihen zu lassen, machen sich an den ersten Schneemaan. Chŏhlen markieren Augen und Rockknöpfe, die Linke trägt einen Rechen, und drollig sitzt auf dem ungeschlachten Kopf das zierliche alte Kinderhütchen. Unwillkürlich erwecken diese elementaren Kunstübungen den lebhaften Wunsch, sie möchten, gleichwie 1906/7 im größten Dorf der Welt, fortan auch im Schnitzlerdorf Grindelwald unter der Schuljugend ernsthaft planmäßig fortgesetzt werden. Welch danktbare Objekte für das Modellieren im Schnee, diesem bildsamsten aller Gesteine, bieten vor allem die Berge und Täler Grindelwalds, die Gegenstände der physikalischen Geographie überhaupt! Der Hauptmann von Köpenik, 74 der Skifahrer u. s. w. könnten dann einen belustigenden Abschluß solcher Studien im Freien abgeben.
Nicht achten die Jungen der Schneebälle, die an ihren Köpfen vorüberfliegen, bis auf die zweite, dritte Herausforderung hin der Fehdehandschuh aufgehoben wird. Die Schlacht beginnt — wie lustig schneewed es sich im dichten Hagel der blitzschnell geformten Geschosse! Lange schwankt unentschieden das Siegesglück, bis das Zünglein der Waage sich zu Ungunsten der Angreifer neigt. Sie kapitulieren und müssen eine tüchtige Wësch (s̆s̆) über sich ergehen lassen. Das Chohl, welches nicht an den Schneemann verwendet worden, reicht eben aus, um erst mit ihm und dann mit Schnee eine richtige Mohrenwäsche anzustellen. Da schlägt die Schulstunde. Schleunig bu̦tzd ei’s d’s andra ab und ruft: eh, wie bist du schneewiga! Eh du schneewigi Hu̦tta! Eh du schneewigs Meitschi!
Wer weiß, wie bald das schneewen umhi so schë̆ë̆n geid! Jetzt war die zarte Masse ballig, wie sie auch schmiegsam dem Fußtritte nachgab und die Schuhnägel «im Negativ» sehen ließ: der Schnee war trättiga. In wenig Stunden aber macht er sich bereits unangenehm; er bildet Klumpen, Stollen (unterbernisch: Stŏglen) an den Absätzen der Schuhe: e̥r tued si ch stollen. In warmer Sonne durchsetzt er sich stark mit Schmelzwasser, bis er sein Vierzehnfaches desselben aufgenommen hat. So wird er plŭ̦driga; es gi bd e̥s Schneeplŭ̦der, e̥s grị̈ị̈sli chß Pflatsch! Der erste starke Kälterückfall hinwieder macht die Schneedecke glänzend hart: herti wie n en Gletscher, so daß sie Roß und Reiter trägt. Bei geringerer Kälte aber vermag sie nicht einmal den Menschen zu tragen, so daß dieser bis zu äußerster Ermüdung Schritt für Schritt einsinkt. Der Schnee ist alsdann g’graifte̥ta oder g’grụ̆ste̥ta: er trägt einen Rajft oder eine Gru̦sta, er ist chächcha, ist uberschŏßna. Er weist dann die feinen Eisnadeln auf, welche im Fallen bei Windstille sich leicht zu Sternchen vereinigen, bei Windzug aber zu Stoibschnee zerfallen. In dieser Gestalt schnịjd es auf Höhen wie dem Faulhorn, während es im Tale kalt regnet. Solch bulvriga Schnee ist die Wonne des Skifahrers; und wie freut er sich, wenn eine noch so dünne Schicht Schneestoib ihm auch den Talschnee überdeckt! Allein bald hapert es wieder, wenn die eindringende Sonne die Masse krümlig macht, so daß sie nach jeder Furchung sofort wieder in sich zusammensinkt. Dann ist der Schnee trë̆ë̆liga, oder er ist g’gŭ̦xe̥ta. Ein leiser, trockener Wind, dessen stärkere Grade den Namen Gu̦xfëhnd tragen, ist im Begleit eines Gu̦xwolhen 3 hergefahren 75 und hat dem Schnee das Aussehen einer ausgeschütteten Masse von Salzkörnern erteilt. Derselbe verweht auch immer wieder die in den Schnee getretenen Spuren: vergu̦xed oder ubergu̦xed sie. Auch läßt er jeden neuen Versuch zu schneien nur halb gelingen. Er verwandelt den ruhigen Schneefall in ein Schneegestöber: in einen Gu̦x 4 oder eine Gu̦xa. Solche sieht man schon aus weiter Ferne herannahen: es rị̈ehrd en Gu̦xa dahaar! So konnte denn auch in der Cronegg 5 z. B. der Februar 1889, welcher viel Schnee und Regen und Wind in unanmutiger Mischung brachte, ein Gu̦xi heißen. Bei den eigenartigen Windverhältnissen Grindelwalds hat hier der Name «Gux» den Begriff des furchtbaren Schneesturms, 6 der ihm im Oberhasli und anderwärts dem Sachverhalt gemäß anhaftet, verloren. Es kann in Grindelwald auch nur bei mäßigem, ja schwachem Wind gu̦xen, wenn es trocken körnig und dabei so spärlich schneit, daß man sagt: es gi bd nu̦mmḁn ḁsó e n toibi Gu̦xa! oder: es tued ni̦d rächt schnịjen, es tued nummḁn ḁsó umha gï̦xlen! Auch das unsichere Schwanken zwischen regnen und schneien, selbst ein solches zwischen Niederschlag und schönem Wetter ist ein gu̦xen, gegen welches sich nach englischem Muster nun mehr und mehr auch einheimische Frauen und Mädchen mittelst Guxchappe n schützen.
Ein stärkerer Grad des Gu̦x heißt die Schneefị̈ehri. Die Fị̈ehri für sich bedeutet eine umständliche Veranstaltung irgend eines Unternehmens mit unverhältnismäßig großem Aufwand an Zeit, Mühe und Aufsehen. In diesem Sinn sagt man: e n Fị̈ehri haan, e n Fị̈ehri aa nreisen, wohl auch: e̥s Zaagg aa nreisen. Das Verdrießliche der Schneefị̈ehri nun macht sich insbesondere während der Alpzeit geltend, wo unzeitiger Schneefall zur Talfahrt zwingt. In der Schneefị̈ehri ab mị̈eßen (abfahren müssen), wie z. B. am 2. Juli 1907, ist eine der Bitternisse des so vielgepriesenen Älperlebens.
Wenn es spärlich oder zart schnịjd, so sagt man auch: es feiserled; und ein geläufiger Reim des Unterlandes bekommt in Grindelwald die Wendung mit dem nicht ganz einwandfreien Reim:
We’s numme nid rägned, we’s numme nid schnijd,
We’s grad aso feiserled, so machd es is niid.
In so vielen «Tonarten» sieht’s der Alpenbewohner schneien. Und senkt sich nun das eine weiße Gewand von den Gipfeln und Berglehnen auf die Talsohle herunter: welch, ein Anblick! Grindelwald im Schnee daliegend und obendrein vom Mond beleuchtet: das ist eine Szenerie, 76 welche weder Worte noch Farben wiedergeben können. Es gibt nur ein seliges Sichvergessen in dieser Ruhe, so feierlich und lieblich zugleich. Welch ein Zauber liegt über diesem durch und durch gleichartig reinen Weiß, abgetönt durch die leisen Schatten halberkannter Gegenstände. Am Sonnentag dann aber dieses Spiel der Gegensätze! Haarscharf geschnitten heben sich auf dem glitzernden Weiß die kohlschwarzen Schatten ab, welche Bäume, Hecken, wandelnde Menschen werfen. Im Bergwald aber unterbricht das tausendfach gegliederte Weiß das dunkle Grün der Nadeln und das Grauschwarz der Stämme. Und diese wieder bieten mit der Mächtigkeit ihrer Kronen, die sich unter der schweigend getragenen Last niederbeugen, einen wirkungsvollen Kontrast. Über und über ịị ngschnịjds, breitet sich zu des Waldes Füßen das ebene Feld. Allein hier wechselt mit dem fahlen Weiß als Grundfarbe das Flimmern und Funkeln, das ruhige Strahlen und das Blitzen der Millionen Kristalle, der immer von neuer Seite beschienenen Diamanten.
Hätte nur nicht auch diese Freude des Naturgenusses ihre Kehrseite an der schlimmen Alltagssorge! Deren aber bringen Zeitpunkt, Zeitdauer und Ausmaß des Schneefalls zur Genüge.
Als Norm der Schneefalltage können folgende Zahlen für die Winterhalbjahre 1901/02 bis 1903/04 gelten:
| Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | April | Mai | |
| 1901/02: | 4 | 4 | 2 | 11 | ? | 1 | 10 |
| 1902/03: | 1 | 12 | 7 | 6 | 11 | 17 | 3 |
| 1903/04: | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 |
| (Trachselwald 1764/65: | 5 | 1 | 4 | 1) | |||
Wie viele Jahre aber gibt es, wo der Winter höchst eigenmächtig uber d’Schnuer haud! Für Berg und Tal gilt der Satz: Z’Grindelwald cha nn’s je gl iha Maanend schnịjen. Für Höhen über 3300 Meter, wo aller überhaupt noch vorhandene Dunst sich bloß in fester Form niederschlagen kann, 7 und für die Mittelalpen, wo 40-70% aller Niederschläge als Schnee fallen, 8 findet man das selbstverständlich in der Ordnung. Um so ungemütlicher sind die Überraschungen eines u nzịịtige n Schnee’s oder auch nur Schneewli’s auf jeder Alpweide, die höher als 1600 Meter liegt. 9 Versetzen wir uns in die Lage des armen Weideviehs! Die Kühe flüchten, Schutz und Futter zugleich suchend, nach dem Wald, mit jedem Tritte tief einsinkend; Schafe gehen bis auf acht und mehr Tage, ja vielleicht ganz unauffindbar verloren. Im Tale aber g’frëërd der unzeitige Schnee die Obstblüte, zerreißt die Baumäste und entmutigt manchen Anfänger in der edlen Obstkultur. 77 Die überschneiten Kartoffelfelder können, wie 1905, nicht abgeerntet werden, das Emd kann nicht besorgt, vielleicht nicht einmal gemäht werden: es erfụụled a’ n Schöchnen old an der Wï̦rzen. Es dient dann, etwa noch im Winter eingeheimst, höchstens als Streuwwi für das Vieh.
Wie erst, wenn es bereits zu Anfang Oktober an der Lütschine z’säme nschnịjd, so daß der ganze Talgrund éine Schneedecke bildet! Wenn dann wegen Lawinengefahr auch an Alpentladung nicht gedacht werden darf und beherzte Männer es wagen müssen, das notwendigste Futter uf d’Alp uehi z’bu̦gglen!
Sehr unliebsam verzögert hinwieder Frühschnee die Alpfahrt. Zur «Tagesordnung» gehören natürlich der Merze nschnee und der Abe̥relle nschnee. Ja, man ist’s gewohnt, daß, we nn’s am alte n Mătịịs (24. März) schnịjd, es denn no ch sị̆benu ndtrịịß’g Mal dḁrnaa ch schnịjd. Auch ist ja Abe̥relle nschnee besser wan Geismist oder so gued wie Schaafmist; jedenfalls ist er der arme n Lịịte n Bu̦w. We nn’s spaat schnịjd, su̦ tued’s den arme n Lị̈ị̈te n d’s Land bu̦wwen. Schnee dagegen, der die Alpzeit verderbt, kann durch keinen noch so liechta (milden) Winter wett gemacht werden, und es bedarf des ganzen reichen Oberländerhumors, um über solch ein verpfuscht’s Jahr hinüber zu kommen. In solchem Humor — erzählen die Grindelwaldner über einander — suchen sie die notwendig gewordene Talfahrt wie folgt zu umgehen. Sie nää n scharpf 10 Milch, su̦u̦ffe n Schlu̦ck, 11 ässen Ṇịidla, stelle n si ch im Mälchhụụs uụf̣, wa’s hilw ist, u nd sääge n: jetz hed’s g’warmed, mier manglen ṇịid ahi. Dem Welt- und Geschichtskundigen bleibt überdies der Hŭ̦deltrost, es sei andern und sogar Bevorzugtern auch schlecht gegangen. Dieser Trost kleidet sich in die Redensart: e̥s hed ei nmḁl dem Nachbụụr o ch g’hăgled.
Zahlenmäßige Verzeichnungen 12 und Berechnungen 13 von Schneezeiten und Schneefallhöhen ersetzt sich begreiflich die Umgangssprache durch einfachere, mehr summarische Angaben. Ist nur so wenig Schnee gefallen, daß sich eben noch durch ihn hindurch Fußspuren auf dem Boden abdrücken, so spricht man von einem Gị̈̆ferli. (Anderwärts im Oberland sagt man «das Bị̈fer» und versteht darunter auch selbstgeronnene Milch. 14 ) Man sagt wohl auch: Es hed nummḁn ḁ’ lsó e̥s Chatze nträ̆bel gschnịjd. Das Trä̆bel für sich ist ein Gemenge von Fußspuren. Im Sinne einer bestimmten Fußspur, welche sonst Treib heißt, 78 (vgl. S. 80) braucht man die Redensart i n d’s Trä̆bel choon (oder z’Wääg choon) für das Zurückkommen auf den eigentlichen Gegenstand einer Verhandlung. Der Oberländer denkt dabei an das träppe̥llen in kurzen, kleinen Schrittchen, obschon «traben» formell näher liegt. (Genauer, dann aber pedantisch, schrieben wir «das ’Träbel», weil es als «Geträ̆bel» zu deuten ist.) Statt von «Chatze nträbel» zu sprechen, spaßt man wohl auch: Më̆ge n d’Chatzi no ch dḁrdï̦ï̦r ch? Eine um’s merken tiefere Schneelage heißt schon e̥s Gịịfer, und man sagt: e̥s ist grăd ḁ lsó ubergrääwd’s. (Nicht allgemein grindelwaldnisch ist e̥s Gịịmerli für eine etwa zollhohe Lage.) Man hat dann bald einmal zu besorgen, daß ’s ei’m uber d’Schueh inha ghịjd, wenn auch d’Achcherstu̦ffla (Getreidestoppeln) «noch obenaus sehen». Hat es aber einen Pätsch oder «ein Flatz» 15 oder e n Last, ja ganz Läst 16 a’schnịjd, so ist es Zeit, seinen Anzug danach zu richten. Denn bald wird einem der Schnee a n d’Chnewsrădi (Kniekehlen) uehi gaan. Noch höher reicht en Uberstrumpfe̥ta oder gar e n Chnewwe̥ta. Steckt man aber einmal bis under d’Uox (das Uox ist die Achselhöhle) im Schnee, dann ist es wenigstens für die Sprache nicht mehr weit bis zur Hyperbel, die auch in Grindelwald den (doch ansehnlichen neuen) Kirchturm ins Spiel zu ziehen liebt. Man sagt hier: Der Sï̦̆ge̥rist mues de n Chilchtu̦re̥ m mid dem Hewrächche n suehen, wen n er lị̈ị̈te n wollt.
Hat es gleed (in rascher Folge wiederholt) «ein großa schne geschneit» oder «geschniet», so türmt sich derselbe an windigen Stellen zu ansehnlichen «Schneeschilten» auf. Der unterbernische Name dafür ist «die Wäächte n», der grindelwaldnische: die Gg’wäächta. Bisweilen sind solche Gg’wäächti ständiger Art, wie die, welche der Eigerspitze allwinterlich ihre drollige Zipfelmütze aufsetzt. 17 Eine zirka drei Meter lange Schneegwächte bildet den höchsten Punkt des kleinen Viescherhorns; sie ruht auf dem senkrecht gegen Grindelwald abfallenden Felsen. 18 Eine «überwächtete» Bergspitze 19 ist das Ggwäächtenhŏren oder die Ggwäächta (3169 m) mit dem Gwäächte njooch (3159 m) 20 in der Schreckhorngruppe.
Aber auch die gleichmäßiger verteilte Landschaftsdecke kann bei anhaltend ruhigem Schneefall erstaunlich rasch zu einer Höhe anwachsen, welche Felsformen, Bachbetten, Büsche in große, allgemeine Wellenformen einhüllt und die Individualität der Einzelgebilde auflöst. So bleibt der Anblick der obersten Hochgipfel. Wie manche noch der schlanken Felsennadeln 79 würden wir das Gebirge charakterisieren sehen, wenn nicht der ewige Schnee sie verhüllte! 21 Drum der überraschende Anblick der Jungfrau im August. Umgekehrt «kennt die Stätte der Menschen nicht mehr,» wer als Neuling einen Sommer lang in fernem, gastlichem Hause verkehrt hat und es im tiefen Winter erstmals wieder aufsucht. Welch ein Unterschied zwischen dem hundertgestaltigen grünen Rasenteppich und dem einförmigen weißen Linnen!
Schlimmer ist, wenn der Älpler zur Zeit der Alpfẹrt seine Hütte nicht mehr erkennt. Wie manches Gebäude schon hat der Schneedruck verchrụụted, z’sämeg’ritten! Im Januar und Februar 1844 wurden zu Ịịschboden «drei Scheureni verherget», 1809 und 1812 auf den Mürrenbergen alle Hütten eingedrückt. Das Dach des ersten Faulhorngasthauses wurde gleich im ersten Winter 1830/31 aus den Fugen gerissen. 22 Kein Älpler, auch kein Besitzer der neuen Boßhütten wird daher vor seiner Abfahrt unterlassen, das dem Winter überantwortete «Gehalt» durch starke Spẹrzla aus jungen Tannstämmen unter den Rasen und unter der First (dem Firstbalken) zu stützen.
Sind aber die Gefahren des Winters ferngeblieben: welchen Segen dann auch spendet der Schnee dem Gebirge! Man denke an den der Luft entzogenen und den Pflanzen zugeführten Ammoniak 23 und andern Nährstoffen. 24
Wunderbar fristet das Leben in hohen Regionen, mit Hunger und Tod siegreich ringend, auch ein Teil der Tierwelt, dessen Namen schon mit «Schnee» verknüpft sind. Wir gedenken des lieblichen Schneefinks, der gesellig da zu finden ist, wo der ewige Schnee beginnt. 25 Wir nennen die geduldig freundliche Schneehenna, welche, weißer noch als der Schnee, sich in ihm verbirgt und, der Schneeschmelze folgend, immer höher steigt. 26 Wir erinnern an die Schneemụụs und den Schneehaas.
Wie aber findet sich der Mensch zurecht, wenn der Schnee uber all Zị̈ị̈n und Heeg ụụs geid! Noch im April, im Mai schreitet ein einsamer Fremdling über Alphütten dahin ohne Ahnung, daß hier in Bälde Menschen hantieren, Brunnen sprudeln, Tiere sich zum Melken einstellen, Glocken klingen werden. Wo nicht aufgepflanzte Stangi, buschige Grotzle̥ni, lange Rueti dem Wanderer oder bereits dem Schneebrecher die Richtung weisen, kann der Neuling verloren gehen. 27
80 Anders freilich der trainierte und ausgerüstete Alpenwanderer ( S. 27 ff.). Ihm dient zu Nutz und Sport auch der kahnartige Schịị, welcher freilich heute keine Auszeichnung des Alpenbewohners, noch gar des männlichen Geschlechts, noch auch der Erwachsenen mehr ist. Wer schịịen will und über keinen Näppel oder Napolion (Zwanzigfrankenstück) für ein Paar wenigstens halbechte Schịị (Schier) «aus Bergeschenholz» verfügt, der weiß sich sonst zu helfen. Ein Paar Dauben (Einzahl: die Du̦wwa, Faßdu̦wwa) eines ausgemusterten Fäßchens tụụre n ’s o ch no ch zĭ̦mli ch lang. Statt des schwer aufzutreibenden Wachses — Wăx — kann dann einfach Seiffa genommen werden, um die Unterfläche z’waxen, damit während des Dauerlaufes der Schnee si ch nid a nschlaaj. Ja, wie es für den Neukantianer eine Psychologie ohne Seele gibt, so gibt es für Grindelwaldner Knaben und Mädchen, die noch lange nicht zur Schule gehen, ein schịịen ohni Schịị. Denn das schụụren (glitschen auf dem Eis mit bloßen Schuhen) heißt nun seit 1904 in einwandfreier Sportgemäßheit ebenfalls schịịen. So verkündet dir triumphierend der Mund voll elfenbeinerner Zähne und das rabenschwarze Auge einer noch ganz kleinen Mühlebacherin. Und das Händchen weist energisch auf die Trăß ( trace) hin, welche über das meterbreite Straßenbord hinunter wenigstens vorläufig angedeutet ist — als Prototyp einer gut englischen Rennbahn, eines noch besser angelsächsischen spurt. Aber nicht lang hat die Kleine Zeit zur Auskunft; denn sie steckt grade mitten in einer großen, selbstgestellten Aufgabe. Die besteht darin, en Hăsler z’nään. Das ist ein Anlauf, welcher dazu hilft, über den Sprung zu kommen. Der Sprung ist nämlich in der Sportsprache erst in zweiter Linie der Flug durch die Luft. Zunächst ist er die mitten in der Trăß eigens aufgetürmte Schneemasse, die wie ein guter emmentalischer Brü̦ggstock 28 mit der Anlaufseite eben verläuft, auf der Gegenseite aber sẹnkelgraad abstürzt, um mit seiner Höhe die Länge des Luftsprunges zu bestimmen: zweiunddreißig Meter bei dem Telemarkerschwung der Norweger Leif Berg und Torleif Björnstad.

Führer Steuri, Ski-König.
Holen allwinterlich Grindelwaldner weit und breit in der Runde sich ihre Preise als Schịị-Chïniga: wie nahe stand da der Schlitten der Gefahr, für immer im Grï̦mpelchämmerli verschwinden zu müssen! Fährt schon der ungekrönte Skifahrer anstandlos über verschneite Hecken und Zäune, Gräben und Klüfte in zweiundzwanzig Minuten von der Männlichenspitze zur Lütschine hinunter: was ist da noch Weg und Steg! An das Treib dagegen (unterbernisch: den Treib, die durch Schneebruch geöffnete Bahn) ist die gewöhnliche Schlittenfahrt gewiesen. 81 Daher mues mụ gă n treiben, gă n Wääg machen, gă n wä̆gen, găn de n Wääg frisch ụụfbrächen immer wieder neu, wenn der Wind ’s Treib verblaasen, oder vergu̦xed, oder verchụted, oder verwuested heed. Auf schmalem Fußsteig ist dies ein einfaches Geschäft: man greift zur Schaufel und schoord de n Wääg ụụs. Origineller ist die Auskunft, einen Rückentragkorb, worin man Brot, oder aber Tannnadeln, Laub, Dünger trägt, also ein Brodhu̦ttli, eine Chrĭ̦snadelhu̦tta, Loị̈bhu̦tta, Misthu̦tta mit Steinen anzufüllen und dä n Wääg b’schwaareti dï̦r ch de n Schnee z’schleipfen. Es erinnert dies an die anderwärtige Praxis, mächtige Balken von Ochsen durch den frischen Schnee ziehen zu lassen, oder auch letztere allein mit ihrer bemerkenswerten Pfadfindergabe nach einem bestimmten Ziel zu treiben. 29 Über die Straße der Niederung aber führt der Schleif oder Schlittwääg. Für den Holztransport aus dem Walde hinwieder, welchen man im Hochgebirge am liebsten auf die Tage nach den ersten Schneefällen verlegt, umgeht man unpraktikable Waldwege mittelst des Holzschleifs oder des «Laß»: womöglich einer Erdrise ( Rĭ̦se̥ten), welche geradlinig talwärts führt. Als daherige Eigennamen figurieren der Raa nschleif neben der Ällflueh, die Stelle bi’m breite n Schleif nahe dem Ällouine nwald. Wer mit einem Unternehmen irgend welcher Art auf guten Wegen ist, ist gued im Schleif. Auf den Talstraßen fährt als Schneebrecher der von Pferden gezogene Schneepflug oder Keilschlitten, 30 die «Treibe n», der «Schneemutz», 30a die Schneeschnụụza. Sie führt noch hie und da ihre bestimmten Fahrten aus vom Bahnhof zum Talhaus, über den Endwääg zum Hotel Glacier, nach der Rothenegg und nach Tuftbach, leider nicht auch nach dem Wetterhorn.
Gegenüber dem Schleif für Schlittner, welche mit dem Lastschlitten, dem Hŏri ( S. 85) schlittnen, dient der Rịịtwääg als 82 Bahn für Schlittler, die auf ihren Lustfahrten sonderlich mit dem Beinz ( S. 85) schlittlen oder Schlitten rịịten oder einfach rịịten. Denn die oben erwähnte Gefahr ist wohl für immer beschworen; kommt doch der Grindelwaldner gleich mit dem Schlitten an der Hand auf die Welt!

Cheme si ächt?!
Welch freundlicher Anblick, bereits vierjährige Mädchen mit der Sicherheit und Eleganz der Großen alleinig oder sälbzweit fahren zu sehen! Und wie strotzt ihnen aus Augen und Mund der Humor, der lustige Übermut, wenn sie einem befreundeten Großen im vollen Lauf den Weg zu sperren vermögen! Erlustigend aber ist es zuerst, wie Respekt gebietend zuletzt, einer Engländerin bei Besitznahme ihres Einzelschlittens heimlich zuzusehen. Auf sicherster Straße ist der erste Versuch eine Meerfahrt auf schwankem Kahne. Die Gefährtin zieht leise, leise an der Schlitte nschnuer — derre n (jener) wollt g’schwinden! Äschfarwig (aschfahl), ja chrịịdenbleich wird ihr Gesicht. Genug für heute! Doch, nịịd ergään erzwingd alls! («Nụ̈ụ̈t naa ch laa n g’winnt.») Am zweiten Abend wird schon flott auf gerader, wenig abhĕltsiger Straße gefahren. Am dritten gilt’s, e n Chehr old e n Chru̦mp z’nään und damit das wịịse n zu erlernen. Das ist freilich 83 ein schweres Stück. Das zăbled, des sporred, das sträcked, das strampelt! Aber nicht allzulange, so ist das augenblickliche Sichbesinnen auf den Fuß, welcher aufsetzen soll, eingeübt, und nun kommt eine steilere Strecke in Angriff. Da heißt es, si ch i n Sparz stellen! (Tapfer sich sperren, sperzen, seinen Mann stellen.) Su̦st geid der Schlitte n z’raaß. Das pfi̦tzd drụ̆ber nịder, mu̦ măg’s ni̦d g’wịịsen un d ni̦d g’stellen! Schon ist die Unglückliche einem steif promenierenden Landsmann zwischen die Beine gefahren: hed mu̦ i n d’Bei n g’wï̦̆sen. Und kaum ist die vollendet höfliche Entschuldigung absolviert, neues Unheil! Das ungehorsame Vehikel fehrd zuehi: fährt in einen Haag hinein. Und das tued eine n lleid an en Haag zuehi rï̆ehrren! Das tued eine n wï̆est aa nschlaan! Ja der Schlitten entledigt sich selbsteigen seiner Last: es rï̆ehrd einen draab. Und «hoch im Bogen» vollzieht sich die Entleerung, die Wẹlpe̥ta, die Troole̥ta; mu̦ tued welpen, oder es tued eine n welpen. Man taumelt kopfüber: mu̦ tued d’Schï̦̆ßla welpen oder d’s Hä̆fe̥lli welpen (Knabenspiele). Und wenn man dabei recht unsanft mit dem harten Boden in Berührung kommt, erinnert man sich noch manchen Tag, wie’s ei’m chan n u̦f d’s Lä̆der gaan, wie’s einen u̦f d’s Lä̆der schlaad, wie’s eine n lä̆de̥rred. Das ereignet sich besonders gern im Sti̦i̦ch: dem durch das a nstächen beschlagner Schuhabsätze stetsfort vergrößerten Gegensatz von Hoch und Tief auf der Straße. Wenn gegen das Frühjahr hin deren Tŭ̦li (Querfurchen) zwischen den hohen Wellenbergen recht tief ausgefressen sind, da hotzled der Schlitten gleich einer Gondel im Kielwasser des Dampfers, nur ungleich rascher. Welche Gefahr erst, wenn auf schmaler Straße Fuhrwerk um Fuhrwerk begegnet! Bei einem Ausweichen neuer Unfall. Ein dienstfertiger Landsmann reicht die Hand zur Hülfe, aber ums Haar wäre er außgeglitscht: bịị hin hätt’s mu̦ ’zï̦ckd, e̥s hätt e n Zu̦ck oder e n Rranz g’gään. Kein Wunder auch: e̥s ist zï̦ckig, denn der Schleif ist g’frorna. Alle fühlen den unsichern Boden; und hin u nd wĭ̦der (da und dort) gibt’s einen Fall.
Aber éinist (gleichwohl, eine nwääg) 31 neu am Werk! Han i ch’s jetz nid më̆ge n g’fäcknen (mit meinem Unternehmen zum Ziele kommen gleich dem jungen Vogel, der seine Fäcken oder Schwingen erst übt): ein Ziel muß nun einmal erreicht werden, e̥s mues eppḁ eppḁrhin gaan! Also nur munter die Beine in Gang gesetzt; nu̦mmḁn 84 ei ns d’Gnăge̥ni g’weigged! Nu̦mmḁ n d’Scheihi fï̦rha g’nụụn! Rasch eine Strecke bergan: schi̦dig en Bi̦tz drü̦̆ber ụụf! Dann in beschleunigtem Lauf, fi̦rderli ch, ti̦fig drü̦̆ber ahi! Da — neue Fahrt in den Zaun hinein. Ein Grobian, der am grëb’ren Ort abg’saage̥ta ist, sieht’s und sagt halblaut sein Sprüchlein auf: Wär z’lest 32 ub’r den Haag ist, hed es Plätte̥lli volls Mï̦ï̦s g’frässen.
Bald nun aber geht’s auf gebahnter Straße ganz scharmánt, und es werden jetzt ungebahnte, und zwar immer steilere, stotzige̥rri Schneefelder in Angriff genommen. Da gibt’s als Lehrgelder der Purzelbäume genug. Totz uber Meis (kopfüber) geht’s in das zum Glück weiche weiße Polster hinein. Das lacht hellauf, das kichert — gŭ̦ge̥lled — leise in allen Tonarten. Allein fï̦ï̦r u nd fï̦ï̦r (nach und nach) wird man sich doch besser vorsehen und die Mißgriffe meiden, welche die Neulinge in dieser edlen Fahrkunst fï̦ï̦raan (gewöhnlich, in der Regel) tun. Besonders gilt dies für Umbiegungen, wa mu̦ chrẹihe n wollt old mues. Ist dann die gewählte oder aufgenötigte Richtung erst noch abheltsig (abschüssig) und zeigt der Schnee zur Rechten oder Linken tiefe Senkungen, so daß e̥s gäre n schwẹichd, so ist doppelte Vorsicht geboten. Da heißt’s, den Schlitten mit der Schnur wie das Rößlein mit dem Zaume zügeln, behufs Anhaltens oder Bremsens ihn energisch vor uehi ziehn, und zu augenblicklicher Schwenkung nach der erforderten Seite rasch mit dem entgegengesetzten Fuß e̥s Schlĕgli old e n Zwi̦ck anhi gään.
Auch das lernt sich, und unsere Anfängerin wird noch als vorgerücktere Sechzigerin, unter ihren Töchtern selber eine Tochter mit grauen Haaren und junger Seele, ihnen voran Meisterschaft fahren. Mit der metallenen Stimme eines Grindelwaldner-Jungen, der unter huo! huo! 32a zum Ausweichen aufruft, wird sie ihr langedehntes Aschtụụụng! oder Agtụụụg! ertönen lassen. Auch wird sie immer noch dabei sein, die Grindelwaldner-Jugend zur Einübung eines geschickten, mutigen und vorsichtigen Fahrens durch Wettschlittleti anzuspornen, wobei die verschiedenen Preisbewerberklassen in bestimmter Zeitabfolge starten. Handelt es sich doch auch bei diesen Schlittenfahrten keineswegs um bloßen Sport. Es gibt Winterszeiten, wo Schlitten und Ski das einzige anwendbare Fortbewegungsmittel sind. Da geht alt und jung mit dem Schlitten den Geschäften nach, transportiert auf ihm lebende und tote Last.
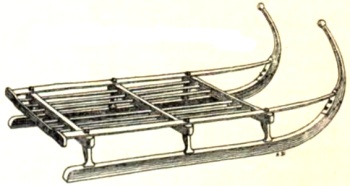
Der Hori, ca. 2 m lang.

Der Beinz, ca. 90 cm lang.
Der
Beinz mit den Einzelteilen:
a: die zwei Chuehen;
b: die sechs Bein;
c: die drei Iicher;
d: d’s Iichli;
e: die zwei Ortsteeb;
f: d’Stebleni.
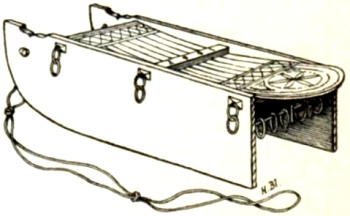
Der Brittler, ca. 80 cm lang.
85 Und zwar ist dieser Schlitten in erster Linie der «Gemmel» oder gut grindelwaldnisch der Beinz, auch etwa: der Beindler, d. i. der Beinschlitten, im Gegensatze zu dem hier altmodisch gewordenen Bri̦ttler des Unterlandes. Letzterer, in seiner Abart als unbeschlagener kleiner Kinderschlitten die Mu̦rra oder auch etwa der Mu̦rri geheißen, ist aus Nußbaum- oder andern Brettern gefügt und daher schwerfällig. Auch machten ihn die angehängten Ringe oder gar Glöckchen, welche durch ihr leid’s tschäde̥rren oder chlinglen beständig zum Ausweichen aufforderten, für den lebhaften Verkehr unmöglich. Wie vorteilhaft werden diese Mu̦rri oder Mu̦rriga durch die leicht gebauten und doch so soliden Beinzen ersetzt! Ein solcher demonstriert auf beigefügter Abbildung seine Einzelteile. Die beiden Ortsteeb (e) ruhen als Einfassung des Sitzes auf den drei Iï̦chch’ren (c). Diese Iï̦chcher sind starke Querleisten. Jedes Jooch ist durch die zwei bis drei breiten oder durch die drei bis fünf runden Stĕble̥ni (f) in der Längsrichtung durchhöhlt. Ein brückenjochähnlicher eiserner Stääg hilft bisweilen 86 den vier bis sechs schlanken und gleichwohl starken Beinen (b) die Last tragen. Diese sind in die beiden Kufen ịị n’zäpfd. Auf der Bauart dieser Kufen oder Chuehen (a) beruht die ganze Tüchtigkeit des Gefährts. Ist das hiefür gewählte Ahorn- oder auch Eschenholz nicht nach natürlicher Austrocknung bleibend gerade gerichtet, so sind die Kufen (ähnlich den schlechten Schiern) bald verzŏgen. Sie bilden einen Bogen nach oben oder nach unten und sind demgemäß entweder hŭ̦pp (konvex) oder ịịnhool (konkav) gekrümmt. Auch eine gueti B’schlẹcht (Beschläge) schützt alsdann den Fahrer nicht davor, dass es ihm gleed (immer wieder) de n Schlitte n verwịịsd. Kommt dann noch Ungeübtheit in der Anschmiegung an die Beschaffenheit des Schleifs dazu, so begegnet es, daß der Schlitten z’stï̦ckine nwịịs, z’bi̦tze nwịịß, z’blätze nwịịs («längs Stück») nu̦mmḁn u̦f ei’m Chuehe n fĕhrd. Die Häufigkeit dieser Erfahrung hat zu einer Bilderrede geführt. «Er fĕhrd nu̦mmḁn u̦f eim Chuehen» heißt: er ist parteiisch. Eine Kommission, welche Liebesgaben zu verteilen übernommen hat, kann hintendrein den Vorwurf zu hören bekommen: Ie̥r heid alls verchuechned!
Ein Beinz in derart vergrößertem Maßstab, daß auf ihm sechs oder zur Not noch mehr Personen sitzen können, ist der Hŏrischlitten, in gewöhnlicher Abkürzung: der Hŏri, oder auch etwa schlechthin der Schlitten. Der Name «Hornschlitten» rührt von der Einrichtung zum Ziehen oder Stoßen durch zwei Hände her. Der Mann oder auch nur der kleine Knabe, der solche Lenkung übernommen hat, hocked i’n Hornen, sobald das Gefährt sich von selber abwärts bewegen darf. Er sitzt auf dem vordersten Jooch, in welchem die sehr starken Steeb gleichlaufend vereinigt sind, und hält, seiner Verantwortlichkeit bewußt, die Hände fest an den Hornen oder Hŏren, an denen er streckenweise die Last zieht. Es mag bei diesen «Hörnern» an die Ziege gedacht sein, die dann auch dem Hornschlitten in Unterwalden die Bezeichnung «Gäißli», im Unterbernischen den Namen «Gị̆bi» oder «Gibe n» eingetragen hat. Auch die Gemse wird ins Spiel gezogen, wenn seltenerweise und wohl nur launenhaft der Beinz das Gemschi, der Gemsch (der «Gemel», Gemmel) geheißen wird. Die Hörner der Schlitten gleichen jedoch nur wenig den Hörnern dieser Tiere. Es ist hier wohl eher eine jetzt mechanisierte Fortsetzung eines sehr alten Volkswitzes im Spiel, der sich schwere Menschen und andere Lasten gerade durch die hiezu ungeeignetsten Tiere getragen dachte. Wie der kreditlos gewordene Student «auf den Hund kommt» oder der dumme Unterberner «u̦f der Chue rịtet», so mußten auch Trag- und Stützgeräte aller Art an komisch belastete Tiere erinnern. Der 87 «Bock», den der Schneider abwechselnd mit dem Tisch zum Sitze wählt, wurde als lebender «Bock» zu dessen Attribut erhoben 33 und dgl. Das Füllen mußte zum Milchtrichter (Folke, Folle), aber in gräßlichem Sarkasmus der alten Justiz auch zur «Folter» werden, 34 und der Esel spielt in der Gerätekunde eine ähnliche Rolle.
Ganz vorherrschend tritt aber der Hŏri in den strengen Dienst des täglichen Broterwerbs. Fremde schlittnen, Hew schlittnen, Chri̦i̦s schlittnen oder chri̦i̦ßen: alles stellt sich auf die gleiche Stufe der Würdigkeit. Ein besonders ernstes, schwieriges und auch gefahrvolles Geschäft 35 ist das Verbringen von Heu und Holz aus Alp und Wald. Beim Abwärtsfahren an steiler Stelle tued der Schlittner en Underlegchetti under; meṇgist zwoo: an e’m jelhe n Chuehen eini. Auf dem Gu̦fi (dem Stützbaum, eigentlich Tragkissen) ruht vornen, mit der Aa nwaag oder dem Sparren uehiglï̦fted, der Träämmel (das Langholz) und hilft als nachgeschleppte Last ebenfalls tüchtig bremsen. Läßt die anders beschaffene Last es zu, so beschwert das Gewicht eines Menschen einen ebensolchen untergelegten Sparren oder auch ein Bri̦tt, dessen Nägel hemmend in den gefrorenen Weg einritzen.
Soll umgekehrt — wenn’s ääber ist — das Gefährt gẹngiger werden, so hilft man sich (ähnlich wie im Wallis) mit untergebundenen Achsen samt Rädern. Knaben ihrerseits vereinigen zwei oder mehr Einzelschlitten mittelst übergelegter Bretter zu Bri̦tschen und sausen bergab, mit dem vom Pferd gezogenen Rennschlitten um die Wette.
Den Holzer und Heuberger aber schützen auch seine besten Vorrichtungen nicht immer vor Unheil. Schon die Schlittbrächa beim Seegaden (am Wetterhorn) erinnert daran. Allein auch Menschenleben kamen aufs Spiel. So wurde 1841 in der Fĕli zu Itramen ein kräftiger Jungbursche durch ein allzu schweres Fuder Langholz in e’n gääjja Chehr ụsig’schossen und gäg’n es Ahiri (einen kleinen Ahorn) geschleudert; das hed mu̦ den Brustkasten i̦i̦ ng’stochen. Solche furchtbare Schlittenfahrten erinnern an die Pestzeit von 1669, wo am 29. April neunzehn Schlitten mit Leichen sich vor dem Kirchhof zusammenfanden.
Ist es aber auch nicht immer «der Weg des Todes», der hier gegangen wird, so führen doch die vielen mit dem Lastschlitten erfahrenen Unfälle zu Redensarten, die mehr oder weniger starkt den Ernst des Existenzkampfes illustrieren. So heißt «einen hinder de n Schlitten 88 bringen»: ihn ökonomisch ruinieren. Zwischen Sarkasmus und Humor, je nach Einzelumständen hier- oder dorthin neigend, schwebt die Redensart under den Hŏri choon oder einfach under choon. Es ist die sauersüße Ankündigung eines «frohen Ereignisses» in einer sonst schon überkindeten Familie. Ganz ohne Zukunftssorgen nimmt den Zuwachs nur derjenige Mittellose entgegen, der auch die Gegenwart fröhlich leicht nimmt, der sorglos alls laad schlittlen.
Einem ernsten, doch bisher immer gut abgelaufenen Sorgengeschäft widmen sich an sehr steilen Hängen, wo ein Schlitten zu rasch gleiten würde, z. B. die Burglauener, wenn sie ihre Wildheulasten vom provisorischen Aufbewahrungsort über den gefrornen Schnee hin zu Tale bringen. Zu diesem Behufe wird ’tääsched oder e̥s Tääsch aa ng’reised. Man legt als Träger der Last große Tannäste so übereinander, daß ihre ịịnhooli (konkave) Seite nach oben schaut, und verbindet sie, wo nötig, mit Seilen unter sich. 36 Ein hervorragender Ast, wohl auch ein an solchem befestigtes Seil, dient zum Ziehen oder Hemmen der Last von der Stelle an, wo diese geschleift werden kann. So wird d’s Wildhew ahi’tääsched (s̆), ahi’tääsched wohl auch eine Person, der solch kleines Abenteuer Spaß macht. 37
Einen noch größern Fortschritt im Sinne der Vereinfachung zeigt die Hewzï̦̆gi. Vier oder mehr Heubündel werden hintereinander an Seile gebunden. Alle Mannen stellen sich vor draan und schleppen die Last, die wie eine riesige Schnecke gleichsam herunterkriecht, ahischnaagged. Ein ähnliches Schauspiel bietet die unter «Wald» zu besprechende Holzzï̦̆gi.
Das Ideal eines schneeüberwindenden Vehikels gibt freilich der eigene Leib selbst ab. Ein jovial gelaunter Herr 38 läßt frischweg die Beine von einem auf den Schnee hinsitzenden Führer als Deichselgabeln unter dessen Arme fassen, und in zwei Minuten saust das eine dreiviertelstündige Strecke talwärts. Ja selbsteigen sitzend über den harten Schnee hinunter zu rutschen, 39 verträgt sich sehr wohl mit der Würde auch eines sonst recht anspruchsvollen Herrn.
89 So wissen Alpenbewohner und Alpenbesucher in tausend Formen den Schnee für Last und Lust sich dienstbar zu machen. Mu̦ chan n en doch ei nmḁl eppas brụụhen! anerkennt schon der Dreikäsehoch. Aber mu̦ mues n e̥n nää n, wịịl e̥r da ist, und wa mu̦ eppḁ zuehi mag! Letzteres ist ja ausgeschlossen in den Wildnissen und Labyrinten des beständigen 40 oder «ewigen» Schnees, wo es nur einen Wechsel gibt zwischen Schneetürmen, Schneehalden, Schneebusen, Schneemulden. Eine solche Mulde zwischen Rinderalp und Bohne̥rren am Eiger, über dem Gg’rị̈ị̈t an dessen Fuß, heißt die Schĭ̦ßla. Dert tued’s de n Schnee z’säme nsappen, bis er als die Schï̦ssellouina ( S. 69) unter gewaltigem Getöse hinunterfällt. In kleinern schattigen Bergmulden bleiben vereinzelte Plẹtschen, Pletschle̥ni, Schneepletschen lange in den Sommer hinein liegen. Sie zeigen anschaulich den Einfluß verschiedener Faktoren auf die «Schneelinie», welche sonst als ein wie mit der Schääri abg’hi̦wna Soïm in ansprechender Naturgeometrie vom Männlichen weg nach der Viescherwand hin verläuft. Diese Linie bestätigt aber zugleich die Beobachtung, wie der Grenzgürtel des ewigen Schnees in der Finsteraarhorngruppe um volle vierzig Meter höher steigt als die durchschnittlich schweizerische von 26-2700 Meter. 41 Ja quer durch unser Lütschental zieht sich von Saint Maurice der nach dem Triftkessel hin eine Isochimene (Linie gleich hoher Schneegrenze) von 2800 Meter. 42 Sehr interessant ist für den regelmäßigen Beobachter auch das jährliche 43 Auf- und Abrücken dieser Durchschnittslinie. Man sollte, um grindelwaldnerisch zu reden, Gu̦fi dḁrzue stecken (durch Stecknadein im Fels oder mitten im Walde dieses Auf- und Abrücken markieren). Dann könnte man sich folgendes veranschaulichen. 44 Alle hundert Meter Erhebung bringen elf Tage längerer Schneebedeckung. Der März drückt mit seiner mittleren Wärme von 2,3° die untere Schneelinie etwa bis ins Lï̦tsche ntal (genauer 710 Meter) hinunter, der April (5,7°) etwa auf den Burgbiel (1020 Meter), der Mai (6,7°) auf Schwarzwaldalp (1440 Meter), der Juni (7,3°) auf das Mittelläger Holzmatten (1930 Meter), der Juli (6,2°) auf Bä̆nisegg (2480 Meter), der August (4°) auf Station Eigerwand (2860 Meter). Dann geht’s wieder abwärts bis auf 700 Meter bei 0/2,3 Grad im Dezember. 45
Wir sehen also, wie gerade die Monate des in der Niederung so gefürchteten Kälterückschlags — Mai und Juni — im Gebirge die höchste Wärme aufbieten, um die Schneegrenze rasch emporzutreiben. Ähnliche 90 Zahlen würden zeigen, wie diese Grenze noch Ende Oktober höher stehen kann als selbst im Mai. Welch Glück für den Älpler und sein Vieh! Damit kann jener bis spät in den Herbst hinein gued ụụsalpen und sich für die oft späte Alpfẹrt schadlos halten.
Doch auch die rückt einmal an: e̥s sịịn uf der Alp no ch nie zwee Wintre n z’säme ng’hanged. Der Wald beginnt den Frühling zu verkünden. Ist auch sein Boden noch so tief mit Schnee bedeckt: die Fichten werfen mit kräftigen Schwüngen ihre Last ab. Schon im Winter haben sie dies wiederholt mit kurzen Erfolgen versucht. Jetzt aber ist der volle Sieg errungen: wie über Nacht ist der Wald z’grächtem e ntschlăgna! Auch im offnen Feld faad der Schnee aa nn schwịịnen: e̥s haud n en! e̥s schlaad ne n z’sä̆men! An steilen und glatten Flächen kann er überhaupt nicht haften. So bleiben beständig vom Schnee entblößt das schwarz Brätt am untern Ende des Eismeers und das rot Brätt am Eiger ( S. 13). Über und neben beiden sammeln sich Schneefälle und kleine Schneerutsche und entladen sich in der wärmern Zeit fast beständig in hübschen kleinen Lawinen. An rauhen, aber sehr steilen Gräten bereitet der im Fallen sofort verschwindende Schnee ein anderes Schauspiel. Da zerstäubt ihn der Wind. Die Höhen rauchen, e̥s roïchned oder es stoïbed in der Heejji. Ein wunderbarer Anblick. 46 Auf sanftern Gehängen und in Niederungen aber verrichten Föhn, warmer Regen und Sonne das große dreiwöchige Werk der Frühlingsschneeschmelze. Das nimmd dä n Schnee ab den Bärgen! (Ruf bei gutem Stich im Kartenspiel.) Da fließt das Schmelzwasser so reichlich von jedem Grat, von jeder Anhöhe, daß schon deswegen von altersher der Schneeschmelzi gleich dem Rein (Rain) 47 grenzbestimmende Bedeutung zukam. Das quillt und fließt denn auch, das rï̦nne̥lled und brï̦nne̥lled — alle zwei Schritte ein munteres, ein eiliges Bächlein. Das wochenlang fließende Wasser vermehrt mächtig die wohltätige Bodenfeuchtigkeit als Reserve für den ganzen Sommer, macht aber freilich auch Weg und Straße und Steig so ungangbar, daß’s nĭ̦mma schëën ist. Der März und der April, oft genug auch der «wundervolle Monat Mai» machen für den Ungewohnten, den sein Geschäft alle Tage an Pfad und Straße weist, den herrlichen Frühling Interlakens zu Grindelwalds Schreckenstagen. Gut, daß der lange Winter, die paradiesische Jahreszeit der Talschaft, zu mehr als reicher Vorausentschädigung vorausgegangen. So übersteht nun männiglich mannhaft den schrecklicha Pfuel und Morast, de n Pflătsch oder das Pflătsch, das G’sood, Schneeg’sood, das oder de n Plŭ̦der, 91 Schneeplŭ̦der, de n Ploiz. In gutem Humor antwortete man auf die Frage: Sol l i ch de̥r eppḁ es Schiffli gă n reihen (um durch den dünnflüssigen Kot zu gondeln)? Ei nmmḁl wohl!
Die Schneeschmelze rückt also im Vorsommer unten sehr rasch, zwischen 600 m. ü. M. und der durchschnittlichen untern Schneegrenze dagegen in sehr langer Frist aufwärts. Dabei treten allerlei Abstufungen und Wechselfälle ins Spiel. Vor allem macht sich natürlich der gerwaltige Unterschied zwischen Sunn- und Schattsịịten geltend. Dazu kommen andere Faktoren der örtlichen Lage: tiefe Einschnitte mit zusammengeschmolzenem Firnschnee, und freiliegende Gräte, wo schon der Wind den Schnee wegfegt; geschlossene Waldungen mit wenig Schnee, und eingeschlossene Weideflächen mit dreifachen Lagen. So kommt es, daß z. B. Wilderswil (mit ungefähr 600 Meter Höhe) auf neun Monate schneefreier Zeit rechnen darf, die Dorfschaft Grindelwald (bei 1000 Meter) in ihren sonnigen Teilen auf acht Monate, die Vorsassi und untern Läger (zwischen 1300 und 1625 Meter) auf etwa hundertfünfzig Tage, Oberläger auf etwa fünfundneunzig Tage. 48
«Schneefrei» heißt in älterer Sprache aaber. Das Wort 49 bedeutet im Altdeutschen 50 spezieller «trocken und warm nach Kälte und Nässe.» In ältern Alpreglementen 51 galt ein bestimmtes «aaberes» Felsstück als Zeichen, daß sofort das nächstobere Läger zu beziehen sei. In dem traurigen Sommer 1816 «haben die alppen nicht köhnen Erabren», während es dagegen 1813 und 1858 «bald wieder geabret hat». Auch in Lützelflüh sagt man noch «aaber», um Trachselwald sogar stellenweise «oofer». Aus «aaber» bildete sich ein Dingwort «das Ääber» (schneefreies Stück Land), welches aber nach häufiger Analogie 52 auch und schließlich immer als Beiwort verwendet wurde. Solches ääber bildet wieder aus sich die Verben ääb’ren, ụụsääbren und das neue Dingwort die Ääbri.
Solche Ääbri an sonniger Halde, in hilwer Gebirgsmulde: welchen Wechsel bietet sie zwischen Scheintod und blühenden Leben! Heute weiß, morgen saftiges Grün. Wie wunderbar und wie natürlich in einem! Im der Umgebung unseres Dorfes (1000 m. ü. M.) 92 schmilzt dee Schnee durchschnittlich am 30. März; dann ist die Luft bereits 5,1° warm; bei 1500 Meter ( Loïchbiel) 6,2°; bei 2000 Meter (etwa Bachlä̆ger) 7°. Die abgedeckten Pflänzchen finden also sogleich warme Luft vor. Ja die Wärme dringt unter die Schneedecke, unterhöhlt sie und unterstützt die Eigenwärme in dem Beginnen, das alte Linnen zu zerstücken und zu zerpflücken. 53 Je langsamer aber dies vor sich geht, desto nachhaltiger tränkt das Schneewasser die Pflanzenwurzeln. So in den Schneetälchen 54 der Bergterassen, auf sandigen Feldern, am Fuß der Schutthalden und z. B. auf dem Gletschersand unter dem Wetterhorn. Da gedeihen denn auch die edlen Alpenkräuter Mŭ̦ttne̥rra und Romeien; da läutet das Geißglëggli den späten Frühling ein, und ganze von Frühlingssafran bedeckte Flächen zaubern in den Alpensommer hinein hier einen neuen weißen, dort einen neuartigen purpurnen Schnee.
Von nichtweißem Schnee redet aber der Volksmund sogar unbildlich. Man denke an den «Blauschnee» am Säntis. Aus der Umgebung von Chur wie auch Signau im Emmental 55 kam erst kürzlich wieder Kunde von dem schwarze n Schnee, der in Wahrheit aus dichten Scharen des Schneeflohs ( Achorutes sigillatus) aus der Insektengruppe der Springschwänze ( Poduridae) besteht und in Schmelztümpelchen sein Frühlingserwachen feiert. Verwandt ist der Gletscherfloh ( S. 63). Mehr Aufhebens hat man seit längerer Zeit vom roote n Schnee gemacht: der vom Firnstaub sich nährenden einzelligen Alge Chlamydococcus oder Haematococcus nivalis mit karminrotem Farbstoff und den Infusorien, die von den Zerfallstoffen solcher Algen leben. 56 An diesem Zusammenhang sei auch gleich die Rede vom Blutregen oder roote n Rä̆gen, der ein noch viel älteres Stück der Volksüberlieferung bildet. Man höre den Bericht unserer Cronegg von 1755: «Den vierzehnten Tag winmonat ist ein starker Wind ausgebrochen, welcher yst mit einem rothen Rägen und mit starkem Donner und Blitz begleitet gesin, daß man zuvor von einem solchen Rägen nicht gehert hat. Wann er ist auf dem Kraut erdrocknet, so ist es worden wie in einem Roten Schleifsteintrog.»
1
Herzog 38 nach Goaz.
2
v. Tav.: Jä gäll, so geit’s.
3
GlM. 96; vgl. der «Wolhen» unter «Dunstgebilde»,
4
ÄFG. XIX.
5
GlM. 163.
6
Tschudi 432.
7
Tschudi 412.
8
Pflzlb. 58.
9
Ebd. 54.
10
Ausgiebig.
11
Schon geronnene Milch aus dem Käsekessel.
12
MGw.
13
St. Sch. 73.
14
And. 487.
15
Cronegg 1821.
16
Läst = Massen; Lasti = Lasten.
17
Täuber 22.
18
ÄFG. 126.
19
Stud. Ü. 1, 252.
20
Cool. BO. 77 f.
21
Vgl.
Berlepsch 21;
Krehbiel 47.
22
Faulh. 9.
23
Hugi 59. 61.
24
Grun. 3, 163.
25
Keller 130. 357;
Schubert 2, 13. 15 f.
26
Cool. JS. 304.
27
Ebd. CXXXIX; 206 (nach Claudian); 217 (nach
Silius Italicus 3, 528);
Wyß 795 (
Ammianus Marcellinus 15, 10).
28
Lf. 212 ff.
29
Cool. JS. 128 f.
30
Osenbr. 6, 121-3.
30a
S. Ankers Bild: Schweiz 1900, zu 180, und Blatt 2 im Ankeralbum.
31
Man halte auseinander:
ei(n)s — ein Mal,
une fois;
einist = gleichwohl;
ei(n)mal, emmel, emel = wenigstens, sicherlich, fürwahr, vgl. das Grindelwaldner-Schibbolet
emmel wohl! Man denke sich dieses «einmal» als den Rest einer Argumentenreihe: einmal ist das zu sagen; sodann usw.
32
Zuletzt, als der letzte (
der lest).
32a
Vgl. «schweizerische Schlittenrufe»: S. 58 bis 66 in Ernst Götzingers «Altes und Neues» (St. Gallen, 1891).
33
Singer M. 10, 65.
34
Kluge 115.
35
Osenbr. 6, 107 f.; 116. Letztere Stelle (eine meisterhafte Schilderung) auch in Edinger-Schmids Sekundarschulbuch.
36
Vgl. die
Dääsche aus ganzen jungen Fichtenbäumen bei
Kasth. 25, 121, 124.
37
Ähnlich fahren andere Bergvölker auf Balken (
Cool. JS. 219 f.); und um ihren Feinden zu imponieren, rasten die alten Cimbern auf ihren Schilden schroffe Gehänge hinunter (Plutarch.
Marius 23). Den Brauch im Kaukasus aber, auf Ochsenhäuten talswärts zu fahren (Strabo 11, 5 f.), erneuerten sogar Heinrichs IV. Gemahlin und deren Gefolge (1077), sowie die Herzogin Yolanda von Savoyen (1476), um über den
Mont Cenis zu kommen (
Cool JS. CXL). Rollen solche Gefährte erst auf nägelbeschlagenen Baumscheiben (Ebd. CXLIII), so ist das schon eine starke Annäherung an die eleganten Rollschlittschuhe auf den
skating rinks.
38
Roth 168 f.
39
Rohrd. 20.
40
Grun. 1, 92, 94.
41
Pflzlb. 29;
Grube 2, 6.
42
Nach einer Veranschaulichungstafel im
AM.
43
Vgl.
Heß 51.
44
Ebd.
45
Hann 205;
Heß 50.
46
Vgl.
Tschudi 21.
47
Lf. 6, 24.
48
Selbstverständlich alles im Durchschnitt. Vgl.
Pflzlb. 51 nach Schlagintweit; St. Sch. 73 und danach die hübsche Tafel der schneefreien Zeit in verschiedenen Meereshöhen im
AM.
49
Um den Ursprung des Wortes streiten sich folgende Ableitungen: 1. aus dem Stamm
ăb in dem schweiz. Zeitwort
ăben = abnehmen, schwinden (
schwz. Id. I, 39); 2. aus lat.
apertus (
ouvert, offen); 3. Urverwandtschaft mit dem ebenfalls zu
aprire (
ouvrir, öffnen) gehörigen
apricus (
Kluge 2): offen, unbedeckt und damit der Sonne ausgesetzt, sonnig, daher auch mild, warm. Die a
prici flatus (warme Südwinde) entsprechen dem
ăberen wind (Zephyr; s.
mhd. WB. 1, 4).
50
Mhd. WB. 1, 4.
51
Z. B. von 1626 für die Brienzer-Rotschalp:
Gusset 48.
52
Vgl. Nutz und nutz u. dgl.
53
Tschudi: «Der Frühling in den Alpen».
54
Schröter;
AM.
55
Emmentalerblatt 1906, 20;
Zschokke 11; vgl.
Tschudi 205.
56
Murray LXXIII f.; Freshfield 265. 450;
Alp. Journ. 1, 152;
Bibl. univ. 1819,
Dec.;
Zirkel 3, 426;
Tschudi 6, 427 f.;
Zschokke 11;
Grube 1, 27, 145;
B. Heim 1905, 210.
Es chunnd mid Rä̆gen. Da hei n me̥r d’s erst Trë̆pfe̥lli. Wie froh aufatmend spricht man so, nachdem in trockenem Sommer wie 93 1832 oder 1885 auch der Alpboden gleich der Niederung sein Quellwasser verweigert hat! Wenn wie im Herbst 1906 selbst entfernte Brunnen kaum mehr die nötige Tränke lieferten! Nun kann man doch wenigstens für die erste Not ’s Rä̆ge nwasser e̥pfaan («empfangen» = auffangen), 1 und in kurzem werden auch die Brünnlein wieder fließen. Das dürre Land aber rüstet sich zu neuem Wachstum: jetz ist wăxigs Wätter!
In wassersï̦chtige n Summren, in Sŭ̦delsummren dagegen, wie etwa das Jahr 1907 ihn bot, da mag es wohl schließlich in Verdruß und Unmut heißen: We nn mu̦ das Rä̆ge nwätter umhigään wellti, su̦ mï̦eßd mu̦ si ch schä̆men! Da bedarf es aller Ergebungskraft des Landmanns, damit er zu dem philosophischen Satz komme: där wa’s netzd, där trë̆chchneds umhi.
Tropfbare Niederschläge von ganz kurzer Dauer sind: die Steipe̥ta, die Sprï̦tze̥ta, die Schmeize̥ta, das Schï̦tte̥lli, die Schï̦tti, der Schụụr, der Gutz, der Wolhenbru̦u̦ch. Diese Regenfälle, deren Wasser grăd vom Bŏden abschießd, dem nechsten Grä̆bli zue, sieht der Landmann weit weniger gern als das sittig rä̆gnen oder auch nur rä̆ge̥llen, welches still und zugleich anhaltend, darum gründlich, den harten Boden durchweicht. Die Stärkegrade des Regnens bezeichnen die Ausdrücke tewwe̥llen, spewwen, rä̆ge̥llen, rä̆gnen, wättren, aha lëësen. Die drei schwächsten Grade charakterisieren sich durch vielfachen Unterbruch, durch gleichsam unentschlossenes Verhalten. Der erst im Beginn begriffene Luftzug mag no ch nï̦d dï̦ï̦r chg’schlaan. Gerät er in leisen Widerstreit mit andern, so kommt es zum fein verteilten Staubregen, der Steipe̥ten, wobei man zu spüren anfängt, daß ’s ei’m a nrä̆gned. Ein stärkerer Kampf führt zur Spritze̥ten, wa ’s da old dert inhi jagd; oder gar zur Schmeize̥ten, wa’s vom Wind der Rä̆ge n trịịbd, daß ’s nen under alli Tächer zuehi schmeizd. Wie viel lieber sieht man, wenn es — selbst wie u̦s’ner Spritzchanne n — schë̆ë̆n grăd aha rä̆gned! Mag es dann auch die im Freien Überraschten derart durchnässen, daß ’s ab ’ne schụụred! — Da lë̆ë̆sd ’s den n guetig ụụs. Wie erst im Wolkenbruch! Da ziehen aufsteigende Luftwirbel von allen Seiten Feuchtigkeit herbei und bilden Tropfen bis zu sieben Millimeter Durchmesser. 94 Nicht umsonst redet hier der Volksmund von einer Entladung, wie we nn mu̦’s u̦s Mälchtren ahi schị̈tteti, und von Tropfen wie Aammoltri (Sauerkirschen), wie Hăselnuß, ja (in ziemlich freigebiger Hyperbel) wie Boimnuß, und zwar zusammenhängend wie Packschnị̈eri.
Anhaltend dichter Regen läßt den Blick im Hintergrund an einer förmlichen Rä̆ge nwand abprallen — im Gegensatze zu der kurz vorhergehenden ungemeinen Durchsichtigkeit der Luft, die uns ausrufen läßt: d’Bärga sịịn ḁ lsó naa ch!
Gemäß der gesamten Beschaffenheit des Alpensommers fällt eine besondere Bedeutung dem Oigste nrä̆ge n zu. Der Älpler sieht an ihm schon gerne, daß er d’Brä̆me n tëëted und das Weidevieh auch vom übrigen Gfleig befreit, das jetzt eben am lästigsten geworden war. Sodann gleicht er die großen Temperaturschwankungen zwischen den Tagen und Nächten dieses letzten Sommermonats aus zugunsten des Milchertrags. Dieser war durch rasches Abnehmen des Chrụụds im zweitobersten Läger in Masse und Güte stark zurückgegangen. Nun bezieht man auf vielen Alpen erst im August das noch unberührt gebliebene oberste Läger mit seinem besten Graswuchs. Dieser Umzug fällt also etwa zusammen mit den soeben erwähnten Gründen höchsten Wohlbefindens der Weidetiere. Die Augustmilch zeichnet sich daher auch durch, vermehrten Fettgehalt 2 aus, und man zieht daraus den Schluß: Milch wird vom Oigste nrägen feißter.
Gram ist diesem Augustregen der Älpler bloß aus einem Grunde: er tued mu̦ gä̆ren den Dorf verrägnen! Ängstlich schauen daher am Frịịtag z’Aaben d und Samstag vor diesem Älplerfest des ersten Augustsonntages die Blicke der Jungburschen nach den Wetterzeichen aus. In der Frühe des so wichtigen Sonntags selbst muß alsdann das Antlitz des Himmels seine letzte und Hauptprobe bestehen. Ist die Bewölkung nu̦mmḁn en Blätz wie n en Bräntlistechchel, so rägned’s nịịd — die Würfel mögen geworfen werden! Das Fest findet statt. Lautet jedoch die Prognose: es chunnd e n Rägen, i ch chan n e wch’s sä̆gen, 3 dann liegt die Entscheidung über Abhalten oder achttägiges Verschieben des großen Tages am zartern Geschlecht. Auch unter diesem gibt’s natürlich solche, wa n es großes Wort hein, und es soll zuweilen einmal bei der Stimmabgabe auf die Bedeutung ankommen, welche den Loibfläcken (Sommersprossen) beigelegt wird. Solche Beeinträchtigungen der Schönheit bringen aber der Mai- und der Augustregen. 4 Der richtige Älpler aber sieht weniger auf die dadurch schwer 95 geprüfte Zartheit der Haut, als auf deren Widerstandsfähigkeit gegen «Sonnenbrand und Kühle». Diese Erwägung riete also zum Beschluß: der Dorf ist aufgeschoben oder sogar aufgehoben — wenn nicht das nämliche Zukunftsinteresse auch einen gegenteiligen Grund auf die Waage legte. Wer nämlich nicht als Hääpe̥lli, als Fịnette̥lli, sondern als robuste Tochter dastehen will, wird beweisen, daß sie auch einen festlichen Regensonntag ohne besondern Schutz zu überstehen vermöge. Zugleich kann alsdann durch Wahl eines anständigen Anzuges, der doch ohne allzugroßen Schaden verrägned werden mag, der haushälterische Sinn bekundet werden. Also hinauf! Der Schäre̥m wird heute gerade so sehr verachtet wie das Su̦nne ntachch der städtelnden Dame. Und sollte es wirklich regnen: mu̦ schlị̈ị̈fd und’r dem Rä̆ge n dï̦ï̦r ch («schlüpft unter ihm durch», indem man vorwärts eilt und so nur wenig von ihm getroffen wird). Im Notfall bietet ja der Graatschäre̥m oder Chïehmatte nschäre̥m der Haslischeidegg Unterstand. Und wenn das Unheil allzu arg in Zug kommen sollte, so läßt sich wohl noch in den nahen Speichern einer und dort wieder einer der halb verwetterten Schaafhäärden (gebeizten Schaffelle) oder eine gebeizte Geishụụt aus d’s Änigroosis (Urgroßvaters) Zeit auffinden. Wie reizend ein solches museumswürdiges Altertumsstück über der Schulter eines jugendkräftigen Mädchens, aus dessen Mund und Augen der Galgenhumor sprudelt! Der Anblick mag wohl einen Ritter aus der jungen Garde zur Lieferung eines Pendant anreizen, indem er der kleinen Raritätenkammer des Berggasthauses einen Kragen von Wachsleinwand oder Taffet 5 enthebt, ihn sich um Rücken und Achseln schlägt und sich so als Touristen alten Schlages drapiert.
1
Also hier im Grundbegriff dieses Wortes
intfâhan und auch in dessen kontrahierter Grundform erhalten. Die grammatische Wechselstufe desPartizips (
ng) hat erst später die des Präsens (ursprüngliches
n’h) verdrängt, so daß man «fangen» durchkonjugierte. Vgl. dagegen z. B. «gezogen» (mit stimmhaft weichen
g) mit zie = «ziehe» (alt zeuche = lat.
dūco). Die weichere Lautstufe des Partizips steht mit dessen ursprünglicher Endbetonung im Zusammenhang. (Berner’sches Gesetz.)
2
Schaff. M. 4.
3
«Kinderlied» von Gertrud Zürcher 02, 258; 03, 188.
4
Rothenb. 21.
5
Wyß 97.

Der Graatschärem auf der großen Scheidegg.
Es tëwwe̥lled us der Bịịsen ( S. 100). So sagt man, wenn durch fortschreitende Abkühlung die Dunstkügelchen so umfangreich und schwer werden, daß ein feiner Nebelregen niedersprüht und durchdringend näßt. Aber auch die Wolken, deren Bereich eine Höhe von 1 bis 9 km ist, sind der Schauplatz einer beständigen Wasserdampfausscheidung und eines daherigen Niederschlags. Derselbe kann allerdings so leicht bleiben, daß es nicht zu einem Fallen auf den Erdboden kommt. Es trëpfe̥lled in der Hëëjji. Im Bereich der obersten Wolken, deren weißliche Farbe eben noch so «geheimnisvoll und düftig» 1 den Himmel sich ausdehnen ließ, machd’s oder studierd’s an e’m Schneewe̥lli oder an e’m Rä̆gelli umha. Trägt eine Windströmung kalte, trockene Luft her und unterdrückt sie damit die Neigung zu lindem, miltem Wätter, so heißt’s: Es mag hị̈ị̈t ni̦d g’schnịjen oder g’rägnen, e̥s ist ’mu̦ z’chaald.
Für den unter Umständen so heiß ersehnten und doch ausbleibenden Regen tritt in klaren, windstillen Sommernächten der Tau als willkommener Ersatz ein. Der Erdboden und sonderlich seine Pflanzendecke kühlt sich durch Wärmeausstrahlung und Verdunstung eigener Feuchtigkeit rascher ab als die Luft, deren Wasserdampf sich auf den abgekühlten Pflanzen in Tropfen niederschlägt, etwa wie wenn die kalten Fenster sich in dunstigem Raum beschlagen. Man sagt dann: d’s Tou falld. 2 Es fällt gewissermaßen vom Himmel als köstliche Gabe, deren Reichtum neben den herrlichen Sprühregen aus der schweizerischen Bergwelt dieses einzigartige Grasland 3 geschaffen hat und noch fortwährend schafft. Wie lechzen denn auch die Pflanzen, wenn sie eine anhaltende Dürre überstanden haben, nach solcher Erfrischung! Es sieht fast aus, als wäre es ihnen ëëd wie einem allzu lang nüchtern gebliebenen Menschen, welchem newwḁ n d’s Tou ab dem Măgen ist. Und der Älpler achted si ch scharpf, wie beim Mähen des Heus der «Taufall» sich anlasse, weil der ihm auch ein Wetterzeichen ist. Wenn die Sense ihren Metallglanz verliert: we nn d’Sä̆gisa a nl loifd u nd leidi wird, so heißt’s: e̥s ist hị̈ị̈t kei ns Tau, e̥s hed’s nid lang! Denn natürlich ist ja der Tau, weil er nur bei unbedecktem Nachthimmel entstehen kann, ein Zeichen schönen Wetters. Gleichwohl wird auch der erwähnte feine Sprühregen mit dem Tau in sprachlichen Zusammenhang gebracht, indem man sagt: Es tëwwe̥lled; es tued so eppḁs umha tëwwe̥llen, es tued derglịịhe n z’rä̆gnen.
97 Geht die Abkühlung der Pflanzen so weit, daß die ausgeschiedene Taufeuchtigkeit gefriert, so rịịffed’s. Gut zwei Monate vor Anfang und nach Ausklang des Winters setzt sich in Grindelwald «der langzahnige Reif» 4 : der Rịịffen auf die Spitzen der Gräser, an den Zaunpfahl im Feld. Auch vo’n Beïmen hangen ganz Strange n Rịịffen, obwohl sich nach gewöhnlicherem Ausdruck an Busch und Baum der «Duft», das «Biecht», das Bịịsengĭ̦cht, die Bịịsa hängt. Gipfel und Gezweig können unter solcher Belastung brechen. Wie zauberhaft dagegen rüsten sich mittelst solchen Schmucks die Fichten im Wald zu Weihnachtsbäumen aus, jede für sich herausgehoben als unnachahmliches Kunstwerk!
Mit diesen Formen gefrornen Taus setzt der Volksmund mittelst der Bezeichnung «Duft» jene unheimlich graulichen Tropfen an Wänden und Decken feuchter Wohnungen in Zusammenhang. In Wahrheit sehr unweihnächtlich dï̦fted die Stube der Trochche nwohner neugebauter Häuser. Solche Grüße des Friedhofs kannte und kennt auch Grindelwald in Häusern mit schlechtem oder gar mangelndem Fundament. Wie schwitzen da Wände und Zimmerdecke ( der ober Soller) von dem geschmolzenen «Duft»! Wie rinnen die häßlichen Tropfen auf Boden und Bett! Namentlich frïejer hed mu̦ g’sehn, daß der ober Soller ganz g’sŏdnassa ist g’sịịn, a lsó sịịn da Trëpf dra n g’hanged! Zu notdürftigster Entfernung wurden sie oft nur zeitweilig mid’ nem Hụdel abg’wï̦schd. Unheimlich wohnt sich’s also hier in der Kälte oder Gfru̦st, welche alles ihr Ausgesetzte g’freerd oder gar vernichtend erfreerd, und unheimlich bei der Frühlingswärme, wo das im Bann des Frostes Gefangene aa nfaad e ntfreeren oder e ntfrieren. Das erste Stadium dieses Vorgangs, das oberflächliche Auftauen heißt e ntlï̦men, im Oberhastli sprachgemäßer: «e ntlịịmen». 5 (Der im Grindelwaldnischen verdunkelte Infinitiv ersetzte sich durch das Partizip; vgl. den Bŏden e ntlï̦̆men.)
Vollzieht sich solches «e ntlịịmen» in höhern Luftregionen unter gewissen, immer noch unaufgehellten 6 Einzelumständen, so ballen sich die Nadeln und Sternchen schwebender Eiskristalle zu zarte n Chï̦̆ri̦nen (kleinen Körnchen). Wächst ein solches Chï̦ri zu Erbsengröße an, so kommt es zum Rä̆sel, welcher an den Schneerä̆sel heftig daherfahrender Schneekörner erinnert. Dieser letztere läutet den Winter ein und aus: mid Schneerä̆sel faad der Winter an, mit Schneerä̆sel hëërd er ụụf. Der Rä̆sel als «Rĭ̦sel» (Graupeln) dagegen 98 fällt im Sommer, zuweilen als Begleit von Gewittern und als Urheber großer Verheerungen. Am 18. Juli 1794 «hat Es an Grindel so stark Geraßt, daß es so wiß war wie der schne und so dik auf dem Boden, daß er den leidten in die Schu getrolet. Darvon war der Bärgelbach angan und nam an Judenwang die brig.» Die Wasserverheerung vom 3. August 1906 war mit eben solchem Graupelfall an Grindel, Holzmatten und Bußalp begleitet. Bedeckt sich ein Graupelkorn mit mehreren exzentrisch gelagerten Eisschichten, so entsteht das Hăgelchoren, entstehen die Hăgelsteina, als Nußsteina so groß wie eine Baumnuß, aber auch bis zur Größe eines Ei’s und (zu Trachselwald im Jahr 1449) zur Schwere von 3½ kg anwachsend. Die zu ihrer Bildung nötigen Temperaturgegensätze lassen als begreiflich erscheinen, daß ’s nie im Herbst und Winter hăgled. Daß aber ein Hagelfall in der Regel e n schmaale n Streich (Strich) oder auch nur e̥s schmals Streichli nimmt und insbesondere gern vom Hăgelsee der die Grindelalp anfällt, erklärt sich aus klimatischen Verhältnissen, welche — wie der Volksmund fest behauptet — besonders seit der Entwaldung sich verschlimmert haben. Wie gut, gäbe es auch da oben Häuser, in welchen man rasch d’s Tischlachen ab dem Ofe nstengli nään und i n d’s Dachtroif lĕgen könnte, um sofort das hăglen aufhören zu machen! Das wäre ein sehr willkommenes Mittel zur Verhütung von Katastrophen wie am 12. August 1709, wo die begleitende Flut «hinder milebach in der brawen Hans Glati sein Haus vnd speicher mit villem ärtrich und ym Tal all Brigge hat hinwäg tragen bis an die vor dem stäg vnd die burglauwinen Brigg.»
Solche Katastrophen und Stürme sind bildlich auch auf dem verwätt’rete n G’sicht manch eines verhăglete n Wittwịịbli 7 zu lesen, in dessen Lebenslauf Schicksalsschläge hăgeldick (gleichsam wie Schlossen sich aufhäufend) gefallen sind. Respekt gebietend mutet es dann an, wenn deswegen die Sprache sich mit seinen dem Hagel usw. entnommenen Kraftausdrücken bereichert, wohl aber die ungebrochene Entschlossenheit und Energie sich in die humoristische Rede kleidet: Dorthin geh ich jetzt, oder das tue ich jetzt, u nd we nn’s Chatzi hăgled, daß s’ me̥r naa ch loị̈ffen! Solch tapfere Frauen und die ihnen gleichgearteten Töchter werden aber auch nie zu den Weibsbildern gehören, auf welche das Wort gemünzt ist: We nn’s i n d’s Chŏren hăgled, de nn fähld vi̦i̦l; aber we nn’s i n d’Chŭ̦chchi hăgled, de nn fähld alls! 8
1
JG. UK. 350.
2
«Der» Tau ist mittel- und von da aus schriftdeutsch.
3
Jerosch 22;
Pflzlb. 27;
Wals. Sch. 54.
4
Tschudi 22.
5
Mhd. (
WB. 1, 998)
lîme leim limen, wozu «Leim» und «Lehm», heißt: sich fest anschließen. «Entlimen» ist also: aufschließen.
6
Vgl. besonders
Hann 180.
7
Vgl.
JG. Käthi 85, 86 Hs.
8
Vgl.
JG. BwM. 105; Ztgst. 2, 3.
Wenn nach einem polynesischen Wort 1 die Nebel die Seufzer der Erde zum Himmel und die Tautropfen dessen Tränen sind, dann muß Grindelwald im Winter doppelt heiter und fröhlich gelaunt sein. So findet es auch der Alpenfreund, der gleich am Eingang des Tales das wüste Nebelmeer gegen himmlisch reine Luft eintauscht. 2 Wie herrlich zumal ein Grindelwaldner- Hornŭ̦g! Wenn diesem Monat z. B. im Jahr 1891 auf 23½ sonnige und 3½ trübe ein einziger nebliger Tag nachgerechnet wird, 3 so mag das trotz dem Widerspruch eines Jahres wie 1907 als so ziemlich zutreffende Stichprobe gelten. Anders der Ụụstăg (Frühling) und der Herbst, zumal der Oktober und der April, welche den Alpenwinter abgrenzen und mit ihren Launen zu dessen «Beständig schön» in möglichst grellem Gegensatze stehen. Doch auch im Sommerwetter der Höhen rücken die Kontraste nahe zusammen. Hị̈ị̈t schëën, mŏre n wị̈est! Ja, wer im schönsten Wetter sein Heim verläßt, kann binnen drei Stunden sich der ausgiebigsten Gratisdusche erfreuen. So rasch und stark wechselt die sommerliche Luft der Alpen und ganz besonders auch unserer Talschaft. Es beruht dies auf folgenden Umständen.
Vom Kochtopf des Feuerherdes qualmt der Toïm in mächtigen Wällen auf. Unmittelbar bevor die Milch über dem Feuer erwalled, toïmed sie. Ihr vom Zahnweh schmerzendes Gesicht schlägt die leidende Person samt dem Topf voll Thee unter ein Wolltuch und läßt den Dampf aufströmen: sie teïmd. Dieser «Taum» veranschaulicht uns das Aufsteigen des Wasserdampfes oder Dunstes in der Luft. Der Wasserdampf bildet sich durch Verdunstung der Feuchtigkeit des Bodens und zumal seiner Pflanzendecke mittelst erhöhter Wärme. Allein die Feuchtigkeitsaufnahme der Luft hängt in bestimmtem Maß von der Schwere der letztern, und diese wieder von der Höhe über Meer ab. Angenommen, die Luft könne am Meeresspiegel volle 100% Feuchtigkeit ụụfziehn u nd b’haan, so beträgt diese Aufnahmefähigkeit bei 1000 m ü. M. (Dorf Grindelwald) bloß noch 70%, bei 2000 m (etwa Bachläger) 49%, bei 3000 m (z. B. Wetterkessel) 35%, bei 4000 m (25 m über dem Eiger) 24%. 4 Daher die Trockenheit und damit gegebene Schönheit der Alpenwinter. Im Sommer aber enthält auch die Alpentluft ein so ausgiebiges Maß von Feuchtigkeit, daß dank demselben gerade während der kurzen Alpzeit 5 mu̦ d’s Chrụụd fast gar g’sehd waxen. Dem Grindelwaldner-Älpler 100 kommt überdies noch «der ew’gen Gletscher Nähe» zu statten. Diese legen ihre Vorräte, die sie von den Schneefällen des Winters beziehen, gleichsam in die Sparkasse, um daraus im Sommer Darlehen vorzuschießen, welche reiche Zinsen tragen. D’Gletschra hụụsen u nd spare n fï̦r den Älper.
Im Roïch ferner, welcher in der Morgenfrische von Flüssen, in der Abendkühle von Mooren und Sümpfen aufsteigt, erblicken wir Nebel in kleinstem Maßstab. Nä̆bel kann es in der obern Bergregion und in der Alpenregion, also auch in Grindelwald jeden Monat geben, im Sommer nach vorigem viel häufiger als im Winter. Nä̆bel, mu̦ chënnt n e n mid ’nem Lëffel abstächen, oder mu̦ chënnt e n Stäcke drị n stoßen und dri̦ n zerhịjen, schleicht über den Boden hin. Er gropped oder «hocket» eim u̦f der Brust und dringt so intensiv durch Fenster und Wandspalten ins Innere der Häuser, das s e̥s herts Brod umhi linds wird. Ja es nä̆bled, mu̦ g’sehd nid e iner Năse n lengs, mu̦ g’sehd nid d’Hand vor den Oị̈gen. Nebel der Niederung gefährden Bahnzüge und Schiffskurse, näbligs Wätter bedroht den Bergwanderer mit Irrgang und Verderben. Urplötzlich kann diesen der tückische Feind beschleichen. Als unschuldiges Wölklein am sonst klarblauen Himmel, so gering wie das Räuchlein der Pfeife, deren Eigner ja ebenfalls nä̆bled, taucht er in der Ferne auf. Allein zusehends wächst er ins Riesige; handkehrum ist er da und breitet sein Labyrinth über die zerrissenen Felsenfirste. Besonders perfid hüllt er, vom Brienzersee ansteigend, die Faulhornkette ein. Folgt ihm ein dichtes Schneegestöber mit Sturm, so kann der Wanderer gezwungen sein, eine ganze Nacht auf dem nämlichen Fleck zu bleiben. 6
Solche Nebel können (z. B. am 21. Dezember 1897) von so starker Abkühlung begleitet sein, daß das Thermometer von 0 auf 0/ 10 hinunterrückt; im Sommer ziehen sie gegenteils nicht selten im Geleit von Regen mit oder ohne Gewitter einher. Sie sind nämlich für Grindelwald mit dem Wehen der Nordwinde von der Faulhornkette her verknüpft. Da diese nun das Tal so trefflich vor der trockenen, schneidenden Kälte dieser Winde schützt, so hat sich in Grindelwald der Begriff der «Bịịsa» verschoben. (Vergl. auch S. 110.) Nur dem Fremden gegenüber spricht man vom Nä̆bel im allgemein geläufigen Sinn. Unter sich reden die Grindelwaldner von Bịịsnä̆bel, und wenn unter einer höhern Wolkenschicht sich eine tiefere in scharf waagrechter Abgrenzung hinbreitet, 101 so sagt man: äs undernä̆bled si ch. So auch undernäbled si ch ein Mensch, wenn sein vorher frohes, zufriedenes Gesicht einen des «Sü̦̆rnĭ̦bels» würdigen, mißvergnügten, toibleiggen Ausdruck annimmt. Aber man unterscheidet (vergl. S. 110) die ober und die under Bịịsa, nennt die untere auch schlechtweg Bịịsa und bemerkt etwa: die ober Bịịsa ist b’strichchni. Das will sagen: der Nebel erhebt sich ins Berech der Wolken und nimmt damit streifige Gestaltung an. Bịịsig nennt man es, wenn der dicke Nebel bis an die Fenster eines sogar recht hoch gelegenen Hauses und über sie hinaus steigt. Ghĕjig ist’s, wenn trotz heiterm Himmel entfernte Gegenstände nur in Umrissen sichtbar sind, und wenn noch entferntere im Dunstschleier verschwinden. Ghĕjig ist also sinnverwandt mit trïeb, fịịsterlochig, u nsich tli ch. 7 Solche Verschleierung z. B. gegen Itramen hin gilt als eins der Vorzeichen schönen Wetters, von welchen unter « Wetter und Klima» eigens zu reden ist. Zu ihnen gehören auch die zerschlissenen und halb durchsichtigen Nebelfetzen, welche über die mittlere Höhe der Wetterhornfront hin und her tanzen, so wie die Nebelfahnen, welche von der Felswand weg sich waagrecht in die Luft hinaus erheben. Solche Nebelfahnen und Nebelbänke hängt ebenso der Eiger aus, und gerade er leistet oft in Schaustellungen mit diesem sonst so unanmutigen grauen Gesellen Außerordentliches. 7a Schade, daß wir auch in diesen oft wundervollen Form- und Farbenspielen ein vom Dialekt verlassenes Gebiet betreten, auf das wir uns hier so wenig einlassen dürfen, wie etwa auf die geisterhaften Nebelbilder der Gewässer. 8 Erwähnt sei bloß noch der unberechenbare Nutzen der Nebel. Sie durchfeuchten als Pflanzenfreunde manches humusarme Steingesimse, von welchem jeder Regen abprallt. Sie verhindern viele Wärmeausstrahlung des Erdbodens und damit das nächtliche Gefrieren des Aufgetauten und wehren zahllosen Frösten namentlich gefährlicher Mainächte. Sie fördern die Schneeschmelze und teilen sich mit dem Föhn in den Titel eines Schneefrässers.
Mit dem «dunkeln» 9 Nebel ist der «feuchte» 10 Wolchen 11 oder Wolhen wesensgleich. Die Wolchen bieten im Hochgebirge ebenfalls wundervolle Schauspiele, für welche die Mundart sehr wenig eigene Ausdrücke hat. Und doch, welch ein Lichteffekt, wenn der Eiger 102 bri̦nnd! An Abenden, vor welchen tagsüber ein tüchtiger Schneefall die erste Dunstspannung entladen hat, sendet die Spitze des wịịßen Eiger wie u̦s ’nem Chĕmi Wolken aus, die im letzten Sonnenschein emporqualmen. Dann verziehen sich die Wolken erst unschlüssig — sie wissen nid wa anhi — und schließlich entschieden ostwärts in starkem grauem Qualm. Gleichzeitig entsenden die Hire̥lle̥ni — der schwarz Eiger — einen gleichlaufenden lichtblaugrauen Wolkenzug. Die Schaustellung wiederholt sich: sie tritt gleed ein und endet mit einer leuchtend rosenroten Umsäumung jenes Qualms. Jetzt wieder ziehen sich von den Eigerpfẹistren her (dem Felsenfenstern der Bahnstation Eigerwand) lange Parallelstreifen ostwärts und bewegen in aufwärts gewölbten Halbbogen sich über den untern Gletscher hin. In den zahlreichen Nischen der Eigerwand aber vollzieht sich der berühmte Wolkentanz. 12 Wie zum Anblick einladend, läßt der Berg mitten an der Wand hier «einen» Fahnen und dort ein Fähnlein weit i n den Luft ụsihangen. Aber wie rasch der Umschlag! E n wietiga 13 Wätterwolhe n stocked si ch dert ụụf! In allen denkbaren phantastischen Gestalten: als jagender Eber, weidender Stier, Jäger mit Seitengewehr, Bergwanderer mit Stock, Spinnerin mit Kunkel, Kind mit ausgestrecktem Händchen usw. usw. gruppieren sich benachbarte Dunstgebilde zur Gewitterwolke, 14 zum brandschwarze n Wolhen.
Wer freilich — wenn auch nur in der Stube ze’r Schịịben ụu̦s — die Vorgänge am Himmel sich schärfer ansah, ward durch diesen Szenenwechsel nicht so sehr überrascht. Zu deutlich gewahrte er das sehr hoch dahin treibende leichte Federgewölk: die Hĭ̦lwi. Sie war ganz ḁ lso wie g’wẹnted’s Äämd anzuschauen, wie Äämdwentliga. (Diese entstehen, wenn die in dünner Schicht ausgebreitete zweite Futterernte zum Wenden auf Meterbreite mit dem Rechen zusammengerafft und mit demselben 103 wieder rückwärts geworfen wird.) Solches Hĭ̦lwi, 15 unter welcher es noch windstill: hĭ̦lw bleibt und die Atmosphäre nicht heiter (hell), sondern hääl (von leiser Wolkenbedeckung getrübt) 16 ist, deutet Regen und Gewitter einige Zeit voraus an. Wenn d’Bịịsa (also der Nebel) uber d’Bärga ụụf ggraagged und Hĭ̦lwi d’roob ist, denn is t’s nid schoondli chß oder schëëndli chß (schön Wetter verheißend). We nn’s einist Hi̦lwi fassed, su̦ will’s flŭ̦gs umschlaan. Es ist zwar möglich, daß es noch einen oder sogar einige Tage u̦s der Hilwi schoned; aber äs ist geng in hangende n Rächten; äs cha nn von ei’m Oị̈ge nblick ze’m and’ren umschlaan.
1
Henne 11.
2
Hugi 19.
3
BOB. 98.
4
Vgl.
Hann 176.
5
Jerosch 23.
6
Wie trefflich daher, wenn man nach der Aufforderung jenes Deutschen im Bädeker nachschauen könnte, ob’s eben jetzt auf jenem Berge Nebel geben werde.
7
Es mag an mhd.
heien (hüten, schützen, pflegen:
WB. 1, 649) und daraus abgeleitete Spezialbedeutung «verhüllen» gedacht werden.
7a
Vgl. auch Gw. Fremdenliste 1906, 5; Weltall 1, 483.
8
Vgl.
Tschudi 20;
Stud. P. 14.
9
Kluge 268.
10
Ebd. 410.
11
Entsprechend der ursprünglichen Adjektivbedeutung war «Wolke» lange Zeit dreigeschlechtig. Wir lesen «der»
wolke neben wahrscheinlichem «die»
wolke (Braune’s Lesebuch 246); «die»
wolke und «das»
wolken (
Mhd. WB. 3, 302), wie schon ahd. (
Graff. 1, 796 f.) «das»
wolchan.
12
Wyß 14 f.
13
E wietige Maan! e wietigi Frau! es wietigs Chind! Welch ein Mann usw. Wie an «welch» =
hewê-lîch (wie beschaffen?) und an «solch» =
sô-lîch (so beschaffen) unter Opferung des
ch die Endung -ig antritt und damit die deklinierbaren Adjektive
welig und
selig (letzteres durch Angleichung an ersteres zu einem Wortpaar) schafft, so wird aus Analogien wie «mäch-t-ig» ein erweitertes -tig geschaffen, vor welchem dann auch l fallen muß:
wettig und
settig oder unangeglichen:
söttig. Das ganze «lich» ist damit eliminiert, und als sein Neuersatz fügt sich «lh» oder «li» an das einfache Fragewort «wie»:
e
n wielha, e
n wielhi, es wieliß (wielichs), (
qualis, quale)! Ganz parallel dem Antritt an «so» unter dessen Assimilation durch das hinzugedachte
lîch:
e selha, e selhi, es seliß (
talis, tale). An «wie» tritt nun aber gleicherweise aud jenes
-tig: wietiga oder
wie n e wietiga! wietigi! wietigs! Interessant ist auch, wie die adjektivische Flexionsfähigkeit bis zur neuesten substantivischen (mit pluralischem Genitiv
-er) fortschreiten kann. Zu Niederried am Brienzersee sagt man: Settiger sellt men usig’heijen!
14
Zum
cumulo-nimbus:
Hann 219.
15
Mhd. «die»
hilwe und «das»
gehilwe (was den Himmel einhüllt:
WB. 1, 679) stellt sich zu der großen Wortgruppe
hil hal hâlen geholn (675 ff.), wozu hehlen, hüllen, Hülfe usw. gehört.
16
Solches
hääl ist als altes (unbelegtes)
hëlw aufzufassen und hat mit nhd. «hell» (alter Genitiv: «helles») nichts zu schaffen. Letzteres gehört übrigens auch nicht zu unserer Mundart, sondern wird hier im seiner erst nhd. optischen Bedeutung (vgl.
Kluge 164) durch
heiter und
luuter ersetzt.

Wijel.
14 cm hoch. Mit Schliff. Aus der 1. Hälfte des 19. Jhd.