
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
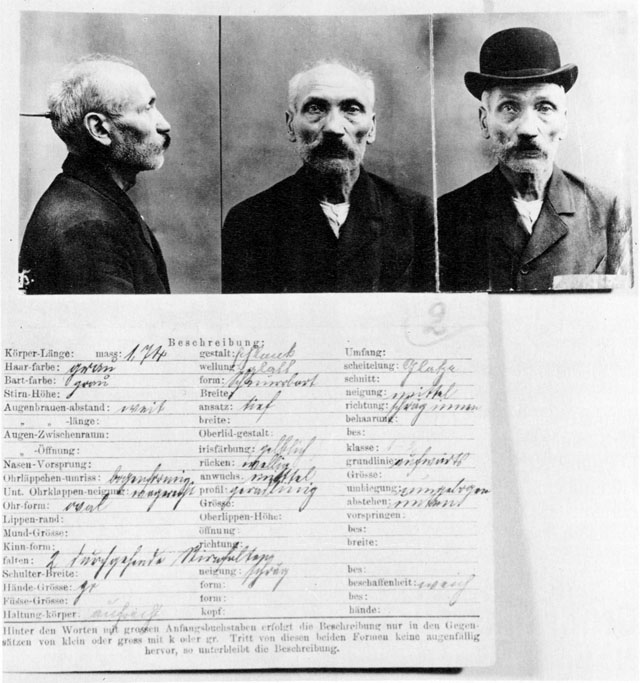
Es ist gewiß ein schwerer Schritt, wenn man aufs Ungewisse hinaus seinen Weg in die Fremde nimmt. Ich hatte die Hoffnung mit mir genommen, in der Ferne mein Glück zu suchen und zu finden, so setzte ich meinen Weg über Königsberg nach Danzig fort.
Königsberg, in bezug auf meine Rückerinnerungen, war mir nicht sympathisch. Danzig kannte ich noch nicht. Übrigens wollte ich die See sehen und setzte deshalb meinen Weg von Danzig nach Stettin über die Ostsee fort.
In Neufahrwasser traten mir zum ersten Male die großen Positionsgeschütze von Gußstahl in ihrer stattlichen Würde in greifbarer Nähe entgegen. Der Dampfer, mit dem ich die Überfahrt machte, hatte zwei Geschütze für die Befestigungen von Swinemünde geladen, und ich benutzte die Mußestunden während der Fahrt, mich mit dem Mechanismus der Geschütze vertraut zu machen.
Mein Reiseziel war Berlin. Ich fuhr mit der Bahn und traf, soweit ich mich erinnere, eines Sonnabends abends in der Hauptstadt ein.
Meine dort wohnende Tante hatte nach dem Tode ihres ersten Mannes wiederum eine Ehe geschlossen, und ihr Ehemann, mein Onkel, hatte sein ursprüngliches Schneiderhandwerk an den Nagel gehängt und sich mit einem gewissen Scharfblick für die Bedürfnisse der Zeit der Photographie zugewendet. Nachdem er in Tilsit seine Vorstudien beendet, war er anfangs der sechziger Jahre nach Berlin übergesiedelt. Ich nehme an, daß er in seinem Fache geschickt war, denn kurze Zeit, nachdem er in Berlin ein Geschäft eröffnet hatte, legte er auch in Köln am Rhein ein Zweiggeschäft an. Meine Cousine, seine Stieftochter, übernahm die Verwaltung des Geschäfts in Köln und meine Tante das in Berlin. Mein Onkel ließ die Sachen in Berlin arbeiten, die in Köln in Auftrag gegeben worden waren. Nebenbei hatte er auch eine Kunsthandlung aufgemacht.
Da nun meine Mutter und ihre Schwester in einem gesunden geschwisterlichen Verhältnis standen, so konnte ich mit Recht erwarten, daß sie mir die Unterstützung, deren ich in meiner bedrängten Lage benötigt war, auch zuteil werden lassen würde. Es war also keineswegs ein Sprung ins Dunkle, auch nicht die Lust am Großstadtleben, das ich ja damals noch nicht kannte, die mich nach Berlin geführt hatte.
Mit heimlichem Bangen schritt ich am Sonntagmorgen der Wohnung meiner Tante zu. Sie hatte mir immer durch ihre Ruhe und Festigkeit imponiert, und ich hatte ihr gegenüber kein gutes Gewissen. Dann aber wußte ich auch, wie unlieb es meiner Mutter gewesen wäre, wenn meine Tante Kenntnis erhielt von dem Schrecklichen, was sich in unserer Familie abspielte.
Der Eindruck, den ich damals von Berlin empfing, war keineswegs so imponierend, wie ich ihn mir immer in meiner Eigenschaft als Kleinstädter gedacht hatte. Ich war im Gegenteil etwas enttäuscht, denn die Bilder, die mir von Berlin in meiner Phantasie vorgeschwebt hatten, waren sehr übertrieben gewesen. Das einzige, was mich zunächst interessierte, waren die aus der Kriegsbeute von 1866 Unter den Linden aufgefahrenen Geschütze. Ich konnte mir den Genuß nicht versagen, Unter den Linden dahinzuschlendern und mit Interesse die ausgestellten Geschütze zu mustern. Ich hatte meinen Weg vom Stettiner Bahnhof zur Potsdamer Straße genommen und mußte deshalb die Geleise der ersten Berliner Pferdebahn überschreiten.
Sie war damals etwas ganz Neues und der Stolz der Berliner. Es war interessant, zu sehen, mit welchem Genuß die meisten die Strecke und die darauf laufenden Wagen betrachteten und, wenn sie im Wagen Platz genommen, zu hören, wie wohl sie sich fühlten, einmal von dem schrecklichen Omnibus auf eine kurze Zeit erlöst zu sein.
Meine Verwandten waren zunächst überrascht und dann auch erfreut, daß ich sie so unverhofft besuchte. Meine Mutter und ihre Schwester hatten sich seit langen Jahren nicht gesehen. Der Briefwechsel war auch bei dem damaligen hohen Porto aufs Mindestmaß beschränkt worden, und so gab's denn sehr viel zu erzählen.
Ich fühlte instinktiv, daß ich im Sinne meiner Mutter handelte, wenn ich die Leiden, denen sie ausgesetzt war, vor ihrer Schwester nicht bloßlegte. Aber ich habe dieses Verschweigen später ebenso bedauert, wie daß ich mein eigenes Verschulden nicht offen meiner Tante eingestand. Es hielt mich zunächst ein gewisser Trotz davon ab, jener Trotz, der die Folge davon ist, daß man sich schämen muß.
Ich verschaffte mir bald Arbeit, und da ich schon damals ein verhältnismäßig geschickter und aufmerksamer Arbeiter war, so würde sich mein Leben wohl bald in ruhigere Bahnen gelenkt haben, wenn ich in der Werkstätte allein gearbeitet hätte. Die besser situierten Kollegen fingen nämlich über meine dürftige Kleidung und mein bescheidenes Auftreten, welches mit Rücksicht auf den kargen Inhalt meines Portemonnaies für mich eine Notwendigkeit war, zu spotten und zu hänseln an.
Da man in solch jungen Jahren Spott am allerwenigsten vertragen kann, so ist es nicht zu verwundern, daß in mir eine Mißstimmung über meine augenblickliche Lage rege wurde und daß ich unzufrieden wurde, ohne es eigentlich nötig gehabt zu haben.
Unglücklicherweise bekam ich in dieser Zeit eine Postanweisung zugestellt, in welcher eine Schuld von drei Talern an mich abgeführt wurde. Die Aushändigung der Postanweisungen fand damals in anderer Weise statt als heute. Der Empfänger der Postanweisung mußte dieselbe quittieren und das Geld für den eingezeichneten Betrag gegen Vorlegung der Postanweisung bei dem Postamt selber oder durch einen Vertreter in Empfang nehmen.
Nun hatte der Aussteller der Anweisung die Ausfüllung etwas mangelhaft vorgenommen, und als ich sie zum Quittieren in der Hand hielt und einen Blick auf die obere Seite der Anweisung warf, da fiel mir wie ein Blitz der Gedanke ein:
»Wenn du hier eine ›2‹ vorschreiben würdest und hinter die mit Buchstaben geschriebene ›Drei‹ zwanzig schreibst, so erhältst du statt drei – dreiundzwanzig Taler!«
Das war mehr ein Augenblickseinfall, der meine Neugierde rege machte, als die Absicht, mir wirklich zwanzig Taler mehr zahlen zu lassen. Trotzdem nahm ich kurz entschlossen die Feder, füllte in der oben angegebenen Weise die Postanweisung aus, quittierte und begab mich dann aufs Postamt, neugierig, ob man mir wirklich den Betrag aushändigen würde.
Ich war selbst ganz erstaunt, als der Beamte am Schalter, ohne irgendeine Einwendung zu machen, dreiundzwanzig Taler statt drei aushändigte.
Daß durch die Buchung der Anweisung der Fehlbetrag festgestellt werden konnte, fiel mir gar nicht ein. In meiner Freude kaufte ich mir bessere Kleidungsstücke und dachte: »Nun bist du ein gemachter Mann und aller Not enthoben!«
Als ich wieder in die Werkstatt zurückkehrte, erzählte mir mein Meister, daß ein Postbeamter in Begleitung eines Herrn in Zivil dagewesen sei und nach mir gefragt habe. Da begann es mir allerdings zu dämmern, daß die ganze Sache doch nicht so arglos verlaufen würde, wie es mir ursprünglich vorgeschwebt, und um den etwaigen Folgen zu entgehen, machte ich mich, wie viele in der gleichen Lage getan hätten, auf die Flucht.
Über das Wohin war ich mir in solcher Lage nicht klar, und da eine Flucht auch Geld kostet, mein Geldbeutel aber wieder an der Schwindsucht litt, so dachte ich: »Ist es dir einmal geglückt, glückt's dir auch wieder!«
Ich versuchte es zum zweiten und zum dritten Male, und es gelang mir immer wieder. Schließlich war ich doch dreist geworden und hatte die Postanweisungen in nachlässiger Weise ausgefüllt, so daß die Schrift zweierlei Tintennuancierung aufwies. Das fiel dem Beamten am Schalter auf, er ließ mich festhalten, und es stellte sich heraus, daß ich noch mehrere Anweisungen gefälscht hatte.
Man muß hier immer beachten, daß diese Fälschungen in eine Zeit fallen, wo noch das alte Strafgesetz, das jetzt lange bei den Toten liegt, gültig war. Nach dem heutigen Gesetz konnte ich überhaupt dieser Angelegenheit wegen nicht mit Zuchthaus bestraft werden, weil ich bei Begehung der Tat noch nicht das achtzehnte Lebensjahr erreicht hatte. Außerdem verhält sich auch das zulässige Strafmaß von damals zu dem heutigen wie vier zu drei, und schließlich hatte der Vorsitzende des Schwurgerichts die beantragten mildernden Umstände abgelehnt mit Rücksicht darauf, daß es öffentliche Urkunden waren, die ich gefälscht hatte. Nur von diesem Gesichtspunkte aus ist es erklärlich, daß der Gerichtshof zu dem Urteil kommen konnte, wie es bei den Akten liegt und welches lautete: »Zehn Jahre Zuchthaus und fünfzehnhundert Taler Geldstrafe oder – noch zwei Jahre Zuchthaus«, in summa also 12 Jahre Zuchthaus.
Ich war der Verzweiflung nahe; denn wenn ich auch schuldig war, so kann ein siebzehnjähriger Mensch die Tragweite seiner Handlungen nicht klar bemessen, sofern es sich um Urkundenfälschung und dergleichen handelt. Nach Ansicht des Vorsitzenden der Strafkammer vom 1. Dezember 1906 wären heute solche Urteile nicht mehr möglich.