
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
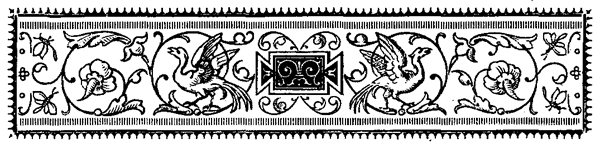
Wo immer – so weit unser Wissen ein Urteil gestattet – der Trieb zu bilden sich in einem Stamme oder Volke regte, hat er sich sehr bald mit dem Kreise der religiösen Vorstellungen verknüpft. Vielleicht darf man sogar annehmen, daß nicht die äußere Welt der Erscheinungen es war, was zur Nachahmung reizte, sondern daß der Mensch zuerst das innerlich Empfundene oder Geschaute zum Sichtbaren gestalten wollte. Sprache, Mythus und Kunst, Familie und Staat sind sicherlich durch die äußeren Verhältnisse in ihrer Entwickelung mitbestimmt worden, aber ihr Ursprung muß im Innern des Menschengeistes gelegen haben. Ein innerer Drang, die geistige Welt mit Hilfe der äußeren auseinanderzufalten, war die bewegende Kraft. So mußten auch zuerst im Geiste gewisse religiöse Vorstellungen oder Gefühle wach gewesen sein, ehe der Drang, sie zu verkörpern oder in äußeren Gebilden wenigstens andeutend (symbolisch) zu gestalten, sich regen konnte.
Nach dem Wesen der Völker hat sich nun die Kunst gestaltet, aber bei allen, welche in der uns bekannten Geschichte der Menschheit eine höhere eigenartige Gesittung erreicht haben, war die Kunst in ihren Ausgängen, wie in der Blüte religiös, und hing auf das Innigste mit den Vorstellungen über Götter, Seele, Fortleben u. s. w. zusammen.
Todtenmale, Tempelbauten und Götterbilder stellen sich als Ursprung des Kunstschaffens dar; dasselbe steht also vom Beginn im Dienste geistiger Bedürfnisse und nicht der bloßen Lebensnotdurft, ahmt daher nicht etwa Aeußeres nach, sondern verkörpert mit Hilfe desselben Inneres. Das geht soweit, daß Gebilde entstehen konnten, welche der Wirklichkeit ganz widersprechen, vielköpfige und vielarmige Gestalten, Götter mit Tierköpfen, Göttinnen mit vielen Brüsten. Es galt eben, das im Geiste als einen Gedanken Geschaute zu verkörpern, nicht aber etwas Vorhandenes nachzuahmen. Es herrschte unbedingter Idealismus, welchem die Schönheit als Vergeistigung des Seienden noch ganz unbekannt war.
Den Griechen erst gelang es, sich allmälig aus den Banden dieser alten Anschauungen zu befreien, ohne jedoch den durchaus religiösen Inhalt der höchsten Kunst aufzugeben. Auch sie stellten in ihren größten Schöpfungen Göttliches dar, den Inhalt ihrer Mythen und die sittlich-religiösen Leitbilder, zu denen sie allgemach, ihre Götter gestaltet hatten. Aber nicht mehr wurde das Göttliche in wirrer Gliederhäufung geschaut, sondern in reinen schönen Formen. Befreit von allem, was im Leben die Gestaltung des Geistigen im Menschen zu hindern vermag, frei von entstellenden Leidenschaften, wuchsen die Leitbilder in dem schauenden Gemüt der Künstler. Ein Zeus von Olympia, eine Venus von Milo, die Pallas Areia, die argische Hera des Polyklet waren wirklich die Göttlichen, wie sie sich dem sehenden Geiste ihrer Schöpfer geoffenbart hatten, Menschen zwar ihrer Form nach, aber hoch erhoben über alles Zufällige und Hemmende, still ruhend in ihrer reinen Göttlichkeit. Phidias hatte den Zeus so gestaltet, daß die Hellenen in dem Bilde die unübertreffliche Verkörperung des höchsten Gottes sahen. Und so sehr entsprach sie dem Volksgeiste, daß nachfolgende Künstler sich an die Schöpfung des Phidias halten mußten – noch im Zeus von Otrikoli vernimmt so das lauschende Auge den Nachhall des ursprünglichen vollen Klangs.
Die höchste Kunst hätte indessen dem Volksgeiste nicht die Ideale seiner Götter schaffen können, wäre nicht in den Seelen der großen Künstler der Glaube lebendig gewesen. Wohl mochten sie fühlen, daß nicht jeder Gestalt der Volksreligion ein Gott im Olymp entspräche, aber das Göttliche selbst, die sittlich religiösen Mächte empfanden sie als etwas Wirkliches, an diese glaubten sie und das war's, was ihrem Schaffen eine religiöse Weihe gab.
Die Römer erscheinen den Hellenen gegenüber als Bettler, was künstlerischen Geist betrifft; sie nahmen die Bildungen der Griechen an.
Als dann das Weltreich sich von der Höhe zu neigen begann und das Christentum unter Leid und Blut seinen Weltgang antrat, da bemächtigte es sich der Formen der absterbenden antiken Kunst, wie wir es in den Katakomben sehen. Wieder galt es weniger ästhetische Ziele zu erreichen, als einen bestimmten Glaubensinhalt anzudeuten. Das ganze Wesen des ältesten Christentums war nicht gerade, wie man oft meint, kunstfeindlich, aber der schöne Schein konnte gegenüber den so scharf ausgeprägten übersinnlichen Hoffnungen seinen Wert unmöglich erhalten. Aber dennoch blieben in den ersten sieben Jahrhunderten noch immer antike Ueberlieferungen maßgebend, bis sie endlich in Ostrom ganz erstarrten. Im Westen sehen wir die Kunst nach neuen Formen streben, aber die sogenannte Romantik, so viel sie von neuerem Geiste enthält, bleibt unbehilflich, wo es sich um Werke der Malerei und Bildhauerei handelt. Erst in der Gothik gewinnt der Glaube wieder schöpferische Kraft. Mochten auch die Formen oft weit von dem hellenischen Leitbild des Schönen entfernt sein, das hinderte nicht die Entfaltung des Innenlebens, so weit es sich im Antlitz spiegelt. Und es waren vornehmlich die mit dem Religiösen verbundenen Gefühle, welche wir verkörpert finden: Andacht, kindliche Hingabe, innige Frömmigkeit, Seelenfrieden. Selten kennen wir die Meister jener Bildwerke, welche die gothischen Dome schmücken, sei es im engsten Zusammenhange mit baulichen Gliedern, oder auf den Altären. Aber der Inhalt der Werke offenbart uns, daß in den Seelen der Schöpfer Glaube lebendig war, wie einst bei den Künstlern von Hellas.
Derselben Thatsache begegnen wir in der Malerei der Zeit, sowohl in Deutschland, wie in Italien. Und das setzt sich fort hier in das Jahrhundert der Blüte hinein, wo sich die Wiedergeburt der schönen Erscheinung vollzog und man zur Natur und zur Antike zurückkehrte, dort ins Zeitalter der Reformation.
Indessen hatte aber auch die Bildung dessen begonnen, was wir als »modernen« Geist bezeichnen, und schritt langsam, aber stetig fort. Bald hier, bald dort rüttelten Zweifelsucht und Verstand an dem Ueberlieferten; indem die kirchliche Anschauung von den zersetzenden Einflüssen ergriffen wurde, litt auch deren religiöser Wahrheitsgehalt. Nur in Spanien blieb die Herrschaft der kirchlichen Gedanken fast unberührt, und nur hier erreichte die religiöse Kunst wieder den Gipfel, während sie sonst überall im Niedergange sich befand. In Italien zehrte sie am Formenschatz der Renaissance, in Deutschland verlor sie auch innere Kraft. So ging die Zersetzung bis in den Beginn unseres Jahrhunderts hinein. Da begann sich wieder in den Gemütern der Widerstand gegen die Vernüchterung der Religiösen zu regen, die Gemüter hungerten und so entstand auch in der Kunst die Romantik. Und wieder sehen wir dieselbe Erscheinung: in den Seelen der Künstler wird als innere Triebkraft das religiöse Bedürfniß mächtig erregt und sucht nach Formen, vornehmlich bei den Deutschen. Wieder lebendig wird der Glaube, obwohl zuweilen dogmatisch eingeengt, aber doch aufrichtig und aus dem Gemüte geboren.
Aber die Verneinung, im vorigen Jahrhundert mehr vernünftelnd und durch Spott zersetzend, ward indeß selbstbewußter und bemächtigte sich der Waffen der sogenannten »Erfahrungswissenschaften«. Der materialistische Geist gewann immer mehr an Boden und begann sich auch in der Kunst zu äußern. Immer seltener wurden die Werke, in welchen tiefsinnige Religiosität zu Tage trat, oder die Stoffe des Kreises wurden zu Stoffen wie jeder andere; man behandelte sie »realistisch«, studirte z. B. den heutigen Orient, um die Menschen, die Landschaft und das Licht so »echt« als möglich zu geben.
In den Berliner Ausstellungen der letzten Jahrzehnte vermochte man diesen Entwickelungsgang zu beobachten, die religiöse Kunst Deutschlands glitt immer tiefer hinunter und nur sehr wenige Künstler von höherer Begabung behandelten sie mit entsprechendem Sinn.
Inzwischen aber war auf anderen Gebieten wieder der Geist des Widerstandes gegen die verneinenden Strömungen wach geworden. In der Philosophie und Ethik wurde der Materialismus bekämpft, und selbst in den Naturwissenschaften begann man zu erkennen, daß die bloß mechanische Bewegung nicht im Stande sei, als Schlüssel zum Welträtsel zu dienen. Auf religiösem Gebiete stieg die Erregung langsam, begann sich, ohne gewisse Errungenschaften der forschenden Kritik aufzugeben, der tieferen Auffassung des religiösen Problems zuzuwenden; man erkannte, wie viel Schäden der Zeit im innigsten Zusammenhange stehen mit der Nichtachtung der Religion. Die leichter bewegliche Dichtung hat schon seit Jahren in mannigfachen Formen die Notwendigkeit einer religiösen Erneuerung betont; von Jahr zu Jahr mehrt sich die Zahl der religiösen Gedichte, der Romane und anderer poetischer Werke, in welchen sittlich-religiöse Fragen mehr oder minder eingehend behandelt werden. Mag auch die Kunst an sich dabei zumeist wenig gewinnen, so beweist die Thatsache doch, daß sich die Geister in erhöhter Spannung befinden und man diesem Anschauungskreise wieder eine viel höhere Bedeutung zumißt, als es durch Jahrzehnte der Fall gewesen ist.
Ist eine derartige Bewegung eingeleitet, so steht sie nicht leicht stille, hat der neue Geist sich erst einer Kunst, hier also der Dichtung, bedient, so versucht er auch durch andere zu wirken. Allem Anschein nach tritt jetzt auch die Malerei in die Bewegung ein: die Zahl der religiösen Bilder beginnt zu steigen und zugleich die Auffassung sich zu vertiefen.
Manche Künstler bedienen sich noch der herkömmlichen Formensprache. So Georg Papperitz (München) in seiner »Kreuztragung Christi«. Die Anordnung der Gruppen wie der Farben zeugt von künstlerischem Geschmack, Körper und Gewänder sind gut gezeichnet und mit Fleiß behandelt. Aber es fehlen zwei wichtige Eigenschaften: Selbstständigkeit der Auffassung und Freiheit in der Wiedergabe des Gefühlsgehalts. Der römische Hauptmann, der Knecht, welcher links von der Rückseite sichtbar ist, Maria, welche hinter dem zusammengebrochenen Christus vortritt: alle diese Gestalten sind aus Erinnerungen hervorgegangen: der Hund in der unteren linken Ecke, wie das Weib rechts im Hintergrunde, welches das Wassergefäß trägt, dienen zu sichtlich als bloße Füllungen. Andererseits ist das Empfindungsleben zu sehr gebunden, so, daß es auf keinem Angesicht mit voller Kraft und Innerlichkeit zu Tage tritt. Auch nicht auf jenem Maria's. Zu loben ist übrigens, daß die Haltung der Gestalten vom Bühnenmäßigen frei gehalten erscheint.
In edler Weise aufgefaßt ist das Christusantlitz auf »Christus und Ischarioth« von C. A. Geiger (Wien). Der Verräter hat sich rasch genähert und will eben, indem er beide Arme um Christus schlingt, den Kuß auf dessen Lippen drücken. Der Erlöser macht mit den Händen eine leise abwehrende Bewegung und senkt den Blick in das Antlitz des Judas. Ernst und traurig, aber hoheitsvoll ist der Ausdruck des Gesichts. Den Gegensatz hat der Künstler etwas zu absichtlich betont, indem er das häßliche Antlitz des Ischarioth ganz in Schatten tauchte. Trotz einzelner Verzeichnungen, besonders am Halsansatz bei Christus, und der sichtlichen Beeinflussung durch Titians »Zinsgroschen«, ist das Ganze eine achtungswerte Arbeit.
Ganz unter dem Einfluß der Ueberlieferung ist Julius Grüns (Berlin) »Madonna mit dem Kinde: Liebet Euch unter einander!« Das Christuskind steht, von der bis zum Knie sichtbaren Maria leise gehalten, auf eine Art von Mauervorsprung und breitet die Hände segnend aus. Die Art wie der Kopf in Form und Ausdruck aufgefaßt ist, beweist die alte Wahrheit: wenn einmal ein großer Geist aus dem Tiefsten seines Wesens heraus irgend eine künstlerische Idee geschaffen hat, dann wirkt diese Verkörperung auf die Einbildungskräfte der Nachkommenden mit zwingender Gewalt. So hat Raffael das »Christuskind« geschaut und dann geschaffen: wenn man den Begriff »Dreieinigkeit« in dessen geistigem Urkern aufgefaßt hat – nicht so wie der bloße Verstand sich ihn zum Widersinn entfaltet – so findet man in dem Jesu der sixtinischen Madonna dieselbe verkörpert Aus diesem Antlitz blickt uns das Schaffende, das Erlösende und Erleuchtende zugleich entgegen. Die Nachfolger fühlen die Uebergewalt und müssen sich an verwandte Formen halten.
Es ist ganz begreiflich, daß sich Verkörperungen, wie Raffaels Christkind auf dem genannten Bilde, welche man als vollendeten Ausdruck der »Idee« bezeichnen muß, so tief in die Seele der Beschauer einprägen, daß sie ihm zum unbewußten Maßstabe jeder neuen Schöpfung werden. Im Kunsturteil, wie im Kunstgefühl wirkt immer die Gesellschaftung von Vorstellungen mit. Nichts, was durch die Pforte der Sinne in unseren Geist eintritt, kann in ihm für sich selbst ein abgeschlossenes Dasein führen, es sucht sich mit Verwandten zu vereinen. So weckt jedes neue Madonnenbild in uns die Vorstellung schon gesehener, und dasjenige, welches den tiefsten Eindruck auf uns gemacht hat, wird besonders lebhaft vor dem inneren Sinn erstehen und den Vergleich hervorrufen.
Das kann natürlich oft die Wirkung eines Kunstwerkes stören. So ist's der Maria Defreggers gegenüber. Sie schwebt, das Kind auf dem Arme, umgeben von Engelsköpfen, in den Wolken. Man darf mit annähernder Bestimmtheit sagen, daß das Gemüt des Künstlers religiös ergriffen war, als es den Gedanken dieser Schöpfung faßte. Aber die Phantasie mußte sich im Allgemeinen an Vorhandenes anschließen. Wo sie jedoch davon abwich, ist's nicht gerade zum Vorteil des Werkes geschehen. Defregger hat die trauernde Mutter allzusehr betont, also das sogenannte »Menschliche« und hat dadurch den religiösen Gehalt geschädigt. Wenn ein Künstler die Gottesmutter darstellt, – und das geschieht indem er sie in Wolken schweben läßt, – so muß er der »Idee« getreu bleiben. Dann darf er aber nicht die tiefe Trauer des Weibes, er soll die Verklärung, den überwundenen Schmerz darstellen. Wohl mag sich hoher Ernst oder etwas Wehmütiges über das Antlitz breiten, aber durch denselben muß, wie siegende Sonnenstrahlen durch Wolken, himmlische Freude blitzen, das klare Wissen, daß des Kindes Tod das Werk der Erlösung abschließen werde. Eine Maria unter dem Kreuze mag uns in ihrem Antlitz all die Schmerzen der Mutter zeigen, die über Irdisches erhobene darf es nicht, nicht in diesem Maße. Defreggers Jesus ist ein herziges Kind, aber ein Kind, wie jedes andere.
Hans Canons, des vor einiger Zeit gestorbenen Wiener Malers »Altargemälde« altertümelt in der ganzen Auffassung, die thronende Madonna ist inhaltsleer. Auch die seltsame »Verkündigung« des Engländers Jones, obwohl vortrefflich gemalt, wirkt nicht rein religiös – die Auffassung des Engels mit seinem Broncegewande und die der Jungfrau wecken mehr Befremden, als daß sie das Gemüt irgend wie tiefer berührten.
Von allen Bildern, welche mehr oder minder auf den Bahnen der älteren religiösen Kunst gehen, stehen wohl »Die heiligen drei Könige« Schraders, des Altmeisters, am höchsten. Wol läßt sich nicht leugnen, daß die Auffassung in manchen Einzelheiten von Ueberlieferungen bestimmt ist, aber dabei macht sich dennoch im Allgemeinen Selbstständigkeit geltend und die technische Leistung verdient warme Anerkennung. Vor Allem aber thut wol die innere Ergriffenheit des Künstlers, welche sich auf allen Gesichtern, in der Haltung und Bewegung der Hauptgestalten spiegelt. Hier ist eben das, was ich bei den griechischen Bildhauern als »Glauben« bezeichnet habe, noch eine lebensvolle Kraft; nicht gerade Glauben im dogmatischen Sinne, aber jene religiöse Stimmung des Gemüts, welche der Künstler haben muß, wenn er dieses Stoffgebiet betritt.
Ein anderes Bild Canons »Loge Johannis«, ausgezeichnet durch kraftvolle und leuchtende Farbe, faßt den Stoff in symbolischer Weise auf. Auf einem reichen Thronstuhl sitzt Moses – das Antlitz ist stark von Michel Angelo's Vorbild beeinflußt – auf dem Schooß ein großes Buch, jedenfalls das alte Testament. Auf demselben steht das Jesukind, rechts kniet der Täufer und unten zwei Gestalten, welche mir Papst und Kaiser zu bedeuten scheinen; ganz klar ist mir das nicht geworden. Links vom Thron zeigt ein aufgeschlagenes Buch die Worte »Liebet Euch unter einander«. Der ganze Aufbau zeichnet sich durch Vornehmheit aus – der innere Zusammenhang der Gestalten aber tritt nicht genügend hervor.
In mehr äußerlicher Weise ist der religiöse Stoff ergriffen von Heinrich Sziemiradzki (Rom), dem Urheber der »Fackeln Nero's« auf dem Bilde: » Christus bei Maria und Martha«, welches mehr Landschafts- und Architekturstudie, als religiöses Gemälde ist. Links im Hintergrunde steht das orientalische Haus, von welchem ein Weinlaubgang in den Vordergrund führt. Die häusliche Schwester kommt durch den Vignengang, die Andere sitzt zu den Füßen Christi, rechts im Hintergrunde ragen aus einem tiefer gelegenen Hofe Oliven empor. Gemalt ist das Ganze vortrefflich, aber das Gemütsleben der drei Gestalten ist ziemlich oberflächlich wiedergegeben. Als kennzeichnend für die Veräußerlichung, in welche die neuzeitlichen Realisten so leicht verfallen, kann der Riesenumfang des Bildes gelten. Je weniger sich ein Künstler in das Innere versenkt, desto mehr sucht er dann durch äußere Größe zu wirken.
Dieselbe Schwäche zeigt Alex. Golz (München) auf » Christus und die Frauen«. Christus selbst gleicht mehr einem Docenten, als dem Erlöser, der Zug der Liebe tritt nicht genug hervor; die Frauengestalten sind zu überfeinert. Doch verdient die Malerei Lob, die leichte graue Stimmung schließt das Ganze zu feiner Wirkung zusammen.
Auch bei Marcus Grönvold (München) » Christus in der Wüste« ist das Geistige nicht tief genug ergriffen. Es war schon ein Fehler, die Wüste so zur Hauptsache zu machen. Nur mühsam brechen einige Mondesstrahlen aus den Wolken und werfen Dämmerschein auf die steinige Wüste, in welcher Christus nach dem Vordergründe herüber schreitet. Er hat ein Antlitz, welches mehr grüblerisch und verkämpft aussieht, als Tiefe des Gemüts verrät. Bei solchen Bildern sollte der Künstler die Landschaft viel mehr zurücktreten lassen; unsere nachschaffende Einbildungskraft sieht die Wüste auch dann, wenn nur der Boden steinigt ist und das Licht uns die Dämmerung der Mondnacht anzeigt, der ringende und betende Christus ist die Hauptsache.
Aehnlich hat der Engländer Grodal »Die Flucht der heiligen Familie« behandelt. Die große Landschaft stellt eine ägyptische Abendlandschaft dar, in welcher die Gruppe der Entflohenen nur als Staffage erscheint.
Mit gesundem Wirklichkeitsgefühl, aber dabei mit Hervorhebung des Idealen hat A. Wolff (München) den Auftritt zwischen Christus und der Ehebrecherin behandelt. Der Vorgang scheint in einen Teil des Tempels verlegt; wenn auch vom Standpunkt des Archäologen die von der Einbildungskraft vollzogene Neuaufrichtung manche Bedenken erregen könnte, so wird doch der Kunstrichter nichts einwenden, denn der Raum ist mit malerischem Sinn geschaffen. Der jüdische Tempelpriester in kostbarem gelben Ueberwurf und den Turban aus dem Haupte weist mit fragender Miene auf die vor Christus knieende, blondhaarige Sünderin hin. Dieser, ebenfalls blond und mit rötlichem Barte, über dem weißen Untergewand einen grünlichen Ueberwurf, blickt dem Eiferer mit hoheitsvollem Ernste ins Antlitz und streckt die Linke nach dem zerknirschten Weibe aus. Links vom Beschauer drängen aus dem Hintergründe Menschen herein, rechts sind mehrere Gruppen, darunter einige Männer, die mit finsteren Blicken nach Christus sehen. Mit Feinheit ist der Eindruck des Vorgangs auf den Gesichtern dargestellt und je nach Eigenart der Zuschauer abgestuft; die Haltung der Gestalten ist lebendig empfunden, die Lichtverteilung überlegt, die Malweise kräftig, ohne Rohheiten. Christus selbst fesselt sofort das Auge durch die edle Haltung und das trotz allem Ernst milde Antlitz.
Recht unglücklich wirkt der mißlungene Realismus auf »Lasset die Kindlein zu mir kommen« von Wilh. Stryowsky (Danzig). Christus, ein blondbärtiger, sehr wohlgenährter Mann, sitzt und hält ein Kindchen zwischen den Knieen, ein zweites bietet ihm Blumen, ein drittes kauert rechts mit der Schiefertafel und andere drängen sich überallher zu ihm. Die Kleidung ist zumeist so, daß man nicht recht weiß, welchem Zeitalter sie angehört, die Farbenstimmung ist zerrissen und geschmacklos. Am meisten aber befremdet der »gemütliche« Christ, den man nicht für den Erlöser, nicht einmal für den Religionsstifter in Straußischer Anschauung halten kann.
Noch einen Schritt weiter im Realismus geht Herm. Prell (Berlin) mit seinem »Judas Ischarioth«. Er ist nicht nur ein begabter Maler, sondern auch ein strebsamer Künstler, welcher das Aeußere des Menschen aus dem Innern heraus zu gestalten sucht. Zeuge dessen ist auch dieses Bild. Ein abfallender Hügelrücken, nach links hin ziemlich jäh abstürzend, so daß sich noch der Blick in die Landschaft öffnet, bildet den Hintergrund. Vorn steht eine Gruppe von drei Männern; links vom Beschauer Judas in zerrissenem, härnenem Gewande, umgürtet mit einem losen Strick, den die rechte Hand umfaßt hält; rechts, von der Seite sichtbar, ein alter, vornehm gekleideter Jude mit dem Turban auf dem Haupte, mit stark geschwungener Nase und langem Bart; die rechte Hand ist, mit Silberstücken gefüllt, vorgestreckt, die linke greift, um noch mehr zu holen, in eine umgehängte Tasche. Zwischen Beiden, aber etwa einen Schritt weiter hinten, steht ein zweiter Jude und berührt den Arm des Judas. Dieser selbst befindet sich offenbar in heftigem Kampf; die Linke hat fast krampfhaft in den langen, roten Bart hineingegriffen, der Kopf ist ein wenig gesenkt; aber die Augen starren vor sich hin. Die Haltung der Gestalten, der Ausdruck der Mienen und besonders die Handbewegungen sind außerordentlich lebensvoll, markig und entschieden. Aber trotzdem hat das Bild einen Fehler: Judas erscheint zu sehr übertrieben, nicht nur sind Haar und Bart von häßlichstem Rot, auch das Gesicht trägt den Stempel der Gemeinheit zu stark ausgeprägt an sich. Der Künstler hätte bedenken müssen, in welcher Art der Verräter den Schergen Christus kenntlich macht. Wenn man als Realist sich das Aeußere eines Charakters im Anschluß an irgend ein Modell entwickelt und nur gewisse Züge stärker betont, so ist man auf dem halben Wege stehen geblieben. Der echte Realist muß wie der echte Idealist von der inneren Vorstellung des Charakters ausgehen, diese kann er jedoch nur durch die Kenntnißnahme bezeichnender Handlungen gewinnen. Aus dieser heraus wird er zum »innerlichen Schauen« gelangen; d. h. die künstlerische Phantasie wird ihm den betreffenden Menschen vor das innere Auge führen. Man wende mir nicht ein, daß der Maler das nicht nötig habe, weil er zuweilen ein ganz passendes Modell finde. Zugegeben: aber was heißt »passend«? Es muß doch zu etwas passen, und dieses » Etwas« ist ebendie, vielleicht halb unbewußt, in der Phantasie schon lebende »Vorstellung«, welche sich aus den inneren Eigenschaften der Gestalt heraus entwickelt hat. Das Urteil »Dieser Mensch paßt zu einem Judas«, – drückt eben nur aus, daß die Uebereinstimmung zwischen dem innerlichen Bilde und der neuen sinnlichen Wahrnehmung plötzlich in das Bewußtsein eingetreten sei.
Oben ist der Vorgang des Verrats als besonders kennzeichnend betont worden. Die Art, wie Judas spricht, schmeichelnd und gleißnerisch, wie er Kuß und Umarmung als Zeichen für die Schergen verwendet, hätte als Hauptquelle für die schaffende Kraft dienen müssen. Dann aber wäre nicht ein solches offenbares Verbrecherantlitz gestaltet worden, sondern eines, in welchem die Fähigkeit, sich zu verstellen, angedeutet war. Der Judas Prells aber ist wol einer Gewaltthat fähig, aber ganz gewiß nicht der Verstellung. Trotz dieses Mangels, den übrigens wenige empfinden werden, verdient das Bild Anerkennung. Geschmacklos ist's aber, daß die Gestalten, wo doch dem landschaftlichen Hintergrund so viel Raum gegeben ist, nur bis zu den Knieen gemalt sind.
Ein sehr merkwürdiges Bild stammt von Albert Keller (München): »Die Erweckung von Jairus Tochter«. Der Künstler, ursprünglich ein Schüler Rambergs, verdankt seine künstlerische Ausbildung hauptsächlich sich selbst. Seine ersten Arbeiten zeichneten sich durch ungewöhnliche Feinheit der malerischen Stimmung und außerordentlich sorgfältige Ausführung der Einzelheiten aus, welche jedoch niemals in Kleinlichkeit ausartete. Während Keller im Süden Deutschlands eines bedeutenden Rufs sich erfreut, ist er im deutschen Norden fast unbekannt.
Das gestaltenreiche aber mäßig große Gemälde bedeutet in gewisser Hinsicht einen ungeheuren Fortschritt. Für die gewählte Auffassung des Vorgangs ist die Charakteristik, obwohl sie fast an Naturalismus streift, ungewöhnlich kraftvoll, bei einigen Gestalten ergreifend.
Den Ort des Vorgangs bildet eine Art von Halle, gestützt von kostbaren Säulen, und nach dem Hintergrunde hin offen. Christus, rechts im Vordergrunde stehend, hat kurz vor dem dargestellten Augenblick sein »Erwache« gesprochen. Jetzt beugt er sich mit mildem Lächeln ein wenig nieder, um die Erweckte zu stützen. Sie hat den Oberkörper aufgerichtet, ihre Linke ruht in jener Christi, die Rechte hat sie an die Wange gelegt. Der Blick des Auges zeugt für bedeutende Künstlerschaft, denn er ist wahrhaftig wie der eines Menschen, welcher, kaum den Schrecken der Unterwelt entronnen, noch an der Schwelle des neuen Lebens zögert und starr und weltfremd in den Tag hineinblickt. Im Hintergrunde und von der Seite her drängen sich Gestalten, Männer und Weiber, nur eine Frau, vielleicht die Mutter, liegt wie besinnungslos vor Schmerz zu den Füßen der Erweckten. Namenloses Staunen, Schmerz und Freude gemischt, liegen auf den meisten Gesichtern.
Diese Auffassung des Vorgangs ist trotz aller Vorzüge nicht frei von Schwächen. Erstlich stört mich die Gestalt der Mutter. Wenn Christus, der Wunderthäter, erwartet wurde, so ist doch kaum denkbar, daß nicht auch die Mutter von Hoffnung ergriffen worden wäre. Ich glaube, der Künstler hätte für seine großen Gaben gerade hier eine sehr dankbare Aufgabe gehabt: zu zeigen, wie die Erweckung der Tochter auf eine liebende, schmerzgebrochene Mutter wirkt. Leicht wäre der Vorwurf nicht, aber Keller könnte ihn sich stellen. Dann befremdet, daß kein einziger der Anwesenden seinen Blick auf Christus wendet. Es ist richtig, der Augenblick ist jener unmittelbar nach der Erweckung: die Zeugen stehen unter dem Bann des Unerhörten, aber einige davon müßten eben des Wunders wegen, nachdem die Bedeutung des Geschehnisses ihnen blitzschnell aufgetaucht ist, ihren Blick nach Christus wenden, Staunen und tiefe Bewegung im fragenden Auge. Ich glaube sicher, das hätte die geistigen Beziehungen des Bildes erheblich bereichert.
Die technische Leistung ist an sich eine sehr bedeutende, aber gefahrlos ist Kellers Richtung nicht, denn in folgerichtiger Entwicklung müßte sie zum »Impressionismus« führen.
Besonderes Aufsehen haben in den letzten Jahren einige Bilder von Fritz von Uhde (München) erregt: »Lasset die Kleinen zu mir kommen« und »Herr Jesu Christi sei unser Gast«.
Der Gedankenkreis, aus welchem Uhde's Auffassung hervorgegangen ist, läßt sich unschwer aus den Arbeiten erschließen. Der Künstler muß eine nicht gewöhnliche ethische Tiefe und religiöse Innigkeit besitzen und hat erkannt, daß ein großer Teil des Elends der unteren Schichten seinen Ursprung habe in der Entfernung von religiösem Leben, vom Christentum Christi. Uhde empfindet ganz richtig, wenn er meint, daß die Vertiefung des religiösen Gefühls, die Hingabe an Christus ein mächtiges Mittel wäre, Frieden auch dorthin zu bringen, wo derselbe jetzt so oft mangelt, weil Atheismus in rohester Form sich eingenistet hat. Es ist darum auch begreiflich, wenn ihm der Nazarener zum Proletarierchristus sich gestaltet hat.
So ist's auch auf dem neuesten Bilde »Abendmahl« der Fall. In einem mehr als schlichten Raum sitzt Jesus am Tische, mitten unter zwölf Arbeitern der Gegenwart. Es sind schlichte, brave Männer mit schwieligen Händen und zum Teil mit Gesichtern, in welche Entbehrung und Kummer tiefe Zeichen eingeschrieben haben. Aber hier ist alles Leid von ihnen genommen. Nur einer, Christus gegenüber, scheint mehr zu denken, als zu fühlen, denn er beugt sich mit dem Ausdruck scharfen Ueberlegens vor, die andern horchen mit warmer Hingebung, einige mit ergreifender Innigkeit und Liebe im schlichten Antlitz.
So läßt sich nicht leugnen, daß in dem bestimmten Wollen des reichbegabten Künstlers ein reiner edler Geist sich ausspreche. Aber nach zwei Richtungen erscheint er dennoch beengt. Erstlich ist's einseitig, Christus nur als den Freund der Armen und Bildungslosen hinzustellen: das mindert für mein Gefühl die erhabene Größe der Gestalt. Was er gelehrt hat, sein reines, unverfälschtes Wort, besitzt, trotz allem Geschrei der Gegner und trotz aller Sünden der Kirchen, heute noch ungebrochene Geltung auch für den Gebildeten, Vornehmen und Reichen. Aber wie unten so ist oben das Verständniß für den Kern des Wesens Christi sehr selten geworden. Dieses Verständniß, welches uns nicht der kritische Verstand, sondern nur das Gemüt zu erschließen vermag, hat erlösende Kraft auch im Jahrhundert der »exakten« Forschung und es wäre im Stande, auch die soziale Frage, wenn daneben die Vernunft mitwirkt, so weit zu lösen, wie diese überhaupt gelöst werden kann.
Andrerseits scheint der Maler selbst schon einzusehen, daß sein Christustypus ursprünglich zu weit vom Göttlichen entfernt war; ich wenigstens finde, daß das Antlitz sich allmälig doch mehr mit idealem Inhalt erfülle. Und darin kann Uhde ruhig noch weiter gehen. Da nämlich seine ganze Auffassung im Kerne ja doch symbolisch ist, so wird die Wirkung der realistischen Welt, die er darstellt, nicht geschwächt werden, wenn er den idealen Zug in Christus stärker betont.
Gegen den Vorwurf, als sei das Bild unverständlich, möchte ich den Urheber doch in Schutz nehmen. Er wollte nicht die Stiftung des Abendmahls darstellen, sondern nur zeigen, daß auch die einfachsten Menschen Jünger Christi seien.
Die »Kreuzigung« von Gabriel Max (München) ist ebenso gepriesen wie verdammt worden. Bei diesem Künstler verbindet sich das religiöse Gefühl mit spiritistischer Mystik. In weiten Kreisen der Bekenner dieser Lehren gilt Christus als der größte Vertreter »mediuminer« Kraft; auch die Wunder werden von diesem Standpunkt aus erklärt. Ich halte die reine Mystik an sich im religiösen Leben als eine durchaus nicht krankhafte Erscheinung, denn nach meiner Auffassung liegt dieselbe begründet im Wesen des menschlichen Gemüts und senkt ihre Wurzeln tief in das Metaphysische unseres Geistes. Dagegen ist es mir und zweifelhaft, daß sie durch Verquickung mit dem Spiritismus vergröbert und nur allzuleicht das religiöse Bedürfniß durch banausischen Geisterglauben verzerrt wird, welcher bewußtem und unbewußtem Betrug Thür und Thor öffnet.
Max hat den Gekreuzigten übrigens edel und vergeistigt dargestellt; es liegt in dem Antlitz mehr, als nur das »Menschliche« und ganz werden sich dem Eindruck wohl wenige entziehen. Die spiritistischen Anschauungen des Malers haben nur den seltsamen Farbenton des Körpers verschuldet. Die Hände, welche man unten am Fuße des Kreuzes sieht, sind künstlerisch vollendet behandelt, aber dennoch bleibt es die Verirrung eines hochbegabten Künstlers, Hände allein aus dem Rahmen herauswachsen zu lassen.
Von Uhde scheint beeinflußt Ernst Zimmermann (München) auf: »Christus bei den Fischern«. Nicht in der Malweise, aber in der Art der Auffassung. Die Gruppe besteht aus Halbfiguren. Christus sitzt rechts, ziemlich stark vorgebeugt und den Blick auf einen alten Fischer gerichtet, welcher, ebenso wie die zwei nur halb sichtbaren Gefährten, mit Hingebung der milden Rede lauscht; die rechte Hand Christi ruht auf dem Unterarm des Alten, die linke, auf das Knie gelegt, macht eine leise erklärende Bewegung.
Liegt nun auch in diesem Realismus, wie er bei Keller, Prell, Sziemiradzki hervortritt, mehr oder minder offen zu Tage die Gefahr, das Religiöse zu Gunsten des Archäologischen oder des Malerischen zu verflachen, so ist das noch mehr der Fall bei einem Künstler, welcher grundsätzlich jede Mitthätigkeit der Phantasie ausschließt, bei dem Russen Wereschagin. Auch er hat sogenannte religiöse Gemälde geschaffen: »Die heilige Familie«, »Jesus bei Johannes in der Wüste«, »Jesus in der Wüste«, »Christus auf dem See Liberias« und »Die Weissagung«. Wie verschiedene französische Schilderer des Orients geht Wereschagin von der Ansicht aus, daß die fast neunzehn Jahrhunderte seit Christi Tod in dessen Heimat nichts geändert haben. Wie Luft- und Lichtwirkungen, so seien auch die Menschen und deren Trachten sich gleich geblieben. Die Anschauung hat ja in gewissen Grenzen ihre Berechtigung, vor Allem für den »naturalistischen« Künstler. Aber in diesem Falle ist sie falsch, weil sie einen Satz nicht kennt: die Wirklichkeit und die' künstlerische Wahrheit sind nicht Eins, sie decken sich aber am wenigsten, wo es sich um Gestaltung religiöser Stoffe handelt.
Hat aber der russische Künstler wirklich religiöse Bilder geschaffen?
Ich behaupte: nein. Da ist zunächst ein Bild von sehr bescheidenem Umfange. Man sieht vorne einen Streifen Gestades, welcher sich von rechts nach dem Hintergrund verbreitert und eine orientalische Stadt zeigt. Das Uebrige ist Wasser. Sonnenglut liegt auf der Landschaft, alles glitzert und glänzt; man empfängt den Eindruck der Echtheit. Bei schärferer Betrachtung bemerkt man am Gestade etwa ein Dutzend Männer, Frauen und Kinder, und eine Barke, in welcher ein Mann steht. Stünde darunter: Tabarche, das alte Tiberias, am gleichnamigen See, – so würde man sehr befriedigt sein. Aber das Ganze wird Lüge mit dem Titel »Christus auf dem See Tiberias«. Diese winzigen Gestalten, dieser Mann im Boote, von dessen Antlitz nichts zu erkennen ist, sind in dieser Landschaft vollkommen Nebensache. Und das gilt von allen anderen Bildern, auch von dem stimmungsvollen »Jesus in der Wüste«, und von der vielverlästerten »Heiligen Familie«. Der Hofraum, welcher den Vorgang umschließt, ist ganz genau nach der Natur gemalt, wie eine Studie beweist. Links im Vordergrund arbeitet mit Gesellen ein Tischler (Joseph), rechts, sitzt ein Jüngling (Christus) auf einem Mauervorsprung und blickt in eine entrollte Schrift, in der Mitte spielen halbwüchsige Kinder und ganz hinten kauert mit dem Jüngsten beschäftigt eine Frau (Maria). Es ist nichts mehr als ein Zustandsbild aus dem orientalischen Familienleben, auf welchem – dem Bilde – der Hofraum fast den Eindruck beherrscht. Alle fünf Gemälde sind nichts als zum Bilde ausgearbeitete Natur- und Architekturstudien mit menschlichem Beiwerke.
Ich will nicht vom Standpunkt kirchlicher Satzungen gegen diese Bilder sprechen. Mich stören auch nicht die »Geschwister« Christi, gegen welche zwar das Dogma, nicht aber die Bibel spricht. Nur vom Standpunkt der Kunst allein.
Der Stoff religiöser Darstellung besteht nicht in dem aus Studien der äußeren Erscheinung gefundenen Rohwerk, sondern aus Gedanken und Gefühlen, welche unauflöslich mit der Vorstellung verknüpft sind. Der religiöse Geist schafft sich aus dem schauenden Gemüt heraus die Gestalten, deren innere Bedeutung ihm das Wesenhafte und darum im höheren Sinne Wirkliche ist. Und spielte sich das Familienleben z. B. vor einem griechischen Tempelbau ab, wäre jedoch dieses Geistige getroffen und beherrschte es alles, dann störte der Widerspruch ebensowenig, wie hier die »Echtheit« es wirklich thut. Diese winzigen Gestaltchen ohne geistigen, ohne religiösen Kern sind uns ganz gleichgültig, sind künstlerisch unwahr, trotz allem Schein der Wahrheit, sind es, weil sie als Nebensachen auftreten. Nicht die Wüste wollen wir sehen, sondern jenen Christ, welcher mit sich selbst kämpfend, gotthungrig in der Einsamkeit weilt. Wie für ihn die Welt um ihn in wesenlosen Schein versinkt, so soll sie es uns: er, das Geistige, Göttliche in ihm, sich spiegelnd in Miene und Gebärde, sind uns die Hauptsache; gleichgültig ist uns die »echte« Beleuchtung des See Tiberias, aber schauen will das Gemüt das Licht im Auge des Verkündigers Gottes und der Liebe und dessen Widerschein in den Blicken der Hörer.
Von alledem ist kein Hauch in den Bildern Wereschagins zu finden. Machtlos bricht dieser ganze »Naturalismus« vor diesem Stoffe zusammen, und diese Wahrheit ist Lüge.
Wenn man die erwähnten Arbeiten überblickt, so läßt sich ja nicht leugnen, daß in der Auffassung noch erhebliche Unterschiede vorhanden sind. Aber trotzdem muß man erkennen, daß die religiöse Bewegung auch in das Gebiet der Malerei eingetreten ist und eigenartige Empfindung in den Seelen Einzelner wachgerufen hat. Für sich allein wäre die Erscheinung vielleicht ohne sonderliche Bedeutung, jedoch im Zusammenhänge mit verwandten Strömungen in der Literatur und Musik gewinnt sie an Wert und wir dürfen sagen: wir leben in einer Zeit, in welcher sich das Erwachen des Gemüts vorbereitet. Mit ihm aber muß die religiöse Sehnsucht wachsen. Krankhafte Erscheinungen sind dabei unvermeidlich, aber das Ergebniß wird doch Gesundheit sein. Die Menschheit kann weder sittlich noch geistig wahre Fortschritte machen, wenn sie sich nicht auf die Quelle ihres Wesens besinnt. Sie wird es. Dann aber wird es sich zeigen, daß auch die religiöse Kunst aus diesem Mutterborn des Großen und Erhabenen den Trunk der Verjüngung schöpft.
*
Frank Kirchbach, ein Münchener Maler, hat jüngst auf einer riesengroßen Leinwand die Entführung des Ganymed durch den Adler des Zeus behandelt. Die technische Leistung verdient warme Anerkennung und auch in der Auffassung zeigt sich starkes, selbstständiges Lebensgefühl, die Bewegung des Tieres hat etwas Mitreißendes, so daß der Beschauer empfindet, daß der Flug aufwärts gerichtet sei und der Körper des Jünglings ist, was die Kenntniß der Formen anbetrifft, hohen Lobes würdig. Und dennoch ist das Werk verfehlt.
Stoff und Auffassung müssen innerlich zusammenhängen. Darum giebt es keine seligmachende einzige Art der Auffassung: weder Idealismus noch Realismus – den kunstwidrigen Naturalismus schließe ich grundsätzlich aus – sind an sich allein giltig, am wenigsten in der Art, wie diese Begriffe landläufig geworden sind. Die bildenden Künste, besonders Plastik und Malerei, können und sollen nur das darstellen, was sich mit Formen, Farben und Licht vollständig aussprechen läßt. Das schließt indessen noch nicht die symbolische Vertiefung aus. Wenn irgend eine geistige Vorstellung in irgend einer Zeit allgemein im öffentlichen Bewußtsein lebt, so wird die Kunst sie mit ihren Mitteln ruhig darstellen dürfen, denn dann erhält das Zeichen in der nachschaffenden Einbildungskraft der Beschauer volle Wirklichkeit.
Indem die Kunst nun die Formen, Farben- und Lichtwirkungen, wie sie dem Menschen erscheinen, benutzt, liegt in ihr an sich ein Zug zum Realismus. Je mehr sie ihren idealen, d. h. ihren Gedanken- und Gemütsgehalt verwirklichen will, desto mehr sieht sie sich auch auf die Natur hingewiesen. Aber damit ist zugleich die Grenze bezeichnet. Natur ist nur Mittel, nicht Zweck der Kunst, der Künstler muß ihre Erscheinungsweisen beherrschen, um durch sie dem Geist die volle Freiheit zu sichern.
Nun aber ist das Verhältniß zwischen Geist und Stoff in verschiedenen Vorwürfen ein verschiedenes, weil die Stufenreihe der darstellbaren Dinge es an sich, im Leben, schon aufweist.
Ein Beispiel mag den Satz erläutern. Ein halbtrunkener, roher Mensch stürzt ein Glas Branntwein in sich. Ein gebildeter Mensch stillt seinen Durst mit einem Trunke frischen Wassers. Ein Anderer trinkt bei einem Festmahl zur Erinnerung an den Tag von Sedan ein Glas Wein. Ein tiefgläubiger Priester am Altar nimmt einen Schluck aus dem Kelche. In allen vier Fällen liegt dem äußeren Vorgang eine physiologische Thatsache, die Ausnahme von Flüssigkeit zu Grunde. Wenn wir jedoch dem Inneren uns zuwenden, so zeigt sich uns überall ein anderes Mischungsverhältniß von Geist und Stoff; ist im ersten Falle das Pathologische des Körpers so mächtig, daß es das Geistige verschlingt, so tritt im letzten das Trinken fast ganz zurück, und der Vorgang im Geist und im Gemüt beherrscht Alles. Um nun die »Idee« zur verständlichen Erscheinung zu bringen, müßte der Maler in jedem einzelnen Falle die Formen der Wirklichkeit kennen, aber in steigendem Maße das Geistige betonen. Damit schon idealisirte er den Vorgang, bliebe aber auch im vierten Fall noch immer in Rücksicht auf die Formauffassung Realist. Kurz, je mehr in der Kunst der Geistes- und Gemütsinhalt mit höheren Anschauungskreisen in Verbindung gesetzt wird, desto mehr drängt auch die Form zur »Idealität«, zur charaktervollen Schönheit, ohne daß dabei das gesunde Lebensgefühl die geringste Einbuße zu erleiden braucht. Schönheit und Wirklichkeit widersprechen sich in der Kunst nicht, wie sie sich auch nicht in der Natur widersprechen. Ein Realismus, welcher die Schönheit ganz verwirft, ist deshalb im Sinne der Kunst nicht mehr echt.
Der Stoff, welchen Frank Kirchbach behandelt hat, gehört ganz dem Gebiete der Einbildung an, ist als Ausschmückung der Göttermythe von der Phantasie erzeugt. Aber die Sage entbehrt nicht der inneren Begründung: die ungewöhnliche Schönheit des Ganymed ist die Veranlassung, daß der Jüngling zum Olymp entrückt wird. Verkörpert ein Maler, welcher sich den Vorwurf innerlich klar gemacht hat, den Mundschenk des Zeus, dann kann er nicht der Notwendigkeit entgehen, den Ganymed in leitbildlicher Jünglingsschönheit zu erfassen.
Herr Kirchbach hat ein Modell gemalt, welches in den Körperformen unedel, in den Formen des Antlitzes gewöhnlich ist. Der Fleiß, mit welchem die Gestalt durchgearbeitet ist, vermag diesen Mißgriff eines falsch angewendeten Realismus nicht gut zu machen. Durch die »Wahrheit« dieser Gestalt erhält die Schöpfung den Beigeschmack der Ironie, ja der Parodie. Dann aber versteht man noch weniger, weshalb der Künstler zur Gestaltung des Stoffes eine solche Riesenleinwand nötig hatte.
Der antiken Mythe gegenüber erweist sich der Realismus als eine auflösende Auffassungsweise; er widerspricht innerlich dem Kult der sinnlichen Schönheit und vermag darum den Stoffen nicht gerecht zu werden, in welchen die schöne Erscheinung den lebendigen Mittelpunkt des Ganzen ausmacht. Hier hätte die freischaffende Phantasie sich im innigen Anschluß an die Natur, das Leitbild eines schönen Jünglings entwickeln müssen, durfte aber nicht irgend ein ärmlich entwickeltes Berufsmodell wiedergeben.
Die Formen der Natur sind, wie oben bemerkt, Kunst mittel, aber nicht Kunst zweck. Wohl besitzen sie in sich als Teile des Weltganzen schon einen geistigen Inhalt, welcher als gestaltende Grundkraft in ihnen wirkt, wie er auch im Aufbau unseres Leibes sich thätig erweist. Aesthetische Bedeutung gewinnen sie aber erst, wenn sie vom Menschengeiste wahrgenommen, in diesen aufgenommen, mit ihm in Verbindung gesetzt worden sind.
Was zuerst im Künstlergemüt leben muß, ist das Leitbild des Werkes, bei dessen Schöpfung die Phantasie einen großen Anteil hat. Es ist heute vielfach Sitte über sie zu spötteln: man wirft dem Maler oder Dichter vor, er arbeite nur mit ihr. Dieser Spott beweist, wie wenig Verständniß für das künstlerische Schaffen vorhanden sei.
Da der bildende Künstler seine Leitbilder doch nur mit Hülfe der sinnlichen Erscheinung darstellen kann, so liegt schon in der inneren Vorstellung das Sinnlich-Wahrnehmbare, also ein realistischer Bestandteil. Er vermag deshalb auch vollkommen selbstständige Gebilde, für welche das Vorbild in der äußeren Wirklichkeit ganz fehlt, so zu gestalten, daß sie den Stempel höherer Wirklichkeit, an sich tragen, und es ist ihm deshalb möglich, diese Phantasiegebilde ganz und gar »realistisch« zu gestalten.
In diesem Sinne Realist auf idealistischer Grundlage ist Arnold Böcklin.
Mag immerhin eine in künstlerischer Beziehung schwunglose Zeit sich mit kleinlichem Genörgel an die Irrtümer und Fehler dieses Mannes anklammern und über ihn mit einem Witzwort aburteilen, das raubt seiner Größe nicht einen Deut. Denn an tief innerlicher Schöpferkraft, an wahrer Genialität steht er hoch über den meisten der vielgepriesenen nüchternen Talente der Gegenwart. In ihm wirkt eine ungebrochene Naturkraft, unbeengt durch Ueberlieferungen der Schulkunst. Was er als sein Eigentum besitzt, läßt sich nicht lehren und lernen, es ist Offenbarung aus der geheimnißvollen Tiefe einer reichen Persönlichkeit, welche viel weiter in die Natur eindringt, als Hunderte von Jenen, welche man Realisten zu nennen pflegt und die hülflose Kinder sind, wenn sie kein Modell vor sich haben. Gewiß, es hat niemals Centauren, niemals Meerjungfrauen und Fischmänner gegeben, wie sie uns Böcklin vorgeführt hat. Aus der inneren Anschauung heraus sind diese Gebilde geboren, die man oft mit Achselzucken als Ausgeburten der Phantasterei bezeichnet.
Aber ich behaupte: in diesen Gestalten liegt viel mehr rechtes Lebensgefühl, viel mehr höhere Wirklichkeit, als in den Nachahmungen der Alltagsmenschen unserer meisten Maler. Und man hat Unrecht zu sagen, daß Böcklins Gebilde nur Erinnerungen an die Antike seien. Nein: in der Urgewalt derselben, in dem innigen Zusammenhang mit der Landschaft und dem Meere, nicht zuletzt in dem vielen ganz unverständlichen Humor liegt unverfälschtes, deutsches Wesen, wie es sich in der altgermanischen Mythe ausgeprägt hat. Aber unsere neuzeitliche Bildung hat, wie sie uns vom Geiste losriß, uns auch von der Natur losgerissen. Unsere Gebildeten schweben haltlos in künstlichen, widergeistigen und widernatürlichen Verhältnissen; Worte und nichts als Worte, sind die »Bildung«, blasse Schemen sind unsere Wahrheiten vom Tage und die jämmerliche Mattheit und Nüchternheit nennen wir »männliche Reife des Menschengeistes«.
Und wie man Jene verspottet, welche mit unvertilgbarem Gemütsdrange rückhaltslos die Wirklichkeit der geistigen Welt behaupten und für das höchste Gut der Menschheit, für Gott und seinen Abglanz in uns, die Liebe eintreten, so versteht man auch einen Künstler nicht, welcher die Selbstherrlichkeit der Phantasie behauptet und die Natur mit schöpferischer Kraft aus sich heraus gebiert und mit seinem eigenen Gemüt erfüllt.
Unter den jüngsten Gemälden von Böcklin ragt besonders hervor » Die Todteninsel«, ein Bild von geringem Umfang. Aus den Fluten erhebt sich ein Eiland aus schroff abfallenden Kalkfelsen, welche, mauerartig aus der Tiefe gehoben, einen dunklen Hafen umschließen. Dort wo die Natur den Zugang offen gelassen hat, sind cyklopische Mauern aufgerichtet, so daß nur eine schmale Einfahrt übrig bleibt. In den rötlichen Kalkstein sind Galerien in zwei Stockwerken übereinander gebrochen; dunkle Cypressen ragen aus dem schmalen Erdstreifen, welcher um den Hafen innerhalb der Felsen sich hinziehen muß. Ganz oben ist der Himmel tief dunkel, links (vom Beschauer) erhellt er sich nach unten, rechts lasten schwere Wolken fast bis zu dem Streifen, welcher Meer und Lust scheidet; vorn liegt die Flut, unbewegt wie geschmolzenes Blei. Der schmalen Einfahrt nähert sich ein Boot. Ein Sklave rudert, vor ihm steht, von hinten sichtbar, eine weiße Gestalt, und quer über dem kleinen Fahrzeug liegt ein mit weißen Tüchern und roten Kränzen bedeckter Sarkophag. Die Felsen, die moosigen Steine am Eingang und das Meer sind mit Böcklinschem Realismus gemalt.
Der geistige Eindruck läßt sich schwer mit Worten schildern. Tiefer Ernst liegt auf dem Bilde, das Schweigen des Todes: selbst das Meer scheint vergessen zu haben, daß es Stürme erlebt hat. Aber dieser Ernst bedrückt nicht, diese Schwermut legt sich nicht auf das Herz wie ein Stein: Frieden weht uns daraus entgegen. Hier ruhen Todte und selbst die Natur beherrscht sich, um die heilige Rast der Entschlafenen nicht zu stören. Hat man sich einmal in das Dichterische dieser Schöpfung versenkt, dann kommt man nicht mehr so leicht los und es zieht uns immer wieder zu dem bescheidenen Werke zurück.
Auch das ist Realismus, aber von Gemüt durchsättigt, ein Realismus, dem die Natur nur die Mittel bietet, welche der Geist mit Hilfe der Phantasie zu freien Schöpfungen der Kunst benützt. Und nur das ist der Weg, welcher die Kunst und die Dichtung wieder vom Ungeiste nüchterner Naturnachahmung befreien kann. Nicht in den Stoffen, welche Böcklin behandelt und die eben nur ihm gemäß sind, liegt die befreiende That, sondern in der Art, wie er sich in seinen gelungenen besten Werken zur Natur stellt, als ihr Herr, nicht als ihr Knecht, dabei als priesterlicher Diener der »Idee«, welche allein aus der Welt des Geistes stammt.
*
Berliner Buchdruckerei-Actien-Gesellschaft Setzerinnenschule des Lette-Vereins.