
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
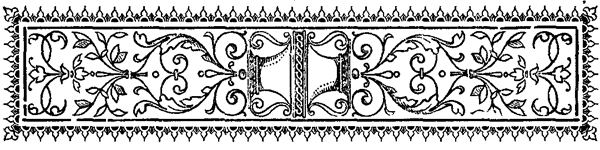
Ignaz Vordermeier ist seines Zeichens ehrsamer Schuster. In Schliersee in Oberbayern geboren, war er nach mannigfaltigen Kreuz- und Querzügen vor nun zwölf Jahren als Geselle nach Berlin gekommen, hatte sich mit der Tochter eines Flickschneiders verheiratet und eine Werkstatt in einem Kellerladen der Schützenstraße aufgethan. Anfangs ließ es sich gut an, die Eheleute waren fleißig und sparsam, und schon nach einem Jahr konnte Vordermeier mit zwei Gesellen arbeiten.
Aber leider dauerte das Glück nicht lange; sein Schwiegervater wurde krank, er mußte auch für ihn sorgen, und fast jedes Jahr erschien ein Tag, wo plötzliches Geschrei die Ankunft eines neuen Sprößlings ankündigte.
Die Frau war oft, trotz ihrer Gutmütigkeit, recht unwirsch; zwar machte sie ihrem Manne niemals Vorwürfe, dazu war ihr Gerechtigkeitsgefühl zu groß; aber wenn die vorhandenen Pfennige nicht mehr zu Brod und Kartoffeln genügten, wenn alle Kunst nicht mehr ausreichte, um aus zerschlissenen Flicken für die Knaben ein »neues« Höschen zu machen, dann legte sie wohl manchmal verzweifelt die Hände in den Schooß und starrte vor sich hin. Doch das dauerte nicht lange, denn das ununterbrochene Klopfen aus dem zweiten Gelaß, dem »Laden«, erinnerte sie daran, daß ihr Mann trotz allem Unglück unermüdlich arbeitete, stets mit heiterem Gesicht, jeden Augenblick bereit, seinen Leibspruch zum Besten zu geben: »Was a echter Oberbayer is, den valaßt unser Herrgott nöt!«
Schon am frühesten Morgen, wenn noch kaum das erste Leben in der Straße erwacht war, saß der Meister auf dem Schemel in der Werkstatt. Er vermied das Klopfen, um nicht die im Nebenraume noch Schlafenden zu wecken. Während er Flicken an alte Stiefel ansetzte und schiefgetretene Absätze richtete, konnte er nach seiner Art philosophische Betrachtungen anstellen.
Eben hielt er einen Schuh in der Hand, der die Spuren ehemaligen Glanzes an sich trug, aber sich jetzt in sehr schlechten Verhältnissen befand. Auf der einen halb durchgelaufenen Sohle stand mit Kreide geschrieben: »Hoche Absez«. Es widersprach zwar der Rechtsschreibung, aber es genügte, um den Wunsch der Besitzerin zu bezeichnen.
»Von der Köchin im vierten Stock«, brummte der Schuster, »dalketes Ding überanander! Z'wegen warum die hohe Absätz braucht, dös möcht' i a wissn! Na, mir kann's recht sein.«
Dann suchte er aus dem Haufen von Lederabfällen einige heraus, um die kleinen Stücke zurechtzuschneiden, aus welchen der Stöckel zusammengesetzt wird, und ließ sich wieder auf den Schemel nieder.
»Die Schucherln san amal recht schön g'wesen«, monologisirte Vordermeier weiter. »Ja ja, 's geht halt den Stiefln grad' a so wie unser an. Dös hab i mir vor drei Jahren a nöt denkt, daß so miserabel werd'! Na, 's wird scho besser, d' Welt is ja kugelrund und der liebe Herrgott kann mi a wieder aufn Glanz herrichtn. Wann nur mein Sechszehntl von der Lotterie rauskäm, so mit'n Haupttreffer. Sakra! Dös wär a Hetz! Jesses na, da freuet i mi! Ja und warum denn nöt? Dös sich i nöt ein, warum i nöt a amol was g'winnen sollt'.«
Ein Geräusch aus der Nebenstube lenkte ihn von den schönen Vorstellungen ab.
»Aha, mei' Alti!«
Wenige Minuten später trat die Frau in bescheidenem, aber doch reinlichem Kleide aus dem einzigen Wohnraume und schritt mit einem kurzen »Juten Morgen« an ihm vorbei in die kleine hinter dem Laden liegende Küche.
»Schau, schau!« brummte er. »Heut' giebt's am End' no a Wetter. Macht nix! Wird ja a no guet werd'n!«
Mit Eifer machte er sich nun ans Klopfen und bald waren die beiden hohen Absätze für die Küchenfee so weit vollendet, daß sie nur noch glänzend zu machen waren. Die Hausfrau, welche unzweifelhaft mit dem linken Fuß zuerst aufgestanden sein mußte, hatte die Vorbereitungen für das Frühstück ungewöhnlich geräuschvoll ins Werk gesetzt und rief jeden Augenblick irgend eine Bemerkung in die Werkstätte hinaus, um ihrem Unmut Luft zu machen, dann ging sie in das Zimmer und schalt ebenso gutmütig wie heftig mit den zwei größeren Knaben.
Vordermeier lächelte nur: »Hm, hiazt (jetzt) dunnert's scho, wird bald ei'schlag'n a!« Richtig, im nächsten Augenblick ertönte das Geräusch einer Maulschelle, welches im Kindergeschrei seine Fortsetzung fand. Damit war der Höhepunkt des Gewitters erreicht, der gestrafte Junge besorgte dann mit seinen Thränen die dazu gehörige Regenstimmung, bis auch die sich verzog und Mutter und Kinder lachten. Dann traten sie zum Vater hin, um ihm guten Morgen zu sagen und kurze Zeit später saß die Familie, jedes Glied in einer anderen Ecke, wo sich eben Platz bot, beim sogenannten Kaffee – an den ziemlich großen Töpfen war zu erkennen, daß es eben mehr auf die Menge, als auf die Güte der graubraunen Flüssigkeit ankäme.
Ehe die ältesten Knaben in die Schule gingen, baten sie den Vater in einer Mundart, welche symbolisch die Einheit zwischen Nord und Süd bekundete, um einige Groschen für Schreibhefte und Federn. Der Meister kraute sich hinter den Ohren und warf einen Blick nach seiner Ehehälfte, welche dem jüngsten Vordermeier eben die Rückseite wusch.
Sie sah auf und zuckte unmutig die Achseln.
»So so – also nix im Haus! Dös is freili – – na wißt's was, Buabn, geht's heunt noch so in d'Schul; und wann der Herr Lehrer enk (euch) auszankt, nacha sagt's nur, der Vater hat koa Kloangeld nöt g'habt.«
Der älteste Junge versuchte umsonst, Einsprache zu erheben.
»Hiazt geht's, gradweg wie der Teufi (Teufel) an Bauern holt.«
Damit schob der Vater seine Sprößlinge zur Thüre hinaus, und sie trotteten niedergeschlagen der Gemeindeschule zu.
Vordermeier aber wandte sich zu seiner Frau, welche dem Kleinsten eben das vielgeflickte Röckchen anzog.
»Sei nöt traurig,« sagte er und streichelte ihr mit der rauhen Hand das blonde Haar. »Bist doch alleweil a Madl wie a Radl g'wes'n, 's wird ja alles guat werden, wann unser »Sechszehntel« in der Lotterie rauskommt«
»Bist en Quatschkopp!« lautete die Antwort. »Wir und jewinnen! Es ist ein Elend – nichts mehr im Haus, nicht einmal Salz und Brod.«
»No no,« tröstete er. »Unser Herrgott wird's scho' recht mach'n. Die Schuch für d' Köchin san ferti, kannst sie auffitragen – i halt den Buab'n, bis Du zaruckkimmst. Kost 75 Pfennig.«
Während die Frau den Gang besorgte, trug der Schuster den Knaben umher und suchte ihn mit einem Kinderlied zu unterhalten:
»Renga, renga, Tropf'n,
Schö' blüaht der Hopf'n,
Schö' blüahts Himmikraut
Königskerzen.
Liebi Frau machs Thürl auf,
Laß 'n Regen nei,
Laß raus n' Sunnaschei.«
Das Kind hatte wahrscheinlich noch kein ausgebildetes Kunstverständniß; es gähnte einigemale, dann neigte es den Kopf und war plötzlich entschlummert.
Mit größter Vorsicht trug es der Vater in die Wohnstube, welche sehr ärmlich eingerichtet, aber rein gehalten war, und legte es auf ein Bett. Wie es so dalag, hätte er es gerne mit der breiten, plumpen Hand gestreichelt, aber er fürchtete sich, es zu wecken und fuhr nur über dem blonden Köpfchen hin. Als er das Auge aufschlug, fiel sein Blick auf das kleine, holzgeschnitzte Kruzifix und blieb dort einige Augenblicke haften.
Ein leiser Schatten flog über das ehrliche, gutmütige Gesicht, aber bald hellte sich das Auge auf: »Du wirst's scho guet machen, liaber Herrgott!«
Als er still die Thüre eingeklingt hatte, trat von der Straße her seine Frau in den Laden und reichte ihm das Geld.
»Das reicht für heute,« sagte sie, »aber morgen?«
»Mueß ma denn glei auf morgen denk'n?« antwortete er, »'s wird si (sich) scho no Arbeit finden. Da hast's Geld, i brauch nix für mi.«
Dann verschwand er in der Küche, sich dort in seinen Sonntagsstaat zu werfen, um, wie schon oft in der letzten Zeit, in den benachbarten Straßen Trepp auf und ab zu steigen und zu fragen, ob es etwas zu flicken gäbe.
Monate vergingen. Gar manchen Tag war der Gang des Meisters vergeblich, und er kam müde nach Haus, ein andermal aber brachte er kleine Aufträge mit, deren Erlös den Hunger für einige Tage fernhielt. Seine Frau half den Hausbewohnern hie und da bei einer häuslichen Arbeit und erwarb so einige Groschen. Aber aller Fleiß, alles ehrliche Streben reichten nicht hin, um der Familie nur das Leben zu fristen.
Die nicht unbedingt nötigen Möbel und Kleidungsstücke verschwanden eins nach dem andern, zuletzt wanderten die zwei schmalen Goldringe auch in das Leihhaus. Aber Vordermeier verlor trotz alledem den Humor nicht und nicht den Arbeitsmut.
»Der liebe Gott wird's scho recht mach'n, kloaweis Kleinweis, nach und nach. wird's wieder besser.«
Vorläufig wurde es »kloaweis« schlechter und als gar der Lederhändler durchaus auf Bezahlung der schon gestundeten Schuld drang, da stellte sich die Möglichkeit des Zusammenbruchs drohend ein. Manche Nacht, wenn die anderen schliefen, saß der Vater auf seinem Lager in der Küche und zerbrach sich den Kopf, was er wohl anfangen könnte, um seine Lage zu bessern.
Manchmal preßte sich ihm das Herz zusammen und er hätte am liebsten geweint, aber er schämte sich vor sich selber seiner Schwäche; sobald er die erste Thräne die Wange hinabrollen fühlte, ballte er die Fäuste, um sich zu bezwingen. Bei Tage sah man ihm überhaupt nicht an, daß ihm das Herz manchmal doch etwas schwer war.
Der Lederhändler klagte endlich, unzugänglich für alles Bitten, die Schuld ein und Vordermeier wurde natürlich verurtheilt; seine Frau verlor den Mut ganz. Es schien ihr eine unauslöschliche Schmach, daß sie wegen einer Schuld vor Gericht gefordert waren. Je näher der Tag der Zwangsvollstreckung heranrückte, desto aufgeregter wurde sie, desto ruhiger und gefaßter ihr Mann; ja manchmal lächelte er so siegesgewiß auf die Klagen der Frau, daß sie ihn für unzurechnungsfähig hielt und wegen solchen sträflichen Uebermuts ausschalt.
»Sei stad (still),« sagte er dann, »es kimmt a Glück, i spür's in olle Glieder. Es muß ans kommen, denn schlechta kann's ja gar nöt mehr werd'n.«
Dabei arbeitete er, wenn es zu arbeiten gab, und lief stundenlang umher, wenn keine Arbeit zu ihm kommen wollte.
So erschien denn der Vorabend des Tages, wo die Pfändung zu erwarten war. Die Knaben hatten so viel davon sprechen gehört, alles solle weggenommen werden, daß sie ihre Spielsachen, eine halbzerbrochene Kanone aus Holz, einen Ball und Reste eines Kegelspiels, im Hofe hinter alten Kisten versteckt hatten, um die Schätze so zu retten. Die Frau weinte still in sich hinein und war durch nichts zu trösten, und selbst Vordermeier fühlte sich unbehaglich.
Wenn der liebe Herrgott am Ende doch die Sache anders beschlossen hätte? Wenn's ihm gefiele, daß Ignaz Vordermeier aus Schliersee auf keinen grünen Zweig kommen dürfe?! Nein, dachte er weiter, das ist unmöglich. Wenn es ihm je schlecht gegangen war, hatte er immer fest vertraut, und es war richtig um die zwölfte Stunde auch Hilfe gekommen.
Sie wird auch dieses Mal ganz sicher erscheinen. Und bei dem Gedanken heiterte sich sein Gesicht auf, und er griff nach seiner Westentasche – dort war etwas geborgen, was Erlösung bringen, sie noch heute bringen mußte; das war so sicher, wie das Evangelium.
Es war die Zeit des Abendbrods. Nur die Zeit, denn heute gab es in der That nichts zu brocken und zu beißen, allein der Kleinste hatte etwas verdünnte Milch und jeder Knabe ein Stückchen Brod, – die Eltern sahen zu. Das Herz krampfte sich der Mutter zusammen, wenn sie an morgen dachte; Vordermeier aber saß auf dem Schemel und blickte nach der Treppe, die von der Straße in den Laden führte, als müßte dort plötzlich – – – und richtig: auf einmal stürzte der Nachbar, der »Herr Budiker,« über die Stufen hinunter und schwang dabei in seiner Hand ein mit Zahlen bedrucktes Papier. – Vordermeier sprang auf, seine Frau blickte teilnahmlos nach den zwei Männern.
»Erlooben Sie,« rief der Ankömmling athemlos, »det ick mir verpuste. Hier, kucken Sie mal, wir sind raus!« Und bei den rätselhaften Worten deutete er auf eine fettgedruckte Zahl: Nr. 16542 80,000 Mark.
Der Schuster griff ohne jede Spur von Aufregung in die Tasche und zog daraus das in ein Stückchen Zeitungspapier gewickelte »Sechszehntel«.
»Stimmt,« sagte er dann, »bis aufs Tipfrl. Ich hab's ja immer g'sagt, was an rechter Baier is, den valaßt unser Herrgott not.« Aber jetzt wich auch die Ruhe und er stieß einen »Jucherzer« aus, als stände er irgendwo auf der Alm. »Alti, freu Di, hiazt giebt's Geld, wie Heu!«
Die Frau vermochte an den plötzlichen Glückswechsel nicht recht zu glauben. Der Budiker bewies ihr aber haarklein, daß die Liste offiziell sei.
»Natürli,« fügte Vordermeier hinzu, »und druckt is ja a. Da failt sie nix dran. Wie viel kriag i denn nacha?«
»Fünfzehnhundert Mark.«
Bedächtig und langsam wiederholte Vordermeier die Worte.
»Na,« schloß er, »der liabe Herrgott is do a zu guater Mo! Aber heunt wird a amal g'rast, – ich kann's, weil i eh nix z' thun hab.« Dann aber wandte er sich zu der Frau, die noch immer ganz still da saß:
»Alti, geh, was dicht'st Denkst nach., wie a Karpf' im Vogelhaus? Geh mit'm Nachbr und hol' was z'essen und z'trinken – ich hab Dr auf amal an sakrischen Durscht und Hunger kriagt.«
Bald darauf kam die Frau mit dem Gewünschten von dem Budiker zurück.
Vordermeier goß sich ein Glas Bier ein und blickte es mit Zärtlichkeit an.
»An alter Bikannter, den i scho lang nöt g'sehn hab.« Dann hob er es empor sagte: »Duck Di, mei Seel', 's kimmt a Platzregen!« und in wenigen Sekunden war das Glas leer.
Noch lange saßen die Eheleute beisammen und malten sich die Zukunft mit den schönsten Farben aus. – –
Wer jetzt durch die Dorotheenstraße um Feierabendzeit geht, kann an einem kleinen, aber netten Schuhladen die derbe Gestalt unseres Vordermeiers sehen, der behaglich seine kurze Pfeife raucht.
Er ist an Humor und Fleiß der Alte. Wenn er aber manchmal zu einem Glase Bier geht, dann liebt er es, die Geschichte von dem »Treffer« zu erzählen, welche stets mit den Worten endet:
»I hab's ja g'wüßt, denn was a rechter Oberbaier is, den valaßt unser Herrgott nöt.«
*