
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
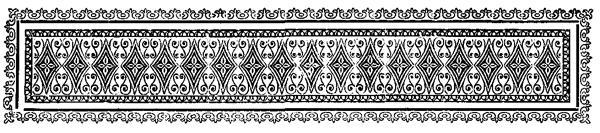
Fast alle Volkskrankheiten haben Aerzte und Gelehrte bewogen, deren Entstehung und Verlauf bis in die kleinste Kleinigkeit hinein zu verfolgen. Mit Werkzeugen aller Art rückten die Herren in geschlossener Reihe gegen die heimtückischen Feinde zu Felde, spürten ihnen in Luft und Wasser, in der Erde, im Bauschutt, in Abzugsröhren nach, verfolgten sie in die feinsten Verzweigungen der Lunge und der Eingeweide, zuweilen mit Mitteln, welche dem Kranken mehr, als dem Uebel geschadet haben.
Aber eine Krankheit haben sie bis heute noch nicht beachtet, trotzdem dieselbe beide Geschlechter und fast alle Stände und Lebensalter befällt und sich immer tiefer in den Organismus der Völker, des deutschen zumal, einfrißt. Wohl giebt es einige besorgte Menschenfreunde, welche dagegen mit dem Messer oder mit kalten Wasserstrahlen oder mit der Hungerkur zu wirken suchen, aber einzelne gelungene Heilungen können das allgemeine Bild nicht verändern. Das Leiden steigt in den Großstädten, wie auf dem Lande, in Mietshäusern wie in kostbar eingerichteten Schlössern.
Obwohl es in einigen Fällen auch das Kindesalter nicht verschont, so ist dieses doch ziemlich seuchenfest. Erst mit dem 15. und 16. Jahre beginnt die Gefahr, steigt langsam bis zum 25. von wo sie bis etwa zum 60. sich auf gleicher Höhe erhält; dann erst sinkt die Erkrankungszahl und Hundertjährige scheinen ganz ansteckungsunfähig zu werden, besonders wenn sie an der Handgicht leiden.
Der Zustand der untersuchten Leichen hat bis jetzt sehr geringe Anhaltspunkte ergeben. Die Röhrchengefäße sind meist etwas verbreitet, der Zufluß des Blutes zum Gehirn scheint ein stärkerer gewesen zu sein, was die Schwindelanfälle und die Fieberzustände zu erklären vermag. Die Bewegungsbänder (Muskeln) der rechten Brustseite und des rechten Armes bis zu den Fingern sind einseitig entwickelt, der Carpus (die Handwurzel) leichter beweglich. Gegenüber den Streckbändern der Finger, welche etwas vernachlässigt sind, sind der sog. lange und der kurze Daumenbeuger ( Flexor pollicis longus und brevis) auffallend kräftig. Zuweilen zeigen sich die Erscheinungen auf der linken Seite. Das Gehirn aber ist dabei oft von auffallender Kleinheit.
Das äußere Krankheitsbild hat wohl etwas stärker hervortretende Merkmale, aber hier ist doch zugleich die Anordnung der Anzeichen im Allgemeinen eine so verschiedene, daß man die größten Gegensätze festzustellen vermocht hat. In einer Reihe von Fällen geht dem Anfall ungewöhnliche Erregtheit voran, das Blut strömt stärker zu Kopfe, die Augen leuchten, die Eßlust ist zuweilen vermindert; die Kranken fühlen sich beklommen ohne Angstgefühl; einige laufen gern in den Wald, blicken starr in den Mond oder weinen über ein geknicktes Gänseblümchen. Wieder andere sind gedrückt, suchen die Einsamkeit, verschließen sich in ihr Zimmer und tragen oft Tage lang ein heimlichthuendes oder zerstreutes Wesen zur Schau. Das einzige gemeinsame Anzeichen ist ein Ziehen in den oben genannten Daumenbeugern und im Zeigefinger.
Nach der Ansicht bedeutender Gelehrten ist das Uebel ansteckend. Doch hat man bis jetzt weder pflanzliche Keime noch tierische Bildungen als Erreger oder Begleiter der Krankheit nachweisen können. Die Versuche, dieselben in der Dinte zu finden – sie rühren von Prof. Koch her – sind bis heute mißlungen.
Nach andern Forschern, denen ich mich anschließe, liegt dem Leiden, wie einst den Geißlerzügen und ähnlichen Erscheinungen, eine seelische Krankheit zu Grunde. In welcher Art die Uebertragung dieser Wahnvorstellungen erfolge, wie es möglich sei, daß das von außen entnommene Bild die freie Willensthätigkeit ganz unterjoche, ist für Seelenforscher und Krankheitskundige gleich geheimnißvoll: nur die Thatsache, daß es geschieht, steht fest. Man hat die Krankheit als »endemische Stilomanie« (Federhaltersucht) oder » rabies scribendi communis« (»die gemeine Schreibwut«) bezeichnet.
Wie schon bemerkt ist, bieten weder Stand noch Geschlecht den geringsten Schutz. Backfischchen und Mittelschüler, Erzieherinnen und Fürstinnen, Handlungsgehilfen und Staatsbeamte, sanfte Pastoren und kampfesmutige Offiziere, Landedelfrauen und Bankiersgattinnen: kurz, alles was Hände hat, kann von dem Uebel ergriffen werden und zwar bei dem geringsten Anlaß.
Hier glaubt Jemand Ueberfluß an Gefühl in sich zu haben – und beginnt zu reimen; dort erblickt eine zufällig ein weißes Blatt – und beginnt zu schreiben; die dritte meint plötzlich, es fehle an Romanen – und flugs dichtet sie; der vierte hörte von hohen Geldbeträgen, welche ein wohlgekaufter Unsterblicher erhält, denkt, er könne sie eben so gut brauchen – und schreibt. Manchen reizt glattes Papier, andere ein volles Dintenfaß, wieder andere der Anblick von irgend etwas Gedrucktem. Dieser hat eine Base, welche schreibt, jene einen Vetter, der dasselbe thut, und sofort werden beide von der Schreibwut erfaßt.
So greift das Uebel von Jahr zu Jahr weiter um sich, vererbt sich vom Vater auf Sohn, ja zieht sich manchmal durch drei Geschlechter, so daß Großmutter, Mutter und Kind der Stilomanie verfallen.
Jeder und Jede werden dann von dem Wahngedanken befallen, daß sie »berühmt« werden müssen und wenden alle erdenklichen Mittel an, um die Menge von ihrer Bedeutung zu überzeugen. Der eine läßt sich photographiren, die andre macht den Leitern von bildgeschmückten Wochenschriften so lange den Hof, bis diese ihren Kopf mit einer Lebensbeschreibung bringen, welche das neue Genie trommelrasselnd verkündigt. Eine Berliner »Bildchenzeitung« soll nächstens das lebensgroße Bild einer Dreijährigen bringen, von welchem ein Mitarbeiter erfahren hat, daß sie »Dichterin« werden wolle. Wieder einer trägt schmutzige Hemdkragen und einen breitkrämpigen Hut, eine andere versäumt keine Gelegenheit, wo sie sich öffentlich in auffälligsten Kleidern zeigen kann, damit die Welt sich nach ihr erkundige. Häufig sind jene, die da mit einem bekannten Schriftsteller in Streit zu geraten streben, nur um genannt zu werden. Mancher sucht durch Liebenswürdigkeit, mancher durch Geld den Herausgeber eines Blattes zu bestechen, daß dieser etwas von ihm aufnehme; andere lassen ihre Bücher, trotzdem keines einen Erfolg hat, auf eigene Kosten drucken, selbst wenn sie das Geld dazu borgen – und schuldig bleiben müssen.
Einige der Kranken sind schüchtern und bescheiden. Im Innern hegen sie doch böse Zweifel, ob ihre Schreibübungen wirklich einem »dringenden Bedürfniß« entgegenkommen, aber leider bilden diese die verschwindende Minderheit. Bei den Andern steigt die Unverschämtheit in geradem Verhältniß mit dem Unwerte der Leistungen. Unaufhörlich belästigen sie die Blatt, Herausgeber mit Briefen und Besuchen; schimpfen dann auf alle andern Schriftsteller, klatschen und verklatschen, und sind weder durch eisige Höflichkeit noch durch hitzige Grobheit zu vertreiben.
Nun sind wir Leute vom Zeitungswesen an sich schon erregbar. Durch diese Menschen aber wird der Zustand immer verschlechtert: wir werden leberleidend, ärgern dann unsere Frauen, behandeln unsre Kinder, unsern Hund und den Kanarienvogel schlecht; die Eßlust sinkt, die Cigarre schmeckt uns nicht und zuletzt sterben wir in der Blüte unsrer Jahre am Gallenfieber. Oder wir lassen vielleicht die angesammelte Wut an ganz unschuldigen Opfern aus. Nun werden diese erbittert, quälen ihre Frauen, Kinder, Hunde und Kanarienvögel – oder verfallen, falls sie noch unbemannt oder unbeweibt sind, in stille Melancholie, so daß der Menschheit manche schöne Kraft verloren geht.
Man sieht, wie Ring an Ring sich fügt: von der rabies scribendi geht eine Fülle von Unheil aus, die Volksgesundheit leidet darunter, Eitelkeit, Klatschsucht, Neid und Haß werden durch sie gezüchtet.
Ein bekümmerter Menschenfreund hat jüngst den Vorschlag gemacht, in allen Provinzen Heilanstalten zu errichten. Jeder Kranke wird in Einzelhaft genommen und muß täglich vier Druckbogen Manuskript liefern, wenn nicht, so erhält er nichts zu essen. Die Verbindung von Hungerkur und homöopathischer Behandlung würde sehr segensreich wirken. Ich verkenne nicht die gute Meinung, aber kann doch von dem Vorschlag keine Beseitigung des Nebels erhoffen.
Es giebt nur ein Mittel: Die Verstaatlichung der Literatur. Eingehend kann ich zwar meinen sehr geistreichen Gedanken nicht ausführen. Auf je 50 000 Einwohner wird ein Schriftsteller als »Schreibrat« angestellt, im Ganzen also 800 im deutschen Reiche, welche je nach der Dienstzeit bis zu Wirkl. Geh.-Ober-Schreibräten mit dem Titel Excellenz vorrücken können. Diese liefern alle Gattungen Dichterei an ein Reichs-Manuskripten-Amt, welches dann alle Theater, Zeitungen u. s. w. mit dem Nötigen versorgt. Nichts anderes, als die staatlich berechtigte Literatur darf gedruckt werden. Wer sich dagegen vergeht, wird mit Gefängniß, nicht unter zwei Jahren, bestraft und geht der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verlustig. Wenn das nicht hilft – so müssen wir uns die Stilomanie noch gefallen lassen. Ich stelle meinen Gedanken mit der gebührenden Bescheidenheit zur Erörterung.
*