
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
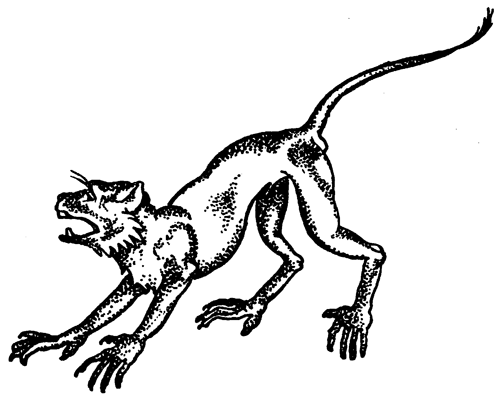
So lehrreich und angenehm der Aufenthalt im Tabakdistrikt von Deli auch für mich war, konnte diese Gegend einen alten Landdurchstreifer und Großwildfreund auf die Dauer doch nicht fesseln. Ich wollte von Sumatra etwas mehr zu sehen bekommen, als wohlbestellte Plantagen, komfortable Wohnhäuser, gemütliche Klubräume, diesen ganzen kultivierten Streifen der Ostküste, wo bereits alles so schon in Ordnung war, wie in irgendeinem Musterländle des lieben Deutschen Reiches – von ehemals. Mein Blick richtete sich auf die ferne, blaßblaue Kette der Berge im Süden, und ich entschloß mich zu einem Ausflug ins Innere, ins Land der Battaker, wo ich auch einen guten Bekannten besuchen wollte.
Die Battaker dürfen neben den Malaien der Padangschen Bovenlanden und den Atsehern als ein besonders interessanter Volksstamm Sumatras gelten. Schon daß sie im Gegensatz zu den anderen Malaien sich ihr uraltes Heidentum und auch eine gewisse politische Unabhängigkeit bewahrt haben, verschafft ihnen eine Sonderstellung. Man hält die Battaker für den ältesten Volksstamm der Insel. Einst über die ganze Nordhälfte Sumatras verbreitet, sind sie jetzt, bei einer Kopfzahl von etwa 265 000, auf die Hochebene zwischen Deli und Tobasee beschränkt. Größer und kräftiger als die Küstenbewohner, übertreffen sie diese zwar nicht an Intelligenz, wohl aber an Energie und Charakterfestigkeit. Ihre Sprache ist für die Wissenschaft insofern höchst interessant, als sie zu den ältesten malaiisch-polynesischen Sprachen gehört und ein Denkmal der ungeheuren Wanderungen des Malaienvolkes darstellt, denn sie hängt aufs engste mit der Sprache der Hova von Madagaskar zusammen, die ja, wie schon im vorigen Kapitel erwähnt, malaiischer Abstammung sind. Die Religion der Battaker ist im wesentlichen ein Dämonen- und Ahnenkultus; als Schöpfer der Welt und oberste Gottheit gilt Diebata, dem drei andere Götter als Weltregenten zur Seite stehen. Die Battaker können durchweg lesen und schreiben und bedienen sich eines eigenen Alphabets, das vorderindischen Ursprungs zu sein scheint. Sie besitzen auch eine in geschriebenen Büchern niedergelegte Literatur. Jedem Gemeinwesen steht ein Radscha mit erblicher Würde vor. Der Ackerbau wird mit ziemlich primitiven Mitteln betrieben, das Kunstgewerbe erzeugt hübsche Goldschmiedearbeiten und Holzschnitzereien.
Das klingt alles ganz gut und schön und erweckt günstige Vorstellungen von den Battakern. Dennoch haftet diesem Volke ein Ruf an, der geeignet ist, jedes Gefühl der Sympathie sogleich im Keim zu ersticken, ein Ruf, der Grauen und Abscheu erregen müßte, wenn er sich bewahrheiten sollte. Die Battaker gelten nämlich für Menschenfresser! Allerdings mit der kleinen Einschränkung, daß sie ihren kannibalischen Gelüsten nicht durchweg und auch nicht gerade gewohnheitsmäßig frönen, sondern nur in bestimmten Fällen. Die Opfer ihrer Anthropophagie sollen nur gefangengenommene, bewaffnete Feinde, sowie Landesverräter und Spione sein, ferner solche Sünder, die sich mit der Frau eines Radschas sträflich eingelassen haben. Nun ist das mit dem Kannibalismus überhaupt eine merkwürdige Sache. Wie sehr auch die Vorstellung, daß ein Mensch den anderen verzehrt, unser Gefühl verletzen mag, uns fast undenkbar erscheint, so läßt sich doch nicht die Tatsache leugnen, daß die Anthropophagie sich keineswegs auf besonders tiefstehende Rassen beschränkt. Wir wollen hier nicht von den Fällen reden, wo alleräußerste Hungersnot verzweifelte, geistig verirrte Menschen dazu treibt, sich mit dem Fleisch von ihresgleichen zu sättigen und es sich sogar durch Mord zu verschaffen. Solche Ausnahmefälle, die ins Pathologische hinüberspielen, sollen ja neuerdings in den Hungerbezirken Rußlands gar nicht so selten vorgekommen sein. Es sei auch nicht von unseren früheren Ahnen die Rede, den vorgeschichtlichen Bewohnern Europas, die, wie aus den Höhlenfunden hervorgeht, offenbar auch Kannibalismus getrieben haben. Vielfach beruht die Menschenfresserei nicht auf ungezügelter tierischer Begierde, sondern auf religiösen und abergläubischen, ja, so merkwürdig es auch klingt, auf pietätvollen Vorstellungen. Das alte Kulturvolk der Azteken in Mexiko und andere auf ziemlich hoher Stufe stehenden Völker haben aus verschiedenen Gründen Anthropophagie getrieben. Heute herrscht sie noch auf mehreren Südseeinseln, bei einigen Negerstämmen Afrikas, auch an verschiedenen Stellen Asiens und Amerikas. Zu einem offenen Eingeständnis ihres Lasters sind die betreffenden Eingeborenen dem Fremden gegenüber nur selten zu bewegen, sie suchen immer nach Möglichkeit zu leugnen.
Daß die Battaker früher und bis in die neueste Zeit hinein dem Kannibalismus gefrönt haben, wenn auch sozusagen aus »edleren« Beweggründen, unterliegt keinem Zweifel; ob solche Fälle aber, vielleicht in entlegenen Gegenden, heute noch vorkommen, ist doch fraglich. Jedenfalls sucht die holländische Regierung jedes Gelüste nach Menschenfleisch mit den strengsten Strafandrohungen zu unterdrücken, und bei dem Stamm der Karo-Battaker, die das an Deli grenzende Hochland bewohnen, will man die abscheuliche Verirrung überhaupt niemals gekannt haben.
Ich trat meine Reise ins Gebirge mit einer mit zwei Pferden bespannten leichten Kareta an; mein einziger Begleiter war der »Tukan kuda«, der Kutscher, der bei schwierigen Passagen abspringt und die Pferde führt. Es ist in Holländisch-Indien eine große Annehmlichkeit, daß man nicht so viel überflüssige Bedienung nötig hat, wie in Britisch-Indien, wo Kastengeist und Trägheit das ganze Bedienungswesen geradezu lächerlich kompliziert machen. Da der gewöhnliche Malaie keine Kastenunterschiede kennt und sich nicht für zu vornehm hält, um überall selbst Hand anzulegen, verrichtet er als einziger mindestens ebensoviel, wie drei indische Boys zusammen. Ich war mit meinem Tukan kuda auf der ganzen Tour außerordentlich zufrieden.
Schon am zweiten Tage befanden wir uns in den Bergen und zumeist in dichtem Wald. Die Landstraßen waren in Sumatra damals noch nicht so gut wie heute, wo man bis tief ins Innere hinein mit Automobilen fahren kann, aber sie waren doch im allgemeinen ganz ordentlich im Stand und oft als Hohlwege tief in den Boden eingeschnitten. Hier, wo die Schwierigkeiten des Geländes die Abholzung nicht so leicht machten, wie unten in der Alluvialebene, und wo auch kein dringendes Bedürfnis dazu vorhanden war, stand noch der richtige Urwald, wie er einst ganz Sumatra bedeckt hat. Das Wesen des tropischen Urwaldes ist Kampf, unaufhörlicher Kampf seit Jahrtausenden. Mit solcher Üppigkeit schießt er aus der dicken, mit fruchtbaren Keimen wahrhaft übersättigten Humusschicht des Bodens hervor, daß große, kleine und kleinste Gewächse, Unterholz und das Dickicht der niedrigen Pflanzen, in furchtbarer Enge um ihre Existenz zu ringen haben. In diesem geräuschlosen Kampf behauptet sich auf die Dauer, ganz wie in dem freilich minder geräuschlosen Menschenleben, nur zweierlei: die Kraft und die List. Die kräftigsten Bäume bahnen sich ihren Weg rücksichtslos nach oben und in die Breite und bereiten den weniger kräftigen Genossen ringsum einen frühen Untergang, indem sie ihnen die Möglichkeit der Entfaltung rauben, so daß sie zu kränkeln beginnen, allmählich absterben und dann mit ihren niedergebrochenen morschen Stämmen von neuem den Boden düngen. Dieser Verdrängungsprozeß ist überall im Urwalde wahrzunehmen, immer sind die besonders kräftigen Bäume von einer Nachbarschaft siecher, absterbender Bäume umgeben. Noch häufiger aber, als die Kraft, führt hier die List zum Ziel. Es gibt so viele geschmeidige Arten und zahllose Schmarotzergewächse, die selbst unter den schwierigsten Verhältnissen »Karriere« zu machen verstehen und überall durchzuschlüpfen wissen. Wer Vergleiche mit Erscheinungen des Menschenlebens liebt, braucht hier nicht lange zu suchen …
Zu diesen schlauen Nutznießern des allgemeinen Kampfes ums Dasein im Urwald gehören in erster Linie die zahlreichen Arten der Lianengewächse. Ohne eigentliche Parasiten zu sein, leben sie doch von den Bäumen, indem sie durch Emporklettern an den Stämmen, durch Entlangkriechen an den Ästen, durch Verschlingung von Baum zu Baum Stützpunkte ihrer eigenen Existenz suchen und finden. Die Liane ist durchaus auf andere, stärkere Gewächse angewiesen. Bald in Gestalt dünner, nur schwach belaubter Zweige, bald solcher, die wie Taue aussehen, strecken sie ihre Fangarme von Baum zu Baum, füllen jeden Zwischenraum aus, daß es ohne die wuchtigen Hiebe des Golok (Buschmessers) kein Durchkommen gibt, hängen von den Kronen in zahllosen Windungen und Schleifen herab und umschlingen die Stämme oft so fest, daß sie tief in die Rinde einwachsen, und der Baum unter der furchtbaren Umklammerung über kurz oder lang dahinsiecht, um schließlich abzusterben. Zu den häufigsten Kletterpalmen des sumatranischen Urwaldes gehört der Rottang, der, wie schon erwähnt, das Hauptmaterial zum Hausbau der Malaien liefert und aus dessen Rinde unser europäisches Stuhlrohr stammt. Jedes Blatt der zierlichen Rottangwedeln läuft in eine ein bis zwei Meter lange dünne, zähe Gerte aus, die mit spitzen Widerhäkchen bedeckt ist. Mit diesen Widerhaken klammert sich der Rottang an den Bäumen fest, klettert an ihnen bis zu den höchsten Wipfeln empor und wandert dort zu anderen Wipfeln weiter, so daß ein Rottangstamm schließlich, obwohl selten mehr als armdick, die enorme Länge von 200 bis 300 Meter erreicht. Wo der Rottang das Feld behauptet, dort gibt es überhaupt kaum ein Durchkommen, denn da auch sein Stamm mit zollangen Stacheln bedeckt ist, die beim Eindringen in die Haut böse Wunden erzeugen, steht in solchem Dickicht der Mensch einem ganz gefährlichen, tückischen Feind gegenüber.
Aber auch zahlreiche tierische Feinde machen dem Eindringling in den Urwald das Leben schwer. Nicht Tiger und anderes Großwild – gegen die kann man sich schützen. Nein, das kleinste Getier, das Gewimmel der fliegenden, kriechenden, springenden Quälgeister, von den entsetzlichen Moskitos angefangen bis zu den ebenso hinterlistigen wie lästigen »Patjets«. Die Patjets gehören derselben niederträchtigen Gattung an wie die sogenannten Ticks, mit denen ich schon auf den Andaman-Inseln Bekanntschaft gemacht hatte, wobei das Vergnügen durchaus auf Seite der Ticks war. Es sind kleine, zollange, in nüchternem Zustand ungefähr streichholzdicke Blutegel. Der Urwald wimmelt förmlich von ihnen. Mit sicherem Instinkt halten sich die kleinen Bestien vornehmlich an allen ausgetretenen Pfaden auf, weil sie hier am ehesten Gelegenheit finden, sich auf ihre tierische und menschliche Beute zu stürzen. Sie sitzen hier im Gras und an den Blättern der über den Weg hängenden Zweige, und wenn man über das Gras schreitet und die Zweige streift, so heften sie sich mit fabelhafter Fixigkeit an einem fest und suchen zwischen den Kleidern Zugang zur Haut. Dabei machen sie sich so fadendünn, daß sie durch die Maschen der dichtesten Strümpfe, sogar durch die Schnürlöcher der Stiefel und zwischen den Windungen der Wickelgamaschen unfehlbar ihren Weg zu finden wissen, und sie suchen sich nun am Körper die Stelle aus, die ihnen für ihr blutdürstiges Handwerk, oder richtiger gesagt Mundwerk, am geeignetsten erscheint. Erst durch einen leise prickelnden Schmerz wird der Befallene auf seinen unerwünschten Gast aufmerksam gemacht. Und da man sich auf dem Marsch doch nicht fortwährend ausziehen kann – die abgelegten Sachen würden auch sofort von Ungeziefer wimmeln –, läßt man die Patjets, solange es nicht gar zu arg wird, gewähren, um erst später im Quartier eine Razzia auf die unangenehmen Tiere abzuhalten, soweit sie nicht inzwischen bereits, vom ausgesogenen Blut dick angeschwollen, das »Lokal« wieder verlassen haben. Obwohl ich mich immer stark mit Senföl eingerieben hatte, dessen Geruch den Blutegeln nicht sympathisch ist, fand ich doch einmal, als ich nach einer längeren Wanderung im Quartier »Inventur« machte, nicht weniger als vierzehn Stück an meinem Körper haften.
Im Widerspruch zur allgemein verbreiteten Ansicht ist der tropische Urwald eigentlich arm an Blütengewächsen. Wohl gibt es zahllose blühende Pflanzen, aber sie verlieren sich entweder im dichten Laubgewirr des Unterholzes, oder sie entfalten ihre Pracht so hoch über dem Scheitel des Wanderers, daß er sie kaum zu sehen bekommt. Das ist besonders bei den seltensten und kostbarsten aller tropischen Blütengewächse der Fall, den Orchideen. Die schönsten Orchideen gehören zur Epiphytenflora, d. h. zu jenen Pflanzen, die auf anderen Gewächsen leben; sie sind deswegen aber keine Schmarotzer und entziehen dem Baum, auf dem sie wachsen, keine Nährsäfte, sondern benutzen ihn nur als Unterlage, um in der Höhe mehr Licht und Luft zu genießen, als ihnen im dunkeln Urwalddschungel geboten wird. Sie klammern sich mit den Wurzeln an einen Ast, gewisse Arten lassen außerdem auch noch zahlreiche Luftwurzeln lang herabhängen. Sie leben von Tau und Regen und saugen die nährende Flüssigkeit mit ihren schwammigen Wurzelhüllen auf. Die seltensten Orchideen sind das heißbegehrte Ziel der berufsmäßigen Blumensammler – meistens sind es Deutsche –, die von den großen Orchideenzüchtereien in Europa und Amerika in alle Welt hinausgeschickt werden, um neue Arten zu erbeuten. Mit einem durch lange Erfahrung geschärften Blick für gewisse Merkmale und Anzeichen weiß der Blumensammler die Orchideen, die man von unten nur schwer zu sehen bekommt, aufzuspüren, und wenn er eine ganz neue, zur Züchtung geeignete Art entdeckt, bedeutet das bei den Riesenpreisen, die von den Liebhabern dafür angelegt werden, immer einen großen Gewinn.
Unter den vielen Stimmen des Urwaldes klingt am sichersten erkennbar die des schwarzen Siamangaffen hervor. Er ist die größte und plumpste Art der menschenähnlichen Gibbons, wird einen Meter lang und lebt sippenweise in größeren Herden. Auf dem Boden sehr langsam und ungeschickt aufrecht gehend, wobei er sich mit Hilfe der Arme im Gleichgewicht hält, zeigt er sich auf den Bäumen als ganz verwegener Springer. Ich sah einmal einen alten Siamang, anscheinend der Anführer der Herde, einen Luftsprung von einem Baumwipfel zum andern über eine Spanne von mindestens zwölf Meter machen. Der Siamang hat eine laut schallende, durch einen Kehlsack verstärkte Stimme, von der er besonders morgens und abends ausgiebigen Gebrauch macht, und wenn so eine ganze Herde mit ihrem Konzert anfängt, hört man es auf weite Entfernung. Besonders scheu sind die Siamangs gerade nicht, man bekommt sie deshalb auf der Wanderung durch den Urwald ziemlich häufig zu Gesicht, und sie zu schießen fällt nicht schwer.
Die Battaker bedienen sich einer recht gemeinen Methode, um die Siamangs, die sie trotz ihrer Menschenähnlichkeit oder vielleicht gerade deshalb als Braten sehr schätzen, zu erlegen. Da sie keine Schußwaffen besitzen, sind sie auf ihre primitiven Jagdgeräte angewiesen, die sie allerdings auf meisterhafte Weise zu handhaben verstehen. Die Affenjagd wird mit dem Blasrohr betrieben. Auf die Herstellung dieser seiner Lieblingsjagdwaffe verwendet der Battaker alle Geschicklichkeit und Kunst. Er setzt den Innenlauf des etwa zwei Meter langen Rohres aus sorgfältig geglätteten, genau ineinandergepaßten Bambusstücken zusammen und umgibt ihn mit einem Mantel aus dem Holz der Arekapalme, der Mantel wird dann gern mit zierlichen Schnitzereien und metallenen Ringen geschmückt. Die etwa 27 Zentimeter langen, sehr dünnen Pfeile werden ebenfalls aus Bambus angefertigt, scharf zugespitzt und unterhalb der Spitze so eingekerbt, daß diese leicht abbricht und im Körper des getroffenen Wildes stecken bleibt. Das untere Ende des Pfeiles wird mit einem Baumwollpfropfen versehen, um den Kontakt mit der Innenwand des Blasrohres herzustellen. Nun vergiftet der Battaker die Pfeilspitzen, indem er sie in einen dickflüssigen Brei taucht, der aus dem Saft des berüchtigten Upasbaumes, aus Pfeffer, Ingwerwurzeln und den Blättern einer gewissen Sumpfpflanze eingekocht ist. Die mit dem Gift getränkten Pfeilspitzen sollen ihre tödliche Wirkung jahrelang beibehalten. Mit dieser heimtückischen Waffe begibt sich der Battaker auf die Affenjagd, die, wenn es sich um Siamangs oder die nahe verwandten Ua-Uas handelt, keine erheblichen Schwierigkeiten verursacht, da diese Affen sich durch ihr weithin schallendes Gebrüll deutlich bemerkbar machen und sich in ihrer Neugier den Menschen gern nähern. Sobald der Battaker zum Schuß kommt, d. h. auf eine Entfernung von 25-30 Meter, sucht er vor allem den Leitaffen der Herde zu treffen, den er daran erkennt, daß es meistens der größte und stärkste Affe ist. Bei der außerordentlichen Geschicklichkeit, mit der der Battaker das Blasrohr handhabt, verfehlt er selten sein Ziel. Immerhin würde der Pfeil den getroffenen Affen in den meisten Fällen wohl nur mehr oder minder schwer verwunden, aber nicht töten – wenn er eben nicht vergiftet wäre. Das Gift übt auf den tierischen Organismus sehr schnell eine tödliche Wirkung aus, so daß der entfliehende Affe nicht weit kommt, sondern bald vom Baume herab zu Boden fällt, wo ihm der Battaker mit dem Hiebmesser den Rest gibt, um ihn dann im Triumph der häuslichen Bratpfanne zuzuführen. Das auf das Tier übertragene Pfeilgift scheint den Genießern des entsetzlichen Schmauses nicht im geringsten zu schaden.
Alles, was man von den Battakern hört, klingt so wenig vertrauenerweckend, daß man der näheren Bekanntschaft mit ihnen mit gemischten Empfindungen entgegensieht. Aber auch dieses Volk, wenigstens der Karo-Battaker, ist entschieden viel besser als sein Ruf, dessen Verunglimpfung sich die Malaien der Ostküste sehr angelegen sein lassen. Als ich das erste Battakerdorf berührte, war ich beinahe überrascht, ein ganz ordentliches Gemeinwesen mit freundlichen, netten Menschen zu finden, und dieser günstige Eindruck wurde im Verlauf meiner Reise beim Besuch weiterer Ortschaften nicht etwa abgeschwächt, sondern eher noch verstärkt. Eines macht sich allerdings sogleich augenfällig bemerkbar: nämlich, daß der Battaker keine so vorgeschrittene Kultur besitzt wie der eigentliche Malaie, besonders der Malaie der Padangschen Oberlande. Zwar lassen die Häuser der Battaker ebenfalls eine bemerkenswerte Kunstfertigkeit erkennen, aber sie bleiben doch hinter den architektonischen Leistungen der Malaien zurück. Auch die Battakerhäuser stehen auf Pfählen, der Rumpf des Gebäudes ist stark nach unten verjüngt, das Dach ragt sehr hoch empor und hängt mit den Giebelwänden etwas über. Die Leiter, die zur Veranda des Hauses hinaufführt, ist sehr primitiv und besteht gewöhnlich nur aus einem eingekerbten Baumstamm. Im Gegensatz zu dem putzsüchtigen, aber geschmackvollen Malaien, dem es nicht darauf ankommt, sein ganzes gerade vorhandenes Geld für die Anschaffung eines schönen Sarong oder einiger Schmucksachen zu verwenden, begnügen sich die Battaker mit der einfachsten Kleidung aus grobem Zeug. Auch die Reinlichkeit läßt sehr zu wünschen übrig. Schneckenförmige Silberspangen im Ohr bilden gewöhnlich den einzigen Schmuck der Frauen; diese Gewinde sind so groß und schwer, daß sie außerdem auch noch am Kopftuch befestigt werden müssen, weil ihr Gewicht sonst die Ohrläppchen zerreißen könnte.
Im allgemeinen sind die Battaker freundlich und dienstwillig. Neben dem Ackerbau treiben sie als Heiden Schweinezucht, während für den mohammedanischen Malaien das Schwein ein verpöntes Tier ist. Früher sah sich der Reisende im Battakerland auf die Unterkunft in den Gemeindehäusern angewiesen, die zur Aufnahme von Fremden bestimmt sind. In neuerer Zeit ist das System der »Pasanggrahans«, der von der Regierung eingerichteten Unterkunftshäuser, auch auf die größeren Ortschaften des Battakerlandes ausgedehnt worden, so daß man das Übernachten in den keineswegs komfortabelen und noch weniger ungezieferfreien Gemeindehäusern kaum noch nötig hat. Diese Pasanggrahans entsprechen in ihrer Einrichtung ungefähr den Dak-Bungalows oder Rasthäusern in Britisch-Indien und sind wie jene für den vorübergehenden Aufenthalt und eine einfache Verpflegung der reisenden Europäer, in erster Linie der Beamten, bestimmt.
Mein Ziel war das größte Binnengewässer Sumatras, der Tobasee, der sich ungefähr in der Mitte zwischen der Ostküste und der Westküste befindet, und dessen Ufer in landschaftlicher Hinsicht den Glanzpunkt des Hochlandes von Nordwest-Sumatra bedeuten. Nach seinem Flächenraum zweiundeinhalbmal so groß wie der Bodensee, windet sich der Tobasee fast ringförmig um die große Halbinsel Samosir herum. Dunkle Bergwände, bis 2400 Meter hoch, fallen steil zu den blauen Gewässern herab, die vermutlich einen alten vulkanischen Riesenkessel ausfüllen. Da infolge der Höhenlage des Tobasees (fast 1000 Meter) hier ein sehr angenehmes, gesundes Klima herrscht und die Landschaft so reizvoll ist, haben sich an seinen Ufern neuerdings zahlreiche Ansiedler Villeggiaturen geschaffen, so daß die Gegend setzt immer belebter wirb. Aber damals waren erst wenige Landhäuser vorhanden, und man genoß hier einen idyllischen Frieden, dem ich mich unter dem gastlichen Dach des Bungalows, das sich hier mein Geschäftsfreund errichtet hatte, mit Wonne hingab.
Meine Beziehungen zu diesem Freunde reichten schon weit in die Vergangenheit zurück, denn bei den meisten Tiergeschäften, die mich mit Sumatra verbanden, hatte er den Vermittler gespielt. Sumatra war ja für mich, in meiner Eigenschaft als Tierhändler, immer von größter Bedeutung gewesen, denn wenn auch die Ostküste, wie bereits erwähnt, durch die fortschreitende Kultivierung des Bodens neuerdings ziemlich arm an Großwild geworden ist, so war – und ist auch heute noch – das Innere der großen Sundainsel doch eines der wildreichsten Länder der Welt, reich besonders an seltenen, hochgeschätzten und hochbezahlten Tieren, unter denen der Orang-Utan obenan steht. Was habe ich nicht alles im Laufe von fünfundzwanzig Jahren aus Sumatra erhalten und in Ceylon in meinen Gehegen für den Weitertransport vereinigt gesehen! Elefanten (der Insel-Elefant wird als eigene Art betrachtet), Rhinozerosse, Tiger, der edle Schwarzpanther, der katzenähnliche Binturongbär, verschiedene Affenarten, Schuppentiere, Buschschweine, Riesenschlangen – um nur einige der wichtigsten Tiergattungen zu erwähnen –, alles war in prachtvollen Exemplaren durch meine Hände gegangen und wurde von mir zum Teil an meinen Bruder Carl Hagenbeck in Hamburg, zum Teil an verschiedene Zoologische Gärten in Europa und Amerika exportiert.
Was die vorhin erwähnten Orang-Utans betrifft, so war es mir wiederholt geglückt, junge Tiere dieser so gesuchten und hochbezahlten, leider sehr empfindlichen und im nordischen Klima wenig widerstandsfähigen Menschenaffenfamilie zu erhalten. Sumatra und Borneo sind ja die einzigen Länder, in denen der Orang-Utan heimisch ist. Er lebt in feuchten, dunklen Wäldern, bewegt sich nur ungern auf dem Boden und hält sich hauptsächlich auf den Bäumen auf, wo er sich in halb aufrechter Stellung mit außerordentlicher Gewandtheit auf den Ästen vorwärts bewegt. Er schläft auch nur auf den Bäumen, und zwar in beträchtlicher Höhe, etwa acht bis fünfzehn Meter über dem Boden, und baut sich dort aus Ästen und Laub ein Nest, das er nach kurzer Zeit wieder erneuert. Im Gegensatz zu den Gibbons, die auf dem Boden meistens aufrecht gehen, stützt sich der Orang-Utan immer mit den Vorderhänden und richtet sich allein mit Hilfe der hinteren Extremitäten nur gelegentlich einmal auf. Orang-Utan heißt auf malaiisch »Waldmensch«, und die Malaien betrachten ihn auch mit abergläubischer Scheu als eine Art Mensch. Nach einer auf den Inseln verbreiteten uralten Legende soll der Orang-Utan aus einer Verbindung von Affen mit eingeborenen Weibern entstanden sein, er soll auch reden können, wenn er nur wollte. Die Menschenähnlichkeit seines Gesichts fällt besonders bei jungen Tieren auf, um sich dann im späteren Alter zu verlieren. Jung gefangene Tiere sind liebenswürdig und gelehrig, aber wenig lebhaft, sehr still, geradezu melancholisch. Ich hatte einmal in Colombo einen jungen Orang-Utan, der so verständnisvoll mit seinem Freunde, einem kleinen Singhalesenjungen, spielte und sich dabei so »menschlich« benahm, daß man gar nicht besonders erstaunt gewesen wäre, wenn er plötzlich gesprochen hätte. Diese liebenswürdigen Züge sind allerdings nur bei jungen Tieren in der Gefangenschaft zu beobachten, und auch nur dann, wenn man sich sehr eingehend und liebevoll mit ihnen beschäftigt. Der alte Orang-Utan ist in der Freiheit, in seinem Urwaldrevier, keineswegs sehr gemütlich, sondern mit seinen kräftigen Armen und dem furchtbaren Gebiß ein nicht zu verachtender Gegner. Jedenfalls gehen ihm alle anderen Tiere gern aus dem Wege, selbst von den großen Katzen hat er nichts zu fürchten.
Wenn alte Tierfreunde und Jäger beisammen sind, ist natürlich die Jagd samt allem, was Tiere betrifft, der Punkt, um den sich die Unterhaltung mit Vorliebe dreht, und somit war der bevorzugteste Gegenstand der Gespräche zwischen mir und meinem Freunde von vornherein festgelegt. Einige seiner interessantesten Jagderlebnisse feilen hier folgen, wobei er selbst als Erzähler auftreten mag.
»Der Orang-Utan oder Mawas, wie ihn der Ostküsten-Malaie meistens nennt, ist kein besonders schwer zu erlegendes Tier, und wenn er trotzdem eine verhältnismäßig seltene Jagdbeute ist, so liegt das erstens daran, daß er überhaupt nicht sehr häufig vorkommt, und dann an seinem zurückgezogenen Leben im dichtesten Wald und hoch oben im Geäst und Laubwerk der Bäume. Selbst von jenen Eingeborenen, die von Berufs wegen in den Wald gehen müssen, haben ihn viele noch niemals gesehen, wenngleich sie auch das dumpfe Geheul, das er mit seinen großen Kehlsäcken ausstößt, oft genug zu hören bekamen. Es ist deshalb kein Wunder, daß über den geheimnisvollen ›Waldmenschen‹ die tollsten Fabeln im Umlauf sind, und die Phantasie der Eingeborenen das Tier mit den seltsamsten Fähigkeiten ausschmückt.
Ich habe im ganzen vier Orang-Utans erlegt und drei lebendige Junge erbeutet. Eigentlich geht dem richtigen Weidmann und Tierfreund, der kein Aasjäger ist, diese Affenjagd stark gegen das Gefühl. Einen menschenähnlichen Affen zu schießen, und noch dazu die Mutter eines hilflosen Jungen, ist mir nicht sehr sympathisch, und das Peinliche der Sache wird noch dadurch verstärkt, daß der verwundete und zu Tode getroffene Affe Klagelaute ertönen läßt, die etwas erschreckend Menschliches haben. Aber wenn man sich junge Orang-Utans verschaffen will, die von den Zoologischen Gärten so dringend begehrt werden, so gibt es keinen anderen Weg, als eine Affenmutter zu erlegen und sich dann des verwaisten Jungen zu bemächtigen.

Tempel in Bangkok

Chinesischer Palast des Königs von Siam in Bangpa-in

Das Königliche Schloß in Bangkok
Obwohl der Orang-Utan in tiefster Verborgenheit lebt, zeigt er sich, wenn man ihn einmal entdeckt hat, durchaus nicht übermäßig scheu. Da er von anderen Tieren nicht angegriffen wird und Menschen gar nicht oder nur selten zu sehen bekommt, fühlt er sich ziemlich sicher und zieht sich, wenn ihm der nahende Mensch verdächtig erscheint, nur zögernd in höhere Baumstockwerke zurück. Ich habe einmal einen alten Orang-Utan beim Bau eines Nestes überrascht. Das knackende Geräusch von abgebrochenen Ästen hatte mich auf ihn aufmerksam gemacht, und dann sah ich über mir im Baumwipfel seinen rotbraunen zottigen Arm hin und her fahren und Äste abbrechen, um sich daraus eine Schlafstelle zu bereiten. Als ich stehen blieb und für alle Fälle mein Gewehr fertig machte, bemerkte mich auch der Affe, hielt in seiner Arbeit inne und glotzte mich mit einem geradezu komischen Ausdruck der Verblüffung lange an, schien dann über die Störung in Zorn zu geraten, fletschte sein furchtbares Gebiß und stieß grunzende, dumpfe Töne aus. Da ihm die Situation doch offenbar ungemütlich wurde, schwang er sich, aber ohne Überstürzung, in dem Geäst eine Etage höher. Ich hätte ihn sicher zu Schuß bekommen, hatte aber gar kein Interesse daran, zumal die Bergung der Beute auf Schwierigkeiten gestoßen wäre, und ging deshalb meines Weges weiter.
Ein anderes Mal bemerkte ich in ganz ähnlicher Lage eine Affenmutter mit einem noch sehr kleinen Jungen, das sich an ihre Seite anklammerte. Da mir viel an der Erbeutung des Jungen lag, gab ich Feuer. Die verwundete Äffin glitt am Baumstamm hinab und fiel zu Boden, erhob sich aber bei meiner Annäherung wieder sehr rasch und stürzte halb aufgerichtet, mit wutverzerrtem Gesicht und furchtbarem Zähnefletschen, gurgelnde Laute ausstoßend, auf mich los. Es ist ja bekannt, mit welcher Furchtlosigkeit Affenmütter ihr Junges verteidigen. Ehe ich mich des überraschenden Angriffs erwehren konnte, schlug mir die Alte die scharfen Krallen der rechten Hand ins Gesicht und riß mir die Wange auf – der tiefe Schmiß ist noch heute zu sehen. Ich sprang zurück, legte an und erledigte das Tier durch Kopfschuß, es fiel auf den Rücken und war sofort tot. Nun löste sich das Junge von der Mutter los und versuchte quäkend die Flucht zu ergreifen. Aber ich nahm meine Regenmantille ab, warf sie über das kleine Tier und wickelte es trotz seines heftigen Sträubens und Kratzens darin ein, worauf ich mit der wimmernden, strampelnden Beute so rasch wie möglich nach meinem glücklicherweise nicht weit entfernten Standquartier zurücklief.
Es war mir weniger um des kleinen Orang-Utans willen, als wegen meiner heftig blutenden und schmerzenden Rißwunde so eilig. Denn die Fälle, wo solche von Tieren gerissene Wunden tödliche Blutvergiftungen zur Folge hatten, sind zahlreich genug. In meinem Jagdquartier angelangt, wusch und desinfizierte ich die Wunde sogleich aufs sorgfältigste, sah dann aber doch mit starker Beklemmung dem weiteren entgegen, bis endlich die kritische Zeit verging, ohne daß Blutvergiftung eintrat. Der kleine Unhold von Orang-Utan wurde von mir und meinen malaiischen Dienern, die sich über den noch niemals zuvor gesehenen Affen nicht genug wundern konnten, in sorgfältigste Pflege genommen. Anfangs gebärdete er sich ganz verzweifelt, schien furchtbare Angst zu haben, wimmerte und schrie und wollte keine Nahrung annehmen. Aber dann beruhigte er sich allmählich und konnte auch dem lockenden Anblick von Milch und Bananen, die wir dicht neben sein Lager stellten, nicht länger widerstehen. Es war nun erstaunlich, wie rasch sich der kleine Orang-Utan an seine Pfleger und die veränderte Umgebung gewöhnte. Wie ein kleines Kind verlangte er mit bittenden Schreien und Gesten danach, auf den Arm genommen und herumgetragen zu werden. Er erhielt ein paar kleine zahme Javaneraffen als Spielgenossen, beteiligte sich aber gar nicht an deren dummen Streichen, sondern beschäftigte sich still für sich selbst. Gefangene Orang-Utans haben immer etwas Melancholisches, so richtig froh werden sie nie. Dieses junge Exemplar habe ich über seine Kinderkrankheiten ebenso gut hinweggebracht, wie ein zweites, das ich unter ähnlichen Umständen fing; ein drittes ging leider sehr rasch bei mir ein.
Nun etwas ganz anderes: die Geschichte eines jungen Nashorns, das ich im vorigen Jahre erbeutet habe. Unser Rhinoceros Sumatranus ist alles andere, nur kein Geistesathlet. Man fügt ihm wohl eine Verbalinjurie zu, trifft aber dennoch den Nagel auf den Kopf, wenn man es als ungewöhnlich stupid bezeichnet. Im allgemeinen ist es ein recht harmloses, friedliches Tier. Ich bin oft genug an äsenden oder sich im Sumpfe suhlenden Nashörnern in allernächster Nähe vorbeigekommen, ohne daß sie sich dadurch im geringsten stören ließen, höchstens daß sie mich eine Weile anglotzten, wie die sprichwörtliche Kuh das neue Tor. Nur dort, wo man Nashörner häufig schießt, werden sie mißtrauisch und auch gefährlich. Wo der Dickhäuter mit Jägern noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat, gehört wirklich nicht viel dazu, ihn zu erlegen, denn man kann ganz nahe herankommen und so ruhig zielen, wie auf einem Scheibenstand.
Aber das Bild verändert sich sehr, wenn man es mit einer säugenden Nashorn-Mutter zu tun hat. Es gibt kaum ein anderes Tier, das sein Junges mit einer solchen Wut und solcher Hartnäckigkeit verteidigt, wie das Rhinozeros. Es hat immer nur ein einziges Junges. Dieses entwickelt sich sehr langsam und wird zwei Jahre lang von der Mutter gesäugt, die ihr ungeschlachtes Baby auch kaum fünf Sekunden lang aus den Augen läßt. Im Gegensatz zu dem apathischen Stumpfsinn, den das Nashorn sonst bekundet, befindet sich die Mutter, die noch ihr Kleines bei sich hat, stets in einem Zustand des Mißtrauens und der Gereiztheit, wenn ihr irgend jemand zu nahe kommt. Mit einem solchen Tier offen anzubinden, ist immer eine riskante Sache, denn wenn man es nicht schnell unschädlich machen kann, sieht man sich der rasenden Wut des Nashorns ausgesetzt. Und was das bei seiner ungeheuren Kraft zu bedeuten hat, bedarf keiner näheren Erklärung. Der Eingeborene zieht es deshalb vor, die Nashörner in Fallgruben zu fangen. Das Fleisch wird sehr geschätzt, die dicke Haut ist zu allem Möglichen zu gebrauchen, und als besonders begehrenswert gelten die Hörner, die der Malaie zerschabt, um das daraus gewonnene Pulver für teures Geld als – Liebeszauber zu verkaufen. Man drechselt aus den Hörnern auch Giftprobebecher; eine vergiftete Flüssigkeit soll darin aufbrausen, was natürlich Unsinn ist.
Eines Tages meldeten mir zwei Leute, daß sie in einem sumpfigen Gelände am Rande des Waldes ein großes, starkes Mutter-Nashorn mit einem etwa einjährigen Jungen gesehen hätten. Ich war sehr begierig danach, das Junge lebend zu erbeuten, und machte mich alsbald nach der bezeichneten Gegend auf. Da die Nashörner nicht, wie die Elefanten, weit umherschweifen, sondern dort, wo sie genügend Nahrung finden und es ihnen gefällt, lange zu verweilen pflegen, konnte ich mit ziemlicher Bestimmtheit darauf rechnen, die Alte mit dem Baby noch anzutreffen. Und richtig, mit dem Jagdglas machte ich beide Tiere schon auf weite Entfernung aus, um aber unterm Winde an das Wild heranzukommen, galt es, den ganzen Sumpf zu durchqueren. Ich ließ die Leute mit Ausnahme eines Jagdgehilfen, eines Battakers, am Rande des Sumpfes zurück, und dann pirschten wir beide uns heran. Es war ein greuliches Stück Arbeit, denn fast anderthalb Stunden lang wateten wir, zwischen dem niedrigen Gesträuch halb kriechend Deckung suchend, durch den Morast, in dem wir oft bis weit über die Knie versackten. Das höchst fragwürdige Vergnügen wurde noch durch die zahlreichen Lintas erhöht, die großen Wasserblutegel, die in den Pfützen der Sümpfe leben und ganz gefährliche Biester sind, weil ihre Saugbisse oft langwierige Eiterungen zur Folge haben. Wir waren mit den scheußlichen Tieren bald so bedeckt, daß wir uns zunächst einmal auf einer einigermaßen trockenen Stelle ausziehen mußten, um uns das Ungeziefer gegenseitig abzulesen.
Endlich kamen wir unserem Wild so nahe, daß ich glaubte, meines Schusses sicher zu sein. Die Alte hatte uns bisher nicht eräugt und äste mit ihrem Jungen gemächlich auf einer mit Buschwerk und einigen Bäumen bestandenen trockenen Fläche, die wie eine Insel im Sumpfe lag. Von dicht belaubten Sträuchern gut gedeckt, lagen wir mit dem Gewehr im Anschlag und hatten ein gutes freies Schußfeld. Ich wollte zuerst feuern, dann sollte Tabong, der Battaker, im Bedarfsfall den zweiten Schuß abgeben. Wir mußten das Tier unbedingt ganz schnell erledigen oder wenigstens kampfunfähig machen, denn wenn wir es etwa nur leicht verwundeten, so hatten wir uns mit Bestimmtheit auf eine rasende Attacke gefaßt zu machen, und bei dem schwierigen Terrain, das nirgends eine Zuflucht bot, stand dann für uns alles auf einer Karte. Denn so plump auch das Rhino aussieht und so langsam es sich für gewöhnlich bewegt, entwickelt es doch beim Angriff eine ganz erstaunliche Schnelligkeit, auch auf sumpfigem Boden, der ja sein ureigenstes Element ist.
Den Finger am Abzug, wartete ich, bis sich das Nashorn, das uns beharrlich seine mächtige Hinterfront zuwandte, endlich einmal von einer besseren Seite zeigen würde. Da – jetzt machte es langsam kehrt, hob den Kopf, schien Unheil zu wittern und glotzte mit seinen kleinen Schweinsaugen zu unserem Versteck hinüber. Aber ehe es noch die günstige Stellung verändern konnte, krachte mein Schuß …
Getroffen hatte ich sicher – aber wo und wie? … Das Nashorn prallte zurück, stampfte mit den Vorderfüßen die Erde, schien ausreißen zu wollen, blieb dann aber unschlüssig und wie betäubt ein paar Sekunden lang stehen. Das Baby, das noch die rötliche glatte Haut der jungen Rhinozerosse hatte, hielt sich ängstlich dicht bei der Mutter.
›Feuer!‹ rief ich meinem Gehilfen zu. Tabong schoß. Das Nashorn machte einen Seitensprung – und dann stürmte es, den Kopf gesenkt, genau auf die Stelle los, wo wir lagen. Als es nur noch zehn Meter von uns entfernt war, schoß ich zum zweitenmal, und unmittelbar darauf auch Tabong. Ohne dadurch abgeschreckt zu werden, setzte das Tier seinen Ansturm fort. Wir sprangen beide auf und ein Stück auseinander. Im nächsten Augenblick durchbrach das rasende Vieh mit seinem Dickschädel das Gebüsch, als ob es Spinnweben wären, und hieb mit seinem Doppelhorn von unten nach oben nach Tabong hin, der mit dem Fuß in ein Wurzelgeflecht geraten und der Länge nach auf das Gesicht gefallen war …
Ich hatte inzwischen Zeit gefunden, mich wieder schußfertig zu machen, und jagte dem Tier aus allernächster Nähe eine Kugel in den Nacken, hinter dem Ohr. Das Nashorn wankte auf zitternden Beinen ein paarmal hin und her und brach dann zusammen. Glücklicherweise fiel es nicht auf Tabong, es hätte ihn sonst mit seinem ungeheuren Gewicht zu Brei zerdrückt. Ich wandte mich zunächst dem Battaker zu, zog ihn aus dem Wurzelgeflecht heraus und sah zu meiner Freude, daß er wohlbehalten war, denn das Horn des Rhinos hatte nur die Wade gestreift und ihm eine starke Schramme beigebracht. Es war für den Burschen in der Tat ein knappes Entkommen gewesen.
Als wir das Nashorn untersuchten, war es bereits verendet. Übrigens hätten, wie wir jetzt feststellen konnten, auch schon mindestens zwei der vorangegangenen Schüsse in kürzester Zeit tödlich gewirkt, nur die äußerste Wut hatte den Koloß zu einer letzten Kraftanstrengung befähigt. Wirklich rührend war das Verhalten des armen verlassenen Jungen, um dessentwillen die Alte ihr Leben hatte hergeben müssen. Es war der Mutter zögernd gefolgt und stand jetzt in einiger Entfernung von uns angstvoll und ratlos da. Als wir es ergreifen wollten, lief es zuerst davon, kehrte dann aber im Bogen zum Kadaver der Alten zurück, wo wir es packen und ihm mit dem mitgebrachten Lederriemen die Beine fesseln konnten.
Meine anderen Leute waren uns inzwischen befehlsgemäß in weitem Abstand gefolgt und trafen jetzt ein. Die zum Abtransport unseres Gefangenen notwendigen Hilfsmittel führten sie natürlich vorsorglicherweise schon mit sich. Dem Rhinobaby wurde ein breiter Gurt unter dem Leibe durchgezogen, und der Gurt ward an einer starken Bambusstange befestigt, deren Enden die Leute auf die Schulter nahmen. Das Tier hing also in der Schlaufe und mußte, halb gezogen, zwischen den Trägern mitgehen, ob es wollte oder nicht. Es sträubte sich aber nur anfangs und ließ sich dann ganz apathisch abtransportieren.
Ehe wir den Rückmarsch antraten, meißelten wir dem Kadaver die beiden Nashörner ab. Aus dem schönen großen Vorderhorn habe ich mir eine Jagdtrophäe herstellen lassen, das minder ansehnliche zweite Horn überließ ich meinen Leuten als Prämie – zur Verwertung als Liebeszauber! Die Battaker schnitten sich auch noch die saftigeren Fleischportionen heraus, die sie sehr zu schätzen wissen, und lederten die besten Hautstücke ab, aus denen sie Peitschen und alles Mögliche machen. Dann begann der beschwerliche Rückmarsch durch den Sumpf. Manchen Schweißtropfen hat es uns gekostet, aber wir haben unser Rhinozerosküken wohlbehalten nach Hause gebracht. Dort hat es sich schnell an die neue Umgebung gewöhnt und so vortrefflich entwickelt, daß ich es bald sehr vorteilhaft verkaufen konnte.«
Schon immer war es mein Wunsch gewesen, den prächtigsten Vogel der Sundainseln, den Argusfasan, erbeuten zu können. Er kommt nur in Sumatra und Borneo, allenfalls noch auf der Malakkahalbinsel vor und verdankt seinen Namen den augenähnlichen Kreisen, mit denen die Flügel- und Schwanzfedern des prachtvoll gefärbten Männchens geschmückt sind; der dem Argos, dem »Allsehenden«, entlehnte Name paßt aber auch für das Mißtrauen und die außerordentliche Wachsamkeit dieses scheuen Vogels. Der Familie der Pfauen angehörend, erreicht der Argusfasan vom Kopf bis zu den Spitzen des Schwanzgefieders eine Länge von 1,8 Meter, ist also ein sehr stattliches Tier, dem nicht bloß wegen der herrlichen Federn, sondern auch um des schmackhaften Fleisches willen stark nachgestellt wird. Da er sich tief im Urwald verbirgt und bei der geringsten Störung abstreicht, ist die Jagd sehr schwierig.
Eines Tages kam der Jagdgehilfe meines Freundes, ein zäher, sehniger Battaker, mit der Meldung, daß im Wald ein Argusfasan und einige wilde Hähne balzten. Auch der wilde Hahn, ein Vetter unseres zahmen Haushahns, dem er jedoch an Farbenpracht ebenso wie an Beweglichkeit weit überlegen ist, gehört zu den begehrtesten und ziemlich seltenen Jagdobjekten Sumatras. Wir nahmen die Kunde mit Freude auf und beschlossen, am nächsten Morgen in aller Frühe auf die Pirsch zu gehen.
Noch lastete das Dunkel der Nacht mit beinahe körperlich fühlbarer Schwere auf Wald und Fluren ringsum, auf dieser gewaltigen wilden Natur, als wir uns in Begleitung des Jagdgehilfen auf dem Wege zum Schauplatz der kommenden Taten befanden. Erquickend kühl umstrich uns ein leiser Wind, spukhaft huschte der Lichtschimmer der Laternen über die nächste Umgebung, die gigantischen Massen der Pflanzenwelt rechts und links, die jetzt, wo das Auge keine Einzelheiten zu unterscheiden vermochte, gleich Riesenmauern von erdrückender Wucht den geschlängelten, kaum erkennbaren Pfad begrenzten. Und beklemmend, wie der geheimnisschwere nächtliche Wald, wirkte auch das tiefe Schweigen um uns, so daß wir unwillkürlich nur flüsterten und das leise Knacken der unter den Tritten zerbrechenden Zweige als Störung empfanden. Es ist die kurz bemessene Pause im Leben des Urwalds, wo in der Übergangszeit vom Dunkel zur Dämmerung das Monstrekonzert seiner Bewohner einmal verstummt. Die Nachttiere sind bereits zur Ruhe gegangen, die Tagtiere aber noch nicht erwacht. Nur eine halbe Stunde noch, dann wird der Wald wieder vom Lärm der Kreaturen erfüllt sein.
Hilflos, verlassen, völlig ratlos käme sich der nicht ortskundige, mit dem Wesen des tropischen Urwalds nicht vertraute Fremdling in diesem Dickicht vor, in welchem es kein einziges Mittel der Orientierung zu geben scheint. Aber Butan, der Battaker, weiß Bescheid, er kennt sein Revier weit in der Runde, verfolgt beim matten Laternenschein mit Sicherheit den kaum wahrnehmbaren Pfad, findet Durchschlupfe, wo es im massigen Untergehölz anscheinend auch nicht die geringste Öffnung gibt, spürt die kleinen Lichtungen auf, die hier und dort wie Atmungsorgane des Bodens in den Wald hineingestreut sind.
Jetzt führt uns Butan ins kompakteste Dickicht hinein, so daß wir unter dem tief herabhangenden Geäst zeitweilig nur halb kriechend vorwärts kommen. Manchmal verfangen sich die Füße im tückischen Wurzelgeflecht, manchmal versinken sie an einer sumpfigen Stelle bis an die Waden im unergründlichen Matsch, dann wieder müssen wir uns mit Mühe aus der Umschlingung allzu liebevoller Lianen befreien, und fortwährend machen uns die mit Widerhaken versehenen Dornen verwünschter Rankengewächse das Leben schwer. Obwohl es noch verhältnismäßig kühl ist, perlt uns der Schweiß von der Stirn. Endlich, als wir wiederum eine kleine Lichtung erreichen, bedeutet uns Butan mit kaum hörbarer Stimme, daß wir am Ziel angelangt sind.
Wir machen uns so geräuschlos wie möglich schußfertig und harren gespannt der kommenden Dinge. Die Schwärze der Nacht weicht allmählich einem nebelhaft fahlen Grau, das uns die Einzelheiten unserer nächsten Umgebung wie durch einen Schleier erkennen läßt und das nun sehr rasch in hellere Farbentöne übergeht. Über uns zwischen den Gipfeln, die sich wie die Wölbung eines ungeheuren grünen Domes über der Lichtung zusammenschließen, leuchten verlorene violette Flecke des Himmels auf. Und es dauert nicht lange mehr, da beginnt es sich im Walde zu regen, die fleißigsten Frühaufsteher erwachen und präludieren dem großen Urwaldkonzert mit vereinzelten Solovorträgen.
Da – horch – in nächster Nähe erklingt der Schrei des wilden Hahnes – und gleich darauf schlagen die mißtönenden, kollernden, schleifenden Laute des balzenden Argusfasans an unser Ohr! Butan gebietet uns mit förmlich beschwörenden Gesten größte Behutsamkeit und Stille, und ihm folgend schleichen wir nun durch den Wald, dem Liebesgesang des Vogels nach, wobei wir ängstlich bemüht sind, jedes unnötige Geräusch zu vermeiden. Zum Glück ist der Wald hier nicht so dicht, so daß wir ziemlich glatt vorwärts kommen, und der Boden ist weich und ohne dürres Gezweig, so daß unsere Tritte keinen Lärm verursachen. Wir sind auf der richtigen Fährte, immer lauter ertönt das Balzgeschrei; es ist uns, als ob der Fasan kaum noch fünfzig Schritte entfernt sein könnte. – Da streicht dicht vor uns ein wilder Hahn ab, wir sehen sein farbenprächtiges Kleid sekundenlang oben im grünen Laubgewirr leuchten … Der Argusfasan ist plötzlich verstummt. Hat er schon Unheil gewittert? Wir stehen still und rühren uns nicht, aber das Herz schlägt uns vor fiebernder Erwartung bis zum Hals … Da, nach einer Pause, beginnt es wieder, leidenschaftlicher noch als vorher ertönt sein Lied. Abermals, mit verdoppelter Behutsamkeit, pirschen wir uns weiter heran. Wir müssen nun ganz in seiner Nähe sein – und jetzt deutet Butans Hand schräg nach oben, und wir entdecken zwischen den Blättern hindurch in ziemlicher Höhe das schöne Tier, das jedoch nur zum Teil sichtbar wird.
Die günstige Gelegenheit muß ohne Verzug sogleich wahrgenommen werden. Noch ein einziger Schritt vorwärts, und es wäre wahrscheinlich zu spät. Wir legen beide an, mein Freund und ich. Rasch hintereinander ertönen unsere Schüsse – und unmittelbar darauf hören wir das raschelnde Herabfallen eines Körpers.
Butan springt mit einem gurgelnden Ausruf der Freude voran, wir folgen ihm nach. Gleich darauf sehen wir, wie der Jäger den glücklich erlegten Argusfasan an den Fängen in die Höhe hebt. Es ist ein schönes, stattliches Exemplar von wundervoller Zeichnung.
Die Stille, die unseren Schüssen im Walde gefolgt war, hält nicht lange an. Die Solisten nehmen ihren unterbrochenen Vortrag alsbald wieder auf, und während jetzt die ersten Strahlen des Tagesgestirns die Wipfel über uns mit ihrem Gold übergießen, wird es wie mit einem Schlage im Walde ganz lebendig. Mit vieltausendfachen Stimmen regt sich das Leben und die Freude am Leben, am neuen Tag. Das schreit und pfeift, das zwitschert und girrt, das krächzt und jubelt aus zahllosen Kehlen. Und in den lärmenden Chor der Vögel mischt sich das Schnattern und meckernde Gezänk der kleinen Affen, das wie Hundegeheul klingende Bellen der großen Gibbons. Das Urwaldorchester spielt uns jetzt in voller Besetzung auf – Kammermusik ist es freilich nicht. Aber aus seiner Klangfülle braust und summt in gewaltigen Akkorden des Lebens Urkraft und Unerschöpflichkeit.