
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
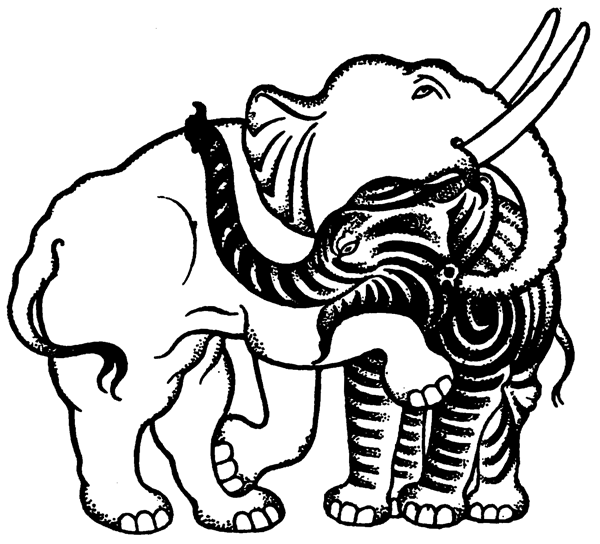
Die Krone aller sportlichen Ereignisse in Ceylon ist und bleibt ein großer Elefanten-Kraal, d. h. das Zusammentreiben, Einfangen und Zähmen wilder Elefanten. Es ist so ziemlich die einzige Veranstaltung, die den ansässigen Europäer und den Eingeborenen in gleichem Maße zu fesseln vermag, beide wochenlang in Atem hält und die führenden Kreise des Kolonistentums mit den vornehmen Familien der bodenständigen Rasse in persönliche Berührung bringt. Zwar nimmt die eingeborene Gentry auch an anderen Betätigungen des Sportlebens teil, an Pferderennen, Motorwagensport, Fußball, Polo usw.; aber eingeladener Gast bei einem Kraal zu sein, das ist kein gewöhnliches Sportsvergnügen, sondern eine Auszeichnung, die den dadurch Beehrten in der gesellschaftlichen Rangordnung gleich um einige Stufen höher rückt. Um das ganz zu verstehen, muß man erstens wissen, welche Rolle der Elefant seit uralten Zeiten im Gemütsleben des Singhalesen spielt, und muß zweitens einen tieferen Einblick in das Verhältnis zwischen den Kolonisten und den Eingeborenen der höheren Stände haben.
Was den ersten Punkt betrifft, so war der Elefant für den vornehmen Singhalesen von jeher nicht etwa bloß ein nützliches Tier, wie manche andere Kreatur, sondern aufs innigste mit seinen Begriffen von Würde und Repräsentation verknüpft. Als auf der Insel noch Könige herrschten – der letzte Singhalesenkönig von Kandy wurde von den Engländern 1815 abgesetzt – war das Halten von Elefanten zu Zwecken des Ausreitens, der Jagd und überhaupt aus Gründen des standesgemäßen Auftretens ein Vorrecht der Häuptlinge von Kandy, der Muhandiramas, Ratamahatmas und anderer vornehmer Kasten. Von diesen alten Überlieferungen und Anschauungen hat sich vieles bis auf unsere Tage erhalten. Auch heute noch legen die auf Landsitzen hausenden vornehmen Singhalesenfamilien hohen Wert darauf, einige besonders schöne Elefanten zu besitzen, wenn auch nicht mehr zu Reit- und Jagdzwecken, so doch deshalb, um die alten Überlieferungen zu pflegen, und auch aus wirklicher, angestammter Zuneigung zu den Tieren, die ihnen jeder nachfühlen kann, der die Elefanten ebenfalls liebgewonnen hat. Auch die mannigfachen sportlichen Erinnerungen, die mit dem Fang der wilden Elefanten seit altersher verknüpft sind, haben sich in diesen Kreisen lebendig erhalten. Ihr uraltes Privileg, beim Kraal das durchaus nicht ungefährliche Fesseln (englisch noose) der Hinterbeine der wilden Elefanten vorzunehmen, wird von ihren Sprößlingen auch heute noch als eine sportliche Ehrenpflicht betrachtet, der man sich mit Eifer unterzieht.
Der zweite Punkt, das Verhältnis zwischen den Kolonisten und den Eingeborenen des höheren Standes, berührt eine Frage, die in den englischen Kolonien weit mehr noch als in den Kolonien der anderen Mächte als »delikat« empfunden wird. Insofern der Europäer in Ceylon nur mit den unteren und mittleren Ständen der eingeborenen Bevölkerung zu tun hat – und auf diese Kreise beschränkt sich bei den allermeisten Kolonisten der Verkehr –, bietet das Verhältnis keine besonderen Schwierigkeiten, es ist durch einen ungeschriebenen und dennoch genau befolgten Kanon seit Generationen zur beiderseitigen Zufriedenheit in sachlicher Weise geregelt: dem dienenden Eingeborenen gegenüber ist der Fremde der wohlwollende Herr, der die geleisteten Dienste bezahlt, aber sich um die privaten Verhältnisse der Eingeborenen nicht bekümmert, und mit dem » native« (wozu auch das Halbblut gehört) der Handels- und Erwerbskreise verkehrt er in rein geschäftlicher, bei alten Beziehungen mitunter auch ganz herzlicher Weise, jedoch immer so, daß das Verhältnis niemals zu dem wird, was man als Europäer unter Freundschaft oder auch nur unter wirklicher Kollegialität versteht. Wahrhaft intime Beziehungen zwischen Kolonisten und Eingeborenen oder gar eheliche Verbindung zwischen europäischen und singhalesischen Familien der höheren Kreise gibt es nicht und kann es nicht geben. Da sind die Gesetze der Realität und der Konventionen doch stärker als alle die sicherlich sehr schönen Postulate der Menschlichkeit. Beide Kreise, hier der Europäer, dort der Asiate, gehören zwei ganz verschiedenen Welten an, und die tiefe Kluft, die aus Gründen der Rassenunterschiede (die angebliche Rassenverwandtschaft zwischen dem europäischen Arier und dem Indo-Arier ist in Wirklichkeit ohne jeden Belang), der Religion, des Temperaments, der Erziehung und der ganzen Weltanschauung zwischen den beiden Kreisen gähnt, wird selbst dann nicht überbrückt, wenn der Singhalese auch in Europa studiert und dort vielleicht den Doktorgrad erworben hat. Auch in diesem Fall kann von wirklich innigen Beziehungen des einen zum andern Teil kaum die Rede sein, denn man kommt da immer wieder zu dem Punkt, wo einer den andern nicht versteht. Kurz und gut, Singhalesen und Europäer beschränken sich im gegenseitigen Verkehr auf korrekte Höflichkeit, darüber hinaus gibt es keine Steigerung, und an diesem modus vivendi wird auch von keiner Seite eine Änderung gewünscht. Es ist ein klares Verhältnis, und klare Verhältnisse sind immer gut.
Weiß da also jeder, wie er sich zu verhalten hat, so bereitet die Frage, wie sich die Spitzen der Kolonie, also die hohen Beamten und Offiziere, die führenden Vertreter von Handel und Industrie usw., zu den vornehmen Kreisen der Eingeborenenschaft zu stellen haben, doch manche Schwierigkeiten, zu deren Überwindung auf beiden Seiten viel Takt gehört. Auch für diese Kreise gilt das vorhin Gesagte, daß es wirklich intime Beziehungen nicht gibt. Aber aus Gründen der politischen Klugheit und eines guten Einvernehmens mit allen Bevölkerungsschichten muß die singhalesische Nobilität, die ja auch im » Legislative Council«, der gesetzgebenden Körperschaft Ceylons, durch Mitglieder vertreten ist und zahlreiche Beamtenstellen in der Verwaltung bekleidet, auch gesellschaftlich angemessen berücksichtigt werden. Etwas Gekünsteltes hat die Aufrechterhaltung dieser Beziehungen zweifellos, aber das ist in anderen Kolonien, z. B. in Holländisch-Indien, in noch weit höherem Maße der Fall. Man ladet die vornehmen Singhalesen also zu Empfängen, Gartenfesten und ähnlichen Veranstaltungen, die kein allzu intimes Gepräge haben, ein, besonders gern auch zu solchen sportlicher Art, weil diese den besten, sozusagen neutralen Boden für ein zwangloses Zusammensein bilden. Und die Krone der sportlichen Veranstaltungen ist eben, wie schon eingangs bemerkt, ein großer Elefanten-Kraal. Er wird zumeist vom Gouverneur persönlich patronisiert, und dieser höchste Beamte Ceylons pflegt dann nicht nur die Spitzen der europäischen Kolonie, sondern auch die Nobilität der Eingeborenenschaft als Zuschauer beim Kraal einzuladen.
Es läßt sich nicht sagen, daß das Dasein der Kolonisten in Ceylon reich an großen gesellschaftlichen Ereignissen wäre. Im Gegenteil, man lebt hier ruhig dahin, der Verkehr beschränkt sich im allgemeinen auf den Klub und den nächsten Freundeskreis. Um so lebhafter geht es dafür zu der Zeit eines großen Elefanten-Kraals zu. Schon Wochen lang vorher bringt die Kolonialpresse ausführliche Artikel über die Vorbereitungen für den Kraal, dann folgen spaltenlange Berichte über jede einzelne Phase des Verlaufs, selbstverständlich mit genauester Aufzählung aller »prominenten« Persönlichkeiten, die bei der Veranstaltung »bemerkt« werden.
Ich habe den typischen Verlauf eines Elefanten-Kraals bereits in dem Band »25 Jahre Ceylon« geschildert und gehe im folgenden auf einige dort nur kurz angedeutete Einzelheiten näher ein, in Anlehnung an den großen Kraal, der im Jahre 1921 bei Kurunegala, der Hauptstadt der Nordwestprovinz, abgehalten worden ist.
Die Kraale werden in gewissen Zeiträumen von etwa drei bis sieben Jahren veranstaltet. Sie sind notwendig, weil sich der Elefant in der Gefangenschaft nur selten fortpflanzt, deshalb also durch das Einfangen und Zähmen wild lebender Tiere von Zeit zu Zeit für Nachwuchs gesorgt werden muß, dann aber auch, weil in drei bis sieben Jahren die wilden Elefantenherden in den Gegenden, wo sie leben, durch Vermehrung so stark werden, daß sie in den Pflanzungen zu großen Schaden anrichten, und schon aus diesem Grunde ihre Zahl durch Einfangen beschränkt werden muß.
Im Zustand der Freiheit lebt der Elefant in Herden bis zu etwa vierzig Stück, oft gibt es aber auch ganz kleine Sippschaften von nur fünf bis sechs Elefanten. Jede Herde hat ein Oberhaupt, das in den meisten Fällen ein altes Weibchen, mitunter ein erwachsenes Männchen ist. Die Elefanten marschieren gewöhnlich im Gänsemarsch, einer hinter dem anderen, das Oberhaupt voran; junge Tiere werden in die Mitte genommen und nicht nur von der Mutter, sondern auch von allen anderen Mitgliedern der Herde sorgfältig und liebevoll behütet. Mit Ausnahme der einsam lebenden Einzelgänger, die sich, geistig wahrscheinlich nicht ganz normal, von der Herde abgesondert haben oder von ihr ausgestoßen worden sind, sowie der gefährlichen »Rogues«, der tollen Elefanten, von deren bösen Streichen ich im Bande »25 Jahre Ceylon« bereits ausführlich erzählt habe, ist der Elefant ein geselliges Tier, das sich gern zu seinesgleichen hält. Eben dieser Geselligkeitstrieb ist es, der beim Kraal eine große Rolle spielt; der Einfänger spekuliert darauf mit Erfolg und erleichtert sich seine Aufgabe durch Verwendung zahmer Locktiere. Da der Elefant ungeheure Mengen Futter braucht, Gräser und Blätter, Bambusschößlinge, Zuckerrohr, Früchte, bis zu 300 Kilogramm täglich und mehr, sieht sich die Herde genötigt, täglich viele Stunden unterwegs zu sein, nur um Nahrung zu suchen. Mit Ausnahme der heißesten Tageszeit, die der Elefant im Walde schlafend verbringt, sowie der zweiten Hälfte der Nacht, von Mitternacht bis Morgen, in der er abermals schläft, ist die Herde beständig auf den Beinen und wechselt innerhalb eines größeren Distrikts im Umkreis von zwanzig bis dreißig englischen Meilen fortwährend die Futterplätze.
Dem Kraal geht die gründliche Untersuchung des für die Razzia ins Auge gefaßten Distrikts durch die eingeborenen Späher (Trachus) voraus. Die Leute schleichen sich an die Herden heran und stellen mit annähernder Genauigkeit fest, wieviel Tiere sich in dem Revier aufhalten, wieviel alte und wieviel junge, ob sich recht stattliche Exemplare darunter befinden, und was sonst zu wissen nötig ist. Versprechen die erhaltenen Auskünfte ein Resultat, das das sehr mühevolle und höchst kostspielige Unternehmen des Kraals lohnend erscheinen läßt, so beginnt man ungefähr in der Mitte des Waldgebietes an einer gesund gelegenen, mit Trink- und Badewasser versehenen Örtlichkeit mit den Aufbauten zum Kraal.
Da sich in neuester Zeit, wie schon gesagt, der Elefanten-Kraal zu einer nicht bloß sportlichen, sondern auch gesellschaftlichen Veranstaltung größten Stils entwickelt hat, muß hierauf von vornherein Rücksicht genommen werden. Den Elefanten- und Jagdfreunden vom alten Schlag will die Entwicklung des Kraals, der einst nur wirkliche Sportsmänner vereinigt sah, zu einer Massenversammlung der » Society« und zu einem modernen Jahrmarkt der Eitelkeiten freilich wenig behagen. Aber das liegt nun einmal im Zuge der Zeit, und es hätte wenig Zweck, da »wider den Stachel zu löcken«, wie es in der Bibel heißt.
Die Anlagen erfordern einen entsprechenden Maßstab. Es handelt sich darum, Tausenden von Menschen für ein paar Wochen Unterkunft und Verpflegung zu bieten. Nicht nur ein Kraal, ein ganzes »Kraal Town« entsteht. Ist die Lichtung nicht groß genug, so muß Urwald niedergeschlagen werden. Das ist auch schon deshalb nötig, weil für den Bau der »Stockade«, des Palisadengeheges und eigentlichen Kraals, sehr viel Holz in Gestalt kräftiger Stämme gebraucht wird. Unweit der Stockade wachsen unter den Händen der Zimmerleute Häuser und Hütten aus dem jungfräulichen Boden empor. Ein schönes Haus für den Gouverneur und sein Gefolge, Häuser für die eingeborenen Mobilitäten und ihre Familien, ein Hotel für die europäischen Besucher, Bäder, hygienische Einrichtungen usw., alles natürlich nur leicht und niedrig aus Holz gebaut, aber doch seinen Zweck erfüllend. Daneben Baracken für die Arbeiter, Diener, Treiber, Elefantenwärter; Restaurants und Erfrischungshallen, Geschäftsläden mit allem möglichen Kram, Ställe für die zahmen Elefanten, Automobilgaragen und der Himmel weiß, was sonst noch alles – kurz, es ist ein Riesenbetrieb und in Wirklichkeit eine ganze Stadt, die dort in der Wildnis entsteht, um für eine kurze Zeit der Schauplatz lebhaftester Geschäftstätigkeit und gesellschaftlichen Glanzes zu sein. Daß bei den heutigen Elefanten-Kraals auch der Filmoperateur nicht fehlt, ist selbstverständlich. Er hat den großen Kraal von Kurunegala in allen Phasen aufgenommen und das Schauspiel so für die ganze Welt in ausgezeichneten Bildern zugänglich gemacht.
Steht Kraal Town endlich vollendet da, so umstellen 1000 bis 2000 Treiber den Walddistrikt und beginnen die Elefanten einzukreisen. Beunruhigt durch die bei Tag und Nacht vorrückenden Leute, die mit Fackeln und allerlei Lärminstrumenten ausgerüstet sind, ziehen sich die Elefanten in die Mitte des Waldes zurück, so daß sich der Ring der Treiber immer enger um sie schließt und sie allmählich in der Gegend des Kraals zusammendrängt. Merken die Tiere zuletzt, welche Gefahr ihnen hier droht, so machen sie Ausbruchsversuche. Einzelnen glückt es wohl, zwischen den Treiber durchzuschlüpfen; es ist auch schon vorgekommen, daß die ganze Herde wieder die Freiheit gewann und der Kraal ein Fehlschlag war. Im allgemeinen aber entgehen die Tiere dank ihrer Ängstlichkeit und Unentschlossenheit dem Schicksal nicht und werden schließlich in den schlauchartigen, anfangs breiten, dann sich verengenden Eingang zur Stockade hineingedrängt, bis sie sich im Innern des Palisadengeheges befinden, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt.
Während dieses Kesseltreibens, an dem sich auch Sportsmänner beteiligen und das drei bis vier Tage, manchmal auch längere Zeit in Anspruch nimmt, stellen sich die Zuschauer ein und lassen sich in Kraal Town häuslich nieder. Damit es den Herrschaften inzwischen nicht an Unterhaltung fehlt, finden sich auch jene Parias ein, die man in Indien nirgends vermißt, wo die Masse zusammenströmt: sogenannte Fakire und Zauberer, Gaukler, Schlangenbeschwörer, Akrobaten, Tänzerinnen der verachteten Rodiyakaste, alle die kleinen Verüber armseliger Künste, die von der guten Laune der Großen leben; sie führen ihren Hokuspokus, ihre Gliederverrenkungen vor und heischen mit dürren Händen den Tribut der Reichen, der Satten.
Sind alle zusammengetriebenen wilden Elefanten im Kraal versammelt, so verschließt man den Eingang und überläßt die Tiere einstweilen, zwei bis drei Tage lang, ihrem Schicksal, damit ihre erste Wut verraucht und sie sich schließlich an die fremdartige Umgebung gewöhnen. Sie machen allerlei Befreiungsversuche, rennen gegen die Palisaden, stoßen trompetende Töne aus, gebärden sich oft ganz wild. Wer sich in dieser Zeit in das Gehege hineintrauen wollte, wäre in wenigen Sekunden zu einer unförmlichen Masse zerstampft. Sind die Tiere nach den furchtbaren Aufregungen der Jagd und der Einschließung endlich erschöpft und ruhiger geworden, so beginnt das von allen Zuschauern – die sich natürlich außerhalb des Geheges auf sicheren Beobachtungsposten befinden – mit Spannung erwartete Schauspiel der ersten Zähmungsversuche. Die wichtigsten Akteure dieses in der Tat sehr erregenden Schauspiels sind die wohldressierten Decoys (Locktiere), d. h. zahme Elefanten, denen unter Leitung ihres Mahouts (Führers) die Aufgabe zufällt, ihre wilden Artgenossen zur friedlichen Ergebung ins Schicksal zu »überreden«. Die Mahouts, mit einem Hakenstab und mit starken Seilen versehen, sitzen in der üblichen Weise auf dem Rücken der Locktiere, hinter ihnen der »Nooser«, der Feßler mit der Schlinge, meistens ebenfalls ein Eingeborener, bisweilen aber auch ein Sportsmann, der die Kunst des Fesselns wilder Elefanten ausüben will. Oft ist der Decoy zum erhöhten Schutz noch von einem zweiten Elefanten begleitet, der, wie wir gleich sehen werden, sozusagen als Boxer mitspielt.
Die Zahl der in die Stockade eingelassenen zahmen Elefanten richtet sich nach der Zahl der wilden und ist annähernd ebenso groß, so daß sich bei einem großen Kraal, wie dem von Kurunegala, insgesamt etwa 150 Elefanten im Ringe befinden.
Es ist nun außerordentlich interessant zu verfolgen, mit welchem feinen, man möchte fast sagen psychologischen Verständnis die Lockelefanten an ihre wahrlich nicht leichte Aufgabe herantreten. Sie wissen genau, um was es sich handelt, und daß sie hier mit »Kollegen« zu tun haben, bei denen es noch ungewiß ist, in welcher Weise sie auf die »Überredungs«-Versuche reagieren werden. Dementsprechend gehen sie, wenn auch entschlossen, so doch behutsam vor. Das Temperament der Gefangenen äußert sich in sehr verschiedener Art. Manche lassen die zahmen Elefanten ruhig an sich herankommen, gleich als ob sie von ihnen Hilfe erhofften, und warten mit einer gewissen Neugier das Weitere ab. Andere aber zeigen sich von ganz entgegengesetzter Seite, fassen die freundliche Umwerbung durch die Decoys als, gelinde gesagt, taktlose Anbiederung auf und nehmen eine so aggressive Haltung ein, daß sich die zahmen Elefanten genötigt sehen, nun ihrerseits selber sehr energisch zu werden. In solchen Fällen übernehmen es die »Boxer«, den wilden Kollegen durch Rippenstöße und Rüsselschläge zur Raison zu bringen, und es entwickeln sich dann hier und dort kleine Scharmützel, bei denen die Mahouts und ihre Begleiter nicht selten ernstlich gefährdet werden. Trotz aller Vorsicht und Gewandtheit der Leute, die im Umgang mit Elefanten aufgewachsen sind, hat man bei jedem großen Kraal erfahrungsgemäß mit ein bis zwei Toten und drei bis sechs mehr oder minder schwer Verwundeten zu rechnen.
Jetzt kommen die spannendsten Augenblicke des Schauspiels. Es ist notwendig, die wilden Elefanten an Bäume zu fesseln, um sie auf die Stelle zu bannen und ihre Widerstandskraft zu brechen. Sie müssen mit einem Hinterbein, noch besser mit allen beiden, möglichst kurz an den Baumstamm gefesselt werden. Das »Noose« (Fesseln) ist eine heikle Aufgabe, es erfordert Geistesgegenwart und rasches Zugreifen. Wie schon früher bemerkt, galt das Noose bei den Angehörigen der singhalesischen Adelskaste von jeher als nobler Sport und wird von ihnen auch heute noch gern ausgeübt, ebenso von europäischen Sportsmännern. Es treten also bei jedem Kraal außer den eingeborenen Noosers noch eine Anzahl Amateure in Tätigkeit. Auch beim Fesseln bewährt sich der zahme Elefant in verständnisvoller Weise als Schützer und Helfer. Er drängt zunächst den zu fesselnden Wilden dicht an den dafür geeigneten Baum, bleibt ihm zur Seite und gewährt dem Nooser, der inzwischen vom Rücken des Decoy-Elefanten heruntergeglitten ist, Deckung gegen Sicht. Der Nooser hat in der Hand ein starkes Seil, besser gesagt ein Tau, mit einer laufenden Schlinge, während das andere Ende des Taues am Nacken des zahmen Elefanten befestigt ist. Nun schleicht er sich an die Hinterbeine des wilden Elefanten heran, und sobald dieser einmal eines der Beine hebt, sucht er ihm schnell von unten herauf die Schlinge um den Fuß zu legen. Das muß möglichst sogleich beim ersten Versuch gelingen, denn sobald der Wilde merkt, daß hinter seinem Rücken irgend etwas gegen ihn unternommen wird, ist es schwer, ihm beizukommen.
In demselben Augenblick, wo die Schlinge glücklich um den Fuß gelegt ist, bewegt sich der zahme Elefant rasch nach der Seite, strafft dadurch das Tau und zieht die Schlinge fest, zugleich wird das Tau um den Baumstamm gewunden. Man sucht, wenn es irgend möglich ist, auch noch das zweite Hinterbein an den Baum zu fesseln, und das ist bedeutend schwieriger als beim ersten, weil jetzt der wilde Elefant, der fortwährend laut trompetet, mit aller Kraft Widerstand leistet und mit den noch freien Füßen und dem Rüssel um sich schlägt. Das sind die Augenblicke, in denen sich der Nooser in höchster Lebensgefahr befindet. Ein Schlag mit dem Rüssel oder dem Fuß genügt, um einen Menschen schwer zu verwunden oder sofort ins Jenseits zu befördern. Ich habe das Fesseln von Wildlingen häufig besorgt und mir dabei so manche böse Schramme und Beule geholt. Einmal erhielt ich einen so wuchtigen Schlag auf den Rücken, daß ich einige Meter weit fort flog und dann tagelang im Krankenhause behandelt werden mußte, ehe ich von den Folgen kuriert worden war. Aber solche Zwischenfälle können den Sportsmann nicht beirren; ist es doch gerade die Gefahr, die uns den Sport mit wilden Tieren so reizvoll macht.

Zwei zahme Elefanten führen einen wilden aus dem Kraal heraus

Vornehme indische Familie
Der gefesselte wilde Elefant fügt sich natürlich nicht widerstandslos in sein Schicksal. Stundenlang quält er sich damit ab, seine Fesseln zu zerreißen. Dabei schneiden die Taue oft tief in die Haut der bedauernswerten Tiere ein, so daß die Wunden sofort behandelt werden müssen, ehe sich die Fliegen hineinsetzen. Man läßt die Elefanten ungefähr vier bis sechs Tage in ihrem gefesselten Zustand und gewöhnt sie allmählich an die menschliche Umgebung sowie an das Reichen von Futter durch Menschenhand. So kehrt langsam Vertrauen in die Tiere ein, sie verlieren die Scheu vor den Mahouts, die ihnen Leckerbissen, wie Zuckerrohr, reichen und sonstige Liebesdienste erweisen. Sind die Elefanten so weit, daß man ihre Fesseln lösen kann, so werden sie sogleich an Ort und Stelle unter Aufsicht der Behörde versteigert; bei der Gelegenheit erhält auch jedes Tier einen Namen, der gewöhnlich dem Elu, der singhalesischen Sprache, entnommen wird. Die Käufer sind zum größten Teil Angehörige der singhalesischen Adelsfamilien, die ganz gern unter der Hand Elefantengeschäfte machen.
Junge und minder widerstandsfähige Tiere werden manchmal sogleich nach der Versteigerung abtransportiert, und zwar wiederum mit Hilfe von zahmen Elefanten, von denen je zwei den Wildling, der mit Tauen an sie gefesselt ist, in ihre Mitte nehmen. Große oder alte Elefanten aber, die sich nicht so rasch an den Verlust der Freiheit gewöhnen, bleiben oft wochenlang noch im Kraal, werden regelmäßig zur Tränke und zum Baden geführt und erst dann abtransportiert, wenn sie annähernd völlig gezähmt erscheinen. Dennoch kommt es beim Abtransport nicht selten noch zu stürmischen Szenen. Manche Elefanten suchen bei der Gelegenheit auszureißen oder »Amok zu laufen«, d. h. wie die tollen malaiischen Amokläufer wildwütig auf alles loszugehen, und dabei kommen dann wieder häufig schwere Unglücksfälle vor.
Aber auch die zahmen männlichen Elefanten, die beim Kraal verwendet werden, erweisen sich nicht immer als zuverlässig, da sie sich zu gewissen Zeiten des Jahres im » must« (Brunst) befinden und, wenn der Kraal gerade in die Zeit dieses Zustandes fällt, bei der Annäherung an die wilden Elefanten unkontrollierbar werden. Selbst der beste Mahout verliert dann die Herrschaft über das Tier, und während ein gut gezogener Elefant meist seinem Mahout aufs Wort gehorcht, ignoriert er jetzt jeden Befehl und jeden Stoß mit dem Haken. Ich bin einmal bei einem Kraal Augenzeuge eines höchst aufregenden Vorfalles dieser Art gewesen. Ein zahmer männlicher Elefant, der sich in dem geschilderten Zustand befand, wurde plötzlich ganz unzurechnungsfähig, lief wie toll hin und her und suchte sich durch heftiges Schütteln des auf ihm reitenden Mahouts zu entledigen, was ihm aber mißlang, da dieser einer der besten Leute seines Faches war. Da langte der Elefant plötzlich mit dem Rüssel nach oben, packte den Mann, schleuderte ihn zu Boden und zertrat ihn zu einer formlosen Masse. Dann gesellte er sich zur Herde der Wilden und tat so, als ob er einer der ihrigen wäre. Als er sich nach ein paar Stunden ausgetobt hatte, kehrte er zu den Mahouts zurück und ließ sich von dem Bruder des getöteten Mannes ohne jeden weiteren Widerstand ruhig abführen.
Ein anderer Elefant, damals das größte Exemplar seiner Art und deshalb auf der ganzen Insel populär, geriet ebenfalls bei einem Kraal in geistige Verwirrung und spielte mehrere Tage lang den »Amokläufer«, so daß alles auseinanderstob, wo er sich nur sehen ließ. Sein Mahout kam auf den Einfall, ihn durch Erschrecken zu kurieren: er verhüllte sich mit einem schwarzen Tuch und trat dem Ausreißer so entgegen. Aber diese Spekulation auf die Ängstlichkeit des Elefanten schlug leider fehl; das Tier ließ sich keineswegs erschrecken, sondern packte den Mahout und tötete ihn. Als man von dem Leichnam des Mannes das schwarze Tuch entfernte und der Elefant, der in der Nähe war, das ihm wohlvertraute Gesicht seines Mahouts erkannte, geschah etwas Wunderbares. Das plötzlich völlig ruhig gewordene Tier trat an die Leiche heran, befühlte und streichelte sie mit dem Rüssel und gab fortwährend ganz eigentümliche Laute von sich, die wie Wimmern und Weinen klangen. Dann scharrte der Elefant mit den Füßen im Boden eine große Höhlung, schob in diese den Leichnam hinein und bedeckte ihn mit Zweigen und Blättern, die er von dem nächsten Baume abriß, wobei er beständig das seltsame Wimmern ertönen ließ. Schließlich ließ er sich ruhig abführen. Diese Geschichte mag märchenhaft klingen, der Vorfall wurde aber von vielen beobachtet, ist absolut wahr und in ganz Ceylon bekannt.
Übrigens schenkt man fast bei jedem Kraal einigen Tieren die Freiheit und läßt sie in den Wald zurückkehren. Das ist besonders dann der Fall, wenn eine Elefantenmutter noch ein ganz kleines hilfloses Baby hat, das man in der Gefangenschaft wahrscheinlich doch nicht durchbringen könnte.
Wenn das Schauspiel des Kraals beendigt ist, und nach einigen Wochen auch die letzten Tiere abtransportiert, die Bauten abgebrochen sind, liegt die Stätte, auf der eine Zeit lang so viel Leben und Aufregung herrschte, wieder verlassen und öde da. Die abgeholzten Flächen bedecken sich, vom nächsten Regen befruchtet, allmählich wieder mit Vegetation, und eines Tages werden abermals neue Herden von wilden Elefanten ahnungslos dort streifen und äsen, wo man ihre Vorgänger so schmählich überlistet hat.
Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, daß die Eingeborenen zur Dressur des Elefanten am besten befähigt wären. Das trifft nach meinen Erfahrungen durchaus nicht zu. Ich bin im Gegenteil der Ansicht, daß ein hierzu talentierter Europäer mit der Abrichtung der Tiere, sei es zu praktischen Zwecken oder für Zirkus und Varieté, viel rascher und mit besserem Erfolge fertig wird, als der Singhalese oder ein anderer Inder. Denn der Europäer geht auch an diese Aufgabe, wie an alles andere, mit planmäßiger Energie heran, während der Eingeborene nach alter süßer Gewohnheit die Zeit vertrödelt und schließlich doch nur alles halb tut. Ich habe so manchen Elefanten unter die Hände bekommen, an dem, wie man zu sagen pflegt, Hopfen und Malz verloren zu sein schienen, der aber, wie sich bald herausstellte, nur der richtigen Leitung bedurfte, um ein ganz vernünftiges, brauchbares Tier zu werden. Selbstverständlich gibt es viele ausgezeichnete Mahouts, die mit ihren Pfleglingen sozusagen verwachsen sind, und auf deren leisesten Wink der Elefant sofort in der erwarteten Weise reagiert; es gibt aber unter den eingeborenen Elefantenwärtern auch recht gleichgültige und unfähige Leute, die aus dem bestqualifizierten Tier nichts herauszuholen verstehen.
Erklären läßt es sich kaum, worin eigentlich das Geheimnis der Tierdressur liegt. Aus Büchern kann man diese Kunst nicht lernen, und die Fähigkeiten, die dazu gehören, hat man entweder oder hat sie nicht. Es gehört vor allem viel Liebe und ruhige Geduld dazu. Früher stellte man sich den Dresseur gewöhnlich als gewalttätigen, brutalen Menschen vor, und meistens war er es auch in der Tat. Aber wie sah denn auch die Kunst dieser Buden-Athleten aus? Sie bestand darin, daß die Leute, mit einer Hetzpeitsche bewaffnet, in möglichst renommistischer Weise den Käfig betraten und die verängstigten Tiere sinnlos herumjagten. Dazu verübte das »verstärkte Elite-Orchester« der Menagerie eine haarsträubende Musik, und hinter der Szene rasselten die »garantiert echten Menschenfresser von den Südsee-Inseln« in schaurig-schöner Weise mit ihren Ketten. Jahrmarkts-Idylle aus der guten alten Zeit!
Diese Sorte von Dressur und Dresseuren gilt heute mit Recht für längst erledigt. Ein brutaler Dresseur kann wohl genau so wie ein brutaler Jugenderzieher durch Anwendung roher Schreckmittel gewisse Wirkungen erzielen, aber mit eigentlicher Dressur hat sein Treiben nichts zu tun. Um den Vergleich mit dem Jugenderzieher fortzusetzen: wie dieser sein Amt um so besser versieht, je mehr er befähigt ist, sich in die Seele des Zöglings hineinzufühlen, seine Wesensart zu erfassen und ihm nichts zuzumuten, was seine Kräfte übersteigt – genau dieselbe Eigenschaft muß auch der Dresseur besitzen. Das Tier soll allerdings die Überlegenheit des Dresseurs spüren und anerkennen, aber es soll ihn nicht fürchten, sondern lieben. Die begabten Tiere, die Elefanten, großen Katzen, Bären, Affen usw., haben alle ein feines Gefühl für das, was gerecht und was ungerecht ist, und auf unangemessene Forderungen reagieren sie, wiederum genau wie das Kind, mit Unlust und Verdrossenheit. In besonders auffälliger Weise ist das beim Elefanten der Fall. Liebevoll, mit Festigkeit, aber gerecht behandelt, ist er wie Wachs in der Hand seines Pflegers, bei falscher Behandlung und übertriebenen Zumutungen wird er übellaunisch und störrisch und in diesem Zustand dann oft unberechenbar.
Bei der Gelegenheit möchte ich noch etwas näher auf die Frage der Intelligenz des Elefanten eingehen.
Es ist dem Leser ja nicht verborgen geblieben, was für ein großer Elefantenfreund ich bin, und deshalb erwartet er nun wahrscheinlich eine überschwengliche Lobhymne auf die Klugheit der Dickhäuter. Die Versuchung, seine Lieblinge gehörig herauszustreichen, wie wir es zum Beispiel an so vielen enragierten Hundefreunden erleben, ist ja in der Tat nicht gering. Aber ich trachte nach Objektivität und möchte mich eher etwas zurückhaltend als zu vertrauensselig zeigen. Deshalb sei noch einmal schon früher Gesagtes wiederholt: der Elefant ist ein gut begabtes Geschöpf, das in der Freiheit zweckmäßig und verständig handelt und in der Gefangenschaft, im ständigen Umgang mit dem Menschen, seine geistigen Fähigkeiten in oft überraschender Weise entwickelt. Ich füge hinzu: die besondere Klugheit, die man im Publikum auf Grund eines reichen anekdotischen Materials dem Elefanten so gern zuschreibt, besitzt er im allgemeinen nicht. Ein gut begabter und gut gezogener Hund steht bei seiner großen geistigen Lebhaftigkeit und Anstelligkeit dem Menschen doch näher als auch der gescheiteste Elefant, der schon durch seine körperliche Schwerfälligkeit stark behindert wird. Dazu kommt noch die Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit des Elefanten im Gegensatz zu dem kouragierten Draufgängertum des Hundes, der, ein richtiger »Hans in allen Gassen«, sich jeder Situation sofort anzupassen weiß. Übrigens hat der Inder keine übertriebene Vorstellung von der Intelligenz des Elefanten.
Bezeichnend für die allzu hohe Meinung, die man in Europa vom klugen Handeln der Dickhäuter hat, ist das aus den Schullesebüchern bekannte Märchen vom Schneiderlein und dem Elefanten. Ein Schneider pflegte einem an seinem Fenster öfter vorüberkommenden Elefanten Leckerbissen zu reichen, aber eines Tages piekt er ihn voll Schabernack mit der Nadel in den Rüssel. Worauf der erzürnte Elefant aus einer in der Nähe befindlichen Pfütze den Rüssel vollsaugt und dann den Schneider samt dem in Arbeit befindlichen weißen Anzug mit Schmutzwasser bespritzt … Das hübsche Geschichtchen ist charakteristisch dafür, wie gern der Mensch menschliche Denkweise auf Tiere überträgt. Selbstverständlich wäre kein Elefant, überhaupt kein Tier, zu derartigem abstrakten Denken fähig und, wie in diesem Fall, zum Erfassen des Kausalzusammenhanges zwischen den Begriffen »weißer Anzug« und »Schmutzwasser«.
Wenig glaubhaft ist auch die Erzählung eines indischen Offiziers, der Folgendes beobachtet haben will. Er befand sich mit seiner Elefanten-Batterie auf dem Marsch, als ein Artillerist von seinem Sitz herunterfiel und im nächsten Augenblick von dem Rad der schweren Kanone zermalmt worden wäre, hätte nicht der dahinter folgende Elefant rasch mit dem Rüssel die Speichen des Rades erfaßt und es über den Körper des Gefallenen hinweggehoben … Sehr schön, aber ganz unwahrscheinlich. Einfach deshalb, weil der Elefant gar nicht weiß, daß das Rad den Körper beschädigen würde, und weil ihm somit die wichtigste Voraussetzung für die Herstellung der Gedankenreihe: »Mann durch Rad gefährdet – das Rad muß hochgehoben werden« (und noch dazu im blitzschnellen Tempo!) fehlt.
Vergleicht man den auffälligen Unverstand, mit dem der wilde Elefant den Fallgruben zum Opfer fällt und sich bei den Kraals einkreisen läßt, mit der äußersten Vorsicht und Schläue, die von den meisten anderen Tieren bei Nachstellungen bekundet wird, so schneidet der Elefant nicht vorteilhaft ab.
G. P. Sanderson, der dreizehn Jahre lang das staatliche Elefantenfang-Institut in Mysore geleitet hat und wohl der größte Kenner auf diesem Gebiet ist, spricht dem Dickhäuter im allgemeinen nur mäßige Intelligenz zu und erklärt ihn in manchen Dingen für geradezu dumm; aber er muß doch zugeben, daß der Elefant in der Hand eines guten Pflegers auf den leisesten Wink in höchst zweckmäßiger Weise reagiert. Die Erziehung ist eben alles bei ihm.
Während der männliche Elefant zu gewissen Zeiten, im Zustand des bereits erwähnten » must«, unberechenbar und mitunter gefährlich ist, darf man den weiblichen Elefanten für das freundlichste, ruhigste und geduldigste Tier der Welt erklären. Unter hundert von ihnen gibt es kaum zwei, die mit störenden Unarten behaftet sind.
Noch ein Wort über den Rüssel. Dieses Organ dient hauptsächlich dazu, Futter und Wasser dem Maul zuzuführen, sowie mit dem fingerähnlichen Auswuchs am Ende des Rüssels kleine Gegenstände zu greifen, ferner zum Riechen, Fühlen und Ausstoßen von Tönen. Es ist aber ein Irrtum zu glauben, daß der Elefant den Rüssel gewissermaßen als Universalinstrument benützt. Er schont dieses empfindliche Organ im Gegenteil möglichst und verwendet es nur im Notfall als Waffe und Werkzeug. In jeder ihm bedenklichen Situation sucht er den Rüssel durch Aufrollen zu schützen. Soll der Elefant eine Last fortbewegen, so entfaltet er die größte Kraft nicht beim Ziehen, sondern beim Stoßen, und zwar stößt er mit der Wurzel des Rüssels, etwa einen Fuß unterhalb der Augen.
Über das Alter, das der Elefant erreicht, herrscht nicht völlige Klarheit. Im Zoologischen Garten wird er oft schon nach zwanzig bis dreißig Jahren recht altersschwach, während er in der Freiheit etwa erst mit fünfunddreißig Jahren zur vollen Reife entwickelt ist. Sanderson kannte einen Elefanten, der nachweislich schon sechsundsiebzig Jahre in der Gefangenschaft verbracht hatte und noch recht rüstig war. Die eingeborenen Shikaris glauben, daß der wilde Elefant ein Alter von achtzig bis höchstens hundertzwanzig Jahren erreicht, aber Sanderson schließt aus gewissen Beobachtungen, daß er es in der Freiheit auf mindestens hundertfünfzig Jahre bringt.
Wo bleiben eigentlich die toten wilden Elefanten? Diese Frage hat schon viele beschäftigt und niemand kann Antwort darauf geben. Denn das ist das Seltsame: obwohl doch jedes Jahr eine nicht unbeträchtliche Anzahl alter Elefanten verenden muß, finden selbst die routiniertesten Shikaris und Waldläufer niemals Überreste von ihnen. Sanderson, der mit Tausenden von wilden Elefanten zu tun hatte, hat nur zweimal Kadaver von Tieren gefunden, die aber verunglückt waren, einmal eine bei der Geburt eines Kalbes verendete Mutter, ein andermal ein im Hochwasser ertrunkenes Tier. Wo verkriechen sich die alten Elefanten, wenn sie ihr Ende nahen fühlen? Sie müssen doch irgendwo bleiben, und ein so gewaltiges Tier kann sich doch nicht so leicht verstecken und kann auch nicht von Insekten verscharrt werden, wie die kleinen toten Kreaturen. Nach einer alten Überlieferung der Singhalesen sollen die Todeskandidaten sich in ein schwer zugängliches Waldtal zurückziehen, das bei Anaradhapura oder in der Nähe des Adamspiks liegt; aber das ist natürlich nur eine Legende. Wo der wilde Elefant seine Tage beschließt, ist und bleibt ein Rätsel.
Die Aufzucht junger, in der Gefangenschaft geborener Elefantenbabys macht große Schwierigkeiten, und um so mehr freut es den Züchter, wenn er solch ein »Elefantenküken« glücklich über alle Kinderkrankheiten wegbringt. Ich kaufte einmal einen großen weiblichen Elefanten, der tragend sein sollte, und brachte ihn auf meiner in der Nähe von Kandy befindlichen Plantage unter. Nachdem ich schon alle Hoffnung auf Familienzuwachs aufgegeben hatte, erhielt ich eines Tages in Colombo von meinem Inspektor die Nachricht, daß die Elefantenmutter durch die Geburt eines Jungen hoch erfreut wäre und daß Mutter und Kind sich »den Umständen nach wohl fühlten«. Ich machte mich sofort nach meiner Pflanzung auf, und nun konnte ich den Werdegang des jungen Weltbürgers beobachten. Die ersten Tage war das Tier noch etwas flau, aber allmählich, durch die kräftige Milch der Mutter sichtlich gedeihend, erreichte es bald die richtige Stärke und wurde der Liebling aller Arbeiter auf der Plantage. Auch die anderen Eingeborenen in der Nähe strömten herbei, um das Baby zu bewundern, denn für Elefanten hat man in Ceylon immer Interesse. Nach ein paar Monaten aber mußten Mutter und Kind sich von ihrer sonnigen Heimat trennen, denn ich sandte die beiden nach Hamburg zu meinem Bruder Carl Hagenbeck, wo das Junge wegen seiner Possierlichkeit den Namen »der kleine Kohn« erhielt.

Eintreiben einer Elefantenherde bei Ayuthia, Siam

Indischer Verkäufer von primitiven Götterbildern

Brahmine beim Reisessen
Nicht immer haben sich die gezähmten Elefanten in so friedlicher Weise wie heute betätigt, wo sie in Ceylon und Indien wie ein wackerer Arbeitsmann allerlei Herkulestaten verrichten, schwere Lasten ziehen, Holzstämme schleppen und dergleichen, und dabei so viel Fleiß und Anstelligkeit zeigen, wie sie der indische Durchschnittskuli im Leben nicht aufbringt. Es hat Zeiten gegeben, wo sich der Elefant hauptsächlich im Dienst des Kriegshandwerks zu betätigen hatte. Wir erwähnten bereits die berühmten Kriegselefanten des Pyrrhus und des Hannibal, die dort, wo diese großen Tiere noch nicht bekannt waren, sicherlich ebensoviel Schrecken verbreitet haben, wie später in Mexiko die Pferde der spanischen Eroberer, die den Azteken auch noch unbekannt waren. In den Arenen des Römischen Reiches wurden die Elefanten mit Vorliebe zur Veranstaltung von Tierkämpfen benützt, bei denen es immer sehr grausam zuging. Im Kriegsdienst hat der Elefant in Indien als Träger von Bewaffneten und Zugkraft für Kanonen bis in die neueste Zeit hinein gewirkt. Seine traurigste und seiner ganzen Natur eigentlich völlig widersprechende Rolle ist aber die des Scharfrichters gewesen, zu der man ihn früher an indischen Fürstenhöfen gemißbraucht hat, indem man ihn zwang, den zum Tode Verurteilten entweder zu zertreten oder mit dem Rüssel zu packen und ihn an einem Pfahl zu zerschmettern oder ihn mit den Stoßzähnen zu durchbohren.
Daß diese abscheuliche Hinrichtungsmethode in Indien und Ceylon früher ganz allgemein in Übung war und hauptsächlich für Staatsverbrecher galt, unterliegt leider keinem Zweifel. In dem bereits erwähnten alten Reisewerk »Ost-Indianische-Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienste« des Nürnbergers Johann Jakob Saar (1672) erzählt der Verfasser, daß der damalige König von Kandy zwei Elefanten für Exekutionszwecke hielt. Er schildert, wie ein gefangener holländischer Fähnrich (die Holländer, die sich an der Küste Ceylons festgesetzt hatten, führten damals mit dem König von Kandy Krieg) wegen eines geringfügigen Vergehens vom König zum Tode durch den Elefanten verurteilt und die Hinrichtung in Anwesenheit aller anderen holländischen Gefangenen vollzogen wurde. Der unglückliche Fähnrich wartete, an einen Pfahl gefesselt, die Attacke des Tieres ab, aber trotz aller Antriebe durch den Mahout wollte der Elefant durchaus nicht auf den Europäer losgehen. Das Weitere sei hier mit Saars eigenen Worten erzählt: »Weil aber einmahl die Exekution folgen muste, muste auch der Mohr den Elefanten ganz bös machen und mit den Hacken so lang hinter die Ohren stoßen, bis er ergrimmet aus lauter Zwang auf den Armen lieffe und die zwey Zähne durch Ihn schoß und in die Höhe schleuderte, auch, da Er wieder zur Erden fiel, mit Füßen geschwind auf den Leib trat, daß Er nur bald Seiner Marter abkäme.« Des historischen Interesses wegen bringen wir eine Wiedergabe des Kupferstiches, der in dem oben genannten seltenen Werk von Johann Jakob Saar diese Szene illustriert.
Zum Schluß noch eine Episode von einer Elefantenjagd an der Südküste Ceylons.
Dort trieb in der Gegend von Hambantota ein wilder Rogue-Elefant seit einiger Zeit sein Unwesen, und er war deshalb von der Regierung zum Abschießen freigegeben worden. Über die Rogues, diese tollen und gefährlichen Einzelgänger, habe ich bereits im Ceylonwerke Ausführliches mitgeteilt. Während der normale Herdenelefant sehr scheu ist und die Berührung mit Menschen und menschlichen Einrichtungen nach Möglichkeit meidet, tritt der Rogue mit angriffslustiger Dreistigkeit auf, treibt allerlei bösartigen Unfug und versetzt oft die ganze Gegend in Schrecken.
Wir, d. h. ich in Gesellschaft einiger Sportsfreunde und Shikaris, hatten uns von Hambantota aus zur Verfolgung des Unholdes aufgemacht und abends unser kleines Lager, das aus zwei Zelten bestand, an einer lichten Stelle des Urwaldes aufgeschlagen. In dem einen Zelt kampierten unsere Shikaris, in dem anderen hatten wir uns selbst schon frühzeitig zur Ruhe gelegt, da ein anstrengender Tag hinter uns lag. Die Büffel, die Zugtiere unserer Gespanne, waren in der Nähe festgebunden.

Alles lag im tiefsten Schlaf, als der Frieden der Nacht plötzlich durch furchtbares Geschrei gestört wurde. Wir sprangen empor und griffen nach den Gewehren, denn wir waren des Glaubens, daß Leoparden oder andere Tiere unsere Leute angegriffen hätten. Aber als wir hinausstürzten, erwartete uns ein ganz anderes Bild, das die erregte Spannung in stürmische Heiterkeit umschlagen ließ. Die Shikaris lagen nämlich auf Stroh und hatten eine Seite der Zeltwand aufgerollt. Der eine von ihnen besaß auffallend langes Haar, und dieses hatte sich mit dem Stroh verwickelt. Nun war einer der Büffel nicht fest genug angebunden gewesen, er hatte sich, da er keinen Schlaf finden konnte, beim Lager herumgetrieben, war an den langhaarigen Shikari geraten und hatte harmlos das in seinem Haar verfangene Stroh, damit zugleich aber auch das Haar zu fressen begonnen. Der auf so jähe Weise aufgeweckte Eingeborene glaubte in seinem schlaftrunkenen Zustand nichts anderes, als daß ein Leopard schon drauf und dran wäre, ihn zu verschlingen, und seine Angst machte sich in erschütterndem Schreien Luft. Das war das seltsame Nocturno, wie es sich uns beim Flackerschein der Windlichter darbot. Wir schnitten dem Mann, zu seinem lebhaften nachträglichen Bedauern, rasch die üppige Lockenfülle ab und befreiten ihn so aus seiner peinvoll am Maul des Büffels schwebenden Lage.
Was den Rogue-Elefanten betrifft, so schien es beinahe, als ob er von der Verfolgung Wind bekommen und sich immer tiefer in die Wälder zurückgezogen hätte, obwohl er noch vor ganz kurzem bis in die Dörfer geschweift war und dort verschiedene Hütten zerstört und die Reisfelder niedergetrampelt hatte. Drei Tage waren wir nun schon zwischen Hambantota und Tissamaharama unterwegs und, wie aus sicheren Anzeichen hervorging, dem Tiere auf der Spur, ohne es je zu Gesicht zu bekommen. Endlich sollte uns sein Anblick doch beschert werden, allerdings unter Umständen, die nicht sehr erfreulich waren. Wir hatten eines Abends wiederum unsere Zelte im Urwald aufgeschlagen und unser Herrenzelt in gewohnter Weise innen erleuchtet. Eine Wache hatten wie nicht ausgestellt, da in dieser Gegend nächtlicher Leopardenbesuch nicht zu befürchten war. Es war kurz vor Mitternacht und ich lag in tiefem Schlaf, als ich durch eine Erschütterung aufgeweckt wurde. Mein Lager befand sich unmittelbar an der Zeltwand gegenüber vom Eingang. Ich fühlte und sah, wie die schräg über mich gespannte Zeltleinwand zitterte und eingebeult wurde, als ob von draußen ein schwerer Körper dagegen drückte, zugleich vernahm ich ein schnaufendes Geräusch. Zuerst glaubte ich, daß wieder einmal einer unserer Büffel draußen herumrumorte, dann kam mir aber die Sache doch verdächtig vor, und ich schlug das Moskitonetz, das meine Lagerstätte verhüllte, zurück, um das Zelt zu verlassen und zu sehen, was es draußen gab. Aber ehe ich noch das Netz, das sich etwas verheddert hatte, beiseite schieben konnte, wurde die Zeltwand noch einmal heftig erschüttert, und jetzt vernahm ich ganz deutlich die mir wohlbekannten schnaufenden Töne eines Elefanten. Der Rogue! Dieser Gedanke schoß mir blitzschnell durch den Kopf, und mit lautem Zuruf weckte ich meine Genossen. Sie fuhren schlaftrunken auf, erfaßten jedoch nicht die Situation. In demselben Augenblick aber erfolgte auch schon die Katastrophe. Ehe ich noch auf den Beinen war, wurde die ganze neben und über mir befindliche Zeltwand dermaßen eingedrückt, daß sie mich vollständig bedeckte, und durch die Leinwand fühlte ich unmittelbar neben mir eine sich hin und her bewegende Masse …
Da befiel mich doch, ich muß es gestehen, ein gewaltiger Schreck. Denn es konnte kein Zweifel sein, daß dieses unheimliche Etwas dicht neben meinem Haupt nichts anderes als einer der Füße des Elefanten war, der sich soeben anschickte, das Zelt niederzutreten, und dabei im nächsten Augenblick zunächst einmal meinen Kopf von allen gegenwärtigen und zukünftigen Sorgen befreien würde … Was sollte ich tun? Ich konnte gar nichts tun, denn ehe es mir gelang, mich aus der mich umhüllenden Leinwand herauszuwickeln, mußte das Unglück schon längst geschehen sein.
Diese wenigen Sekunden, neben mir der hin und her bewegte, sich bald hebende, bald senkende Elefantenfuß, kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Inzwischen waren aber meine Gefährten munter geworden und zur Erkenntnis dessen gelangt, was da geschah. Während der eine, durch mein halb ersticktes Geschrei auf meine gefährdete Lage aufmerksam gemacht, mich mehr in die Mitte des Zeltes zerrte, stürzte der andere mit dem Gewehr hinaus. Gleich darauf hörten wir zwei Schüsse, denen ein zorniges Trompeten folgte, und als ich nun mit dem Kameraden ebenfalls hinauseilen konnte, sahen wir im hellen Mondlicht den Elefanten, ein großes Tier, gerade noch im Walde verschwinden.
Das war wieder einmal ein » narrow escape«, ein knappes Entkommen, gewesen! Ich glaube übrigens nicht, daß der Rogue das Zelt in wirklich bösartiger Absicht demolieren wollte. Die Zerstörungsakte dieser halb oder ganz verrückten Einzelgänger sind mehr auf dummdreiste Neugier zurückzuführen. Auch bei den Herdenelefanten macht sich diese täppische Zudringlichkeit, halb Neugier, halb Spielerei, oft in drastischer Weise bemerkbar; sie belustigen sich dann damit, Telegraphenpfähle umzulegen, schön aufgeschichtete Haufen von Landstraßenschotter zu zertreten und ähnlichen Unfug zu treiben, natürlich nur dann, wenn kein Mensch in der Nähe ist.
Ob der Rogue getroffen war? Wir konnten es nicht ausmachen, Schweißspuren waren jedenfalls nicht sichtbar, und obwohl wir sogleich die Verfolgung aufnahmen, war und blieb er verschwunden. Erst einige Tage später, als wir schon angenommen hatten, er wäre doch tödlich verwundet worden und in irgendeinem versteckten Winkel des Urwalds verendet, stießen wir wiederum in überraschender Weise auf eine frische Fährte von ihm. Da inzwischen noch einige andere Jagdliebhaber, der Gouvernementsagent des Distrikts und zwei Engländer, zu uns gestoßen waren, gelang es uns diesmal, den Elefanten einzukreisen und zu stellen. Als er vergeblich auszubrechen suchte und kein Entrinnen mehr sah, ging er mit wütend emporgerecktem Rüssel auf uns los. In demselben Augenblick krachten aber auch schon unsere Schüsse, der Rogue machte nur noch wenige Schritte vorwärts, taumelte, stürzte zu Boden und war bald darauf verendet.
Es war ein männlicher Elefant ohne Stoßzähne, er hatte die stattliche Höhe von 8¼ Fuß.
Als ich von diesem Ausflug nach Hambantota zurückkehrte, wurde ich dort von zwei deutschen Weltbummlern und Amateurjägern begrüßt, die es sich, da sie an Elefanten doch nicht herankommen konnten, in den Kopf gesetzt hatten, wenigstens ein paar wilde Ceylon-Büffel zu schießen und ihre Trophäensammlung im heimischen Wigwam um einige Büffelhörner zu bereichern. Obwohl ich allen Anlaß hatte, den weidmännischen Künsten der Landsleute etwas mißtrauisch gegenüberzustehen, wollte ich, da es im übrigen liebenswürdige Herren waren, doch nicht ungefällig sein und schloß mich ihnen auf ihre Bitte an. Schon nach einer Tagesreise befanden wir uns in einem Distrikt, wo es viele wilde Büffel gab. Nun haben die wilden Büffel die Gewohnheit, sich in der Nähe der Dörfer unter die dort weidenden zahmen Büffel zu mischen und mit ihnen friedlich gemeinsam zu grasen. Unter solchen Umständen ist es dann für den Neuling schwer, das richtige Tier ausfindig zu machen, denn er wird auf größere Entfernung den wilden Büffel kaum vom zahmen unterscheiden können, und wenn er einen zahmen erlegt, der den Dorfbewohnern gehört, wird das ein ziemlich teurer Spaß – vom Spott ganz zu schweigen.
Wir stießen unweit eines Ortes bald auf eine Herde, in der sich, wie ich mit meinen Shikaris ausmachen konnte, zwei wilde Büffel befanden. Da mir persönlich nichts am Abschuß der Tiere gelegen war, überließ ich sie gern meinen neuen Jagdfreunden. Wir pirschten uns vorsichtig an die Herde heran, und die Shikaris bezeichneten meinen beiden Landsleuten die beiden wilden Büffel. Fiebernd vor Weidmannslust, ließen die Amateur-Nimrods alsbald ihre Büchsen krachen. Sei es nun, daß sie die Zeichen der Singhalesen falsch verstanden hatten, sei es, daß es mit ihrer Schießkunst noch schlechter bestellt war, als ich ohnehin dachte, genug, die Herde stob auseinander – und mit ihr die beiden wilden Büffel, während zwei friedliche zahme Tiere als Opfer des sportlichen Ehrgeizes liegen blieben! Es läßt sich denken, mit was für verlegenen Gesichtern die Herren ihre »Strecke« betrachteten. Und die Gesichter wurden noch länger, als bald darauf vom Dorfe her die Besitzer der unglückseligen Büffel erschienen und unter Heulen und Haareraufen Entschädigung für die Erschossenen verlangten, die jetzt, nach dem Tode, selbstverständlich zu den wertvollsten Tieren der ganzen Herde avancierten. Nach endlosem Feilschen einigte man sich auf 150 Rupien, so daß jeder Nimrod 75 Rupien Schußgeld zu zahlen hatte. Ich konnte mir nicht die Frage verkneifen, ob meine Freunde nicht wenigstens das Gehörn der Dorfbüffel als Trophäe nach Deutschland mitnehmen wollten – der wohlmeinende Vorschlag wurde aber dankend abgelehnt …
Das waren zwei »Großwildjäger« ziemlich harmloser Art, ich habe jedoch in meiner Praxis auch eine leider recht große Anzahl minder harmloser kennengelernt, Wildschlächter jenes Schlages, die der ehrliche Weidmann Aasjäger nennt, die alles schießen, was ihnen vor den Gewehrlauf kommt, sich weder um Schonzeit noch um Mutterwild kümmern, und denen es ganz gleichgültig ist, wenn sie das Wild krank schießen, so daß es elend verkommt. Zum Glück wird solchen Frevlern an der Kreatur in Indien durch strenge Jagdgesetze das Handwerk einigermaßen erschwert; immerhin fehlt es aber auch dort nicht an Bezirken, die sich durch ihre Weiträumigkeit der Kontrolle entziehen, und in denen der Aasjäger seinem Vergnügen nachgehen kann, ohne sich allzu ernstlich der Gefahr des Erwischtwerdens auszusetzen. »Der Himmel ist hoch und der Zar ist fern,« dieses alte russische Sprichwort hat, mutatis mutandis, auch für Indien Geltung. Die britischen Behörden können nicht überall sein, und in vielen Eingeborenenstaaten haben sie auch nur sehr beschränkte Befugnisse. Kein Wunder also, daß es in solchen Gegenden mit dem Wildschutz im argen liegt, und daß dort dem skrupellosen »Großwildjäger«, wenn er nur über eine gut gespickte Börse verfügt, kaum Hindernisse bereitet werden.
