
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Gasteréa est la dixième Muse, elle
préside aux jouissances du goût.
Brillat-Savarin
Der Gartenbau gehört unstreitig zu den ältesten Beschäftigungen der Menschen; für diese Annahme spricht schon die alte Sage von Adams Aufenthalt im Garten von Eden. Aus Homer wissen wir, daß schon vor 3000 Jahren Wein, Birnen, Feigen, Oliven und anderes mehr in Gärten gezogen wurden. Noch weiter als die Griechen bildeten die Römer aber den Gartenbau aus. Plinius liefert das älteste Pflanzenverzeichnis; mehr noch machte sich aber Lukullus um die Pflege und besonders die Einführung fremder Pflanzen verdient. Durch ihre fernen Eroberungen trugen die Römer viel zur Bereicherung der Gärten, nicht nur in Italien, sondern in ganz Südeuropa bei. Aber unter Diokletian, der der Herrschaft der Welt entsagte und seinen Salat in den Gärten von Salona selbst baute, war der Gartenbau so herabgekommen, daß ein einziges Kohlhaupt gegen einen halben Taler kostete. Auch die Barbaren des Nordostens, obgleich sie alle Künste verschmähten, trugen große Sorgfalt für die Erhaltung der nützlichen Gemüse. Schon die Gärten König Childeberts enthielten Obst und Wein, und Karl der Große gab bekanntlich Namen und Zahl der Küchengewächse an, die er zu bauen befahl.
Zwei wichtige Ereignisse des Mittelalters, der Einfall der Mauren in Europa und die Kreuzzüge, trugen ganz besonders zur Vermehrung aller Gartengewächse ungemein bei. In Deutschland gediehen sie zuerst in den Klostergärten, von wo auch die ersten Obstgewächse verbreitet und der Weinbau befördert wurde.
Gegenwärtig sind wohl die Gemüsegärten in der Umgegend von Paris die ersten der Welt. Zwei treffliche Grundsätze kommen hier in Anwendung: daß der Gemüsegarten nämlich selten zuviel Wasser und niemals zuviel Dünger bekommen kann. Durch Befolgung dieser unabänderlichen Regel sind an und für sich ganz unfruchtbare Grundstücke, die anderwärts für jede Kultur ganz untüchtig gefunden werden, in der Umgegend von Paris in die fruchtbarsten Gemüsegärten verwandelt worden: eine Erfahrung, die sich dort bei jeder neuen Gemüseboden-Anlage bestätigt. Ein anderer, nicht weniger wichtiger Grundsatz ist der: nicht auf die Fortsetzung einer Kultur versessen zu sein, welche einmal nicht vorwärts will; man tut besser, ein solches Feld zu leeren und frisch zu bepflanzen.
Die notwendigste Eigenschaft für einen Gemüsegärtner ist aber, daß er die Umstände möglichst voraus berechne, die von Einfluß auf seine Pflanzungen sind. Durch nichts darf er überrascht werden, nichts darf ihn unvorbereitet finden; am wenigsten ein Temperaturwechsel. Besonders aber muß er für jede Arbeit den rechten Moment finden, so daß alles zur rechten Zeit geschieht.
Die heutige Gärtnerei ist eine ganz moderne Kunst. Man kennt ganz genau, wann z. B. in Frankreich der erste Salatsamen eingeführt wurde. Dies geschah im Anfange des 16. Jahrhunderts, und fast alle besseren Gemüse sind nicht viel länger in Europa heimisch. Unter Karl IX. schrieb der Domherr Charron sein Buch der Weisheit, worin er die Gemüse als Luxusartikel bezeichnet, den Kohl und die Rübe ausgenommen, welche echt gallische Erzeugnisse seien. Er führte die ganze menschliche Weisheit auf die zwei Worte Frieden und Genügsamkeit zurück, und als Wappen hatte er zum Symbol der Mäßigkeit die Steckrübe vorgeschlagen. Die Gärtnerei von A. Bixio, aus dem Französischen von F. Mandry.
Belgien war schon zwei Jahrhunderte früher einem großen Garten gleich: der Geschmack für den Gartenbau war dort schon früher herrschend, als alle seine Provinzen sich unter dem mächtigen Szepter des Hauses Burgund vereinigt fanden. Sobald aber ein großer Teil des reichen und aufgeklärten Belgien, des spanischen Jochs und der Inquisition überdrüssig, nach Holland flüchtete, erhoben sich hier die unbedeutendsten Flecken schnell zu wichtigen Städten. Die Bedürfnisse derselben brachten die Gartenkunst in Aufnahme. Bald bezogen die meisten Völker der Alten und Neuen Welt ihre Gartenbedürfnisse aus Holland und erhielten zugleich von hier aus eine Menge von exotischen Gewächsen, welche namentlich über ganz Europa verbreitet wurden.
 Unter solchen Umständen ward Holland der klassische Boden der Gärtnerei. Noch jetzt heißen Erbsen, Blumenkohl, Zwergbohnen und eine Menge feiner Gemüse holländische Sorten, weil die Kultur derselben zuerst in Holland zur höchsten Vollkommenheit gebracht wurde, wie man denn auch noch jetzt in Holland einen größeren Reichtum von getriebenen Gewächsen findet als selbst in der Umgegend von
Paris. In Gent, wo man nicht weniger als 400 Gewächshäuser hat, ist der Spargel berühmt, in Brüssel der Rosenkohl, der aber mit Unrecht den Namen Brüsseler Kohl führt, weil der allerbeste in der Gegend von Mecheln und Löwen wächst. In der Umgegend von Doornik sind die Obstfrüchte so ausgezeichnet, daß die Genter Gartengesellschaft schon eine Preisfrage darauf gesetzt hat, um davon die Ursache zu erforschen.
Unter solchen Umständen ward Holland der klassische Boden der Gärtnerei. Noch jetzt heißen Erbsen, Blumenkohl, Zwergbohnen und eine Menge feiner Gemüse holländische Sorten, weil die Kultur derselben zuerst in Holland zur höchsten Vollkommenheit gebracht wurde, wie man denn auch noch jetzt in Holland einen größeren Reichtum von getriebenen Gewächsen findet als selbst in der Umgegend von
Paris. In Gent, wo man nicht weniger als 400 Gewächshäuser hat, ist der Spargel berühmt, in Brüssel der Rosenkohl, der aber mit Unrecht den Namen Brüsseler Kohl führt, weil der allerbeste in der Gegend von Mecheln und Löwen wächst. In der Umgegend von Doornik sind die Obstfrüchte so ausgezeichnet, daß die Genter Gartengesellschaft schon eine Preisfrage darauf gesetzt hat, um davon die Ursache zu erforschen.
Die merkwürdigsten Gemüsegärten der Welt sind die mexikanischen schwimmenden Küchengärten im See von Mexiko, welche mit leichter Mühe von einer Stelle zur anderen geschafft werden können. Man flicht Weidenzweige und Wurzeln von Sumpfpflanzen, sowie anderes Material zusammen, welches leicht ist, aber durch feste Verbindung die nötige Erde tragen kann. Auf dieses legt man allerlei leichtes Gesträuch, und darauf Schlamm und Erde, acht Ruten lang, nicht über drei breit und nicht völlig einen Fuß über der Oberfläche des Sees. Das Ganze ist mit Blumen umkränzt, mit den mannigfaltigsten Küchengewächsen bepflanzt und bringt reichlichen Ertrag.
Seitdem die Wissenschaft die Möglichkeit zeigte, verschiedene Pflanzengattungen durch Kreuzen zu befruchten, liefert sie uns die Mittel, beliebige Veränderungen, und zwar bis ins Unendliche, zu erzielen. Leider hat man sich bis jetzt mehr auf Kreuzung der Ziergewächse gelegt, obgleich dies Verfahren, auf Küchengewächse angewandt, sehr belohnend sein würde.
So manche Gemüsepflanzen befinden sich seit undenklichen Zeiten in einem sehr unvollkommenen Zustande. Wir haben keinen guten Frühkohl; derjenige, den man unter dem Namen des grünen Kohls kennt, ist eine Art Futter, welches man selbst den Kühen nicht vorwerfen sollte. Man könnte durch ein wohlberechnetes Kreuzen einen Frühjahrskohl gewinnen, der ebenso zeitig und hart als der grüne Kohl wäre, um der Winterkälte zu trotzen und zugleich von besserer Beschaffenheit. Vielleicht könnte man eine Kreuzung vornehmen mit den Kohlspielarten Coeur de boeuf, Pin d'York und Conique de la Poméranie. Das Kreuzen des Blumenkohls und Brokkoli würde gute Bastardspielarten geben, und bei manchen Spargelarten würde der grobe und starke Geschmack verschwinden, wenn sie mit feineren Arten gekreuzt würden.
Nicht minder vorteilhaft würde eine Kreuzung bei den Erbsen sein. Durch den Fleiß der Holländer und Engländer sind wir hinlänglich mit Früherbsen versehen. Von Späterbsen haben wir fast gar keine empfehlenswerte Sorte. Die Versuche hierin müßten hauptsächlich darauf gerichtet werden, die Größe der Späterbsen zu verringern. Auch könnte man einige Unterspielarten erzeugen, welche die Trockenheit des Sommers besser ertragen. Denn wenn die erste Ernte unserer Sommererbsen vorüber ist, so sucht man – selbst in den großen Städten – vergebens welche auf den Märkten.
Wenn die Kreuzung gehörig zur Verbesserung der Küchengewächse benutzt wird, so werden wir bessere Gemüse für denselben Preis bekommen, für welchen man jetzt schlechte hat. Eine gute Gemüseart verlangt nicht mehr Platz im Küchengarten als eine schlechte und ist auch nicht kostspieliger zu ziehen.
Gewächse sind im allgemeinen gesünder als Fleisch (aber freilich im Norden weniger als im Süden: England und Indien sind hierin die entscheidenden Gegensätze), weil die meisten unseren Säften durch den Mangel aller Schärfe am ähnlichsten sind. Deshalb gab Pythagoras ihnen einen so großen Vorzug. Die ersten Griechen aßen nichts als Gemüse und erwiesen dem Pelasgus göttliche Ehre, weil er sie gelehrt, Eicheln zu essen, die sie für gesünder hielten als Kräuter. Reis, Kräuter und Butter sind noch die einzigen Speisen der Inder; auf Malabar lebt man fast einzig von Gemüsen.
Gewächse in Treibhäusern, die bloß durch die Kunst reifen, sind ohne Süßigkeit, Geschmack und Aroma; sie sind gut für die Tafel des Lukullus. Dergleichen Kunstprodukte befriedigen den eiteln Wirt, nicht den verständigen Gast, der den späteren, reineren, rechtzeitigen Genuß solchem Charlatanismus vorzieht. Frühbeete ohne künstliche Erwärmung, die bloß die jungen Gemüse gegen die Kälte schützen, sind ungleich besser als Treibhäuser, am besten die in französischen Gemüsegärten sehr üblichen Glasglocken. Aber alles das so Erzielte steht dem reinen Naturprodukt nach, wie schon die gepflegte Gartenerdbeere beweist, die jederzeit der Walderdbeere an Geschmack wie an Aroma nachsteht. In Rußland ist die Kunst hierin am weitesten gediehen. Das ist natürlich, eben weil die Natur so wenig bietet; in Italien denkt kein Mensch an so etwas. In Petersburg wird in strengster Winterkälte viel Obst in den Treibhäusern erkünstelt. Es gewährt den herrlichsten Anblick, aber nicht das Aroma, welches Sonne und Luft dem im Freien gewachsenen Obste gibt; jenes sind nur traurige Surrogate, geschmacklos und wässerig. Dabei sind sie begreiflicherweise sehr teuer; man kann sehr schnell für 100 Silberrubel Weintrauben verzehren. In Italien freut sich der Bauer, wenn man seinen Weinberg besucht und unentgeltlich daraus genießt; ja, sagt er stolz, zu meinen Nachbarn kommen keine Gäste, denn mein Wein ist besser. Ich liebe nicht das Land, wo nichts reif wird als gebratene Äpfel, gedämpfte Birnen und gebackene Pflaumen.
Ich kannte einen Gastrosophen, der von seinem Gärtner verlangte, alle Tage im Jahr für ein anderes Gemüse Sorge zu tragen. Schon Kaiser Karl der Große nannte in einer Verordnung zweiundsiebzig verschiedene Gattungen von Gartengewächsen, die gepflegt werden sollten. Von den Äpfeln befahl er vorzüglich die Arten, welche man damals Gormaringa, Geroldinga und Spirauca nannte (Capitulare Caroli M. de villis). Da sein Befehl alle Kammergüter, auch in anderen Ländern als Deutschland betraf, so weiß man nicht genau, welche von diesen Gewächsen eigentlich bei uns gezogen wurden. Unter den fränkischen Kaisern nahm die Mannigfaltigkeit der Speisen noch mehr zu. Man genoß vielen Knoblauch, gesalzene Fische, zusammengesetzte Speisen und Getränke von Wein und allerlei starken Gewürzen. In neueren Zeiten – unter dem Großen Kurfürsten – verdankte die Küche, besonders die Gartenkunst den französischen Refugiés sehr viel; wir haben noch eine große Menge feiner Obstarten, die wir französisches Obst nennen. Durch sie ist der Gebrauch einer unendlichen Menge von Gemüsen erst bei uns bekannt geworden und hat eine merkwürdige Veränderung in der Diät veranlaßt.
Die Pflanzen des Südens sind kräftiger und süßer als die des Nordens; aber nicht bloß deshalb, sondern auch, weil der Genuß der Vegetabilien ein durch die Lokalität und Temperatur bedingtes Naturbedürfnis ist, werden sie dort häufiger genossen. Im südlichen Frankreich und in Italien lebt man auch ohne Fleisch in ganz gesundem Zustande. Aber es sind auch dort die Pflanzen nahrhafter und von besserem Geschmacke. In Nordfrankreich und Deutschland, wo sie schon weniger von einer so warmen Sonne genährt werden und mehr Wasser enthalten, gelten sie um ein Bedeutendes weniger, und in England werden sie fast für nichts geachtet, und doch kostet ihre Kultur viel mehr. Die Erfahrung lehrt, daß das Getreide aus der Berberei mehr Mehl gibt als das französische, und dies wieder mehr als das des Nordens. Diese Abstufung geht bis zum Pol.
Der beständige und vorherrschende Genuß der Mehlspeisen begünstigt die Entwicklung des phlegmatischen Temperaments, und in heißen Ländern, wo die Tätigkeit der Verdauungsorgane beschleunigt wird, ist diese Nahrung ein wohltätig hemmendes Gegengewicht gegen den Drang der Lebensglut. Ähnlich scheint die Nahrung der Hirten, der Kamele und der wiederkäuenden Tiere, welche auf Pflanzennahrung beschränkt sind, dem Körper die Beweglichkeit und innere Lebenskraft des kindlichen Alters zu bewahren. Der vorherrschende Genuß des Gemüses wurde öfters von solchen Männern empfohlen, deren innere Bestimmung es war, den Geist aus dem Spiele der Sinnlichkeit zu den tiefsten Betrachtungen zu erheben.
In warmen und trockenen Jahren sind alle Feld- und Gartengewächse, sowie das Fleisch der pflanzenfressenden Tiere von viel nahrhafterer Beschaffenheit als in nassen Jahren, welche bei uns öfter Jahre der Teuerung waren. Daher erzählten Leute, die die teure Zeit von 1770 erlebt hatten, daß damals die dreifache Menge des Brotes kaum hingereicht habe, um den Hunger wie zu anderer Zeit zu stillen.
Die mäßig trockenen und etwas erhöht gelegenen Gegenden der wärmeren Länder zeichnen sich durch besondere Kraft der Nahrungsmittel aus; so namentlich das Innere von Persien, dessen Bewohner durch ihre große Mäßigkeit das Staunen der Europäer erregen, und das Hochland von Spanien, die beiden Kastilien, wo ein Ei mit einigen Zwiebeln das Mittagsmahl vieler Bewohner bildet. So fristet auch der Inder das Leben mit wenigen Löffeln Reis. Dagegen gibt es schon ganz in der Nachbarschaft jener Länderstriche andere Völker, deren Nahrungsmittel durch den beständigen Regen und die Feuchtigkeit des Bodens von sehr kraftloser Beschaffenheit sind. So die feuchten Gegenden am Kaspischen See, so einige Niederungen von Spanien, in Aragonien und besonders Asturien, wo selbst die aromatischen Pflanzen der vierzehnten Linnéischen Klasse nicht gedeihen wollen.
Die Verschiedenheit der Nahrungsmittel wird vorzüglich bei einem Vergleich zwischen Amerika und den meisten ähnlich gelegenen Ländern der Alten Welt sichtbar. So erscheinen zwar die Früchte wie das Fleisch der Tiere am Mexikanischen Meerbusen dem Auge ebenso saftig und fett wie bei uns; aber es fühlen sich die mäßigsten Europäer, welche dahin kommen, zu unmäßigen Mahlzeiten gezwungen. Die sonst so genügsamen Spanier, wie die Franzosen mußten zwei bis drei Stunden nach den reichlichsten Mahlzeiten Schokolade nehmen, weil sie sich erschöpft fühlten. Aus den Konsumationslisten der Stadt Mexiko geht hervor, daß die Zahl der geschlachteten Schafe fast vier Fünfteile und die der Schweine sogar mehr als sieben Fünfteile der in Paris verbrauchten beträgt. Gleichzeitig werden auch (nach Humboldt) in Mexiko mehr gegorene Getränke genossen als in Paris. Ein Amerikaner wird kaum halb satt von einer Portion, welche einen Europäer ersticken würde. Ein Quaranier verzehrt in wenig Stunden ein ganzes Kalb. Bei alledem haben die Indianer immer Hunger; sie essen, bis sie einschlafen, und setzen noch vor dem Schlafengehen das Fleisch ans Feuer, um gleich beim Erwachen wieder essen zu können. Überdies macht sie der Hunger schon nach Verlauf des zweiten Tages mager (nach Schomburgk in seinen »Reisen in Guiana usw.«). Den zweiten Tag, sagt er, an welchem die gewohnten Rationen ausgeblieben waren, traten an ihren sonst so fleischigen Körpern die Rippen und übrigen Knochen immer deutlicher hervor; der starke Leib fiel ein, und, faltig wie ein fremdes Kleid, schlotterte die sonst wohl ausgefüllte Haut des Bauches. Die Europäer essen in Paraguay mehr als in ihrem Vaterlande.
Es fehlt in jenen heißfeuchten Ländern den Nahrungsmitteln sogar der gewöhnliche Geschmack, und der Gaumen der Bewohner scheint schon deshalb häufig den Genuß der wilden Tiere, namentlich der Tiger, jenem der Haustiere vorzuziehen. Die Abiponer zeigen besonders eine so unwiderstehliche Gier nach dem Fleische des Tigers, daß sie keine Gefahr von der Tigerjagd abhalten kann. Unter allen zähmbaren Tieren behält nur das Schwein ein Fleisch von gleicher Güte; ja, diese Güte scheint sich sogar noch in den dumpfig-warmen Ländern zu steigern.
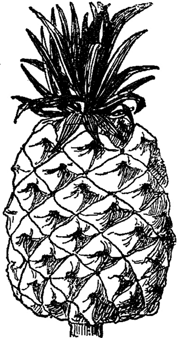 Ein fast unwiderstehliches Bedürfnis treibt in jenen Ländern die Menschen zum Genuß des Branntweins und starker Gewürze. Es genießen die Spanier auf Trinidad, wo die Temperatur selten unter 22 Grad Réaumur ist, ihr getrocknetes Brot mit vielem Spanischen Pfeffer und die Frauen trinken dort, wie die Männer, so viel Rum, daß man täglich zwei bis drei Flaschen für ein gewöhnliches Maß hält. Auch in den ungesunden heißen Gegenden von Afrika können die Europäer ungleich mehr Branntwein vertragen als in ihrem Vaterlande. Dagegen sollen (nach Bruce) in Arabien und dem angrenzenden heißen Afrika die Liköre zwar die Verdauung stärken, aber den Kopf angreifen, und er rät deshalb vorzugsweise den Genuß des Schwarzen Pfeffers.
Ein fast unwiderstehliches Bedürfnis treibt in jenen Ländern die Menschen zum Genuß des Branntweins und starker Gewürze. Es genießen die Spanier auf Trinidad, wo die Temperatur selten unter 22 Grad Réaumur ist, ihr getrocknetes Brot mit vielem Spanischen Pfeffer und die Frauen trinken dort, wie die Männer, so viel Rum, daß man täglich zwei bis drei Flaschen für ein gewöhnliches Maß hält. Auch in den ungesunden heißen Gegenden von Afrika können die Europäer ungleich mehr Branntwein vertragen als in ihrem Vaterlande. Dagegen sollen (nach Bruce) in Arabien und dem angrenzenden heißen Afrika die Liköre zwar die Verdauung stärken, aber den Kopf angreifen, und er rät deshalb vorzugsweise den Genuß des Schwarzen Pfeffers.
Pfeffer wie anderes heißes Gewürz wird in manchen heißen Ländern so häufig angewendet, daß man auf St. Lucie die dort sehr häufige Speise des Stockfisches und geräucherten Fleisches, in Paraguay den Käse, in Sierra Leona und Kongo alle Speisen mit rotem Spanischen Pfeffer ganz überschüttet. Nebst dem Pfeffer wendet der Abessinier die Ochsengalle, der Baniane den Assa foetida an, und in einigen Ländern, wie in den südwärts vom Senegal gelegenen, zeigt sich ein unnatürlicher Hang zu faulen Fischen, aus denen man selbst im östlichen Asien einen Brei oder eine Sauce, Balachian genannt, bereitet, welche den Bewohnern von Pegu, Arrakan, Siam und selbst den Chinesen, gleich unserem Senf, als ein guter Beisatz zu Reis und anderen Speisen erscheint. Auch das Bedürfnis nach Salz wächst in heißen Erdteilen. Der kalte Norden bedarf dagegen mehr der fetten Speisen und liebt rohes Fleisch.
Als Beweis für den Einfluß der vorherrschenden Nahrung auf den Charakter der Völker gilt auch die Kühnheit und die zornmütige Grausamkeit der vorzugsweise fleischessenden Javaner sowie die natürliche Sanftmut der meist vom Pflanzenreich lebenden Inder und Südsee-Insulaner. Dem Genuß der rohen Kastanien und anderen mehligen Speisen wird (von Cabanis) der Stumpfsinn einiger Völker zugeschrieben. Arbuthnoth erwähnt Fälle, wo sich die cholerische Gemütsanlage durch häufigen Genuß der Pflanzenspeise gemildert hat.
Die meisten Köche versehen es mit den Gemüsen dadurch, daß sie die Mühe des Blanchierens scheuen. Diese besteht bekanntlich darin, daß man die Gemüse vor dem eigentlichen Kochen mehrere Male mit heißem Wasser abbrüht; dadurch wird ihnen der wilde, erdige Geschmack genommen und besonders, was für die Gesundheit am wichtigsten ist, die blähende Eigenschaft. Übrigens müssen auch die meisten Kohl- und Rübenarten, um schmackhaft und gesund zu sein, mit reiner Bouillon gekocht werden, sogar die jungen Mohrrüben, die aber nie anders genossen werden sollten, als wenn sie noch so klein sind wie ein kleiner Kinderfinger. Nur aus den elenden Küchen wagt man, sie in langen, holzigen, saftlosen, viereckig zugeschnittenen Stücken auf die Tafel zu bringen. Solche Rübe ist ein gutes Futter zur Gänsemast. Zichorien und Eiskraut können nur mit einer Béchamelsauce genossen werden; junge Erbsen aus dem Salzwasser, ohne das beliebte Einbrennen, bloß mit frischer Butter, die man darin auf dem Teller selbst zerfließen läßt; ebenso junge Schnittbohnen; Spargelsalat, von dem die Rippen des Blattes zubereitet werden wie anderer Spargel und Brokkoli; aber man kann sie auch in der sehr bekannten weißen Buttersauce servieren.
Brot. Dasjenige, welches wir gut nennen, zeichnet sich aus durch weiße Farbe, angenehmen Geruch, Wohlgeschmack, durch eine poröse, schwammige, lockere Textur. Es ist aber ein Vorurteil, daß nur weißes Brot gut sei, welches durch das Brot der Landbäcker oft sehr schlagend widerlegt wird. Um diesem Vorurteile zu huldigen, kam man auf den Kunstgriff, es zu bleichen, wozu man sich des Alauns bedient; dadurch wird dasselbe der Gesundheit nachteilig. Manche Bäcker wenden auch kohlensaueres Ammoniak an, um aus verdorbenem, feuchtem Mehle weißes, lockeres Brot zu bereiten. Dies ist nur schädlich, wenn das Ammoniak, wie es oft der Fall ist, Blei enthält. Auch läßt sich mit Hilfe des sogenannten blauen Vitriols (schwefelsaures Kupfer) aus schlechtem Mehle gut scheinendes Brot backen, was sich glücklicherweise leicht ermitteln läßt, weil man es nur mit eisensaurem Kali behandeln darf, infolgedessen das Brot eine rote Färbung bekommt. Auch hat man seit etwa zehn Jahren gefunden, daß im Handel dem Weizenmehl Kartoffelstärke beigemischt ist. Dies ist zwar unschädlich, aber es macht das Brot weniger gut, da der im Mehl enthaltene Kleber nahrhafter als Kartoffelstärke ist. Denn von der Menge wie von der Qualität des Klebers hängt die Güte und Lockerheit des Brotes ab. Mehl, welches wenig Kleber und viel Stärkemehl enthält, wird nur ein schweres, flaches und dichtes Brot geben.
Wenn ich auch schon in der Vorrede über schlechtes Brot, besonders über schlechte Semmel, in Deutschland klagte, so gilt dies doch nur besonders von einem Teile von Norddeutschland. Die Wiener Weißbrotbäckerei gilt schon lange als die beste in der Welt; ihr schließt sich die von München, überhaupt die Süddeutschlands, besonders die der Schweiz an. Die letztere macht darauf Anspruch, die erste und älteste zu sein und den Wienern neben dem Kaisergeschlecht auch die feine Weißbrotbäckerei gebracht zu haben. Daher Schweizerbäckerei überhaupt für alle feinere. Neben anderen minder wichtigen Sachen ist dies Faktum auf dem Kongreß zu Wien diplomatisch festgestellt worden. Die entscheidenden Richter aus Frankreich, England und Italien, aus welchem Lande nur aus der Blütezeit der venetianischen Republik Reminiszenzen hoher Leistungen dieser Kunst auftauchten, wovon übrigens noch heutzutage Rudera existieren, die mit Wien rivalisieren können, z. B. die Biscotti (nicht etwa Zuckerbiskuit, sondern ein unnachahmlich fein Gebackenes zum Dessert zu essen), haben der Wiener Weißbäckerei neben dem Wiener Gefrorenen von Dehmel den europäischen Vorrang anerkannt.
Dies veranlaßte einen spekulativen Kopf zur Zeit, als neueren Ideen Raum gegeben war, sich in der Hauptstadt des allgemeinen Geschmacks, besonders der Gaumenkunst, auf dem Boulevard Bonne Nouvelle eine Wiener Weißbrotbäckerei zu errichten. Die Pariser, stolz darauf, daß ihnen das Gute und Beste aller Weltteile zugeführt wird, um darüber das eigentliche Sanktus zu sprechen, den Probestempel darauf zu drücken, fanden, daß dies die beste Bonne Nouvelle sei, welche ihnen jemals zugeführt worden. Der Unternehmer – man sagt, einer jener Kongreßdiplomaten haben die Hand dabei im Spiele gehabt Mir ist es wahrscheinlich, daß es die liebenswürdige Frau eines Diplomaten war, der so lange seinen Hof in Paris glänzend repräsentierte. – fand seine Spekulation so richtig, daß er in kurzer Zeit ein wohlhabender Mann wurde, die Bäckerei verkaufte und sich der Presse widmete. Sein Nachfolger wurde reich in noch kürzerer Zeit und ist jetzt Herrschaftsbesitzer. Die Boulangerie Viennoise floriert jetzt in dritter Hand, obwohl ihr Visavis, die berühmte Pariser Galette, die höchsten nationalen Anstrengungen macht, mit ihr zu rivalisieren. Auch erst seitdem die Wiener Kipfel und Huckauf nebst Franzbrodeln in Paris sich mit den Wiener Walzern vertraut haben, kennen die Franzosen und also alle übrigen gebildeten Nationen feines und gutes Brot und verachten ihr altes, von den Römern überkommenes gesäuertes Weißbrot.
Berühmte Altertumsforscher suchen vergeblich zu erforschen, wie das berühmte Weißbrot der Athener zu den Wienern gekommen ist und sich dort so lange unbekannt und unerkannt hat halten können. Man kann es nur der Verbindung, welche Wien stets mit den Griechen direkt unterhielt, zuschreiben. In Paris heißt das beste Brot Pain Viennois, und alle Bäcker und Pâtissiers, selbst der nicht genug zu rühmende Félix, Der Bäcker Félix wohnt in der Rue Richelieu. Er muß unterschieden werden von einem ebenso berühmten Manne seines Namens, dem eminenten Pastetenbäcker Félix, Rue Neuve Vivienne und Passage des Panoramas. verkaufen ihr feinstes Gebäck unter diesem Namen, obwohl sie auf der untersten Seite ihrer Waren, selbst ihres Brotes, ihren Namen in erhabener Schrift einbacken.
In Frankreich bedient man sich zur Düngung der Getreidefelder, ja der Gärten, sehr häufig der sogenannten Poudrette (des Kotpulvers), die wohlfeiler als anderer Dünger und für das Wachstum der Pflanzen sehr förderlich ist. Dieselbe teilt aber, auch wenn sie geruchlos zubereitet wird, besonders den feinsten Gemüsepflanzen, den Erdbeeren und allen Salatpflanzen einen unangenehmen Geschmack mit. Weniger ist solches der Fall, wenn Zwiebeln, Kohlarten und Wurzelgemüse damit behandelt werden. In Paris verleugnen die Gärtner durchaus die Poudrette, weil sie fürchten, ihre Kunden zu verlieren; aber sie verwenden sie vielfach. Die Hälfte des Brotes, welches in Paris verzehrt wird, ist aus Früchten gebacken, die mit Poudrette gedüngt sind, deren Bereitungsweise übrigens noch ein Geheimnis ist. Ich habe einen geistreichen Freund, der ein großer Feinschmecker ist und allen Früchten herausschmeckt, womit sie gedüngt wurden. Man hat gefragt, ob dies ein Glück, ob der nicht beneidenswerter sei, der ein Stück Brot, obschon es sandig sei, vergnügt hinunter schlucken kann, als der Zärtling, der überall hungern muß, wo er seinen Mundkoch nicht bei sich hat; man hat sogar behauptet (Justus Moser in seinen »Patriotischen Phantasien«), daß derjenige die Sphäre seines Vergnügens sehr erweitert, der sich jenes sandige Brot wohlschmecken läßt. Ich kann in so engen Grenzen keine Erwiderung finden. Mein eben erwähnter Freund – und ich teile ganz diese Ansicht – würde sich für den Mangel des Geschmacks bedanken, auch bietet wohl unbedingt der feinste Geschmack die größte Mannigfaltigkeit der Genüsse dar, und es kann nicht Vorzug sein, keinen oder einen geringen Grad von Geschmack zu besitzen.
Die vorzüglichsten Zuckerbäcker auf der ganzen Erde, die man auch in allen großen Städten inner- und außerhalb Europas findet, kommen aus Graubünden. Dort haben die Leute, die wir von Mexiko bis Petersburg in grauen Jacken und weißen Schürzen sehen, große Steinpaläste. Man sollte glauben, in Samaden und St. Moritz wachsen nichts als Baumkuchen; aber dort wohnen die Zuckerbäcker ohne ihre Ware. Durch die allgemeine, oft brüderliche Verbindung dieser Zuckerbäcker waren sie – vor der Einrichtung der Telegraphen und Eisenbahnen – oft imstande, die sichersten Nachrichten schnell, mitunter schneller wie die Regierungen, zu erhalten. Die Zuckerbäcker in Warschau wußten sehr zeitig den Tod des Kaisers Alexander. Nun hatte ein schlesischer Zuckerbäcker den Auftrag, mehrere hundert Fasanen nach Warschau zu liefern. Der Warschauer Zuckerbäcker sah ein, daß die Festlichkeiten des Karnevals abbestellt werden würden; er gab also eilig nach Breslau Kontreorder, und von hier bekam Josty diese Nachricht. Zwar hatte der Großfürst Konstantin sogleich, als er die Todesnachricht seines Bruders erfuhr, den preußischen Residenten kommen lassen, um ihm die wichtige Nachricht mitzuteilen, der sie dem Oberpräsidenten in Posen zusendete. Von hier brachte der Oberpostmeister, ein großer Gourmand, der wegen der Austern gern nach Berlin ging, sie dem Könige. Dieser war aber in Potsdam und kam eben nach Berlin zurück, als der Postmeister nach Potsdam kam, kurz, Josty erhielt die Nachricht früher als der König.
Das Mehl finden wir in den Samen der Pflanzen, in einigen Gräsern, Schotengewächsen, im Mark einiger Palmen und in einigen Knollengewächsen. Das rohe Mehl nährt stark und dauerhaft; allein es erfordert einen sehr starken Magen. Noch weniger sind freilich Pfannkuchen und Mehlbrei zu überwinden. Die Mühle zerstört die gröbsten Teile des Korns; endlich tun das Salz und die durch ein Ferment bewirkte Gärung das Beste. Man hat ein saures Ferment, den Sauerteig, der dem Mehl zugesetzt wird, und ein süßes, die Bierhefe, die aber die Substanz des Mehls nicht mit der Energie aufschließt wie der Sauerteig. Zuletzt wird der Teig gebacken, durch die Einwirkung des Feuers von seinem überflüssigen Wasser befreit und der Gärung ein Ende gemacht. Durch diese Zubereitung erhalten wir das zarte, gesunde und lockere Brot, das von der Wiege bis an das Grab unsere tägliche Speise ist, ohne uns zum Ekel zu werden. Dasjenige Mehl, welches leicht in Gärung übergeht, ist zur Bereitung des Brotes am besten. Weizen- und Roggenmehl gären leicht; das von Hafer und Gerste schwerer. Das Weizenbrot ist süßer und weißer, nährt stärker und erzeugt die wenigste Säure im Magen. In England kennt man kein anderes Brot als Weizenbrot, und ein Bettler würde die Gabe von einem Stück Schwarzbrot nicht nur verschmähen, sondern als einen Schimpf betrachten. In Schottland aber ißt man selbst Haferbrot. Dr. Johnson hatte daher die Bosheit, in der ersten Ausgabe seines englischen Wörterbuchs den Hafer in der Art zu definieren, daß derselbe in England ein Nahrungsmittel für die Pferde und in Schottland ein solches für die Menschen sei.
Makkaroni werden von feinstem Mehl, und am besten nur in Neapel bereitet. Man hat sehr verschiedene Arten. Die eigentlichen Makkaroni und die Lasagnetti sind die gewöhnlichsten; nächstdem die Vermicelli, Fidelini, Stellette usw., welche feinere Sorten sind. Die besten werden im Flecken Torre dell'Annunciata am Fuße des Vesuvs gemacht. Sie bestehen aus einer Getreideart, die man in Italien Segarolla nennt, welche aus Sizilien und der Levante kommt.
Reis ist nahrhaft, Der Reis ist nahrhafter als der Weizen, denn jener enthält 85 Prozent Stärke, 3½ Kleber, 4 Pflanzenfaser, der Weizen nur 71 Prozent Stärke, 10 Kleber, der Roggen sogar nur 61 Prozent Stärke, 12 Kleber, 6 Pflanzenfaser usw. gesund und leicht zu verdauen. In Deutschland wird er fast ohne Ausnahme zu sehr zerkocht und verliert dadurch den Wohlgeschmack und die nährenden Kräfte. Soll sich der Reis lange halten, so muß er noch recht sorgfältig im Ofen oder noch besser im wärmsten Sonnenschein ausgetrocknet werden. Der beste Reis ist der japanische, er kommt aber selten zu uns; den meisten erhalten wir aus Amerika. Die in Europa bekannte beste Reissorte ist die, welche in der Ebene zwischen Mantua, Verona bis nach Rovigo, in den Niederungen und Sümpfen des Po gebaut wird. Sie ist gleichsam eine höhere Potenz des so gerühmten karolinischen. Dieser Reis ist ungemein nahrhaft und blutmachend, wird aber bei der Aufbewahrung im zweiten Jahr leicht sauer.
Reis ist dem Inder ebenso unentbehrlich wie uns das Getreide. Reiche und Arme halten selten eine Mahlzeit ohne Reis, den sie als Brot und auf sehr viele Arten zubereiten. Aus geschrotenen Reiskörnern macht man das feinste Mehl, Reisblume genannt. Auch in Nürnberg verfertigt man ein sehr feines Mehl davon. Das starke geistige Getränk, den Arrak, gewinnt man ebenfalls von diesem Gewächs.
In China wird wohl am meisten Reis gegessen. Deshalb wird das Wort Reis (Fan) bei allen Arten von Speisen angewendet, wie das Wort Brot bei uns. Ein Mahl heißt bei den Chinesen Tsche-Fan, wörtlich Reis-Essen; das Frühstück Tsaa-Fan, d. i. der Morgen-Reis, und das Abendbrot Quam-Fan, Abend-Reis.
Die Anpflanzung von Reis ist gefährlich, weil man ihn nach der Aussaat viele Wochen lang unter Wasser setzen muß, wodurch so giftige Dünste aufsteigen, daß die benachbarten Bewohner in große Gefahr kommen. In Italien ist verordnet, daß man den Reis mindestens eine halbe Stunde von den Städten entfernt anpflanze. Im Tortonischen, wo der Reis häufig gepflanzt wird, haben die Bewohner eine wahre Totenfarbe. Aus gleichen Gründen gingen einige der ersten spanischen Kolonien in Amerika zugrunde. Der Boden war vor Ankunft der Spanier dürr. Da sie aber für die Zuckerpflanzen anfingen, den Boden zu bewässern, entstanden sehr schlimme Dünste, und die Menschen verfielen in Kachexien und Wassersucht.
Der Türken Lieblingsspeise, der Pilau, besteht aus Reis, zu dem man doppelt soviel Wasser als Reis nimmt. Man läßt aber das Wasser zuerst aufwallen, ehe man den Reis hinzutut und den Topf bedeckt. Ist der Reis weich gekocht, dann tut man geschmolzene Butter hinzu, und nun wird das Gericht noch fünf Minuten über dem Feuer gelassen und stark mit Pfeffer bestreut. Wohlhabende Leute richten den Pilau mit Schöpsenfleisch zu und kochen ihn mit Rosinen.
Hülsenfrüchte nähren stark, aber ihre Substanz ist gröber und weniger subtilisiert als die des Getreides; auch führen sie Schärfe mit sich und sind blähender Natur. Die Samen der meisten Hülsenfrüchte enthalten einen reichen Anteil von Stärke, verbunden mit Pflanzenkleber und gummiartigen, stickstoffhaltigen Substanzen. In unseren Bohnen (Phaseolus communis) beträgt die Stärke über 42, der Kleber 18 %, während die Saubohnen 34 % Stärke und 11 % Kleber in sich führen. Die Erbsen enthalten 14 % Kleber, 32 % Stärke, fast 2 % Eiweiß und etwas Zucker und so scheinen die meisten Hülsenfrüchte der Mischung des tierischen Fleisches noch näher zu stehen als die Gräser.
Erbsen. Die zahlreichen Varietäten dieses vortrefflichen Gemüses zerfallen in zwei Hauptabteilungen: in die Erbsen, von denen man nur die Kerne, und in die sogenannten Goulus, von denen man die Schoten und Kerne genießt. Berühmt sind die kleinen Pariser Erbsen durch ihre Frühzeitigkeit und Vortrefflichkeit wie die von Auvergne. Die besten von allen Zuckererbsen sind die Sans-par-chemin-blanc-à-grands-cosses. Eine neuere und wie schon der Name zeigt, englische Erfindung ist die Viktoria-Erbse. Sie macht den Engländern die größte Ehre, mag sie durch irgendeine Prozedur hervorgebracht (was ich nicht glaube, da sie nicht ausartet, wenn man sie bei uns zieht) oder irgendwo entdeckt sein. Sie bleibt, auch wenn sie ganz reif ist, von schöner grüner Farbe wie die ganz jung getrockneten und liefert ein sehr zart schmeckendes Püree.
Je früher man die Erbsen sät, desto weniger hat man von Mehltau zu befürchten, und je dünner man sie sät, desto mehr ist man vor dem Ausarten gesichert, auch sollen dick gesäte Erbsen nicht recht weich kochen. Von den Gartenerbsen kennt man die Früherbsen, die man fast zu jeder Zeit legen kann, da ihnen die Nachtfröste nicht schaden. Alle Gartenerbsen sind, wenn noch jung, ein gutes Essen. Schwerer sind die Felderbsen, die überdies einen schlechten Nahrungssaft enthalten. Die grauen Erbsen werden entweder grün oder getrocknet oder mit Salz gegessen. Eine nur dem deutschen Namen nach verwandte Gattung, die Kichererbse, welche im Orient wild wächst, gibt besser Viehfutter als menschliche Nahrung.
Die Bohnen sind unter allen Hülsenfrüchten diejenigen, welche durch die Kultur am meisten variieren; fast jede Gegend hat eine ihr eigentümliche Sorte, die ausartet, sobald sie irgendwo anders angebaut wird. Einige sind Stangenbohnen, andere Zwergbohnen, einige stehen zwischen beiden in der Mitte. Von einigen ißt man nur die Kerne, von anderen die Schoten; von den sogenannten Mange-tout ißt man beides, bis sie beinahe reif sind.
In Frankreich nennt man unsere gewöhnliche flache weiße Bohne Bohne von Soissons; denn an diesem Orte gedeiht sie allerdings am ausgezeichnetsten. Reichtragender, groß und breit, vielleicht die beste aller Bohnen ist die Sabre. Die sogenannte Prudhomme, graulich-weiß, oval und klein, ist eine der vorzüglichsten Mange-tout-Arten, wie die sehr reich tragende von Prag. Die Haricot d'Algèr ist eine neue treffliche, ganz schwarze Bohne. Die amerikanische Zwergbohne hat viele Varietäten, welche sich sämtlich durch längliche Bohnen auszeichnen und nur grün verspeist werden. Die belgischen sind sehr klein und die frühzeitigsten von allen. Die Zwergbohnen von Kanada sind in jedem Alter von ausgezeichneter Güte. In der neuesten »Revue horticole« wird eine Spielart der Bohne von großer Vortrefflichkeit empfohlen, deren Samen Herr Masson aus Rußland nach Paris gebracht hat, und die unter dem Namen Haricot délicieux, Butterbohne, bekannt ist.
Linsen sind schwerer zu verdauen als die Erbsen, und ihr Genuß soll sogar dem Vieh nachteilig sein. Sie enthalten 37 % Kleber und 33 % Stärke.
Kartoffeln nähren weniger als Hülsenfrüchte, denn sie enthalten 75 % Wasser, nur 15 % Stärke und 7 % Faserstoff. Sie sind leicht verdaulich und die Hauptnahrung von Millionen von Menschen. Sie sind uns freilich das, was dem Pferde das Heu ist, beiden schwellt der Leib davon auf. Dr. Meckel, der die berühmte Magensammlung anlegte, bemerkte, daß in den Ländern, wo viele Kartoffeln gegessen werden, die Magen am ausgedehntesten sind. Norddeutschland ist der Magen der Jungfrau Europa; der norddeutsche Magen ist nach Meckel von sehr bedeutendem Umfang.

Verschiedene alte Kartoffelsorten
Von den Gartenkartoffeln sind die besten Frühkartoffeln: die niedrige frühe, die Marjolin (Kidney early der Engländer), das Kleinauge (Pink eye), die Schaw, der Damenfinger, die zarte frühe, und auch die belgische Kartoffel, die beste von allen läßt sich den Frühkartoffeln anreihen. Wer den ganzen Winter gute Kartoffeln haben will, muß die holländische sogenannte Ochsenzunge, die Pariser violette und die belgische Ziegenkartoffel, welche alle gleich gut sind, sorgfältig kultivieren. Die größten Freunde von frischen Kartoffeln sind unstreitig die Engländer. Sie legen ein besonderes Gewicht darauf, daß die Kartoffeln frisch aus der Erde kommen, kurz zuvor sie zubereitet werden.
Wurzeln wachsen unter der Erde, ohne Luft und Licht, haben keine Ausdünstung als durch die Blätter und enthalten grobe, wenig durchgearbeitete Säfte. Die süßen und süßbitterlichen dienen vorzugsweise zur Ernährung, die scharfen und balsamischen zum Gewürz, als Zusatz und Verbesserungsmittel anderer Speisen. Süße Wurzeln geben eine leicht verdauliche Nahrung.
Karotten, Möhren, gelbe Rüben nehmen unter den Wurzelgewächsen, sowohl wegen ihres angenehmen Geschmacks, als weil sie ein ausgezeichnetes, gesundes Nahrungsmittel sind, den ersten Platz ein. Sie enthalten gegen 8 % Rohzucker. Es gibt viele Varietäten, die beste ist die kurze holländische Rübe. Keine Pflanze läßt sich durch Kultur, durch Boden und Klima so zu den verschiedensten Spielarten abändern. Vier bis fünf beständige Sorten ausgenommen, verändern sich die übrigen alle, wenn sie von einer Gegend in die andere verpflanzt werden, so sehr, daß sie nicht mehr erkannt werden. Als echte Sorten kann man nur die Rübe aus der Pfalz, mit rosenrotem Kopf, die schwarze Elsässer, die graue französische von Marigny, die gelbe der Holländer, die lange amerikanische, die Turnips und die Limousiner Rübe betrachten. Die übrigen Rübensorten sind, streng genommen, nicht einmal Untervarietäten; sie sind nur zufällige Abänderungen infolge des Standorts oder der Kultur. Mit Recht gibt man ihnen daher gewöhnlich ihren Namen von dem Orte, wo sie vorzugsweise gedeihen. Die in den Vogesen wachsende und die violette aus Spanien sind die vorzüglichsten.
Die roten Möhren haben in der Regel einen stärkeren Geschmack als die gelben und die weißen, und sind bei den Köchen wegen ihrer Farbe beliebter, aber die hochgelbe Möhre von Achicourt bei Arras ist die beste von allen Möhren. Die violette ist ungemein süß und erreicht einen merkwürdigen Umfang; aber sie hält sich nicht besonders im Winter und schießt gern, besonders wenn sie frühzeitig gesät ist. Die Möhren sind gesund, süß, leicht verdaulich. Die roten Karotten sind im Sommer am besten; denn zum Wintergebrauche eignen sie sich nicht, weil sie, älter geworden, einen schlechten Geschmack bekommen.
Rüben sind nicht so süß, sondern bitterlich von Geschmack. Die großen, wässerigen, holzigen Rüben verdienen nur als treffliches Viehfutter Lob, weil ihr Geschmack sich sowohl dem Fleische als der Milch mitteilt. Die Winterrüben werden im Herbst, wenn sie gut ausgewachsen sind, im Keller oder an einem anderen frostfreien Orte schichtweise im Sande aufbewahrt. Je trockener sie liegen, desto länger halten sie sich; auch muß das Kraut nicht ganz abgeschnitten werden, sondern nur die großen und gelben Blätter. Die Wurzeln des roten Mangolds haben eine mit den Rüben verwandte Beschaffenheit; durch Essig bekommen sie kühlende Kraft und verlieren ihre fade Flüssigkeit. Im Alter werden sie holzig. Es wäre aber sehr zu wünschen, daß die Kultur des Mangolds allgemeiner würde; denn der sogenannte Rippenmangold ist ein gesundes und angenehmes Nahrungsmittel, so daß er in England der Spargel der Armen genannt wird.
»Es ist hier ein Kerl«, sagte ein englischer Advokat zu einem Richter, »der beschuldigt wird, Rüben gestohlen zu haben; welche Akte läßt sich wohl auf ihn anwenden?« »Ich weiß es in der Tat nicht«, versetzte der Richter. – »Aber meinen Sie nicht die Holzakte?« – »Allerdings, wenn die Rüben zähe und holzig waren.«
Kohl ist vorzugsweise ein europäisches Gemüse, alle anderen stammen im Vergleich mit demselben erst aus der neueren Zeit. Bekanntlich hatte Rom vier Jahrhunderte lang keinen Arzt. Während dieser Zeit war Kohl das Universalmittel gegen alles Wehe, und es scheint nicht, daß damals mehr Kranke gestorben sind, als wenn in der Hauptstadt der Welt Doktoren und Apotheker in Menge gewesen wären. Der Kohl gibt sich tausend Phantasien der Kochkunst hin; mit Unrecht wird er eine vulgäre Speise genannt. Von allen Kohlsorten hat man ebensoviel Gutes wie Böses gesagt. Freilich ist er Schwachen, Rekonvaleszenten und Hypochondristen nicht zu empfehlen, aber er ist für stärkere Magen eine vortreffliche Speise. Die Ärzte sind ihm in der Regel nicht hold. Es fragt sich, ob es aus Brotneid ist, weil er ihre Entbehrlichkeit fast durch ein halbes Jahrtausend bewiesen hat. Die zahlreichen Gemüsesorten, mit denen der Gartenbau nach und nach bereichert worden ist, haben dem Kohl nichts von seiner Geltung geraubt; noch jetzt nimmt derselbe den ersten Rang unter den Küchengewächsen ein, schon weil er immer billig und in Menge zu haben ist.
Von der unendlichen Menge der Kohlarten nenne ich folgende:

1. Kopfkohl. Dazu gehört der Zuckerhut mit gelblichgrünen Blättern, der zart und sehr gut ist, sowie das Ochsenherz, das dem Weißkraut nahe verwandt und wegen seiner Vorzüglichkeit sehr im Gebrauch ist. Von Weißkraut ist das aus dem Elsaß auch unter dem Namen Straßburger Kraut (Sauerkraut) mit Recht beliebt, wie das pommersche mit regelmäßig kegelförmigem Kopfe, das auch zur Bereitung von Sauerkraut verwendet wird.
2. Mailändische Kohlarten sind zarter als die vorigen und auch nicht dem fatalen Moschusgeschmack so sehr als jene unterworfen. In Frankreich hat man vorzugsweise zwei Sorten davon, den gemeinen mailändischen mit kleinen Köpfen und sehr runzligen Blättern (sein Hauptvorzug ist, daß er selbst bei einem Frost von mehreren Graden noch fortwächst), die andere Sorte ist der sogenannte deutsche Krauskohl, Milan de vertus, der in der Mitte zwischen den eigentlichen Kraus- und Kopfkohlsorten steht, aber delikater als beide ist. Hierher gehört auch der Brüsseler Kohl (Rosenkohl), der mit Recht von Jahr zu Jahr mehr Raum in guten Gemüsegärten findet, wie auch der russische Kohl, der sehr zart und in jeder Hinsicht vortrefflich ist.
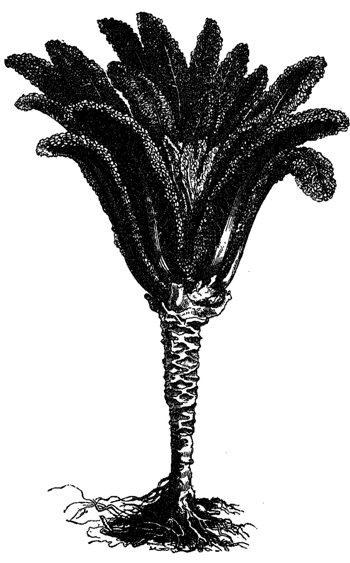
3. Der Grünkohl und Braunkohl, welche der Kälte gut widerstehen und keine Köpfe bilden; der von Neapel hat einen niedrigen Stengel. Der Palmkohl, so genannt, weil seine gekräuselten Blätter am Stengel sehr elegant aussehen, ist, wie der vorige, aus Italien und sehr zärtlich gegen den Frost.
4. Kohlrüben und Kohlrabi kommen mit den dichteren, aber mehr nährenden und weniger blähenden Rüben überein. Halbgewachsene Kohlrabi gehören aber unter die edleren Gemüse, wenn man sie gut begossen hatte.
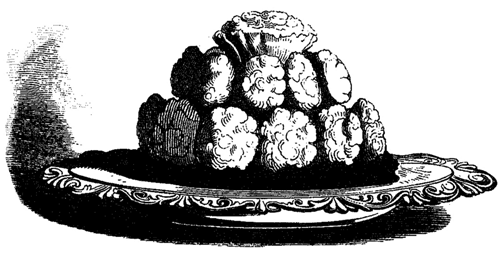
5. Blumenkohl verdient unter all den mannigfaltigen Kohlarten den ersten Rang. Im Frühling und Herbst gedeiht er aber besser als im heißen Sommer. Es gibt wenig Gemüse, die ein so gesundes Nahrungsmittel sind als der Blumenkohl. Schlechte Gärtner lieben ihn nicht, weil sie ihn nicht zu ziehen verstehen und er mehr Mühe und Sorgfalt erfordert als anderes Gemüse. Man unterscheidet drei Hauptvarietäten: den zarten, halb harten und harten. Die berühmten Blumenkohlsorten von Malta, Zypern, England und Holland gehören einer dieser drei Varietäten an, unterscheiden sich aber wenig durch charakteristische Merkmale. Der Brokkoli ist mit dem Blumenkohl nahe verwandt, doch noch vorzüglicher; denn er ist zarter und treibt größere Köpfe. Aus Italien zu uns gekommen, will er Schutz gegen unsere nordische Kälte und die wärmste Lage im Garten haben. Seine Hauptvarietäten sind der weiße, violette und der frühe zwergviolette; die beiden ersten sind die vorzüglichsten.
In Südamerika hat man Palmenkohl, den die schöne Oreodoxa, Areca oleracea, liefert, der ein sehr beliebtes Gemüse ist; freilich kostet eine ganz mäßige Portion jedesmal einer Palme das Leben, weil sie umgehauen werden muß, um den eßbaren Teil, der in Form eines kompakten, zylindrischen Körpers zwischen den Wedelscheiden liegt, zu erhalten, der aber den feinsten europäischen Gemüsen in nichts nachsteht und dem Spargel an Geschmack verwandt ist.
Zichorien haben einen mehr bitteren Geschmack und ein seifenartiges Wesen, welches Stockungen zerteilt, die Eingeweide aufschließt und bei hypochondrischen, melancholischen und anderen schwarzgalligen Krankheiten von ausgezeichneter Wirkung ist. Leider ist diese Pflanze wenig kultiviert, obgleich sie sich sehr dazu eignet, wie neuere Varietäten beweisen, besonders eine von dem berühmten Pariser Samenhändler Jacquin erzielte. Die Zichorie wird im Herbst, ehe es friert, aus der Erde genommen, aber erst, nachdem vier Wochen lang die Blätter eines Stockes an der Spitze zusammengebunden worden sind, wodurch sie die schöne Weiße mit goldgelben Spitzen erhält; dann wird sie im Keller verwahrt. Erst gegen Weihnachten bekommt sie ihren süßen Geschmack.
Spargel. Man unterscheidet zwei Hauptvarietäten: den grünen oder gewöhnlichen und den dicken violetten, sogenannten Holländischen Spargel. Die berühmtesten Spargelorte sind Marchiennes, Besançon, Darmstadt, einige Gegenden von Polen und ganz besonders Ulm, wo der Spargel zeitig, violett und sehr dick ist, ähnlich dem von Gent, aber bei weitem schmackhafter. Im Departement der Meuse stürzt man, sobald der Spargel aus der Erde kommt, eine Bouteille darüber. Der Spargel wächst alsdann bis hinauf zu dem Boden der Flasche, beugt sich dort um, steigt wieder hinab, und fährt so fort, bis die ganze Flasche ausgefüllt ist. Zwei solche Spargeltriebe geben eine ganze Schüssel voll, und was sie besonders empfiehlt, ist, daß sie sehr zart und wohlschmeckend sind.
Es ist ein arger und weitverbreiteter Irrtum, daß der Spargel, wenn er nur zwei Stunden lang über der Erde und noch nicht ausgestochen ist, nichts mehr taugt. Beklagenswert ist der Gourmet – einem Gourmand ist so etwas gleichgültig; diesem sind die großen, dicken, weichen und blassen die liebsten, besonders wenn es recht viele sind –, der noch nie einen Spargel aß, welchen die Sonne geküßt hat! Nur durch den Blick der allbelebenden Sonne erhält der Spargel das ihm eigentümliche Aroma und die gerühmten und bewährten Eigenschaften. Ein Gastrosoph ißt ihn nie anders, als wenn die Spitze ein bis zwei Zoll bläulichgrün ist; so wird er in Frankreich und in Italien genossen. In diesem Falle kann man freilich nur die Spitze essen, der Rest ist faserig und hart; aber dies spricht eben für den Gourmet, und der Gastrosoph findet es aus einem sicheren Gesichtspunkte gerechtfertigt. Es gehört oft ein großer Apparat der Natur dazu, um dem gebildeten Menschen einen Mundvoll Nahrung zuzuführen.
Spargel und Nachtigallengesang fallen in dieselbe Zeit. Ein Greis, den aber die Gourmandise nicht verlassen hatte, sagte mir, daß der größte Vorzug des Spargels sei, daß er keine Knochen habe, also keiner Zähne zur Verarbeitung bedürfe. Ein großer, sehr reicher Verehrer dieses Gemüses, der sehr viel darauf verwendete, um vortrefflichsten Spargel zu ziehen, fand ein Gericht Spargel an meinem Tische so gut, daß er mich bat, ihm die Quelle anzugeben, wo ich ihn her habe. Der Spargel war aus seinem eigenen Garten und der Gärtner verkaufte, etwas nicht Seltenes, die besten Exemplare für schweres Geld und das ist noch nicht das schlimmste, was von dieser Seite geschehen kann. Wenn aber die edelsten Früchte gekniffen, zerdrückt, gequetscht und zerstoßen vom Gärtner kommen, dann, und dann erst ist es Zeit, dem Unwesen ein Ziel zu setzen.
Die schlechtesten Spargel habe ich in England gegessen, wie denn die Engländer überhaupt keine Freunde von Gemüsen sind, auch sie selten zu bereiten verstehen. Börne erzählt von einer englischen Küche in Paris ganz anmutig und gewiß wahr: »Dann folgten Gemüse, woran, wie an hetruskischen Vasengefäßen, nur die ersten naiven Regeln der Kunst sich aussprachen. Es war nicht sauer, nicht süß, nicht geschmolzen, und drang niemand einen vielleicht unwillkommenen Geschmack auf.«
Rhabarber ist die einzige Pflanze, die in England im großen gebaut und ebenso allgemein gegessen wird. Die saftreichen Blattrippen und Blattstiele werden büschelweise zu Markte gebracht und meist zu Verzierungen aller möglichen Torten verwendet. Man bereitet auch ein vortreffliches Konfekt daraus. Das in neueren Zeiten unter dem Namen von Tartreum so vorzüglich gepriesene Gemüse ist nichts anderes als das Blatt einer Rhabarber-Varietät. Der australische Rhabarber, aus dem man auch einen köstlichen Sirup gewinnt, hat größere Blätter und ist ein Lieblingsgemüse in Ostindien.
Der Halm des Bambus schießt in einer einzigen Regenzeit zu der völligen Höhe, die er erreichen kann, verholzt nur in den folgenden Jahren und treibt Seitenzweige, ohne zu wachsen. Der junge Sprößling ist wie der des Spargels genießbar. Warum läßt man diese Spargelsorte noch nicht von den Philippinen, von Ostindien in hermetisch verschlossenen Blechbüchsen kommen, oder in Essig gelegt als Salat? Von den jungen Sprossen unten am Stamme macht man köstliches Konfekt, Aschiar genannt, womit die Chinesen einen starken Handel treiben; es ist magenstärkend. Der süße Saft, welcher, solange das Rohr jung ist, bei den Knoten von selbst hervorquillt und an der Sonne erhärtet, wird gesammelt und unter dem Namen Tabaschir als Zucker verkauft.
Rettich ist scharf, schwer zu verdauen und hat eine reizende Kraft. Die Radieschen sind eine Spielart davon; sie sind zarter und von angenehmerem Geschmack. Die verschiedenen Rettichsorten oder Monatsrettiche zerfallen in zwei natürliche Abteilungen, deren eine die Radieschen in der Form von runden Rübchen begreift, die andere die langen Monatsrettiche. Die Hauptsorten von diesen sind: die bekannte rosenrote, die weiße, die frühe holländische, der halblange rote von Metz und der Wiener Rettich. Der rosenrote ist unstreitig der beliebteste. Der Meerrettich aber ist etwas ganz anderes. Seine Wurzel ist lang, außen blaßgelb und inwendig weiß; sie hat einen beißenden Geschmack, der vielen angenehm ist. Die Wurzel wird gerieben, mit Essig angemacht und als eine Art Senf auf den Tisch gegeben.
Zwiebeln und Knoblauch sind Völkern sehr nötig, die wenig Fleisch genießen. Die Zwiebel ist eine der wichtigsten Pflanzen unter den Gemüsewurzeln. Sie hat zahlreiche Varietäten; die beste ist wohl die dunkelrote; auch hat die spanische, schwefelgelbliche einen milden Geruch, zartes Fleisch und süßen Geschmack. Die Zwiebel, die aus heißen Ländern gekommen ist, hat bei uns etwas Herbes und wird daher hier meist nur an Ragouts, Saucen und zum Spicken verwendet. In Südeuropa ist sie größer, wird häufig als Gemüse genossen und fast allgemein schmackhaft bereitet.
Bei uns herrscht ein großes Vorurteil gegen die Zwiebel; dies verdient aber nur unsere gewöhnliche Bereitung, nicht die Frucht. Diese kann auch bei uns ein köstliches Gemüse abgeben, wenn sie gut zubereitet wird. Sie wird glaciert genossen. Zu dem Glacé, welches vorzüglich aus der Oberschale des in Burgunder gekochten Schinkens, mit der nötigen Portion Konsommee bereitet wird, setzt man noch hinlänglich Zucker zu. Man kann sich kaum etwas Lieblicheres, Anreizenderes und Gewürzhafteres denken.
Horaz (in dem Epoden, dritte Ode) setzt den Zwiebeln das würdigste Denkmal. Die Ägypter waren die größten Freunde davon. Bei Erbauung der Pyramide des Cheops aßen sie für 1600 Talente (für mehr als zwei Millionen Taler) Zwiebeln. Aber die griechischen und ägyptischen Zwiebeln waren auch so süß, daß sie von den Alten als Leckerbissen betrachtet wurden. Und doch wollte Sokrates, an Xenophons bekanntem Gastmahle teilnehmend, keine auf der Tafel leiden. Er sagte: Wenn einer sich zum Gefecht anschickt, so tut er wohl daran, Zwiebeln zu essen, so wie einige die Hähne mit Knoblauch füttern, um sie zum Kampfe zu ermuntern. Persius, in seinen Satiren, nennt die Zwiebel ein Gericht für Geizhälse:
Und hat er dann die schalenreiche Zwiebel
Mit Salz verschluckt, und sich den Mehlbrei, der
Sonst nur die Sklaven futtert, eingerührt,
Sein Mahl mit zähen Essighefen krönt.
In einem verloren gegangenen Schauspiel verschmäht Herkules dieselben. Er sagt (Athenäus, 2. Buch, 23. Kap.), ob man sie heiß oder kalt oder zwischen beidem essen muß, ist für sie ein wichtigerer Gegenstand der Unterhaltung als die Zerstörung von Troja. Ich bin aber nicht gekommen um die Stengel des Silphium, nicht um jene profanen, bittern Gerichte, nicht um Zwiebeln. Ich esse zuvörderst, um mich zu nähren, dann um mich zu kräftigen, und ich will, daß alles, was ich esse, gesund sei. Ein großes und tüchtiges Stück Rindfleisch, drei gut gebratene Spanferkel usw. – Ein desto größerer Freund von Knoblauch und Zwiebeln war Heinrich IV., dem schon unmittelbar nach der Geburt, nach alter Sitte in Bearn, Knoblauch auf die Lippen gestrichen wurde. Ein Gebrauch, dem seither alle Bourbons folgten. Bei der Geburt des Herzogs von Bordeaux sang, mit Anspielung auf diesen Gebrauch, ein Dichter:
C'est l'ail qui pénétra d'un courage sublime
Le jeune cœur du grand Henri;
Il partage sa gloire, et ce roi magnanime
Dut à l'ail la palme d'Jvry.
On vit l'ail présider à l'heureuse naissance
De son auguste petit-fils.
L'ail aime les Bourbons. L'ail est cher à la France,
L'ail est le compagnon des lis.
Die Botanik ist, wegen der Verwandtschaft beider Geschlechter, hierin mit dem Dichter einverstanden.
Lotos ist ein Gewächs, das mit unserem Klee verwandt ist; es gibt aber auch einen Baum dieses Namens, der kleine, dattelartige, süße Früchte gibt, aus denen man Wein, wie aus den Wurzeln eine Art Brot bereitet. Endlich gibt es auch eine ägyptische Pflanze dieses Namens, eine Art Wasserlilie, die im ganzen Morgenlande sehr bekannt und auch eßbar ist. Schon nach Herodot ist die Wurzel des Lotos eßbar und süß und beinahe so groß wie ein Apfel. Es gibt auch noch in Ägypten andere Wasserlilien; dazu gehört der ägyptische Lotos, den Rosen ähnlich, die im Nil wachsen. Ihre Frucht, die in einem runden Kelche sitzt, hat eine Menge eßbarer Körner, groß wie ein Olivenkern; man ißt sie frisch und getrocknet.
Der Baum, nicht die Wasserlilie, oder das niedrige Gewächs, ist der, von dem die homerischen Lotophagen den Namen haben, eine Völkerschaft an der nordafrikanischen Küste, wo dieser Baum noch gegenwärtig wächst. Nach Homer waren die Früchte dieses Baumes so angenehm, daß man über ihrem Genuß alles vergaß, selbst das Vaterland.
Kräuter geben wenig Nahrung, sind feucht und wässerig. Man ißt sie mit allerlei Gewürzen, Essig, Ingwer, Pfeffer, Salz, um ihren faden Geschmack zu verbessern und ihre Verdauung zu erleichtern. Man muß das Wasser bei ihrer Zubereitung nicht abgießen, weil es den größten Teil ihrer nährenden Substanz enthält. Nach ihrem Genuß soll man kein Bier trinken, welches sie in Gärung setzen würde. Sie kühlen, feuchten an und verdünnen das Blut, erzeugen wenig Galle und befördern den Schlaf. Für hitzige und trockene, für vollblütige und gallige Konstitutionen sind sie eine gute Speise.
Hierunter will ich natürlich nicht die Gewürzkräuter begriffen haben, auf welche das eben Gesagte nicht passen kann; wogegen jene mit Gewürz, als Estragon, Thymian – das unentbehrliche Ingrediens alles getrüffelten Geflügels –, Kresse, Raute usw. genossen werden sollen. Vorzüglich aber mit dem Liebesapfel (Tomate). Dies ist eine Frucht, die wohl unmittelbar aus dem Paradiese zu uns gekommen sein muß, und wenn sie nicht die hesperidischen Äpfel bedeutet, gewiß der Apfel gewesen ist, den Paris der Venus bot, sehr wahrscheinlich auch der, welchen die Schlange zur Verlockung der Eva anwendete. Wer auch nur die Liebesapfel-Sauce nennt, hat alles verständlich gemacht, was über Saucen in letzter entscheidender Instanz zu sagen ist.
Spinat. – Der gewöhnliche und der englische sind die Hauptvarietäten. Die schönsten und reichtragendsten aller Varietäten sind die mit zichorienartigen Blättern, die breit, dick, dunkelgrün sind und oben einen großen, runden Busch bilden. Der Spinat ist eine leicht verdauliche Speise. Man muß ihn im Rocher de Cancale gegessen haben, um seinen Wert schätzen zu lernen, oder wenigstens in Paris oder doch in Frankreich, nur nicht bei uns. Hier ist er kurz, schießt gleich im Samen, und man gibt sich vergebens Mühe, ihn zu verbessern; selbst die Bedeckung mit Töpfen gegen die Nachtfröste hilft eben nicht viel. Der Spinat verträgt keinen hitzigen Boden, keinen Sand.
Artischocken sind in unserem Klima freilich mühsam zu erziehen; sie verlangen, was nicht zu übersehen ist, besonders in der Jugend, täglich ein- oder zweimal mit Wasser begossen zu werden, wenigstens so lange, bis die Setzlinge wieder im Triebe sind. Das Eßbare daran, der sogenannte Stuhl, wird bei uns selten groß, nie vollkommen. Artischocken sind ebenso wohlschmeckend als leicht verdaulich. Man darf sie die Königinnen des Gemüses nennen. Die Cardi sind ein mit ihnen verwandtes Geschlecht, aber vielleicht noch zarterer Natur. In Italien sind sie sehr gewöhnlich; süß, leicht, vortrefflich. Sie wollen aber wenigstens drei Wochen lang gebleicht werden, weil sie sonst sehr leicht faulen.
 Trüffeln müssen, sollen sie gut sein, möglichst rund, wenigstens in Nierenform gestaltet, in der Jugend von außen weißlich, im Innern mit ins Blaue spielenden Flecken versehen, die auch rot oder braun sein dürfen, und überall von Venen durchlaufen sein. Solange die Trüffel jung ist, hat sie den Geschmack von verdorbenen Pflanzen, ist erdig und erhält erst ihren balsamischen Wohlgeschmack bei vollkommener Reife. Dieser hält nur einige Tage an, und wenn die Knolle dem Tode nahe ist, wird ihr Geruch unangenehm, ja später unerträglich. Die weiße Art, die in Italien, und zwar vorzugsweise in Piemont wächst, ist die vorzüglichste; ihre Oberfläche ist grau oder gelblich braun, ihre Venen sind zarter als die der schwarzen Trüffel. Sie ist in Geruch und Geschmack feiner als diese. Die weiße Trüffel behält ihre Farbe immer. Man glaubt, daß sie ein anderes Geschlecht sei als die schwarze. Sie findet sich auch in Weinbergen und auf Feldern, während die schwarze nur im Walde gedeiht. Die Trüffeln wachsen nicht, wie die Pilze, aus der Erde und vertragen weder Luft noch Sonnenschein. Aigrefeuille nannte die Trüffeln gut und schön. Man hat Hunde, sogenannte Trüffelhunde,
die zu ihrer Auffindung dressiert werden, aber der wahre Christoph Kolumbus der Trüffel ist das Schwein: der feine Geruch dieses Tieres eignet es vorzugsweise zur Trüffelaufsuchung. Alle Arten, die Trüffeln aufzubewahren, sei es in Sand, Öl, Essig, Spiritus, verschlossenen Büchsen, hindern nicht die Verflüchtigung ihres balsamischen Aromas. Die feinschmeckenden Römer kannten die Trüffeln; aber sie bezogen sie nicht aus Gallien, sondern aus Griechenland und Afrika; die besten vorzugsweise aus Libyen. Noch vor fünfzig Jahren war eine getrüffelte Pute die höchste Seltenheit auf den Tafeln von Paris.
Trüffeln müssen, sollen sie gut sein, möglichst rund, wenigstens in Nierenform gestaltet, in der Jugend von außen weißlich, im Innern mit ins Blaue spielenden Flecken versehen, die auch rot oder braun sein dürfen, und überall von Venen durchlaufen sein. Solange die Trüffel jung ist, hat sie den Geschmack von verdorbenen Pflanzen, ist erdig und erhält erst ihren balsamischen Wohlgeschmack bei vollkommener Reife. Dieser hält nur einige Tage an, und wenn die Knolle dem Tode nahe ist, wird ihr Geruch unangenehm, ja später unerträglich. Die weiße Art, die in Italien, und zwar vorzugsweise in Piemont wächst, ist die vorzüglichste; ihre Oberfläche ist grau oder gelblich braun, ihre Venen sind zarter als die der schwarzen Trüffel. Sie ist in Geruch und Geschmack feiner als diese. Die weiße Trüffel behält ihre Farbe immer. Man glaubt, daß sie ein anderes Geschlecht sei als die schwarze. Sie findet sich auch in Weinbergen und auf Feldern, während die schwarze nur im Walde gedeiht. Die Trüffeln wachsen nicht, wie die Pilze, aus der Erde und vertragen weder Luft noch Sonnenschein. Aigrefeuille nannte die Trüffeln gut und schön. Man hat Hunde, sogenannte Trüffelhunde,
die zu ihrer Auffindung dressiert werden, aber der wahre Christoph Kolumbus der Trüffel ist das Schwein: der feine Geruch dieses Tieres eignet es vorzugsweise zur Trüffelaufsuchung. Alle Arten, die Trüffeln aufzubewahren, sei es in Sand, Öl, Essig, Spiritus, verschlossenen Büchsen, hindern nicht die Verflüchtigung ihres balsamischen Aromas. Die feinschmeckenden Römer kannten die Trüffeln; aber sie bezogen sie nicht aus Gallien, sondern aus Griechenland und Afrika; die besten vorzugsweise aus Libyen. Noch vor fünfzig Jahren war eine getrüffelte Pute die höchste Seltenheit auf den Tafeln von Paris.
Es gibt einen Brief des heiligen Ambrosius an einen Bischof von Como – die Berge dieser Stadt waren von jeher wegen ihrer Trüffeln berühmt –, worin er seinem Kollegen für ein so delikates Geschenk dankt: Misisti mihi tubera et quidem mirae magnitudinis.
Die Trüffeln erzeugen sich am schnellsten im starken Sommerregen, bei Sturm, nach starken Gewittern; sind aber erst nach dem ersten Frost recht schmackhaft; man muß es daher den Unwissenden überlassen, sie frühzeitig zu genießen. Von der Verdauung der Trüffeln schweige ich, aber gewiß ist nichts wohlschmeckender als eine getrüffelte Gänseleberpastete; sie erinnert an das berühmte Wort des »Almanach des Gourmands«: so zubereitet – wer würde da nicht seinen leiblichen Vater verspeisen. Dies Gericht hat unstreitig mehr Gourmands getötet als die Pest. Jedermann weiß das, sieht aber dennoch den Trüffeln mit Sehnsucht entgegen und ißt sie mit Delice, ohne an ihre Verdauung zu denken. Und dennoch ist es wahr, daß es viel mehr vergnügte Herzen geben würde, wenn es bessere Magen in der Welt gäbe.
Trüffeln und Austern, sagte mir ein berühmter Philosoph, schmeckten deshalb so gut, weil sie auf der letzten Grenze beider Naturreiche stehen. Trüffeln auf der letzten Stufe der Vegetabilien zum Übergang in das Mineralreich, und Austern als Übergang der Mineralien zu den Animalien. Ich bemerkte, daß nach diesem Grundsatze auch wohl Fledermäuse gut sein müßten. Das sind sie auch, belehrte er mich, und die Römer mästeten sie, wie sehr bekannt ist. Man findet in den Ausgrabungen von Herculanum Glycerias eine Art irdene Käfige, worin diese Tiere gemästet wurden.

Champignons, Pilze. – Die ersteren sind die Seele der Saucen, das innerste Leben der Kochkunst. Der Kaiser Nero, der eine sehr feine Zunge, aber den schlechtesten Magen in der Welt hatte, nannte Pilze die Speise der Götter. Das sicherste Mittel, sich vor vergifteten Pilzen zu bewahren, ist: sich genau an die Regeln der Wissenschaft zu halten. Frau und Kinder des Euripides starben an vergifteten Pilzen, wie der Kaiser Claudius, der Papst Clemens VIII. und König Karl VI. von Frankreich.
Obst. – Die Bestandteile des Obstes sind vor allem Wasser (71 bis 90 Prozent), Erde, Salz und ein öliges Wesen, ferner enthalten die Birnen 11, die Aprikosen 12, die Pfirsiche 16, die Kirschen 18 Prozent eines leicht verdaulichen, gesunden, mit etwas Gummi und Eiweiß verbundenen Zuckers. Der Saft der reifen Weinbeere enthält am meisten Zucker, in guten Jahrgängen 30 bis 40 Prozent, und hierbei noch Gummi, Kalk, Kali, Äpfel- und Weinsäure, vor allem aber das zum Ferment der künftigen Weingärung dienende Pflanzeneiweiß. Die süßen Mandeln enthalten 54 Prozent eines milden Öles, verbunden mit vielem Eiweiß. Dies sind nur die einzelnen Linien, worin sich neben der vielseitigen Verwandtschaft und Beziehung des menschlichen Verdauungsvermögens auf das Pflanzenreich aller Zonen und aller Formen zugleich das angeborene Eigentums- und Herrschaftsrecht unseres Geschlechts über die ganze Vegetation andeutet.
Obst ist desto schmackhafter, je größer die Quantität des Wassers in seiner Mischung ist; desto süßer, je mehr darin brennbares Wesen enthalten ist, welches sein Salz, das sauer ist, einwickelt. Das ölige Wesen entbindet sich zuletzt im Obst, verbindet sich durch die Einwirkung der Sonne innig mit der zarten salzigen Erde, gibt ihm seine angenehme Süßigkeit, seinen eigentümlichen Geschmack und seine nährende Kraft. Es ist ein kostbares Geschenk für die Jahreszeit, worin es reif wird. Kurz vor, oder gar nach Tische soll man kein Obst essen, weil es die Verdauungssäfte verdünnt, den Magen schwächt und seiner Wärme beraubt. Die blähende Natur des Obstes ist aber um so weniger einem Zweifel unterworfen, weil Hales gefunden hat, daß ein Apfel einen Raum voll Luft enthält, der bei einem doppelten Druck des Luftkreises 480mal größer ist als der Apfel. Gekochte Äpfel sind eine sehr leichte Speise, und zwar eine solche, sagt Zimmermann, mit welcher ich, mit Brot und Wasser, ohne Melancholie leben zu können hoffte, wenn ich so zu leben wünschte. Man glaubt fast überall, daß das Obst die Ursache der Ruhr sei, obgleich von allen wahren Ärzten bewiesen worden, daß dieser Glaube grundfalsch ist. Die Ursachen der Ruhr liegen meist in der Luft, die erst heiß war und bald darauf kalt wurde. Sie herrscht sehr oft in der Jahreszeit, in welcher die Obstfrüchte erst in der Blüte sind. Das Obst kommt in große Städte meist durch den Wassertransport; dadurch verliert es sein bestes Aroma. Wird aber das so versendete Obst in Mahagonispäne gepackt, so soll der Wassertransport ihm nichts anhaben. Will man Obst lange aufbewahren, so geschieht dies am zweckmäßigsten dadurch, daß man in ein Gefäß eine Schicht gelöschten und fein gesiebten Kalk tut, eine Lage Obst darauf legt und über diese wieder eine Kalklage, und so fort, bis das Gefäß voll ist, worauf es sorgfältig verschlossen und an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahrt wird. An dem vortrefflichen holländischen Obst, welches oft auf dem elendesten Sandboden gewonnen wird, sieht man, was Industrie vermag. Ein einziger holländischer Obstgärtner lieferte aus seinen eigenen Gärten für 100 000 Gulden Obst nach Reims bei Gelegenheit der Krönung Karls X., und man fand es schmackhafter als die sonst mit Recht so berühmten Obstsorten von Montreuil.

Feigen sind, frisch genossen, sehr gesund, nahrhaft und leicht verdaulich, besonders wenn man Wasser darauf trinkt. In den königlichen Gärten von Kew bei London steht ein Gewächshaus, welches nur zur Feigentreiberei bestimmt ist. Das Wesentlichste in den Treibhäusern ist: den Feigen anhaltend die Temperatur zu geben, der sie in ihrer Heimat unterworfen sind. Bei der Beobachtung dieses Grundsatzes kann man auf zwei Ernten im Jahre rechnen, eine im Frühling, die andere im Herbst. Die weiße und die kleine Marseiller Feige sind sehr beliebt. Die Feige ist die wahre Poesie des Obstes. Es ist eine Verleumdung, daß ihr Genuß den Magen erkältet: im Norden von Deutschland vielleicht; aber dann nur, weil sie da nicht reif oder ihr Zuckergehalt von der Sonnenwärme nicht genug entwickelt worden ist. Wer einmal die kleine griechische Feige, auch in Oberitalien einheimisch, genossen hat, kann den Enthusiasmus begreifen, welchen die feinzüngigen Athener für die Feigen hatten. Die besten getrockneten Feigen kommen aus der Gegend von Bari in Kalabrien. Man bringt sie zum Trocknen unter gläserne Glocken, damit die Luft nicht ihre besten Kräfte raube, nachdem man vorher die Haut abgezogen hat. Es ist nicht möglich, ein vortrefflicheres trockenes Obst zu gewinnen, als das auf diese Weise bereitete.
Melonen sind anerkannt eine der vortrefflichsten Gartenfrüchte, überall verbreitet, in einer Unzahl von Varietäten vermehrt. Die Melone mit weißem Fleisch ist sehr saftreich und gewürzig, auch leicht zu kultivieren. Von den Canteloupen ist die orangenfarbige, kleine, runde, sowie die später kommende, mit kleinen Knoten und markierten Rippen zu empfehlen, wie von den glatten, mit dünner Schale, die Malteser und nordamerikanische, grün und benetzt, von Geschmack sehr fein und saftreich.
Melonen gehören, nach Mercier, zu den sehr wenigen Gegenständen, die man, selbst in Paris, anständigerweise öffentlich nach Hause tragen kann, weil die vortrefflichen so selten sind, daß man sich, wo man sie findet, sogleich in ihren Besitz setzen muß. Ein großer Verehrer der Melonen hat gefunden, daß Homer in seinen beiden großen Werken nur viermal dieselben erwähnt, während Knoblauch 130mal genannt wird; auch Plinius scheint sich nicht viel daraus zu machen. Spätere römische Schriftsteller erwähnen dieselben gar nicht, selbst Tacitus nicht, als er von den mannigfaltigen Speisen des Vitellius spricht. Erst Palladius, der im fünften Jahrhundert lebte, spricht von ihrer Kultur; seine Vorschläge sollten versucht werden. Er sagt, daß die Melonen sehr aromatisch würden, wenn man zwischen die Samenkörner trockene Rosenblätter streue. Karl VIII. brachte die Melonen aus seinem italienischen Feldzuge mit nach Frankreich. Man glaubt, daß der Name Canteloup von einer Villa der Päpste unfern Rom komme, die Canteloup hieß. – Wenn die Melonenverkäufer die abgeschnittene Frucht der Sonne ausgesetzt haben, muß sie mehrere Stunden lang in möglichst kaltes Wasser gelegt werden. Auch muß man wohl achtgeben, daß der Stiel daran bleibe. Eine Melone ohne Stiel ist eine beschädigte Frucht. Eine gute Melone muß, wenn sie nicht sanft hingelegt wird, einen dumpfen Ton, aber ohne Echo, von sich geben: drückt sie sich leicht ein, so ist sie überreif und daher wenig saftig; gibt sie dem Druck nicht nach, so ist sie noch nicht vollkommen gereift. Gut ist sie, wenn sie dem sanften Drucke des Fingers nachgibt, aber, davon befreit, sofort die alte Form wieder gewinnt. Man sagt Melonen nach, daß sie schwer verdaulich sind, und sie sind es in der Tat für einen vollen Magen, dem aber überhaupt gar kein Obst zuträglich ist. Am besten bekommt die Melone, wenn der Magen leer ist. Pfeffer, nicht Zucker, sollte dazu gegessen, ein feuriges Glas Wein danach getrunken werden: unter diesen Voraussetzungen ist die Melone ein leicht verdauliches Obst.
Gurken. – Die weißen von Boneuil sind die besten, wie die kleinen, grünen (Cornichons) die geeignetsten zum Einmachen. Man ißt die Gurken vor ihrer völligen Reife: sie kühlen das Blut und sind deshalb bei großer Hitze am zuträglichsten. Vor fünfzig Jahren preßte man sie aus, um den Saft (die gemeine Gurke enthält nicht weniger als 97 Prozent Wasser), den man für schädlich hielt, wegzuschaffen; später wurde dieser, als das Beste der Gurke, getrunken; jetzt ist man zur Natur zurückgekehrt.
Chate, ein ägyptisches Gewächs, das einige den Melonen, andere den Gurken beizählen, wird von Hasselquist die Königin der Gurken genannt; sein Fleisch kommt der Melone sehr nahe und ist ein angenehmes durststillendes Mittel.
Kirschen dämpfen die Hitze. Die gesundesten sind die schwarzen, sauren.
Erdbeeren bilden sechs verschiedene Rassen, von denen drei europäischen und drei amerikanischen Ursprungs sind. Die ersten haben meist gelbliche Blätter und runde Früchte, die letzteren sind bedeutend größer als jene.
Birnen. – Die saftreichen Weinbirnen sind leicht verdaulich, doch weniger nahrhaft als die mehligen. In Indien gibt es Weinbirnen, die sehr saftig, von gutem Geschmack und ohne Steine sind.
Äpfel. – Unter ihnen sind die süßesten nicht gerade die besten, sondern die süßsäuerlichen. Der beste Apfel ist nicht der Borsdorfer, der zu trocken ist, und ebendeshalb so weit ausgeführt werden kann. Der beste Apfel ist unstreitig der Rosmarin im Bozener Tale, der bei uns der italienische genannt wird. Er ist auch feinfleischiger als der Borsdorfer und so aromatisch, daß er eine Stube parfümiert; sein Saft erinnert sehr an den der Ananas.
Der Liebesapfel (Solanum Lycopersicon). – Der große, rote und tiefgefurchte ist der beste. Der Liebesapfel ist in Mexiko einheimisch, bei uns sehr selten, weil er gegen den Frost sehr empfindlich ist. In Italien bilden die Tomaten, mit Zwiebeln in Öl eingemacht, ein Nahrungsmittel für das gemeine Volk.
Pflaumen sind in voller Reife von angenehmer Süßigkeit. Von allen Arten der Pflaumen verdient die Reineclaude (in der ersten Revolution Citoyenne-Claude umgetauft) wegen ihrer Größe und Süße, sowie um ihres trefflichen Geschmacks willen den ersten Rang.
Weintrauben werden bei uns nicht immer reif, jedenfalls tut man gut, weder Schale noch Kerne mitzuessen. Die spanischen, die zu uns kommen, werden unreif abgepflückt; daher die Schalen doppelt ungesund sind. Um sie aufzubewahren, schneidet man die trockene, d.h. mit keinem Regen oder Tau benäßte Weintraube sorgfältig ab, damit keine Beere zerdrückt werde; aber erst nach ihrer vollen Reife. Natürlich bei trockenem Wetter. Die abgeschnittene Stelle des Stiels wird in flüssiges Wachs getaucht und die Trauben in trockenen, luftigen Stuben, die nie mehr als sieben, nie weniger als einen Grad Wärme haben, aufbewahrt, was alles sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Auf diese Weise habe ich sie bis Mai so gut, als wären sie frisch, bewahrt, und auch nur im Juni keine mehr gehabt, weil sie schon immer früher aufgegessen waren.
In Kaschmir gibt es eine andere Aufbewahrungsart der Trauben, welche Baron Hügel für die zweckmäßigste hält. Es werden zwei oder drei Trauben in einen irdenen, unglasierten, tiefen Teller getan, der mit einem andern bedeckt ist, die Ränder beider werden mit Gips oder Kalk verkittet. Diese Doppelteller werden an einen trockenen Platz gestellt und erhalten durch das Einsaugen der Feuchtigkeit, die im Innern entsteht, den Inhalt bis in den nächsten Sommer frisch. Es gehört zu den Höflichkeitsbezeigungen, welche man in Kaschmir den Fremden erzeigt, ihnen ein Dutzend solcher Teller mit frischen Trauben zu senden.
Apfelsinen. – Nicht die größten, sondern die schwersten sind die besten. Die von der Insel Malta und die dünnschaligen Genueser verdienen vor allen anderen den Vorzug.
Die Ananas hat ein festes Fleisch, welches einen angenehmen säuerlichen Zuckersaft enthält, worin sich Wohlgeschmack und Aroma von Erdbeeren, Himbeeren, Pfirsichen und aller unserer edelsten Früchte vereinigen. In Amerika, ihrem Vaterlande, werden sie bis zwölf Pfund schwer und rechtfertigen ihren Namen als Königin der tropischen Gewächse vollkommen. Hier zieht man auch einen Likör daraus, der dem Malvasierwein gleicht. Man zählt jetzt mehr als sechzig Ananasarten. Die gewöhnliche Ananas ist zur Bereitung des Gefrorenen von großem Werte. Die violette von Jamaika und die Cayenne sind die vorzüglichsten. Die Ananas verlangen zu ihrer Kultur viel Hitze und werden bei uns in den sogenannten Ananashäusern gezogen, wobei zu bemerken ist, daß sie im Sommer sehr viel, im Winter aber gar keiner Nässe bedürfen, besonders muß man die Herzen der Pflanze vor aller Nässe bewahren. Soviel ich weiß, ist im Altertume nirgends von Ananas die Rede, obgleich dieselbe ebensogut im heißen Asien als in Afrika zu Hause ist. Die Spanier brachten sie zuerst aus Mexiko, und doch grub man im Jahre 1809 in Pompeji ein Haus auf, welches zum Wahrzeichen eine Schlange hatte, die in eine Frucht biß, welche einer Ananas ähnelt. Dies Haus, in dem man sehr viele chemische Präparate fand, ward für eine Apotheke erkannt. Die Altertumsforscher sehen aber nicht immer das Nächstliegende, und lieben oft phantastischen Hypothesen nachzugehen. Diese sogenannte Ananas war nach meinem Dafürhalten nichts als ein Pinienapfel, der in dem Kunstwerke eines Töpfers einer Ananas gleicht, wenn diese ein heutiger Töpfer nachbildet, und wie sie ein pompejanischer auch gemacht haben würde, wenn er – eine gekannt hätte.
Auf Banda läßt man die zerschnittenen Ananasfrüchte eine Viertelstunde im Wasser liegen, ehe man sie mit Wein genießt. Man hat jetzt in Deutschland eingemachte Ananas aus Mexiko, die vortrefflich sind.
Nüsse haben ein fettes Öl, versüßen das Blut und wickeln die Schärfe der Säfte in ihren milden Schleim ein. Die größten Walnußbäume in Europa sind in Interlaken in der Schweiz; es gibt deren, die drei Männer nicht umspannen können.
In Kaschmir wächst im Wullersee, und nur in diesem, eine Wasserkastanie, Singhara genannt. Von dieser Pflanze werden jährlich 600 000 Zentner gefischt, und die Bewohner der Gegend leben einzig von dieser in der Sonne getrockneten oder gerösteten Wurzel und können dann nichts anderes mehr genießen, ohne krank zu werden. Frisch schmeckt die Frucht wie eine gesottene Artischocke. Das Blancmanger ist aber sehr schal. Nüsse, Äpfel und Birnen gibt es überhaupt in solchem Überfluß in Kaschmir, daß man diese Früchte, sorgfältig in Birkenrinde verpackt, durch Kolonnen von zweihundert Trägern versendet.
Gewürz hat einen hervorstechenden Geschmack und arzneihafte Kraft. Man würzt Speisen, um sie vor Verderbnis zu schützen oder sie schmackhafter oder verdaulicher zu machen.
Zucker. Ob man den Zucker im hohen Altertume gekannt, ist zu bezweifeln, weil das Wort Saccharum in den lateinischen Übersetzungen der Bibel nur in einer Stelle vorkommt, welche man obendrein für unecht hält (im 5. Kapitel des Hohen Liedes). Das eigentliche Wort Zucker kommt erst im Plinius vor. Die Römer, sagt er, haben zwar den Zucker im glücklichen Arabien kennen gelernt, aber der indische ist vorzüglicher. Lukanus spricht in seiner Beschreibung Indiens vom Zucker. Auf eine fünffache Weise haben sie den süßen Saft des Rohres genossen, und Statius beschreibt im Buch von den Festen der Dezembersaturnalien unter den Speisen, welche der Kaiser Domitian unter das Volk werfen ließ, auch diejenige Speise, welche man aus dem ebosischen Rohre heraussiedet. Eborien ist aber eine Provinz des glücklichen Arabien und jene Speise keine andere als Zucker. Dioskorides (in seiner Naturgeschichte) spricht noch sehr unschuldig vom Zucker, indem er sagt: Sie nennen Zucker jenen Honig, welcher sich, ohne Bienen, im Rohre erzeugt. Strabo sagt: Sie bereiten jenen Honig ohne Bienen, welcher eingedickt dem Salze ähnlich sieht. Arrian (in seiner »Umschiffung des Roten Meeres«) erwähnt auch des Saftes, der aus dem Rohre fließt und eingedickt wird, und Seneca spricht sogar von dem Gebrauch des gebrannten Zuckers nach den Speisen bei den Indern und meint, daß sich die Inder dadurch die Zähne verderben.
So dienlich, auflösend und mildernd nach Galenus Wasser und Zucker ist, so Schleim, Säuren und Hitze erregend, sagt er, sei Wasser und Honig – ein zu seiner Zeit beliebtes Getränk, und während jenes ein wohltätiges Getränk sei, sei dieses schädlich und gefährlich. Also kannten die Alten den Gebrauch des Zuckerwassers, was so lange bei uns außer Gebrauch war, bis es im Beginn der französischen Revolution die ersten Emigranten zum Modegetränk der höheren Stände, besonders unter den Damen machten; es hat damals die Bierkonsumtion bedeutend verringert.
Wir finden ferner, daß der Herr von allen ihm darzubringenden Gaben sich den Honig und Sauerteig verbeten habe (3. Moses, 2. Kap., 11. Vers). Dem Herrn, sagt der heilige Thomas, seien von jeher alle Gärungen ein Greuel gewesen; denn, wie sich bei körperlichen Dingen durch Gärung der Stoff aufbläht und gewaltsame Risse in demselben entstehen, überhaupt Gärung beginnende Fäulnis oder Zerstörung ist: geradeso auch habe sich im ruhigen Leben durch die Gärung gefallener Engel das Zerfallen der Welt, die Sünde, erzeugt. Deshalb ist der Honig, welcher das beste Gärungsmittel, vor dem Herrn verhaßt. Der Ausdruck ein gärender, aufgeblähter Pharisäer kommt nicht selten in der Schrift vor; aber auch bei neueren Schriftstellern finden wir den Sauerteig oder das Ferment als Sinnbild der Aufgeblasenheit und der Leidenschaftlichkeit. So Plautus in der Mercatrix: Nam mea uxor propter illam tota in fermento jacet – meine Frau hat sich in eine ihrer Gärungen begeben. – Ebenso Juvenal:
– – – Accipe, et istud
Fermentum tibi habe! –
Faß' es auf, und es wird als Gärungsstoff in dir wirken. – Aus den »Römischen Fragen« Plutarchs erhellt, daß den Priestern des Jupiter, welche man Flamines Diales nannte, verboten war, Gärungsstoff zu ihren Opfern zu tun, da alles Gärende als ein in Verderbnis begriffener Stoff betrachtet wurde. Philon (in seinem Buche von den Opfern) glaubt, daß deshalb der Honig bei den Opfern der Hebräer verboten gewesen sei, weil er von den Bienen (Apis) bereitet werde, und der Apisdienst als Greuel verboten war. Es scheint überhaupt, daß die Alten den männlichen Göttern auch nur den Männern würdige Speise dargebracht und das Süße, welches den Frauen überlassen blieb, davon ausgeschlossen hatten. So ist's, nach Martial, den Männern Schande, in ihren Wein Honig zu mischen, nicht aber den Frauen, wie man aus seinem Epigramme ersehen kann, wo ein weibliches Tischgetränk von Wein, Honig, Narden und Zimmet vorkommt, was nicht schlecht sein kann. Das Judentum, welches sich allenthalben als männlich aussprechen wollte, artete in Härte und Roheit aus, während der milde Geist des Christentums den Honig wieder zugelassen hat. So lesen wir in den Akten der heiligen Susanne, daß sogar ein Papst sowohl Taufe als letzte Ölung mit Honig verrichtete.
Bei den Alten war der Honig vom Hymettus berühmt; er taugt gegenwärtig wenig, unbezweifelt wegen der geringen Kultur der Gegend. Der beste soll jetzt der aus Anatolien sein; er ist weiß wie die Baumwolle, von deren Blüten die Bienen ihn bereiten, und sehr fest.
Man glaubt allgemein, daß der Zucker viel Schleim mache und das Blut verdicke, da doch schon Boerhave gezeigt hat, daß er eine sehr große, auflösende Kraft hat, den Schleim schmelzt, verdünnt und zerteilt. Aber er sagt, er löse zu sehr auf und schwäche; daher Fracassini ihn unter die entfernten Ursachen der Hypochondrie zählt. Linné sagt: Leute, die Zucker in ihre Speisen tun, seien recht alt geworden.
Manna ist ein aus dem hebräischen Worte Man entlehntes Wort, welches verschiedene vegetabilische Süßigkeiten bezeichnet, die aus den Rinden gewisser Bäume und Stauden dringen. Das älteste Manna dieser Art ist dasjenige, womit sich die Israeliten in der Wüste erhielten, und welches in der deutschen Bibel auch Man genannt wird. »Am Morgen lag der Tau um das Heer her. Und als der Tau weg war, siehe da lag es in der Wüste rund und klein, wie ein Reif auf dem Lande. Und da es die Kinder Israel sahen, sprachen sie unter sich: Das ist Man; denn sie wußten nicht, was es war« (2. Moses, 16. Kap., 13. Vers). Michaelis sagt: Dies sahen die Israeliten, und sagten einer zum andern in ihrer Sprache: Man hu, d. h. was ist das? weil sie nicht wußten, was es war.
Aus Niebuhrs »Reisebeschreibung von Arabien« erhellt, daß noch jetzt in vielen Gegenden des Morgenlandes aus den Blättern der Eichbäume und gewisser stachliger Sträuche, welche die Araber Gul und Algul nennen, Manna schwitze, welches im Monat Juli und August häufig gesammelt und dem von Moses beschriebenen Manna ähnlich ist. Nach anderen Schriftstellern ist Manna ein dem Honig ähnlicher Tau, den schon Celsus den Tau von Soria in Arabien nennt, Galenus nennt ihn Lufthonig und Suidas Waldhonig. Galenus sagt, daß man viel davon auf dem Libanon sammle, und Josephus (im Buch von dem »Altertum des jüdischen Volks«) sagt, daß zu seinen Zeiten noch welcher gefallen sei. In Kalabrien sammelt man ihn noch, und schon Dioskorides (in seiner Naturgeschichte) spricht von der Vorzüglichkeit des kalabresischen Manna. Es ist freilich zweifelhaft, ob dieses das Manna der Juden ist, obgleich Franziskus Valesius (in seinem Buche über Meteore) ihn zu den Dingen zählt, welche aus der Luft fallen, und Levinias Lemnios (in seinem Buche von den biblischen Kräutern) ihn eine Moosgattung nennt. Im Jahre 828 fiel Manna in der Gascogne, eine Erscheinung, die sich auf derselben Stelle im siebzehnten Jahrhunderte wiederholte.
Pfeffer erhitzt nicht so sehr als Zimt und Gewürznelken, wenn er nicht etwa pulverisiert aufgetragen wird, was oft der Fall und das sicherste Kennzeichen einer schlechten Küche ist. Solches Pulver setzt sich so fest an die Kehle als an die Eingeweide und kann, besonders bei starken, vollblütigen Personen, Entzündungen hervorrufen. Der Pfeffer darf nur grob gestoßen sein, dann allein dient er zur Verdauung.
Gewürznelken sind sehr hitzig, der Ingwer ist scharf und beißend. Im Erzstift Köln wurde bei Gelegenheit des Ingwers der gute Rat erteilt: »Doch sehen wir für nützlicher und besser an, daß sich unsere Untertanen mit dem Gewürze ihrer Gärten begnügen.«