
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die stärkste und größte Menschenrasse,
die ich auf der Erde angetroffen
habe, sind die Kolonisten
am Kap, auch habe ich noch keine
Nation kennen gelernt, die mehr
Fleisch genießt.
Le Vaillant
Rindfleisch. – »Mir ist (heißt es im Shakespeare), als hätte ich manchmal nicht mehr Witz, als ein Christensohn oder ein gewöhnlicher Mensch hat. Aber ich bin ein großer Rindfleischesser und ich glaube, das tut meinem Witz Schaden.« – Mein Großvater, ein General Friedrichs des Großen, der aber sicherlich den Shakespeare nicht gelesen hatte, pflegte zu sagen: Viel Rindfleisch essen macht grobe Gebärden.
Rindfleisch ist ein unerschöpflicher Quell in der Hand des geschickten Kochs. Das Rindfleisch ist der König der Küche, die immer frische Quelle für Entrées und Hors-d'œuvres: unzählige Vorteile sind ohne dasselbe gar nicht möglich. Ohne Rindfleisch keine klassische Suppe und Sauce; ohne dasselbe kein vollkommenes Mahl. Freilich wird man bei einem mittelmäßigen Kulturzustande kein gutes Rindfleisch erzielen. Eine Kuh, die nicht mehr kalbt, und ein Ochs, der nicht mehr im Pfluge taugt, können, wenn auch möglichst gut gemästet, keine Zierde der Tafel sein. Dreijähriges Vieh, das nie viel Arbeit getan, von zarter Jugend an nur der Bestimmung des Gegessenwerdens planmäßig folgte, gehört auf eine gute Tafel. Es ist aber unmöglich, gutes Rindfleisch zu erhalten, solange man, wie bei uns, in allen kleinen und mittleren, selbst in vielen großen Städten für dasselbe nur einerlei Preis hat. In England, Frankreich ist das für die herrschaftliche Tafel bestimmte Fleisch überall teurer als alles andere. Ich habe mich bei uns in vielen Städten vergebens bemüht, für höheren Preis allemal das beste Fleisch zu bekommen. Das fast allgemeine Vorurteil der Fleischer sträubt sich gegen eine Einrichtung, aus welcher sie namhaften Nutzen ziehen könnten. Sie behaupten, sich ihre Kunden dadurch zu verjagen. Das dümmste Apfelweib ist klüger; denn sie sortiert den ganzen Tag und bestimmt danach ihre Preise. In den meisten großen Städten Deutschlands kosten freilich die besten Teile des Rindes, z. B. das Filet, mehr und sind außer den Taxen. Oder wenn die pedantische Marktpolizei diese streng aufrecht erhalten will, wird sie auf eine andere Weise umgangen. Das Filet wird z. B. in Dresden so herausgehauen, daß es mit allen daran hängenden Knochen, Flechsen und Fetteilen dreimal soviel wiegt als das eigentliche Filet, welches auf die Tafel kommt, schwer ist. In Berlin kann man Fleisch zu jedem Preise bekommen.

Beefsteak kennt man (nach J. G. Kohl) in Deutschland gar nicht. Man hat, sagt er, in Hamburg ausgenommen, weder das Fleisch dazu, noch kennt man die Art, es zu schneiden und zu bereiten. Es muß fett sein, keine andere Sauce als Butter haben, schnell am großen Feuer bereitet, blutig, saftig und tendre zugleich sein. Es darf gebunden werden, damit die Jus konzentriert bleibt; aber dies Binden muß mit großer Vorsicht geschehen. Der Engländer nimmt dazu entweder ein Lendenstück, oder ein aus dem Schenkel in senkrechter Richtung auf den Knochen, auf beiden Flächen soviel als möglich parallel geschnittenes Stück von nicht weniger als 3/4 Zoll Dicke, salzt es auf beiden Seiten gehörig ein, bestreut es alsdann mit grobgestoßenem, nicht bis zu Sand zerstoßenem Pfeffer und legt es auf einen möglichst heißen Rost, unter welchem sich eine Holzglut, oder besser, ein starkes, aber nicht flammendes Steinkohlenfeuer befindet. Die Ursache, warum der Rost vorher heiß sein muß, ist, daß das Blut nur an den äußersten Flächen gerinne, das Innere aber vollkommen saftig bleibe. Wird aber das Fleisch auf einen kalten Rost gebracht, so wird es während der ersten Sekunden langsam geschmort; denn es absorbieren die Eisenstäbe, als dessen Wärmeleiter, anfangs eine sehr bedeutende Menge Wärmestoff, ehe sie diesen als Leiter dem Fleische zuführen, und so wird das Steak gewöhnlich zähe und geschmacklos. Auch wird es durch diese unmenschliche Behandlung buchstäblich gebrandmarkt und trägt sodann den unverkennbaren Stempel der Barbarei des Kochs.
In England hat man auch nicht, wie bei uns, die alberne Gewohnheit, die Ochsen in kleine Stückchen zu zerfetzen, um den jedesmaligen Verbrauch den Bedürfnissen der kleinsten Familien anzupassen, die davon nichts als ausgekochte oder verbrannte Tierfasern zu essen bekommen, sondern man bereitet ein großes Stück von 20, sogar bis 80 Pfund auf einmal, und es ist dann das am Spieße gebratene oder in großen Dampfkesseln nicht zur Suppe ausgekochte Fleisch natürlich schmackhafter und saftiger als jedes ähnliche Gericht auf dem Kontinent. Zwar wird dieser Braten, wenn er nicht in einer Mahlzeit aufgezehrt wird, den folgenden Tag kalt aufgetragen; aber es ist doch gewiß besser, daß man einen guten Braten kalt, als einen schlechten heiß und verbrannt genieße. Freilich bin auch ich dieser Meinung, denn mein alter Spruch:
Gut gemeint und schlecht geraten,
Das ist ein verbrannter Braten,
gilt denn doch hier wie überall – aber gegen die obige Beefsteak-Theorie muß ich großenteils ankämpfen.
Vor allen Dingen taugt die Pfefferwürzung den Teufel nichts, und ist höchstens für einen überreizten oder einen Matrosenmagen, für Rum- und Portwein-Trinker, und für ein Nebelland, wo man der schweren Verdauung zu Hilfe kommen muß. Das Beefsteak wird nur von Filet und nicht von der grobfaserigen Lende geschnitten; dies ist ein arger Schnitzer. Steinkohlenfeuer ist bei den ungeheuern Holzpreisen in England zu entschuldigen. Gebildete Leute des Kontinents nehmen dazu Koks, und Menschen von feinem Geschmacke Holzkohlen. Man darf überhaupt im allgemeinen wohl das Material der Engländer zu Fleisch- und Fischspeisen obenan stellen und zum Beispiel annehmen, aber durchaus nicht die Zubereitungsweise. Diese ist für alle mit Sprit zu einem Likör gesteigerten feurigen Weine für die Verdauung das, was uns ein Glas Wasser bei Tische. Man sehe, was eine englische zierige Dame bei Tische in der Regel in Madeira und Claret vertilgt, und erstaune.
Es ist auch unrichtig, daß bei uns überall das Material zu gutem Beefsteak fehlt: jeder Fleischer schneidet es selbst in den Landstädten aus dem Filet, und da in keiner nur einigermaßen ordentlichen Küche ein Rost fehlt, der mit Unrecht gerühmten Beefsteakmaschine von Blech nicht zu gedenken, die jeder Klempner macht, so kann sich jeder verständige und geschmackvolle Mensch ein Beefsteak bereiten. Das Fleisch findet sich in den größeren Städten Deutschlands von ganz guter, in einigen, wie Berlin, Wien, Dresden, Frankfurt, München, Augsburg, Stuttgart, Hamburg usw. von bester Qualität. Die Engländer klagen freilich, aus falschem Patriotismus, wenigstens oft mit Unrecht über schlechtes und schlecht bereitetes Fleisch auf dem Kontinente; auch kennen sie oft nur das aus Gasthäusern. Es gibt, sagt Lord Byron, in ganz Italien kein Stück Rindvieh, was einen Fluch wert ist, wenn nicht jemand einen ganzen Ochsen samt seiner Haut an der Sonne getrocknet essen kann. Die Franzosen necken zwar überall die Engländer wegen ihrer Vorliebe für schwere Massen, wie für Beefsteak, haben aber freilich nichts, was dem nahe kommt. Voltaire sagt:
Sur les Anglais il étendit ses soins,
Selon leurs goûts, leurs mœurs et leurs besoins.
Un gros rostbif que le beurre assaisonne,
Des plumpuddings, des vins de la Garonne
Leur sont offerts; et les mets plus exquis,
Les ragoûts fins dont le jus pique et flatte,
Et les perdrix à jambes d'écarlate,
Sont pour le Roi – – –
Die Säugetiere, welche dem Menschen am nächsten stehen, liefern ihm offenbar die passendste Nahrung; unter ihnen wieder vorzugsweise die pflanzenfressenden, besonders die Wiederkäuerfamilien. Daher ist Rindfleisch eine leicht verdauliche Speise; nächst ihm Schöpsen- und zuletzt Schweinefleisch. Letzteres steht schon auf einer niederen Stufe der Entwicklung; Faserstoff und Cruor sind in ihm weniger ausgebildet, es ist dichter, fettreicher.
Ein junger, aus der Weide geschlachteter Ochse gibt zwar eine gesunde, subtilisierte, dauerhafte Nahrung; aber es gehört auch ein starker Magen dazu, der sie, bei hinlänglicher Leibesbewegung, bald verdaut. Schwachen Magen freilich macht ein so kräftiges Nutriment leicht Beschwerde. Gebraten ist Rindfleisch am besten; frisch gesalzen hat es überdies noch eine reizende und auflösende Kraft. Da das Rindvieh gewöhnlich auf der linken Seite liegt und schläft, so sind (nach Buffon) die Lenden, Nieren auf dieser Seite durchgängig dicker und fetter, als sie auf der anderen Seite zu sein pflegen. Ich bin der Ansicht, daß dies nur bei jungen Tieren der Fall ist, weil im Alter gerade diese Teile vorzugsweise hart und unverdaulich sein werden.
Bouillon ist die Basis fast aller Suppen. Das frischeste Fleisch gibt unbezweifelt die beste; es muß aber freilich seine Reife je nach dem Alter des Tieres und seiner Konstitution haben – das à point des Garde-manger. Gute Fleischbrühe kommt nicht nur von Fleisch, sondern auch von Knochen, und diese geben die beste, fettlose Brühe. Gute Suppen kommen selten aus großen Küchen, in denen man alle Augenblicke aus den Fleischtöpfen schöpft, zu Tassenbouillons, Saucen, Ragouts, Gemüsen und, was noch schlimmer ist, das Fehlende im Topfe meist mit frischem Wasser ergänzt, welches jede Suppe verdirbt. In schlechten, ja auch in guten Restaurationen ist das nicht nur oft, sondern sogar gewöhnlich der Fall. Ein Fremder kam an einen solchen Tisch und fand die Suppe so elend, daß er sich ein Glas Rotwein geben ließ und es in die Suppe goß, um ihr einen leidlicheren Geschmack zu geben. Sein Nachbar aber machte ihm bemerklich, daß hier der Rotwein so schlecht sei, daß man ihn mit Suppe verbessern möchte.

In kleinen Wirtschaften ist der Suppentopf der Hauptgegenstand, auf den man alle Sorge verwendet. Eine gute Suppe ist daher sehr oft das Diner der Armen, ein Genuß, der oft von den Reichsten vergebens gesucht wird. Damit die Suppen nicht so leicht verbrennen, möge man das Fleisch in den Topf hängen und den Deckel mit Brotkrume an den Topf kleben; das Feuer wirkt auf den so hermetisch verschlossenen besser. Will man das Fleisch saftig erhalten – wiewohl dasjenige, woraus die Suppe genommen ist, eigentlich nie auf den Herrentisch kommen sollte –, so muß es stark und mehrfach mit Bindfaden zusammengezogen sein. Es ist, wie gesagt, ein Irrtum, doppelt starke Bouillon schwachen Mägen zu geben; der tierische Stoff stimmt den Magen zu hoher Reizbarkeit und ermüdet ihn desto früher. Man sorge dafür, daß die Suppe nicht zu dick werde, daß genug Bouillon, besonders für italienische Nudeln, Reis, Makkaroni usw. vorrätig sei.
Gute Bouillon ist so wichtig und köstlich als selten. Es kommt, wie sonderbar das auch klingt, dabei nicht vorzugsweise auf die Quantität, vielleicht selbst nicht auf die Qualität des Fleisches an, sondern noch mehr auf die Bereitung derselben, damit das Fleisch das Osmazom Die Entdeckung des Osmazom ist, beiläufig gesagt, einer der wichtigsten Dienste, welche die Chemie der Küche geleistet hat. Die Hitze des Feuers zieht das Osmazom z. B. an die Oberfläche des Bratens und gibt ihm die eigentümlich schöne, blaßgelbe Farbe. Rindfleisch, Wild und Hammel enthalten viel Osmazom, Geflügel aber enthält nur sehr wenig. und besonders den tierischen Leim gibt. Dies aber geschieht nur, wenn das Wasser durch seine allmähliche Erhitzung einwirkt. Aber die Muskeln enthalten auch Albumin, eine Materie, die dem Eiweiß sehr ähnlich ist und welche den Schaum auf dem Fleischtopfe bildet. Dieser Bestandteil gerinnt und verhärtet sich bei einer Hitze von 80°, und deshalb will der Fleischtopf vorsichtig und mit Mäßigung dem Feuer ausgesetzt sein. Man kann ihn nicht zeitig genug ans Feuer bringen. Nicht an heftiges; denn nur das lange, gelinde Kochen gibt die beste Suppe. Nichts aber ist häufiger als die Versäumnis dieser so notwendigen Maßregeln.
Will man eine gute Bouillon und zugleich genießbares und nahrhaftes Fleisch erhalten, so muß man vor allen Dingen das Fleisch und kaltes Wasser zugleich ans Feuer bringen und etwas Kochsalz sofort hinzufügen. Nur hierdurch wird zuerst das Albumin mit extraktiven und salzartigen Substanzen aus dem Fleische gezogen, ersteres durch die allmählich gesteigerte Erhitzung innerhalb der Flüssigkeit zum Gerinnen gebracht und als Schaum abgefüllt, während ein Teil des im Fleische enthaltenen Zellgewebes sich in Leim verwandelt hat. Durch allzu starkes Auskochen verliert aber das Fleisch seinen Zusammenhang, Geschmack und Nahrhaftigkeit, was nur vom Vorhandensein von Zellgewebe, Fett und extraktiven Stoffen zwischen den Muskelfasern abhängig ist. Durch Anwendung ungesalzenen und noch dazu gewöhnlichen kalk- und gipsartigen Brunnenwassers erhält man eine schlechtere und weniger wohlschmeckende Bouillon als mit kochsalzhaltigem Wasser. Am schlechtesten aber werden sowohl Bouillon als Fleisch, wenn man letzteres sogleich in siedendes Wasser bringt. Besonders oft glauben die besten Köche, daß es ihnen an Zeit fehlt, welche sie durch ein recht starkes Feuer zu ersetzen sich vergebens bemühen; so wird das Fleisch durchhitzt, nicht lange und gehörig durchwärmt, das Albumin verhärtet sich, der tierische Leim ist verhindert, aus dem Fleisch zu dringen, die Muskelfaser verschrumpft, das Wasser kann nicht in das Innere dringen und die extraktiven Teile lösen; so wird nicht nur die Bouillon kraftlos, sondern auch das Fleisch hart und unverdaulich. Wird aber das Feuer im Anfang mäßig unterhalten, der Fleischtopf durch eine natürlich verständige Sorgfalt gepflegt, so hebt sich das Albumin in leichtem Schaume, der tierische Leim löst sich vom Fleische; die Bouillon wird delikat und kräftig, das Fleisch weich und nahrhaft.
Der große Rabelais hat diese Grundsätze in Frankreich sprichwörtlich gemacht, lange bevor die Chemie sie lehrte. Man kann nicht genug die Tiefe, Präzision und den Sinn der Maxime bewundern, die wir der Beurteilung des Lesers überlassen:
Plus y étant, plus cuit restait,
Plus cuit restant, plus tendre était.
Man sagt den Suppen mit großem Unrecht viel Böses nach. Es ist sonderbar, sich davon eine große Erschlaffung des Magens zu träumen.
Wird denn nicht alles Getränk, wenn wir es auch noch so kalt zu uns nehmen, im Magen in wenigen Minuten warme Suppe, und befindet sich denn nicht der Magen Tag und Nacht in der natürlichen Temperatur einer warmen Suppe? Nur hüte man sich, sie heiß oder in zu großer Menge auf einmal oder zu wässerig zu genießen. Die Suppe hat ihre großen Vorteile: sie ersetzt das Getränk, besonders bei Gelehrten und Frauenzimmern – und diese namentlich trinken fast immer zu wenig –, wie bei allen denen, welche außer Tisch wenig oder gar nicht trinken, und die, wenn sie nun auch das Suppenessen unterlassen, viel zu wenig Feuchtigkeit in das Blut bekommen. Dabei ist noch zu bemerken, daß das Flüssige, in Suppengestalt genossen, sich weit besser und schneller unseren Säften beimischt, als wenn es kalt und roh getrunken wird.
Eben deshalb ist Suppe zugleich ein großes Verhütungsmittel der Trockenheit des Körpers, und daher für trockene Naturen und im Alter die beste Art der Nahrung. Je älter der Mensch wird, desto mehr muß er von Suppe leben. Ja, selbst die Dienste eines Arzneimittels vertritt eine gute Suppe. Nach Erkältungen, bei nervösem oder Magen-Kopfweh und manchen Arten von Magenkrämpfen ist Suppe das beste Mittel. Unsere Vorfahren, die stärker waren als wir, genossen viel Suppen, und die Bauern, die es noch sind, genießen noch viel Suppen. Das Sprichwort: Wer lange suppt, lebt lange, ist wahr wie irgendeines.
In Paris gibt man fast bei allen Suppen geriebenen Parmesankäse herum; er gibt das Pikante. Die Fremden machen es gern nach und bringen diese löbliche Gewohnheit in ihre Heimat. Ursprünglich kommt aber die Sitte, Parmesankäse zur Suppe zu geben, aus Italien, aus der Zeit, wo Sitte und verfeinerte Lebensweise dieses Landes in Europa dominierten, lange bevor Paris tonangebend geworden war; sie kam (nach Rabelais) erst mit der Renaissance nach Frankreich.
Man gebe der Bouillon viele und mannigfaltige Vegetabilien, vielerlei Wurzeln, Sellerie, aber keine Pastinaken, keinen gestoßenen Pfeffer oder gar Ingwer; dieser Putz kleiner Küchen ist eine höllische Zutat, verletzt Auge, Geruch und Geschmack; man glaubt, Harpyen haben über der Suppe geschwebt. Einige, wiewohl kleine Stücke diverser Fleischsorten, Schinken, machen das Ganze würzhaft. Zimmermann gab gern, namentlich bei Rekonvaleszenten, Scorzenera in die Suppe.
Alle Gallerten werden nur durch große Kräfte verdaut und verwandeln sich in einem schwachen Magen zu einem wahren Leim; wenn sie aber hinlänglich mit Wasser verdünnt werden, nähren sie geschwind und stark. Man hat es dahin gebracht, durch fortwährendes Auspressen und Einkochen die Kraft von mehreren Pfund Fleisch und Markknochen in einen kleinen Raum zu konzentrieren, den Zähnen und dem Magen die Arbeit zu ersparen, um eine solche Essenz von Nahrungssaft gleich auf einmal ins Blut zu schicken. Man restauriert sich aber so nicht im Galopp. Denn die Einrichtungen der Natur kann man nie ohne Schaden überspringen. Der Magen kann nur eine gewisse Menge fassen. Wenn man aber durch eine gewisse Art von Schleichhandel mehr Nahrung in den Körper bringt, als er zu fassen imstande ist, so entsteht eine Überfüllung der Gefäße, die das Gleichgewicht, also die Gesundheit stört. Nicht ohne Ursache hat die Natur die Einrichtung getroffen, daß die Speisen in gröberer Gestalt genossen werden müssen. Der Nutzen davon ist, daß sie erst beim Kauen im Munde mazeriert und mit Speichel vermischt, daß sie länger im Munde aufgehalten werden und durch ihren Reiz den Magen zu größerer Reaktion ermuntern, folglich weit besser assimiliert und in unsere Natur umgewandelt werden. Hierauf beruht aber die wahrhafte Restauration.
Milch vereinigt die Eigenschaften der Speise und des Getränks, des tierischen und vegetabilischen Elements, sowie alle zur Bildung und Mischung der verschiedenen Organe erforderlichen Erdarten und Salze in sich. Man könnte sie deshalb das Universalnahrungsmittel nennen; auch ist sie von dem Herrn der Welt augenscheinlich zu unserer ersten Nahrung bestimmt.
Die Nahrhaftigkeit der Milch hängt von ihrem Gehalt an Butter und Käsestoff, und die Verdaulichkeit im umgekehrten Verhältnis ab. Durch einen zu großen Reichtum jener Stoffe, und von phlegmatischen, mit einer lymphatischen Konstitution, mit schwachen, zur Säurebildung neigenden Verdauungsorganen begabten Personen genossen, und in Verbindung mit fader, oder zu nahrhafter und zu wenig reizender Kost, als Eiern und Mehlspeisen, tierischen Fetten, wird die Milch schädlich. Kindern und Greisen bekommt die Milch im allgemeinen besser als den im männlichen Alter befindlichen, starke körperliche Arbeiten Verrichtenden; desgleichen sagt sie auch dem weiblichen Geschlechte mehr zu als dem männlichen.
Unter allen Gattungen von Milch ist die menschliche die dünnste und süßeste; am nächsten kommt der Frauenmilch die Eselsmilch, welche den meisten Milchzucker von allen Milcharten enthält; sodann die der Stuten und Geismilch, und endlich die der Kühe. Schaf- und Ziegenmilch sind am nahrhaftesten, aber auch am schwersten verdaulich wegen der größeren Menge von Rahm- und Käsestoff, den sie enthalten. Esels- und Stutenmilch verhalten sich wegen ihres geringen Gehalts an diesen Stoffen und wegen des größeren Reichtums an Milchzucker und Molken in ihrer Mischung und in ihrer Wirkung umgekehrt. Die Kuhmilch steht hinsichtlich ihrer Eigenschaften zwischen den genannten Milcharten gerade in der Mitte. Die Stutenmilch hat wenig Käse- und Butterstoff, und ist daher am leichtesten verdaulich. Aber, was nicht alle Leute glauben werden, ist, daß es aus Erfahrung erwiesen ist, daß die dünnste Milch, wenn sie gerinnt, einen weit festeren Quark macht als die fetteste, daher auch die Käse von dünner Milch hart und zerbröcklich sind, und die von der fettesten mürbe und zart. Die geronnene Milch zu fürchten ist Torheit, weil die Milch immer im Magen gerinnt, um verdaut werden zu können.
Der individuelle Zustand des Organismus, von welchem die Milch abstammt, hat großen Einfluß auf ihre Beschaffenheit. Welch großen Einfluß die Nahrung auf die Mischung der Milch ausübt, ist hinlänglich bekannt. Von giftigen Kräutern, welche Kühe, Ziegen fressen, z. B. Ranunculus acris und Euphorbia, bekommt die Milch schädliche Eigenschaften. Die Milch der Kühe, nachdem sie gekalbt haben, enthält weniger Rahm und Käse. Vorher soll sie basisch, nachher sauer sein. Gekochte Milch ist wegen Einbuße ihrer Kohlensäure schwerer verdaulich als ungekochte, abgerahmte leichter als unabgerahmte.
Der Molken ist weniger nahrhaft als die Milch, doch wegen des Ausscheidens des Käse- und Butterstoffs leicht verdaulich. Des Morgens gemolkene Milch rötet das Lackmuspapier, nicht aber die des Mittags und Abends. So ist die Morgenmilch reicher an Rahm als die anderer Tageszeiten.
Die Buttermilch ist nahrhafter als der Molken und leichter verdaulich als die Milch. Jene, weil sie noch den Käsestoff enthält, dieser, weil er von der Butter befreit ist. Bei Fiebern wirkt sie höchst heilsam, nur bei vorhandener Magensäure schädlich.
Eine gesunde Milch muß weiß von Farbe, süß von Geschmack und ohne fremden Geruch sein. Die Milch auf feuchten Wiesen weidender Kühe ist fade und wässerig; dagegen reich an Rahm nach Fütterung mit Luzernen und Maisstengeln. Aromatische Kräuter, Laucharten, viele Doldengewächse erteilen ihr angenehmen Geruch und Geschmack.
Wegen des dem Pflanzenkleber sich nähernden Käsestoffs und des Milchzuckers vereinigt die Tiermilch auch vegetabilische Eigenschaften in sich. Die Milch enthält 92 % Wasser und ist dadurch zum Getränk geeignet; sie ist durch ihren Käse- und Buttergehalt, sowie durch den Milchzucker sehr nahrhaft und besitzt die Qualität einer Speise, zumal da sie auch im Magen feste Gestalt erhält. Insofern sich in ihr salz- und phosphorsaures Kali und Eisen sowie insbesondere eine große Menge phosphorsaurer Kalk befindet, enthält sie alle zur Ernährung des menschlichen Organismus erforderlichen Elemente.
Die beste Milch ist die, die des Morgens im Frühjahr, einige Wochen nach dem ersten Austreiben, von einer dreijährigen, gesunden und schwarzen Kuh, die vor drei Monaten gekalbt hat und auf einer trockenen Wiese gesunde Kräuter weidet, gemolken wird.
Milchsuppen sind in Frankreich sehr in Gebrauch; ihre Einfachheit ist modern; man zieht sie den gelehrten Juliennen vor, die größere Kosten erfordern, und die, bei auch nur einiger Mittelmäßigkeit, fast ungenießbar sind, bei dem geringsten Fehler in den elendesten Zustand fallen. Die unbedeutendste Küche kann in den Milchsuppen sich den berühmtesten Künstlern nähern; dabei sind sie so gesund, daß sie selbst Rekonvaleszenten erlaubt sind.
Butter. Ohne Butter keine Ragouts, keine Küche. Butter muß, wenn sie gut ist, recht fett glänzen, gelb aussehen, angenehm riechen, süß lieblich schmecken. Gebirgsbutter ist die beste. Märzbutter, wegen der jungen Kräuternahrung der Kühe, die vorzüglichste. Die Sommerbutter, schon wegen der Hitze und der Angst der Tiere, dabei von dem Ungeziefer gequält, ist nicht so gut, Herbstbutter aber hart, fest und körnig. Winterbutter schmeckt nach Stroh und anderem Winterfutter. Die Butter wirkt den übrigen Fettarten analog. Sie ist schwer verdaulich, verursacht Magendrücken und Übelkeiten; im Übermaß genommen Gasentwicklung. Ranzig geworden erzeugt sie Sodbrennen.
Damit die Butter ein körniges Ansehen gewinne, wird sie oft mit Kreide, Sand oder Schwerspat gemischt. Wenn man die so verfälschte Butter kostet, so bringt sie ein eigentümliches Geräusch zwischen den Zähnen hervor; kocht man sie mit zehn Teilen Wasser auf, so fallen die erdigen und steinartigen Substanzen auf den Boden des Gefäßes, während die Butter obenauf schwimmt. Des frisch ausgepreßten Saftes vom gelben Schöllkraut oder der Goldwurzel – Chelidonium majus – bedient man sich, um der Butter eine schöne gelbe Farbe zu geben. Daß diese Beimischung schädlich ist, wird klar, wenn man weiß, daß Schöllkraut so scharf ist, daß, wenn man den Saft davon auf die Haut bringt, er beizend, ja selbst Blasen erzeugend wirkt. Die Holländer setzen ihrer Butter häufig Alaun zu; eine solche Butter ist weiß, salbenreich und süßlich fett.
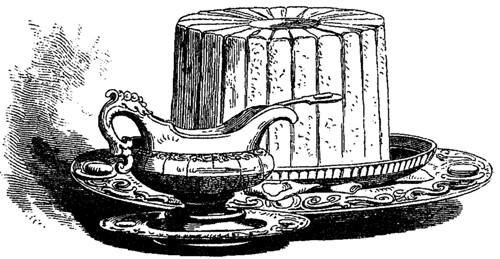
Käse besteht aus dem erdigen und fettigen Teile der Milch und ist daher schwer zu verdauen. Allein er gibt ein widerstehendes und kräftiges Nutriment, wenn er einen robusten Magen findet. Im Übermaße genossen macht er dicke und zähe Säfte. Die weichen Käse sind die schmackhaftesten, allein sie erfüllen den Magen und die Gedärme mit einem häßlichen, fast nicht zu verzehrenden Schleim und bringen viele daher rührende Übel. Diese Art Käse ist von Gastronomen zuweilen hoch geachtet, wenn sie ganz faul, daher so riecht wie der bei den Römern vormals so beliebte und von den Ostindern eine Götterspeise genannte Teufelsdreck. Alter Käse ist immer zu sehr reizend, weil er in faulende Gärung übergegangen ist, deshalb schwer verdaulich; er kann selbst giftige Zufälle erzeugen.
Der Fromage de Brie ist nach meinem Dafürhalten der erste der Welt. Wir erhalten ihn in Deutschland sehr selten unverfälscht. Seit ich diesen Käse kenne, verstehe ich erst die unendliche Tiefe der Sehnsucht in Goethes »Fischer«:
Sie sprach (er, nämlich der Fromage de Brie) zu ihm,
sie sang zu ihm,
Da war's um ihn geschehn:
Und ward nicht mehr gesehn.
Halb zog sie ihn, halb sank er hin
Ebenso haben der Vache au vin, der Schachtelkäse, der Stilton, der Chester, der Rochefort und viele spanische Käsesorten Poetisches, Überschwengliches.
Ein Ziegenkäse, den sie auf Elba Recotta nennen, weich und mit Zucker bestreut, ein Mittelding von Milch und Käse, ist vortrefflich und behagt ganz besonders den Damen.
Der Strachino, ein sehr guter Käse, kommt zuweilen nach Deutschland; freilich nicht jene vorzügliche Art, die die Italiener Gorgonzola nennen, die rund ist, während die andere Art, die zu uns kommt, nicht so fein und viereckig ist.
Die Schlesier aßen in ihren alten Zeiten bei ihren Festen Käse mit Gewürznelken; daher das sogenannte Quark-(Käse-)Schießen, welches das war, was nach dem Königsschießen kam, an dessen Stelle aber, bei mehr Aufklärung, das Pomeranzenschießen trat.
Man pflegt bei uns dem Käse durch Orleans eine rote Farbe zu geben. Orleans selber aber wird mit Cochenille und diese mit Mennige verfälscht. Es kommt Blei in den Käse, und dies gibt ihm giftige Eigenschaften. Da alter Käse häufig eine grünliche Farbe bekommt, so hat man, um jungem Käse ein altes Ansehen zu geben, selbst zum Grünspan gegriffen. Welche Folgen ein auf diese Weise verfälschter Käse auf die Gesundheit haben muß, ist leicht zu ermessen.
In meiner Jugend verkehrte ich in einem Kreise genialer Menschen – ich nenne nur Hoffmann, den Verfasser der »Phantasiestücke«, und den großen Devrient in Berlin – sehr viel in der damaligen Weinhandlung von Lutter & Wegner am Gendarmenmarkte. Baron L-, unter dem Namen der Armenier sehr bekannt, der alles kennen und wissen wollte, wurde, als vom Strachinokäse die Rede war, gefragt, ob er auch Lodikäse kenne, und ihm ein sehr zart aussehendes Stück Schaumseife unter dieser Firma vorgesetzt. Er machte sich sogleich darüber her, er biß, er kaute; aber je mehr er arbeitete, desto mehr quoll der unglückliche Gegenstand zwischen seinen Kinnbacken; große Blasen – der Baron war, was ihm mitunter begegnete, nicht mehr ganz nüchtern – spielten angenehm in allen Regenbogenfarben aus seinem Munde. Endlich begriff der Unglückliche, daß die Kugel nicht zu überwältigen sei. Sie sind gar kein Mensch, schrie er in unbeschreiblicher Wut seinen Gegner an. Nie mag ein Tiger so gewütet haben; denn hier erzeugte den Schaum nicht bloß die Wut, sondern auch ganz vorzüglich die Seife. –
Das Kalb muß nach polizeilichen Geboten aller Länder mehrere Wochen alt werden, bevor es zur Schlachtbank geführt werden darf; nichts ist aber auch ungesunder, nichts weniger nahrhaft als zu junges Kalbfleisch. Den Türken ist das Kalbfleisch sogar verboten, weil es noch nicht vollendet ist. Indes kann die mangelnde natürliche Reife im Garde-manger ersetzt werden; aber dies Verfahren erfordert höchste Vorsicht, vielseitige Erfahrung und ganz besonders eine günstige Lokalität.
Die Schlächterei kennt keinen besseren Braten, aber sie liefert ihn selten gut. Von elenden Kühen dürftig genährte Kälber können kein gutes Fleisch haben. Vom Kalb ist das beste die Milch und das Gehirn – beide durch nichts auf der Erde zu ersetzen – sowie die Füße, welche aber eine kunstfertige Behandlung verlangen, wenn man sie nicht ganz einfach auf den Rost legt. Dann kommt das Frikandeau, was aber nur von dem gut zubereiteten, à point gegebenen gilt; in dem Zustande aber, wo man es mit dem Löffel schneidet, wie es gewöhnlich gegeben wird, ist es sehr ordinär. Das Nierenstück ist nur für die Garküche das beste, weil es das fetteste ist. Zu solchen Braten werden dann Klöße gegeben und – gebackene Pflaumen. Übrigens geben die Nieren auch Entremets unter dem Namen Omelettes.
Das Kalb kommt unter so vielen Formen auf die Tafel, daß man es das Chamäleon der Küche nennen kann. Fast alle Teile bieten sich den mannigfaltigen Launen des Kochs dar, es kann selbst verschiedenartig maskiert die Eßlust täuschen, ja erwecken.
Man gebe dem neugeborenen Kalbe ein Ei und täglich bis zum dreißigsten Tage eins mehr; von da ab wiederum durch dreißig Tage täglich eins weniger; und wenn man auf diese Art zuerst von einem Ei zu dreißig Eiern gestiegen und ebenso gefallen ist, so schlachte man das Kalb am sechzigsten Tage und man wird Mühe und Kosten belohnt finden. Kalbfleisch ist eine weiche, zarte, aber flüchtige Nahrung, daher für Damen, Gelehrte, Kinder, Genesende, die wenig Bewegung haben. Es macht wenig Hitze, und kann Fieberkranken mit Zitronensäure erlaubt werden. Ein kalter Kalbsbraten mit einem Glase Rheinwein ist, trotz allem Vorurteil dagegen, und selbst nach Reil, für geschwächte Personen eine treffliche Stärkung.
Böttiger sagt (in den »Literarischen Zuständen«): Als Kalbsbraten aufgetragen wurde, der kalt aufgeschnitten war, bat Wieland, man möge ihn wegnehmen und im Zimmer räuchern, weil der Geruch des ausgedämpften Bratens seiner Nase unausstehlich sei. Nur im Dampfe rieche der Braten lüstern. Ich finde diese Bemerkung sehr schlagend.
Der Kalbskopf, der bekanntlich mit der Haut serviert wird – außer wenn er farciert wird –, erfordert schnelle Diener beim Aufwarten, weil er sehr heiß gegessen sein will.
Kalbsmilch haben die Franzosen schon zu Rabelais' Zeiten gegessen; denn dieselbe steht schon auf dessen Küchenzettel. Aber einige Jahrhunderte lang verschmähten sie dieselbe; denn bevor die Franzosen 1807 nach Warschau kamen, warf man sie, namentlich in Paris, den Hunden vor. In Warschau fanden sie dieselbe so gut zubereitet, daß man dies Gericht in Paris suchte.
Der Frikandeaus geschieht im schönen Jahrhundert Leos X. zuerst Erwähnung. Sie kamen mit Katharina von Medicis nach Frankreich; diese brachte aus Florenz einen Koch mit, der nicht nur das Kalbfleisch, sondern auch das Rindfleisch spickte.
Riz de veau hat fast immer, sogar in den besten Restaurationen, einen eigentümlichen, aber nicht angenehmen Geruch, weil es so zart ist, daß das kleinste Versehen diesen Übelstand hervorruft, besonders wenn es nicht äußerst frisch ist. Hierbei will ich ein für allemal warnen, daß man keiner Speise den Geschmack durch Kunst gibt, den sie durch ihr Verderben erhält, z.B. wie ich es in Paris leider in guten Küchen erlebte, die Croquets de riz nicht mit Zitronensaft zu behandeln. Denn der Reis wird von der Wärme nach einigen Stunden von selber sauer. Oder, was noch schlimmer ist, diejenigen Salatarten mit Sardellen zu verzieren, zu welchen man Eier verwendet hat.
Schwein. Ohne Schwein kein Speck, also keine Küche, keine Schinken! Das Schwein ist, nach Georg Forster, die Palme des Nordens, und wie die Palme Wein, Butter, Milch, Essig, Zucker, Brot und Kleidung gibt, so mannigfaltig wohltuend ist das Schwein durch das ganze Jahr in der Küche. Das Schwein gibt zwar eine schwer verdauliche, aber, wenn der Magen sie einmal überwunden hat, dichte und nachhaltige Nahrung. Schwächlichen Personen beschwert es den Magen und macht das Blut träge. Galen, im Widerspruche mit den meisten Ärzten, lobt das Schweinefleisch sehr; er gab sogar einem an der Fallsucht leidenden jungen Menschen den Rat, er solle das Fleisch aller vierfüßigen Tiere meiden, das von Schweinen ausgenommen. Frisch ist das Schweinefleisch gesünder, als wenn es in Salzlake oder Rauch lange gehärtet ist. Rohe Schinken aber sind nahrhafter und verdaulicher zugleich als gekochte.
Die im Altertum so beliebten Saumagen waren von einem Mutterschweine, welches im Augenblick des Werfens geschlachtet wurde. Die Alten behaupteten, der Magen sei dann wegen seiner großen Ausdehnung von ganz besonderer Weiche und Schmackhaftigkeit.
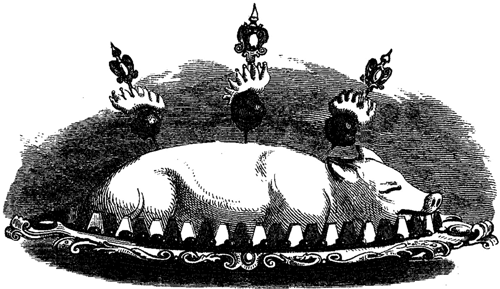
Die Spanferkel müssen, bevor sie das allergeringste genossen haben, geschlachtet werden; aber man will sie ansehnlich, d.h. hübsch groß, und so verlieren sie ihren eigentümlichen Wohlgeschmack, was eigentlich auch nicht sehr schade ist und vielleicht dazu beigetragen hat, daß dies schon wegen der unverkleideten Gestalt und der Leichenfarbe widerliche Gericht aus der Mode gekommen ist.
Von allen Würsten verdient wohl unbezweifelt die Salami den Vorzug. Die Italiener sagen, es sei eine Speise für Gott; denn der allein möge wissen, was alles dazu gehöre. Gleichzeitig behaupten sie, daß von den vielen Spezifizis, die dazu gehören, kein einziges fehlen dürfe, so vortrefflich wäre jedes. So bestehen die Pillulae hydragogi Janini aus 87 Spezies, von denen Selle (in seiner »Medicina clinica«) sagt, daß er keins wüßte, welches man auslassen dürfe, so vortrefflich wäre dies berühmteste Mittel gegen die Wassersucht.
Die Schädlichkeit des Genusses verdorbener Würste war schon vor neunhundert Jahren erkannt. Denn als die Bereitung der Blutwürste in Aufnahme kam, erließ Kaiser Leo folgendes Verbot: »Es ist uns zu Ohren gekommen, daß man Blut in Gedärme, wie in Röcke, eingepackt und so als ein ganz gewöhnliches Gericht dem Magen zuschickt. Es kann unsere Kaiserliche Majestät nicht länger zusehen, daß die Ehre unseres Staates durch eine so frevelhafte Erfindung bloß aus Schelmerei freßlustiger Menschen geschändet werde. Wer Blut zu Speisen umschafft, der wird hart gegeißelt, bis auf die Haut geschoren und auf ewig aus dem Lande verbannt.«
Die in England so beliebten Sandwiches bestehen aus zwei sehr dünnen Butterschnitten, zwischen denen ein mit Moutarde angemachtes Stück Schinken liegt. Dies Gericht führt den Namen des Lords, der es erfunden. Es wird zum Tee gegeben und ist, ganz nach Verdienst, sehr beliebt.
Schafe. Die breitgeschwänzten überstehen, nach Aristoteles, den Winter besser als die langgeschwänzten; ebenso auch die kurzhaarigen vor den langwolligen. Am schwersten überstehen die kraushaarigen den Winter. Aber auch die überwinterten sind in diesem Verhältnis mehr oder weniger angegriffen, und darauf ist für eine gute Tafel wohl zu achten. Die Schafe sind im ganzen gesünder als die Ziegen; die Ziegen wieder in einem höheren Grade gesund als die Ochsen.
Das Fleisch aller vierfüßigen Tiere, die in sumpfigen Gegenden weiden, schmeckt schlechter als von denen, die in höheren Gegenden weiden. Diese allgemeine Wahrheit findet ganz besonders bei den Schafen ihre Anwendung.
Ich bin, sagte der Prinz von Ligne, weniger Egoist als Voltaire, der die Hammel, wie er sich ausdrückte, bloß in der Sauce liebte, und weniger Gourmand als der Herzog von Nevers, der, indem er den Abbé Chaulieu voll Bewunderung eine schöne Schafherde auf grüner Weide poetisch loben hörte, bemerkte, daß vielleicht kein einziger Hammel von entschiedener Zartheit sei.

Die Hammelkeule ist der gewöhnlichste Braten des Bürgers, obwohl er in Wahrheit ein vulgäres Gericht ist. Das englische Leg of mutton ist aber eine klassische Speise. In den Ardennen, namentlich in Marche en Famine, sind die Hammel so schmackhaft wie in England. Eine Hammelkotelette, welche ich auf dem Mont Cenis erhielt, roch wie tausend Veilchen und schmeckte ebenso köstlich.
Welcher Weg, fragte Heinrich IV. eine Hofdame, führt zu Ihrem Herzen? – Der durch die Kirche, war die lebhafte Antwort. Seinem Enkel würde die Prinzessin Soubise wahrscheinlich geantwortet haben: durch eine schmackhafte Kotelette, von der Erfindung meines Vaters.
Das Lamm, obgleich etwas fade, ist doch unter einigen Formen gut, besonders durch den Spieß und eine gelehrte Sauce. Potenzierte Gourmands bestreichen die Schüssel, auf der es serviert wird, mit ein wenig Assa foetida von der Größe eines Stecknadelkopfs. Der beste Monat für dies Gericht ist der Mai. Lämmer, die zwei und ein halb Monat alt und gut genährt sind, sind die besten. Ein Ragout davon, mit einer Trüffelsauce, ist der Triumph der Küche:
Denn wo das Starke mit dem Zarten,
Wo Kräft'ges sich und Mildes paarten,
Da gibt es einen guten Klang.
Da ich einmal bei dem Lamm poetisch geworden, so möge man es auch natürlich finden, daß ich die Lammkotelette die Blume, das Madrigal der feinen Kochkunst nenne, wie die Hammelkotelette das Sonett derselben. Eine Lammkotelette sautée aux champignons, sauce tomate, ist das sublimste, was die Küche bieten kann; man sollte es nur au petit souper unter vier Augen genießen.
Hammel- und Kalbsfüße, auf dem Rost gebraten, ohne alle Zutat, am wenigsten mit der bekannten Mehlbutter-Mischung, geben ein nahrhaftes, gesundes und schmackhaftes Essen, welches schwer zu verderben ist. Kalbsfüße geben überdies ein leichtes und nahrhaftes Gallert; sie müssen vier Stunden mit Petersilie und reichlichen Zitronen gekocht werden. Dazu gehört aber unbedingt eine Champagnersauce.
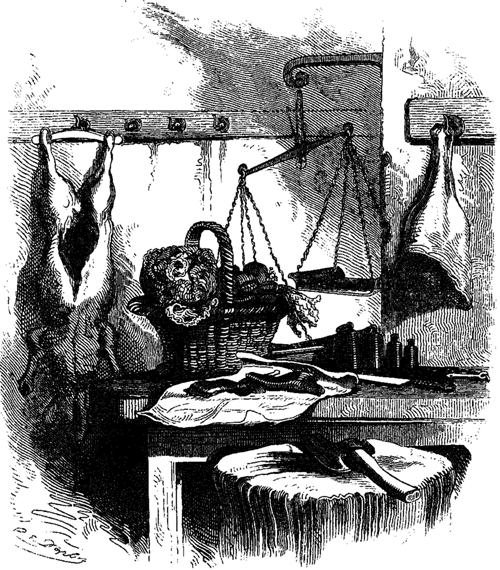
Das Lammfleisch ist eine leichte, feuchte Nahrung, besonders für hitzige und trockene Temperamente. Am besten ißt man es gebraten. Auch hat ein ein- oder zweijähriger Hammel schönes, gesundes Fleisch und ist balsamisch von Geschmack, wenn er, wohl verstanden, auf hohen und bergigen Gegenden geweidet hat; doch ist sein Fleisch trockener, dürrer und fester von Fasern als Rindfleisch. Auf fettes Schaffleisch muß man kein Bier trinken, keine Säuren, eingemachte Gurken genießen, weil darnach leicht Magenkrämpfe entstehen. Fleisch von ausgelämmerten Schafen und alten Widdern ist kränklich, rohsaftig und virulent.
Nur Engländer gehen mit der Zubereitung des Hammels praktisch und sehr gründlich zu Werke. Welche Sorgfalt verwendet der Brite nicht schon auf seine Zucht und Rasse, auf das Futter, die Lage der Weide, die Qualität des Grases. Lauter Dinge, die man in England wirklich sieht und nicht bloß in Lehrbüchern findet. Zuletzt wird das Tier nach allen Regeln der Kunst gemästet, aber nicht, wie in anderen Ländern, nach der Stadt getrieben, um erhitzt, erschöpft und in einem fieberhaften Zustand auf die Schlachtbank geführt zu werden, sondern es wird mit der äußersten Sorgfalt für seine Gesundheit auf einen mit Sprungfedern versehenen bequemen Wagen geladen und, gehörig gegen Sonne, Staub und Regen geschützt, in kurzen Tagereisen, damit sich das arme Geschöpf nicht fatiguiere, an den Ort seiner Bestimmung gebracht. Dort angelangt, erlaubt man ihm, sich gehörig auszuruhen, und von der von jeder Reise unzertrennlichen Erhitzung zu erholen, ehe man es abschlachtet, und selbst dieser Akt wird nach anatomisch-gastrosophischen Regeln nicht von gewöhnlichen Fleischern, sondern von Personen vollzogen, welche ihr ganzes Leben nur auf die Erlernung dieser Geschicklichkeit verwenden. Endlich wird der Hammel nach allen Regeln der Wissenschaft zergliedert, und die für die Tafel bestimmten Stücke oft mehrere Wochen lang in reiner, kühler Luft getrocknet. Durch dies sinnige Verfahren wird zwar die Kohäsion der Muskeln und des Bluts aufgehoben, das Fleisch mürbe gemacht, keineswegs aber dem Prozeß der natürlichen chemischen Auflösung in die Hände gearbeitet, und der Braten erhält denjenigen Grad von Schmackhaftigkeit und Feinheit, den man in England, wo man mit Epitheten nicht sonderlich verschwenderisch ist, mit dem Ausdrucke tender, d. i. zärtlich belegt. Frauen und Mädchen sind in jenem vernünftigen Lande bloß sensible, nice oder pretty – gescheit, niedlich oder hübsch; Hammel dagegen zärtlich, wenn sie so erzogen, gemästet und geschlachtet worden sind.
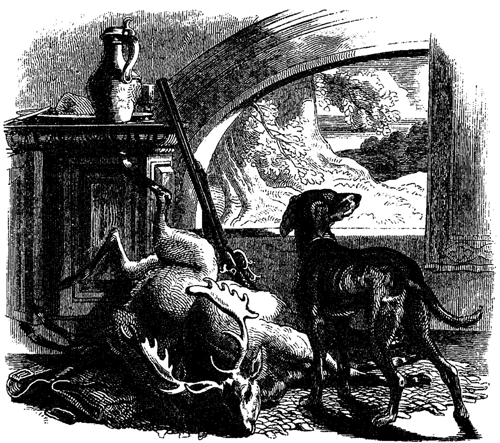
Wild ist eine der ersten Grundlagen eines guten Tisches. Es ist gleich gut als Braten, Pastete, Salmi. In Frankreich ist wegen der freien Jagd und des sehr geteilten Bodens großes Wild, selbst Fasanen, Seltenheit, und in England wird Wild beinahe mit Gold aufgewogen. Die in Freiheit lebenden wilden Tiere genießen beständig frische Luft und haben immerwährend Bewegung, um ihrer Nahrung nachzugehen, sich vor ihren Feinden zu sichern. Ihr Körper ist daher trockener, dichter, subtilisierter und zur Fäulnis geneigter als der der Haustiere. In ihren Säften entwickelt sich ein flüchtig-laugenhaftes Wesen, das ein Produkt und Analogon der Fäulnis ist, und unseren Säften eine ähnliche Neigung zur Korruption mitteilt. Eben von diesem alkalischen Bestandteile hat der Wildbraten seinen Fumet, der unsere Nerven pikiert. Im Überfluß genossen macht das Wild faulen Geschmack, Hitze, Durst und Hang zur Fäulnis. Doch ist das Wild von Natur mürber, zarter, leichter verdaulich und hat die ekelhafte Süßigkeit des zahmen Fleisches nicht, es nährt aber minder, weil es trockener und weniger lymphatische und gallertartige Teile hat. Zu kräftigen Suppen ist es daher untauglich, zum Braten desto geschickter. Bei naßkalten und feuchten Herbsten, im Winter, ist es gesünder als im Sommer.
Faules Wildbret mag ekelhafter Überreizung und krankem Sinne wohltun; ein gebildeter Mann sollte es keinem vorsetzen; der Gastrosoph wird es nie genießen. Man muß es den Franzosen verzeihen, wenn sie ihr Wild meistens nur mit Essigsaucen und in Essig gelegt (daher mariné genannt) essen. Denn erstens bekommt man in Paris nur höchst selten oder mit den größten Kosten und Umständen frisches Wild; denn es kommt meist weit her, und erst jetzt kann es durch Eisenbahnen aus den gebirgigen, wildreichen Gegenden rasch, also frisch, geschafft werden. Ob es außer Paris noch Franzosen in Beziehung auf Tafel und Küche gibt – die vier Städte Bordeaux, Marseille, Lyon und Rouen ausgenommen –, darf bezweifelt werden; sie haben wenigstens keine Stimme. Zweitens haben die Wildhändler Interesse dabei, allen ihren Kunden ganz frisches Wild zu versagen; denn sie äßen ihnen sonst das alte nicht mehr weg. Drittens hauptsächlich ist das frisch nach Paris, also aus der Nähe kommende Wild fast ein zahmes, von so fadem, nüchternem Geschmacke, daß es erst durch die halbe Fäulnis (haut-goût) und diese wieder durch die Essigzubereitung (das Mariné) eßbar wird, weshalb sie auch das gehetzte Wild dem geschossenen vorziehen, was denn doch eine an Barbarei grenzende Überreizung bekundet.
Wer einmal einen Ziemer von einem lustig herangewachsenen jungen zweijährigen Rehbocke, welcher auf dem Anstande oder beim Pirschen, in dem angenehmsten Momente seines Lebens, auf frischer Wiese weidend überrascht und jagdgerecht ins Blatt geschossen wurde, also im Moment des Schusses verendete, und zwar selbigen Ziemer den zweiten Tag darauf, nachdem er in freier Luft vierundzwanzig Stunden gehangen, gegessen hat, der verlangt gewiß nie mehr Wild mit haut-goût. Daß man das Wild kurze Zeit der freien Luft aussetze – besonders der Zugluft –, bis es den eigenen, in der Wildnis empfangenen, unangenehmen Geruch und Geschmack, das Ranzige, verliert, ist ebenso natürlich als die Gewohnheit, z.B. die Auerhähne einige Tage zu vergraben, um sie mürbe zu machen, unnatürlich ist; in Essig legen, gelindes, aber anhaltendes Klopfen bewirken das besser.
Die Bergschotten hatten ehedem eine so vortreffliche Art, das Wild zu bereiten, daß der Vidame von Chartres, der unter Eduard VI. als Geißel in England war, die Erlaubnis erhielt, diese Art an Ort und Stelle zu untersuchen. Nach einer großen Jagdpartie, die ihm dort gegeben wurde, war er sehr erstaunt, daß die Bergschotten einen Teil des getöteten Wildes ganz roh aßen, durch nichts zubereitet, als daß sie dasselbe zwischen zwei Knüppeln sehr quetschten, um das Blut auszupressen. Der Vidame machte sich populär, indem er dies harte Gericht nicht verschmähte.
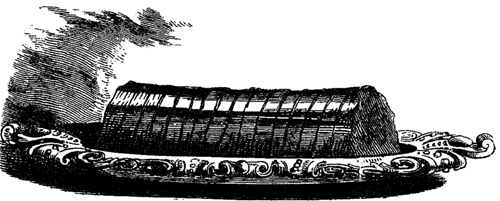
Hirschziemer
Hirsche geben, wenn sie jung sind, eine gesunde, feste Nahrung; sind sie über das dritte Jahr hinaus, so werden sie schwer verdaulich und machen üble und schwarzgallige Säfte. Damhirsche sind zarter als Hirsche und härter als Rehe, sind aber im Fett dem Hammel nahe verwandt.
Rehe geben eine gesunde, zarte und leicht verdauliche Speise. Das schönste Stück ist, wie bei den Hirschen, der Ziemer.
Schwein. Das wilde hält sich nicht wie das zahme im engen, unreinlichen Stall auf und hat deshalb ein gesünderes, trockeneres, zarteres und leichter verdauliches Fleisch als das zahme. Der Kopf ist das geschätzteste Stück.
Hase. Ein junger, drei bis acht Monate alter Hase gibt ein zartes, leicht verdauliches und durchgearbeitetes Nutriment. Nach dem dritten Jahre wird er hart, wenig nahrhaft und beschwert den Magen. Die Hasen leiden zuweilen an einer Art böser Blattern, was man daran erkennt, daß ihnen die Wollhaare hinter den Löffeln ausgegangen sind. Da die Beschaffenheit des Erdreichs auf dies Tier einen starken Einfluß ausübt, so findet man die Berghasen viel größer und dicker, auch gemeiniglich anders gefärbt als die Feldhasen. Sie sind aber auch viel delikater als diese.
Der amerikanische Bison wird bloß der Zunge wegen, welche ein ausgesuchter Leckerbissen ist, getötet. Auch bei Elentieren und Renntieren sind die geräucherten Zungen delikat. Letztere kommen auch nach Deutschland. Ich fand sie sehr trocken. Sie werden am besten mit einer Remouladensauce gegessen.
Der amerikanische Büffel der Prärie wird, einer gewichtigen Autorität – Cooper – und der Erzählung vieler Reisenden zufolge, besonders seines Höckers wegen verfolgt und getötet. Dieser mit Fett durchwachsene Fleischklumpen soll das delikateste sein, was man der Zunge bieten kann; er wird geröstet. Viele Feinschmecker haben dieses Büffelhöckers wegen die Reise nach Amerika gemacht und sich für alle Mühseligkeiten der Reise und der sehr beschwerlichen, ja gefährlichen Jagd dieses Tieres durch den Genuß seines Höckers entschädigt gefunden.
Der Bär. Ich hatte dieses liebenswürdige Geschöpf ganz vergessen. Als ein guter Freund von mir, ein großer Gastrosoph, dies bei Durchlesung meines Manuskripts gewahr wurde, rief er ungeduldig: »Um des Himmels willen, wo bleibt denn der Bärenschinken, dies Ideal von einem Schinken. Du kannst nie davon gekostet haben, sonst hättest du den gewiß nicht vergessen. Die Bärentatzen freilich gebe ich preis, sie haben nur für Fettmäuler (eine besondere Spezies der Gourmands) einen Reiz.« Diesem Ausruf liegt wohl sogar ein doppelter Irrtum zugrunde, denn ich bin kein Fettmaul, vielleicht eher das Gegenteil, liebe die Bärentatzen und kenne Bärenschinken. Bärentatzen habe ich immer vortrefflich gefunden, obgleich ich das erstemal einen Widerwillen zu überwinden hatte, weil diese Tatzen eine große Ähnlichkeit mit Menschenhänden haben. Bärenschinken habe ich sogar oft gegessen; oft, weil ich sie immer wieder von verständigen Essern loben hörte, während ich sie immer hart und wenig wohlschmeckend fand. Ich ließ mir welche aus Schweden kommen. Aus Rußland brachte mir ein Freund welche mit. Endlich, um nichts zu versäumen und ein gegründetes Urteil fällen zu können, ließ ich mir in Italien einen ganz jungen Bären mästen, schlachten und die Schinken gehörig zurichten: sie waren wieder fast ungenießbar. Der Wahrheit gemäß waren aber die Schinken meines italienischen Bären nicht gut geräuchert worden; ich hätte also eigentlich nach Konstantinopel gehen müssen, wo bekanntlich alles Rauchfleisch in allervorzüglichster Güte bereitet wird. Man kann mir aber nach so betrübten Bärenschinken-Erfahrungen nicht verargen, wenn ich eine spezielle Malice gegen den Bärenschinken habe. Der Bär schmeckt aber auch im allgemeinen und der Wahrheit gemäß weichlich, fast wie zahmes Schweinefleisch. Kopf und Tatzen sind davon wohl allein Delikatessen. Der schwarze Bär nährt sich vorzugsweise von Pflanzen, Obst und Honig, der braune mehr von Tieren; jener ist schmackhafter. Man genießt überhaupt am liebsten junge Bären, die noch kein Fleisch gefressen haben. Im Oktober sind sie sehr fett und dann am besten.
Das Kamel. Die Milch desselben ist so ergiebig wie nahrhaft. Sie ist das beste Mittel gegen die Wassersucht. Mohammed scheint sie nicht geliebt zu haben. Er, der die Milch sehr liebte, gibt aber der Kuhmilch überall den Vorzug und erwähnt nicht einmal der Kamelmilch. Die Kost von Mekka und Medina war zur Zeit Mohammeds schon schwelgerisch geworden. Die Beduinen trinken fortwährend Kamelmilch und geben auch ihren Rassepferden davon, wodurch sie sehr kräftig werden. Junges und zartes Fleisch von Kamelen hat den Geschmack von bestem Kalbfleisch.
Das Lama hat ein vortreffliches, gesundes, schmackhaftes Fleisch, vorzüglich das der Jungen von vier bis fünf Monaten.
Biber. Der Schwanz desselben ist eine Delikatesse; er wiegt drei bis vier Pfund. Er wird, wie ein Karpfen, in Stücken angerichtet, im Wasser so lange gesotten, bis er allen Tran verliert. Darauf kocht man ihn in einem Tiegel mit Wein, Essig, Gewürz und geriebener Semmel. Die Missourijäger halten den Biberschwanz für eine der köstlichsten Leckerspeisen, und europäische Reisende haben diese Behauptung bestätigt. Nur muß man das unter den Schuppen liegende Fleisch zur Seite legen, weil es seinen Trangeschmack niemals verliert.
Elefantenfüße, Flußpferdzungen und Kamelbuckel sind orientalische Delikatessen. Aber diejenigen Kamele, die zum Essen bestimmt sind, sind weiß wie Schnee; sie werden niemals zur Arbeit, zum Reiten oder Lasttragen gebraucht. Ihr Fleisch ist rot und sehr fett.
Tribuzzi, ein bekannter österreichischer Gourmand aus Triest, war 1819 in Wien, als er hörte, daß man sich in Venedig genötigt gesehen, einen unbändig gewordenen Elefanten zu erschießen. Er wußte, daß im Orient Elefantenfüße und Rüssel zu den ausgezeichnetsten Delikatessen gehören. Er bat also dringend, man möge Teile von beiden einsalzen, ordnete seine Geschäfte, nahm Kurierpferde und reiste nach Venedig. Als er durch die Kärtnerstraße in Wien fährt, sieht er bei einem Delikatessenhändler eine gewisse lange weiße Wurst, deren Namen und sonstige Eigenschaften ich leichtsinniger Mensch vergessen habe – kurz, eine Wurst, die er längst erwartet hatte. Aber er hält keine Minute; der Elefant läßt ihm keine Ruhe, und doch verfolgt ihn wieder auf der ganzen Reise das Bild dieser Wurst. Sie schwebt seinen Träumen so gut wie der Elefant vor. Endlich in Venedig angekommen, findet er, daß man seine Aufträge versäumt hat. Nun läßt er den Elefanten ausgraben. Der aber findet sich schon so sehr in Verwesung, daß sich nichts mehr von ihm genießen läßt. Nun eilt Tribuzzi zurück, aber die berühmte Wurst ist verzehrt. Dieser Gastronom reiste alle Jahre zur Fasanenzeit nach Steiermark; er genoß am liebsten alles an der Quelle. Von Steiermark ging er durch Savoyen, zu den berühmten weißen Trüffeln, und von da nach Straßburg zu den Gänselebern. Er nannte das seine Kunstreise.