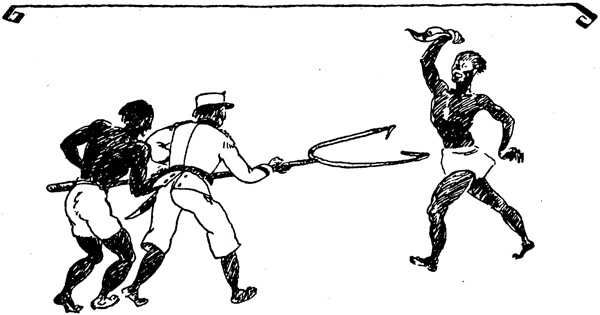|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
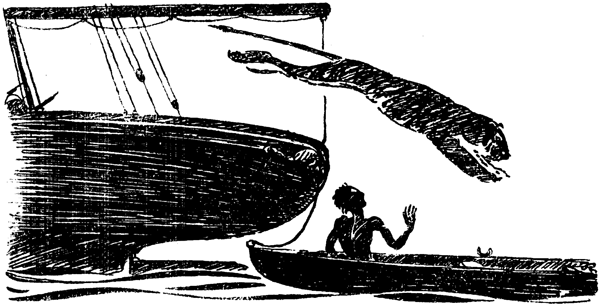
In den Sunderbans – Tigerjagd auf einem Segelschiff – Kalkutta – Rangoon und die Burmanen – In Singapore – Ankunft in Batavia – Die Holländer in ihrer Kolonie – Von der Reistafel – Buitenzorg und Soekaboemi – Garoet und der Vulkan Papandajan – Ein Amokläufer – An den Fürstenhöfen von Djokjakarta und Soerakarta – Der Riesentempel von Borobudur
Wenn der mächtige Ganges, gleichsam ermüdet von seinem sangen Lauf, die durch zahllose Nebenflüsse verstärkten Wassermassen immer träger in breitem Bett durch das bengalische Tiefland wälzt, beginnt er sich, wie so viele andere Ströme der heißen Zone, noch weit vor der Mündung in den Golf von Bengalen in eine Anzahl größerer und kleinerer Läufe zu zersplittern, zu deren bedeutendsten der Hugli gehört, an welchem Indiens größte Stadt, Kalkutta, liegt. Zwischen dem Hugli und dem durch den Brahmaputra verstärkten Hauptarm des Ganges, dem Meghna, dehnt sich das deltaförmige Mündungsgebiet des Stromes aus, ein ungeheures Labyrinth von Schlamm- und Sandinseln, durch eine Unmenge von Flußadern und Rinnsalen gebildet, mit Mangrove- und Dschungeldickichten, mit Grasflächen und undurchdringlichen Sümpfen bedeckt. Wohl wenig in der weiten Welt gibt es, was beim ersten Anblick einen trübseligeren, niederdrückenderen Eindruck macht, als dieser höchst eigenartige Landstrich, der seinen indischen Namen Sunderbans, d. h. »schöner Wald«, wie zum Hohne führt. Wie groß mag einst die Enttäuschung so manchen jungen Offiziers der Ostindischen Kompanie gewesen sein, der nach einer fünfmonatigen Reise um das Kap der guten Hoffnung den Hugli stromaufwärts fuhr und nun dieses Land seiner Sehnsucht, das vielleicht das Land seiner lebenslänglichen Verbannung werden sollte, zum erstenmal vor sich sah. War das in Wirklichkeit Indien, die so gepriesene Wunder – und Märchenwelt? Wohin sein Auge blickte, sah es verkümmerten Baumwuchs, undurchdringliches Unterholz voller Schlingpflanzen, die sich mehr und mehr verdichteten und verfilzten, alles das auf einem Boden, der mit dem gewaltigen Strom und den zahllosen Nebengewässern schwer um sein bißchen Existenz zu kämpfen hat. Es wäre vergebliches Bemühen, diesem Boden irgend etwas Verwendbares entringen zu wollen, dafür bildet er aber einen geradezu idealen Tummelplatz für Tiger, Leoparden und Büffel, Krokodile und Schlangen, nicht zu reden von all dem kleineren, vierbeinigen und befiederten Getier, das sich auf diesem Sumpfboden bei der Treibhaushitze des Lebens freut. Man stelle sich ein Gebiet von gewaltiger Ausdehnung vor, von 350 km Breite, zum großen Teil von unwegsamem Urwald bedeckt, dabei so tiefliegend, daß es zur Flutzeit aussieht, als wüchsen die Bäume aus dem Wasser heraus. »Dringt man in einen der zahlreichen Flußläufe ein,« – so schreibt Alfred Peuker – »so erblickt man schlanke, hochaufschießende Farne, Bambusschößlinge und verkrüppelte Bäume, alles von einer schleimigen, tröpfelnden Feuchtigkeit überzogen und inmitten der rankenden Schlinggewächse wie mit unzähligen Schlangen bedeckt. Ein einsamer, unbeweglich dastehender Reiher, ein wahres Standbild der Geduld, oder ein glitzernder, ruheloser Eisvogel, das ist alles, was dieser Szenerie, die des Griffels eines phantastischen Künstlers würdig wäre, eine Spur von Leben verleiht. Bei den fremdartig dumpfen, unheimlichen Lauten, die aus den entlegensten Tiefen des Urwaldes hervorzudringen scheinen, kriecht eine seltsame Beklemmung, die von Angstgefühl nicht ganz frei ist, zum Herzen empor. Man glaubt in dem dunstigen Sonnenbrand Gespenster zu sehen. Selten nur unterbricht ein taktmäßiges Klatschen wie von fernen Ruderschlägen die Stille. Oder es zieht in den glühendsten Sommermonaten, wenn die höher im Inland gelegenen Wasserläufe beinahe ausgetrocknet sind, ein stattlicher Flußdampfer im Gefolge seiner flachen und plumpen Schleppboote vorüber. Seine Schaufelräder klatschen und peitschen die Flut, während das Schiff sich in der schmalen Fahrrinne mühsam seinen Weg durch das Mangrovedickicht bahnt. Gelegentlich läßt sich auch wohl ein Tiger sehen, der auf der Suche nach neuen, besseren Jagdgründen über den Fluß schwimmt. Oder es streicht ein Rudel Wildschweine unter der Leitung eines hageren, ausgemergelten Ebers vorbei und sucht eilends das andere Ufer zu erreichen, wobei vielleicht ein jämmerlich quiekendes Ferkel zwischen den Kiefern eines still und stumm auf der Lauer liegenden Krokodils zurückbleibt. Und wieviel Tragödien, von denen nichts in die Öffentlichkeit dringt, spielen sich in den einsamen Urwäldern ab! Da geht ein Trupp von Holzfällern, die am Ufer eines entlegenen Nebengewässers eine Anzahl Stämme schlagen wollen. Plötzlich raschelt und kracht es im Dickicht, und als sie sich umwenden, sehen sie, daß einer ihrer Gefährten, der ein wenig zurückgeblieben war, unter den Pranken eines Tigers liegt …«
Zu den Verheerungen, die durch wilde Tiere verursacht werden, gesellt sich im Gangesdelta noch die kaum erträgliche Pein stechender, beißender, blutsaugerischer Insekten, die aus der Luft und vom Boden her den menschlichen Eindringling attackieren und zur Verzweiflung bringen. Und auch die allerwinzigsten und allergefährlichsten Lebewesen, die Sumpffieberparasiten, gibt es hier in verschwenderischer Fülle. Der Stich der Anophelesmücke verpflanzt sie ins menschliche Blut; in den roten Blutkörperchen sich weiter entwickelnd, erzeugen sie die Krankheitserscheinungen der schweren tropischen Malaria. Das Gangesdelta ist geradezu das klassische Land der Malaria, nirgends äußert sie sich in so heftigen, gefährlichen Formen wie hier. Wie daraus hervorgeht, kann man das Mündungsgebiet des gewaltigen indischen Stromes gerade nicht zu den angenehmsten Landschaften der Erde rechnen, und es wäre jedenfalls ein höchst sonderbarer Einfall, hier eine Sommerfrische zu suchen. Trotzdem hat auch dieses verlorene Land des Wassers, des Dschungels und der Sümpfe seinen eigenartigen Reiz, besonders für den Naturfreund und Sportsmann. Daß es kein leichter und bequemer Sportsbetrieb ist, braucht nach dem oben Gesagten kaum noch betont zu werden. Man muß schon einen gehörigen Puff vertragen können. Das habe ich bei den Jagdausflügen, die ich von Kalkutta aus ins Gebiet der Sunderbans unternahm, mehr als einmal am eigenen Leibe erprobt.
Wie vorhin erwähnt wurde, schwimmen die Tiger häufig von einem Ufer zum andern. Viele halten die großen Katzen irrtümlicherweise durchgängig für wasserscheu, und es ist wenig bekannt, daß der Tiger ein ganz vorzüglicher Schwimmer ist, der selbst vor sehr breiten und schnell fließenden Strömen nicht zurückschreckt, wie der folgende von mir erlebte Vorfall zeigt. Wir, d. h. einige Jagdfreunde und ich, befanden uns an Bord einer Segeljacht auf dem Hugli, um hauptsächlich Wasservögel zu schießen. Es war einem glühend heißen Tag eine wundervolle mondhelle Nacht gefolgt. Wir waren im Strom vor Anker gegangen, und da es der Moskitos wegen leider nicht möglich war, auf Deck zu schlafen, lagen wir in den Kabinen, während zwei unserer Bootsleute oben Wache hielten. Plötzlich ertönte furchtbares Geschrei und riß uns vom Lager, schlaftrunken stürzten wir an Deck, und was sahen wir dort? Ein Tiger hatte die Backbordseite der Jacht erklommen, war auf Deck vor den zu Tode erschrockenen Bootsleuten aufgetaucht und wandte sich dann, durch den Lichterschein und das Geschrei verscheucht, dem hinteren Teil des Schiffes zu. Anscheinend hatte der Tiger beim Durchschwimmen des Stromes die Kraft verloren und unsere Jacht als einen willkommenen Ruheplatz betrachtet. Als wir auf Deck erschienen und die Situation erkannten, sahen wir den Tiger gerade hinter dem Ankerspill und einigen Kisten, die dort standen, verschwinden. Wir holten rasch die Gewehre und machten uns zur improvisierten Tigerjagd auf dem Wasser bereit. Aber das Tier hatte begreiflicherweise keine Lust, auf einem ihm so wenig vertrauten Terrain den Kampf mit uns aufzunehmen, und als wir mit schußfertiger Waffe gegen sein Versteck vorgingen, sprang er mit einem Satz über Heck. Neues Geschrei ertönte von unten herauf. Wir wußten im ersten Augenblick nicht, was nun dort wieder los war; als wir uns aber über die Reling beugten, ward es uns klar. Hinten am Schiff und dicht an diesem vertäut lag nämlich unser Beiboot im Wasser und einer unserer Leute hatte sein Schlaflager im Boot aufgeschlagen, um die vom Wasser aufsteigende Kuhle aus erster Hand zu genießen. Der Tiger war nun in das Boot hinabgesprungen, zum größten Entsetzen des armen Kerls, der vor Angst nicht wußte, was er tun sollte, und sich auf der Steuerbank des Bootes wie ein Häufchen Unglück zusammenballte. Aber der Tiger hatte ebenso große Angst und dachte gar nicht daran, dem Burschen zu Leibe zu gehen. Wir schossen nun gleich zu zweien. Jetzt sprang der Tiger ins Wasser und begann auf das Ufer zu zu schwimmen. Er mußte jedoch schwer getroffen sein, denn er kam nicht recht vorwärts, und als wir ihm zwei weitere Kugeln nachschickten, gaben sie ihm offenbar den Rest, denn der Körper begann hilflos im Wasser zu treiben. Wir begaben uns nun rasch in das Boot, um uns das Fell zu sichern, aber ehe wir das Tier erreichten, versank es, von einem Strudel gepackt. So endigte diese höchst wunderbare Tigerjagd auf dem Wasser, die unseren Leuten, hauptsächlich dem armen Laskar im Boot, ganz gehörig auf die Nerven gefallen war.
Übrigens kommt es keineswegs selten vor, daß schwimmende Tiger, die ihre Kraft überschätzt hatten oder in eine reißende Strömung gerieten, sich auf treibende Baumstämme oder auch auf besetzte Boote, wenn diese gerade in der Nähe sind, zu retten suchen. In solchen Lagen äußerster Gefahr verlieren alle Tiere die Scheu vor dem Menschen.
*
130 Kilometer landeinwärts vom Golf von Bengalen liegt am Hugli Kalkutta, die Hauptstadt des britisch-indischen Kaiserreiches, mit l¼ Millionen Einwohnern Indiens größte Stadt und die zweitgrößte ganz Asiens, nur von Tokio übertroffen. Obwohl landeinwärts gelegen, ist Kalkutta ein Schiffahrtsplatz ersten Ranges, denn selbst die ganz großen, sehr tiefgehenden Ozeanschiffe fahren mit der Flut den Hugli bis Kalkutta hinauf, wo geräumige Dockanlagen für sie eingerichtet sind.
Kalkutta enttäuscht. Wenigstens den, der schon die große Reise durch Vorderindien hinter sich hat und, wie es bei den meisten Touristen der Fall ist, die größte Stadt des Landes als eine der letzten Stationen der Indienreise besucht. Wer in Ceylon den Garten Indiens und die Singhalesen, in Südindien die Kulturdenkmäler der drawidischen Rasse, in Haiderabad, Jaipur, Gwalior usw. die Eingeborenenstaaten und den Glanz ihrer Fürstenhöfe, in Delhi und Agra die höchste Blüte indischer Baukunst, im Norden die gigantische Alpenwelt des Himalaya – wer alles das und hundert andere Dinge gesehen hat, dem kann Kalkutta nichts Überraschendes mehr bieten. Es ist die wirtschaftlich wichtigste Stadt Indiens, ein Welthandelsplatz von größter Bedeutung, ein von geschäftigstem Leben überfüllter Mittelpunkt der Industrie, auch insofern von Interesse, als hier »Europa in Indien« am stärksten und glänzendsten zum Ausdruck kommt, aber eine echt indische Stadt mit charakteristischen Eigentümlichkeiten indischen Lebens ist Kalkutta nicht. Nur ein Drittel der Bewohner ist in Kalkutta geboren, zwei Drittel sind Eingewanderte aus ganz Indien und dem übrigen Asien nebst 15 000 Europäern, meist Engländern. Sehr beträchtlich ist auch der Prozentsatz an Eurasiern (Mischlingen) mit ihren nicht immer erfreulichen Eigenschaften.
Schon die Wolken von Dunst und Rauch, die ständig über Kalkutta lagern, zeigen die große Fabrikstadt an. Ihr wichtigstes Erzeugnis ist die Jute, der Kalkuttahanf, der von hier in rohem oder verarbeitetem Zustand in zahllosen Schiffsladungen über die ganze Welt hinausgeht. Dreiviertel der ganzen indischen Teeproduktion wird über Kalkutta ausgeführt, daneben sind Opium, Häute und Felle, Getreide, Hülsenfrüchte und Baumwolle als Hauptausfuhrartikel zu nennen. In den Geschäftsstraßen der City geht es bisweilen so lebhaft zu, daß man sich plötzlich nach London versetzt glauben könnte, und in der Fabrikvorstadt Howrah jenseits des breiten, schmutzigen, übelriechenden Hugli drängt sich das Proletariat in Massenquartieren von drückender Häßlichkeit zusammen. Alles das kann den Touristen, der im Wunderlande Indien doch schließlich etwas anderes sucht, nicht sonderlich reizen, und auch die großzügig monumentalen Gebäude der Stadt, wie der Palast des Vizekönigs, fesseln ihn auf die Dauer ebensowenig wie die schonen Anlagen des Maidan mit seinen riesigen Rasenflächen und zahllosen Denkmälern oder der idyllische Edenpark. Und sein abschließendes Urteil lautet deshalb gewöhnlich: eine große, geräuschvolle Handels- und Industriestadt mit stattlichen modernen Palästen – aber eigentlich keine indische Stadt, wenigstens nicht in dem Sinne, daß nationales indisches Leben darin In erster Linie zum Ausdruck käme. Manchester, nach Bengalen verpflanzt und indisch kostümiert – das ist Kalkutta.
Übrigens habe ich einmal in Kalkutta einen Schlangeneinkauf gemacht, der wohl der größte jemals erfolgte Abschluß auf diesem Gebiete war, denn es handelte sich dabei um nicht weniger als 300 Riesenschlangen, die für Amerika bestimmt waren und die ich dorthin weitersandte. Ist es schon nicht ganz leicht, eine einzige Riesenschlange sachgemäß zu verpacken, so kann sich der Leser wohl eine Vorstellung davon machen, was es heißt, die ungeheure Menge von 300 Schlangen – es waren Exemplare von 7 bis 28 Fuß Länge darunter – auf den Transport zu bringen. Immerhin »klappte« die Sache unter Aufsicht meines schon wiederholt erwähnten famosen Shikaris Fernando vorzüglich, bis auf einen Fall, der für mich beinahe einen sehr bösen Ausgang genommen hätte. Als ich nämlich mit Hand anlegte, um die größte der Riesenschlangen, ein außergewöhnlich kräftiges und ungebärdiges Tier, in den Transportkäfig zu befördern, glitt Fernando, der den oberen Teil des Schlangenkörpers hielt, auf dem Boden aus und kam zu Fall, wobei die Schlange seinen Händen entglitt. Diesen Augenblick benützte das Tier, um sich überraschend schnell um meinen Körper zu winden und mir mit solcher unwiderstehlichen Kraft die Brust zu umschnüren, daß mir der Atem verging und ich nach wenigen Sekunden die Besinnung verlor. Wären zum Glück nicht mehrere meiner Leute in der Nähe gewesen, die rasch hinzusprangen und die Schlange durch Schläge und Kneifen mit Zangen zum Loslassen veranlaßt hätten, dann wäre die Sache für mich sehr böse verlaufen. So kam ich noch einmal, wie man zu sagen pflegt, mit einem blauen Auge davon, hatte aber noch lange an den Folgen der allzu stürmischen Umarmung zu leiden.
*
Wir verlassen damit Vorderindien, um mit einem Dampfer der British India Steam Navigation Company über Rangoon nach Singapore zu fahren und von dort nach Java, der Perle holländisch-Indiens, hinüberzusetzen.
Langsam geht es den Hugli hinab. Dieser Strom ist wegen der fortwährenden, durch Schlammablagerungen verursachten Veränderungen der Tiefenverhältnisse eines der schwierigsten Fahrgewässer der Welt, und die Lotsen, die die Schiffe begleiten, sind deshalb unter ihrer ganzen internationalen Kollegenschaft wahrscheinlich die bestbezahlten. So manches Schiff ist den Tücken des Hugli zum Opfer gefallen, da die zahllosen Inseln und Sandbänke so wenig über den Wasserspiegel ragen, daß man sie bei unsichtigem Wetter gar nicht bemerkt. Allmählich erweitert sich der breite Strom, die Ufer treten auf beiden Seiten immer mehr zurück, um schließlich in Dunst und Nebel zu verschwinden, und nur an der stärker werdenden Dünung nimmt man es wahr, daß das Schiff das offene Meer, den Golf von Bengalen, erreicht hat.
Am zweiten Tage der Fahrt, die bei Passatwind recht bewegt und unangenehm sein kann, nähern wir uns der Südwestspitze von Burma, den am Horizont Verschwimmenden flachen Ufern des Irrawaddy-Deltas. Genau wie der Ganges spaltet sich auch der Irrawaddy, Hinterindiens großer Strom, noch weit vor seiner Ergießung ins Meer in eine Anzahl größerer und kleinerer Mündungsarme, deren schlammiges Wasser das Meer weithin trübt. In einen dieser Arme, den Rangoonfluß, lenken wir mit der Flut hinein, und nach zweistündiger Flußfahrt liegt die große goldene Shwe Dagon-Pagode vor uns, das glänzendste und berühmteste der vielen buddhistischen Heiligtümer von Rangoon.
Rangoon gehört mit 300 000 Einwohnern zu den größten und geschäftlich lebhaftesten Städten des britisch-indischen Reiches. Die ganz regelmäßig gebaute moderne Stadt bietet mit ihren geradlinigen Straßen keinen architektonischen Reiz, sehr anziehend aber ist der um einen großen See gelagerte Dalhousiepark, ein Meisterwerk englischer Landschaftsgärtnerei, und nicht weit davon liegt Rangoons bedeutendste Sehenswürdigkeit, die schon erwähnte Shwe Dagon-Pagode, das heiß begehrte Ziel zahlloser Wallfahrer aus Burma und ganz Indien, aus Siam, Kambodscha, ja selbst aus China und Korea, denn das Heiligtum, das mit seinen vielen Nebenbauten ein hochgelegenes großes Terrain bedeckt, enthält eine Anzahl Haare vom Haupte Buddhas sowie Reliquien von seinen Vorgängern. Den Mittelpunkt her umfangreichen Anlage bildet die riesige, über und über vergoldete, glockenförmige Pagode, nach unseren europäischen Begriffen eigentlich ein recht unschönes, plumpes Bauwerk, dem aber von den Indern die höchste Bewunderung gezollt wird. Die Vergoldung muß übrigens alle 20-25 Jahre mit ungeheuren Kosten erneuert werden. An der Spitze der seltsamen Riesenglocke sind außer einigen tausend, von unten nicht wahrzunehmenden Edelsteinen (man bedenke diese sinnlose Verschwendung!) nicht weniger als 1500 silberne und goldene Glöckchen angebracht, die bei Wind ein liebliches, zartes Geläut ertönen lassen – und das ist denn auch der einzige hübsche Einfall der Schöpfer dieses Kolosses gewesen. Rund um die Pagode drängen sich in strotzender, verwirrender Fülle zahllose Buddhastatuen und andere Götterbildnisse, manche von kolossaler Größe, und eine Unmenge kleinerer Tempel, Kapellen und heiliger Schreine. Große Verehrung genießen in Burma, wie im benachbarten Siam, die »weißen« (in Wirklichkeit nur besonders hell gefärbten) Elefanten. Man hält sie oft in Tempelbezirken, beladet sie mit prächtigem Schmuck und erweist ihnen göttliche Ehren.
Ermüdet von dieser hauptsächlich auf das Bizarre gerichteten religiösen Kunst wendet sich das Auge bald lieber dem Volksleben zu. Welch ein Unterschied gegen die Eingeborenen Vorderindiens! Obwohl die Burmanen ebenfalls Buddhisten, Hindus und Mohammedaner sind, haben sie doch in ihrem Wesen, das eine glückliche Mischung von mongolischem und malaiischem Blut darstellt, nicht das geringste von jener düsteren und humorlosen Bedrücktheit, die für die Mehrzahl der Inder bezeichnend ist. Offene, heitere, freie Mienen, sorgloses Plaudern und Lachen selbst an den heiligen Stätten, keine Spur von Befangenheit gegenüber dem Europäer, im Gegenteil eher ziemlich dreist – das ist burmanische Art. Am meisten fällt, wenn man aus Vorderindien kommt, die Ungeniertheit der weiblichen Wesen auf. Wie diese kleingewachsenen, schön frisierten, mit Blumen geschmückten Damen und Dämchen dem Europäer lachend ins Gesicht sehen und die Künste ihrer Koketterie spielen lassen, das wäre in Vorderindien ganz unerhört und einfach unmöglich. Man merkt es sofort, daß auf Sittenstrenge in Burma kein übertriebener Wert gelegt wird. Die Frauen erfreuen sich fast derselben Freiheiten wie der Mann und rauchen auch in der Öffentlichkeit ihre »Cheroots«, die sonderbaren burmanischen Riesenzigarren, die selbst den widerstandsfähigsten europäischen Kettenraucher schon nach wenigen Zügen erbleichen lassen und »matt« setzen. Auch das indische Kastenwesen mit seinen Verschrobenheiten ist in Burma unbekannt. Weiß also der Burmane auf den ersten Anblick sehr für sich einzunehmen, so zeigt sein Charakterbild doch auch recht unerfreuliche Schattenseiten. Das Volk ist vergnügungssüchtig und anhaltender Arbeit nicht hold, jeder Anlaß zum Bummeln wird fleißig benützt, auch über Unzuverlässigkeit und Verschlagenheit bekommt man lebhafte Klagen zu hören. Es gibt eben nirgends Mustermenschen in dieser unvollkommenen Welt!
Aber wir dürfen uns nicht lange in Rangoon aufhalten, denn unser Dampfer setzt nach Erledigung des Ladegeschäftes die Reise bald fort. In mehrtägiger Fahrt geht es. nun an der langgestreckten, riesigen Halbinsel von Malakka nach Süden weiter, bis wir wieder ganz dicht am Äquator angelangt sind und eines Morgens nach schwierigem Lavieren zwischen zahlreichen kleinen, dichtbewaldeten Inseln und tückischen Korallenriffen in flimmernd heißer Luft Hafen und Dockanlagen vor uns auftauchen sehen, dahinter die bunten Häuser einer großen exotischen Stadt: Singapore.
Singapore! Boshafte Globetrotter behaupten zwar gern, es gebe in Singapore nur eine einzige Stunde ungemischter Freude, und das wäre die Abschiedsstunde. Aber ich habe mich, vielleicht wegen meiner unverbesserlichen optimistischen Veranlagung, niemals zu dieser Ansicht bekannt, habe mir vielmehr diesen Knotenpunkt des maritimen Weltverkehrs immer mit lebhaftem Interesse betrachtet und mich auch recht wohl darin gefühlt, schon deshalb, weil Raffles Hotel entschieden zu den besteingerichteten Karawansereien des Südostens gehört. Unfehlbar trifft man hier, wo alle Fäden zwischen Europa, Ostasien, Holländisch-Indien und Australien zusammenlaufen, mindestens einen Bekannten, meistens aber mehrere an. In allen Winkeln und Ecken der weiten Hallen wird nach dem Dinner auf den Faulenzerstühlen vom Geschäft und von Kursen gesprochen, von Kautschuk, Tabak, Tee, Kakao, Kopra, Seide, Erzen, Hölzern und einigen Dutzend anderen Dingen, mit denen sich draußen immer noch ein Erkleckliches verdienen läßt. Und ist das unerschöpfliche Thema doch einmal vorübergehend erschöpft, dann heißt es »Boy, Rickscha!« – und von einem chinesischen Traberkuli gezogen, geht es auf den exotischen Nachtbummel hinaus, der in dem kosmopolitischen Singapore, wo Malaien, Javanen, Chinesen, Japaner, Siamesen, Annamiten und ich weiß nicht was noch für Nationen in buntester Mischung hausen, wahrlich interessant genug ist. Vielleicht zunächst in das kuriose malaiisch-indische Theater, in dem die unglaublichsten Mordgeschichten (in 13 Akten und 12 Zwischenspielen!) mit Musik und Tanz verzapft werden, dann in ein japanisches Teehaus, weiter in ein chinesisches Gambling Hall (Glücksspielhaus) und zuletzt, von kundiger Hand geführt, in eine geheime Opiumkneipe, nicht um selber diesem höchst zweifelhaften Genuß zu frönen, sondern um das Leben und Treiben in den oft glänzend eingerichteten »Höllen« zu beobachten. Es mag seltsam erscheinen, daß die Opiumraucher ihrem Laster – wenn man diesen entschieden zu starken Ausdruck durchaus gebrauchen will – immer an solchen Gemeinschaftsstätten nachgehen, obwohl sie ihr Opiumpfeifchen doch zu Hause in größerer Ruhe und Sicherheit rauchen könnten. Das geschieht aber einfach aus demselben Grunde, aus dem sich die Trinker gern zusammentun: sie fühlen sich wohl unter ihresgleichen, die Geselligkeit erhöht den Genuß.

Aus dem Botanischen Garten in Buitenzorg, Java: Teich mit Victoria Regia (Text Seite 201)

Fakir, im glühenden Sonnenbrand sitzend

Ein ambulanter Straßenkoch in Batavia
Wenn ich der Vollständigkeit wegen erwähne, daß Singapore, dieser Welthandelsplatz ersten Ranges, einer der wichtigsten Stützpunkte Englands auf der Etappenstraße Europa-Ostasien und eine starke Festung ist, so sage ich dem kundigen Leser damit kaum etwas Neues. Minder bekannt dürfte es sein, daß in dieser ursprünglich malaiischen Stadt unter 240 000 Einwohnern nicht weniger als 170 000 Chinesen (und nur 3800 Europäer und Amerikaner) leben, ein Beweis für die zähe, geräuschlose Energie, mit der sich die gelbe Rasse trotz aller Abwehrmaßregeln über den asiatischen Südosten ausbreitet. Reger Geschäftssinn, Anpassungsgabe, Fleiß und Bedürfnislosigkeit, das sind die Waffen, mit denen sie vordringt und sich ihre Erfolge verschafft.
*
Gern gedenk' ich des Tages (obwohl mich damals schwere Sorgen bedrückten), an dem ich in Batavia zum erstenmal den Boden Javas betrat, zum erstenmal in einem »Sado« – aus dos à dos für Javanen mundgerecht gemacht – dem flinken Zweiradwägelchen, an einem echt holländischen Kanal entlang nach Weltevreden fuhr, zum erstenmal den sympathischen javanischen Menschenschlag in seiner Heimat sah, zum erstenmal alle Behaglichkeiten eines holländisch-indischen Hotels genoß.
Es ist wieder eine völlig andere Welt, die hier den Fremden umfängt und die selbst für den deutsch-indischen Kolonisten, der das Tropenleben fast ein Menschenalter hindurch erprobte, viel Neues und Überraschendes hat. Ich denke dabei nicht so sehr an Natur und Volksleben, als vielmehr an das, was der Europäer aus diesem Lande gemacht hat, denn ich finde, daß diese Frage in den Kolonien den schaffenden Menschen doch immer am meisten interessiert. Wir sind hier auf Java, Sumatra und den anderen Sundainseln im Reiche Hollands, und wie die Engländer mit ihren gewaltigen Mitteln aus Indien ein ganz einzigartiges staatliches Kunstwerk zu gestalten wußten, so ist es auch dem kleinen, aber zähen und klugen Volke der Niederländer gelungen, aus ihrem tropischen Insulinde eine geradezu musterhaft gut eingerichtete und verwaltete Kolonie zu machen. Aber darüber später noch einige Worte, zunächst möchte ich in Kürze meine Eindrücke in Batavia und der weiteren Umgebung schildern.
Selbst für eine nicht sonderlich enthusiastisch veranlagte Natur ist der erste und vorherrschende Eindruck der des Entzückens über diese reizende Gartenstadt, die, ähnlich den Europäervierteln Colombos, eigentlich mehr einem großen Park mit vielen schönen Landhäusern gleicht. Ich meine damit nicht das eigentliche, dicht am Meere gelegene, alte Batavia, das zwar die Pflanzstätte der holländischen Kolonisten in Insulinde ist, heute aber vom Europäer nur noch zu geschäftlichen Zwecken aufgesucht und sonst lediglich von Chinesen und anderen Asiaten bewohnt wird. Außerhalb der Kontorstunden, die von 9-4 Uhr dauern, ist diese Altstadt ganz verödet. Der Europäer wohnt landeinwärts in dem langgestreckten Villenstadtteil Weltevreden. Weltevreden heißt Wohlzufrieden, und wenn der Mensch nicht ein so undankbares und meistens unzufriedenes Wesen wäre, dann sollte er sich hier wirklich wohlzufrieden fühlen. Denn dieses Weltevreden ist, wie schon gesagt, wirklich eine reizende Gartenstadt, die sich um die große, quadratische Rasenfläche des Koningspleins gruppiert, um sich dann in immer lockerer werdender Schichtung südlich bis zum Vorort Meester Cornelis auszudehnen.
Batavia-Weltevreden ist weit davon entfernt, irgend etwas Weltstädtisches an sich zu haben, nicht einmal etwas ausgeprägt Kaufmännisches merkt man der Hauptstadt Javas trotz ihrer lebhaften Handelstätigkeit an. Viel eher denkt man an eine jener stillen holländischen Städte, die wie durch ein Märchenwunder plötzlich in die indische Welt verseht wurden und sich nun der fremdartigen Umgebung nach Kräften angepaßt haben. Auf den von prächtigen, schattenspendenden Bäumen eingefaßten Alleen und den Kanalstraßen herrscht nur zur Zeit des nachmittägigen Korsos regeres Leben, in den heißen Tagesstunden liegen sie wie verlassen da. Frühmorgens, bald nachdem das »Auge des Tages«, wie der Malaie in seiner poetischen Sprache die Sonne nennt, emporgestiegen ist, nehmen die Eingeborenen in den Kanälen und anderen Wasserläufen ein rasches Bad, ihre gedämpfte Fröhlichkeit schallt zu den Ufern hinauf. Inmitten sorgfältig gepflegter Gärten erheben sich die aus Stein gebauten, durchweg sehr schlichten, nur aus einem Erdgeschoß bestehenden, blendend weißen Herrenhäuser; mehr landeinwärts an der Peripherie, dort wo die Stadt allmählich in die Reisfelder und Pflanzungen übergeht, liegen die malerischen Kampongs, die Hüttenviertel der Eingeborenen, ebenfalls in üppigstes Grün gebettet und allenthalben von kleinen Wassergräben durchzogen, ohne die eine javanische Siedelung überhaupt nicht denkbar wäre. Der Stil der Herrenhäuser Javas ist anders als jener der indischen Bungalows, aber mit diesen hat er die Anpassung an das Tropenklima, die Vorrichtungen zu möglichster Abwehr der Sonnenhitze gemeinsam. Niemals fehlt an der Vorderfront eine säulengetragene, geräumige Loggia, der halboffene, abends in heller Beleuchtung strahlende Lieblingsaufenthalt der Familie, sowie die auf den hinteren Garten hinausgehende breite Veranda.
Der starke Unterschied zwischen der typisch englischen Lebensführung in den Tropen, wie sie uns in Britisch-Indien überall entgegentritt, und der holländischen äußert sich in so auffälliger Weise, daß er den Fremden, der beides miteinander vergleichen kann, zu allerlei amüsanten Betrachtungen anregt. Der Engländer verpflanzt seine heimischen Gewohnheiten überall dorthin, wo er sich gerade befindet, und macht nur ungern den Sitten der Eingeborenen Konzessionen. Auch bei 35 Grad Hitze legt er abends zum Dinner den Frack oder mindestens ein Frackjackett – das der Deutsche komischerweise »Smoking« nennt, obwohl der Engländer darunter etwas ganz anderes versteht – nebst der dazu gehörigen weißen, gestärkten Wäsche an, denn er glaubt dieses feierliche Zeremoniell sich selbst, dem weißen Herrn, und seiner farbigen Umgebung schuldig zu sein. Wir wollen daran nicht mäkeln, jedes Volk hat eben seinen bestimmten Lebensstil. Auch der Holländer verpflanzt seine heimischen Gewohnheiten nach den Kolonien, aber da er nun einmal den Zug zur Gemächlichkeit hat, fällt es ihm gar nicht ein, sich um des Prestiges willen Unbequemlichkeiten aufzuerlegen, die er nicht liebt. Außerdem übernimmt er von den Eingeborenen gern solche landesüblichen Bräuche, die ihm praktisch und bekömmlich erscheinen. Er denkt nicht daran, sich abends mit der feierlichen Kriegsbemalung eines Fracks zu schmücken; damit würde man sich in Insulinde, mit Ausnahme von offiziellen und sonstigen festlichen Anlässen, geradezu lächerlich machen. Die holländischen Damen haben von den Javaninnen den so kleidsamen und bequemen Sarong entlehnt, einen gebatikten Faltenrock – das neuerdings auch in Europa so modern gewordene Batiken der Baumwollstoffe ist ja eine uralte javanische Kunst – sowie die weiße, spitzenbesetzte Kabaya, eine leichte Schoßjacke. In dieser gesunden, dem Klima angepaßten, dabei sehr kleidsamen Tracht, unter der nur die nötigste Unterkleidung getragen wird, bewegen sie sich zuhause den ganzen Tag, und nur bei Ausgängen wird sie mit der üblichen europäischen Kleidung vertauscht. In ähnlicher leichter, luftiger Hülle tummeln sich unter der Obhut ihrer braunen Babus, der javanischen Kinderfrauen, die Kinder herum. Die Herren sind in den Morgenstunden, bevor sie in ihre Kontore und Ämter fahren, nur mit dem Pyjama bekleidet, die nackten Füße in den Pantoffeln, und wer gerade nichts zu tun hat, verbleibt wohl auch den ganzen Tag im Pyjama, wenigstens innerhalb seines Heims. Selbstverständlich sind alle diese Sachen immer sehr sauber, wie denn überhaupt großer Wert aus peinlich sorgfältige Körperpflege gelegt wird, die in den heißen Ionen noch wichtiger ist als bei uns in Europa. Der Deutsche fühlt sich von der ihm sympathischen Zwanglosigkeit des holländischen Lebensstils in den Tropen angenehm berührt und wird infolgedessen auf Java sehr bald heimisch.
Unter den vielen Eigentümlichkeiten des holländisch-indischen Lebens ist eine, die dem Fremden anfangs ungemein komisch vorkommt, nämlich die Art zu schlafen. Statt der Steppdecke befindet sich auf dem Lager ein walzenförmiges Kissen von Körperlänge, dieses nimmt der mit einem flanellenen Schlafanzug bekleidete Schläfer zwischen die Arme und hält es an den Leib gedrückt. Der Brauch ist, wie so viele andere, von den Malaien übernommen und sehr bekömmlich, denn das Schlafkissen schützt den Unterleib vor Erkältung, ohne den übrigen Körperteilen beschwerlich zu fallen.
Wenn man von Lebensgewohnheiten in den Tropen spricht, darf man die so ungemein wichtige Frage der Ernährung nicht unbeachtet lassen. Daß die englische Kolonialküche, wenigstens vom deutschen Standpunkt aus beurteilt, keineswegs ideal ist, wurde schon früher erwähnt. Um so mehr freut sich der Deutsche, in Holländisch-Indien eine Kost zu finden, die, kräftig und wohlschmeckend zugleich, überhaupt zu den besten kulinarischen Leistungen ganz Asiens gehört. Der Tag beginnt mit dem ersten Morgentrank landesüblicher Art, im tiefsten Negligé genossen: einer Vierteltasse starken, kalten Kaffeeextraktes, auf welchen heiße Milch gegossen wird, dazu ein paar Zwiebacks. Das ist nur die bescheidene Ouvertüre. Um die neunte Stunde folgt das richtige Frühstück, dann füllt sich der Speisesaal des Hotels mit Gästen und Pensionären. Die Kaufleute haben zumeist schon ein tüchtiges Stück Arbeit hinter sich – denn es wird hier wahrlich nicht gefaulenzt und man nützt die kühlen Morgenstunden gern aus – und bereiten den Fleischschüsseln und Eierspeisen mit gutem holländischen Appetit eine vernichtende Niederlage. Etwa um ein Uhr mittags folgt die berühmte » Reistafel«. Sie spielt ja auch in Britisch-Indien eine große Rolle, aber bei den Holländern erreicht sie Dimensionen, die selbst dem klassischen Riesenschlemmer Gargantua, der sich immer gleich einen ganzen Ochsen servieren ließ, höchsten Respekt eingeflößt hätten. Da die meisten meiner Leser sich von dem, was unter Reistafel zu verstehen ist, so ohne weiteres wahrscheinlich keine rechte Vorstellung machen können, ist eine nähere Erklärung am Platz. Die Reistafel ist also das umfangreichste und komplizierteste Gericht der Welt und mit einem so großen Apparat verknüpft, daß der Anfänger darob geradezu in Verwirrung gerät. Sie besteht aus einer Generalidee und vielen Spezialideen. Die Grundlage bildet, wie schon der Name verrät, gedämpfter Reis, so lecker, wie man ihn nur in Java erhält. Zum Reis gesellen sich auf zahllosen Schüsseln alle denkbaren Zutaten: verschiedene Sorten von gebratenem, geschmortem, geröstetem Fleisch, von Geflügel und Fischen, von Eiern in allen möglichen Zubereitungsarten, von Gemüsen, Salaten, Gewürzen, den mannigfachsten pikanten Saucen, gedörrten und geschmorten Früchten usw. usw. Natürlich darf auch das Curry nicht fehlen, das sich von einer indischen Tafel gar nicht fortdenken läßt und eine Mischung verschiedener, zu einer Sauce verarbeiteter Gewürze darstellt. Das wäre also so beiläufig die Generalidee der Reistafel. Wenn nun ein Gast die Reistafel verlangt – die meisten Kolonisten essen sie Tag für Tag – so tritt ungefähr ein Dutzend Diener in Gänsereihe an und jeder präsentiert einige Bestandteile des Gerichts, der Gast trifft daraus eine Zusammenstellung nach seinem Geschmack (das ist die Spezialidee), zerkleinert und mischt alles auf einem mächtig gehäuften Teller und vertilgt dann eine ungeheuerliche Portion. Da sich die Reistafel immer wieder nach neuen Spezialideen zusammenstellen läßt, wird man ihrer sobald nicht überdrüssig.
Gegen acht Uhr macht die leichtere Abendmahlzeit den Beschluß der gastronomischen Freuden. Vor den beiden Hauptmahlzeiten pflegt der Holländer einen »Paitje« ( pait heißt im Malaiischen bitter) zu nehmen, ein Gläschen Schnaps, um den Verdauungsapparat für die bevorstehenden Strapazen in gute Form zu bringen.
In früheren Zeiten war Batavia so von Fieber durchseucht und so berüchtigt, daß man das Wechselfieber auch Bataviafieber nannte. Diese ungünstigen klimatischen Verhältnisse haben sich seit der Anlage einer guten Kanalisation so sehr zu ihrem Vorteil verändert, daß heute nur noch die unmittelbare Nähe des sumpfigen Küstenstriches gern gemieden wird, während das landeinwärts gelegene Weltevreden für den, der vernünftig lebt, ein ganz bekömmlicher Ort ist. Überhaupt werden die Gefahren des Tropenlebens für den Europäer stark überschätzt. Es kommt nur auf die richtige Lebensführung, das weise Maßhalten in allen Dingen an. Hierfür darf ich mich wohl selbst, der ich fast ein Menschenalter in den heißesten Zonen verbracht habe und mich jetzt in vorgerückten Jahren trotzdem voller Gesundheit und Rüstigkeit erfreue, als lebendigen Beweis vorstellen.
Es läßt sich also recht angenehm in Batavia leben. Es gibt hier so manches, das man in anderen Kolonien kaum dem Namen nach kennt, wie zum Beispiel: Biergärten mit Militärmusik, ganz nach deutscher Art, Kaffeehäuser, Konditoreien und ähnliche nützliche Institute, und fast überall findet der deutsche Reisende eine deutsche Ansprache und freundwillige Gastlichkeit, mag der Ton der holländisch-indischen Zeitungen im allgemeinen auch nicht gerade sehr deutschfreundlich sein. Nicht minder angenehm berührt ist man vom Wesen der Eingeborenen. Schon im Hotel freut man sich über das leise und bescheidene Auftreten der braunen Boys, ihre aufmerksame Dienstwilligkeit. Auf der Straße und in den Kampongs sehen wir graziös schreitende Javaninnen in ihren kleidsamen bunten Sarongs, ausgesprochene Schönheiten sind keineswegs selten. Java ist verhältnismäßig sehr stark bevölkert, 31 Millionen Menschen bewohnen die Insel, darunter 65 000 Europäer und Mischlinge, welch' letztere den Europäern gesetzlich gleichgestellt sind – allerdings nur gesetzlich, denn in der Gesellschaft nehmen sie eine abgesonderte Stellung ein. Man unterscheidet bei den Eingeborenen die im Westen der Insel lebenden Sundanesen, die für die zuverlässigsten gelten und deshalb am meisten als Diener geschätzt sind, die eigentlichen Javanen Mitteljavas, die kulturell am höchsten stehen, und die Maduresen im Osten. In den vornehmeren javanischen Kreisen, besonders in der Umgebung der Fürsten, wird großer Wert auf umständliche und überhöfliche Zeremonien gelegt, da ist des Verbeugens und selbst des Knierutschens kein Ende, während das gewöhnliche Volk sich zwangloser gibt. Selbst der einfachste javanische Boy hat ein instinktives Gefühl für Anstand und Würde und wünscht dementsprechend anständig behandelt zu sein, was ja auch sein gutes Recht ist. Die Javanen sind Mohammedaner, aber von ihrer früheren buddhistischen Religion hat sich in den Kultusgebräuchen noch manches erhalten. Von starker Religiosität ist nichts zu spüren.
Selbstverständlich ließ ich es mir nicht entgehen, mir auch die Vergnügungen der Eingeborenen anzusehen. Die nationale Hauptbelustigung ist das Wajang, Schattenspiele von Marionetten hinter einem durchscheinenden Vorhang, sowie das Wajang-Orang, Pantomimen von seltsam kostümierten und vermummten Schauspielern. Dazu ertönt die Musik des Gamelangs, eines Orchesters mit vielem Schlagzeug und einem zweisaitigen Streichinstrument. Stundenlang können die Javanen, in stummer Verzückung hockend, dem Spiel zusehen und den traumhaft zarten Tönen des melancholischen Gamelangs lauschen.
Überrascht schon in Batavia die Üppigkeit der Flora, so erreicht diese den Höhepunkt ihrer Entwicklung in dem weltberühmten Botanischen Garten der eine Bahnstunde landeinwärts gelegenen Stadt Buitenzorg. (Sprich Beutensorch, d. h. Ohnesorge. Das holländische ui wird wie eu, oe wie u gesprochen.) In eine herrliche Landschaft gebettet, von den mit Urwald bedeckten Kegeln der großen Vulkane Salak und Gedeh beschirmt, ist dieses Buitenzorg, der Wohnsitz des Generalgouverneurs von holländisch-Indien, ein ganz reizender Ort, allerdings ein bißchen feucht, da es an 20-24 Tagen des Monats täglich einige Stunden regnet. Der Botanische Garten hat viel Ähnlichkeit mit jenem von Peradeniya in Ceylon und enthält die hauptsächlichsten tropischen Charaktergewächse in hervorragend schönen Exemplaren. Der imposanteste Baum Javas ist der mächtige, ein Dickicht von Luftwurzeln treibende Waringinbaum, der den Eingeborenen für heilig gilt und nach ihrer Auffassung von Geistern und Kobolden beseelt ist.
Fast noch besser als in Buitenzorg gefiel es mir auf der Weiterfahrt in dem ebenfalls ganz von üppigstem Pflanzenwuchs umgrünten Städtchen Soekaboemi, dessen Name auf deutsch »Entzücken der Welt« bedeutet. Eine wirklich nicht zu überschwengliche Bezeichnung, denn es ist ein wunderhübsch gelegener Ort mit mildem Klima und deshalb ein bevorzugtes »Pensionopolis« jener holländischen Kolonialbeamten, die es vorziehen, nach absolvierter Dienstzeit nicht nach Holland zurückzukehren, sondern in Java zu bleiben und hier den Feierabend ihres Lebens zu verbringen. Manche waren auch schon in die Heimat zurückgekehrt, um sich dann nach einiger Zeit, enttäuscht und von Sehnsucht getrieben, doch wieder nach Java zu wenden. Das kommt ziemlich häufig vor, hauptsächlich bei alten Junggesellen, und läßt ahnen, welche starken Konflikte sich da auf dem Grund der Seele abspielen. Solche Männer haben vielleicht ein Menschenalter in der Kolonie verbracht, unzähligemal haben sie es sich in verlockendsten Farben ausgemalt, wie sie nach Ablauf der Dienstjahre ihr wohlverdientes Ruhegehalt in irgendeinem holländischen Provinzstädtchen in Frieden und Beschaulichkeit verzehren und sich dort so manchen Genuß, den sie in Java entbehren mußten, gestatten würden. Endlich kommt der ersehnte Tag. Sie quittieren den Dienst und fahren heim. Schon auf der langen Seereise stellen sich, anfangs noch rasch unterdrückt, allerlei Zweifel und bange Fragen ein. Sie merken dann erst so recht, wie sehr sie mit allen Fasern der Seele mit der Tropeninsel verwachsen sind, auf die sie in Stunden des Unmuts so oft recht schlecht zu sprechen waren. Noch werden diese Gefühle durch die spannungsvolle Erwartung des Neuen, das ihnen die alte Heimat zu bieten hat, zum Schweigen gebracht. Aber sie drängen sich immer stärker hervor, wenn nun der alte Kolonist in der Heimat angelangt ist und es allmählich immer deutlicher zu spüren bekommt, daß diese Heimat – gar nicht mehr seine Heimat ist! Seine Verwandten und alten Bekannten sind vielleicht tot oder ihm längst entfremdet; die Verhältnisse, die er im Vaterland vorfindet, wollen ihm gar nicht gefallen, er findet sie eng und kleinlich; hier ist er nichts anderes, als ein bescheidener »a. D.«, ein Unbekannter, Unbeachteter, einer von vielen, während er draußen in Übersee der weiße Herr war, einer, der etwas galt und dem der Eingeborene überall Respekt entgegenbrachte. Auch sagt dem ans heiße Tropenklima gewöhnten Körper die kühle, kalte Feuchtigkeit der Nordseeküste nicht zu, allerlei Beschwerden stellen sich ein … Und immer leuchtender, immer verlockender tritt das Bild der fernen, von Palmen und Waringinbäumen beschatteten Insel vor seine Seele, immer eindringlicher erinnert ihn die Stimme im Innern daran, daß er ja ein Fremder in der alten Heimat ist und seine wirkliche Heimat auf der anderen Seite des Erdballs, in Insulinde, liegt. Vielleicht, sehr häufig ist das der Fall, lockt ihn auch das Bild eines braunen Weibes, das dort in irgendeiner Hütte lebt und immer noch seiner gedenkt … Genug, eines Tages besteigt der alternde Mann, enttäuscht und wiederum neuer Hoffnung voll, den Dampfer, um nach Java zurückzukehren, jetzt für immer – und dort zu sterben.
Auch das im Hochland des Innern, in den landschaftlich herrlichen Preanger Regentschaften inmitten einer ungemein fleißig angebauten Talebene gelegene Garoet ist als Höhenkurort und Ruhesitz sehr geschätzt. Ich wohnte hier in einem Hotel, das mir seiner baulichen Anlage wegen von allen, die ich in Indien jemals kennen gelernt habe, am besten gefiel. Es besteht nämlich aus einer Anzahl kleiner und größerer Bungalows von 1-3 Zimmern, die über einen großen Park verteilt sind und sich um das Wirtschaftsgebäude gruppieren, das die Speise- und Gesellschaftsräume enthält. Man kann solch ein winziges Einzimmerhäuschen mit Veranda und Badestube für sich allein haben und reizend idyllische Stunden darin verbringen. An Unterhaltung fehlt es nicht. Dafür sorgen schon die vielen Hausierer, die, bescheiden und freundlich in ihrem Auftreten, vor dem auf der Veranda faulenzenden Gast ihre Waren ausbreiten: prächtig gemusterte Batikstoffe, schöne Waffen, besonders den geschlängelten Kris, ein langes Dolchmesser, die alte Nationalwaffe der Javanen, die von den vornehmen Leuten auch noch heute im Gürtel getragen wird und die es in sehr kostbaren Stücken gibt, ferner kunstvolle Arbeiten aus Silber, Schildpatt und edlen Hölzern, sowie eine Menge interessanter Naturalien aller Art. Am schönsten aber ist doch der Blick über die grünen Reisfelder auf die Berge und Vulkane ringsum. Java ist das klassische Land der Vulkane. Nicht weniger als 121 Vulkane gibt es in Java, wovon allerdings nur noch 14 tätig sind oder in geschichtlicher Zeit tätig waren. Unter diesen tätigen Vulkanen zeichnen sich einige, wie der bei Garoet gelegene Papandajan, durch große Aktivität und häufige verheerende Eruptionen aus. Die furchtbarste javanische Vulkankatastrophe der neueren Zeit war der berühmte Ausbruch des Krakatau auf der gleichnamigen kleinen Insel an der Westküste Javas im Jahre 1883. Dreiundzwanzig Jahre lang hatte der Vulkan kein Lebenszeichen von sich gegeben, als er in der Nacht vom 26. zum 27. August 1883 plötzlich einen ungeheuren Ausbruch hatte, genauer gesagt explodierte, denn er brach in sich zusammen und versank samt dem größeren Teil der Insel im Meer, wodurch zahlreiche Dörfer mit 40 000 Menschen in den Fluten verschwanden. Die mächtige Meereswelle, die durch die Erschütterung entstand, richtete an den Küsten Javas und Sumatras große Zerstörungen an und durchzog den ganzen Ozean bis zur Küste Südamerikas. Ältere Leser entsinnen sich wohl auch der großartigen Dämmerungserscheinungen, die der Ausbruch des Krakatau später überall in der Welt, auch in Deutschland, zur Folge hatte und die durch die ungeheuren Massen von Dämpfen und feinstem vulkanischen Staub hervorgerufen wurden.
Von den bei Garoet gelegenen, das Landschaftsbild beherrschenden Vulkanen tritt außer dem wunderschön geformten, anscheinend erloschenen Tjikoeraj hauptsächlich der schon erwähnte Papandajan hervor, über dessen Gipfel beständig eine Rauchwolke liegt. Seine Besteigung ist nicht schwer und kann in einem Tage ausgeführt werden. Ich ließ mir die Gelegenheit nicht entgehen, denn in Vorderindien gibt es – ich möchte beinahe sagen: leider – keine Vulkane, und diese hatten deshalb für mich den Reiz der Neuheit. Ein flinkes Wägelchen brachte mich und meine Begleiter zuerst durch die fruchtbare Ebene und freundliche Dörfer nach dem Städtchen Tjisoeroepan, das am Fuße des Vulkans liegt, dann bestiegen wir Ponys und kamen bald, immer bergan reitend, in eine prächtige Urwaldlandschaft, die später mit zunehmender Höhe allmählich in verkümmerte Gebirgsvegetation überging. Ein immer stärker werdender Schwefelgeruch, sowie das Geräusch von Sieden und Zischen verkündigte die Nähe des Kraters. Dieser befindet sich innerhalb eines größeren, älteren Kraterkessels und ist mit Schwefelablagerungen, brodelnden Schlammpfützen und Löchern angefüllt, aus denen unter lautem Zischen glühendheiße Wasser- und Schwefeldämpfe und Rauchwolken aufsteigen. Man muß vor dem Erklimmen des Kraterrandes genau feststellen, von welcher Seite der Wind kommt, denn es wäre im höchsten Grade gefährlich, sich den giftigen Schwefeldünsten auch nur ganz kurze Zeit auszusetzen. Unheimlich ist der Blick in die »Schmiede« (das bedeutet im Javanischen der Name Papandajan) der unterirdischen Titanen, in diese brodelnde, zischende, qualmende Werkstatt des Feuergottes, der, wenn es ihm just einfallen sollte, mit einer einzigen lässigen Handbewegung das Ventil zieht, den Vulkan zum Ausbruch bringt und die vorwitzigen Menschlein am Kraterrand in einer Sekunde wegputzt, in Asche verwandelt … Aber der Feuergott entließ uns in derselben guten Laune, in der er uns empfangen hätte, und wir traten, die Kleider von Schwefelgeruch gesättigt, den Abstieg an, nicht ohne uns vorher noch an dem herrlichen Panorama, tief unter uns die grüne Ebene von Garoet und ringsum die Vulkane und anderen Berge des Hochlandes, ergötzt zu haben.
Meine Hoffnung auf interessante Jagderlebnisse in den Preanger Regentschaften wurde enttäuscht, da die Umstände für Jagd auf Großwild gerade nicht günstig waren. Überhaupt sind die Aussichten für den Waidmann in Java nicht sonderlich verlockend, jedenfalls nicht im entfernten mit den Möglichkeiten und Chancen zu vergleichen, die er in Britisch-Indien hat. Auf dieser stark bevölkerten Insel, auf welcher jeder nur irgendwie kultivierbare Flecken Land ausgenützt wird und die Kulturen sich, wenn es der Boden gestattet, sogar an den Bergen hoch hinanziehen, ist das Wild aus den Ebenen und Tälern immer mehr zurückgedrängt worden. An jagdbaren Tieren fehlt es ja nicht, der Artenreichtum ist sogar sehr groß, um aber etwas wirklich Lohnendes vor die Büchse zu bekommen, muß man schon ziemlich tief in die entlegeneren Teile des Hochlandes eindringen, und dazu fehlte es mir leider an Zeit. An der Spitze der Raubtiere steht der Tiger, der hier aber die Größe des bengalischen Tigers nicht erreicht, sowie der berühmte, auf Java und Sumatra beschränkte schwarze Panther. Das Rhinozeros kommt vor, aber nicht häufig, dagegen fehlen Elefant und Bär. Unter dem Hornvieh steht der Bantengbüffel obenan. Von Affen sind am häufigsten der in Herden lebende Budeng und der Makak. In den wasserreichen Küstenstrichen hausen massenhaft Krokodile, ebensowenig fehlt es an Schlangen, darunter vielen giftigen, und ungemein reich und farbenprächtig ist auch die Vogelwelt.
Als wir auf der Rückfahrt nach Garoet in einem Dorfe Rast machten, um den Nachmittagstee einzunehmen, fanden wir groß und klein in einer Erregung, die bei dem stillen javanischen Volk eigentlich ziemlich selten ist. Bald erfuhren wir von zwei holländischen Herren, die ebenfalls in dem Wirtshaus eingekehrt waren, was die guten Leute so in Aufruhr versetzt hatte: ein Amokläufer. Das Amokläufen oder Mataglap (d. h. verdunkelter Blick) ist die Äußerung einer Geisteskrankheit, die bei den Malaien ziemlich häufig zum Ausbruch kommt und über deren Ursachen man sich nicht im Klaren ist; vermutlich handelt es sich um ein schleichendes Leiden, das durch einen starken Affekt plötzlich in Tobsucht ausartet. Der vom Mataglap Befallene ergreift auf einmal einen Kris oder ein Beil, stürzt damit auf die Straße und verwundet oder tötet in raschem Lauf jeden, der ihm in den Weg tritt oder ihm nicht rechtzeitig ausweichen kann. Das Sonderbare ist, daß der Amokläufer immer geradeaus läuft und das, was rechts oder links von ihm geschieht, unbeachtet läßt; er kehrt weder um, noch wendet er sich zur Seite, sondern verfolgt seinen Weg, die Augen stier nach vorn gerichtet, immer geradeaus. Wie häufig diese Form der Raserei in Java ist, geht daraus hervor, daß man in den meisten Dörfern Alarmtrommeln hat, die man ertönen läßt, wenn ein Amokläufer sein Unwesen treibt, ferner große Holzgabeln, mit denen man den Wahnsinnigen einfängt, um ihn zu überwältigen. Überdies ist jeder Amokläufer vogelfrei, er darf erschossen oder auf jede andere Weise unschädlich gemacht werden.
»Wir befanden uns,« so erzählten die Herren, »auf einem Spaziergang durch das Dorf, als wir plötzlich hinter uns Geschrei hörten. Wir drehten uns um und sahen einen Eingeborenen, in der erhobenen Rechten den Kris schwingend, mitten auf der Dorfstraße angelaufen kommen, während die auf der Straße befindlichen Leute schreiend zur Seite sprangen. Auch wir flüchteten rasch in ein Haus und sahen von dort, wie sich der durch den Lärm alarmierte Ortspolizist bereits mit der großen Amokläufergabel bewaffnet hatte und, von einem Bauern unterstützt, mit diesem Instrument dem Rasenden den Weg vertrat. Es ist bemerkenswert, daß der Amokläufer nicht einmal den Versuch machte, den beiden Männern und ihrer Gabel auszuweichen, sondern wie blind in die Gabel hineinlief, dann zu Boden stürzte und leicht überwältigt werden konnte. Leider hat er gerade noch vor dem Abfangen eine Frau, die über die Straße zu ihrem Kinde springen wollte, mit dem Kris niedergestreckt. Zum Glück ist sie nur leicht verwundet, wie auch die beiden anderen Leute, die der Rasende vorher gestochen hatte, keine lebensgefährlichen Verletzungen davongetragen haben.«
Der Amokläufer war, wie wir des Weiteren erfuhren, bis zum plötzlichen Ausbruch seines Wahnsinns ein ganz ruhiger, friedlicher Mann gewesen, dem man nichts von einer Geisteskrankheit angemerkt hatte.
*
Das echte, alte, romantische Java erschließt sich dem Reisenden erst so recht in den » Vorstenlanden« (Fürstenländern) des Innern der Insel, in den beiden Sultanaten von Djokjakarta und Soerakarta, deren gleichnamige Hauptstädte mit der gut eingerichteten, pünktlich und sicher fahrenden javanischen Zentralbahn leicht zu erreichen sind.
Mit der Selbständigkeit der eingeborenen Herrscher ist es allerdings nicht weit her, ihre Macht ist noch enger begrenzt, als die der meisten britisch-indischen Fürsten, ja, man darf wohl sagen, daß sie eigentlich kaum mehr als Scheinherrscher sind und ihre Befugnisse nicht allzuweit über den Bezirk ihres »Kraton« (Palastes) hinausreichen. Aber spielen sie auch politisch keine Rolle, so wird ihnen als den Vertretern der göttlichen und weltlichen Obrigkeit, als den Nachkommen ruhmreicher alter Fürstengeschlechter von ihren Untertanen doch große Verehrung gezollt, und ihr ganzes Tun und Treiben sowie der Glanz des höfischen Lebens – der sich allerdings nicht im geringsten mit dem Glanz und dem Reichtum der indischen Radschas vergleichen läßt – beschäftigt die Phantasie der Eingeborenen in hervorragender Weise.
Djokjakarta, in blühender Landschaft gelegen, die von dem prächtig geformten, Fumarolen ausströmenden Vulkan Merapi und anderen Vulkangipfeln beherrscht wird, hat sich im Gegensatz zu Batavia ganz den Charakter einer Eingeborenenstadt bewahrt, denn die hier ansässigen Europäer stellen nur einen geringfügigen Bruchteil der 80 000 Einwohner dar. Richtiger ist es mehr ein Riesendorf, dessen kleine, von üppigstem Baumwuchs beschattete Bambushäuschen nur die Trabanten der eigentlichen Stadt, des von Wällen und Bastionen umgebenen Kraton sind. Fast alle Bewohner Djokjakartas stehen in irgendeinem Abhängigkeitsverhältnis zum Sultan, beläuft sich doch die Zahl der im Kraton – einem weitläufigen Bezirk mit architektonisch unansehnlichen, niedrigen Bauten – fest angestellten Beamten, Diener, Leibwachen usw. auf 15 000. Der Sultan ist der wahre Landesvater, ihm gehört, wenigstens dem Buchstaben nach, das ganze Fürstentum mit allen Bodenschätzen, er ist der Herr über Leben und Tod seiner Untertanen. Das klingt sehr pompös – aber leider befindet sich unweit des Kraton ein anderes, wenn auch ziemlich bescheidenes Palais, und in diesem schaltet und waltet der holländische Resident, der als »älterer Bruder« des Sultans (so lautet im Javanischen sein Amtstitel) nicht nur alle Regierungsakte des »Herrschers«, sondern auch alle Vorgänge im Kraton und im ganzen Fürstentum überwacht und regelt. Ohne Erlaubnis des Residenten darf der Sultan den Kraton nicht verlassen, nicht einmal Besuche von Europäern oder fremden Eingeborenen empfangen. Das ist nicht kleinliche Schikane, sondern eine durch die eigenartigen Verhältnisse und gewisse unterirdische Strömungen gebotene Vorsicht. Die Finanzen des Fürstenhofes von Djokjakarta sollen nicht eben glänzend sein, was bei der übergroßen Menge von Kostgängern, die, von den zahlreichen Verwandten des Sultans angefangen bis zum Riesentroß der Bedienten und kleinen Schmarotzer, alle aus der fürstlichen Krippe essen, sehr begreiflich ist. Man begegnet in den Straßen Djokjakartas häufig den Würdenträgern des Hofes, immer von Gefolge umgeben, immer von dem großen vergoldeten Ehrenschirm überdacht, den es mit den verschiedensten Abzeichen gibt, da er in Java ungefähr dieselbe Rolle spielt, wie in Europa die Ordensdekorationen. Auf dem großen Innenhofe des Kraton und in der Audienzhalle finden an gewissen Festtagen feierliche Empfänge unter peinlichster Beobachtung eines althergebrachten Zeremoniells statt. Nach offiziellem Brauch führt dann der holländische Resident, der »ältere Bruder« des Sultans, diesen wie eine Dame untergefaßt am Arm, und wenn der Sultan auf seinem Thronsessel Platz nimmt, sitzt der Resident als Gleichberechtigter neben ihm, während die eingeborenen Hofbeamten, sogar die Minister, nur auf den Knien hocken und sich im Angesicht des »Herrschers« auch nur auf den Knien rutschend fortbewegen dürfen, was eine nicht unerhebliche akrobatische Gewandtheit voraussetzt.
In Soerakarta, auch Solo genannt, der Hauptstadt des benachbarten zweiten Fürstentums gleichen Namens, herrschen ziemlich genau dieselben Zustände wie in Djokjakarta, nur daß die Vermögensverhältnisse des Sultans von Solo bedeutend besser als die seines Nachbarn sind; er gilt sogar für außerordentlich reich und läßt bei den höfischen Festen große Summen draufgehen. In seinem ellenlangen Titel nennt sich der Sultan von Solo etwas überschwenglich »Paku Buwana«, d. h. »Nagel der Erde«, ferner »Heerführer im Kriege«, obwohl er keine Kriege zu führen hat; im übrigen ist er, wie alle javanischen Aristokraten, ein Mann von Takt und feinem Anstand, der sich mit Würde in die Verhältnisse schickt.
Wirkt es schon in Britisch-Indien überraschend, mit welchem verhältnismäßig geringen Aufwand an Machtmitteln die Engländer das indische Riesenreich beherrschen, so muß man sich in Holländisch-Indien noch mehr darüber wundern, wie es den Holländern möglich ist, das große Insulinde mit insgesamt 40 Millionen Menschen zu verwalten und dergestalt in Ruhe und Ordnung zu halten, daß die Sicherheit in den zivilisierten Gebieten des Archipels überall gewährleistet ist. Denn Großbritannien verfügt als Weltmacht allerersten Ranges über unerschöpfliche Hilfsquellen, während Holland nur ein kleiner Staat mit entsprechend kleiner Armee und Flotte ist. In der Tat verdient es alle Bewunderung, mit welcher staatsmännischen Klugheit und welchem feinen Verständnis für die Seele der Eingeborenen Holland sein Kolonialreich aufgebaut hat und seine Herrschaft dort mit geräuschloser Zurückhaltung und doch mit der nötigen Energie zu behaupten versteht. Es ist ein bewährter Grundsatz des Regierungssystems in Holländisch-Indien, die Gefühle und Traditionen der Eingeborenen zu schonen, sie mit dem Bewußtsein zu erfüllen, daß es in der Verwaltung gerecht und reinlich zugeht, und die einheimischen Autoritäten, denen das Volk sehr ergeben ist, zum Mitregieren heranzuziehen. Dieser klugen Verwaltungspolitik und der richtigen Behandlung der Eingeborenen hat Holland es zu verdanken, daß in Java seit beinahe hundert Jahren völlige Ruhe herrscht. Die holländische Kolonialarmee ist ein Söldnerheer. Sie besteht aus ungefähr 1400 europäischen Offizieren und 37 000 Mann, von denen nur 14 000 Europäer, die übrigen aber Eingeborene sind. Dazu kommt eine kleine Kolonialkriegsflotte.
Auf die Beschreibung des Ostens von Java nebst den der Küste vorgelagerten Inseln Madura und Bali muß hier wegen Raummangels verzichtet werden, davon vielleicht ein anderes Mal. Aber bevor wir »die Perle Insulindes« verlassen, sei noch rasch ein Blick auf ihr bedeutendstes Baudenkmal geworfen, den uralten Riesentempel Borobudur, der sich einige Meilen von Djokjakarta mitten im Ackerlande erhebt, eines der großartigsten und kulturgeschichtlich wichtigsten Heiligtümer des Buddhismus. Es ist eine Art Pyramide von 30 m Höhe, in zehn Terrassen stufenförmig ansteigend, mit einer quadratischen Grundfläche von 606 m Umfang. Auf allen vier Seiten führen Treppen hinauf, so daß man auf jeder Terrasse in der Runde herumgehen kann. Diese große, aus hartem Trachyt bestehende Pyramide ist nun über und über mit bildnerischem Schmuck bedeckt, mit 1504 mächtigen Reliefplatten, von denen jede zahlreiche Figuren und andere Darstellungen enthält, und 441 Buddhastatuen. Die Darstellungen behandeln hauptsächlich Szenen aus der Geschichte Buddhas und seiner Jünger und sind zum Teil von großer Feinheit. Alles in allem haben wir da eine jener ungeheuerlichen Leistungen des buddhistischen Kunstfleißes vor uns, wie sie uns schon in Vorderindien häufig überrascht haben. Der Borobudur wurde vermutlich im achten Jahrhundert nach Christus zu bauen begonnen, also zu einer Zeit, als die Bevölkerung Javas sich noch zum Buddhismus bekannte.