
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
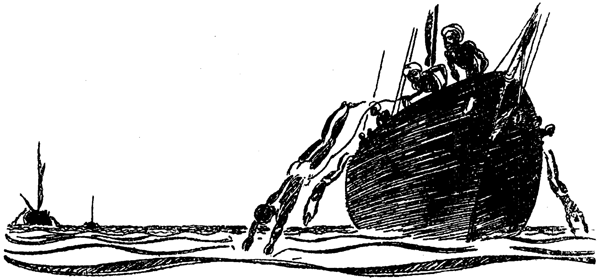
Geschichtlicher Rückblick – Madura und der große Tempel – Indische Prachtbauten – Tamulisches Volksleben – Von der Perlenfischerei – Trichinopoly und Tanjore – Indische Zigeuner – Madras – An der Koromandelküste – Die Malabarküste – Der Maharadscha von Travancore – In Cochin und Calicut
Von allen Ländern der weiten Welt hat schwerlich ein anderes so wie Indien die Einbildungskraft des Europäers beschäftigt. Eine geheimnisvolle, halb unbewußte, tief im Blut nistende Sehnsucht hat unseren Geist von jeher nach den Gestaden des fernen heißen Südostens gelenkt, der, wie es hieß, die Urheimat der hellhäutigen arischen Menschenrasse wäre. Schon im grauesten Altertum war es so, schon damals suchte der Okzident in Verbindung mit dem sonnigen Wunderland der Elefanten, der phantastischen Tempelbauten zu kommen, von welchem phönizische Schiffer abenteuerliche Kunde heimgebracht hatten, außerdem aber auch handgreifliche Beweisstücke in Gestalt kostbaren Zierats und duftender Gewürze. Alexander der Große drang bis an die Ostgrenze des Pandschab vor, fuhr den Indus bis zu seiner Mündung hinab und ließ mazedonische Truppen im eroberten Land zurück. Arabische Händler vermittelten den Warenaustausch zwischen Indien und Europa. Aber zu innigeren Beziehungen zum Abendland ist Indien doch erst zweitausend Jahre später im Zeitalter der großen Entdeckungen gelangt, nachdem der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama nach der ersten Umschiffung Afrikas 1498 in Calikut an der Malabarküste gelandet war und dort freundliche Aufnahme gefunden hatte.
Für Indien bedeutete diese erste ausgiebige Berührung mit den Vertretern abendländischer Kultur den Beginn des allmählichen, unaufhaltsamen Unterganges seiner politischen Selbständigkeit. Zuerst waren es die Portugiesen, die sich höchst selbstherrlich und anmaßend im Süden des Landes festsetzten und dort die arabischen Händler verdrängten, dann kamen die Holländer und begründeten die Holländisch-Ostindische Handelskompanie, der bald darauf eine englische, eine dänische und eine französische folgte. Es dauerte nicht lange, und England verstand es mit seinen schon bedeutenden kolonialen Erfahrungen und seiner zähen Tatkraft, unterstützt durch eine starke Flotte, die Oberhand in Indien zu gewinnen. Indem sie die Eifersüchteleien der zahlreichen eingeborenen Fürsten geschickt benützte und gegeneinander ausspielte, sicherte sich die Britisch-Ostindische Handelskompanie auf dem so harmlos und friedlich erscheinenden Wege von Handelsverträgen ein Vorrecht nach dem andern, bis sie allmählich auch die politische Macht in die Hände bekam. Mit Recht darf man sagen, daß das mächtige indische Reich vom englischen Handlungsreisenden erobert worden ist.
Eine Zeitlang schien es, als ob die von Colbert begründete Französisch-Ostindische Handelskompanie im Konkurrenzkampf den Sieg davontragen würde. Es kam im achtzehnten Jahrhundert auf indischem Boden zwischen Engländern und Franzosen zu schweren Kämpfen um die Vormacht in Indien. Sie endigten mit dem Siege Englands. 1770 löste sich die Französisch-Ostindische Kompanie auf, und England hatte nun keinen ernsthaften Nebenbuhler mehr im Lande, denn die ostindischen Besitzungen der anderen europäischen Staaten – heute sind nur noch Frankreich und Portugal in Ostindien vertreten – waren und sind ganz unbedeutender Art. Unter dem ersten Generalgouverneur Warren Hastings (1774-85) dehnte England seine Macht in ebenso energischer wie rücksichtsloser Weise immer mehr aus. Auch die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist noch angefüllt mit unaufhörlichen Kämpfen mit einzelnen Fürsten, die zähen Widerstand leisteten, von denen aber doch einer nach dem andern die Überlegenheit der englischen Waffen und des abendländischen Geistes anerkennen mußte. So setzte sich England in Indien so fest in den Sattel, daß selbst der gefährliche große Aufstand der eingeborenen Truppen von 1857/8 unter Führung von Nana Sahib die britische Oberherrschaft nicht mehr beseitigen konnte. Der glücklich niedergeschlagene Aufstand gab die Veranlassung dazu, daß Indiens Verwaltung 1858 auf die englische Krone überging und der Generalgouverneur von jetzt ab als Vizekönig regierte. Später legte sich die Königin Viktoria den Titel Kaiserin von Indien bei und Indien wurde zum Kaiserreich erhoben. Die zahlreichen eingeborenen Fürsten, rund siebenhundert, sind zwar im Besitz ihrer Herrschaft belassen worden, einige von ihnen gelten auch als »unabhängig«, aber sie sehen sich in ihren politischen Rechten aufs äußerste beschränkt und sie stehen dermaßen unter britischer Kontrolle, daß sie in Wirklichkeit nur in internen, ihre persönlichen Angelegenheiten und ihre eingeborenen Untertanen betreffenden Fragen Selbständigkeit besitzen.
*
Wie ein etwas längliches, spitzes Dreieck, dessen nach Süden gerichtete Spitze das Kap Comorin bildet, dehnt sich südlich von Haiderabad zwischen dem Arabischen Meer und dem Meerbusen von Bengalen der südlichste Ausläufer Indiens aus, im Westen von der gebirgigen Malabarküste, gegen Osten von der flachen, sandigen Koromandelküste eingerahmt und durch den Golf von Mannar sowie die Palks Bai von Ceylon getrennt.
Seit 1914 ist Ceylon mit dem indischen Festland durch eine Eisenbahn verbunden, die über die unterseeische Sandbankkette der Adamsbrücke von Mannar auf ceylonischer Seite direkt nach Madura führt. Vor Eröffnung dieser neuen bequemen Linie war es etwas umständlich, von Ceylon nach Indien zu gelangen, da war man lediglich auf den kleinen Dampfer angewiesen, der in fünfzehnstündiger, bei Monsun recht unangenehmer Fahrt von Colombo über den Golf von Mannar nach Tuticorin fuhr.
Wohl die allermeisten Besucher Indiens haben das Land ihrer Träume zum erstenmal an dieser Stelle betreten und sich nach den auf Ceylon empfangenen schönen Eindrücken hier wahrscheinlich etwas enttäuscht gefühlt. Denn weder die unbedeutende Stadt Tuticorin noch die flache, sandige, im Dunst der Hitze förmlich verschwimmende Küste ringsum gibt einen verheißungsvollen Vorgeschmack von den erwarteten Wundern Indiens, und auch aus der Eisenbahnfahrt nach Madura bekommt man kaum etwas sonderlich Bemerkenswertes zu sehen. Es geht über flaches, sonneverbranntes Land, durch endlose Reis- und Getreidefelder, durch Baumwollpflanzungen, über Weidestriche mit äsendem Vieh, an schattenlosen Tamulendörfern mit dürftigen Lehmhütten vorbei, und außer den isolierten Felskuppen, die hier und dort die Ebene überragen und zuweilen mit alten Befestigungsbauten, mit Tempeln und Klöstern besetzt sind, unterbricht nichts die Eintönigkeit dieser keineswegs bezaubernden Gegend.
Aber stärkere Eindrücke harren des Reisenden, wenn ihn der Zug nach fünf Stunden in Madura absetzt, der uralten, schon von Plinius erwähnten Hauptstadt des ehemaligen mächtigen Pandya-Reiches. Die nahezu quadratisch geformte, von Reisfeldern umgebene Stadt mit 135 000 Einwohnern wurde bereits mindestens 500 Jahre vor Christus gegründet. Die Handelsbeziehungen der alten Römer zu Indien, von denen u. a. zahlreiche Funde römischer Münzen in Südindien Kunde geben, hatten ihren Sammelpunkt in Madura. Nach einer sehr wechselvollen Geschichte, in der auch die schweren Kämpfe der von Norden her eindringenden, dann nach Ceylon weiterziehenden Singhalesen eine große Rolle spielten, erreichte Madura im siebzehnten Jahrhundert den Höhepunkt hinduistischer Kultur; aus dieser Zeit stammen die gewaltigen, prachtvollen Tempelbauten, die der Stadt das charakteristische Gepräge verleihen und selbst in diesem klassischen Lande Prunkhafter religiöser Kunst nicht ihresgleichen haben.
Hier seien zunächst einige allgemein orientierende Bemerkungen über einen Hauptreiz Indiens eingeschaltet, eben über diese heiligen Prachtbauwerke, die es hierzulande in so erstaunlicher Menge gibt und die durch ihre Eigenart jeden ernsthaften Reisenden, vor allen aber den Kunsthistoriker, im höchsten Grade fesseln.
Viele von ihnen liegen freilich schon längst in Trümmern, aber auch ihre Ruinen sind nicht wertlos und bilden obendrein in der üppigen tropischen Vegetation, die um sie herum und zwischen ihnen wuchert, einen besonderen landschaftlichen Reiz. Allen indischen Baudenkmälern ist ein verwirrender Reichtum an Ornamenten eigentümlich, auch das Phantastische der Form und bei vielen eine gewaltige Ausdehnung. Schon in den ältesten Heldenliedern der Inder finden wir Berichte über die Wunderbauten, die von den sagenhaften Fürsten und Großen uralter Vorzeit errichtet worden sind. Wir würden diese überschwenglichen Berichte wohl für poetische Phantasien halten, wenn wir nicht mit eigenen Augen Hunderte von Bauten sähen, die an Größe und Pracht nicht hinter dem z2urückbleiben, was uns die alten Geschichtsschreiber erzählen. Die ältesten Baudenkmäler Indiens sind großenteils leider zerstört und gänzlich vom Erdboden verschwunden, denn das Land wurde häufig von fremden Erobererscharen heimgesucht, die die prachtvollen Tempel und Paläste vernichteten, um mit den Steinen und Einzelteilen neue Bauten in ihrem, der Eroberer, Sinne auszuführen. Das geschah besonders mit den Kultusstätten der von den Besiegten verehrten Gottheiten, die nun den neuen Göttern der Sieger weichen mußten. Immerhin sind auch aus den ältesten Zeiten Indiens einige Bauwerke, hauptsächlich im Innern des Landes, wohin die fremden Eroberer nicht so leicht gelangen konnten, erhalten geblieben; zu ihnen gehören die Grotten- und Felsentempel von Elephanta, Salsette, Bang, Karli und anderen Orten. Diese unterirdischen Tempel gehen allerdings nicht über die brahmanische Zeit, also ungefähr das neunte Jahrhundert vor Christus, zurück und stammen aus dieser Zeit zumeist auch dort, wo sie für den buddhistischen Kultus umgestaltet wurden. Bei dem Mangel an historischem Sinn, der für die Inder und auch für ihre Literatur bezeichnend ist, geben die schriftlichen Überlieferungen nur sehr unsichere Anhaltspunkte zur Bestimmung des Alters der indischen Bauwerke. Monumentale Profanbauten gibt es nur in verschwindend geringer Zahl. Fast alle Prachtbauten des Landes waren dem religiösen Kultus gewidmet oder standen doch in innigsten Beziehungen zu diesem. Wir haben da zwischen dem brahmanischen, dem buddhistischen und dem islamitischen Kultus zu unterscheiden, daneben gibt es noch die Tempel der Dschainas, einer Sekte, deren religiöse Vorstellungen dem Brahmaismus und dem Buddhismus zugleich entnommen waren und die ein Mittelglied zwischen diesen beiden Religionen bildete.
Ursprünglich hatte weder die brahmanische noch die buddhistische Religion das Verlangen nach bedeutenden Bauwerken für ihren Kultus. Es genügte hierfür ein kleiner, abgeschlossener Raum, der als Aufstellungsort für das Bildnis des Gottes oder des göttlichen Buddha diente und gern in mystischem Halbdunkel gehalten wurde. Diese Bevorzugung eines geheimnisvollen Dämmerlichtes macht es erklärlich, weshalb viele Tempel in Grotten angelegt wurden oder weshalb man zur Herstellung einer künstlichen Grotte das Gestein mit großer Mühe ausbrach und entfernte. Da die Andächtigen sich außerhalb des Allerheiligsten, in dem nur die Blumen- und Tieropfer dargebracht wurden, versammelten, schuf man vor dem Tempel oder um ihn herum geräumige Plätze mit offenen Hallen, in denen die Versammelten Schutz vor Sonne und Regen fanden und die aus der Ferne gekommenen Pilger auch nächtigen konnten. Die den ganzen Tempelbezirk abschließenden Mauern wurden der religiösen Würde entsprechend mit schönen Pforten und Türmen und reichem Skulpturenschmuck verziert. Innerhalb und außerhalb der Tempelmauern siedelten sich Händler mit ihren Buden an, die Eßwaren, Kultusgegenstände und dergleichen zum Verkauf ausboten. Diesen Gewohnheiten ist man auch heute noch treu geblieben, und da sich bei feierlichen Gelegenheiten zu den Krämerbuden und Garküchen auch noch die Zauberer, Gaukler, Akrobaten und allerlei »heilige« Wundermänner gesellen, haftet diesen religiösen Festen immer etwas Jahrmarktsartiges an.
In der Nähe buddhistischer Kultusstätten werden gern kleine Säulen errichtet, die, mit religiösen Symbolen versehen, von reichen und angesehenen Männern dem Gedächtnis des großen Religionsstifters gewidmet waren. König Asoka hat Tausende solcher Gedenksäulen errichten lassen. Außerdem wurden überall kuppelförmige Dagobas oder Topen gebaut, kleine Kapellen, in denen das Bildnis Buddhas, vielleicht auch angebliche Reliquien von ihm untergebracht waren. Für Priester und Mönche wurden ferner Viharas errichtet, große klosterartige Gebäude, in denen sich, um einen offenen Innenhof gruppiert, zahlreiche Zellen befanden. Aus der Verbindung aller dieser verschiedenen Bauelemente entstanden schließlich hier und dort an besonders beliebten Wallfahrtsstätten großartige Tempelanlagen, umfangreiche Komplexe von Tempeln, Klöstern, Dagobas, geräumigen Höfen, Türmen, Mauern und Toren. Die Gedächtnissäulen entwickelten sich oft, da von ihren Stiftern einer den andern übertreffen wollte, zu riesigen, nach oben verjüngten Pagoden. Besonders auffallend an allen diesen Bauwerken ist eine für unser ästhetisches Gefühl fast unerträgliche Häufung von Sinnbildern, Figuren und Ornamenten, meistens mit unsäglicher Mühe und Sorgfalt bis ins Kleinste hinein gemeißelt und geformt. Wir bewundern die ungeheuren Arbeitsleistungen, die in diesen Verzierungen liegen, ebenso wie die religiöse Inbrunst, die zu einer solchen Arbeit befähigte, aber unser so gänzlich anders geartetes Empfinden fühlt sich von dem chaotischen Wirrwarr der Dekorationen auf die Dauer doch abgestoßen.
Alles hier Gesagte trifft in besonders auffälliger Weise auf den Riesentempel von Madura zu, der wohl das ausgedehnteste religiöse Bauwerk der Welt ist. Freilich ist es kein einzelnes Bauwerk, sondern ein Komplex von Bauten. Dieses in der Mitte der Stadt gelegene, dem Schiwa gewidmete Heiligtum von fast gleichmäßig quadratischem Grundriß ist eine geradezu ungeheuerliche, das Auge verwirrende Häufung phantastischer Architekturen, ein zu Stein gewordener Traum, die Verkörperung visionärer Gebilde. Eine von neun monströsen Tortürmen überragte Mauer umfaßt den ganzen Tempelkomplex. Die Türme verjüngen sich absatzweise pyramidenförmig nach oben und sind über und über dermaßen mit mythologischen Skulpturen bedeckt, daß es dem Auge unmöglich ist, in diesem Hexensabbath von Figuren und Ornamenten überhaupt noch Einzelheiten zu unterscheiden. Es mag der Fachgelehrsamkeit vorbehalten bleiben, sich in den höchst verzwickten, labyrinthischen Gedankengängen altindischer Mythologie mit ihren tausend dunklen Anspielungen zurechtzufinden. Der mit sotaner Wissenschaft nicht allzu stark belastete Laie begnügt sich mit einem ästhetischen Gesamteindruck, und als das Dominierende dabei herrscht wohl die Bewunderung des ungeheuren, kaum faßbaren Fleißes und Eifers vor, mit dem sich hier die Kunst in den Dienst einer Gottidee gestellt hat. Wenn man bedenkt, daß die technische Bewältigung dieser Baumassen Tausende von Kräften während dreier Jahrzehnte in Anspruch genommen und das Sinnen und Trachten einer ganzen Generation vollkommen ausgefüllt hat, so kann man solchen erstaunlichen Werken von Menschenhand nur größte Bewunderung entgegenbringen, auch wenn sie, wie schon gesagt, im Widerspruch zu unserem gänzlich anders gearteten ästhetischen Empfinden stehen.
Das Innere des Tempelbezirkes ist von großen und kleineren Hallen und Gängen erfüllt, die, teils von hellem Tageslicht durchflutet, teils in mystischem Dunkel liegend, von steinernen Bildwerken und Gemälden aus der Legende förmlich strotzen. Am bemerkenswertesten ist darunter die Tausendpfeilerhalle, so genannt nach den annähernd tausend, zumeist sehr subtil gearbeiteten Pfeilern, die das Dach tragen. Überhaupt ist die außerordentliche Hingabe und Sorgfalt, mit der sich hier allenthalben künstlerisches und handwerkliches Können in den Dienst der Religion gestellt hat, nicht genug zu rühmen. Und dennoch: wir Andersgesinnten vermissen in allem die edle Einfachheit, die Klarheit und Reinheit. Wohin auch das Auge sich wenden mag, überall fällt der Blick auf Fratzenhaftes und Ungeheuerliches, auf Groteskes und Verzerrtes, auf die Ausgeburten einer im finsteren Dämonenkultus schwelgenden Phantasie, die jeden Zusammenhang mit der schlichten, reinen Natur verloren zu haben scheint.
Gern wendet sich das ermüdete Auge von diesen steinernen Dokumenten einer schwer begreiflichen Kunst wieder ab und dem Volksleben zu, das an einem der zahlreichen religiösen Festtage – so ziemlich jeder zweite Tag ist ein Festtag – in farbenfrohester Buntheit um den Tempelbezirk herum und innerhalb seiner Mauern flutet. Wir sind hier im uralten Land der Tamulen, deren Bekanntschaft wir schon auf Ceylon gemacht haben, der dunkelbraunen, fast schwärzlichen Vertreter des höchststehenden Zweiges der Drawida, der heute etwa 17 Millionen zwischen Madras und Kap Comorin umfaßt und zu dem auch die 750 000 ceylonischen Tamulen gehören. Von schlanker, gut gebauter Gestalt, mit angenehm offenen Gesichtszügen, zählen die Tamulen zu den sympathischsten Völkern Indiens, auch als Arbeiter sind sie mehr als andere Rassen geschätzt. Sie haben eine eigene Sprache, das Tamulische, und bekennen sich fast durchgängig zum Schiwakultus, was sie durch das Anbringen wagerechter Farbenstriche auf der Stirn zum Ausdruck bringen, während die Anhänger Wischnus die Linien senkrecht ziehen. Diese Abzeichen werden jeden Morgen im Tempel erneuert. Von entzückend malerischem Reiz sind die farbenbunten Trachten der Tamulfrauen. Gelb und blau, grün und rot, in allen Tönen leuchten die Tücher, mit denen sie, anmutig schreitend, die bronzefarbenen Glieder umschlingen. Die Männer niederen Standes bewegen sich größtenteils mit entblößtem Oberkörper, die kleinen Kinder sind meistens nackt bis auf eine zierliche, vorn mit einem kleinen Metallschild (einer Art Feigenblatt!) versehenen Schnur um die Hüften. Zwischen der drängenden, flutenden Menge der Staubgeborenen schreiten gravitätisch hoheitsvolle, korpulente Brahmanen mit der ganzen Arroganz ihrer Kaste; für den ungläubigen Fremden haben sie nur höchst geringschätzige Seitenblicke übrig. Sie betrachten sich als »menschliche Götter« mit vier Vorrechten: dem Anspruch auf Ehrerbietung, dem Anspruch auf Geschenke, der Unbedrückbarkeit und der Untötbarkeit. Reiche Brahmanenfrauen, ganz in feinste Seide gehüllt, mit schönem Schmuck überladen, lassen sich in den landesüblichen Karren, den zweirädrigen, von weißen Buckelochsen gezogenen Tongas, spazieren fahren. Vor den Tempelmauern haben Krämer ihre Verkaufsstände aufgeschlagen, bieten allerlei Tand, Rosenkränze und sonstige Kultgegenstände an, fliegende Eßwarenhändler rufen Süßigkeiten und Limonaden aus, Bettler in Unmenge strecken den Vorübergehenden verkrüppelte Gliedmaßen, grauenhafte Wunden entgegen, »heilige« Samnyasi oder Fakire, die unverschämtesten Vagabunden, eine wahre Landplage Indiens, fordern gebieterisch ihren Tribut, Schlangenbeschwörer, Akrobaten, Gaukler aller Art suchen die Aufmerksamkeit auf ihre Produktionen zu lenken, denn auch sie wollen leben und die Kupfermünzen in ihrem Sammelteller klappern hören. Und über dem allen, über Tempeln, Häusern und Straßen, über steinernen Göttern und lebendigen Heiligen, über Reichen und Armen, Gerechten und Ungerechten strahlt der glühend heiße Himmel, die Sonne Indiens.
*
Wie schon im ersten Band dieses Werkes, im Ceylonbuch, berichtet wurde, habe ich mich eine Zeitlang vorübergehend im Perlenfischereifach betätigt, ohne dabei auf den so beliebten »grünen Zweig« zu kommen, denn man hat es im indischen Perlengeschäft mit Konkurrenten zu tun, gegen deren skrupellose Verschlagenheit kein Europäer aufkommen kann. Aus diesem Anlaß hatte ich wiederholt südöstlich von Madura in Nähe der Adamsbrücke zu tun, der Sandbankkette, die das Festland mit Ceylon verbindet. Hier im Golf von Mannar befinden sich hauptsächlich die Bänke der Perlenaustern, hier werden die unscheinbaren Muscheln mit ihrem oft so kostbaren Inhalt zutage gefördert, und da die Perlenfischerei mit ihrem ganzen Drum und Dran sehr interessant ist, dürfte eine kurze Beschreibung der dabei angewandten Methoden wohl angebracht sein.
In den südindischen Gewässern wird die Perlenfischerei größtenteils noch nach uraltem Brauch mit einfachem Tauchen ohne Verwendung von Taucherkostümen und sonstigen Apparaten betrieben. Es ist ein mühseliger, anstrengender Beruf, denn im Durchschnitt können es die Perlenfischer beim Tauchen höchstens zwei Minuten unter Wasser aushalten, und sie müssen deshalb sehr oft in die Flut hinabspringen, um ein hinlänglich großes Quantum von Perlenmuscheln ans Tageslicht zu befördern. Jeder Taucher taucht an einem Arbeitstage ungefähr 40-50 mal und bringt dabei insgesamt 1000-2000 Muscheln herauf, die er unten mit einem Messer vom Meeresgrund ablöst. Die indische Seeperlmuschel lebt in größeren Gruppen in Tiefen von 6-30 Meter auf Bänken, meist von Korallengrund. Die Perlen bestehen aus zahlreichen winzig dünnen Schichten organischer Substanz und kohlensauren Kalkes, genau wie die Perlmutter, und werden dadurch gebildet, daß die Muschel einen in ihr Inneres gelangten Fremdkörper mit dieser Substanz allmählich überzieht. Nach neuesten Forschungen sollen die Fremdkörper, die den Anlaß zur Entstehung der Perle geben, die Embryonen eines im Meere lebenden Wurmes sein; sie dringen in die Muschel ein und üben dort an irgendeiner Stelle des Innern einen der Muschel lästigen Reiz aus, der die Absonderung der Perlmuttersubstanz und die Umkleidung des Fremdkörpers mit der Substanz hervorruft. Man hat bekanntlich versucht, auf künstlichem Wege Perlen zu erzeugen, indem man in die lebende Muschel winzige Fremdkörper einführt, aber die damit erzielten Resultate sind nicht sehr befriedigend.
Die indische Perlenfischerei ist Regierungsmonopol, und die Regierung verpachtet entweder das Nutzungsrecht oder gibt es zu gewissen Zeiten unter bestimmten Bedingungen frei. Infolge der lange Zeit hindurch betriebenen Mißwirtschaft sind viele einst ergiebige Perlenbänke größtenteils oder völlig erschöpft, aber die Regierung gibt sich alle Mühe, die Ertragsfähigkeit wieder zu heben. Eine Londoner Gesellschaft, die die Perlenfischerei 1903 in Pacht genommen hatte, machte nach einigen erfolgreichen Jahren so schlechte Geschäfte, daß sie es vorzog, ihren Vertrag unter Opfern zu lösen. Die ganze Perlenfischerei ist bei der Unberechenbarkeit aller dabei in Betracht kommenden Faktoren ein höchst unsicheres Geschäft, eine gewagte Spekulation.
Sobald die Regierung eine Perlmuschelbank zur Ausnutzung freigibt, wächst in der Nähe am Strande schnell eine Budenstadt empor, in der die von allen Seiten herbeigeströmten Fischer hausen. Am Eröffnungstage ist dann das Meer rings um die Bank, die immer etwa 10 Seemeilen von der Küste entfernt liegt, von Segelbooten umschwärmt. Jedes Boot enthält ungefähr 20 Taucher und deren Mandaks oder Assistenten, von denen zu jedem Taucher zwei gehören, im ganzen also etwa 60 Mann. Das Gewässer über den Muschelbänken ist durch Absteckung mit Flaggen gekennzeichnet. Endlich ertönt, mit fiebernder Spannung erwartet, vom überwachenden Regierungsdampfer her ein Kanonenschuß, das Zeichen zur Eröffnung der Fischerei, und in demselben Augenblick springen Hunderte von dunkelhäutigen Tauchern ins Meer hinab, um die Hüften einen Korb, in den sie die vom Meeresgrunde aufgesammelten Schaltiere tun. Ungefähr zwei Minuten bleiben sie unten, dann schnellen sie sich wieder empor an die Bootsseite, wo ihre Mandaks ihnen die heraufgebrachte Ladung abnehmen. Sobald ein Taucher erschöpft ist, tritt ein anderer an seine Stelle, denn auch die Zeit, in der gefischt werden darf, ist genau bestimmt. Es heißt also, die kostbare Zeit nach besten Kräften ausnutzen; kann doch ein einziger glücklicher Zug den Tauchern ein Vermögen einbringen.
Gewöhnlich dauert das Fischen täglich sechs Stunden, dann gibt ein zweiter Kanonenschuß das Signal zum Aufhören. Jetzt fahren die Boote an Land, wo sich ein lebhaftes Treiben entwickelt. Eine bunt zusammengewürfelte Menge von Händlern wartet ungeduldig auf das Ausladen, Verteilen und Versteigern des Fanges. Hier kann man Inder, Moormen, Araber, Juden, Griechen, Perser und noch ein Dutzend andere Nationalitäten sehen, die einander mit scheelen Augen betrachten und bei ihrem brennenden Konkurrenzneid leicht Händel anfangen, während Beamte und Polizei sich nach Kräften bemühen, die Menge in Ordnung zu halten.
Sofort nach Ankunft der Boote wird jedes entladen und die Ladung nach dem offiziellen Stapelplatze gebracht, wo man jede Bootsbeute in drei gleiche Teile teilt. Zweidrittel der Beute gehören nämlich der Regierung, ein Drittel verbleibt den Fischern, die ihren Anteil in Partien von zehn bis hundert Muscheln sogleich unter den Händlern versteigern, während die Regierung ihren Anteil in großen Posten von tausend Stück versteigert. Es ist für die Händler das reine Glücksspiel. Hat einer Glück, so findet er in nur zehn ersteigerten Muscheln unter Umständen zehn Perlen; hat einer Pech, so bringen ihm auch tausend Muscheln nicht eine einzige Perle von einigermaßen erheblichem Werte ein. Im Durchschnitt rechnet man auf tausend Muscheln eine größere Perle. Man wirft die Muscheln auf Haufen, läßt sie absterben und faulen und wäscht die verweste Masse in geneigten, mit feinen Abzugslöchern versehenen Holzkästen, bis alle Weichteile der Tiere entfernt sind. Die Perlen bleiben dann zurück.
Am wertvollsten sind die ganz runden und die regelmäßig tropfenförmigen Perlen, während die unregelmäßig geformten, häufig sehr großen sogenannten Barockperlen bedeutend geringeren Wert haben. In früheren Zeiten standen gerade die Barockperlen in höherer Gunst, weil sie von den Juwelieren gern zu Schmucksachen von grotesker Form verarbeitet wurden. Eine wertvolle Sammlung solcher Barockperlen befindet sich im Dresdener »Grünen Gewölbe«. Bei den regelmäßig geformten Perlen wird der Wert nicht nur von der Größe, sondern auch von Farbe und Glanz bestimmt. Neben der häufigsten perlgrauen Farbe gibt es auch weiße, gelbliche, rosige, grünliche, kupferfarbige, ja sogar tiefschwarze Perlen, letztere sind wegen ihrer Seltenheit besonders kostbar. Eine vollkommene Perle darf nicht die kleinsten Risse und Flecken haben, sie muß von glänzender, zarter Struktur sein und jenen irisierenden Schimmer zeigen, der das Auge des Kenners entzückt. Es gehört große Sachkenntnis und lange Erfahrung dazu, um Perlen richtig abzuschätzen, besonders heute im Zeitalter raffiniertester Fälschungen. Übrigens lassen sich weniger schöne Perlen durch ein allerdings sehr schwieriges Veredelungsverfahren oft in tadellose Perlen verwandeln. Sie werden dann nämlich geschält, das heißt, man trägt die oberste Schicht behutsam ab und entdeckt darunter dann nicht selten eine neue Haut von vollkommener Schönheit.
*
Von Madura führt die große südindische Eisenbahnlinie weiter nach Trichinopoly und Tanjore und dann an der Koromandelküste entlang nordwärts nach Madras.
Beim Namen der Stadt Trichinopoly denkt man natürlich gleich an Trichine. Aber mit diesem unangenehmen Schmarotzer hat die Stadt nicht das geringste zu tun, vielmehr ist der Name nur eine Korruption des indischen Wortes Tirutchinapalli, wie der Engländer es eben liebt, sich solche Namen, deren Aussprache ihm Schwierigkeiten bereitet, durch Veränderung einfach mundgerecht zu machen. Trichinopoly, Distriktshauptstadt mit 124 000 Einwohnern, verdankt seinen landschaftlichen Reiz einer hohen, gebuckelten Felskuppe, die mitten in der Stadt hinter einem großen Stauteich aufragt und auf ihren Gipfeln umfangreiche Tempelbauten trägt. Aber den an der Stadt vorbeifließenden Cauvery, einen der heiligen Ströme der Hindu, an dessen Badeplätzen sich morgens immer ein buntes Leben entwickelt, gelangt man nach der kleinen Nachbarstadt Srirangam, berühmt durch ihren Wischnutempel, den umfangreichsten in ganz Indien. Die ganze Anlage erinnert stark an den Tempel von Madura, auch hier sehen wir wiederum die gewaltigen, pyramidenförmig abgestuften Tortürme, die Unmasse von mythologischen Skulpturen und Ornamenten, auch hier gibt es eine Halle der tausend (genau 940) Säulen, von denen jede einzelne in Höhe von fast fünfeinhalb Meter aus einem einzigen Granitblock herausgehauen und mit plastischem Schmuck bedeckt ist – eine Arbeit von kaum vorstellbarer Mühseligkeit! Srirangam ist der wichtigste Wallfahrtsort des Landes. Täglich treffen Kranke und Krüppel ein, die oft wochenlang unter Beschwerden und Entbehrungen aller Art unterwegs waren, um nun hier den Göttern ihre Bitten vorzutragen, diesen fratzenhaften Göttergestalten, die eher den bösesten Dämonen gleichen. Ein Blick auf die dargebrachten Opfer, die im Tempelschatz vereinigt sind, auf diese Fülle von Perlen und Edelsteinen, von goldenem und silbernem Zierat und kostbaren Geweben, zeigt deutlich die grenzenlose Hingabe der Gläubigen an die verehrte Gottheit. Wer will sich vermessen, die Rätsel des Glaubens lösen zu wollen! Alljährlich, meist im Dezember oder Januar, findet unter ungeheurem Zustrom von Pilgern aus allen Teilen des Landes ein zehntägiges Hauptfest statt, bei dem es, wie es so üblich ist, sehr jahrmarktsmäßig und mitunter auch sehr unheilig zugeht, denn außer den Massen der Gläubigen geben sich dann auch Tausende von fahrenden Leuten, von Gauklern, Krämern und Bettlern, in Srirangam ein Stelldichein.
Auch die nächste Stadt, Tanjore (Tandschur gesprochen), berühmt durch die Kunstfertigkeit ihrer Handwerker, durch ihre getriebenen Arbeiten aus Kupfer und Silber und ihre Seidenweberei, hat einen vielbesuchten Schiwatempel mit einem schlechterdings unaussprechlichen Namen, weshalb er hier gar nicht erst wiedergegeben werden soll. Ich hatte in Tanjore Gelegenheit, als Zuschauer an einem großen Tempelfest teilnehmen zu dürfen, das sonst für Europäer unzugänglich ist. Zunächst sei aber erwähnt, aus welchem Anlaß ich mich damals längere Zeit in Tanjore und den benachbarten Städten aufgehalten habe. Eines Tages waren nämlich bei mir in Colombo ein paar Amerikaner erschienen, die den Auftrag hatten, für ein großes amerikanisches Unternehmen eine umfangreiche Truppe von indischen Akrobaten, Bajaderen, Fakiren, Schlangenbeschwörern usw. zusammenzustellen, und denen es trotz monatelangen Reisen und allen Bemühungen nicht gelungen war, ihr Ziel zu erreichen. Sehr begreiflicher Weise, denn landfremde Leute können in dieser Hinsicht in Indien gar nichts ausrichten, mit dem »großen Portemonnaie« allein ist es da nicht getan, dazu muß man Land und Leute gründlich kennen und muß mit den Eingeborenen so sprechen, wie sie es verstehen. Nachdem die Herren mit ihrem Latein zu Ende waren und nicht mehr wußten, was sie anfangen sollten, kamen sie also zu mir und fragten, ob ich die Zusammenstellung der Truppe übernehmen wollte. Wir wurden unter der Bedingung handelseinig, daß man mir zwei Monate Zeit ließ, und so trat ich denn die Reise nach Madura, Trichinopoly, Tanjore und Madras an. Es ist sehr schwer, gute indische Kräfte der gewünschten Art für eine Kunstreise ins ferne Ausland zu gewinnen, von dem die Eingeborenen bei ihrer abgrundtiefen Unbildung natürlich die abenteuerlichsten Vorstellungen haben. Schon der Gedanke an die wochenlange Seefahrt flößt ihnen Grauen ein. Tausend Bedenken sind da zu zerstreuen, Äußerungen des größten Mißtrauens und Aberglaubens zu widerlegen, und das alles erfordert Zeit und endlose Verhandlungen, denn der Inder ist kein Mensch, dem irgend etwas »pressiert« und der seine Entschlüsse im Handumdrehen faßt.
In Madura und Trichinopoly hatte ich wenig Glück, aber in Tanjore lernte ich einen reichen Brahmanen kennen, der nicht so hochmütig und zugeknöpft war, wie es sonst bei seiner Kaste üblich ist, sondern als aufgeklärter, intelligenter Mann sogleich mit Vergnügen auf meine Ideen einging. Seinen weitreichenden Beziehungen hatte ich wertvolle Anknüpfungspunkte zu verdanken, auch stellte er mir ein schönes Ochsenfuhrwerk zur Verfügung, mit dem ich den ganzen Landbezirk von Tanjore bereiste. Es gelang mir, vier Bajaderen und sechs Musikanten mit Geld und guten Worten dahin zu bringen, daß sie sich engagieren ließen und die weite Reise über den Ozean nach Amerika antraten. Wenn ich hier von »Bajaderen« spreche, so folge ich dem europäischen Wortgebrauch, denn, wie schon im Ceylonbuche bemerkt wurde, ist in Indien der Ausdruck Bajadere für Tänzerin unbekannt. Die heiligen Tänzerinnen, die zum religiösen Kultus gehören und im Tempel wohnen, heißen Dewedaschies. Diese echten »Bajaderen« kommen nicht in nur die geringste Berührung mit Europäern und sind natürlich unter keinen Umständen für »Kunstreisen« zu gewinnen. Was der Europäer unter einer Bajadere versteht und was ihm als solche vorgeführt wird, das sind nicht heilige, sondern höchst weltliche Tänzerinnen, in Indien »Nautsch-Girls« genannt. Es gibt deren die verschiedensten Arten, solche sehr vornehmen Ranges, die im Privatdienst von Fürsten stehen, und solche der untergeordneten Klasse, an deren Künsten sich der Mann von der Straße ergötzt.

Indische Zigeuner-Akrobaten. (Text Seite 17)

Indische Straßenszene: Schlangenbeschwörer und Gaukler
Nach einer meiner Erkundigungsreisen entdeckte ich auch in einem Dorf einen ganzen Trupp indischer Zigeuner-Akrobaten mit ihren Eseln, Zelten und Apparaten. Es gibt auch noch heute in Indien, der Urheimat des rätselhaften Nomadenvolkes, Zigeuner, die man also als Originalzigeuner bezeichnen kann. Ihre Zahl ist allerdings gering, sie wird auf nur 20 000 geschätzt, während sich in Europa nahezu eine Million Zigeuner aufhält. Die indischen Zigeuner gehören einer unreinen, verachteten Kaste an, aber ihre Körper sind schlank und sehnig und ihre Gesichtszüge, die sofort an die Züge unserer europäischen Zigeuner erinnern, meistens von feinem Schnitt. Als Gaukler und Akrobaten leisten sie Vorzügliches. Daß die in aller Welt zerstreut lebenden Zigeuner aus Indien stammen, daran wird heute nicht mehr gezweifelt, hängt doch ihre Sprache eng mit dem Zend zusammen. In Deutschland sind die Zigeuner auf ihrer großen Wanderung zum erstenmal zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts aufgetaucht.
Die Zigeunertruppe nun, die ich auf meiner Rundfahrt traf, überraschte mich durch ihre ausgezeichneten Leistungen dermaßen, daß ich beschloß, sie ebenfalls für Amerika zu engagieren. Das war insofern nicht ganz leicht, als die Leute das Handgeld, das ich ihnen gab, sofort dazu benützten, sich sinnlos zu betrinken, und zwar mit dem aus der Kokosnuß gewonnenen und gegorenen Toddysaft. Ich mußte sie also erst wieder nüchtern werden lassen, worauf sich dieselbe Komödie, erst Handgeld, dann Kanonenrausch, prompt wiederholte. Da ich auf diese Weise die Bande nicht einmal nach Colombo, geschweige denn nach Amerika spediert hätte, sagte ich dem Zigeunerhauptmann, daß es jetzt erst an Bord des Schiffes in Colombo neues Handgeld gäbe, sie könnten sich dann auf der Überfahrt soviel betrinken, wie sie Lust hätten. Es ist mir denn auch gelungen, die braunen Burschen über das große Wasser zu schicken, außerdem noch Zauberer, Schlangenbeschwörer, Bärendresseure und andere zugkräftige »Nummern«. Was den Amerikanern nicht in vier Monaten geglückt war, hatte ich in sechs Wochen zustande gebracht, und die Truppe fand in Amerika einen derartigen Beifall, daß man immer wieder mit Aufträgen ähnlicher Art an mich herantrat. Übrigens sind die von mir engagierten Inder von ihren »Kunstreisen« immer als reiche Leute zurückgekehrt, das heißt natürlich nach ihren bescheidenen Begriffen reich.
Meine Bekanntschaft mit dem angesehenen Brahmanen in Tanjore hatte also gute Früchte getragen und ihr verdankte ich auch, wie schon erwähnt, manches Schauspiel, das sonst, wie jenes große Tempelfest, dem Europäer verborgen bleibt. Von ihm, der heimlich stark dem Haschisch zusprach, wurde ich auch zum erstenmal mit dem Genuß dieses Berauschungsmittels bekannt gemacht, das neben dem viel gefährlicheren Opium – von welchem später noch die Rede sein wird – in Asien eine so große Rolle spielt. Haschisch, ein Hanfpräparat, wird in den verschiedenen Ländern auf verschiedene Art zubereitet und genossen. In Indien zerreibt man die zur Blütezeit der Pflanze gesammelten Blätter, mischt sie mit Wasser oder Milch, gibt etwas schwarzen Pfeffer, auch Zucker und Gewürz dazu und trinkt die grüne Flüssigkeit in kleinen Mengen, während man in anderen Ländern wieder den Haschisch in feste Form bringt und ißt oder raucht. Aber die Wirkungen des Haschischgenusses und seine Folgen sind sehr übertriebene, unrichtige Vorstellungen verbreitet. In Wahrheit hat maßvoller Haschischgenuß für den daran Gewöhnten ebensowenig üble Folgen, wie mäßiger Tabak- und Alkoholgenuß für den, der darin vernünftige Grenzen respektiert, erst der Mißbrauch des Haschisch äußert sich in zerrüttender Weise. Mäßige Haschischgenießer sind heiter und mitteilsam und zu größeren körperlichen und geistigen Leistungen befähigt. So sind z. B. die türkischen Hamals, die Lastträger, die so erstaunlich schwere Lasten tragen, fast ausnahmslos Haschischraucher, das schadet ihnen ebensowenig wie etwa den deutschen Hafenarbeitern ihr Tabak und Schnaps. Erst im Übermaß, besonders in Verbindung mit schlechter Ernährung, hat der Haschisch, wie gesagt, sehr üble Folgen, kann dann zum völligen Zusammenbruch, zu Verblödung und Irrsinn führen. Übrigens bekommt der Anfänger von den angenehmen Wirkungen des Haschisch nichts zu spüren, ihm wird gewöhnlich nur schlecht, wie es ja auch beim Tabak- und Alkoholgenuß den jungen Anfängern zu gehen pflegt.
Auf der Weiterfahrt von Tanjore nach Madras kommt man nahe an der Hafenstadt Pondichéry vorbei, der Hauptstadt des kleinen Restes vom ehemaligen französischen Kolonialreich in Indien. Viel Freude erleben die Franzosen an ihren » Établissements français dans l'inde«, wie es offiziell heißt, gerade nicht. Die Besitzungen umfassen außer dem schläfrigen Pondichéry mit seinen französischen Provinznestmanieren nur noch ein paar unbedeutende Küstenorte und sind auch in wirtschaftlicher Hinsicht ziemlich ohne Belang.
Wie anders mutet da Madras an, die Königin der Koromandelküste, mit 560 000 Einwohnern Indiens drittgrößte Stadt (die größte ist Kalkutta, die zweitgrößte Bombay). Überraschend wirkt die außerordentliche Ausdehnung des Stadtgebiets, das sich an dem sandigen, der Schiffahrt gefährlichen Strande 15 Kilometer lang erstreckt und bis zu acht Kilometer ins Innere hineinragt. Die ganze Gegend ist flach. Genau genommen stellt sich Madras als lockere Vereinigung verschiedener Städte dar, die durch zwei größere Flüsse, durch Kanäle, Tanks, Parkanlagen, weitläufige Villenquartiere und unbebaute Flächen voneinander getrennt sind. Man hat Madras mit einigem Schein von Recht ein Riesendorf genannt, aber dieses Halbmillionendorf hat doch auch sehr großstädtische Einrichtungen und Gebäude von höchster Monumentalität, wie z. B. den Palast des Obergerichts, der zu den umfangreichsten Gerichtsbauten der ganzen Welt gehört.
Wie im kleineren Maßstabe Colombo, gehört auch Madras zu jenen indischen Städten, die der Fremde wegen ihrer übermäßigen Ausdehnung und Unübersehbarkeit nur in Teilerscheinungen und charakteristischen Einzelheiten auf sich wirken lassen kann. Das eng gebaute George Town am Hafen, die Geschäftsstadt mit ihren Banken, Kontoren, Kaufmannsläden, ist das Madras des Handels und Verkehrs. Das benachbarte alte Fort St. George mit seinen Kasernen ist das militärische Madras, von hier nahm die allmähliche Unterjochung Südindiens ihren Ausgang. Die vom Cooumfluß umschlossene Insel mit ihren Parkanlagen und Spielplätzen ist das Madras des Sports. Die beiden weitläufigen Gartenstädte des Egmore- und des Nungambakamviertels mit dem für Südindiens Natur- und Kulturgeschichte höchst wichtigen Museum, dem Gouverneurpalast, den Kirchen, Klubhäusern und Denkmälern bilden zusammen das Madras des Anglo-Inders, und die große Strandpromenade der Marina schließlich ist der allabendliche Treffpunkt von allem, was sich zu »Ganz Madras« zählt, hier entfaltet sich gegen Sonnenuntergang auf viertausend Meter Ausdehnung der Korso von Wagen, Automobilen und Spaziergängern, zu welchen letzteren aber nur der ärmere Eingeborene gehört, da der weiße Kolonist und der wohlhabende Inder sich in der Öffentlichkeit kaum zu Fuß sehen lassen, es sei denn bei Ausübung von Sport. Es ist eine der schönsten Strandpromenaden der Welt, diese Marina, mit ihrem Blick über die flache, von merkwürdig kurzen, hüpfenden Brandungswellen bewegte See, stimmungsvoll aber auch, wenn zur Zeit des Ostmonsuns mächtiges Regengewölk Meer und Land förmlich zu erdrücken scheint und eine unwiderstehliche Schwermut auf Natur und Menschen lastet.
Aller Glanz und Luxus eines auf größtem Fuße lebenden Kolonistentums kommt in den zahlreichen geradezu fürstlichen Europäerbungalows in Nungambakam zum Ausdruck, die mit ihren üppigen Parkanlagen, ihren Spiel- und Sportplätzen vielleicht die größte Sehenswürdigkeit von Madras darstellen. Wie gern möchte der Fremde, der durch die aristokratischen Gartenstraßen wandert, einmal einen Blick ins Innere der prachtvollen Häuser werfen, ihre Bewohner in der Intimität belauschen, ihre Einrichtungen und Kunstschähe sehen. Aber der »gewöhnliche« Globetrotter muß hierauf natürlich verzichten, denn es gehören schon sehr gewichtige Verbindungen und Empfehlungen dazu, um die stolzen Heime ihrer noch stolzeren Besitzer als Gast betreten zu dürfen.
Meine Geschäftsreisen führten mich an der Koromandelküste über Nellore wiederholt bis Bezweda hinauf. In der Gegend von Nellore hatte ich für Carl Hagenbeck in Hamburg eine große Anzahl der berühmten Nellore-Bullen anzukaufen, eine große Zeburasse, die sich besonders zur Kreuzung mit europäischem Rindvieh eignet. Hieraus entwickelte sich ein umfangreiches Geschäft, denn ich wurde nun auch von der englischen Regierung sowie großen amerikanischen Farmern mit der Lieferung von Nellore-Bullen beauftragt. Beim Abtransport der Tiere hatte ich einmal schweres Mißgeschick, denn es herrschte damals im Nelloredistrikt gerade die Cholera, und da meine aus Ceylon mitgebrachten Leute nach unverbesserlicher Art der Eingeborenen von dem verseuchten Wasser tranken, wurden alle sechs von der Krankheit hingerafft, sodaß ich mit meinen zwölf Waggons Bullen in Madras plötzlich allein dastand. – Bemerkenswert im Nelloredistrikt sind auch die bedeutenden Minenbetriebe, die das schöne Marienglas (Gipsspat), das im indischen Kunstgewerbe so starke Verwendung findet, zutage fördern.
Es war schon wiederholt von der Koromandelküste die Rede, die, von den Wogen des Golfes von Bengalen bespült, sich von der Südspitze des indischen Festlands bis hinauf zur Mündung des Kistnastromes erstreckt und in deren Mitte Madras liegt. Ihr Name hat nichts mit der Frucht des Mandelbaumes zu tun, sondern ist von europäischen Ansiedlern aus der indischen Bezeichnung Tscholamandalam, d. h. Land am Tschola, einem früheren selbständigen Staat, gebildet worden. Berückende Landschaftsbilder sind ihr versagt. Fast durchweg flach, sandig und vegetationsarm, hinter zahllosen Dünenwällen verschanzt, die durch Brandung und Stürme immer wieder zerstört wurden, um sich bald darauf immer wieder von neuem zu bilden, ist sie so recht eine Schöpfung des Meeres, das, gleich den indischen Gottheiten Wischnu und Schiwa, Erhalter und Vernichter zugleich ist und den Bewohnern der kargen Küste einen harten Kampf um das bißchen Leben aufzwingt.
Aus der Ferne betrachtet, erscheint das freilich kaum glaubhaft. Wenn der verwöhnte Weltenbummler auf der Fahrt nach Madras oder einem anderen Platz der Koromandelküste an endlos langen, entnervenden Tagen im Faulenzersessel auf Deck seines Dampfers liegt und über die schläfrige, dunstige See nach dem Strande und seinen Palmen blinzelt, dann packt ihn vielleicht für Augenblicke die Sehnsucht, sich aus der Übersättigung der Kultur an jenes idyllische Gestade zu retten; Bilder eines selig stillen, von keinen Enttäuschungen und schmerzlichen Dissonanzen, keinem Hunger nach Macht, keiner Jagd nach Erfolg gestörten Gleichmaßes der Tage mögen lockend vor seine Seele treten. Wie anders dachte er darüber, wenn er nur ein paar Wochen unter den Küstenbewohnern leben müßte, zumal in der schlechten Jahreszeit der herbstlichen Stürme. Wo ist dann der Friede geblieben, das Paradies? Vom schwärzlichgrauen Himmel peitscht der Monsun die Wogen, daß sie in gewaltigen, langschwingenden, sich überstürzenden Rollern dröhnend und heulend die Küste bestürmen. Die entfesselte Wut der Elemente steigert sich dann oft in Zyklonen zum Fortissirno und räumt im Handumdrehen mit Fischernetzen, Booten, Dörfern und Pflanzungen auf, unentwirrbare Haufen von Gebälk und Gestrüpp bleiben als Endresultat des vergossenen Schweißes zurück. Nein, wie nirgendwo in der Welt, gibt es auch unter der Sonne Indiens keinen Ort, wo der Mensch die Hände unbekümmert in den Schoß legen und sich ganz auf das gütige Walten des Himmels verlassen könnte, auch hierhin hat Zeus die Pandora mit ihren verhängnisvollen Gaben entsandt.
Aber schwerlich wird ein vergnügungssüchtiger Globetrotter sich die Mühe geben, dem dürftigen Dasein der Koromandelküstenbewohner persönlich nachzuspüren. Abseits der größeren Städte wird dieser Küstenstrich am Bengalischen Meer nur gelegentlich von Reisenden mit ernsteren Forschungsinteressen besucht, seine Bewohner haben sich deshalb die Ursprünglichkeit ihrer Sitten und Bräuche gut bewahrt. Sie nennen sich Pattanavans oder Karayans, das heißt Küstenvolk, und gehören zum Stamm der Tamulen. Ziemlich klein von Gestalt, von muskulösem Körperbau und dunkler Hautfarbe, haben sie angenehme, offene Züge mit großen Augen und weichem, lockigem Haar. Was dem einfachen, durch keinerlei Schulbildung beschwerten Küstenvolk an höheren Geistesgaben gebricht und worin es hinter den höherstehenden Rassen Indiens zurückbleibt, das erseht es durch manche gute Eigenschaften. Besonders sympathisch berührt den Europäer in dieser Hinsicht die würdigere Stellung der Frau. Sie ist hier nicht die stumme Dienerin ihres Herrn und Gebieters, als die wir sie bei den meisten anderen Stämmen Indiens kennen, sondern die Genossin und Mitarbeiterin ihres Mannes und nimmt eine ziemlich freie Stellung ein. So darf sich z. B. eine Witwe nach Ablauf der Trauerzeit wieder verheiraten.
Die Pattanavans der Küste leben fast ausnahmslos von der Fischerei und treiben nur nebenbei für den eigenen Küchenbedarf noch etwas Landwirtschaft. Ihre sehr primitiven Behausungen bestehen aus Hütten von Bambus, Rotang und Stroh. Jeder Fischer ist sein eigener Baumeister, und behagt ihm einmal der Ort, wo seine Hütte steht, nicht mehr oder fegt die Sturmflut sie fort, so schlägt er sein Dach einfach an irgendeiner anderen Stelle auf. Zumeist hat die Hütte nur einen einzigen Raum, der zugleich auch als Stall dient, denn der Pattanavan trägt kein Bedenken, sogar das grunzende Borstenvieh seine Häuslichkeit teilen zu lassen. Er gehört einer zu niedrigen Kaste an, als daß er deshalb Verachtung zu fürchten hätte. Die Ehe ist meistens reich mit Kindern gesegnet, sie bedeuten auch dem Ärmsten ein großes Glück, denn der Inder hängt an seinen Sprößlingen mit inniger Liebe. Schon im zartesten Alter beginnen sich die Knaben mit jenem Element zu befreunden, dem sie später ihren Lebensunterhalt verdanken sollen; stundenlang plantschen sie im Wasser herum und entwickeln sich allmählich zu einer Art von Amphibienmenschen, die sich im Wasser ebenso zuhause fühlen wie auf dem Trockenen. Ihre Fähigkeiten im Schwimmen und Tauchen sind erstaunlich. Läuft ein Dampfer einen Hafen der Koromandelküste an, so wird er alsbald von schwimmenden Knaben umringt, die den Passagieren zurufen, sie möchten Geldstücke ins Wasser werfen. Mit unfehlbarer Sicherheit erhaschen die Jungen beim Tauchen jede noch so kleine Münze, die in Ermangelung anderer Behälter einstweilen im Munde geborgen wird.
Seiner zäh an alten Überlieferungen hängenden Wesensart entsprechend, betreibt der Fischer der Koromandelküste sein Handwerk nach Urväterweise. Der Fang geschieht mit Netzen und Haken von einem eigenartigen Fahrzeug aus, dem »Katamaran«. Es besteht aus drei roh behauenen, mit Kokosfaserstricken und Bastgeflecht verbundenen Stämmen, auf denen zwei oder drei Fischer kniend hocken und sich mit langen Stoßstangen durch die meist rauhe Brandung ins offene flache Meer hineinarbeiten. Die Engländer an der Koromandelküste nennen die Katamaran die Moskitoflotte, weil sie so behend und allgegenwärtig wie die lästigen Stechmücken sind. Auf dem offenen Meere angelangt, werfen die Fischer die Netze aus oder segeln mit Schleppsegeln. Kehren sie nachmittags mit ihrem Fang zurück, so werden sie schon von den städtischen Händlern erwartet und von diesen gehörig geprellt. Für sich selbst hält der Pattanavan nur ein paar Fische der geringsten Qualität zur Ergänzung der häuslichen Reistafel zurück. Schlimm geht es dem bedürfnislosen Küstenbewohner zur Zeit des Monsuns, der mit seinen schweren, oft wochenlang anhaltenden Stürmen seine Tätigkeit völlig lahmlegt. In solchen dunklen Stunden gedenkt der Pattanavan eifriger als sonst seines Gottes Schiwa und seiner verschiedenen kleinen Nebengötter und Schutzgeister. Das religiöse Hauptfest ist die alljährlich zelebrierte Masi-Mackam-Feier, dann zieht die Bevölkerung in pomphafter, Prozession mit ihren Götterbildern an den Strand und taucht unter mancherlei Zeremonien die Schiwastatue ins Meer, um so ihrem Lebenselement für das kommende Jahr den Segen zu erteilen. Und hat der Pattanavan endlich sein Dasein beschlossen, dann bestatten die Hinterbliebenen die sterblichen Reste in sitzender Stellung, wofern sie nicht, wie es jetzt häufiger geschieht, die Verbrennung vorziehen. Von allen sündigen Schlacken befreit, schwingt sich die Seele des armen braunen Fischers zum ewigen Licht empor, zum Antritt der Wanderung, die ihm nun auch einmal ein besseres Leben, vielleicht gar das eines Radschas, erschließen wird – so Gott es will.
*
Das natürliche Gegenstück zur Koromandelküste ist die Malabarküste, die Südindien gegen das Arabische Meer begrenzt. Aber während das charakteristische Merkmal jener die Flachheit, die Eintönigkeit des Landschaftsbildes ist, weist Malabar und sein Hinterland eine große Mannigfaltigkeit der Formen, einen ständigen Wechsel von Flußläufen, tiefeingeschnittenen Lagunen, Reisfeldern, dichten Wäldern und Steppen auf. Der langgestreckte, schluchtenreiche Gebirgswall der Westghats, der sich an der ganzen Westküste vom Golf von Cambay bis Kap Comorin erstreckt, reicht bis in die Nähe des Meeres und verdichtet sich in den Nilgiri- und Anamalaigebirgen zu kompakteren Bergmassen von beträchtlicher Höhe. Infolge seiner schweren Zugänglichkeit hat Malabar an der guten Entwicklung des indischen Verkehrswesens nicht teilgenommen, Eisenbahnen gibt es hier so gut wie gar nicht, und der Reisende sieht sich deshalb zu seinem Vorwärtskommen auf die ursprünglichsten Fortbewegungsmittel, auf Pferd, Zebukarren, Ruder – und Segelboot, Sänfte usw. angewiesen. Bedeutend ist der Reiseverkehr unter solchen Umständen nicht, zumal auch das Unterkunftswesen auf niedrigster Stufe steht, und von den Besuchern Indiens haben deshalb wohl nur die allerwenigsten das so schöne und interessante Malabar zu sehen bekommen.
Meine Tiergeschäfte hatten mich mit dem Fürstenhof von Travancore in Verbindung gebracht, und das war die Veranlassung, daß ich meine südindische Reise bis Trivandram, der an der Malabarküste gelegenen Hauptstadt des Landes, ausdehnte. Die indischen Fürsten haben durchweg lebhaftes Interesse für Tiere, ja es ist für sie geradezu eine Standespflicht, einen möglichst großen und gut gepflegten Tierpark zu unterhalten. Auch die Maharani von Travancore, die Witwe des verstorbenen Maharadscha, besaß einen sehr schönen zoologischen Garten, dessen Bestand immer wieder durch neue wertvolle Exemplare aus den ungemein wildreichen Wäldern des Landes ergänzt wurde. In den Malabarstaaten gilt das weibliche Erbfolgerecht; Fürstenwürde und Besitz gehen nicht vom Vater auf Sohn oder Neffen, sondern von der Mutter auf Tochter oder Nichte über.
Von den beiden »unabhängigen« Tributärstaaten von Malabar, Travancore und Cochin (sprich Kotschin), ist Travancore mit drei Millionen Einwohnern der bedeutendere und das Fürstenhaus gehört zu den reichsten in Indien. Auffallend ist die große Zahl von Christen, 700 000. Das kommt daher, weil hier das Christentum schon in den ältesten Zeiten Eingang gefunden hat, angeblich soll schon der Apostel Thomas hier im Jahre 52 n. Chr. eine Kirche gegründet haben. Auch das Judentum. das im übrigen Indien so gut wie gar keine Rolle spielt, ist hier und in Cochin mit einigen Tausend orthodoxen Glaubensgenossen vertreten; schon nach der Zerstörung Jerusalems sollen sich in Cochin Juden niedergelassen haben. Man kann auch hieraus wieder sehen, wie uralt die Beziehungen zwischen den Mittelmeerküsten und Indien sind und auf welcher Höhe der Leistungsfähigkeit sich die Schifffahrt vor bald 2000 Jahren bereits befand. Die Malabarjuden unterscheiden sich in »weiße« (reinblütige) und »schwarze« (mit Inderblut vermischte) Juden, beide halten sich streng voneinander getrennt und vermeiden nicht nur jede Vermischung, sondern auch jeden Verkehr miteinander.
Von Cochin hat die europäische Kolonisation in Indien ihren Ausgang genommen; in Cochin war es auch, wo der große Weltumsegler Vasco da Gama zum erstenmal indischen Boden betrat und wo er 1524 starb und begraben wurde. Den ersten Kolonisten verdankt Cochin in seinen ältesten Quartieren eine Architektur, die man sonst in Indien nicht findet: enge, halbdunkle Gassen mit hohen, halb portugiesischen, halb holländischen Häusern, alles von Alter und Nässe verwittert, düster und gespensterhaft trotz dem lachenden Tropenhimmel. In der Eingeborenenstadt beherrschen die schwärzlichen Hindu mit nacktem Oberkörper die Szenerie; sie gehören dem drawidischen Stamm der Naïr an, zu dem auch das Fürstengeschlecht von Travancore gehört. Ein etwas problematisches Volkselement sind die Mopla, die sich auch bei den südindischen Unruhen der neuesten Zeit (Sommer 1921) wieder stark hervorgetan haben. Ursprünglich ein drawidischer Stamm, haben sich die Mopla durch Vermischung mit den arabischen Kaufleuten und Ansiedlern der Malabarküste, von denen sie auch die mohammedanische Religion übernahmen, stark zu ihrem Vorteil verändert. Sie sind von kräftiger, wohlgebauter Gestalt, ausdauernd und fleißig und gehören als Fischer, Seeleute und Bauern zu den besten Bestandteilen der indischen Bevölkerung. Was sie aber von den zaghaften, energielosen Indern am meisten unterscheidet, das ist der rücksichtslose Mut, mit dem sie sich gegen Bedrückungen und Unrecht auflehnen und den sie auch bei den jüngsten Unruhen von neuem bewiesen haben. England kann froh sein, daß es nur ungefähr anderthalb Millionen Mopla in Indien gibt.