
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
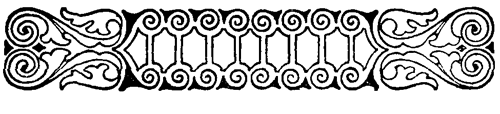
Der Winter war vorüber. Der Tag, an welchem Fritz Stegmann seine Strafe abgebüßt hatte, war gekommen. Er hatte die traurige Zeit meist im Gefängnisspital zugebracht und war noch immer ein kranker Mann. Otto, der ihn, so oft dies gestattet war, besucht hatte, war gekommen, um ihn abzuholen.
Aber noch einer außer ihm war da – Herr Thomas Leibner, Stegmanns früherer Chef. Die beiden Herren trafen einander auf dem Korridor des Gerichtsgebäudes.
Falk wollte nur stumm grüßen. Da fiel ihm ein, daß des alten Herrn Hiersein ja nur Wohlwollen für Fritz bedeuten konnte; daher trat er auf den Bankier zu und fragte: »Was hat Sie bewogen, jetzt hier zu sein?«
Leibner seufzte. »Halten Sie mich denn für herzlos? Ich möchte Ihrem Stiefbruder sagen, daß mir mein Handeln leid tut. Ich habe nämlich erfahren, daß der Schrecken, an dem ja eigentlich ich schuld war, seinen Zustand so gefährlich gemacht hat.«
»Fritz war in der Tat dem Tod sehr nahe.«
»Ich möchte mein Verschulden wieder gutmachen.«
»Herr Leibner!«
»Er könnte wieder bei mir eintreten, wenn er Lust hat.«
»Wirklich?«
»Machen Sie kein Aufhebens davon. Ich hätte keine Ruhe mehr gehabt, wenn Stegmann gestorben wäre. Ich bin ja kein schlechter Mensch, ich war nur damals sehr erbittert gegen ihn, habe ihm halt alles zugetraut.«
»Und mir auch!« warf Otto herb ein.
Da hielt Leibner ihm die Hand hin und bat: »Verzeihen Sie mir!«
Otto war schon versöhnt. Er drückte die Hand des alten Herrn.
»Fritz Stegmann soll sogar wieder seine Kasse haben,« sagte Leibner. »Ich denke, er wird jetzt für sein Lebenlang gut tun.«
»Das denke ich auch,« erwiderte Otto und zeigte auf jemand, der langsam durch den langen Gang daherkam.
Leibner wich zurück und murmelte: »Ach, du lieber Gott!«
Otto ging dem Herankommenden entgegen. Es war ja Fritz. Aber es war nur noch ein Schatten jenes flotten Fritz Stegmann, der er noch am 30. November des vergangenen Jahres gewesen war.
Als er Leibner erblickte, färbte sich sein bleiches Gesicht mit dunklem Rot, und sein Fuß stockte.
Da ging Leibner schnell auf ihn zu und sagte bewegt: »Stegmann, kommen Sie wieder zu mir. Ich nehme Sie gern wieder – Sie können es mir glauben. Natürlich müssen Sie sich vorher erst erholen.«
Stegmann starrte den alten Herrn eine Weile an, dann schluchzte er plötzlich laut auf und wäre in seiner Schwäche hingestürzt, hätten die beiden ihn nicht gehalten.
Sie führten ihn zu dem Wagen hinunter, in welchem Otto hergekommen war. Es war nur ein Einspänner. Nur die Brüder hatten darin Platz. Leibner nahm also Abschied von ihnen.
Sein letztes Wort war: »Also, Stegmann, erholen Sie sich, und dann – dann sind wir wieder die alten!«
Ein glückliches Lächeln des blassen Menschen war ihm eine sein Herz erleichternde Antwort. Herr Thomas Leibner hatte sich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt als an diesem Tage.
Die Brüder fuhren zum Nordwestbahnhof. Dort nahmen sie Abschied voneinander.
In der kleinen Station im Süden des Isergebirges hielt am späten Abend dieses Tages ein leichter Korbwagen. Sein Lenker war Tilgner. Er brachte seinen Schwager nach dem Schulhause.
Es war Mitternacht nicht mehr fern, als sie dort anlangten. Hanna empfing den Heimkehrenden voll ernster Herzlichkeit, seine Mutter schloß ihn laut weinend in die Arme. Die vier Monate, welche zwischen seinem letzten Gehen und dieser Heimkehr lagen, hatten die alte Frau gewaltig verändert. Sie war still, sehr still und bescheiden geworden und suchte nun wirklichen, herzlichen Anschluß an ihre Tochter und deren Mann.
Sie fand ihn auch, und damit war der Friede in das kleine Schulhaus gekommen, der Friede, der auch Fritz nun zugute kommen sollte.
In der Woche vor Ostern wurde gegen Alfons v. Eck verhandelt.
Den Rest jener Nacht, in welcher er Müller gegenüber sein Innerstes dargelegt, hatte er dazu verwendet, sein Hauswesen zu bestellen und zwei Briefe zu schreiben.
Der eine war an Simonetta gerichtet. Er gab sie darin frei, schrieb ihr, daß und warum er der Schubert Mörder geworden sei, und bat sie, die nächste Zeit auf Reisen zuzubringen. Der andere Brief war an Malten adressiert.
Am nächsten Morgen fuhr Eck mit Müller nach Wien. Unterwegs erfuhr er, daß nur durch den roten Merkur, dessen Anna Lindner erwähnt hatte, Müller auf die richtige Spur gebracht worden war.
»Merkwürdig!« sagte Eck gedankenvoll. »Ich wähnte mich so sicher, und da hat mich nun ein Nichts verraten, das mit meiner Tat nicht einmal in Verbindung steht, ein Nichts – eine alte Zeitungsmarke.«
»Nennen Sie mir den roten Merkur nicht ein Nichts!« protestierte Müller lebhaft. »Für uns Philatelisten ist er etwas sehr Bedeutendes, einfach der Stolz einer Sammlung, so ein zweifellos echter, noch auf seiner Zeitungsschleife sitzender roter Merkur!«
»Ist das eine schöne Marke? Haben Sie eine solche?«
»Der rote Merkur stammt aus den fünfziger Jahren. Natürlich habe ich keinen. So viel Geld lege ich für eine Liebhaberei nicht aus. – Aber sehen Sie – dort das Automobil hätte fast das Bauernfuhrwerk erwischt! Ich hasse diese brutalen Kasten.«
Man sprach nun von Automobilen, denn Müller wollte seinen Reisegefährten absichtlich vom Nachdenken ablenken. Eck wurde denn auch bald so ruhig, so gefaßt, daß seine Ruhe schon fast an Frohsinn grenzte.
In Wien angekommen, schieden die Herren schon auf dem Bahnhof voneinander.
»Also irgend einmal im Leben auf Wiedersehen, Herr Müller!« sagte Eck bewegt, als er des alten Detektivs Hand drückte. »Ich danke Ihnen, daß Sie mir zu dem einzig Richtigen rieten. Das Grauen, das ich vor mir selber empfand, ist von mir abgefallen. Dank also – innigen Dank!«
Über Alfons v. Eck war wegen Totschlages das Urteil gesprochen worden. Es war ein sehr mildes. Daß Eck sich selbst gestellt, daß er seine Tat reuig und ohne jeden Beschönigungsversuch eingestand, hatte ihm die Sympathie des Gerichtshofes von vornherein gesichert und auch einen günstigen Einfluß auf das Ausmaß der Strafe genommen. Er wurde zu zwei Jahren Kerker verurteilt.
Ruhig hatte Eck das Urteil angehört, hatte sich vor seinen Richtern verneigt und war dann abgeführt worden.
Man brachte ihn in ein Zimmer, in dem ihn mehrere Personen erwarteten. Sein Verteidiger war da, General Labriola, Doktor Malten, Müller, Ecks alter Förster und die Wirtschafterin von Pachern.
Der letzte, der von dem Verurteilten Abschied nahm, war Müller.
Wieder dankte ihm Eck, und dann reichte er dem Detektiv ein Briefchen, das Malten ihm kurz zuvor eingehändigt hatte. »Ein paar Worte, die ich nicht vor anderen Leuten reden will, habe ich Ihnen aufgeschrieben,« sagte er, dann winkte er allen noch einmal mit der Hand zu und ließ sich wegführen.
Der General, Doktor Malten und Müller verließen miteinander das Gerichtsgebäude.
»Er ist trotz seiner wilden Jugend und trotz dieser Tat ein braver, tüchtiger Mensch,« sagte bewegt der alte Offizier. »Wie gut stand es ihm, daß er nichts – gar nichts beschönigte«
»Dafür haben aber auch die beiden Herren,« wandte Müller sich zum General und dem Doktor, »glänzend für ihn ausgesagt.«
»Sie etwa nicht? Und alle anderen nicht?« fragte Malten, Müllers Hand kräftig drückend.
»Wir haben eben alle der Wahrheit die Ehre gegeben,« sagte Labriola.
»Wo befinden sich jetzt Ihre Damen?« erkundigte sich Müller.
»In Riva,« antwortete der General. Dann wendete er sich an Malten. »Na, Doktor, Sie wissen Simonetta zu behandeln. Die braucht auch eine so feste Hand, wie die Ihrige eine ist.«
»Und eine Liebe von der Art der meinigen,« sagte Malten ernst.
»Was hat er mir nur vor den anderen Leuten nicht sagen können?« dachte Müller, als er in den nächsten Straßenbahnwagen stieg.
Er öffnete den Umschlag des Briefchens, das Eck ihm gegeben hatte.
Es enthielt eine Visitenkarte Ecks, auf welcher stand: »Mein Ostergeschenk! Malten hat es mir besorgt. Sie haben mir ja unendlich mehr geschenkt – den Frieden mit mir selbst.«
Darunter war leicht eine Marke angeklebt.
Es war ein »roter Merkur«.
*
Drei Jahre waren vergangen. Es blühten schon die Kirschen, da ging ein schlanker, hochgewachsener Mann mit dem Stationschef auf dem Bahnsteig der Station Bruck auf und ab.
Als der Wiener Schnellzug signalisiert wurde, sagte der Beamte: »Also diesmal kommen Sie nicht ins Kasino?«
»Mein Besuch muß mich entschuldigen. Ach habe Müller seit einem halben Jahre nicht gesehen und –«
»Und da er beinahe Ihr Freund ist, Herr v. Eck, wollen Sie –«
»Er ist wirklich mein Freund.«
»Da müssen wir freilich zurückstehen.«
»Oder auch zu mir nach Pachern kommen.«
»Sie vergessen, daß Damenabend ist.«
»Richtig, das vergaß ich. Da nehme ich also meine Einladung zurück.«
»Sie wollen also durchaus nicht geheiratet werden?«
»Durchaus nicht.«
Die Herren lachten.
»Sie öffnen die Pforten Ihres Schlosses also nach wie vor nur Männern?«
»Und Kindern,« ergänzte Eck weich. »Aber da ist er ja schon!« rief er dann lebhaft und winkte mit dem Hut dem einfahrenden Zuge zu und dem grauköpfigen Herrn, der seine Reisemütze ebenfalls lebhaft schwenkte.
Wenige Minuten später fuhren Eck und Müller im offenen Wagen Pachern zu. Sie hatten über sehr vieles zu reden. Sie hatten einander seit Ecks Freiwerden erst einmal in Wien gesehen. Nun aber wollte Müller einige Zeit auf Pachern zubringen.
Und darauf freuten sich die beiden gleichermaßen.
Rasch rollte der Wagen die Landstraße hinab, und bald darauf gingen sie mit dem Empfinden inniger Freude durch den alten Bau.
Auch in die Kapelle traten sie wieder ein, und wieder lagen auf dem Sarkophag der letzten Herrin von Pachern einige Rosen.
»Sehen Sie,« sagte Eck zu seinem Gast, »der tiefen Liebe, welche die, die hier ruht, ihrem Gatten eingeflößt hat, verdanke ich es, daß ich ein Leben höherer Ordnung führen kann. Hätte Hans v. Eck sein Weib nicht so über alles Maß hinaus geliebt, so zöge ich vielleicht heute als Bettler oder als Strolch umher.«
Von der Kapelle führte Eck seinen lieben Gast in sein Arbeitszimmer.
Sie setzten sich an denselben Tisch wie damals bei ihrer verhängnisvollen Unterredung. Heute aber redeten sie Freundlicheres, redeten sie von ihren gemeinsamen Bekannten.
»Das Ehepaar Falk ist also glücklich?« fragte Eck.
»Glücklich durch sich selber, denn beide sind gute, tüchtige Menschen. Aber die beiden Leutchen leben mit ihren zwei Kindern, die sie schon haben, auch sorgenlos, und das danken sie Ihnen, der Sie Anna so reich bedacht haben.«
Eck zuckte die Schultern. »Ich bitte Sie, lieber Freund, was soll ich denn sonst mit meinem Geld anfangen!«
»Und daß auf einem gewissen Grabe so oft frische Blumen liegen, das rührt Anna tief,« fuhr Müller fort und setzte dann rasch hinzu: »Auch die in Salzburg sind glücklich. Aber das wissen Sie wohl schon durch Malten selbst. Der Doktor steht ja mit Ihnen in ständigem Briefwechsel.«
»Gewiß,« bestätigte Eck lebhaft. »Auch Simonetta schreibt mir. Sie hat sich an Maltens Seite sehr vorteilhaft entwickelt. Es scheint, daß sie jetzt keine Launen mehr hat, daß sie eine recht gute Frau und Mutter ist. Eine wirklich gute Mutter.«
Der alte Detektiv betrachtete seinen Wirt aufmerksam. Dann faßte er seine Hand und schaute ihm fest in die Augen. »Und Sie?« fragte er. »Wie sieht es in Ihnen aus?«
Ecks Blick hielt dem seinen stand. »Ich habe gebüßt nach außen und nach innen. Ein gut Teil meiner Seele ist leer gewesen – trostlos leer. Ich habe sie jetzt mit Liebe ausgefüllt, mit Liebe zu allen, die der werktätigen Liebe bedürftig. Müller, mein alter Freund, Sie brauchen keine Sorge um mich zu haben.«
Ende.
