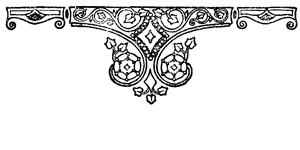|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
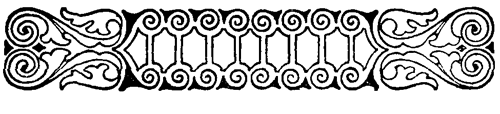
Wieder einmal hatten sich eine Menge Besucher in der Villa Romana eingefunden.
Auch Malten und Alfons waren da.
Eine Dame, die die Schubert auch gekannt hatte, wie man eben die Dienstleute seiner Bekannten kennt, hatte das Gespräch auf das schreckliche Ende der alten Frau gebracht.
Da erwähnte Simonetta der telegraphischen Anfrage, welche die Wiener Polizei an sie gerichtet hatte, und man besprach alsdann den Fund des Vierblattes, den auch die Zeitungen flüchtig erwähnt hatten. Eine der Damen bemerkte, daß das Tragen von Vierblättern modern und deshalb sehr verbreitet sei, und auf diese Bemerkung hin begann unwillkürlich eine Musterung der von den Anwesenden getragenen Schmuckgegenstände. Tatsächlich trugen verschiedene der Herren und Damen Vierblätter.
Der Gesang einer Dame, die der General zum Klavier geführt hatte, unterbrach das Gespräch. Später redete man dann von den herrlichen alten Spitzen, welche Paduaner Verwandte der jungen Braut geschickt hatten.
Simonetta holte sie herbei, und sie wurden rückhaltlos bewundert.
»Es ist zum Glück allzeit modern, alte Spitzen zu tragen,« bemerkte eine der Damen. Es hieß, daß sie nicht immer mit der Mode gehen konnte, da es ihre Mittel nicht erlaubten. In der Tat war ihr Ton ein wenig säuerlich.
Simonetta schaute verlegen auf die Neidische, was Alfons bemerkte und zu der Bemerkung veranlaßte: »Jedenfalls ist es eine Mode, die sich nicht viele gönnen können.«
»Ist dir's nicht recht, daß ich gern modern bin?« fragte Simonetta etwas spitz. »Du bist es ja selbst, wie dies hier beweist.«
Sie wies auf das Vierblatt an seiner Uhrkette.
»Und ich, Baronesse,« sagte Doktor Malten, auf sein ebenfalls ein Vierblatt darstellendes Berlocke deutend, »fühle mich da wenigstens auch einmal nicht rückständig.«
Dann wurde von etwas anderem geredet, auch vom Rodeln, und die jüngeren Herrschaften bestürmten den Bräutigam, auf seinem Gute eine Rodelbahn herzustellen.
Er schaute fragend seine Braut an, und diese klatschte in die Hände und rief vergnügt: »Das war schon lange meine Idee. Die Bahn ist bereits hergerichtet. Morgen komme ich mit der Tante nach Pachern, um sie anzusehen.«
»Und wann darf ich das Vergnügen haben, Sie alle bei nur zu begrüßen?« erkundigte sich Alfons. »Am Montag,« schlug eine der jungen Damen vor. »Da habe ich keine Klavierstunde.«
»Sie kommen doch auch mit, Doktor?« wandte sich die Baronesse an Malten.
»Gern, wenn ich an dem betreffenden Tage abkommen kann.«
»Sie werden sich eben freimachen und damit basta!«
»Also werde ich mich eben freimachen und damit basta!« wiederholte lächelnd der Doktor. »Und wenn ich keine Vertretung bekomme, dann soll die Patienten einfach der Kuckuck holen, das Vergnügen geht selbstverständlich über alles.«
Simonetta war rot geworden. »Sie sind abscheulich wie immer,« sagte sie schmollend. »Aber diesmal haben Sie ausnahmsweise recht. Weil Sie aber dabei sein müssen –«
»Muß ich wirklich?«
»Sie müssen wirklich! Und deshalb wird man sich eben nach Ihnen richten.«
»Das kann ich nicht gut annehmen.«
»Gut oder nicht gut – Sie werden es eben annehmen! Ich mag mich nicht umsonst gefreut haben auf diese Rodelfahrt.«
Das war ein wenig sonderbar geredet für eine Braut, deren Verlobter ja jedenfalls bei dieser Fahrt anwesend sein würde. Simonetta wurde sich dieser Absonderlichkeit auch bewußt, denn helle Röte schlug ihr ins Gesicht.
Eck preßte einen Augenblick lang die Lippen fest aufeinander, aber er mußte viel Selbstbeherrschung besitzen. Rasch reichte er dem Arzt die Hand und sagte liebenswürdig: »Natürlich, lieber Doktor, wird man sich nach Ihnen richten. Sie müssen unbedingt mitkommen. Ich weiß ja, daß Sie ein Meisterrodler sind. Sie werden es also Simonetta wissen lassen, an welchem Tag Sie frei sind, und ich werde dann mitteilen, wann ich die Herrschasten in Pachern erwarte.«
»Also – ich nehme diese Liebenswürdigkeit an,« erwiderte Malten. »Jetzt aber empfehle ich mich – meine Patienten warten.«
Im Vorzimmer kam Simonetta ihm entgegen. »Sie fahren morgen nach Leoben?« fragte sie.
»Soll ich Ihnen vielleicht etwas mitbringen? Einen schönen Bergknappen zum Beispiel?« scherzte er.
Aber sie verzog kaum den Mund zu einem Lächeln und sagte dann etwas, das zu ihrer Frage ganz bestimmt nicht in Beziehung stehen konnte. »Gestern habe ich der Anna Lindner geschrieben. Das arme Mädchen braucht jetzt Entgegenkommen.«
»Wer ist Anna Lindner? Ach so, die Nichte der Schubert?«
»Ja. Sie ist ein reizendes Mädchen und eine sehr tüchtige – Arbeiterin.«
Simonettas Gesicht war plötzlich tiefrot. Sie drückte eilig des Doktors Hand und war gleich daraus verschwunden.
Während Malten die Treppe hinunterschritt, lächelte er eigentümlich vor sich hin, und dieses Lächeln begleitete ihn bis nach Hause.
Nach Leoben sollte er übrigens am nächsten Tage nicht kommen. Schon zeitig am Morgen holte ihn ein armes Weib zu ihrem erkrankten Kinde. Das hielt ihn so lange auf, daß er den Zug versäumte. –
Malten bewohnte mit seiner Mutter ein nettes kleines Haus an der Grenze der Stadt. Das Haus und der hübsche Garten, in welchem es stand, waren Frau Maltens Paradies, das ihr Sohn ihr geschaffen hatte, dieser kluge, brave Mensch, den alle, die ihn kannten, achteten, und den sie selbst liebte, wie nur eine Mutter ihr Kind lieben kann.
Gegen elf Uhr klingelte es. Frau Malten streute gerade Futter für die Vögel. Eine elegante junge Dame stand an der Tür des Gartengitters.
»Sie wollen wohl zu Doktor Malten?« fragte auf sie zutretend die alte Frau und öffnete die Tür.
Die junge Dame war sehr rot im Gesicht, als sie eifrig entgegnete: »Nein, nicht zum Herrn Doktor will ich, sondern zu Frau Malten. Ich glaube, ich bin schon bei ihr.«
»Ich bin Frau Malten.«
»Wollen Sie mich einen Augenblick eintreten lassen?«
»Gewiß, liebes Fräulein. Womit kann ich dienen?«
Frau Malten führte die Besucherin in eine gut bürgerliche Stube. Die gediegenen Möbel wiesen sämtlich den besten Stil auf. Beim Fenster zwitscherte ein Kanarienvogel zwischen Pflanzen, wie sie jeder, der will, im Zimmer ziehen kann, und ein Schrank, auf dem eine alte Säulenuhr stand, war mit einer mühsam gehäkelten, schneeweißen Decke belegt. Von Überflüssigkeiten war nirgends eine Spur, dafür aber war alles sehr behaglich.
Die junge Dame machte sich keine Gedanken weiter darüber, aber sie fühlte es sofort, als sie in die angenehm durchwärmte Stube trat und gleich darauf Frau Malten gegenübersaß.
»Also, womit kann ich dienen?« fragte diese. »Und wer sind Sie, liebes Fräulein?«
Wieder vertiefte sich die Röte in dem frischen und vom Wind gefärbten Gesichte der jungen Dame, aber weltgewandt sagte sie: »Frau Malten, nehmen Sie an, daß ich zu einem Wohltätigkeitsverein gehöre.«
»Gut.«
»Deshalb tut mein Name nichts zur Sache.«
»Der bloße Name tut niemals etwas zur Sache.«
»Dieser Meinung sind Sie? Und – wenn es nun zum Beispiel ein berühmter Name wäre?«
»Nur der darf stolz auf solch einen Namen sein, der ihn berühmt gemacht hat. Aber darüber zu reden sind Sie wohl nicht hierher gekommen?«
»Nein,« sagte die junge Dame. Dann fuhr sie lebhaft fort: »Mein Verein möchte eine Summe in Hände legen, die es an wirklich würdige Arme zu verteilen verstehen.«
»Welche Arme hält Ihr Verein einer Berücksichtigung für wirklich würdig? Meiner Meinung nach sollte, soweit dies eben möglich ist, von jedem Armen Kälte und Hunger ferngehalten werden.«
»Wir werden uns Ihrer Meinung gern unterwerfen. Wir wollten Sie bitten, dieses Geld in erster Linie unter solche Frauen zu verteilen, die viel arbeiten müssen, sich nichts gönnen und vor allem sich nicht schonen können.«
Dabei legte sie ein rotes Beutelchen, durch dessen Maschen Gold blitzte, vor Frau Malten hin.
Diese neigte sich freundlich dem jungen Mädchen entgegen. »Wie komme ich zu diesem Vertrauen?« fragte sie.
Es war etwas wie Begeisterung in den klaren Augen, die sich auf Frau Malten richteten, während die jungen Lippen sagten: »Sie sind doch Doktor Maltens Mutter!«
In die Augen der alten Frau schossen Tränen, und unwillkürlich falteten sich ihre Hände. »Ja,« sagte sie bewegt, »ich bin seine Mutter, und das ist mein Glück und mein Stolz, denn mein Uli ist ein guter, ein sehr guter Mensch. Ich wollte, es wüßten es alle und namentlich aber eine, wie gut er ist, trotz der Kühle, die er zuweilen zur Schau trägt.«
»Eine? Was wollen Sie damit sagen? Liebt Ihr Sohn – unglücklich?«
Weit vorgebeugt saß die Besucherin da und schaute der alten Frau aufmerksam in die Augen, und als diese nicht sogleich antwortete, setzte sie rasch hinzu: »Sie müssen nämlich wissen, ich bin Braut, da interessieren mich solche Sachen sehr.«
Da antwortete die alte Frau. Sie tat es, indem sie sich erhob und damit zu verstehen gab, daß die Unterredung zu Ende sei. »Mein liebes Fräulein,« sagte sie, »solche Geschichten erzählt man, selbst wenn man sie genau wüßte, nicht jedermann. Entschuldigen Sie mich jetzt – ich habe zu tun. Übrigens danke ich noch einmal für das Vertrauen, das Ihr Verein in mich setzt. Wohin soll ich die Mitteilung über die Verwendung des Geldes schicken?«
»Oh, wir wollen gar nichts davon wissen. Und, Frau Malten, ich war taktlos – verzeihen Sie mir.«
»Sie sind jung und lebhaft. Da braucht es keiner Verzeihung,« entgegnete die alte Frau freundlicher und geleitete das junge Mädchen hinaus.
Oben stand Doktor Malten am Fenster und schaute nachdenklich in die Weite. So pflegte er immer zu tun, wenn eine Idee ihn ausschließlich beschäftigte.
Da hörte er unten die Tür gehen. Eine junge Dame lief durch den Vorgarten. Natürlich wußte Malten nach dem ersten Blick, wer da so eilig davonlief. Er dachte zuerst, daß in der Villa Romana jemand seiner bedürfe, aber da hätte wohl ein Diener ihn geholt – und nicht Simonetta. Was hatte sie nur gewollt?
Doktor Malten lief eilig zur Tür. Dort aber machte er plötzlich halt und sagte laut: »Mir scheint, ich bin ein Esel!« Dann tat er aber doch die Tür auf und ging langsam hinunter.
Auf dem Treppenabsatz kam ihm schon seine Mutter entgegen. »Denk dir,« rief sie ihm zu, »soeben hat mir eine junge Dame, die sich nicht nennen wollte, im Namen ihres Vereins eine Menge Geld gebracht zur Unterstützung von Frauen, die viel arbeiten müssen und sich nichts gönnen und sich nicht schonen können.«
»Nun,« sagte Malten, der auf dem Treppenabsatz stehen blieb, »das ist ja sehr löblich von dem Verein.«
»Weißt du was, Uli?«
»Was denn?«
»Ich glaube, es steckt gar kein Verein dahinter.«
»Nicht?«
»Die junge Dame hat sich einmal verschnappt. Ich glaube, sie allein gibt das Geld her.«
»Um so schöner.«
»Jedenfalls kennst du sie. Sie ist reizend.«
»Ich kenne mindestens ein paar Dutzend reizender junger Damen.«
»Prachtvolle Augen hat sie – braune.«
»Ich werde künftig auf solche besonders achten.«
»Ja – und Braut ist sie.«
»Ich kenne auch eine Menge Bräute.«
»Also kannst du dir wirklich nicht denken, wer es war?«
»Hm –hm.«
»Sie schwärmt für dich.«
»Da wirst du dich aber irren, Mutter.«
»Ganz gewiß schwärmt sie für dich – natürlich, wie eine Braut halt noch für einen anderen Mann schwärmen darf. Ein liebes, herziges, reizendes Mädchen ist's!«
»Also kann ich wieder hinaufgehen?«
»Warum bist du denn heruntergekommen?«
»Ich – na, ich hab' halt reden hören und meinte, ich werde geholt. Essen wir bald?«
»Ich werde gleich in die Küche schauen.«
»Und der Reis soll recht körnig sein.«
Frau Malten ging in die Küche, ihr Sohn stieg wieder die Treppe hinauf.
Als er die Tür seines Zimmers hinter sich geschlossen hatte, blieb er stehen. Lange gab er sich stillen, frohen Gedanken hin, dann sagte er laut, aber ganz langsam: »Die viel arbeiten müssen und sich nichts gönnen und sich nicht schonen können –«
Dann ließ er sich an seinem Schreibtisch nieder und griff nach seiner langen Studentenpfeife, die er vorhin weggestellt hat. Er sog am Rohr und siehe, sie war noch nicht erloschen.
Mit Absicht qualmte er darauf los. Das Rauchen sollte ihn, wie so oft schon, wieder ins Gleichgewicht bringen.
Aber seine Seele pendelte ja schon nicht mehr zwischen unerfüllbarem Wünschen und sinnlosem Sehnen hin und her. Er war schon wieder ganz ruhig. »Nun,« sagte er laut vor sich hin, »dem Eck gönne ich sie. Denn der ist ein lieber Kerl!«