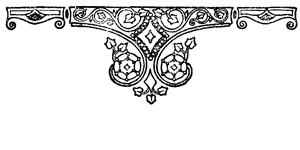|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
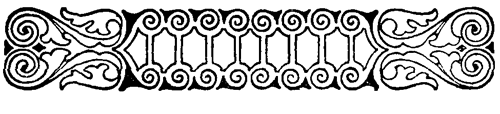
»In Wien, im fünften Bezirk, ist am 30. November dieses Jahres eine Frau getötet worden.«
Müller hielt schon wieder inne. Seine ernsten und jetzt auch traurigen Augen hatten sich forschend auf Ecks Gesicht gerichtet.
Das hatte soeben noch eine frische Färbung gehabt; jetzt war es totenblaß und trug den Ausdruck großen Erschreckens und grenzenloser Verwunderung.
Daran war für Müller nichts Seltsames. Ihn überraschte nur, daß sich die Hand dieses bleichen Mannes abermals erhob und daß Ecks blutlose Lippen sich abermals auftaten, um wieder einen Zug aus der Zigarre zu tun.
Dieser ganz mechanische Vorgang kam Müller förmlich grausig vor.
»Haben Sie von dieser Bluttat nichts gelesen?« fragte er.
Eck nickte nur. Es ging augenscheinlich Schreckliches in ihm vor. Sein Gesicht verzerrte sich bis zur Unkenntlichkeit, und er war offenbar im Begriff aufzuspringen.
Aber er tat es nicht. Blitzschnell kam eine wunderbare Gelassenheit über ihn, huschte sogar ein Lächeln über sein blasses Gesicht. Er schaute seinem seltsamen Gast voll in die Augen.
»Getötet wurde die Schubert, sagte ich, getötet, nicht ermordet. Der die Tat vollführte, kam nicht zu der alten Frau in der Absicht, ihr das Leben oder sonst irgend etwas mit Gewalt zu nehmen, der kam zunächst als Bittender zu ihr. Aber er wurde schroff abgewiesen. Der Zorn und wohl auch die Furcht, durch die Schubert in etwas für ihn Bedeutungsvollem gehindert zu werden, haben dann zur Tat geführt.«
»Wer hat diesen Schluß gezogen?«
»Ich.«
»Sie heißen nicht Schleinitz?«
»Nein.«
Die beiden Männer tauschten einen langen Blick.
Eck rauchte weiter. Den ersten Schrecken hatte er schon überwunden.
»Sie sind Detektiv?«
»Ja.«
»Die Tat hat für einen Raubmord gelten sollen?«
»Ja.«
»Es wurde ja auch getötet und geraubt.«
»Ja. Aber der Räuber suchte nur Briefe.«
»Wer kann das wissen?«
»Briefe, die jetzt vielleicht noch hier sind.«
»Die Erfahrung wenigstens macht dies wahrscheinlich. Man bezahlt etwas nicht so teuer, um es dann wegzuwerfen.«
»Mit einem Menschenleben bezahlt!« flüsterte Eck vor sich hin, und sein bleiches Gesicht drückte Grauen aus. »Das war ein furchtbarer Preis! Mit einem Menschenleben bezahlt, dessen Vernichtung unser ganzes eigenes Leben vernichtet!«
»Selbst wenn es ihm Gefahr bringen könnte, wirft einer, der sich auf solche Weise etwas zu eigen gemacht hat, es nicht leicht weg,« setzte Müller seinen Gedankengang fort. »Es ist wie ein böser Zauber, daß auf solche Weise Erworbenes gewöhnlich bei seinem neuen Eigentümer bleibt.«
»Ja – wie ein böser Zauber, wie ein Fluch.«
»Und falls ihm solcher Besitz gar Nutzen bringt oder ihn vor Schaden bewahrt –«
Eck fuhr auf. »Nutzen! – Man wird doch nicht meinen, daß die Wertpapiere –«
»Sie zu jener Tat verleitet haben?« sagte der alte Detektiv schier freundlich. »Nein, Herr v. Eck, das glaubt niemand. Wer ein Vierblatt von der Art verlieren kann, wie eines an Ihrer Uhrkette hängt und ich eines hier in der Hand habe, der sucht nicht in den Schränken alter Frauen nach Wertpapieren. Diese kommen ihm nur zufällig in die Hand, weil sie bei anderen Papieren, sagen wir bei Briefen liegen, die Hans v. Eck merkwürdigerweise Jahre hindurch an eine ehemalige Dienerin schickte, was darauf schließen läßt, daß irgend ein Geheimnis diesen Herrn und diese Dienerin viele Jahre miteinander verbunden hat.«
»Das alles weiß man schon?«
»Und hat auch richtige Schlüsse daraus gezogen.«
»Vollkommen richtige Schlüsse.«
»Es geschah also alles dieser Briefe wegen?«
»Nur dieser Briefe wegen.«
»Die bei den Wertpapieren lagen?«
»Ja. Ich nahm mir zuerst nicht die Zeit, sie abzusondern.«
»Das glaube ich.«
»Und mein zweiter Gedanke war, daß ich ja auch solche Dinge mitnehmen müsse, damit man nicht an mich denken könne.«
»Was sehr richtig erwogen war. Nur führten Sie den guten Gedanken nicht genügend durch.«
»Was meinen Sie?«
»Lesen Sie nicht, was die Zeitungen darüber bringen?«
»Es stand darin zu lesen, daß der Nichte der Schubert sechstausend Kronen gesandt wurden.«
»Gewiß!«
»Von einem Ungenannten gesandt wurden.«
»Ich konnte ihr doch keinen Brief dazu schreiben!«
»Nein. Aber Sie durften die Sendung überhaupt nicht aufgeben.«
»Es zwang mich etwas dazu.«
»Das glaube ich Ihnen gern. Sie wollten gutmachen, was noch gutzumachen war.«
»Selbstverständlich!«
»Und haben uns damit eine Spur gegeben, die wir allerdings eigentlich nicht mehr gebraucht haben. Auch die Bestecke hätten Sie mitnehmen müssen.«
»Ich wollte Ihnen soeben deren Versteck nennen.«
»Ist nicht mehr nötig. Die Bestecke habe ich längst gefunden.«
»Auch schon?«
»Wenn Sie sie nicht so übereilig versteckt, sondern sie mitgenommen hätten, so –«
»Sie haben mir in den Händen gebrannt.«
»Auch das glaube ich Ihnen. Dennoch hätten Sie sie mitnehmen müssen. Sie wären doch auch mit ihnen ganz unbehelligt von dem Kohlenplatz weggekommen!«
»Ich mußte diesen Weg nehmen, denn im Hausflur redeten ein paar Leute miteinander.«
»Ja. Sonst wären Sie natürlich dort hinausgegangen und hätten keine Kohlenflecke auf Ihren hellen Winterrock bekommen, die Sie sich vom Hotelportier wegputzen ließen. Sagen Sie mir übrigens, warum Sie sich im Hotel als ›Wenzel Bogdan aus Prag‹ eingetragen haben? Der Name paßt doch gar nicht zu Ihnen!«
»Ich hatte beim Militär einen Burschen, der so hieß und ein Prager war. Meinen Namen wollte ich doch nicht hinschreiben!«
»Nun, ein anderer wäre besser gewesen. – Auch in Triest war ich,« fuhr Müller nach einer kleinen Pause fort.
»Sie kommen also nicht von Laibach?«
»Nein. Die Geschäftskarte, derentwegen Lisi von Ihnen ausgezankt wurde, ließ mich diese Reise tun.«
»Ah – ich verstehe.«
»Ihr neues Vierblatt hatte ich beim ersten Blick schon bemerkt. Durch Lisi wußte ich, daß Sie angeblich wegen Holzverkaufes in Triest gewesen waren, und daß der Goldschmied, bei dem Sie waren, Umberto als Vornamen führt. Es gibt derzeit in Triest nur zwei Goldschmiede, deren Rufname Umberto ist. Umberto Seraja gab mir die Auskünfte, die ich eigentlich nicht mehr brauchte und die ich nur der Vollständigkeit wegen noch einholte.«
»Womit sämtliche Beweise meiner Schuld erbracht sind,« sagte Eck merkwürdig ruhig.
Müller war voll Staunen. So gelassen war noch keiner gewesen von all denen, deren Verbrechen er aufgedeckt hatte. Frecher Kälte, zynischem Gleichmut war er schon oft begegnet. Noch niemals aber hatte er einen solch schrecklicher Tat Überführten in so edler Ruhe gesehen.
Und noch niemals hatte er erlebt, was er jetzt erlebte.
Eck hatte die nun doch erkaltete Zigarre weggelegt – stand auf und ging ein paarmal mit auf den Rücken gelegten Händen langsam durch das Zimmer.
Bei einem der Fenster blieb er stehen und schaute lange hinaus.
Dann kam er wieder auf Müller zu und ließ sich nieder. Seine schönen, klaren Augen standen voll Tränen. Er streckte ihm die Hand entgegen und sagte: »Ich danke Ihnen. Sie haben mir eine kaum mehr erträgliche Last von der Seele genommen!«
Seine Hand war eiskalt, aber ganz ruhig lag sie in den beiden, sie umspannenden Händen Müllers.
Und wieder ruhten der beiden Männer Blicke lange ineinander. Dann sagte Eck: »Ich bewundere Ihren Scharfsinn.«
Müller lächelte wehmütig und gab Ecks Hand frei.
»Da ist nicht viel zu bewundern,« sagte er. »Das gehört zu meinem Beruf. Es hat weit mehr Sinn, wenn ich Ihre Ruhe bewundere.«
»Sie müssen deren Ursache doch schon erraten haben.«
Müller nickte. »Sie denken an ein freiwilliges Sterben?«
Eck hatte sich erhoben. Er trat dicht vor Müller hin und sagte hastig: »In meiner Lage kann man doch nur an so etwas denken, und Sie – Sie werden mich nicht daran hindern! Nicht wahr – es ist Sympathie, eine echte Sympathie zwischen uns. Sie fühlen, daß ich kein Schurke bin, und daß ich den Namen, den ich trage, nicht in einen Kerker schleppen darf.«
»Sie nehmen auf Ihre Ahnen Rücksicht?«
»Meine Ahnen – ach, wenn ich wüßte, wer meine Ahnen sind!«
»So sind Sie kein Eck?« rief Müller überrascht aus.
»Nein. Hans v. Eck war nur mein Ziehvater. Hören Sie die Geschichte meiner Kindheit.«
In kurzen Worten schilderte Alfons die Ereignisse, die sich an seine Geburt knüpften.
»Also so ist die Sache!« meinte Müller nachdenklich. »Weiß Ihre Braut das alles?«
Ecks Gesicht rötete sich. »Nein,« sprach er rauh. »Simonetta weiß es ebensowenig wie irgend ein anderer. Ich hätte es ihr, der Adelsstolzen, wohl auch für immer verbergen können, daß ich kein Eck, sondern der Sohn einer Magd bin.«
»Ihre Mutter lebt nicht mehr?«
»Sie starb, als ich noch in der Wiege lag.«
»Und Ihr Vater?«
»Der muß schon vor meiner Geburt gestorben oder ausgewandert sein. Kein Lebender konnte mir mehr schaden als nur die Schubert.«
»Die war doch eine gemütliche Frau. Und sie muß Sie doch liebgehabt haben?«
»Meinen Sie? Ich weiß das besser. Sie hat mich gehaßt, und sie hat auch Ursache dazu gehabt, denn schon als Kind hatte ich eine starke Abneigung gegen sie. Erst viel zu spät für uns beide erfuhr ich, warum sie mich, wenn wir allein waren, so von oben herab behandelte. Ich war schon siebzehn Jahre alt, als ich durch sie erfuhr, daß ich in Wahrheit auch nicht mehr sei als sie selbst. In die Kadettenschule schrieb sie es mir. Ich war damals furchtbar bestürzt, schrieb sofort an Papa, dessen Antwort mir die Richtigkeit ihrer Enthüllung bestätigte, der mir aber in seiner Güte riet, es nicht offenbar werden zu lassen, wie eigentlich mein Verhältnis zu ihm sei, denn was so lange dem Wissen Fremder vorenthalten gewesen sei, das sollte auch fernerhin nur zwischen uns bleiben. Der Schubert hat er damals einen scharfen Brief geschrieben. Sie nannten die Frau vorhin gemütlich. Sie war es durchaus nicht. Dienstboten, die einer Familie gar zu nahe getreten sind, überheben sich fast immer. Therese fand immer Mittel und Wege, sich über mein Tun und mein Leben Kenntnis zu verschaffen. Wo immer ich war, nie verlor sie mich aus den Augen. Das Romantische in meinem Lebensbeginn beschäftigte ihre Phantasie, und ihre Abneigung gegen mich blieb immer gleich groß. Sie war es, die meinem gütigen Adoptivvater die Nachrichten, die sie über mich sammelte, zuführte. Es begleitet uns manchmal ein Haß oder eine Liebe, davon niemand aus unserer Umgebung eine Ahnung hat. Mich hat der Haß dieser Frau begleitet, seit ich Alfons v. Eck heiße.«
Er hielt inne. Atem und Stimme hatten ihm versagt.
»War die Schubert etwa auch eine Erpresserin?« fragte Müller, der tief nachdenklich der Rede des jungen Mannes gelauscht hatte.
Dieser schüttelte den Kopf. »Nein,« antwortete er nachdrücklich, »habsüchtig war sie nicht. Ihre großen Fehler lagen auf einem anderen Gebiete. Vor allem fehlte es ihr an dem Wohlwollen, das bei einem guten Menschen immer zu bemerken ist. Auch hat sie sich wohl immer selbst überschätzt und wollte immer eine Rolle spielen und womöglich Leiterin meines Geschickes sein. Als ihr Mann starb und sie wieder einen Posten suchte, stand es bei ihr fest, daß sie wieder hier in Pachern leben müsse. Das habe ich vereitelt, und das wußte sie, hat es mir nie verziehen, auch nie verziehen, daß ich auf den Vater Einfluß hatte, bis er starb.«
»Da wurde sie aber doch hierher berufen.«
»Gewiß. Als Papa erkrankte, war ich zufällig gerade hier. Es fehlte uns eine Wärterin, und der Kranke verlangte nach Therese. Da berief ich sie telegraphisch. Es war nämlich auch nur ganz recht, daß sie sofort kam. Am Bette eines Kranken schweigt der Haß. Therese und ich verkehrten in jenen Tagen recht friedlich miteinander, und sie pflegte den Vater mit großer Aufopferung, vielleicht freilich auch nicht ohne Hintergedanken. Sie hat wohl gemeint, daß er wieder gesund werden und sie zur Pflege seines Alters hier behalten würde. Als der Vater gestorben und begraben war, zeigte ich es ihr unverhohlen, daß ich auf ihre Abreise warte. Da kam es zu einem Auftritt. Sie erklärte mir, daß sie mir stets feindlich gesinnt gewesen sei und daß sie nicht anstehen würde, mir, falls sich ihr Gelegenheit dazu böte, unangenehm zu werden. In dieser Stimmung schieden wir, und danach habe ich sie nur noch zweimal gesehen, in diesem Frühjahr, bald nachdem meine Verlobung bekannt gemacht wurde, und – und am letzten November.«
»Haben Sie sie im Frühjahr besucht?«
»Ja. Damals waren Simonetta und ihre Tante in Wien und besuchten, wie immer bei solchen Gelegenheiten, auch Therese. Diese hat stets eine leidenschaftliche Zuneigung zu Simonetta gezeigt, und auch meine Braut war der einstigen Dienerin zugetan. Darum dieser Besuch. Natürlich kam auch unsere Verlobung zur Sprache, und Therese, die im Hause Labriola trotz aller klugen Zurückhaltung auch schon Ungünstiges über mich hatte verlauten lassen, sprach damals ziemlich offen ihr Bedauern über diese Verlobung aus, so daß Simonetta und auch die Gräfin recht verstimmt nach Graz kamen. Da reiste ich nach Wien und stellte der alten Frau vor, daß sie mir unrecht tue, daß ich nicht mehr der Wildling sei, der ich einmal gewesen, und der – Sie werden es bald aus den Briefen meines Vaters erfahren – es nicht einmal immer mit der Ehre ganz ernst genommen hatte.«
»Was können Sie getan haben, das gegen die Ehre verstößt?«
Eck lächelte trübe. »Es ist schon so, wie ich sagte,« erwiderte er. »Albernes Großtun, Spiel und Wetten haben auch in meinem Leben ihre Rolle gespielt. Ich tat, was freilich auch schon mancher echte ›Edelmann‹ getan hat – ich machte Schulden und habe, als einmal der Verfall meines Ehrenscheins drohte, den Namen Hans v. Eck auf zwei Wechsel gesetzt. Die Schubert, die immer hinter mir her war, erfuhr das und hatte mich nun in ihrer Hand. General Labriola, den sie während der langen Zeit, in der sie in seinem Hause diente, genau kennen gelernt hatte, würde mir diese – sagen wir »jugendliche Verirrung« niemals vergeben haben. Das wußte sie, und das wußte ich auch. Sie hätte es mir aber bei unserem letzten Zusammensein nicht so voller Hohn zu sagen gebraucht, daß Simonetta gewaltig abgekühlt werden würde, wenn man ihr sagte, daß ich außerdem der Sohn einer Dienstmagd sei. Sehen Sie, mit dieser Drohung brachte sie mich um den Rest von Ruhe, den ich noch besaß, nachdem sie mir die Bitte, sie möchte die Briefe meines Vaters, aus denen das hervorging, vor meinen Augen verbrennen, höhnisch abgeschlagen hatte. Ich bot ihr für jeden Brief hundert Kronen. Sie lachte nur. Ihres Hasses Befriedigung war ihr lieber als Geld. Ich verlor alle Besinnung und weiß heute noch nicht, wie das Messer mir in die Hand kam. Sie wollte es mir entreißen und schlug mich dabei ins Gesicht. Da stieß ich zu, und – ich muß es bekennen in dieser Beichte, die mich vielleicht vor dem Wahnsinn rettet – ich fühlte keine Gewissensbisse, als die alte Frau zusammensank. Ich blieb ganz ruhig. Ich zog die Fensterläden zu und sah mich dann im Zimmer um. An einem hohen Schrank steckte ein Schlüssel, an dem ein Ring mit noch weiteren Schlüsseln sich befand. Ich öffnete den Schrank und suchte darin nach den Briefen. Ich fand sie erst in einer Kommode. Sie liegen noch alle beisammen. Ich werde sie Ihnen dann übergeben. Auch die Wertpapiere liegen dabei. Als ich dann auf die Straße kam, ging ich ruhig, wie irgend ein anderer, meinen Weg. Erst während der Heimreise regte sich mein Gewissen, sagte ich mir, daß solche Art von Notwehr doch nichts anderes als ein Verbrechen sei. Unter Qualen verbrachte ich den nächsten Tag. Daheim hielt ich es nicht aus. Ich mußte in den Wald hinaus. Abends fuhr ich nach Graz. Ehe ich zu meiner Braut ging, kaufte ich eine Zeitung. Darin stand schon vom Mord. Auch das Vierblatt war erwähnt. Ich hatte dessen Fehlen zwar schon bemerkt, hatte aber gehofft, daß ich das Anhängsel beim Überklettern der Planke verloren habe, daß es zwischen die Kohlen gefallen sei und noch lange nicht gefunden werden würde. Merkwürdig aber war, daß ich jetzt plötzlich eine immer heftiger werdende Abneigung gegen die empfand, um derentwillen ich getötet hatte. Simonetta war mir jetzt sicher, aber ich fühlte nichts mehr von Glück bei dieser Vorstellung. Es war mir eine Erleichterung, daß ich meine Braut einige Tage nicht zu sehen brauchte. Als wir dann wieder zusammenkamen, blieb ich innerlich ganz fern von ihr. Ein wenig äußerliche Zärtlichkeit brachte ich noch auf – das war aber auch alles.«
»Das wird vorübergehen.«
Da schüttelte der junge Mann energisch den Kopf und erwiderte fest: »Nein, das wird nicht vorübergehen. Und das ist gut so. Heute abend auf dem Bahnhof habe ich mich davon überzeugt.«
»Wieso?«
»Ein Blick Simonettas hat es mir gesagt, daß nicht ich der bin, den sie liebt. Und – es hat mir nicht einmal weh getan.«
»Doktor Malten –«
»Warum nennen Sie diesen Namen?« fragte Eck betroffen.
»Weil die Baronesse diesen Mann liebt.«
»Ja – das habe ich heute abend entdeckt.«
»Ich habe es schon heute nachmittag gewußt.«
Eck stand auf. Wieder ging er ein paarmal langsam durch das Zimmer, dann blieb er vor Müller stehen und sagte: »Ich danke Ihnen, daß Sie mir zugehört haben. Es ist mir ganz leicht geworden, Ihnen dieses alles zu sagen, denn ich habe Sie in den wenigen Stunden unseres Zusammenseins liebgewonnen. – Gebeichtet habe ich also,« fuhr er trüb lächelnd fort. »In jenem Fach finden Sie alles, was zu diesem Fall gehört. Und nun leben Sie wohl und nehmen Sie meinen Dank dafür, daß Sie –«
»Wofür wollen Sie mir danken?« fragte Müller, sich ebenfalls erhebend.
»Dafür, daß Sie es auch selbstverständlich finden –«
»Daß Sie sich erschießen?«
»Ja.«
»Das finde ich durchaus nicht selbstverständlich.«
»Wollen Sie mich daran hindern?«
Müller schaute ihm fest in die Augen und sagte sanft: »Ich kann und will Sie nicht daran hindern, ich kann Ihnen nur zu bedenken geben, daß mit einer Kugel Ihre Tat nicht gesühnt ist, daß dieser Selbstmord nur eine Flucht vor der gerechten Strafe ist. Aus Furcht vor Strafe sich töten, das ist wenig – in Demut eine verdiente Strafe entgegennehmen, das finde ich würdiger.«
Eck starrte ihn an. Er war wieder sehr bleich geworden, mußte sich auf die Lehne des Sessels stützen, mußte die Hände darum schließen, um nicht zu fallen. »Daran habe ich noch nicht gedacht,« murmelte er.
Dann ließ er es willenlos geschehen, daß Müller ihn in den Sessel drückte.
Der alte Detektiv legte ihm die Hand auf die Schulter. »Wollen Sie also auf die einzig richtige Art Ihre Tat büßen?«
»Auf die einzig richtige Art!« antwortete Eck gefaßt.