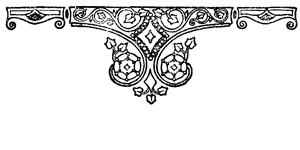|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
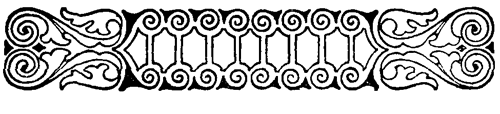
Es war fast elf Uhr geworden, als Müller vor der Wohnung der Schubert ankam. Auch heute war kein freundlicher Tag. Und das trübe Licht, das er spendete, schloß Müller noch sorgfältig von der Wohnung, in der jüngst so Schauerliches vorgegangen war, aus. Er zog in dem Zimmer, in dem die blutige Tat geschehen war, die Holzläden dicht zu.
Gleich darauf aber überstrahlte des alten Detektivs elektrische Lampe den ganzen Raum. Die niedrige Decke, die Wände samt allem, was sie umschlossen, waren von dem grellen Lichte beleuchtet. Die ungestrichenen Fichtenbretter, aus denen der Fußboden bestand, waren an drei Stellen mit Teppichen bedeckt. Ein solcher lag auch unter dem in der Mitte des ziemlich großen Zimmers stehenden Tische; ein dicker Vorleger befand sich beim Bette, und der dritte Teppich lag in der Fensternische. In dieser Nische standen ein Nähtisch und ein bequemer Sessel.
Müllers Blick blieb auf diesem Winkel haften. Er wußte es schon, daß dort die arme Frau ihr Leben ausgehaucht hatte.
Wie oft mochte sie an dieser gemütlichsten Stelle der ganzen Wohnung über das so schnell verschwundene Glück ihrer Ehe nachgedacht und dabei auf den hübschen kleinen Garten hinausgeblickt haben!
Jetzt bot der sonst so liebe Winkel einen unheimlichen Anblick.
Der Sessel lehnte halbumgestürzt an der einen Seitenwand der tiefen Nische, die Decke des Nähtischchens war heruntergerissen, auf dem Boden lag eine angefangene Näherei, und der helle Teppich, sowie ein Stück des Fußbodens wiesen große, braunrote Flecken auf. Unter dem Speisetisch aber lag ein Messer. Es war spitz und so blank, wie Werkzeuge zu sein pflegen, die man viel benützt.
Nur an seiner Spitze glänzte es nicht, da war es matt und so braunrot wie der Teppich und der Fußboden.
Müller warf auch einen Blick aus dem Fenster, von welchem er für einen Moment den Laden zurückschlug, und begriff, wie es auch die anderen begriffen hatten, warum der Angriff auf die alte Frau von niemandem im Hause hatte bemerkt werden können. Das Zimmer der Schubert befand sich am Ende des einen Seitenflügels, der um etwa zehn Meter länger war als der gegenüberliegende Teil des Hauses.
Nachdem der alte Detektiv den eigentlichsten Schauplatz des Verbrechens betrachtet hatte, untersuchte er die Fächer der zwei durchwühlten Schränke, welche man in dem Zustand gelassen hatte, in dem man sie gefunden. Es interessierte ihn nämlich, auch zu wissen, was dem Mörder der Schubert wertlos erschienen war. Nun, feine Wäsche, Kleidungsstücke, der bescheidene Putz der alten Frau hatten ihn augenscheinlich zum Mitnehmen nicht gereizt.
Wozu hatte er aber dann in diesen Fächern alles untereinandergeworfen? Hatte er angenommen, daß die Schubert zwischen ihrer Wäsche noch anderes, wertvolleres Gut aufbewahrte?
Wenn der Betreffende dies annahm, mußte er die Eigenheiten seines Opfers genau gekannt haben, denn zu deren Gewohnheiten hatte tatsächlich eine solche Heimlichtuerei gehört.
Nun, ohne Beute war der Mörder ja auch nicht entwichen. Er mußte in den durchwühlten Schränken nicht nur verschiedene Wertsachen, sondern auch Bargeld oder Wertpapiere im Betrage von mindestens viertausend Kronen gefunden und mitgenommen haben. Die alte Frau hatte so viel ihrer Nichte zugesagt, man mußte demnach annehmen, daß sie so viel Geld auch besessen hatte. Es war aber nirgends zu finden, ebenso hatte man keine Notiz gefunden, die gesagt hätte, wo etwa die alte Frau ihr Vermögen aufbewahrt habe.
Auch ihr silbernes Tafelgerät war verschwunden. Es war das Hochzeitsgeschenk gewesen, das ihr erster Herr, der Gutsbesitzer Hans Eck v. Pachern, ihr geschenkt hatte. Es war zuerst in einem Lederetui gewesen, doch dieses hatte Stockflecken bekommen, und sie hatte es daher weggetan und das Silberzeug in einem Sack aus Hirschleder aufbewahrt. Anna Lindner hatte darüber genaue Angaben gemacht.
Den Schmuck, den die alte Frau von ihren Dienstherrschaften erhalten, hatte die Untersuchungskommission wohlverwahrt in einem unansehnlichen Schrank gefunden, der hinter der Zimmertür stand.
Vielleicht war er aus diesem Grunde den Blicken des Mörders entgangen, denn Anna hatte ja ausgesagt, daß diese Tür bei ihrer Heimkunft weit offen gewesen war.
Von den fünf Schmucketuis trugen zwei Grazer Firmen, eines stammte von einem Paduaner Juwelier, und bezüglich der beiden letzten konnte man nicht ersehen, wo ihr Inhalt gekauft worden war. Die kleinen Schmuckstücke, die sie enthielten, waren ziemlich wertvoll, aber in Formen gehalten, die auf längstvergangene Jahrzehnte hindeuteten.
Die Vierblätter aber waren ein Motiv, welches die Juweliere erst seit kurzem verwendeten. Zudem war das bewußte Vierblatt mit Gewalt von irgend etwas, von einer Uhrkette, vielleicht auch von einer Halskette, abgerissen worden, und – man hatte es in der Faust der Ermordeten gefunden.
Es war kaum zu bezweifeln, daß sie es der Person entrissen hatte, die ihr den Tod gegeben.
Müller wußte das alles schon, und er fand, so genau er auch nachforschte, nichts Neues.
Er verließ etwas unbefriedigt die Wohnung, versperrte sie und machte sich jetzt daran, den Hof und den Garten zu untersuchen.
Es zeigten sich wohl da und dort an den Fenstern die Gesichter Neugieriger; aber sonst wurde Müller nicht belästigt.
Der Täter hatte an jenem Abend bis acht Uhr das Haus nicht verlassen, denn wäre er während dieser Zeit durch den Flur gegangen, so hätte ihn das Liebespaar, das dort plauderte, bemerken müssen. Er hatte sich also bis dahin im Gärtchen aufgehalten, denn der Hof bot keinerlei Versteck.
Müller durchsuchte das Gärtchen mit peinlicher Gewissenhaftigkeit. Es war immerhin möglich, hier noch eine Spur zu finden. Aber er fand nichts.
Als er Garten und Haus verließ, war er etwas ärgerlich und brummte über den Schnee, der vom Himmel herabzufallen begann.
Sein Weg führte ihn jetzt nach dem allgemeinen Krankenhause. Dort besichtigte er die Tote. Was der Polizeiarzt Herbig schon gesagt, daß die Schubert zuerst gewürgt und dann gestochen worden sei, worauf sie an Verblutung durch die verletzte Schlagader starb, das bestätigte auch der Spitalarzt.
Müller untersuchte die Hände der Leiche mit seiner scharfen Lupe. Da bemerkte er, daß auf dem Ballen der rechten inneren Handfläche der Toten einige bläuliche Spuren waren.
Zwei Reihen kurzer, schlangenartig gewundener Linien zeigten sich da. Sie sahen etwa wie winzige Fragezeichen aus. Sogar der Punkt unter jeder der gewundenen Linien fehlte nicht.
»Aha!« sagte Müller vor sich hin. »Eines ist jetzt wenigstens sicher. Es war ein Mann.«
Nun ging er nach der Kärntnerstraße und stellte sich der Schneiderin vor, bei welcher Anna, die seit heute wieder ihre Arbeit ausgenommen hatte, beschäftigt war. Sie saß schon an ihrem Platz, war soeben vom Mittagessen zurückgekommen. Müller bat die Arbeitgeberin, Fräulein Lindner mit ihm weggehen zu lassen, er sei ein alter Bekannter und müsse in wichtiger Angelegenheit mit Anna reden. Es wurde gerne gewährt.
Anna und Müller begaben sich nun in eines der feinen und gemütlichen Gasthäuser der inneren Stadt, in denen es so hübsche, gemütliche Winkel gibt.
Der alte Detektiv, der hier offenbar gut bekannt war, bestellte einige Delikatessen und eine Flasche Donauperle. Dann half er der noch immer ganz verträumt dastehenden Anna aus ihrem Wintermantel und wies ihr das behaglichste Plätzchen an dem Tische an.
»So, liebes Kind,« sagte er väterlich, »jetzt wollen wir hier erst ein bißl warm werden, und dann müssen Sie mir verschiedene Fragen beantworten.«
Nach einer Weile begann er. »Wo wohnen Sie denn jetzt?«
»Eine Freundin hat mich aufgenommen.«
»Das haben Sie nicht notwendig, bin ich doch ein alter Freund der Lindners. Kommen Sie also zu mir, Anna. Sie kennen ja meine Wirtschafterin. Sie ist eine gutmütige, brave Frau, und das Zimmer neben dem ihrigen ist ganz frei. Sie werden sich da wohlfühlen und haben abends eine Ansprache und auch Gelegenheit, Ihren Verlobten bei sich zu sehen. Das Herumlaufen in Wind und Wetter tut euch beiden nicht gut, da sitzt sich's weit behaglicher in einem warmen Zimmer, und ich weiß dann doch wenigstens, daß meines alten Freundes Tochter gut aufgehoben ist.«
»Aber Herr Müller!«
Mehr konnte Anna, der die Tränen über das Gesicht perlten, nicht sagen.
Der alte Detektiv reichte ihr die Hand hin und sagte: »Schlagen Sie ein, Kinderl. Ziehen Sie heute noch zu mir.«
»Wie gern – wie gern!« schluchzte Anna, ihre Hand in die seinige legend.
Zn diesem Augenblick brachte der Kellner den Wein. Müller schenkte ein und sagte: »So, Annerl – und jetzt trotz allem – prosit!«
Als Anna getrunken hatte, beugte sie sich plötzlich ganz nahe an Müllers Ohr. »Heute ist mir noch etwas eingefallen.«
Müller zündete sich eine Trabuco an, und dann sagte er behaglich: »Also, was ist Ihnen denn heute eingefallen?«
»Daß das Vierblatt doch vielleicht der Tante gehört hat.«
»So?«
»Sie hat nämlich vor ein paar Wochen, gerade einen Tag vor ihrem Namenstag –«
»Also am 14. Oktober,« schaltete Müller, der in solchen Dingen sehr genau war, ein.
»Also am 14. Oktober einen Besuch bekommen. Die Baronesse Simonetta und ihre Tante, die Gräfin Vivaldi, waren damals in Wien.«
»Baronesse Simonetta ist, soviel ich weiß, die Tochter des Generals, bei dem Frau Schubert so lange Wirtschafterin war?«
»Ja, die Tochter vom General Labriola di Malfettani. Die Damen waren für mehrere Tage nach Wien gekommen, um noch allerhand einzukaufen, das die Baronesse zu ihrer Ausstattung braucht. Sie wird nämlich Anfang Januar heiraten. Die Damen haben meine Tante sehr gern gehabt. Sie hat ja die Baronesse von klein auf gekannt, und als die Gräfin Vivaldi als Witwe ins Haus des Generals gekommen ist, war Tante Therese fast immer um die kränkliche Dame herum. Ich war damals nicht zu Hause und habe sie erst am Theresientag in der Oper gesehen. Sie haben nämlich eine Loge genommen und haben die Tante und auch mich eingeladen, ins Theater zu kommen. Sie waren auch zu mir sehr freundlich. Die Baronesse hat mir ein Armband gezeigt, das sie sich gekauft hatte, und wie ich ihr erzählte, daß ich auch Braut sei, hat sie mir gleich ein Hochzeitsgeschenk versprochen. Ich hab' ihr sagen müssen, was mich am meisten freut. Ich hab' um ein Stück Leinwand gebeten. Darüber hat sie sich sehr gewundert. Sie hat mir Seide für eine Toilette kaufen wollen. Das hab' ich ihr aber ausgeredet. Ich bitt' Sie, Herr Müller, was tät' denn ich mit einem Seidenkleid! Diese reichen Leut' haben halt keine Idee, was unsereins braucht, und was uns notwendig ist. Die Baronesse ist also sehr freigebig. Ist es da nicht möglich, daß sie das Kleeblatt der Tante Therese als Namenstaggeschenk gegeben hat?«
»Das wäre schon möglich.«
»Aber Sie glauben nicht daran?«
»Ich glaube nicht daran.«
»Warum nicht?«
»Meinen Sie, daß Ihre Tante das Kleeblatt gerade in der Minute, in der sie überfallen wurde, in der Hand gehabt hat?«
»Das ist allerdings nicht wahrscheinlich.«
»Und warum wäre denn die Öse ausgerissen?«
»Richtig!«
»Sagen Sie mir, hat Ihre Tante eine Kette gehabt, die aus ganz kurzen, geschwungenen Gliederchen bestand, zwischen denen Kügelchen eingefügt waren?«
»Davon weiß ich nichts.«
»Nun, jedenfalls werde ich telegraphisch bei der Baronesse anfragen lassen, ob sie der Frau Schubert ein Kleeblatt geschenkt hat.«
»Sie werden bei der Baronesse anfragen lassen?«
»Durch die Polizei natürlich. Ich habe nämlich den Fall übernommen.«
»Sie? Gott sei Dank! Aber ich hätte es mir ja gleich denken können.«
»Ja, das hätten Sie sich denken können. Bin ich doch Ihr alter Bekannter, und es tut mir auch um Ihre Tante leid, leid tut mir's auch um die viertausend Kronen, die sie Ihnen versprochen und die der Schuft mitgenommen hat. Jetzt aber habe ich noch allerlei zu fragen.«
Und er fragte und fragte, und Anna antwortete.
Aber Müller erfuhr dabei nichts Neues.
Es war etwa vier Uhr, als sie das Gasthaus verließen. Es schneite noch immer.
Anna ging mit dem frohen Bewußtsein ins Geschäft, daß sie wieder eine Heimat hatte. Müller aber fuhr zu Lauterer, und der telegraphierte nach Graz an die Baronesse Labriola.
Während man auf die Antwort wartete, studierte Müller die beiden Protokolle und die drei Aufnahmen, welche man von dem unglücklichen Opfer dieser immer noch so rätselhaften Tat gemacht hatte.
Es war schon fast zehn Uhr, als die Antwort ankam.
Das Telegramm lautete: »Habe Frau Schubert niemals ein Kleeblatt geschenkt. Am 14. Oktober gab ich ihr eine Staatsrente zu zweihundert Kronen.
Simonetta Labriola.«