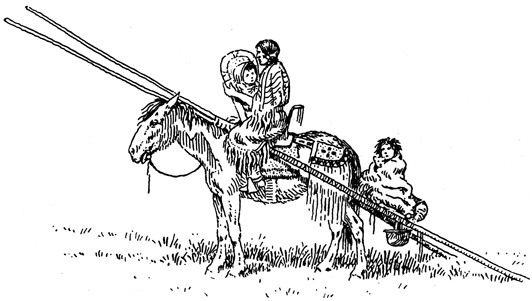|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Is-sap-ah'-ki, die Krähenfrau, wie die Schwarzfußindianer sie nannten, stammte von den Arickaree ab, die in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Nähe der Mandanen am Missouri lebten. Gleich letzteren wohnten sie in erdbedeckten Hütten, und das ganze Dorf war mit hohen, festen Pappelstämmen eingezäunt. Mit den Krähen konnten sie sich verständigen, da zwischen diesen beiden Stämmen verwandtschaftliche Beziehungen unterhalten wurden. Ihre eigene Sprache war, ebenso wie die der Mandanen, für den Fremden außerordentlich schwer zu erlernen. Die Krähen und Arickaree waren zeitweise gut Freund miteinander, dann kamen aber wieder Jahre, in denen sie sich unaufhörlich auf das bitterste befehdeten.
Die Krähenfrau heiratete sehr früh. Sie muß in ihrer Jugend ein sehr hübsches Mädchen gewesen sein, denn selbst im Alter, als ich sie kennen lernte, ihr Haar ergraut und ihr Gesicht voll Runzeln war, sah sie noch immer stattlich und gut aus. Die klaren, glänzenden Augen schauten höchst mutwillig drein. Nach vielen trüben Erfahrungen hatte sie endlich, für den Rest ihres Lebens, bei ihrer treuen Freundin, Frau Berry, ein Heim gefunden. Eines Abends erzählte sie mir, behaglich am Feuer sitzend, ihre Lebensgeschichte.
»Wir waren ein sehr glückliches Paar, mein junger Gatte und ich, denn wir hatten uns von Herzen lieb. Er war ein trefflicher Jäger und brachte stets reichlich Fleisch und Fett mit heim. Ich arbeitete im Sommer sehr fleißig in meinem kleinen Garten, pflanzte Bohnen, Kürbis und Mais und im Winter gerbte ich eine Menge Felle. Als wir bereits zwei Jahre verheiratet waren, wechselten aus irgend einem Grunde die Büffel, außer ein paar alten Bullen, von den Ufern des Missouri, hinaus in die Prärie. Unsere Leute wollten dort draußen nicht gern jagen, denn unser Stamm war nur klein, und was konnten die paar Männer gegen mächtige und zahlreiche Feinde ausrichten? Einige blieben daher daheim und aßen das zähe Fleisch der alten Büffel, die Tapferen aber scharten sich zusammen und zogen den Büffeln nach. Mein Gatte und ich gehörten zu den Letzteren. Er wollte mich nicht mitnehmen, aber ich bestand darauf ihn zu begleiten. Seit unserer Verheiratung waren wir noch keinen Tag getrennt gewesen, und ich hatte geschworen: wo du hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich auch. Wir zogen einen vollen Tag durch die weite, grasige Ebene gen Süden. Gegen Abend trafen wir große Herden, es war nahezu alles schwarz von Büffeln. So ritten wir in ein Tal hinab und lagerten an einem Fluß, dessen Ufer mit Weiden und Pappeln umsäumt waren.
Unsere Pferde waren nicht gerade wohlgenährt und kräftig, denn während der Nacht mußten wir sie, sicherheitshalber, in unserem Lager halten, und ihr Weideplatz am Tage war bald von ihnen abgegrast.
Jeden Morgen zogen wir aus. Wir Frauen folgten den Männern, die sorgsam Umschau hielten, welche Herde sie am gefahrlosesten angreifen könnten. War die Jagd vorüber, so ritten wir zu den großen Tieren und halfen beim Abhäuten, Zerlegen und Packen. Ins Lager heimgekehrt, hatten wir reichlich bis zum Abend Arbeit, denn wir mußten das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und zum Trocknen in die Sonne hängen. So rückten wir drei Tage hintereinander aus, und unser Lager nahm allmählich eine rote Farbe an, denn schon von weitem konnte man das Fleisch hängen sehen. Wir waren sehr froh und glücklich.
Am vierten Morgen machten wir uns schon bald nach Sonnenaufgang auf den Weg. Es war eine sehr erfolgreiche Jagd in der Nähe unseres Lagerplatzes. Mein Mann schoß 9 Büffel. Wir waren eifrig dabei, das Fleisch zu zerlegen und zu verpacken, als wir plötzlich unsere Genossen, die etwas weiter ab gejagt hatten, in rasendem Lauf auf uns zusprengen sahen. »Feinde! Feinde!« schrien sie, und schon kamen sie auf uns zu, viele Männer auf schnellen Pferden, ihre Kriegshauben flatterten im Winde, und schrecklich gellten ihre Kriegslieder uns in den Ohren. Ihrer waren so viele, und wir hatten nur die paar Männer, daß es zwecklos war, ihnen Widerstand zu leisten. Wir schwangen uns auf unsere Pferde, und unser Führer befahl: »reitet so schnell wie möglich ins Lager, in den Wald, das ist unsere einzige Rettung. Schnell, schnell, schnell, nur Mut!«
Ich peitschte auf mein Pferd los und bohrte meine Hacken in seine Flanken. Mein Mann ritt neben mir und hieb auch auf das arme Tier ein, das nicht schneller vorwärts kommen konnte. Der Feind kam näher und näher. Plötzlich stieß mein Gatte einen kurzen Schmerzenslaut aus, streckte die Hände in die Luft, und schlug nieder zur Erde. Als ich ihn fallen sah, sprang ich vom Pferde, rannte zu ihm und barg seinen Kopf in meinen Schoß. Er starb. Ein dicker Strahl Blut quoll aus seinem Munde. Trotzdem sagte er noch: »Nimm mein Pferd, schnell, du kannst noch entkommen.«
Ich wollte nicht. Starb er, so wollte ich auch sterben. Die Feinde konnten mich ja auch töten. Ich hörte das Dröhnen der Pferdehufe, als sie näher und näher kamen, zog meine Decke übers Gesicht und beugte mich über meinen toten Mann. Würden sie auf mich schießen oder mich mit der Keule niederschlagen? Ich freute mich ja, dorthin zu kommen, wo meines Geliebten Schatten seit kurzem weilte. Aber nein! schnell ritten sie an uns vorbei, und ich hörte sie noch singen und schießen, als sie schon in weiter Ferne waren. Nach einer kleinen Weile hörte ich wieder Pferdegetrappel, und als ich aufschaute, hielt ein stattlicher Mann in den besten Jahren vor mir. »Ah,« rief er aus, »das war ein guter Schuß.«
Es war ein Krähenindianer, und ich konnte mich mit ihm unterhalten. »Ja, du hast meinen armen Mann getötet, sei barmherzig und töte mich auch.«
Er lachte. »Was?« antwortete er, »solch' hübsches, junges Weib soll ich töten? o, nein, du sollst mit mir kommen und mein Weib werden.«
»Dein Weib will ich nicht sein,« widersprach ich, »ich töte mich selbst.« »Du gehst mit mir und tust, was ich befehle,« sagte er streng, »erst aber muß ich den Skalp von meinem Feinde hier nehmen.«
»O, nein!« schrie ich und sprang auf, als er sich vom Pferde schwang. »O, skalpiere ihn nicht, laß mich ihn begraben, und ich will dir gehorsam sein. Ich will für dich arbeiten und deine Sklavin sein, aber laß mich diesen armen Leichnam bestatten, damit er nicht den Wölfen und Vögeln zur Beute wird.«
Er lachte wiederum und schwang sich in den Sattel. »Ich nehme dich beim Wort,« antwortete er. »Jetzt will ich ein Pferd für dich fangen, indes kannst du den Toten hinunter in den Wald zu eurem Lager bringen.«
So geschah es. Ich wickelte den teuren Körper in Decken und bettete ihn auf ein Gestell, das ich in einen Baum am Fluß einbaute. O, wie traurig war ich! es dauerte lange, lange Jahre, bis ich wieder auflebte und meinen Kummer überwand.
Der Mann, der mich gefangen hatte, war ein Häuptling. Er besaß eine große Pferdeherde, ein prächtiges Zelt und mancherlei Reichtümer. Außerdem nannte er sechs Frauen sein eigen. Diese Weiber maßen mich mit feindlichen Blicken, als wir ins Lager kamen, und die Hauptfrau wies auf einen Platz am Eingang und sagte: »Dort leg' deine Decke und Sachen hin.«
Keine lächelte, alle schauten böse auf mich herab und unfreundlich blieben sie, solange ich mit ihnen zusammen war. Mir wurden immer die schwersten Arbeiten aufgetragen. Ich mußte stets die Felle für sie abschaben, aus denen sie sich dann ihre Gewänder gerbten. Das war meine tägliche, harte und mühsame Arbeit, es sei denn, daß ich Holz sammeln oder Wasser tragen mußte. Eines Tages fragte mich der Häuptling, wessen Fell ich da schabe. Ich sagte es ihm. Am folgenden und nächstfolgenden Tage tat er dieselbe Frage, und ich antwortete jedesmal, welcher seiner Frauen das Fell gehöre. Da wurde er sehr zornig und schalt mit seinen Weibern: »Ihr habt ihr keine Arbeit für euch aufzutragen,« herrschte er sie an. »Schabt euch selbst eure Felle ab, sammelt euch euer Holz und holt das Wasser, das ihr braucht. Merkt's euch aber, denn ich sage das nicht zum zweiten Male.«
Dieser Krähenhäuptling war ein sehr guter Mann und behandelte mich sehr freundlich, ich aber konnte ihn nicht leiden. Wenn er mich berührte, so lief es mir eiskalt über den Rücken, und ich erstarrte. Wie konnte ich ihn wohl gern haben, wo ich so tief um den, der mir genommen, trauerte?
Wir wanderten viel umher. Die Krähen besaßen so viele Pferde, daß, nachdem das Lager abgebrochen und alles verpackt war, hunderte von fetten, kräftigen Tieren ohne Lasten nebenher liefen. Einmal war die Rede davon, daß mit unserem Stamm Frieden geschlossen werden sollte. O, wie glücklich war ich in dem Gedanken, wieder zu meinem Volk zurück zu kommen! Man hielt eine Ratsversammlung ab und sandte zwei junge Männer mit Tabak zu den Arickaree, um ihnen die Friedensvorschläge zu unterbreiten. Die Boten reisten ab und kamen niemals wieder. Nachdem man drei Monate auf ihre Heimkehr gewartet hatte, nahm man an, daß sie getötet worden seien. Wir verließen dann den Yellowstone und wandten uns zum oberen Muschelfluß. Ich war nun schon 5 Monate in Gefangenschaft. Es war die Zeit der Beerenernte; die Sträucher beugten sich unter der Last der reifen Früchte, und wir Frauen sammelten sie in großen Mengen, und trockneten sie für den Winter. Eines Tages gingen wir in die nördlich vom Lager sich hinziehende Schlucht, in der es einen solchen Reichtum an Früchten gab wie sonst nirgends. Am Morgen war in unserem Zelt große Aufregung. Während mein Herr – meinen Gatten konnte ich ihn niemals nennen – frühstückte, wünschte er den Vorrat an Beeren, den wir gesammelt hatten, zu sehen. Die Frauen brachten ihre Säcke. Die Hauptfrau hatte fünf, die anderen je drei und zwei Beutel voll gesammelt. Ich konnte nur ein kleines Säckchen und ein zweites, nur zur Hälfte gefüllt, vorzeigen. »Wie kommt das?« fragte er. »Ist mein kleines Arickareeweib faul geworden?«
»Ich bin nicht faul,« erwiderte ich angstvoll. »Ich habe viele Beeren gesammelt und sie jeden Abend ausgebreitet und während der Nacht gut zugedeckt, damit sie vom Tau nicht leiden sollten. Aber des Morgens, wenn ich die Decken abnahm, fehlten stets eine Menge Beeren. So war es Morgen für Morgen, seit wir hier sind.«
»Das ist wunderlich,« meinte er. »Wer kann die fortgenommen haben? Wißt ihr Frauen etwas darüber?, wandte er sich an seine Weiber.
Sie sagten, sie wüßten nichts.
»Ihr lügt,« schrie er, sprang auf und stieß die Hauptfrau beiseite. »Hier, kleine Frau, hier sind deine Beeren!« damit nahm er Letzterer zwei, den anderen je einen Sack ab und warf sie mir zu.
O, wie böse waren die Frauen! Den ganzen Morgen sprachen sie kein Wort mit mir, aber könnten Blicke töten, ich wäre an jenem Tage sicher gestorben, so schrecklich schauten sie mich an.
Die fünf hielten sich an jenem Tage nahe beieinander und ließen mich allein gehen. Näherte ich mich ihnen, so wichen sie mir aus. Gegen Mittag kamen sie plötzlich alle in meine Nähe und als ich meine Beeren in einen größeren Sack ausleeren wollte, schlug mich jemand von hinten so heftig auf den Kopf, daß ich hinfiel und die Besinnung verlor.
Als ich wieder zu mir kam, war es Abend. Ich war ganz allein, mein Pferd war fort, mein großer Beerensack fehlte, und der kleine lag leer neben mir. Betäubt und krank war mir entsetzlich zumute. Ich griff nach meinem Kopf, der war stark geschwollen, und das Haar klebte von Blut.
Da hörte ich meinen Namen rufen und gleich darauf Pferdegetrappel. Es war mein Häuptling. Er sprang ab, sagte zuerst nichts, sondern befühlte sorgsam Kopf und Arme. »Sie sagten mir, sie hätten dich nicht finden können, als sie heimkehren wollten, du seiest ihnen fortgelaufen,« erzählte er mir. »Ich aber wußte es besser, ich wußte wohl, daß ich dich hier finden würde, aber ich fürchtete, daß du tot seiest.«
»O, wäre ich doch tot,« antwortete ich und fing zum erstenmal an, bitterlich zu weinen. Wie einsam fühlte ich mich! Der Häuptling hob mich auf, und setzte mich hinter sich in den Sattel, und wir ritten heim. Als wir ins Zelt kamen, schauten mich die Frauen schnell einen Augenblick an und wandten sich dann scheu ab. Ich wollte mich auf mein Lager am Eingang niederlegen, da rief der Häuptling mich und sagte: »Hier an meiner Seite ist jetzt dein Platz!« Dann versetzte er der Hauptfrau einen harten Stoß, wies auf das Lager an der Tür und fuhr sie an: »Du liegst fortan da.«
Damit war die Angelegenheit erledigt. Er machte seinen Weibern nie einen Vorwurf, daß sie versucht hatten, mich zu töten, behandelte sie nur fortan mit eisiger Kälte und spaßte und scherzte nie mehr mit ihnen, wie er es sonst stets getan hatte. Verließ er das Lager, um zu jagen oder verlaufene Pferde wieder zu suchen, so nahm er mich mit. Er ließ mich niemals mit den anderen allein. Als er mit einigen Freunden gegen die nördlichen Stämme ausrücken wollte, befahl er mir, mich ebenfalls reisefertig zu machen. Ich hatte keine großen Vorbereitungen zu treffen, packte nur meine Ahle, Nadeln und Stickmaterial zusammen, legte etwas Pemmikan dazu und war bereit.
Unser Zug bestand aus 15 Männern und zwei Frauen. Meine Gefährtin war ein junges Weib, das erst vor kurzem einen bedeutenden Kriegshäuptling geheiratet hatte. Man wollte den Feind nicht angreifen, sondern das Lager nur vorsichtig anschleichen und die Pferdeherden forttreiben. Wir reisten zu Fuß, wanderten des Nachts und durchschliefen die langen, heißen Tage. Nach langen Märschen erreichten wir, oberhalb seiner Fälle, gegenüber der Sonnenflußmündung, den Missouri. Der Morgen graute, und talaufwärts konnten wir ein großes Zeltlager erkennen und sahen, wie eine Pferdeherde nach der anderen sich in den Hügeln verlor, um zu grasen. In unserer Nähe standen dichte Weidengebüsche, in denen wir schleunigst Unterschlupf suchten, ehe wir etwa von Frühaufstehern gesehen wurden.
Die Männer hielten langen Kriegsrat. Sie entschlossen sich, über den Fluß zu gehen, sich nach Möglichkeit die besten Pferde zu nehmen und dann gen Osten die Reise fortzusetzen. Gingen wir gen Osten, so mußten die Feinde glauben, daß wir Crees oder Assiniboines seien. Wir wollten uns einen trockenen, grasigen Platz suchen und dann wieder die Richtung auf unser Lager einschlagen, damit der Feind, wenn er uns verfolgte, die Spur verlöre.
Bald nach Einbruch der Dunkelheit gingen wir über den Fluß. Wir fanden am Ufer ein paar dicke Baumstämme, die die Männer zusammen banden. Mit Waffen und Kleidern der Männer wurden wir zwei Frauen darauf gepackt, und dann bugsierten uns dieselben, rudernd und schwimmend, ans andere Ufer. Die Stämme wurden wieder auseinandergerissen, in den Strom geworfen und unsere Fußspuren im Schlamm sorgsam vertilgt. In einem Dickicht von wilden Kirschbäumen am Ufer hieß man uns Frauen die Rückkehr der Männer erwarten. Einzeln schlichen sie ins Lager. Wir schliefen bald ein, denn wir waren übermüdet von der langen Reise. Nach einer Weile wachte ich auf, denn ich hörte in nächster Nähe Wölfe heulen. Ich weckte meine Gefährtin, wir unterhielten uns eine Weile und wunderten uns, daß unsere Männer noch nicht zurückkamen. Vielleicht war im fremden Lager Tanz, Spiel oder irgend eine Lustbarkeit, daß sie warten mußten, bis alles ruhig war, ehe sie ihr Vorhaben ausführen konnten. Dann schliefen wir wieder ein. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als wir aufwachten. Wir sprangen auf und schauten uns um. Keiner der Unsrigen war zurückgekommen. Das ängstigte uns. Wir schlichen uns an das Ende des Gehölzes und spähten umher. Talaufwärts grasten die Pferde, und hie und da sah man auf den Hügeln einen Reiter. Ich glaubte bestimmt, daß unsere Männer abgefangen und getötet oder so gehetzt und verfolgt wären, daß sie nicht zu uns zurückkehren könnten. Dasselbe dachte meine Gefährtin. Wir hofften aber doch, daß bei Einbruch der Dunkelheit einige der Unseren zu uns zurückkommen würden. Wir mußten einstweilen bleiben, wo wir waren. Das wurde ein langer, langer Tag. Zu essen hatten wir nichts, aber das schadete nicht. Das junge Weib war sehr elend. »O, was soll ich tun, wenn mein Mann tot ist?«
»Ich kann dich verstehen,« sagte ich ihr. »Einst hatte ich auch einen heißgeliebten Gatten und verlor ihn.«
»Aber,« fragte sie, »liebst du denn deinen Krähenmann nicht?«
»Er ist nicht mein Mann,« erwiderte ich, »ich bin seine Sklavin.«
Wir gingen an den Fluß, wuschen uns und kehrten dann an den Rand des Gebüsches, von wo wir Ausschau halten konnten, zurück und setzten uns dort nieder. Meine Genossin fing an zu weinen. »O! was sollen wir nun anfangen, wenn sie nicht wiederkommen, wenn sie tot sind?« schluchzte sie.
Ich hatte schon darüber nachgedacht und erzählte ihr, daß weiter östlich, am Missouri, mein Stamm wohnte, und ich versuchen würde, ihn zu finden. Beeren gab es massenhaft, Kaninchen konnte ich gut mit einer Schlinge fangen, und Feuerstein hatte ich, so daß wir uns Feuer anmachen konnten. So glaubte ich sicher, daß wir die weite Reise machen könnten, es sei denn, daß uns ein Unglück zustieße. Gegen Mittag tauchten zwei Reiter auf; sie kamen auf uns zu, hielten zuweilen an und suchten das Ufer ab. Sie wollten Biber fangen. Wir krochen in das Dickicht zurück und wagten kaum zu atmen. Das Gehölz war von Büffeln stark zertreten, man konnte sich schwer darin verbergen. Würden die Fallensteller zu uns eindringen? – Sie kamen. Der eine nahm mich, der andere meine Gefährtin, und wir mußten hinter ihnen, auf ihren Pferden, aufsitzen. So brachten sie uns zu ihren Zelten. Das ganze Lager lief zusammen, um uns anzugaffen. Mir war das ja nicht neu, aber meine Gefährtin zog ihre Decke über den Kopf und weinte laut.
Wir waren bei dem Blutstamm der Schwarzfußindianer. Ich konnte ihre Sprache nicht verstehen, mich aber durch die Zeichensprache mit ihnen verständigen. Der Mann, der mich gefangen genommen hatte, fing an mich auszufragen. Wer ich sei, woher ich käme, und was ich in dem Dickicht gewollt hätte. Ich sagte ihm alles. Dann erzählte er mir, daß sie in der Nacht überfallen und daß vier der Feinde getötet worden seien. Die anderen wären flußabwärts verfolgt worden und seien dort in den dichten, dunklen Wäldern entkommen.
»War einer von jenen, die getötet worden sind, ein großer, starker Mann, mit einem Halsband von Bärenklauen?« fragte ich.
Er machte ein Zeichen, das »ja« hieß.
Dann war also mein Häuptling tot. Ich kann nicht sagen, was ich empfand. Er war gut gegen mich gewesen, sehr gut sogar. Aber seine Genossen hatten mir meinen geliebten Gatten getötet, das konnte ich nicht vergessen. Ich dachte an seine fünf Weiber. Die würden ihn nicht vermissen. Alle seine vielen Pferde gehörten ja nun ihnen. Und wie froh würden sie sein, wenn ich nicht wiederkam.
»Du hast hier Tauben Mann, den Blutindianer, der heute mit mir sprach, gesehen. Ich lebte lange Jahre in seinem Zelt, und er und seine Weiber waren sehr freundlich gegen mich. Nach einiger Zeit konnte ich ruhig, ohne in Tränen auszubrechen, an mein Volk denken, und ergab mich in mein Schicksal, die Meinen nie in meinem Leben wiederzusehen. Nun war ich keine Sklavin mehr, sondern tat meine Arbeit, wie die anderen. Tauber Mann sagte, ich sei sein jüngstes Weib, und wir spaßten miteinander über meine Gefangennahme. Ich war nun sein Weib und war glücklich.
So flossen die Jahre dahin, und wir wurden alt. Als wir einmal in Feste Benton zu tun hatten, traf ich zu meiner größten Freude meine alte Freundin, Frau Berry, wieder, die mit dem Feuerboot (Dampfer) angekommen war, um ihren Sohn zu besuchen. Das war ein glücklicher Tag, denn wir hatten als kleine Kinder miteinander gespielt. Sie ging zu Tauber Mann und verhandelte mit ihm, mich frei zu geben, damit wir zusammen leben könnten. Er willigte ein. Und nun bin ich hier in meinem hohen Alter zufrieden und glücklich. Tauber Mann kommt oft, plaudert mit uns, und raucht seine Pfeife. Wir freuten uns heute sehr über seinen Besuch, und schenkten ihm reichlich Tabak, und eine neue Decke für sein altes Weib beim Abschied.
Nun habe ich dir eine lange Geschichte erzählt, mein Sohn, und es ist dabei sehr, sehr spät geworden. Geh' nun schnell zu Bett, denn du mußt morgen früh auf sein zur Jagd. Die Krähenfrau wird dich wecken. Ja, so nannten mich die Schwarzfüße. Früher haßte ich den Namen, jetzt habe ich mich an ihn gewöhnt. Wir gewöhnen uns ja mit der Zeit an alles.
»Halt,« sagte ich, »du hast mir noch nicht alles erzählt. Was wurde aus den anderen, als euch damals die Krähen überfielen?«
»Ich erwähnte das nicht,« erwiderte sie, »denn bis zum heutigen Tage mag ich nicht daran denken und davon sprechen. Es lagen viele, viele Leichen am Wege, erschlagen beim Versuch zu fliehen, nackt, blutig, schrecklich verstümmelt und skalpiert. Nur wenige sind entkommen.