
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
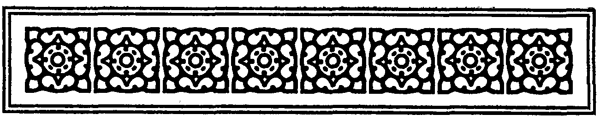
Auf der Stauden, der Bauer, das war ein Gestandener und Schwerer. Da mag eins gut und gern auf der Gratlspitz oben das Land ausschauen, so weit das Aug nur greifen kann, er wird kaum wo einen Hof sehen, der schwerer wär.
Wo das Leben mit vollen Gabeln gibt, da hat es aber immerlings auch wieder sein Trutzhäuserl daneben. Die Leut wurden sonst wohl zu übermütig. Und das Trutzhäuserl war für den Staudenbauer die ganz dumme Sach, daß er keinen Buam nit hat. Grad ein lebfrisches Diendl, so an die tausend Wochen alt, braunzopfet, mit Zähnderln wie eine Maus und einem G'schau, das dir die helle Freud ins Gesicht treiben kann. Wenn das Diendl geht, ist's, als wollt's über den Boden hinfliegen …
Der Vater sieht das alles nit, denn dem ist das Diendl das lebendige Unglück. Was so eine Vev wohl mit 80 Küh und 12 Roß tuat … dadrüber sinniert er oft und immer. Und mußt denken, der Hof, der itzt länger in der Familie ist wie der Kirchturm im Dorf da, der soll einen fremden Herrn kriegen, oh, mein Gott, wie der Gedanken weh tut!
Wenn der Bauer auf der Stauden im Dunkeln am Bildstöckl vorbei geht, ist's ihm oft, als müßt er die Faust hin zum Heiligen recken, wodrum hat er nit … Kreuzteufel …
Das alles aber ist noch längst nit das Dümmste an der Sach. Seine Vev hat er gern, der Bauer, und da wär ihm heilig nix drum, wenn's etwan was merken tät von seiner Unfreud. Jahr lang hat er sich eine ganz grausige Müh geben, daß das Diendl nix spürt. Und die Müh, die ist ihm immerlings vorkommen, wie die besondere Bosheit Gottes. Von ihm ist das dumm, weil seine G'schäften gehen, wie's besser frisch nimmer sein könnt. Schon all die Jahr her. Verhagelt's wo im Dorf die ganzen Äcker, bei ihm auf der Stauden spürst kaum ein paar Körndlen. Reißt der Wildbach mal wo den halben Grund weg, bei ihm ist er brav, der Bach, und fangt immerlings erst hinter seinem Zaun zu wüten an.
So wird alleweil mehr Geld auf der Kassa und abgehen laßt sich der Bauer eh nix nit. Herrgott, wenn grad a Bua da wär … Herrgott, grad das …!
Vor Jahr und Tag ist der Bauer auf der Staud' erster Gemeinderat worden und richtig um 30 Prozent weniger Umlag zahlt das Dorf itzt. Da stirbt der alte Feichtinger, der Schützenhauptmann, und wer wird's jetzt? … Der Bauer auf der Stauden.
Die Sach hat ihm aber meiner Seel auch zugehört von Rechts wegen und weil's g'wiß sein soll. Denn in den Kriegen 1796, 1799, 1802 und 1809 haben acht von der Stauden ihr Leben lassen müssen ungerechnet noch zwei Weiberleut, eine Bäuerin und eine Haustochter. Die Bäuerin haben die Lumpen im Haus verbrennt, und die Haustochter haben sie bei einem Botengang abgefangen und über den Schrofen ausgejagt. So 200 Fuß tief hat das Diendl braucht, bis es im Himmel war …
Im ganzen Dorf war keine einzige Familie, die die Tiroler Freiheit so mit ihrem Blut bezahlt hätte, wie die Leut auf der Stauden. Das hat der Pfarrer beim Einstand des neuen Schützenhauptmanns auch gesagt und alle, gar alle haben sich drum gefreut. Die alte eroberte Fahn hat gar von selber zu wehen anfangen, wie die Red davon geht. Mein Gott, Fahn … Du lieber Himmel … Eine Stang ist das Ganze halt und etli Fetzen sind noch dran. Das andre ist alles weggeschossen. Halt einen größeren Fleck hat man in der Kirch aufbewahrt, weil er mit der Zeit sonst verloren ging. So eine alte Fahn, das ist für einen richtigen Tiroler was, wie ein Brünndl im Wald, dort wo er am tiefsten und heimlichsten ist, der Wald. Meinen könntest, die paar Fetzen, die alten, abgefärbten, keinen Kreuzer sind sie wert, und wenn sie den Leuten vorangetragen werden, dann schießt dir 's Wasser in die Augen …
Der Bauer auf der Stauden ist gut aufgelegt den ersten Tag als Hauptmann, das ist zu begreifen. Und grad mit eins schießt ihm ein Gedanken durch den Kopf. Itzt ist ja nachher bald die Jahrhundertfeier. Da tat sich's wohl gehören, daß die alte Fahn mitkäm.
»Freili!« schreien gleich etli Bauern. »Aber nit sein kann's, voraus, wenn der Wind hart blast.«
»Ah was«, wirft der Bauer auf der Stauden das Wort in den Winkel. »Machen wir halt ein Netz drum, ein seidenes, wie bei der Spingeser Fahn …«
»Das kostet ja alles zu viel, Bauer, in zwei Monat ist ja schon die Feier …, da tut niemand mehr was um Gottslohn. Meinst nit auch?«
»Und wenn …!« lacht der neue Hauptmann. »Die Sach werd i doch noch heben, nit?«
Und dann haben die Leut von was andrem geredet, denn der Bauer hat's nit gern. Wenn er schon zahlen will, sollt wenigstens nit drüber geredet werden.
Spät sind die Leut auseinander. Vor der Tür meint der Stöcklbua, ein junger, fester Bursch voll federnder Kraft und mahren (mürben) Herz: »Ob er mit gehen mag. Einen Weg hätten sie ja.«
Der Bauer deutet ja und fangt von Stöcklvater zu reden an. Wie's ihm geht, dem Stöcklbauern, wie weit sie im Feld itzt sind und halt so Ding mehr.
Der Bua antwortet auf alles, aber grad fest am Nagel ist er einmal nit, das müßt eigentlich ein Blindes sehen.
Die Vev redet auch einmal und da wird der Stöcklbua grad mit eins munter.
Heroben unterm Zaun sieht der Bauer, der mehr vorausgegangen ist, im Mondschein, wie eins einen Büchsenschuß weiter draußt seinen Zaun offen hat lassen. Das wär grad recht, trachtet er, für die Vieher morgen in der Fruah.
Mit langen Tappern geht er voll Zorn hin und steckt die Stangen wieder ein. Die zwei jungen Leut hören einen Kautz und dann eine Fledermaus. Der Stöcklbua will sie verscheuchen und bleibt ungemeint an der Hand von der Vev hängen. Mein Gott, da unter den dunklen Bäumen ist so was bald. Und wie er jetzt die Hand spürt, da ist's, als ob ihm das Herz fast springen will.
»Vev!« schreit er fast laut, »Vev, magst mi ein bißl leiden?« Und seine Frag, die kommt ganz zu tiefst aus dem Herzen und das warme Blut, das merkst bei jedem Hauch. Das Diendl will ihre Hand wieder haben, aber statt allen Reißen und Ziehen, es wird grad ein fester warmer Druck mehr …
Da halst der Stöcklbua die Vev, und zwei Menschen sind grundglücklich da in der Einsamkeit. Die Stern freuen sich über ihr Glück, und wie der Vater wieder kommt, meint das Diendl verhalten:
»Vater, der Stöcklbua muß itzt wohl gradaus gehen, nit?«
Verwundert schaut der Bauer auf der Stauden auf, denn das weiß der Bua ja besser wie seine Dirn.
Er sagt Pfied Gott, und dann ist die Vev mit einem Herzen wie eine Lohstampf neben ihrem Vater allein. Still und stumm gehen die beiden heimzu.
Wie der Bauer im Haus bei der Latern seiner Vev so beiläufig ins Gesicht schaut, stoßt ihn doch der Wunder.
»Ja, Diendl, was ist denn dir angeflogen?« tut er hellverwundert.
»Mei, nix nit, Vater …«
Der Vater steht vor einem Brunn ohne Rohr. Endlich meint er so besinnlich, wie es manchmal sein Brauch ist:
»Itzt das lugst, Vev …«
Da wird das Diendl brennend. Er sieht das, und jetzt gibt er nimmer auf, bis er richtig die ganze Sach erfragt.
»Teufel,« tut er nach einer Weil, »das muß i mir no überlegen … Das könnt passen und nit …« Im Denken und Trachten wird er ungeduldig und mit seinem groben Schuh stoßt er auf den Laden, daß es einen Spektakel gibt im Haus. Auf einmal pfeift er ganz langgezogen und leise vor sich hin. Und grad mit eins meint er: »So, Diendl, morgen gehst mit mir nach Innsbruck. Da machen wir gleich die Sach mit'n Fahn. Du kannst bei der Gelegenheit deine Godl heimsuchen. Magst?«
»Ja gern, Vater.«
»Ist schon recht, Diendl, z'widers«, lacht der Bauer und geht über die Stieg in seine Kammer.
Die Vev aber hat vor Freud hart schlafen können und schuld haben beide, der Bua und der Vater …
Gleich den andern Tag waren die Leut auf der Stauden droben in Innsbruck beim »Goldenen Hirsch«. Die Wirtin ist die Godl von der Vev und mit den blitzsaubern Diendl hat eins leicht prahlen lassen, meiner Seel. Der Wirt, der dicke Herr Zach, hat die Vev geneckt, wie's brave Leut in Tirol so im Brauch haben, wenn's Diendl doz ein bißl ihr großes Geld wechseln kann. Die Neckereien nicht schuldig bleiben. Und weil die Vev das gut kann, ist's verflixt lustig gewesen. Der Vater ist seinen Geschäften nach und die Wirtsbuam haben derweil der Dirn die eisernen Mander gezeigt und auf die Hungerburg sind sie mit ihr gefahren. Mein Gott, so ein Diendl muß es doch endlich zu wissen kriegen, daß Sprugg ein Stadtl ist, das sich sehen lassen kann auf der Welt.
Den zweiten Tag, die Vev ist völlig müd von den Rennen und Schauen, hockt beim Wirt alles am Tisch.
Hebt der Bauer auf der Stauden mit eins seinen besten Finger. »Halt aus!« tut er. »Weißt, einen Gefallen könntest mir schon tun.«
»Zwei für einen«, lacht der dicke Wirt.
Und besinnlich kommt er mit seinem Wünschen daher, so behutsam, wie die Flieg über die Nas' kriecht. »Mir tät's schon höllisch passen, weißt«, redet er fein langsam. »Geh, behalt mir meine Vev ein Jahr zum Kochenlernen … Magst?«
»Was fallt dir grad ein, Vater!« ist seine Vev hellverwundert.
»Still bist!« trumpft der Bauer auf.
»Ja, wenn das Diendl mag, gern«, ist die Wirtin beim Wort.
Die Vev aber macht ein Gesicht, wie wenn's Mandl in Essig gefallen wär. Grad daß sie noch an Vaters: »Still bist!« denkt, und so zwingt es sich halt:
»Da müßt i wohl arg Vergeltsgott sagen, Godl.« Und damit gibt sie sich drein.
»Nachher kannst gleich dableiben, Vev«, tut der Bauer und redet von was andrem.
Der Wirt bohrt mit seinem Pfeifenspitz Löcher durch die dicke, rauchige Luft in der Stub, das tut er immer, wenn er was zu denken hat. Dann sagt er: »Sollst leben!« trinkt und stellt sein Glas so langsam hin, daß es ja keiner hört.
»Macht mi grad aufdenken«, meint er mit eins. »Wär das nit möglich? … Weißt, i hab zwei Fremde, Fabrikanten sind's aus Berlin. Die Frau ist ein bißl schwach. Die Leut möchten gern bei einen guten Bauern etli Wochen bleiben. Kannst du sie nit halten? Schau, du hast ein festes Gemauert. Haus, hast schöne Kammern und dein Haus steht da am Bühel wie der Graf vorm Bettelmann … Geh, sei so gut. Zahlen, das tun sie gern …«
Die Wirtin redet auch, denn Zureden hilft, das weiß jeder, und so ist nach einem Zeitl die Sach ausgemacht. Die Wirtin holt den Herrn, dem ist das recht und voller Freud ist er, denn morgen geht's zum Bauer auf der Stauden …
Nicht genug wundern können sich die Herrschaften, wie sie wieder an ihrem Tisch plaudern über den komischen Namen »auf der Stauden«.
Die Einheimischen klären die Herrschaften auf. Vor Jahr und Tag, erzählt einer, hat ein Bauer um das Haus lauter Haselnußstauden gesetzt. Die sind jetzt so fünfzig Schritt vor dem Haus zu einem kleinen Wald angewachsen und das Grün leuchtet weit hinaus ins Tal. Vom Dorf aus sieht einer die Stauden und grad da und dort einen weißen Fleck, den der Kalk der Hauswand wirft. So haben's die Bauern halt »auf der Stauden« geheißen …
Etli Tag später ist in Alpach drin auch eine Schützenzusammenkunft und gehen tut's natürlicherweis' um die Jahrhundertfeier. Der Bauer auf der Stauden muß hinein zu der Versammlung und trifft bei der Gelegenheit richtig den Stöcklbuam.
»Du Bua, dummer, … 's Fensterln kannst dir schenken, hörst«, tuschelt er ihm zu.
»Wodrum?« ist der Junge ganz überfahren.
»Weil s' nimmer da ist, die Vev …«
Oh, mein Gott, ist der Stöcklbua rot worden. Die ganze Red hat es ihm verschlagen, und um und um nimmer gewußt hat er, was er sagen soll im Augenblick.
Endlich tut er:
»Wo ist's nachher, die Vev?«
»Möchtest wissen, gelt, du Schlaucherl du …« Aus der Weis' pfiffig lacht der Staudenbauer vor sich hin.
Der Bua aber geht und meinen könnt eins, zehn Zentner tragt er auf seinen Achseln, so hatscht er dahin.
Die Versammlung ist gar und aus. Der Bauer will gehen, da steht auf einmal der alte Stöckl vor ihm.
»Was fragen möcht i halt, Bauer«, tut er verhalten. Wie der andre grad aufschaut, redet er mit bohrenden Augen: »Wissen möcht i gern, ob er dir zu schlecht ist, mein Bua …?« Das kam schwül und zitterig heraus, so zitterig, daß es den auf der Stauden stoßt. Und Trotz gießt es ihm ins Herz, viel Trotz.
»Wennst Streit willst, Stöckl, brauchst es grad zu sagen«, ist der auf.
»Aber, Vater!« schreit der junge Stöckl. »Geh«, dreht er sich dem andern zu. »Vater ist einmal so ein grober Zoch, mußt nit denken, daß i …«
Viel Sorg leuchtet aus seiner Red.
»Weiß Gott, ob d' nit no froh bist um meinen Buam«, brüllt der Stöckl dazwischen. »Für einen Buam langt's bei dir eh nit«, ist er voller Hohn. »Und wenn dein großer Hof in falsche Händ käm, Bualein, das wär übel, gelt? …«
Da dreht sich der Bauer auf der Stauden um und geht, ohne daß er ein einziges Wort mehr verliert.
So aber kommt's, daß der alte und der junge Stöckl im Wirtshaus fast zu raufen anfangen. Andere müssen sich ins Mittel legen. Endlich reißt sich der Junge los und stürmt davon.
Der Stöcklbua bindet sich Flügel an die Füß und rennt talaus, 'leicht fangt er den Bauern noch ab. Über eine Stund rennt er schon so dahin, da sieht er ihn so hundert Schritt voraus, aber nit allein, der Samer Toni von Reith ist bei ihm, und so kann er nix tun wie langsam hinterdrein gehen.
In der Näh von der Stauden schleicht der Stöcklbua die längste Zeit herum. Sollt er hin zum Bauern, sollt er nit, und solche Gedanken und Zweifel zerdrücken ihn völlig. Endlich reißt er sich zusammen. Weil's sein muß, sonst ist er seine Vev los. Und eher … nit dran denken kann er an so was.
»Na, grad so eine Ehr!« empfangt ihn der Bauer in der Stub.
Aber zum Wörteln und Streiten laßt der Bua ja nit Weil. Grad mit einem Tapper ist er vorn Bauern und redet:
»I muß es nehmen, wie's ist, Bauer, aber verzeih's meinem Vater. Er hat ja kein bißl ein Recht, so zu reden, das weiß niemand besser wie i.« Jedes Wort klingt ehrlich und durchzittert von einem festen Willen.
»Weißt, i muß ja froh sein um einen solchen Buam. Bei mir langt's ja nit, weißt eh. Und mein Hof in falsche Händ … Da hat er ja recht, dein Vater«, grollt der Bauer auf der Staud.
Da faßt der Stöckl seine Hand. Er weiß selber nit, wie er dazukommt, und fast lieb redet er: »Ob d' froh sein mußt um mi, Bauer, das ist erst no die Frag. Das muß i zuerst einmal aufweisen. Aber gelt, das laßt zu, daß i's aufweisen kann …?«
Da huscht es über das Bauerngesicht. Er streitet mit sich selber und einen harten, wehen Streit. Lang dauert das. Endlich fallt sein Blick auf den Buam vor ihm, der glühende Willen, die helle Kraft steht ihm aufgeschrieben. Da wird er langsam hell, der Bauer. Müh kostet es ihm, schreckhaft viel Müh, aber endlich meint er doch um halbs feiner:
»Freilich aufweisen mußt es zuerst, Bua. Das kann i und will i dir nit verwehren.«
Dem jungen Loter fällt ein Stein vom Herzen. Und froh wie nie noch im Leben schaut er zu dem Mann vor ihm auf.
Wochen gehen hin, bringen Sonnschein und ein kleines Tröpfel Regen. Das Heu ist schön in den Tenn kommen und wie ein bißl Ruh ist auf dem Feld, da war's dann so weit, daß die Fahn feierlich geweiht wird. Das war ein Fest fürs ganze Dorf.
Die Vev droben in Innsbruck hat Zeitlang gehabt, jeden Tag und jede Stund. Grad heim ist ihr einziger Gedanke bei Tag und bei Nacht. Und die Godl, die 's längst merkt, hat mit der Dirn alles möglich angefangen, aber 'geben hat sich ihr Weh keinen Strich nit. Wie sie nun hört, daß die Fahn am Sonntag von den Schützen abgeholt und neu geweiht wird, da hat sie ihr selber zugeredet, auf etli Tag heimzufahren.
Oh, mein Gott, wie gern, grad wie gern die Vev gefolgt hat. In den großen Steinerhaufen kann sich ein Bergdiendl so v'l hart eingewöhnen. Vom Vatern ist auch noch ein Brief kommen. Und schuld an den Brief waren die studierten Leut im Dorf. Der Doktor, der Verwalter und der Pfarrer.
Der Doktor ist einmal auf die Stauden kommen. »Die Vev muß her, wir brauchen noch eine Marketenderin, Bauer«, ist seine Red noch unter der Tür.
»Haben ja eh schon zwei.«
»Sei stad, was weißt denn du!« fahrt ihm der Herr übers Maul. »Unsre Tiroler Diendln sind zum Gernhaben auf der Welt wie alle Diendln. Aber, mein Lieber, das wär ihnen z'wenig, schon viel zu wenig. Unsre Diendln wollen auch löschen, wenn's wo brennt.«
Redet der Pfarrer:
»'s Diendl gehört zum Schützen wie der Stutzen bei uns in Tirol. Denk doch. Bei all unsern Kriegen, was hat das Diendlvolk da Gutes und Großes getan! Mitgekämpft und mitgelitten unverzagt und voll Geduld. Dann die vielen, vielen Opfer, die grad das Diendlvolk außerdem bracht hat. Wie viel Botschaften, Kundschaften und Sachen haben nit sie redlich … Sie mit ihren schwachen Kräften …«
»Halt aus, Pfarrerle,« fahrt ihm der Doktor dazwischen, »schwache Kräft ist gut. Mit einem windigen Franzosen nimmt's unser Bergdiendl alleweil auf. Das lernt ihm schon Reu und Leid machen«, lacht der z'widere Leutumbringer.
»Alsdann gut«, ist der Pfarrer wieder beim Wort. »Dein Vev muß mit bei den Schützen. Seine Diendln laßt ein Tiroler Schütz einmal nit hint, bald er Ehr einlegen will. Das nit.«
Ist dem Bauern auf der Staud rein nix übrigblieben, wie ein Markl kaufen und auf Innsbruck schreiben. –
Wie dann die Vev da war auf der Stauden, da ist ihr fürs erste das Herz weit, weit aufgegangen. Droben auf dem Bühel steht das Diendl die längst Zeit und trinkt und trinkt den Zauber der Heimat mit vollen Zügen. Jeder Schatten, den die Sonn an einen Berg hinlehnt, jeder Glanz, den sie darüberschüttet, das Silber des Inns drunt im Tal, jeder Schrofen und jeder Stein – oh, wie mächtig stark ist das alles mit ihr verwachsen … Es will schon bald eindunkeln, da kommt einer daher mit einem Buschen.
»Diendl, wie blüht's?!«
Die Augen glänzen, daß es die Sonn auch nit besser kann, und das Diendl, die dumme Vev, die macht es ans Herz greifen. Der Bauer steht daneben, fürs erste noch zwiespältig, aber in all der himmelhohen Freud, er kann nimmer anders, so stark ist er einfach nit, er muß sich mitfreuen.
Da halst der Stöcklbua sein Diendl und nix, rein gar nix mehr spüren die zwei von der Welt um sich herum.
Endlich, meinen könntest, eine kurze Ewigkeit dauert auch nit viel länger, tut das Diendl:
»Wie ist denn das grad kommen, Vaterl? …«
»Du fragst zu viel, Dirn, liebe, dumme«, lacht der Bauer.
Und dann ist es fein worden droben auf der Stauden.
»Daß du's nur weißt, Vater, auf Innsbruck bringen mi keine zehn Rösser mehr«, beichtet die Vev endlich in einer ruhigen Weil.
»Wird dir aber nix anders übrigbleiben,« schmunzelt der Vater. »Der Franzl, der Lump, der muß itzt fürs erste bei mir bleiben. Muß alles zu viel lernen, der Schwanz. Alsdann kann man di nit brauchen im Haus.«
»Wenn i nit mag, Vater …«, klingt's wehleidig.
»Und wenn i di bitt, Dirn?« ist der Franzl auf …
Den andern Tag haben die Pöller der Sonn beim Aufgehen zugejubelt und den ganzen Morgen hat es gekracht, bald da, bald dort, aber gekracht haben die Pöller immer und immer. Herrgott, wie die alte Fahn im Wind hersteht! Ein grünseidenes Netz ist drum, und so ist jedes Fleckl an seinem Platz, wenn's halt überhaupt noch da war. Viele Fleck haben ja gefehlt. Nach der Feier ist ein Lied gesungen worden und dann hat die Musik mit den Schützen die Fahn heimbegleitet, hinauf auf die Stauden. Denn beim Schützenhauptmann ist die Fahn immer einquartiert.
Die Lust aber hat gedauert, bis fast die Sens' Das Siebengestirn. wieder verschwunden ist.
Die nächsten Tag ist die Vev mit vergoldetem Herzen durch ihre kleine Welt im Vaterhaus. Eine Woch hat der Vater doch zugegeben und eine zweite, die luxt sie ihm schon noch ab.
Langsam geht wieder die Feldarbeit an und zu tun gibt's für ein lebfrisches Diendl einen ganzen Hut voll. Der Faden hat kein End nit in einem Bauernhaus.
Einmal, es ist ein sonnenheller Tag, sind die Leut auf der Stauden beim Weizen. Die Sicherln klirren und der Schweiß rinnt. Grad wird marendet Die Vesper. und die Leut rasten einen Schuß. Es hat's auch wahrhaftig not, das Rasten. Der Haustrunk schmeckt, und wenn einer im Krug bis auf den Grund will, muß er die Augen gegen Himmel heben. Der Hüterbua eher wie der große Bauknecht.
»Ui, Leut,« schreit der Bua, »das Sonnwendjoch hat eine Hauben!«
Das weiß jeder in der Gegend, was das heißt, wenn's Sonnwendjoch eine Hauben hat. Ein Wetter kommt, und je schöner die Hauben ist, desto ärger wird's. Das ist was Altes.
»Uns kann's frisch gleich sein,« tut die Dirn, »haben eh grad nur drei, vier Schober, dann sind wir fertig.«
Die drei, vier Schober werden hergesichelt, wie wenn's brennende Feuer auf den Leuten läg. Aber die letzte Garb ist noch nit bunden, da fallt schon der eine und andre Tropfen. Der Himmel ist schwarz und überall drohen wüste Wolken gegen Tal.
Dort, wo die Wolken am dunkelsten sind, fahrt mit eins ein Blitz auf, der gar nimmer aufhören will. Dann grollt der Donner, und der wird von den vielen Bergen immer trotziger zurückgeworfen, keiner will ihn behalten, den lauten Gesellen, und so findet er schon rein kein End mehr. Da fahrt ein neuer Blitz, sein Donner vermischt sich noch mit dem Echo des ersten. Und jetzt ist es mit eins, als ob die Welt voller Feuer und Groll wäre. Rein minutenlang hört es nicht auf, das Feuer und der Wutgroll. Einer, der's nit gewöhnt ist, müßt sich rein fürchten.
Nach dem dritten Blitz setzt der Regen ein. Regen … Oh, mein Gott, Regen, das wär ein leichtes. Herunterfallen tut das Wasser und jeder Tropfen ist ein Eisen. Zutiefst in den Boden bohrt er sich hinein. Ganze Löcher schlagt er in die Erd.
Und im Augenblick haben die Leut am Feld keinen trockenen Faden mehr am Leib.
Dazu kein bißchen Wind. Die Hüte kleben in den Haaren, als wären sie damit verwachsen, und jetzt fangen die Leut endlich zu laufen an.
Heim geht's, grad trocken stehen möchten sie.
Drüben kracht es. Ein Blitz hat im Bach einen Stein, einen haushohen, getroffen, ist abgeprallt und gegen eine Tann gefahren, die nun zersplittert am Boden liegt.
Dort steht eine Buch, wohl über 100 Jahr ist der Baum alt, ein Blitz fährt dran herunt und im Nu brennt der große Baum. Der Regen löscht im gleichen Augenblick die Flammen, aber es ist schon zu spät. Die schöne Buch wird nimmer grünen …
Wie die springenden Leut endlich vor dem Haus stehen, da will der ärgste Regen aufhören. Dafür setzt aber der Wind ein. In seiner Wut bricht er Bäume und tragt die größten Äste weit, mächtig weit.
Wieder ein Blitz. Er hat eingeschlagen, aber wo sehen sie nicht. Noch einer. Da, schon sind sie unter Dach, tut's einen fürchterlichen Krach. Die Leut fahren zusammen und die Vev springt heraus, der Knecht hinter ihr, denn das hat in der nächsten Näh gezunden. Schwefel liegt in der Luft, jeder von ihnen spürt es. Da schreit die Vev:
»Ho! … Ho! … Bei uns hat's geschlagen!«
Da ist neues Leben in die Leut gekommen.
»Schnell, die Sommerfrischler …«, schreit eine Dirn.
Der andere schreit nach den Bauern und ein dritter rennt nach dem Stall. Grad im Nu war jeder an seiner Arbeit. Keine Minut war seit dem Blitz vergangen und jeder, gar jeder im Haus war schon im vollen Helfen. Die Vev hat das Geld geholt und die Schriften vom Vater. Wie sie damit im Freien war, sieht sie schon die beiden Sommerfrischler. Und der Bauer kommt auch grad daher mit einer Bettstatt.
Schon brechen aus dem Dach die Flammen. Der Wind laßt sie hellauf lodern. Der Holzaltan um das große Haus ist auch schon kohlschwarz. Ein Vaterunser später huscht die gelbe Flamme über das schwarze Holz und springt über auf die Schindeln. Durch die engen Fenster siehst sie wüten und lecken.
Was einmal zu retten war, das wird gegriffen und jeder, gar jeder setzt sein Bestes drein, denn da hängt alles von Augenblicken ab. Alles …
Zu retten ist am Haus nichts mehr. Man muß es rein brennen lassen, wie's brennt. Alles wär umsonst, denn Wasser ist nit genug da, und bis die Spritz aus dem Dorf kommt, o, mein Gott, bis dort ist alles ein Haufen Stein und Aschen.
Der Bauer steht bei den Sommerfrischlern neben seiner Vev. Jetzt ist er schon wieder ruhig. Nur die Vev zittert am ganzen Leib und die beiden Fremden sind zerweicht von der üblen Gottesgab.
Da mit eins fallt dem Diendl was ein:
»Vater! Die Fahn! … Die ist noch im Haus …!«
Der Bauer schaut drein, als ob ihm im Augenblick die Fahn gleich sein könnt.
Da will er reden, aber seine Vev ist nimmer da, die ist schon ins brennende Haus.
»Hoho, Diendl!« schreit er.
Da hört er die andern:
»Ja, um Gotteswillen, Vev, bist denn ganz verrückt! Vev …, Diendl, dumms …!«
Wie die drei Leut hinlaufen, erzählt der Knecht, die Vev ist verbrannt. So ein Unglück …
»Sie will den Fahn holen«, schreit der Bauer mit eins wieder ganz auf der nassen Welt. »Heilige Mutter Gottes, grad nit verbrennen laß mein Diendl, mein liebes!« Damit sinkt er auf die Knie. Und nit einmal Zähren kommen dem alten Mann in dem Augenblick, so ist er voll zerwürgter Spannung und Elend.
Um ihn ist ein Knistern, ein Fallen von brennenden Trümmern, ein Brechen und Stürzen und die Sekunden rinnen und rinnen … O, mein Gott, grad nit verbrennen laß das Diendl …
Endlich ist das überwunden. Das nächste Beil greift der Bauer und haut die Holzwand damit ein. Die Knecht helfen und so ist im Augenblick ein großes Loch … »Vev! … Vev! …«
Der Dachbalken übern Stall bricht mit lautem Stöhnen in sich zusammen und die Glut loht wild auf zum Himmel …
»Vev! …«
Endlich, die Augenblick werden zentnerschwere Stein, endlich sieht man Bewegung im Rauch durch ein helles Fenster.
»Vev!« schreien alle in tiefster Herzensnot.
Da, Gott Lob und Dank, da endlich steht das Diendl wieder im Freien, die Fahn in der Hand. Zum Glück war der Lederüberzug drüber, sonst wär sie wohl sauber verbrennt. Wie ein Engel steht die Vev da. Die Glut hinter ihr ist, als ob das Diendl vom Himmel käm.
»Da, Vater, da ist die Fahn!« schreit sie und dann fällt sie hin.
Die fremde Frau aus Berlin aber fangt zu weinen an und der Krampf schüttelt sie, daß die lauten Schluchzer grad aufstoßen. – –
Die Nachbarn haben den Leuten von der Stauden Unterschlupf gegeben für die Nacht, nur die Vev haben sie herunter ins Dorf. Der Pfarrer hat es nit anders tan, sie muß hinauf in den Widum. Die Häuserin soll sie wieder gesund pflegen. Ist ihr wohl nit grad extra viel geschehen. Die eine Seit halt ist ein bißl arg verbrennt, aber sonst ist nix Schreckhaftes.
Der Bauer auf der Stauden hat die ganze Zeit in sein Herz hineingelost. Die schreckhafte Angst, die er ausgestanden hat, die laßt noch immer seinen Stolz nit aufkommen. Grad das eine fühlt und denkt er, wie groß grad die Gnad Gottes ist, daß er das Diendl nit hat verbrennen lassen.
Andern Tags ist der Stöcklfranzl im Widum. Der Pfarrer selber führt ihn hinauf in die Krankenstub, denn der Bua hat ja nit nachgeben.
Dort liegt die Dirn still ruhig in den Kissen und reines Gold ist in ihren Augen. Der Franzl hat wollen schelten. Wo Manderleut gnua um die Weg waren, muß ein Diendl sein Leben dransetzen …
Aber wie er das Diendl sieht, ist ihm vor lauter Glück nimmer um das Schelten.
Er kniet am Bett und streichelt sie, die Vev, und bußt ihre verbrennte Hand. Endlich meint er verhalten:
»Manderleuten hätt das zugehört, nit dir, Vev.«
»Schon,« redet die dawider, »aber weißt, denen ist's nit eingefallen, und bis ich's ihnen verdeutsch … In solchen Augenblicken mußt zugreifen oder du bist auch nit mehr wie ein Spatz …«
»Ja, Diendl, i weiß ja gar nit, wie i dir danken sollt«, redet der Franzl zutiefst aus dem Herzen.
»Du willst danken, Franzl …, mir? …«
»Ja, danken muß i dir …«
»Mehr will i ja gar nit. Mehr kann mir keins geben, Bua, lieber«, ist das Diendl still und heimlich.
Da geht die Tür noch einmal und die beiden Sommerfrischler auf der Stauden kommen daher. Die Frau hat gar Blümel mit fürs Diendl, fürs tapfere.
Man plaudert eine Weil, und so meint die Dame schließlich:
»Das war tapfer, liebes Fräulein. Aber unüberlegt. Schließlich war's doch nur ein Fetzen, der das Leben nicht wert ist.«
Sie will damit ihrem Meinen Ausdruck geben.
Da aber faßt's den Stöcklfranzl, und seine Faust ballt sich:
»Was, das Leben soll der Fetzen nit wert sein … Frau … sein S' still, das verstehen S' nit. Der Fetzen, wie Sie sagen, der bedeutet uns Tirol … Das ganze Land mit allem, was Schönes, Gutes und Liebes dran ist an dem kleinen Landl …« Der ganze Mensch zittert voll verhaltenem Zorn.
Der Berliner Herr ist mit seiner Frau längst drunt auf der Dorfgass' … Da meint er still: »Der Fetzen bedeutet uns Tirol … Donnerwetter, Kerle sind's doch, diese Bauern …«
