
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Schnell gingen Dina die Monate dahin. An Capri dachte sie jetzt selten mehr, sondern war ganz erfüllt von den täglichen, kleinen Ereignissen und Freuden, ihren Schulfreundinnen und ihren Aufgaben.
Doktor Reinhart neckte sie oft, wenn er sie fleißig bei ihren Büchern sah: »Dina, Dina, Du wirst noch ein Blaustrumpf werden.«
Aber Onkel Alfred meinte lächelnd: »Doktorchen, lenke mir das Kind nicht vom Lernen ab. Im übrigen ist sie ja doch zu nichts zu gebrauchen und stellt uns nur das Haus auf den Kopf, wenn sie nichts zu thun hat.«
So machte Dina erfreuliche Fortschritte, gefiel sich ausgezeichnet in der Schule und war auch bei den Lehrern gut angeschrieben. Einmal aber kam es doch dazu, daß sie den Lehrern ernsthaft zu denken gab.
Nelly hatte ein paar Tage einer Erkältung wegen gefehlt, und als sie an einem Freitag wieder in die Schule kam, ließ sie sich von den Mitschülerinnen alle Aufgaben sagen, die zum nächsten Tage vorlagen, um sie nachzuarbeiten. Nun war an dem folgenden Tage aber italienischer Unterricht, und da Nelly in dieser Stunde erste saß, hatten sich die übrigen Schülerinnen verschworen, ihr die Aufgaben nicht zu sagen, damit sie am nächsten Tage herunterkäme. Wohin sie sich auch wandte, sie erhielt keine Antwort.
Als Nelly Dina von der Verschwörung gegen sie erzählte, war diese empört.
»Das ist ja unerhört«, rief sie einmal über das andere. »Das kannst Du Dir nicht gefallen lassen«, und sie beschloß für die Freundin einzutreten.
Als Schulschluß war, eilte Dina allen anderen voraus und stellte sich am Ausgang des Hofes auf, über den die Mädchen kommen mußten. Sobald aber eins von den Mädchen nahte, die an dem italienischen Unterricht, der fakultativ war, teil nahm, packte sie sie um die Taille und warf sie der Länge lang in die Pfützen und Wassertümpel, die von den letzten Regengüssen noch auf dem Hof standen. Ein paar Mal wollte ihr eine ihrer Gefährtinnen in die Arme greifen um sie zurückzuhalten, aber Dina schlug dann so heftig um sich, daß sich bald keine mehr heran traute. Sie wußten alle, daß Dina trotz ihrer zierlichen, geschmeidigen Gestalt tüchtige Kräfte und Muskeln besaß und daß mit ihr nicht zu spaßen war. Es bildete sich also ein ganzer Kreis von jungen Mädchen um sie herum, die alle zuschauten, wie Dina eine nach der andern der italienischen Schülerinnen, die doch älter und größer waren als sie, zu Boden warf. Ein paarmal gab es ein heftiges Ringen, besonders ein großes Mädchen setzte sich energisch zur Wehr, aber schließlich blieb Dina doch Siegerin, und die Große flog mit dem Kopf zuerst in den Schmutz. Einige waren allerdings bei dem Kampf durchgewischt, und ein paar hatten sich ängstlich irgendwo verkrochen. Doch auch diese letzteren wurden von Dina noch aufgefunden und entgingen nicht ihrem Geschick.
Dann stob die ganze Schaar auseinander. Dina langte mit aufgelösten Haaren und mit Schmutz bespritzt zu Hause an, wo Doktor Reinhart gerade an der Hausthür klingelte.
»Du siehst ja nett aus, Dina«, rief er, »bist Du auf dem Straßendamm hingefallen, oder steht in Eurem Schulhof der Schmutz so hoch?«
Dina überblickte ihren Anzug, er war allerdings bös zugerichtet.
»So wird Dich Herr Schenk gleich wiedererkennen, wenn er Dich sieht«, fuhr der Doktor fort. »Ich habe ihm eben erzählt, aus dem Capreser Wildfang wäre ein ganz artiges Schulmädchen und angehender Backfisch geworden, aber wie ich sehe, habe ich falsch berichtet.«
»Ist Hans Schenk hier?« rief Dina freudig bestürzt, »mein Herr Lehrer aus Capri. Onkel Doktor, das ist ja herrlich!« Damit flog sie dem behäbigen Doktor um den Hals und hinterließ auf seinem tadellos gebürsteten, schwarzen Ueberrock deutliche Spuren ihres beschmutzten Kleides.
»Ehe Du mich nicht wieder sauber abbürstest«, entschied der Doktor, »erzähle ich Dir gar nichts«, und Dina beeilte sich eine Kleiderbürste herbeizuschaffen, damit sie nur endlich einmal etwas genaueres erführe.
Bald war der Onkel Doktor sauber, hatte sich auch Haar und Bart übergestrichen und betrat mit Dina das Zimmer der Frau Konsul.
»Meine verehrte Frau«, sprach er nach der ersten Begrüßung, »wenn Sie es mir erlauben, gestatte ich mir, Ihnen am Sonntag einen jungen Bekannten von mir zuzuführen, mit dem mich der Zufall in Capri zusammenbrachte. Er ist ein gemeinsamer Freund von mir und Dina, von dem Sie auch schon hörten, Herr Schenk.«
Frau Weber forderte den Doktor freundlich auf, den jungen Herrn, von dem Dina stets des Lobes voll gewesen und der so gütig zu ihrer Nichte gewesen war, doch am kommenden Sonntag zum Familienmittagstisch mitzubringen, und Doktor Reinhart meinte, er sei überzeugt, er könne gleich für ihn zusagen.
Nun aber fiel Dina mit Fragen über ihn her: »Onkel Doktor, wie sieht er aus? Ist er wieder ganz gesund? Bringt er Grüße von Gitta – und ist sein Bart gewachsen – und trägt er noch den graukarrierten Rock?« – und was sie alles wissen wollte.
»Du wirst ihn ja sehen, Du wirst ihn ja sehen, dann kannst Du Dich selbst von allem überzeugen«, wehrte der Doktor sie ab.
Aber Dina fragte immer von neuem und beschäftigte sich den ganzen Nachmittag nur mit Gedanken an ihren Herrn Lehrer.
Nicht wenig erstaunt war sie, als die Tante sie vor dem Abendbrot noch einmal zu sich ins Zimmer rufen ließ. Um diese Stunde machte sie gewöhnlich Schularbeiten, und da ließ Frau Weber sie sonst nie abrufen.
»Ich habe ein ernstes Wort mit Dir zu reden«, sprach sie zu der Eintretenden. Und als Dina vor ihr stand, sah sie ihr ganz traurig in die Augen und fuhr fort: »Soeben habe ich einen Brief von Deinem Direktor erhalten, Du habest auf dem Hof der höheren Töchterschule eine regelrechte Prügelei in Szene gesetzt, und er bäte uns, Deine Angehörigen, dringend, so weit auf Dein Betragen einzuwirken, daß so etwas nicht wieder vorkäme, er sähe sich sonst, zu seinem größten Bedauern, genötigt, Dich zu entlassen. Einige Mütter der von Dir angegriffenen Mädchen seien selbst zu ihm gekommen, um sich über die Behandlung ihrer Töchter zu beschweren. Nebenan im Gymnasium sollen die Knaben frohlockt haben über die Schlägerei in der Mädchenschule, die man vom Korridorfenster beobachten konnte. Ich verstehe nicht, Bernhardine, wie Du Dich so weit fortreißen lassen kannst, und es scheint mir, als ob jeder Erziehungsversuch an Deiner natürlichen Wildheit und Ungezogenheit abprallt.
Dina stand mit gesenktem Kopf vor der Tante, so ernst hatte diese noch nie zu ihr gesprochen.
Aber die Tante fuhr fort: »Onkel Alfred hat den Brief noch gar nicht gesehen. Was wird er dazu sagen, wenn ihn seine Nichte in dem Munde der Leute bringt? Denn, Kind, Du trägst unsern Namen, und es ist wahrlich für Deine einzigen Anverwandten nicht angenehm, wenn es heißt, Bernhardine Weber benimmt sich wie ein Kind, das von der Straße aufgelesen ist.«
»Von der Straße aufgelesen«, diesen Ausdruck hatte auch Lieschen Müller gebraucht ihr gegenüber, als sie sie kränken wollte. Es mußte also etwas sehr schlimmes sein, von der Straße aufgelesen zu werden, und sie war ja in Wahrheit von der Straße aufgelesen.
Dina stürzten die Thränen aus den Augen.
»Tante, Tante«, flehte sie, »sprich nicht so bös zu mir.«
Doch die Frau Konsul fuhr fort: »Was werden nur Deine Freundinnen davon denken, Mohrs und alle die anderen und Nelly Mühlmann?«
»Aber um Nellys willen war es ja gerade«, warf Dina schluchzend ein.
»Wie um Nellys willen?«, fragte die Tante.
Und Dina stammelte nun unter Thränen ihren Bericht hervor, wie die großen Mädchen Nelly die Aufgaben vorenthalten hatten, damit sie in der italienischen Stunde herunterkäme, – »und das ist doch hinterlistig und schändlich und verdient Strafe«, schloß sie ihre Erzählung.
»Gewiß hatten die großen Mädchen Unrecht; aber Dir stand nicht zu ihr Betragen zu rügen«, meinte die Tante, etwas erleichtert, daß Dinas Gerechtigkeitssinn und nicht bloße Unart den unliebsamen Zwischenfall verursacht hatten. So war wenigstens der Anlaß zu allem eine Empfindung gewesen, die Frau Weber bei ihrer Nichte nicht misbilligen konnte. Dina war streng gerecht gegen sich und gegen andere, das wußte die Tante recht wohl und hatte sich oft an dieser Eigenschaft gefreut.
»Ich werde morgen in der Freiviertelstunde nach der Schule kommen, und dann wollen wir gemeinsam zu Deinem Direktor gehen«, entschied sie daher; »aber eins bedenke stets«, fügte sie hinzu, »Du bist in unserm Hause, Bernhardine, und darfst nie außer Acht lassen, was ein Mädchen ihrem guten Rufe schuldig ist.«
Am nächsten Tage, wie verabredet, begab sich die Tante mit Dina zum Direktor. Hier mußte die letztere buchstäblich alles wiederholen, wie es gekommen war.
Der Direktor sagte darauf: »Um Nelly ihre Aufgabe zu verschaffen, wäre es viel einfacher gewesen, Sie oder Nelly wären direkt zu der Signora Grandi gegangen, diese hätte Ihnen sicher gern Bescheid gesagt. Hier in der Schule, Dina, wird nicht Lynchjustiz geübt, das merken Sie sich.«
Damit entließ er sie, reichte ihr aber doch die Hand zum Abschied, und Dina war sehr glücklich, daß er sie in der Folge ihr unweibliches Betragen nicht mehr entgelten ließ.
Das Wort Lynchjustiz hatte sich aber ihrem Gedächtnis fest eingeprägt, und Onkel Alfred mußte ihr gleich am Nachmittag erzählen, was es bedeute.
»Lynch ist der Name eines Richters, nach dem diese Art der Justiz benannt ist«, meinte er, »Lynchjustiz ist in Amerika gebräuchlich und bedeutet Volksjustiz, wobei das Volk eigenmächtig und unmittelbar strafend eingreift.«
Ganz anders als Webers und der Direktor dachten indessen die Mühlmannschen Kinder über Dinas thatkräftiges Eintreten für Nelly.
Oskar bezeichnete Dinas Benehmen als: »Schneidig«, und auch Mütchen konnte ihr seine Bewunderung nicht versagen. Ja, Dina wurde in Zukunft sogar stets als Beispiel zwischen den Kindern aufgestellt. Wenn ein Mädchen so mutig wäre, hieß es bei den Knaben, so dürften sie es nicht anders machen.
Eines Tages, als Dina mit Oskar und Nelly zusammen saß, kam Mütchen weinend ins Zimmer.
»Ox«, klagte er, »der lange Franz Küster hat mich in den Rinnstein geworfen.«
»Und da weinst Du?« fiel ihm Oskar ins Wort, »und schämst Dich nicht vor Dina. Gleich geh' nochmal hinunter und wirf ihn auch hin.«
Mütchen klappte die Thür zu und verschwand.
Nach kurzer Zeit erschien er strahlend wieder.
»Nun?« fragte Ox.
»Er liegt«, lautete die Antwort.
Am nächsten Sonntag erschien, wie angekündigt, Hans Schenk mit Doktor Reinhart. Als Dina die Klingel gehen hörte, lief sie sofort die Treppe hinab auf die Herren zu und streckte dem jungen Dozenten freudig beide Hände entgegen.
Eine ganze Weile hielt er sie fest und seine Augen ruhten voll Wohlgefallen auf dem herangewachsenen Mädchen bis der Doktor Reinhart schließlich sagte:
»Nun, Dina, bekomme ich heute gar kein Willkommen?«
Da wandte sie sich ihm endlich zu und hielt ihm die Backe zum Kusse hin.
Dabei verteidigte sie sich aber: »Mein Herr Lehrer aus Capri hat doch ältere Rechte«, und sie begann den Ankömmling wie gewohnt mit Fragen zu überhäufen.
Er mußte ihr berichten, wie Gitta jetzt nicht mehr allein die Gartenarbeit thun könne und eine Hilfe angenommen hätte, dann erzählte er von Bella, die Junge bekommen hatte und schließlich war noch zu erwähnen, daß der Herr der Villa einige Wochen mit ihm zusammen dort gehaust und sich gegen ihn so sehr liebenswürdig gezeigt hatte.
Wenn er aber pausiren wollte, so bat Dina immer wieder: »Ach erzähle doch weiter«, und sie konnte gar nicht genug bekommen.
Nach Tisch flüsterte die Tante Dina ins Ohr, daß sie Herrn Schenk nicht so einfach: »Du« nennen dürfte, ohne ihn danach zu fragen.
Dina aber blickte treuherzig zu Hans Schenk hinüber und meinte: »Zu Dir brauche ich doch nie: »Sie« zu sagen. Nicht wahr, Herr Lehrer?
»Nein, nein«, entgegnete dieser, »zwischen so alten, guten Bekannten, wie wir Beide sind, würde die förmliche Anrede mit: »Sie« schlecht passen, ich würde auch nie zu Dir Sie sagen können, Dina, und wenn Du noch viel größer wärst, als Du es schon bist. Nur eins denke ich ändern wir, nämlich die Bezeichnung: Herr Lehrer; das klingt jetzt etwas zu kindlich, und Du weißt doch ganz genau, wie ich mit Vornamen heiße.«
»Ja, Hans«, sagte Dina lachend; aber es kam ihr zuerst doch putzig vor, den so viel älteren Mann mit dem Vornamen zu benennen, und oft genug fiel sie noch in die alte, liebe Anrede: Herr Lehrer zurück.
Nelly, die von Dina zum Nachmittag eingeladen worden war, fand sich in ihren Erwartungen von Hans Schenk, nach Dinas Schilderung, sehr enttäuscht. Erstens fand sie ihn nicht entfernt so hübsch, wie ihn Dina ihr beschrieben. Die blauen Augen wären zwar sehr schön, meinte sie; aber der lange, blonde Vollbart wollte ihr gar nicht gefallen, ein kecker Schnurrbart däuchte ihr weit hübscher, und dann hatte Hans Schenk die ganze Zeit den Erwachsenen von seiner neuen Arbeit: »Über die Seesternarten im Mittelmeer« gesprochen, und das war Nelly sehr langweilig erschienen.
Sie hatte ein paar Mal Dinchen Zeichen gegeben, daß sie lieber herausgehen wollten in den Garten, und als sie endlich draußen waren, hatte sie dann von einer Neuigkeit zu erzählen angefangen, die sie noch auf dem Herzen hatte.
»Es ist etwas ganz schreckliches, von Lieschen Müller«, so hatte sie begonnen. »Rate einmal, was sie gethan hat?«
»Sie hat neulich Nachsitzen gehabt, weil sie ihren Aufsatz nicht abgeliefert hat, meinst Du das?« fragte Dina.
Aber Nelly sagte: »Nein, viel schlimmer, viel schlimmer.«
»Dann ist sie wohl wieder gegen ihre Mutter ungezogen gewesen«, forschte Dina.
»Nein, noch schlimmer«, behauptete Nelly, »aber Du kannst es nicht rathen. So höre bloß, was mir heute früh Ella Mohr erzählt hat, die es von ihrer Mutter hat, welche, wie Du weißt, mit Frau Müller gut befreundet ist.«
»Du machst einem ja ganz bange«, meinte Dinchen.
Und Nelly erzählte: »Also gestern – Du kennst ja Lieschens berühmte Naschhaftigkeit – gestern will unser Lieschen einmal wieder nach der Konditorei, wo sie sich mit dem rothaarigen Hermann Degen und dem Franz Ekstein, dem faulen Sekundaner, verabredet hat. Sie hatte aber kein Geld. Ihr Taschengeld war zu Ende, und das war kein Wunder, sie gab es ja stets für den thörichsten Plunder aus. Was denkst Du nun aber, was sie thut? Auf dem Frühstückstisch liegt die Bäckerrechnung und darauf das Geld, was Frau Müller dort hingelegt hat, damit das Dienstmädchen die Rechnung bezahlt. Lieschen aber, die sich unbeobachtet sieht, zerreißt schnell die Bäckerrechnung und steckt diese mitsammt dem Gelde in die Tasche.«
»Pfui«, rief Dina ganz entrüstet, »das heißt ja stehlen.«
Nelly aber fuhr fort: »Höre weiter. – Alles dieses wäre wohl kaum herausgekommen, denn Niemand hatte es ja gesehen, und Lieschen ließ sich gar nichts merken, als sie hörte, wie ihre Mutter das Dienstmädchen um die Quittung über das Geld befragte. Das Mädchen hatte weder Rechnung noch Geld gesehen und bestritt natürlich, daß irgend etwas auf dem Frühstückstisch gelegen hätte. Frau Müller war in großer Aufregung, sie wußte genau sie hatte das Geld auf den Tisch gelegt, und irgendwo mußte es doch geblieben sein. Da – als das Mädchen am nächsten Morgen Lieschens Kleider ausbürstet – fällt ganz zufällig aus Lieschens Tasche die zerrissene Bäckerrechnung, und das war ein Glück, denn sonst hätte Frau Müller wohl möglich noch Verdacht gegen das unschuldige Dienstmädchen gefaßt. Nun nahm die Mutter Lieschen gleich ins Verhör, sie zeigte ihr die Rechnung, die ihr das Dienstmädchen ausgehändigt und zog dann aus Lieschens Tasche ihr Portemonnaie, in dem sich noch ein gut Teil der Geldstücke vorfand, die sie sich wohl für ein andermal aufsparen wollte, während der größte Teil schon beim Konditor verausgabt war. Was sagst Du dazu?«
»Für so schlecht hätte ich Lieschen doch nicht gehalten«, meinte Dina ganz aufgeregt von der Erzählung. »Ihre arme Mutter ist wohl sehr traurig.« »Ja«, entgegnete Nelly, »sie soll den ganzen Tag geweint haben. Lieschen wird nun aus der Schule genommen und kommt in sehr strenge Zucht, in eine Pension, weit fort von hier und das ist sehr gut«, schloß Nelly ihren Bericht, »es wird sich manche in der Schule daran ein abschreckendes Beispiel nehmen und sich hüten auf gleiche Bahnen zu kommen wie Lieschen Müller.«
Dina aber konnte lange die Geschichte nicht vergessen, und als keiner mehr von Lieschen Müller sprach, dachte sie noch oft darüber nach, wie es möglich sei, daß ein Kind seine Mutter so tief betrüben konnte.
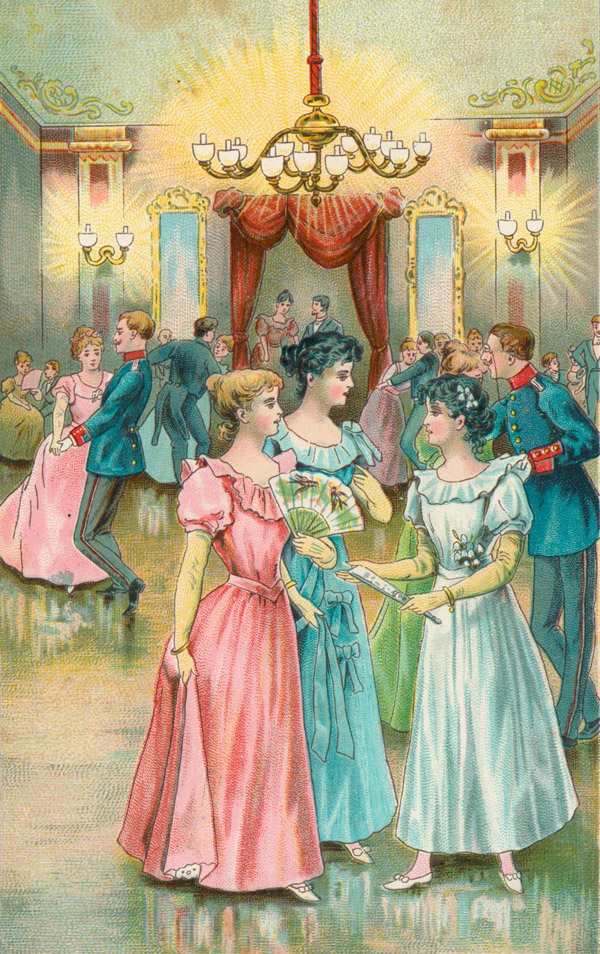
Dina.