
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ein neuer Abschnitt in Chopins Leben trat ein, als er die Frau kennen lernte, die ihn mehr als zehn Jahre an sich fesselte, die einzige, die ihn dauernd zu faszinieren vermochte, George Sand, eigentlich Aurore Dupin. Sie war zu jener Zeit 33 Jahre alt und als Schriftstellerin schon berühmt. In einem abenteuerreichen Leben hatte sie die merkwürdige Macht ihrer Persönlichkeit schon oft erprobt. Ihre Ehe mit Casimir Dudevant wurde 1836 nach 14jähriger Dauer getrennt. Die Gatten waren einander zu ungleich. Schon 1831 hatte sie Dudevant in Nohant, ihrem Landgut in Berry, zurückgelassen, und war nach Paris gegangen, wo sie ihre schriftstellerischen Talente verwertete und sich unter dem Pseudonym George Sand schnell Ruf verschaffte. In den literarischen Kreisen war sie bald heimisch. Von den Erlebnissen dieser Zeit ist am bekanntesten geworden ihr Verhältnis zu dem Dichter Alfred de Musset, mit dem sie 1834 in Italien reiste. Mussets heisse Leidenschaft war nach wenigen Monaten abgekühlt; später hasste er sie geradezu. Ihre mannigfachen Abenteuer hinderten sie nicht, von Zeit zu Zeit ihrem Gatten in Nohant einen Besuch abzustatten, bis endlich die Scheidung ausgesprochen wurde. Sie ging vorerst mit ihren Kindern Maurice und Solange nach Paris. Ein Jahr später begegnete sie Chopin dort. Eingehendes über G. Sand's Lebensgeschichte bei Niecks I, 314-315; in ihrer Histoire de ma vie; siehe auch bei Liszt das Kapitel VII, S. 248ff; Heinrich Heine, Kunstberichte aus Paris, sämtliche Werke XI, 282-307, das Kapitel: George Sand. Ueberhaupt kann man sich bei Heine, wie auch in Grillparzer's Tagebuch aus dem Jahre 1836 (Stl. Werke, Bd. 10) über das Pariser Milieu einigermassen unterrichten.
Ueber die erste Zusammenkunft von George Sand und Chopin ist ein ganzer Kranz von Legenden geschrieben worden. (Niecks kritische Abfertigung aller erhaltenen Berichte macht es hier überflüssig, auf sie einzugehen.) Gewicht hat einzig und allein Liszts Bericht. George Sand hatte von Chopin, seinem Spiel und seinen Kompositionen viel gehört. Sie sprach Liszt gegenüber den Wunsch aus, mit Chopin bekannt zu werden und Liszt sprach mit Chopin darüber. Dieser jedoch, in seiner Abneigung gegen Schriftstellerinnen, war nicht leicht zu einer Zusammenkunft zu bewegen. George Sand liess nicht locker, bis Liszt sie einmal unangemeldet mit der Comtesse d'Agoult zu Chopin brachte. George Sand selbst schreibt, dass sie Chopin bei der Comtesse d'Agoult kennen gelernt habe.
Wie dem auch sei, sicher ist es, dass Chopin und George Sand im März 1837 mit einander schon gut bekannt waren, denn am 28. März schreibt George Sand an Liszt: »Sagen Sie Chopin, ich bitte ihn, Sie nach Nohant zu begleiten; Marie (die Comtesse d'Agoult) kann ohne ihn nicht leben, und ich bete ihn an.« Am 5. April schreibt sie an die Comtesse d'Agoult und trägt ihr Einladungen auf für Mickiewicz, den polnischen Dichter, Liszt, Chopin, »den ich vergöttere« und Grzymala, Chopins Freund. Ueberhaupt ist Chopins Name in George Sands Briefen aus dieser Zeit oft erwähnt.
Mit dem Jahre 1836 bricht die erhaltene und zugängliche Familienkorrespondenz plötzlich ab, erst aus den vierziger Jahren sind die Familienbriefe wieder als Quelle benutzbar. Es ist also wenig über die Einzelheiten von Chopins Leben, besonders 1837-38, zu melden. Insbesondere über die erste Zeit von Chopins Beziehungen zu George Sand ist Dunkel gebreitet. Im Winter 1837 war Chopins Gesundheitszustand nicht gut; sein Leiden machte im Jahre 1838 bedenkliche Fortschritte, so dass ein Aufenthalt im Süden für ihn zur Notwendigkeit wurde. Er fasste den Entschluss, mit George Sand nach Majorka zu gehen. Ueber die Vorgeschichte dieser Reise sind verschiedene Angaben gemacht worden. Liszt berichtet, dass George Sand sich fürsorglich erboten habe, Chopin zu begleiten. Karasowski erzählt umgekehrt, Chopin habe seine Freundin bewogen, mit ihm zu reisen. George Sand schliesslich gibt wiederum eine andere Erklärung. Sie hatte, hauptsächlich ihres Sohnes Maurice wegen, der von rheumatischem Leiden stark geplagt war, die Absicht, nach dem Süden zu gehen, und Chopin schloss sich ihr an.
Ueber die Reise nach Majorca und den Aufenthalt dort sind wir sehr genau unterrichtet durch George Sands »Un hiver à Majorque«, ihre »Histoire de ma vie«, und ihre »Correspondance«, ferner durch Chopins Briefe an Fontana (in der polnischen Ausgabe von Karasowskis Biographie). Von diesen Quellen kommen natürlich Chopins Briefe in erster Linie in Betracht; bei George Sands Berichten ist die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit nicht ganz leicht zu ziehen. (Es sei in Betreff der Einzelheiten auf die genannten Bücher verwiesen.) Als ganz sicher beglaubigte Tatsachen dürften etwa die folgenden anzusehen sein: Im November 1838 reiste George Sand mit ihren beiden Kindern Maurice und Solange (damals 15 und 10 Jahre alt) und einer Zofe ab. Die Reise führte über Lyon, Avignon, Vaucluse, Nîmes, Perpignan. In Perpignan traf sie mit Chopin zusammen. Dieser hatte über seine Pläne grosses Stillschweigen bewahrt. Nur die allervertrautesten Freunde wussten von Chopins Absicht, und in den Briefen an Fontana findet sich wiederholt die Mahnung, niemandem über Chopins Reise näheres zu erzählen, sondern lästige Frager mit ein paar allgemeinen Redensarten abzuspeisen. War Chopin schon für gewöhnlich sehr wenig vertrauensselig, überhaupt nur den allerintimsten Freunden gegenüber mitteilsam, so mochte er diesmal noch besonderen Anlass zum Schweigen gehabt haben. In der Pariser Gesellschaft würde man wohl nicht versäumt haben, über das Verhältnis der berühmten Schriftstellerin zu dem berühmten Musiker ausgiebige Glossen zu machen, zumal da George Sand der chronique scandaleuse schon mehrfach Stoff zu pikanten Anekdoten gegeben hatte. Es ist also begreiflich, dass ein Mensch wie Chopin, der die gute Form so peinlich wahrte, der überhaupt so wenig vom bohémien an sich hatte, dem Gerede der Leute sich nicht preisgeben wollte. Die Reise führte von Perpignan nach Port-Vendres. Dort stieg die Reisegesellschaft aufs Schiff. Barcelona war der nächste Halteplatz. Nach mehrtägigem Aufenthalt, den Sehenswürdigkeiten der Stadt und Umgebung gewidmet, wurde die Reise nach Palma fortgesetzt, der Hauptstadt von Majorca. Sommerliche Wärme grüsste die Reisenden bei der Ankunft in Palma. Der ganze Zauber des Südens umfing sie. George Sands Schilderung der Ueberfahrt, der ersten Eindrücke in Palma verdiente ihrer literarischen Qualität halber hier mitgeteilt zu werden, – der eng umgrenzte Umfang dieses Buches lässt es nicht zu. So finde wenigstens ein Teil von Chopins Brief an Fontana (Palma, 15. November 1838) hier einen Platz:
»Ich bin in Palma, unter Palmen, Cedern, Kaktus, Aloen, Oliven, Orangen-, Citronen- und Granatenbäumen u. s. w., die der Jardin des Plantes nur dank seiner Oefen besitzt. Der Himmel glänzt wie ein Türkis, die See ist wie Lazuli, die Berge scheinen wie Smaragd. Die Luft? Die Luft ist wie im Himmel. Den Tag über scheint die Sonne, es ist also warm; jedermann trägt Sommerkleidung. In der Nacht hört man zu jeder Stunde und überall Lieder zur Guitarre. Riesige Balkone unter Rebendächern, maurische Wälle ... die Stadt blickt gen Afrika, wie alles hier ... Kurz – ein entzückendes Dasein ...«
Die ersten Eindrücke waren also angenehmster Art. Freilich machten sich bald Unannehmlichkeiten in Fülle bemerkbar. Ein Hotel war in Palma nicht vorhanden, wie George Sand erzählt. Die Reisenden mussten mit zwei kleinen Zimmern ohne jeglichen Komfort vorlieb nehmen. Die Kost war von spartanischer Einfachheit, Schmutz und Ungeziefer dagegen in Fülle vorhanden. In der Umgegend fand man endlich eine bewohnbare Villa, möblirt, mit Garten und schöner Aussicht für 50 Fr. den Monat. War auch die ganze Einrichtung recht primitiv, so waren die Reisenden dennoch froh, untergebracht zu sein. Die Villa, von ihnen Son-Vent, Sohn des Windes, getauft, lag herrlich am Fusse eines Berges, mit Ausblick auf das Gebirge, die See und die Stadt Palma. So vergingen die ersten Wochen zur allgemeinen Zufriedenheit. Bald jedoch setzte die Regenzeit ein. Das leicht gebaute Haus bot nicht genügenden Schutz gegen Nässe und Wind. Der Kalk fiel von den Wänden. Im Hause wurde es kalt und unbehaglich, draussen strömte der Regen unaufhörlich. Chopin begann zu husten. Die Nachbarn hielten ihn für schwindsüchtig und in übertriebener, beinahe abergläubischer Furcht mieden sie Chopin und seinen Kreis. Es war schwer, einen Arzt zu erlangen, die Heilmittel aus der Apotheke waren verdorben. Der Wirt kündigte seinen Mietern schliesslich unter dem Vorwande, dass Chopin das Haus verseuche. Unverzüglich mussten sie ausziehen. In der Stadt ein Unterkommen zu finden, war unmöglich. Durch günstigen Zufall fanden sie endlich Aufnahme in einem alten unbewohnten Karthäuser-Kloster zu Valdemosa. Ein dort weilender Spanier, der sich aus politischen Ursachen verbergen musste und zu eiliger Abreise genötigt war, trat ihnen mit Freuden sein Asyl ab. Für 1000 Fr. erhielten sie seine leidlich eingerichtete Wohnstätte im Kloster. Vor ihrem Auszug aus Son-Vent mussten sie auf ihre Kosten das ganze Haus aufputzen lassen, was der Wirt verlangte, indem er behauptete, es sei von Chopin infiziert.
»In einigen Tagen werde ich im schönsten Teil der Welt wohnen,« schreibt Chopin am 3. Dezember an Fontana, »die See, Berge ... alles was man sich wünschen mag. Wir haben unser Quartier in einem grossen, alten verfallenen Kloster der Karthäuser. ... Nahe Palma ... etwas wundervolleres gibt es nicht: Klostergänge, höchst poetische Friedhöfe. Kurz, ich fühle, dass es mir hier wieder gut gehen wird.«
Später schreibt Chopin über seine neue Wohnung:
»Zwischen Felsen und der See, in einem grossen, verlassenen Karthäuser Kloster, in einer Zelle, deren Thüren grösser sind, als in Paris die Thore, hause ich – stelle Dir vor mit unfrisiertem Haar, ohne weisse Handschuhe, bleich wie gewöhnlich. Die Zelle hat die Gestalt eines Sarges, ist hoch, alle Bögen sind voll Staub. Vor dem kleinen Fenster Orangenbäume, Palmen und Cypressen. Gegenüber dem Fenster, unter einer maurischen filigree rosette, steht mein Bett. Daneben ein altes viereckiges Ding, wie ein Schreibtisch, kaum brauchbar; darauf ein bleierner Leuchter (grosser Luxusgegenstand) mit einem kleinen Talglicht, Werke von Bach, meine Skizzen, alte Papiere, die nicht von mir sind – das ist mein ganzes Besitztum. Ruhe ... man kann brüllen, ohne dass jemand es hört ..., kurz, ich schreibe Dir von einem seltsamen Platz aus ... Es ist etwas schönes um die erhabene Natur, aber man sollte mit Menschen nichts zu tun haben, auch nicht mit Wegen und Wegweisern. Oft kam ich von Palma hierher gefahren, immer mit demselben Kutscher, doch immer auf einem anderen Wege. Wasserströme machen hier Wege, heftige Regengüsse zerstören sie; heute ist eine Strecke Landes unpassierbar, denn wo früher ein Weg war, ist jetzt gepflügtes Feld; morgen können nur Maulesel passieren, wo man gestern mit dem Wagen fuhr. Und was für Wege gibt es hier! Das ist der Grund, warum man hier keinen einzigen Engländer sieht, nicht einmal einen englischen Konsul.«
Dieser Brief ist merkwürdig wegen des echt Chopinschen Hin- und Herspringens von einer Sache zur andern. Zwischen die zwei oben zitierten Abschnitte schiebt Chopin ein paar ganz gleichgültige persönliche Mitteilungen ein. Unmittelbar auf die Beschreibung der Zustände in Palma folgt ein heftiger Ausfall auf Pariser Bekannte, den Bankier Leo und den Verleger Schlesinger, darauf wieder ein entzückter Ausruf über den wundervollen Mondschein, dann gleichgültige Fragen, darauf:
»Dein Brief war schlecht adressiert. Hier ist die Natur gütig, aber die Leute sind diebisch. Sie sehen niemals Fremde und wissen also nicht, was sie von ihnen verlangen sollen. So würde man Dir z. B. eine Orange hier umsonst geben, für einen Rockknopf aber eine fabelhafte Summe verlangen.«
Einige Angaben über das Leben in Valdemosa sind auch in George Sands Briefen an Mme. Marliani und M. A. Duteil zu finden. Ihr Buch: »Un hiver à Majorque«, enthält prachtvolle Schilderungen der landschaftlichen Schönheiten Palmas und genaue Einzelheiten ihrer Erlebnisse dort. Sehr bald zeigte sich, dass trotz der herrlichen äusseren Umrahmung die ganze Reise »in vieler Hinsicht ein Fiasco war«, wie G. Sand schreibt. Das ungeheuer weitläufige Kloster war ausser von Chopin und seinen Freunden nur von drei Leuten bewohnt. Die Einsamkeit brachte allerlei Unbequemlichkeiten mit sich. Die Vorräte mussten von der Stadt herbeigeschafft werden; die Verbindung war schlecht und unzuverlässig. Viel Abwechslung an Lebensmitteln war nicht zu erlangen; die Führung des Haushalts war schwer, weil brauchbare Bedienung mangelte. G. Sand hatte nach und nach die Zellen so behaglich, als unter den Umständen möglich war, eingerichtet. Sie selbst in ihrer robusten Kraft und Energie befand sich ganz wohl. Schlimmer erging es Chopin. Kräftige Krankenkost, wie er sie brauchte, war nicht zu erlangen. Er war ernstlich krank; die ungesunde Regenzeit, der Mangel an Bequemlichkeit und des ihm gewohnten Lebens im Wohlstand trugen zu seiner Reizbarkeit und Melancholie noch mehr bei. Dazu vermisste er sein Klavier. In den ersten Wochen behalf er sich mit einem elenden Instrument aus der Stadt; endlich nach monatelangen Verzögerungen kam das bei Pleyel in Paris bestellte Instrument an. 300 Fr. mussten für Transport und Zoll bezahlt werden, ca. 600 Fr. waren verlangt worden. Von den Inselbewohnern wurden die Fremdlinge bei jeder Gelegenheit geprellt; sie waren in schlechtem Ruf, da man sie nie in der Kirche sah.
Eine Stelle aus G. Sands »Histoire de ma vie« darf hier nicht übergangen werden. Sie schreibt dort: »Der arme, grosse Künstler war ein abscheulicher Patient. Was ich noch nicht genug befürchtet hatte, traf unglücklicherweise ein. Er war vollständig entmutigt. Die Krankheit ertrug er ohne Tapferkeit, er konnte die Unruhe seiner Fantasie nicht überwinden. Das Kloster war für ihn voll von Schrecken und Phantomen, auch wenn es ihm besser ging. Er sagte es nicht, und ich musste es ahnen. Wenn ich mit meinen Kindern von meinen abendlichen Streifereien in den Ruinen zurückkehrte, so fand ich ihn gegen 10 Uhr Abends wohl vor seinem Klavier sitzend, blass, mit aufgerissenen Augen, die Haare wie gesträubt. Er brauchte mehrere Augenblicke, um uns zu erkennen. Dann mochte er wohl gezwungen auflachen und spielte sublime Sachen, die er eben komponiert hatte, oder besser gesagt, schreckenerregende, herzzerreissende Gedanken, die sich seiner bemächtigt hatten, fast unbewusst in dieser Stunde der Einsamkeit, der Traurigkeit und der Furcht ... Es gibt ein (prélude), das die Seele in grauenhafte Niedergeschlagenheit wirft. Es fiel ihm an einem tristen, regnerischen Abend ein. Wir hatten ihn an jenem Tage ganz wohl verlassen ... Der Regen war gekommen, die Bäche waren ausgetreten. Um drei Meilen zurückzulegen, hatten wir sechs Stunden gebraucht, endlich kamen wir mitten in der Ueberschwemmung an, in dunkler Nacht, ohne Schuhe, von unserem Kutscher verlassen, durch unerhörte Gefahren hindurch. Wir hatten uns beeilt, mit Rücksicht auf die Unruhe unseres Kranken. Sie war wirklich lebhaft gewesen, hatte sich aber in einer Art ruhiger Verzweiflung gelegt, und er spielte sein herrliches prélude unter Tränen. Als er uns eintreten sah, erhob er sich plötzlich mit einem lauten Schrei, und dann sagte er mit verstörter Miene und seltsamem Tonfall: »Ach! Ich wusste wohl, dass Ihr tot seid.« Als er sich erholt hatte und unsern Zustand sah, wurde ihm übel beim Gedanken an die Gefahren, die wir durchgemacht hatten; aber er gestand mir später, dass er, auf uns wartend, dies alles im Traume gesehen hatte, und dass er den Traum von der Wirklichkeit schliesslich nicht mehr unterscheiden konnte; so hatte er sich am Klavier beruhigt und getröstet, überzeugt, dass er selbst tot war. Er sah sich in einem See ertrunken; schwere, eisige Wassertropfen fielen ganz gleichmässig auf seine Brust, und als ich ihn darauf aufmerksam machte, wie die Regentropfen gleichmässig auf das Dach fielen, leugnete er, sie gehört zu haben ...«

Friedrich Chopin. Nach einer Portrait-Skizze von Winterhalter.
Hier ist ein erschütternder Blick in die nervösen Krisen aufgetan, von denen Chopin zuweilen gepackt wurde. Doch gab es auch heitere Tage. Da wurden weite Spaziergänge unternommen, oder Forschungsreisen in den verfallenen Kreuzgängen, Klosterzellen und Kapellen. Mit ihren sonderbaren, halb maurischen Ornamenten und Skulpturen, die zum Teil noch aus dem 15. Jahrhundert stammten, ihren zum Teil kostbaren alten Möbeln, mochten diese Räume nicht wenig anziehend gewesen sein. Dann gab manchmal ein Feiertag Gelegenheit, Volksbelustigungen beizuwohnen. G. Sand erzählt von einer Art Mummenschanz, wo die Bauern und Bäuerinnen als Teufel verkleidet, Lucifer an der Spitze, eines Abends mit grossem Geschrei das Kloster heimsuchten und dort einen Ball veranstalteten. Guitarren, Geigen und Kastagnetten bildeten das Orchester. Der merkwürdig gemessene Tanz, die sonderbare, halb arabische Musik, der Anblick der burlesk verkleideten Tänzer in verfallenen Klosterzellen, dies alles mag der Pariser Gesellschaft von hohem Reiz gewesen sein.
G. Sand war sehr tätig. Täglich unterrichtete sie ihre Kinder, las mit Maurice im Thucydides, brachte Solange die Regeln der Grammatik bei, beschäftigte sich mit Chopin und arbeitete unablässig an ihren eigenen Schriften, oft die halbe Nacht durch. Ihr »Spiridion« entstand damals. Chopin selbst schuf in Majorca nicht viel. Aber was er dort vollendete oder konzipierte, ist seinen allerbesten Leistungen zuzurechnen. Es handelt sich um die Préludes op. 28, die Ballade op. 38, das Scherzo op. 39, die 2 Polonaisen op. 40, und die Mazurka op. 41, No. 2 (E-moll).
Da der Zweck der Reise in der Hauptsache verfehlt war, so beschloss man, möglichst schnell nach Frankreich zurückzukehren. Chopins Zustand war so schlimm, dass es ein Wagnis war, die anstrengende Reise zu unternehmen, das gleichwohl gemacht werden musste, da es ihm in Valdemosa immer schlechter ging und dort keine Aussicht auf Hilfe vorhanden war. Sobald das Wetter günstiger wurde, gegen Ende Februar 1839, brach die Gesellschaft auf. Von Palma aus musste das einzige vorhandene Dampfschiff zur Ueberfahrt benutzt werden. Es hatte eine Ladung von 100 Schweinen, die mit ihrem Quieken und üblen Geruch für Chopin eine schreckliche Nachbarschaft waren. In Barcelona nahm sich der französische Konsul der Reisenden hilfreich an. Nach einem Aufenthalt von einer Woche in Barcelona wurde die Reise nach Marseille fortgesetzt.
In Marseille weilte Chopin mit der Familie Sand von Anfang März bis Anfang Mai. Das Wichtigste für ihn war eine tüchtige ärztliche Behandlung, die er so lange hatte entbehren müssen. Dr. Cauvière behandelte ihn mit gutem Erfolge. Die erhaltenen Briefe von G. Sand und Chopin aus Marseille geben einige Aufklärung über das Leben dort. Chopin schreibt, dass es ihm allmählich besser geht. In der »Krämerstadt« Marseille, wie sich G. Sand ausdrückt, war allerdings von geistigen Genüssen nicht viel die Rede. Chopin tat sich einmal als Musiker hervor, bei einem allerdings traurigen Anlass. Der Tenorist Adolphe Nourrit hatte sich in einem Anfall von Schwermut über seinen sinkenden Ruhm durch einen Sturz aus dem Fenster getötet. Von Neapel aus brachte seine Frau die Leiche nach Paris, und in Marseille wurde für den berühmten Sänger ein Trauergottesdienst abgehalten. Am 25. April 1839 fand die Feier statt, bei der Chopin die Orgel spielte. George Sand schreibt darüber:
»Es war ein schlechtes Instrument, mit schreiendem Ton ... Chopin zog die am wenigsten schrillen Register und spielte ›Die Gestirne‹ (von Schubert), nicht stolz und enthusiastisch, wie Nourrit das Lied zu singen pflegte, sondern einfach und sanft, wie ein leises Echo aus einer fernen Welt. Höchstens 2 oder 3 der Anwesenden empfanden dies tief, und mehrere Augen füllten sich mit Tränen, die anderen waren sehr enttäuscht; man hatte erwartet, dass er mächtigen Spektakel machen würde und wenigstens ein paar Register zerbrechen würde.«
Nach einigen Wochen hatte sich Chopin in Marseille so gut erholt, dass er G. Sand und ihre Kinder auf einem Ausflug nach Genua begleiten konnte. Nach stürmischer Seefahrt langten die Reisenden am 20. Mai wieder in Marseille an und brachen einige Tage später nach Nohant auf.
Die Briefe Chopins aus Marseille an Fontana sind ziemlich zahlreich. Der Hauptinhalt betrifft Verhandlungen mit den Verlegern. Sie zeigen, dass Chopin als Geschäftsmann auf seinen Vorteil sehr ernstlich bedacht war. So erfahren wir z. B., dass die Ballade op. 38 Pleyel für 1000 Fr. angeboten wurde, und dass der Verleger Probst für den Vertrieb desselben Werkes in Deutschland schon vorher ca. 500 Fr. gezahlt hatte. Für die zwei Polonaisen op. 40 verlangte Chopin 1500 Fr. (Verlagsrecht für Frankreich, England und Deutschland). Seine Verleger betrachtet Chopin immer mit Misstrauen, oft nennt er sie geradezu Betrüger. Fontana wird instruiert, die Ballade und die Polonaisen dem Verleger Schlesinger anzubieten, wenn Pleyel die geringsten Schwierigkeiten mache, und auch weniger zu nehmen, wenn Schlesinger den geforderten Preis durchaus nicht zahlen will. Für die Polonaisen möge Fontana 1500 Fr. verlangen, aber sie schliesslich, wenn nötig, auch für 1400, 1300 und sogar 1200 Fr. verkaufen. Fontana soll die Manuskripte nur gegen bare Bezahlung aus Händen geben. Wer von Chopin nichts kennt, als diese Marseiller Briefe, würde in ihm eher einen Handelsmann als einen Künstler vermuten. Lange Seiten sind mit den trockensten geschäftlichen Einzelheiten angefüllt. Die Invektiven gegen die Verleger, besonders die jüdischen Verleger, erinnern an Beethoven, der auch mit seinen Verlegern meistens auf sehr gespanntem Fuss stand. Nur in kurzen Sätzen, mitten im Schwalle der langatmigen geschäftlichen Weisungen erfahren wir einige interessante Details. So wird z. B. über die Dedikationen der neuen Publikationen mehrfach geschrieben. Die Ballade war erst Pleyel gewidmet, dann aber wurde auf Chopins Wunsch der Name Robert Schumanns auf das Titelblatt gesetzt, Pleyel wurden die Préludes gewidmet, J. C. Kessler die deutsche Ausgabe dieses Werkes und Fontana als Dank für seine Mühe die Polonaise op. 40.
* * *
In Betreff der Préludes ist nicht ganz sicher festzustellen, wo die einzelnen Stücke entstanden sind. Nach der Behauptung von Chopins Schüler Guttmann sollen alle Préludes schon vor der Abreise aus Paris fertig gewesen sein. Dem steht entgegen, dass Chopin in seinen Briefen aus Majorca immerwährend von den Préludes spricht, noch am 28. Dezember schreibt, sie seien noch nicht fertig, auch das Zeugnis von George Sand, die in diesem Falle unbedingt glaubwürdig ist, und von Liszt. Man kann also wohl annehmen, dass Chopin einen Teil, vielleicht den grössten Teil der Préludes in Paris geschrieben habe, in Valdemosa eine Anzahl neuer Stücke hinzugefügt und das Ganze sorgfältig durchgearbeitet habe. Einige, die in A-moll und D-moll sind sogar schon 1831 geschrieben worden. Die Préludes verkaufte Chopin noch vor seiner Abreise an Pleyel für 2000 Fr., wovon er 500 Fr. bar erhielt, den Rest erst viel später, nach Ablieferung des Manuskripts.
Die 24 Préludes in allen Dur- und Molltonarten, op. 28, sind den besten Werken Chopins zuzurechnen. Sie nehmen in der Klavierliteratur eine Sonderstellung ein. In der Gattung Praeludium sind sie etwas ganz neues. Man denkt natürlich zuerst an Bachsche Praeludien, die aber ihrem Wesen nach ganz anders sind: meistens grösser angelegte Einleitungsstücke im polyphonen Stil. Nach Bach lag das Praeludium ziemlich lange brach, – was Clementi z. B. in dieser Gattung schrieb, ist kaum ernst zu nehmen. Auch Kessler und Moscheles haben Préludes geschrieben, ob durch Chopin angeregt oder umgekehrt? Die Chopinschen Préludes sind meistens kleine Skizzen; sie sind nicht als Einleitung zu einem bestimmten Stück gedacht, sondern haben jedes für sich Giltigkeit. Am besten spielt man sie hintereinander. Der Komponist selbst hat ihnen weislich eine solche Reihenfolge gegeben, dass ein jedes an seinem Platz vorzüglich zur Geltung kommt. An Mannigfaltigkeit der Stimmungen, an Präzision des Ausdrucks, an Schärfe der Zeichnung bieten sie erstaunliches. Aber auch an musikalischem Reichtum, an Neuheit der Harmonik und Klangzauber geben sie Zeugnis von einer schöpferischen Phantasie, einem Wissen um die Möglichkeiten des Klaviers, die in ihrer Art ganz einzig sind. Die feinsten Feinheiten des Klaviersatzes sind in ihnen offenbart.
No. 1 (C-dur). Eine Arabeske von feinster Linienführung. Kräftig und doch weich steigt die Figur zum Höhepunkte an, gleitet dann immer sanfter herab und läuft ganz zart aus.

No. 2 (A-moll). 1831. In Stuttgart geschrieben. Zusammen mit den Tagebuchblättern, der C-moll-Etüde (op. 10, No. 12) und dem D-moll-Prélude lässt dieses Stück einen Blick tun in Chopins seelischen Zustand, zur Zeit, als er die Kunde von der Niederlage der Seinigen erhielt. In jenen Stücken ein leidenschaftliches Aufwallen, ein trotziges Auflehnen, eine ekstatische Erregung – hier die Reaktion: matt, kraft- und mutlos schleicht es dahin. Von unheimlich düsterer Färbung. Die gewundene chromatische Figur in der Mittelstimme ist Chopin eigentümlich (vgl. Etüde op. 10, No. 6). Die Melodie der Oberstimme über dem schwankenden Bass, viermal auf verschiedenen Tonstufen anhebend, wirkt wie ein Ruf, eine Zauberformel, beklemmend, atemraubend. Ein bedeutsames Motiv Wagners ist hier vorgeahnt.

Die Harmonie ist seltsamster Art, zwischen vielen Tonarten irrend, ohne irgend eine fest auszuprägen. Ein kleines Stück von zwingender Ausdruckskraft.
No. 3 (G-dur). Ein lustig über Kiesel rauschendes Bächlein; am Ufer lässt der Hirt seine Schalmei erklingen; hell und freudig.
No. 4 (E-moll). Eine weite Geigenmelodie; sehnsüchtig, voll verhaltener Glut, über chromatisch absteigenden Tristanakkorden. Wie ein Prolog zu einer Tragödie.

Facsimile von Chopin's Prélude op. 28 No. 4.
No. 5 (D-dur). Etüdenartig. Geschmeidiges Gleiten beider Hände. Wohlig wie der Fisch im klaren Wasser.
No. 6 (H-moll). Der Cis-moll-Etüde aus op. 25 verwandt. Ein breiter Cellogesang, dazu in der Oberstimme ein eintöniges Wiederholen des nämlichen Tones. Oft als das sogenannte »Regentropfen«-Präludium bezeichnet. Was G. Sand in ihrer Histoire de ma vie erzählt, wird oft auf dieses Stück bezogen, kann aber auch auf No. 15 bezogen werden, vielleicht mit mehr Recht.
No. 7 (A-dur). Hold und lieblich. Flöten und Klarinetten. Wie ein Reigentanz junger Mädchen. Voran die Schönste der Schönen in entzückender Grazie.
No. 8 (Fis-moll). Kraus und wirr. Ein schäumendes Gewoge; stellenweise schwillt es zum Donner an, dann wieder sinkt es zum Murmeln herab. Chopin soll das Stück während eines fürchterlichen Unwetters in Majorka skizziert haben (s. Liszt p. 273).
No. 9 (E-dur). Schwer lastend, tragisch. Merkwürdigerweise in E-dur, einer der hellsten Tonarten. Allerdings kommt der E-dur-Akkord unter 48 verschiedenen Akkorden nur 4mal vor. In der Mitte prächtige Akkordfolgen über dem stufenweise abwärtssteigenden Bass; mit markiger Kraft tritt das As-dur beim ff ein.
No. 10 (Cis-moll). Ein kleines Capriccio von ausserordentlicher Eleganz der Linie, dabei in der Haltung nobel; trotz des Cis-moll ziemlich hell.
No. 11 (H-dur). Ueberaus anmutiges Spiel. Ganz hell und heiter. Ein zierliches Wiegen und Drehen.
No. 12 (Gis-moll). Etüdenartig. Leidenschaftlich vorwärtsdrängend. Aparte Wirkung machen die eigenartigen harmonischen Sequenzen (Takt 21 ff.), dreimalige Wiederholung der gleichen 3taktigen Phrase, jedesmal einen Ton tiefer, auf H, A, G.
No. 13. (Fis-dur). Nocturnenartig. Besonders schön der zweite Teil in Dis-moll. Die teilweise Wiederholung des ersten Teils am Schluss erhält gesteigerten Ausdruck und ungemein schöne Klangwirkung durch Hinzufügen einer neuen Oberstimme über der Melodie, etwa wie man im Orchester manchmal durch eine hohe Flöte über die Melodie sanften Glanz breitet. Sechs Takte vor dem Schluss ein Chopin eigentümlicher Wechselnoteneffekt:

No. 14. (Es-moll). Dem Finale der B-moll-Sonate verwandt. Ein Murmeln und Brausen.
No. 15. (Des-dur). Nach der üblichen Annahme das bekannte Regentropfen-Präludium. Den grössten Teil des Stückes hindurch klingt der immer wiederholte Ton gis oder as in Mittel- oder Oberstimme, wie das eintönige Fallen der Regentropfen. Der erste Teil in Des-dur entzückend ruhig wie ein leuchtender Wasserspiegel. Der zweite in Cis-moll eine Vision von düsterer, beklemmender Phantastik. Wie eine Schar von Trauernden zieht es dahin. Mächtig schwillt der Chor an, nimmt wieder ab; dumpfe Klagetöne erklingen, von einer erschreckenden Monotonie durch das immer wiederholte gis. Da endlich naht die Erlösung; wieder erscheint die holde Anfangsmelodie; aber wie anders wirkt sie jetzt – ein Erwachen aus fürchterlichem Traum, noch wirken die Schauer nach (das immer wiederholte as).
No. 16. (B-moll). Im Bass eine Art Barcarolen-Rythmus. Aber keine idyllische Szene entwickelt sich. Hier schwankt das Schifflein auf brandenden Meereswogen, drüber hinweg weht ein gieriger Sturmwind.
No. 17. (As-dur). Romanzenartig. Die Rückleitungen des Themas durch starke, überraschende Ausweichungen sehr wirksam gemacht. Vor dem Schluss ein langer Orgelpunkt. Das tiefe As wie Glockentöne. Vor dem Ende 4 Takte oben und unten gebundene Töne, dazu stellenweise dissonierende Mittelstimmen von grossem Reiz.
No. 18. (F-moll). Ein tobendes Unwetter, zuckende Blitze, krachender Donner. Mit grösster Vehemenz durchgeführt.
No. 19. (Es-dur). Rauschend und rieselnd. Chopinsche Sprungtechnik. Liszt (p. 238,37) zitiert darüber aus einer Abhandlung des Grafen Zaluski (erschienen in der Wiener Zeitschrift »Die Dioskuren«, II. Band) Zaluski weiter über die Préludes: »Anderswo rollen Orgeltöne im weiten Domesraum, oder es erzittern im fahlen Mondlichte Friedhofsklagetöne, während Irrlichter geisterhaft vorbei huschen. Dort wandelt der Sänger am Meeresufer und der Athemzug des bewegten Elementes umweht ihn, mit unbekannten Stimmungen aus fernen Welten.«: »Wer denkt da nicht gleich an das Prélude in Es-dur, das an einem stürmischen Tage auf den Balearen entstand. Gleichmässig und immer wiederkehrend fallen bei Sonnenschein Regentropfen herab; dann verfinstert sich der Himmel und ein Gewitter durchbraust die Natur. Nun ist es vorübergezogen und wieder lacht die Sonne; doch die Regentropfen fallen noch immer!«
No. 20. (C-moll). ff setzt es wie mit schmetterndem Blech ein, abschnittweise wird es immer leiser, bis es in der Ferne verhallt. Ein Trauermarschmotiv von ergreifender Gewalt des Ausdrucks.
No. 21. (B-dur). Nocturnenartig, weich. Mittelsatz in Ges-dur, orgelpunktartig, immer auf Ges. Ein Abendlied am mondüberstrahlten Gestade, ruhig flutendes Wasser hört man in der stetig bewegten Begleitfigur.
No. 22. (G-moll). Ein leidenschaftlich tobendes Nachtstück. Wie ein Nachtlied der brandenden Meereswogen an felsiger Küste.
No. 23. (F-dur). Ein entzückendes Idyll. Rauschen der Bäume. Auf schwankenden Zweigen schaukeln sich die Vöglein, hell und freudig klingt ihr Ruf.
No. 24. (D-moll). Sehr pathetisch. Von packender Ausdrucksgewalt. Erregte, weitgriffige Begleitfigur. In der rechten Hand eine breite pathetische Melodie; erinnert thematisch an den Anfang der Beethovenschen Sonata appassionata. Mixolydische Harmonie des Themas. Mächtiger Klang, wenn im 2. Teil das Thema in Oktaven wuchtig einherschreitet, in glänzenden schnellen Läufen sich hoch hinaufschwingt oder in die Tiefe hinabstürzt. Sehr wirksam ist 6 Takte vor dem Schluss der Uebergang von Cis-moll nach D-dur und zurück nach cis. Verwendung des sogenannten neapolitanischen Sextakkordes in der Schlusskadenz. Die merkwürdige Schlusskadenz verdient besondere Erwähnung:

Zum Schluss drei Contra D fff, sie werden als drei dumpfe Kanonenschüsse interpretiert. Die ungeheure Erregung in der sich Chopin befand, als ihn die Nachricht vom Fall Warschaus in Stuttgart erreicht, machte sich in diesem Stück und der C-moll-Etüde Luft (vgl. S. 49). {Hoesick weist auf die merkwürdige Parallele hin, die zwischen diesem Stück und gewissen Stücken aus Mickiewicz' Dziady existiert, die unter ähnlichen Umständen um die gleiche Zeit geschrieben wurden}. Huneker, in seinem Buche: Chopin the man and his music, London, William Reeves 1901, schreibt über das D-moll-Prélude: »Es ist lauttönend, tragisch, durchzogen von fieberhaften Visionen, kapriciös, unregelmässig, massiv in der Anlage. Gleich dem ungeheuren Anprall von riesigen Meereswogen an der unwirtlichen Küste einer fernen Welt ist dies Prélude. Trotz seines fatalistischen Grundklanges ist die Note der Verzweiflung darin nicht niederdrückend. Sein Ausdrucksgehalt ist grösser, unpersönlicher, von elementarerer Gewalt als der der übrigen Préludes. Es ist eine wahrhafte Appassionata, aber ihr Schauplatz liegt auf dem Welttheater, nicht mehr hinter den geschlossenen Türen von Chopins Seelenkämmerlein. Der ›Seelenschrei‹ des Stanislaus Przybyszewski ist hier zu finden, Ausbrüche von Wut und Empörung; nicht Chopin leidet, sondern seine Landsleute.«
Für sich selbst steht das Cis-moll Prélude op. 45. Es ist noch mehr als die Stücke des op. 28 in der Art einer Improvisation. Die Haupttonart Cis-moll wird nur zu Anfang und gegen den Schluss gehört. Das Stück ist voll der apartesten Modulationen, und hat ein Ansehen, als wäre es in unseren Tagen entstanden. Dabei aber immer Wohllaut und Kunst in der Harmonienverknüpfung. Ganz besonders klangvoll die Kadenz am Ende, eine Sequenz, dadurch merkwürdig, dass jeder Ton der ziemlich schnellen Passage harmonisiert ist, ein Glitzern und Funkeln, wie Lichter auf geschliffenem Glas spielend. Zum Schluss eine Kette von verminderten Septimenakkorden. Mit dem Schluss der Kadenz vergleiche man Cramers Etüde No. 60 (in Bülows Ausgabe), um zu sehen, wie reich Chopin eine ältere Idee ausgestaltet.
* * *
Den Sommer 1839 verbrachte Chopin zu Nohant im Hause der George Sand. In ihrer »Historie de ma vie« lässt sie sich über die Ereignisse dieser Zeit aus und rechtfertigt ihre Motive für das Zusammenleben mit Chopin. Ihr sehr schön gefärbter Bericht ist freilich mit grosser Vorsicht aufzunehmen. Als eine Art von barmherziger Schwester möchte sie gelten, die das kranke Kind (ihren Sohn Maurice) und den kranken Freund mit Aufopferung pflegt.
»Ich war nicht von Leidenschaft verblendet. Ich hegte für den Künstler eine Art mütterlicher Zuneigung, die sehr warm, sehr real war, aber doch nie mit der Mutterliebe in Konflikt kommen konnte, dem einzigen Gefühl, das gleichzeitig keusch und leidenschaftlich ist. Ich war noch jung genug, um vielleicht gegen die Liebe ankämpfen zu müssen, gegen die Leidenschaft im eigentlichen Sinne. ... Nach genauer Ueberlegung verschwand jedoch diese Gefahr für mich und erhielt sogar ein ganz anderes Aussehen, das eines Präservativs gegen Erregungen, die ich nicht mehr kennen wollte. Eine Pflicht mehr in meinem Leben, das schon so übervoll
von ›fatigue‹ war, schien mir eine ›chance‹ mehr für Erlangung jener ›austérité‹, zu der ich mich in einer Art von religiösem Enthusiasmus hingezogen fühlte.«
Aus Nohant sind eine Reihe Briefe Chopin's an Fontana erhalten. Auch in diesen Briefen spielen die geschäftlichen Angelegenheiten mit den Verlegern eine grosse Rolle. Doch sind sie nicht ausschliesslich mit diesen Dingen angefüllt, wie die Briefe aus Majorka. Fontana wird beauftragt, für Chopin eine Wohnung zu mieten und einzurichten. Bezeichnend für Chopin ist die peinliche Sorgfalt, mit der er jedes Detail der Ausstattung vorschreibt, wie z.B.:
»Suche Tapeten aus, wie ich sie früher hatte, tourterelle (taubengrau) aber hell und glänzend, ... auch dunkelgrün mit nicht zu breiten Streifen. Für das Vorzimmer etwas anderes, aber doch respectable ... Ich ziehe die einfachen, unauffälligen, reinen Farben den aufdringlichen Farben der gewöhnlichen Art vor. Darum gefällt mir perlfarben, denn es ist weder laut, noch sieht es ordinär aus. ...«
Mit ebenso grosser Sorge ist er auf seine Toilette bedacht:
»Kaufe mir einen neuen Hut bei Duport, Chaussée d'Antin. Er hat mein Mass und weiss, wie leicht und von welcher Art der Hut sein muss. Nimm ein diesjähriges Façon, aber nichts übertrieben modernes ... Gehe auch zu meinem Schneider Dautremont auf dem Boulevard und bestelle für mich ein paar graue Beinkleider. Wähle selbst dunkelgrauen Stoff aus, passend für den Winter; etwas feines, nicht gestreift, sondern einfach und elastisch (weich). Du bist ein Engländer, also weisst Du, was ich brauche ..., auch eine ruhige schwarze Sammet-Weste, aber sehr wenig gemustert, kein ›lautes‹ Muster, etwas sehr ruhiges und elegantes. Sitze dem Schneider auf dem Halse, damit die Sachen Freitag morgen fertig sind, so dass ich sie bald nach meiner Ankunft anziehen kann.«
Ein langer Brief ist damit angefüllt, dem Freunde Vorschriften über die Beschaffenheit einer Wohnung für George Sand in Paris zu machen, die Fontana mieten soll. Ausdrücklich bemerkt Chopin, der Freund möge sich der Sache sehr sorgsam annehmen: »ich sage, er möge sich meiner Angelegenheit annehmen, denn sie ist so gut wie meine eigene Sache.« Sogar den Plan der Wohnung, wie er sie für George Sand wünscht, zeichnet Chopin. »Um Gottes Willen bitte ich dich, lieber Freund, interessiere Dich für diese Angelegenheit aufs regste.« Das klingt leidenschaftlicher, als G. Sands Versicherung der mütterlichen Zuneigung. Was Chopins künstlerische Tätigkeit betrifft, so erfahren wir aus den Briefen, dass er in Nohant (Sommer 1839) an der B-moll-Sonate arbeitete, eine Nocturne in G-dur (op. 37) und drei neue Mazurkas (op. 41, die vierte stammt aus Palma) geschrieben habe: »Sie scheinen mir hübsch zu sein, wie Eltern ja immer die jüngsten Kinder hübsch finden, wenn sie selbst alt werden.« Ferner heisst es: »Im übrigen tue ich gar nichts; für meinen Gebrauch korrigiere ich die Pariser Ausgabe von Bach; nicht nur die Fehler des Stechers, sondern auch die harmonischen Schnitzer derer, die vorgeben Bach zu kennen.« Moscheles sollte um diese Zeit nach Paris kommen. Chopin empfiehlt: »ihm eine Einspritzung zu verabreichen, bestehend aus Neukomms Oratorien, angerichtet mit Berlioz's Cellini und Doehlers Konzert.« Dass Chopin in spöttischem Ton von Neukomm und Doehler redet, ist nicht zu verwundern; dass er aber Berlioz's Cellini in so schlechte Gesellschaft stellt, ist nur aus seiner Antipathie gegen Berlioz's Musik überhaupt zu erklären. Seine polnischen Landsleute, denen er immer bereitwillig und freigebig Hilfe leistete, kosteten ihm viel Geld. Darauf beziehen sich die folgenden Sätze: »Es trifft sich gut, dass Dziewanowski heiratet; nach der Hochzeit wird er mir die 80 Fr. sicherlich zurückzahlen. Auch Podczaski möchte ich verheiratet sehen und Nakwaska und auch Anton (Wodzinski).« Die ganze Korrespondenz mit Fontana ist bezeichnend für die Art, wie Chopin seine Freunde in Anspruch nahm und wie diese ihm ergeben waren. Beim Lesen dieser Briefe möchte man fast glauben, dass Fontana weiter nichts zu tun hatte, als sich um Chopins Angelegenheiten zu bekümmern, so zahlreich und mannigfaltig sind Chopins Aufträge. Als Zeichen des Dankes ist die Dedikation der Polonaisen op. 40 an Fontana anzusehen. Die eine davon scheint Fontana nicht ganz befriedigt zu haben. Darauf bezieht sich das Folgende: »Lass auch den Hut von Duport bringen; dafür werde ich den zweiten Teil der Polonaise für Dich umändern bis zur letzten Stunde meines Lebens.« Vielleicht liegt hier auch ein wenig Selbstironie. Chopin konnte sich im Feilen und Umarbeiten seiner Kompositionen niemals genug tun. Auf ein nicht näher bezeichnetes Impromptu kommt er im letzten Brief zu sprechen:
»... Ein Impromptu, das vielleicht ohne Wert ist – ich weiss es selbst noch nicht, das Stück ist zu neu. Doch hätte es nichts geschadet, wenn es weniger im Stil der Orlowski, Zimmermann oder Karso-Konski (Kontski) oder Sowinski oder ähnlicher Tiere wäre, denn nach meiner Schätzung müsste es mir ungefähr 800 Fr. einbringen.«
Wahrscheinlich ist damit das erst nach Chopins Tode veröffentlichte Fantasie-Impromptu (op. 66) gemeint. Aus dem angegebenen Grunde hat Chopin selbst es wohl nicht drucken lassen. Wenn diese Annahme richtig ist, dann ist damit auch Niecks irrtümliche Angabe richtig gestellt, das Stück sei 1834 komponiert. Es würde dann in das Jahr 1839 zu verlegen sein. Ein anderer Irrtum Niecks lässt sich aus einem späteren Briefe Chopins (neue Briefsammlung vom 1. Oktober 1845) berichtigen. In dem ersten Briefe aus Nohant vom Jahre 1832 (Niecks II, 63) schreibt Chopin: »Mein Vater teilt mir mit, dass meine alte Sonate von Haslinger veröffentlicht worden ist, und dass die Deutschen sie loben.« Damit ist die Sonate op. 4 gemeint, die Chopin von Warschau aus an Haslinger sandte, die aber nicht gedruckt wurde und in Haslingers Besitz als Manuskript verblieb. Niecks bemerkt hierzu, dass hier offenbar ein Missverständniss vorliege, da die Sonate erst im Jahre 1851 veröffentlicht wurde. Es liegt jedoch kein Missverständnis vor. Chopin gibt in dem Brief vom Jahre 1845 die Erklärung:
»Die Elsner gewidmete Sonate ist bei Haslinger in Wien erschienen. Wenigstens hat er mir selbst vor einigen Jahren die Korrekturbogen gesandt ... ich habe ihm mitgeteilt ..., dass ich vieles in der Sonate abändern wollte, und daraufhin hat er wohl den Druck inhibiert, was mir sehr angenehm wäre, denn für eine Musik dieser Art ist es jetzt zu spät; vor 14 Jahren konnte ich so etwas schreiben.«
Chopin scheint auf dies schwache Jugendwerk so wenig geachtet haben, dass er nicht genau anzugeben wusste, ob es tatsächlich erschienen war oder nicht. Warum die Sonate erst 1851 als posthumes Werk erschien, ist aus Chopins Erklärung ersichtlich.
Gegen Ende Oktober 1839 traf Chopin mit George Sand wieder in Paris ein. Er bezog die von Fontana eingerichtete Wohnung, Rue Tronchet No. 5, sogleich, George Sand die ihrige, Rue Pigalle 15, erst erheblich später, da das Instandsetzen viel Zeit in Anspruch nahm. Erwähnenswert ist aus den ersten Wochen seines Pariser Aufenthaltes eine Zusammenkunft mit Moscheles. In seinem Tagebuch hat Moscheles Nachrichten über seinen Verkehr mit Chopin niedergelegt. Er traf Chopin zum ersten Male bei dem Bankier Leo, auf den Chopin in seinen Briefen oft heftig schimpft, dessen Gastfreundschaft und hilfreiche Hand er aber durchaus nicht verschmäht. Kurz darauf stattete Moscheles Chopin seinen Besuch ab. Chopin spielte ihm seine B-moll-Sonate vor und liess durch seinen Schüler Guttman sein Cis-moll-Scherzo vortragen.
Auf Veranlassung des Comte de Perthuis, Adjutanten von Louis Philippe, wurden Chopin und Moscheles nach St. Cloud eingeladen; sie spielten dort vor der königlichen Familie. Moscheles schreibt darüber:
»Es ging durch viele Prunkgemächer in einen Salon quarré, wo die königliche Familie en petit comité versammelt war. An einem runden Tisch sass die Königin mit einem eleganten Arbeitskorb vor sich (etwa um mir eine Börse zu sticken?), neben ihr Madame Adélaide, die Herzogin von Orleans und Hofdamen ... Chopin spielte zuerst eine Zusammenstellung von Nocturnos und Etüden und wurde wie ein Liebling bewundert und gehätschelt. Nachdem auch ich alte und neue Etüden gespielt und mit demselben Beifall, setzten wir uns zusammen ans Instrument – er wieder unten, worauf er immer besteht. Die gespannte Aufmerksamkeit des kleinen Kreises bei meiner Es-dur-Sonate ward nur durch die Ausrufe ›divin, délicieux‹ unterbrochen. Nach dem andante flüsterte die Königin einer Hofdame zu: ›Ne serait-il pas indiscret de le leur redemander?‹ was natürlich einem Wiederholungsbefehl gleichkam, und so spielten wir es noch einmal mit gesteigertem abandon. Im Finale überliessen wir uns einem musikalischen Delirium.«

J. Moscheles Stich im Besitz der Musikhistorischen Sammlung des Herrn Fr. Nic. Manskopf in Frankfurt a. M.
Später improvisierten die beiden Künstler, Chopin über Grisars Romanze La Folle, damals eins der beliebtesten Salonstücke, Moscheles über Themen von Mozart (s. Neue Zeitschr. f. Mus., 12. Nov. 1839). Der König sandte den Künstlern nach dem Konzert Geschenke, für Chopin eine goldene Tasse und Untertasse, für Mocheles ein Reiseetui. Chopin liess sich die Gelegenheit nicht entgehen, auf Kosten Moscheles' ein gewürztes Bon-mot zu prägen – kleine Bosheiten dieser Art machten ihm oft besonderes Vergnügen. »Der König schenkte Moscheles ein Reiseetui, um ihn desto früher los zu werden«, soll er gesagt haben. Ob wahr oder erdichtet, der Ausspruch ist für Chopins spitze Zunge bezeichnend. Seine Spottlust machte auch vor durchaus achtenswerten Persönlichkeiten, ja vertrauten Freunden, kein Halt. Auch Moscheles berichtet von Chopins überaus komischen Nachahmungen von »Liszt, Pixis und einem buckligen Klavierliebhaber« und spricht von seinem lebhaften Wesen, seiner Heiterkeit.
Nicht lange dauerte es, bis Chopin seine Wohnung, Rue Tronchet, aufgab und ganz zu George Sand übersiedelte. In ihrer »Histoire de ma vie« gibt G. Sand eine Erklärung dieser neuen Vereinigung. Reines Mitleid mit Chopins schlechtem Gesundheitszustand, der Wunsch, ihn pflegen zu können und ihm die Annehmlichkeiten einer geordneten Häuslichkeit zu verschaffen, waren nach G. Sand ihre einzigen Motive. {In der} Rue Pigalle wohnte Chopin ununterbrochen bis zum Sommer 1841. Entgegen ihrer Gewohnheit ging G. Sand im Sommer 1840 nicht nach Nohant. Ueber Chopins Erlebnisse während des Jahres 1840 sind wenig Nachrichten vorhanden. Er nahm seine frühere Tätigkeit wieder auf, unterrichtete, komponierte, ging viel in Gesellschaften. G. Sands Wohnung war ein Stelldichein der geistigen Elite. Balzac, Eugène Delacroix (Lehrer von G. Sands Sohn Maurice), der Abbé de Lamennais, der Philosoph Pierre Leroux, verkehrten dort, wie aus G. Sands Korrespondenz ersichtlich ist, aber auch Saint-Beuve, Heine, Liszt, Lamartine und viele andere gehörten zu ihrem engeren Bekanntenkreise. Mit allen diesen Männern kam auch Chopin zweifellos häufig in Berührung. Der Anfang des Jahres 1840 brachte wohl ungewöhnliche Erregung. Die erste Aufführung von G. Sands Drama »Cosima« im Théâtre français stand bevor. Darüber möge man Heines Bericht nachlesen (sämtliche Werke, Bd. 11, S. 282 ff.). Die Proben, die Anstrengungen, die G. Sand machte, um die Schauspielerin Dorval in das Théâtre français zu bringen, der schliessliche totale Misserfolg mögen auch Chopin nicht wenig Aufregung verursacht haben.
Chopins Schülerin Frau Streicher (damals Frl. Friederike Müller) hat Erinnerungen an ihre Studienzeit bei Chopin hinterlassen, die sich gerade auf die Jahre 1839-41 beziehen. Hier ins Deutsche übersetzt aus dem englischen Text, den Niecks, Anhang III, mitteilt. Wo diese Erinnerungen ursprünglich erschienen sind, ist mir unbekannt. Sie erzählt, dass Chopin trotz seines leidenden Zustandes seine Pflichten als Lehrer mit peinlicher Gewissenhaftigkeit erfüllte.
»Manch einen Sonntag begann ich bei Chopin um 1 Uhr zu spielen, und erst um 4 oder 5 Uhr wurden wir fertig. Dann spielte er auch, und wie herrlich! nicht nur seine eigenen Kompositionen, sondern auch die anderer Meister, um dem Schüler zu zeigen, wie sie gespielt werden müssten. Eines Morgens spielte er 14 Präludien und Fugen von Bach auswendig, und als ich meine freudige Bewunderung aussprach, entgegnete er: ›Cela ne s'oublie jamais‹ und traurig lächelnd fuhr er fort: ›Depuis un an je n'ai pas étudiße un quart d'heurc de suite, je n'ai pas de force, pas d'énergic, j'attends toujours un peu de santé pour reprendre tout cela, mais ... j'attends encore.‹ ... Oft hörte ich ihn in wunderbar schöner Weise präludieren. Einmal, als er völlig in sein Spiel versunken war, vollkommen der Welt entrückt, trat sein Diener leise ein und legte einen Brief auf das Notenpult. Mit einem Aufschrei hörte Chopin auf zu spielen, seine Haare sträubten sich – was ich bis dahin für unmöglich gehalten hatte, sah ich nun mit eigenen Augen.«
Trotzdem Friederike Müller oft in Chopins »Pavillon« Rue Pigalle, einem Teil von G. Sands Wohnung, gewesen sein muss, hatte sie doch keinerlei Berührung mit ihr:
»Ich sah Mme. Sand im Jahre 1841 und später 1845 im Theater in einer Loge und hatte Gelegenheit, ihre Schönheit zu bewundern. Ich habe niemals zu ihr gesprochen«
ist alles, was sie über George Sand berichtet. Möglich, sogar wahrscheinlich ist es, dass Chopin das junge Mädchen aus feinem Taktgefühl absichtlich von George Sand fernhielt. Merkwürdig ist es jedenfalls, dass diese bevorzugte Schülerin Chopins 1 1/2 Jahre lang im Hause der Sand aus und ein ging, ohne diese jemals gesehen zu haben.
Ueber Chopins Lehrweise sind wir durch zahlreiche, verstreute Mitteilungen seiner Schüler einigermassen unterrichtet.
[Endnote. Aus technischen Gründen an der Verweisstelle eingepflegt.Re] Von Beginn des Pariser Aufenthalts an bis kurz vor seinem Tode war Chopin fast unausgesetzt als Lehrer tätig. Verwunderlich mag es erscheinen, dass er keinen einzigen Schüler heranbildete, der auch nur entfernt einen Vergleich mit ihm selbst als Pianist aushalten konnte. Zu erklären ist dies teilweise dadurch, dass Chopin besonders von den Damen der vornehmsten Pariser Gesellschaft überlaufen wurde und dass er verhältnismässig wenige Berufsspieler unterrichtete; diese waren zum grössten Teil nicht hervorragend begabt. Er hatte einen Schüler von phänomenalen Fähigkeiten, den »kleinen Filtsch«, auf den er die allergrössten Hoffnungen setzte. Wie Lenz berichtet (»Die grossen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit«), sagte Liszt einst über Filtsch zur Comtesse d'Agoult: »Quand le petit voyagera, je fermerai boutique.« Filtsch, ein Ungar aus Hermannstadt, starb jedoch schon im Jahre 1845 in Venedig ganz jung, kaum älter als 15 Jahre. In London und Wien hatte der Knabe durch sein Spiel schon Aufsehen erregt. Ein anderer der begabtesten Schüler Chopins, Paul Gunsberg, starb gleichfalls in jungen Jahren, ebenso die vielversprechende Karoline Hartmann aus Münster bei Kolmar. Chopins Lieblingsschüler war Adolf Guttmann aus Heidelberg. Guttmann war 15 Jahre alt, als ihn sein Vater im Jahre 1834 zu Chopin brachte. Er blieb bis zu Chopins Tod in engstem Verkehr mit seinem Meister. Guttman gab später die Virtuosen-Karriere auf, unterrichtete viel, zog sich als wohlhabender Mann nach Florenz zurück und verbrachte viel Zeit mit einer von ihm erfundenen Methode, mit Oelfarben auf Atlas zu malen. Er starb im Jahre 1882 in Spezia. Andere Schüler Chopins waren die Engländer Brinley Richards und Lindsay Sloper, der Norweger Tellefsen (1823-74), Karl Mikuli aus Czernowitz, später Herausgeber von Chopins Werken, Georg Matthias, später Lehrer am Pariser Konservatorium, Lysberg (eigentlich Samuel Bovy) aus Genf u. a. Unter den Damen, deren Beruf das Klavierspiel wurde, schätzte Chopin am höchsten Frl. Friederike Müller, später Frau des Wiener Pianofortefabrikanten Streicher (sie hat interessante Erinnerungen an Chopin hinterlassen; ihr ist das Konzertstück op. 46 gewidmet, dessen Manuskript Chopin ihr schenkte); ferner Mlle. O'Meara, von irischer Abkunft (ihr Vater war Arzt von Napoleon I. in St. Helena), später als Mme. Dubois eine der geschätztesten Klavierlehrerinnen in Paris; Mme. Rubio, née Vera de Kologrivof, in späteren Jahren Hilfslehrerin bei Chopin. Von den vornehmen Dilettantinnen nahm vielleicht den höchsten Rang als Künstlerin ein die Fürstin Marcelline Czartoryska. Liszt schreibt von ihr (Brief vom 23. Mai 1863): »Du findest in der Fürstin C. eine seltene Verstandesbildung ... einen lieblich eifernden Mozart-, Beethoven- und Chopin-Kultus ... eine ernstlich liebenswürdige, geistig wie musikalisch vielfach bevorzugte Frau ... Sie spielt das kleine Stück (Liszt's Berceuse) entzückend.« Andere waren: Frau Peruzzi, Tochter des russischen Generalkonsuls in den Vereinigten Staaten, Gemahlin des toskanischen Gesandten in Paris. (Zu ihrer Hochzeit schrieb Chopin für sie einen Walzer (aus op. 70?). Sie und ihr Gatte brachten Paganini zu Chopin. (Niecks II, 194.) Die Fürstin Chimay, die Gräfinnen Esterhazy, Potocka, Branicka und viele andere wären noch zu nennen.

Carl Filtsch
Fragmente zu einer »Méthode des Méthodes«, für die auch »les trois nouvelles Etudes« geschrieben sind, wurden im Manuskript von Chopins Schwester nach Chopins Tode der Fürstin M. Czartoryska übergeben, beide Manuskripte jetzt im Besitz von Natalie Janotha. In Kleczynski's: Chopins grössere Werke, Leipzig 1898, Breitkopf u. Haertel, sind S. 3-5 diese Fragmente einer Klavierschule abgedruckt. Es sind nur ein paar Sätze, deren jeder jedoch zu einem Kapitel könnte ausgeweitet werden. Für Pianisten von grossem Interesse:
»Der Ausdruck der Gedanken durch Klänge, die Manifestation der Empfindungen durch diese Klänge, die Kunst, sich durch Klänge (Töne) zu offenbaren, ist ›Musik‹. Der unbestimmte menschliche Laut ist der unbestimmte Klang, die unbestimmte Sprache ist die Musik.
Das Wort entstand aus dem Klange – der Klang war vor dem Worte. – Das Wort ist eine gewisse Modifikation des Klanges. Klänge benutzt man, um Musik zu machen, wie man Worte braucht, eine Sprache zu bilden.
Es handelt sich hier nicht um die Frage des musikalischen Gefühls oder Stils, sondern einfach um die technische Ausführung – Mechanismus – wie ich es nenne. Ich teile das Studium dieses Mechanismus in drei Teile ein:
1. Den beiden Händen zu lehren, die Noten in der Entfernung von einer Taste, von einem oder einem halben Ton zu spielen; – die chromatische, diatonische Tonleiter und den Triller.
Da keine abstrakte Methode existiert, um dieses Studium zu verfolgen, so ist alles, was man tun kann, um die Noten eines ganzen oder halben Tons Entfernung zu spielen, Zusammensetzungen oder Bruchstücke von Tonleitern anzuwenden oder Triller zu üben.
2. Dann die Noten von mehr als einem oder einem halben Ton, anfangend mit der Entfernung von anderthalb Ton; die Oktave geteilt in kleine Terzen, infolge dessen jeder Finger einen ganzen Ton beanspruchend; und den vollkommenen Akkord in seinen Umkehrungen.
3. Die doppelten Noten (in zwei Stimmen). Terzen, Sexten, Oktaven.
Unnötig ist es, das Studium der Tonleitern mit C-dur zu beginnen, welche am leichtesten zu lesen, aber am schwersten zu spielen ist, da sie der Stütze entbehrt, die die schwarzen Tasten gewähren. Es wird gut sein, zu allererst die Ges-dur-Tonleiter zu spielen, welche die Hand regelmässig leitet, indem sie die langen Finger für die schwarzen Tasten benutzt. Der Studierende gelangt dann fortschreitend zur C-dur-Tonleiter, indem er immer einen Finger weniger für die schwarzen Tasten braucht.
Der Triller würde mit drei Fingern gespielt werden, oder, als eine Uebung, mit vier Fingern.
Die chromatische Tonleiter würde mit dem Daumen, dem zweiten und Mittelfinger, ebenso mit dem kleinen, dem vierten und dem Mittelfinger geübt werden.
In Terzen, Sexten und Oktaven benutze man stets dieselben Finger.
Niemand bemerkt eine Ungleichheit des Tones einer sehr schnell gespielten Tonleiter, wenn sie in gleichmässigem Tempo gespielt ist.
Es scheint mir, dass der Zweck eines gut ausgebildeten Mechanismus nicht der ist, alles mit gleichmässigem Ton zu spielen, sondern eine schöne Art des Klanges gut zu nuancieren.
Lange Zeit hindurch hat man gegen die Natur gehandelt, indem man jedem Finger die gleiche Kraft zu geben versuchte; da jeder Finger verschieden gebildet ist, wäre es besser, nicht zu vernichten, sondern im Gegenteil auszubilden: den Reiz des Anschlages, welcher jedem Finger eigen ist. Jeder Finger hat die Kraft, welche seiner Bildung entspricht.
Der Daumen hat die grösste Kraft, indem er der stärkste und freieste ist. Dann der fünfte Finger als Stütze an der äussern Seite der Hand. Der Mittelfinger ist die Hauptstütze der Hand, durch den zweiten mit gefördert. Endlich kommt der vierte, der schwächste unter ihnen. Diesen siamesischen Zwilling, der mit dem Mittelfinger durch ein und dasselbe Band verbunden ist, versucht man mit aller Macht unabhängig vom dritten zu machen. Sache der Unmöglichkeit und Gott sei Dank unnötig!
Es gibt so verschiedene Klänge wie es Finger gibt. Die Aufgabe ist: einen guten Fingersatz zu brauchen.
Die Bewegung des Handgelenks beim Spielen ist dem Atemholen beim Singen in gewisser Beziehung vergleichbar.«
Die Etüdenwerke von Cramer, Clementi bildeten die Grundlage der technischen Studien. Dem wohltemperierten Klavier von Bach widmete er grosse Aufmerksamkeit. Sonaten und andere Stücke von Mozart, Hummel, Field, Weber, Moscheles bildeten im wesentlichen das Repertoire seiner Schüler, soweit Chopin darüber bestimmte; dazu kamen seine eigenen Kompositionen. Von Beethoven liess er nur gewisse Kompositionen mit Vorliebe spielen, von Schubert nur ganz wenig. In seinem Verhältnis zu anderen Komponisten war er überhaupt sehr konservativ und etwas engherzig. Bach schätzte er sehr hoch, Mozart liebte er über alles. Beethoven sagte ihm nur bis zu einer gewissen Grenze zu; er fand vieles bei ihm trivial, sah sich oft aus dem Himmel plötzlich auf die Erde geworfen. Der geniale Beginn des letzten Satzes der C-moll-Symphonie z.+B. war ihm zuwider; dieser plötzliche Ausbruch war ihm von zu brutaler Kraft. Solche Schroffheiten missfielen ihm. Auch an Schubert'schen Liedern hatte er ähnliches auszusetzen; manche davon, wie auch viele der kleineren Klavierstücke dagegen liebte er sehr. Berlioz' Musik war ihm ganz und gar zuwider. Webers Sonaten und Konzertstücke liess er oft spielen. Hummels Werke spielte er selbst mit grosser Vorliebe, Fields Nocturnen versah er oft mit den schönsten Verzierungen (bei seinen eigenen Kompositionen litt er von anderen, auch Liszt, nicht die geringsten Aenderungen). Bellini und Rossini waren ihm angenehm, Meyerbeer mochte er nicht ausstehen. Von Schumann wollte er nicht viel wissen und Mendelssohns Musik konnte er überhaupt nicht leiden. Er gab sich wohl niemals die Mühe, in eine ihm fremde Individualität einzudringen. Was seiner Art nahe kam, zu seinem Empfinden unmittelbar sprach, gefiel ihm, alles andere lehnte er ab. Auch hier zeigt sich bei ihm der Mangel an umfassendem Blick. Er war nicht eigentlich ein grosser Geist. Seine geistigen Interessen waren klein. Auch in anderen Künsten sah er sich wenig um. Für Malerei hatte er nicht sehr viel übrig. Michel-Angelo war ihm ganz zuwider, Delacroix, einer seiner besten Freunde, konnte mit seiner grossen Kunst keinen bedeutenden Eindruck auf ihn machen. Bücher las er nicht viel. Er lebte ganz und gar nur in der Musik.
Um diese Zeit, Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre war Chopin auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. In diese Jahre drängen sich die meisten jener Werke zusammen, die ihm seinen Platz unter den Meistern bereitet haben. Auch als Spieler war er um diese Zeit unvergleichlich. Zwei Berichte von Künstlern, die ihm nahe standen, seien hier genannt, von Heinrich Heine und Liszt.
Heine schreibt (»Lutetia«, 1837):
... »Chopin, der nicht blos als Virtuose durch technische Vollendung glänzt, sondern auch als Komponist das Höchste leistet. Das ist ein Mensch vom ersten Range. Chopin ist der Liebling jener Elite, die in der Musik die höchsten Geistesgenüsse sucht. Sein Ruhm ist aristokratischer Art, er ist parfümiert von den Lobsprüchen der guten Gesellschaft, er ist vornehm wie seine Person. Chopin ist von französischen Eltern in Polen geboren und hat einen Teil seiner Erziehung in Deutschland genossen. Die Einflüsse dreier Nationalitäten machen seine Persönlichkeit zu einer höchst merkwürdigen Erscheinung; er hat sich nämlich das Beste angeeignet, wodurch sich die drei Völker auszeichnen: Polen gab ihm seinen chevaleresken Sinn und seinen geschichtlichen Schmerz, Frankreich gab ihm seine leichte Anmut, seine Grazie, Deutschland gab ihm den romantischen Tiefsinn. ... Die Natur aber gab ihm eine zierliche, schlanke, etwas schmächtige Gestalt, das edelste Herz und das Genie. Ja, dem Chopin muss man Genie zusprechen in der vollen Bedeutung des Wortes; er ist nicht blos Virtuose, er ist auch Poet, er kann uns die Poesie, die in seiner Seele lebt, zur Anschauung bringen, er ist Tondichter, und nichts gleicht dem Genuss, den er uns verschafft, wenn er am Klavier sitzt und improvisiert. Er ist alsdann weder Pole, noch Franzose, noch Deutscher, er verrät dann einen weit höheren Ursprung, man merkt alsdann, er stammt aus dem Lande Mozarts, Raphaels, Goethes, sein wahres Vaterland ist das Traumreich der Poesie. Wenn er am Klavier sitzt und improvisiert, ist es mir, als besuche mich ein Landsmann aus der geliebten Heimat und erzähle mir die kuriosesten Dinge, die während meiner Abwesenheit dort passiert sind ... Manchmal möcht' ich ihn mit Fragen unterbrechen: Und wie gehts der schöen Nixe, die ihren silbernen Schleier so kokett um die grünen Locken zu binden wusste? Verfolgt sie noch immer der weissbärtige Meergott mit seiner närrisch abgestandenen Liebe? Sind bei uns die Rosen noch immer so flammenstolz? Singen die Bäume noch immer so schön im Mondschein?« ...
Liszt schreibt (S. 111 seines Buches):
»Nun müssten wir noch von Chopins Spiel reden, wenn nicht der traurige Mut uns dazu fehlte; wenn wir seelische Regungen ausgraben könnten, die mit den intimsten persönlichen Erinnerungen eng verknüpft sind, um ihre Grabtücher (linceuls) mit den Farben zu verschen, mit denen sie gemalt werden müssten ... Kann es gelingen, jemandem eine Vorstellung von dem Zauber einer unsagbaren Poesie zu geben, der sie nicht selbst empfunden hat? ... In den meisten seiner Walzer, Balladen, Scherzos, liegt die Erinnerung irgend eines flüchtigen poetischen Hauches wie eingesargt, der von einer flüchtigen Erscheinung herübergeweht scheint. Manchmal idealisirt er sie so weit, macht er ihre Fibern so zart und zerbrechlich, dass sie nicht mehr unseresgleichen anzugehören scheint, sondern sich der Feenwelt nähert und uns die Geheimnisse der Undinen, der Titanias, der Ariel, der Königin Mab, der mächtigen und launischen Oberons enthüllt, aller Genien der Lüfte, des Wassers und Feuers, die auch, wie wir, den bittersten Enttäuschungen und unerträglichsten ennui ausgesetzt sind. Wenn diese Art von Inspiration Chopin überkam, dann nahm sein Spiel einen ganz bestimmten Ausdruck an, ganz gleich, was er immer spielen mochte, Tanzmusik oder träumerische Nocturnen, Mazurkas, Préludes oder Scherzos. ... Allem gab er eine ganz unnennbare Färbung, ein nebelhaftes Ansehen, einen Pulsschlag von einer Vibration, die nichts Stoffliches mehr an sich hatten und wie ein impondérable auf das Wesen wirkten, ohne durch die Sinne zu gehen. Bald meinte man, das freudige, ungeduldige Fusswippen einer Peri zu vernehmen, die im Liebesstreit schmollt, bald waren es sammetweiche, schillernde Modulationen, wie der Rücken eines Salamanders; bald hörte man traurige, trostlose Aceente, als wenn die Seelen im Fegefeuer nicht barmherzige Beter fänden, die ihre endliche Erlösung erflehten. Dann wieder entströmte seinen Fingern eine so traurige, untröstliche Verzweiflung, dass man den leibhaftigen Jacopo Foscari des Byron vor sich auferstanden sah, dass man meinte, ihn aus Liebe zum Vaterland den Tod erleiden zu sehen, ihn, der den Tod der Verbannung vorzog, der es nicht überleben konnte, Venezia la bella zu verlassen. ... Durch sein Spiel erweckte der grosse Künstler in bezaubernder Weise jenes Zittern von ängstlicher, atemloser Erregung die über einen kommt, wenn man sich in der Gegenwart übernatürlicher Wesen fühlt, nahe denen, die man weder ahnen kann, noch fassen, noch umarmen, noch beschwören. Er liess die Melodie immer leise auf- und abwogen, wie der Nachen auf dem Busen einer mächtigen Welle; oder, er liess sie schreiten, wie eine Erscheinung in den Lüften. ... In seiner Niederschrift zeigte er die Manier, die seinem Spiel einen so eigenen Zug verlieh, durch das Wort: Tempo rubato an: ›geraubte‹ Zeit, abgeschnittener, geschmeidiger Takt, abrupt und languid zugleich, wie die Flamme unter dem Lufthauch hin- und hertreibt, wie die Aehren auf dem Feld unter dem Druck des warmen Windes wogen, wie die Baumwipfel schwanken unter dem Hauch der frischen Brise. Aber später liess Chopin diese Bezeichnung fort; denn das Wort sagte dem Wissenden nichts neues, dem Unwissenden, der es nicht verstand und fühlte, gar nichts. ... Es müssen also alle seine Kompositionen mit diesem eigentümlich accentuierten und rythmisierten balancement gespielt werden, mit jener morbidezza, deren Geheimnis schwer zu fassen ist, wenn man ihn nicht selbst oft gehört hatte.«
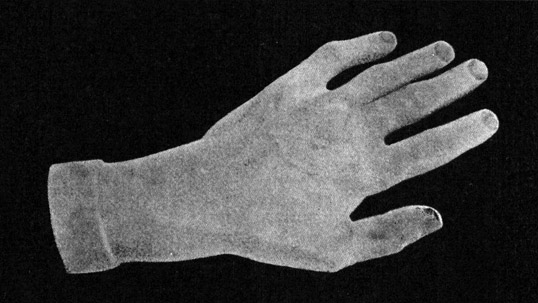
Chopin's Hand. (In Marmor im Museum zu Budapest.)
In Betreff des Rubato ist auch daran zu erinnern, dass es im Grunde nicht eine Erfindung Chopins ist, sondern von ihm aus der polnischen Volksmusik übernommen und künstlerisch verwertet worden ist. Das Rubato ist ein Charakteristikum der slavischen Volksmusik, besonders der ländlichen, bäurischen; ein Wiederspiegeln des etwas schwankenden, unentschiedenen slavischen Charakters im Rythmus, wie ein polnischer Schriftsteller es ausdrückt. Vgl. Hoesick S. 838, Kleczynski S. 65.
Die meisten Berichterstatter heben hervor, dass Chopin durch seinen eigentümlichen Pedalgebrauch die überraschensten Nüancen, ganz neue Effekte erzielt habe. Rubinstein behauptete irgendwo, wohl mit einiger Uebertreibung, aber nicht ganz grundlos, dass Chopin bei der Niederschrift seiner Kompositionen, hinsichtlich der Pedalvorschriften nachlässig gewesen sei, und dass man die Pedale anders gebrauchen müsse, als vorgeschrieben. Kleczynski gibt einige interessante Beispiele hinsichtlich der richtigen Pedalverwendung S. 9-12. Vgl. auch Hans Schmidt's Werk über das Pianoforte-Pedal S. 57.
