
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
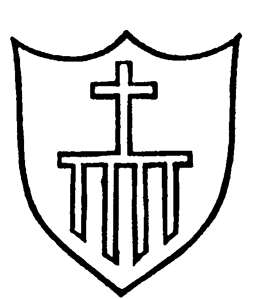
Unterhalb des Domberges, wo unter überhängendem Gebüsch die silberne Pader fließt, träumt die Vergangenheit. Eins von diesen kleinen Häusern mit den schützenden Dächern konnte das Wohnhaus des unglücklichen Bürgermeisters Liborius Wichart gewesen sein, unter dem eine Paderquelle hervorfloß, die eines unheilvollen Tages so seltsam rot gefärbt war, daß alle sich entsetzten. Das war vor dreihundert Jahren; aber noch 600 Jahre früher, als der große Kaiser Karl zuerst in diese Gegend kam, da sah es noch ganz anders aus: da rauschten weithin Wälder von Eichen, und die Straße, die sie durchschnitt, wurde selten von Reisenden begangen. Begegnete ihnen die reine Quelle nicht wie eine gastliche Nymphe, aus kristallener Schale Erquickung spendend? Hatte sie göttlich waltend die Sitten der sächsischen Bauern, die wer weiß wie lange schon auf wohlbestellten Höfen hier angesiedelt waren, gemildert? Irgendein menschliches Dasein muß wohl die Wildnis am Quell beseelt und den Frankenkönig angehaucht haben, daß er hier seinem Gott eine Kirche und damit einen Mittelpunkt sich ansammelnden Lebens zu gründen beschloß. Solchen Klang hatte der Name des germanischen Helden, daß er an das namenlose Wasser im deutschen Walde arabische Gesandte aus Saragossa lockte, die Hilfe gegen den Kalifen von Kordova suchten, daß er von Italien den Papst herführte, den die Römer vertrieben hatten. Damals waren die Deutschen das auserwählte Volk und ihr Führer der Herr des Abendlandes. Es war im Sommer des Jahres 799, zweiundzwanzig Jahre nachdem Karl das erstemal an der Pader Hof gehalten hatte, daß Leo III. ihn dort aufsuchte und Gespräche mit ihm führte, in denen, so nimmt man an, der Gedanke des durch die Deutschen zu erneuernden Römischen Reiches zuerst ausgesprochen wurde. Im folgenden Jahre empfing Karl in Rom die Kaiserkrone.
Edle Sachsen mit fremdartig wohllautenden Namen, Harhumar und Baderad, wurden die ersten Bischöfe von Paderborn, neben der Kirche entstand für sie eine ihrem Rang entsprechende Wohnung, die auch die Kaiser beherbergte. Nach dem Tode Karls kamen Ludwig der Fromme, Ludwig der Deutsche, Otto der Große, neunmal Heinrich II., dessen Gemahlin Kunigunde im Dome durch den Erzbischof Willegis von Mainz gekrönt wurde, siebenmal Konrad II. und dreimal Heinrich III., dem der Erzbischof von Mainz Bardo bei einer Predigt im Dome seinen nahe bevorstehenden Tod verkündigt haben soll. Der letzte deutsche Kaiser, der sich in Paderborn aufhielt, war Otto IV. Damals war Paderborn schon eine blühende Stadt; in der Zeit der Karolinger und der sächsischen Kaiser jedoch wurde nichts so sehr gerühmt wie das silberhelle Wasser der Pader, eine Gabe der noch heiligen Natur an ein junges Heldenvolk.
Nie ist mir ein Turm so überwältigend groß erschienen wie der des Domes von Paderborn; es raubt den Atem, an ihm hinaufzusehen. Man denkt an die Eichenurwälder, die einst an dieser Stelle rauschten, an die heiligen Bäume, in deren Zweigen der Westfale die Stimme seiner Götter vernahm, an die Mächtigen, die sie fällten und statt ihrer im Dienste des Gottes der Götter Riesenbäume aus Stein errichteten. Es sind nicht mehr die alten Steine; nicht einmal von dem, was der große Erbauer-Bischof Meinwerk schuf, ist viel übriggeblieben; dennoch ist denen, die die ersten Kirchen und Paläste anlegten, das Bedeutende zu verdanken, das man heute sieht, da sie die großen Linien zogen, die sich durch Jahrhunderte erhalten haben. Zerstörte auch das Feuer wieder und wieder die unermüdlich neuerstellten Werke, es blieb doch ein Gemäuer, ein Grundriß, ein Grundgedanke, der in die Erde hineinwuchs und trotz aller Baumeister mit baute. Paderborn war lange ein verkümmertes und ist noch jetzt ein verschlafenes Städtchen; aber nichts und niemand kann ihm den heroischen Umriß nehmen, den erhabenen Menschensinn, der sich hineinergoß, und daß es Geruch von Urwald, Sumpf und Heide ausatmet, die es einst verschlang. Dieselbe Größe wie der romanische Dom hat die halbgotische Jesuitenkirche mit dem stolzen Aufgang und dem Innenraum, der wie in Feuer vergoldet erscheint, hat das gotisch-barocke Gymnasium und die Franziskanerkirche mit der breiten Treppenanlage und dem Brunnen. Wieviel träumerische Versunkenheit aber brütet über den Quellen, an den alten Mauern, in den engen Gassen, die zur Domfreiheit führen! Neben der Idee des allumfassenden heiligen Reiches, die sich hier Denkmale setzte, weht noch der Geist der schweigsamen Wilden, die als Herren auf ihren Höfen saßen, die ihre Götter im Sturm und im Rauschen hundertjähriger Bäume ehrten und ihr blondes Haupt nur dem selbstgewählten Herzog beugten.
Die Zeit der großen Bischöfe, die den Reichsgedanken vertraten und Kulturmittelpunkte gründeten, war mit den Hohenstaufen vorüber; sie waren nun im allgemeinen nichts anderes als Fürsten, die ihre Verbindung mit Rom benutzten, um auf Kosten des Reichs Macht zu genießen und sich und ihre Familie zu bereichern. Die Paderborner Bürgerschaft stand dauernd schlecht mit ihren Bischöfen, weil diese auf gewisse Rechte, die ihnen in der Stadt geblieben waren, nicht verzichten wollten. Es handelte sich um die Gerichtsbarkeit, die bequemste und wirksamste Handhabe, um in das Regiment einzugreifen und es an sich zu ziehen. Indem sich die Paderborner nach Bundesgenossen umsahen, bot sich ihnen die Politik des Erzbischofs von Köln an, der nach Einverleibung des Bistums Paderborn trachtete. Wahrscheinlich durch die Vermittelung Engelberts von Köln erlangten sie von König Heinrich, dem Sohne Kaiser Friedrichs II., ein wichtiges Privileg, welches ihnen gestattete, einen den Bischof vertretenden Grafen selbst zu ernennen. Zwar gab es noch eine Zeitlang einen vom Bischof ernannten Stadtgrafen, von welchem Amte das Geschlecht der Grafen von Paderborn abstammte, allein ihre Befugnisse wurden immer geringer, und schließlich verschwanden sie ganz; in der Mitte des 14. Jahrhunderts besaß die Stadt die volle Gerichtsbarkeit und übte sie durch den Rat aus. Es begann eine Zeit der Blüte, bezeichnet durch selbständig abgeschlossene Bündnisse der Landeshauptstadt mir Warburg und Brakel und über das Stift hinausgreifend auch mit Soest. Paderborn, Warburg und Brakel versprachen sich, einem neuen Bischof nur dann zu huldigen, wenn er sie bei ihrem alten Recht, ihren alten Gewohnheiten und allen althergebrachten Ehren zu lassen gelobe. Indem er Administrator von Paderborn wurde, kam Erzbischof Dietrich von Köln seinem Ziel, das benachbarte Stift dem seinigen einzuverleiben, sehr nah; kölnisch zu werden, lehnten jedoch die Stände von Paderborn, auch die Stadt ab; sie hätten dadurch einen mächtigen gegen einen schwächeren Herrn eingetauscht. Zwar wurden die Stände aus Angst vor der Feme, deren oberster Stuhlherr der Erzbischof von Köln war, bewogen, in der großen Soester Fehde sich Dietrich von Mörs anzuschließen; die Stadt Paderborn aber hatte den Mut, zu Soest zu halten, bis die Kunde vom Herannahen der Hussiten sie schreckte.
Um diese Zeit etwa, um die Mitte des 15. Jahrhunderts, begann der wirtschaftliche Niedergang, dem damals die meisten deutschen Binnenstädte anheimfielen, sich bemerkbar zu machen. Hier wie in Soest war die Stadtverfassung insofern demokratisch, als auch Handwerker in den Rat gewählt werden konnten, und als es städtische Adelsfamilien nicht mehr gab. Die Geschlechter v. Elzen, v. Driburg, v. Westphalen, v. Schildern, v. Krevet, v. Haxthausen, v. Herse, die in und um Paderborn begütert waren, gehörten dem Domkapitel oder der Ritterschaft an, und ihr Ansehen, ihr Ehrgeiz, ihr Selbstbewußtsein waren der Stadt entzogen. Es bildete sich trotzdem aus den Familien, die in den Rat gewählt zu werden pflegten, Kaufleuten und reich gewordenen Gewerbetreibenden, eine Art Aristokratie; aber sie hatte von einer solchen nur die Engherzigkeit und den Hochmut, nicht den kühnen Griff in der Politik. Die Abneigung gegen die Geistlichkeit, die in den Bischofsstädten besonders stark war, wo man ihr Treiben vor Augen hatte, die Meinung, daß sie durch verbotene Gewerbstätigkeit den wirtschaftlichen Niedergang mit verschuldete, erleichterte der neuen Lehre den Eingang, für die ohnehin Geist und Gemüt überall vorbereitet war. Stadt und Ritterschaft waren überwiegend protestantisch, aber auch in den Klöstern und selbst im Domkapitel und auf dem Bischofssitz fand das Luthertum Anklang. Als Bischof Heinrich von Lauenburg starb, der den Protestantismus offen begünstigt harte, beschloß das Kapitel, das in der Mehrzahl doch katholisch geblieben war, es müsse etwas Außerordentliches geschehen, um den alten Glauben wieder in Aufnahme zu bringen. Zu diesem Zwecke wurden die Jesuiten nach Paderborn gerufen und wurde aus der Mitte des Domkapitels ein als eifriger Katholik bekannter Mann gewählt, Dietrich von Fürstenberg, aus westfälischem Geschlecht.
Ein Jahr nachdem Dietrich in Paderborn seinen Einzug gehalten hatte, verließ ein Mann die Stadt, in dem sich der Widerstand gegen die bischöfliche Macht und der Gedanke städtischer Unabhängigkeit noch einmal sammeln sollte, so daß der Kampf zwischen Fürstengewalt und modernem Staat und mittelalterlicher Vielgestaltigkeit zu einem Zweikampf zwischen Dietrich von Fürstenberg und Liborius Wichard wurde. Dietrich war ein feiner Politiker und ein schwer zu durchschauender Mensch. Er war eifrig katholisch, empfing aber erst einige Jahre nach seinem Regierungsantritt die Weihe, weil es verlangt worden war, und hat niemals ein Meßopfer dargebracht, was zu allerlei Gerüchten Anlaß gab. Er war eigentlich nicht unduldsam, wenigstens gab es, sogar in seiner Verwandtschaft, Protestanten, mit denen er verkehrte; es scheint, daß er, wie so viele, den Katholizismus als das Gegebene und Legitime und die Protestanten als Rebellen betrachtete, die als solche unterdrückt werden müßten. Die Protestanten in seinem Stift entweder katholisch zu machen oder zu vertreiben, bedeutete ihm dasselbe wie seinen Ständen die Selbständigkeit nehmen; er wollte als echter Fürst des 17. Jahrhunderts eine möglichst gleichartige Masse leicht zu regierender Untertanen.
Es läßt sich denken, daß er mit solcher Disposition zunächst den Jesuiten nicht günstig gesinnt war; aber da er außer ihnen keine Freunde im Stift hatte, wurde er allmählich in ihre Arme getrieben. Das Domkapitel, sittenlos und verwildert, wollte sich die hergebrachte Weiberwirtschaft nicht nehmen lassen, die Ritterschaft war protestantisch und eigenmächtig, und beide Stände hätten es unbedingt mit der Stadt gegen den Bischof gehalten, wenn nicht ihre Steuerfreiheit dazwischengestanden hätte, welche der Stadt begreiflicherweise ein Dorn im Auge war. Wäre die Stadt einträchtig gewesen, so hätte sie auch jetzt noch eine achtbare Macht bedeutet; aber Rat und Gemeinheit, das heißt die Bürgerschaft, die im Rat nicht vertreten war, standen sich durch Verschulden des Rats feindlich gegenüber. Infolge der Schlamperei des Rats war die Stadt in der letzten Zeit in Verfall geraten, die Befestigung vernachlässigt, die Bürgerschaft nicht zum Wachtdienst herangezogen, das Recht nicht gepflegt, kurz, es harten sich überall verderbliche Mißstände eingeschlichen. Im Rat saß ein vermögender Lohgerber, Liborius Wichard, der gegen den Schlendrian seiner Genossen auftrat und sie sich dadurch zu Feinden machte. Auch seine erbittertsten Gegner haben ihm zugestanden, daß er klug und beredt war, besonders eine Eigenschaft aber wird an ihm hervorgehoben, die überall und jederzeit selten ist, daß er furchtlos aussprach, was sein Herz bewegte. Er gehörte offenbar zu jenen Menschen, auf die der Anblick der Ungerechtigkeit wie Gift wirkt. Dadurch wurde er im Rat als unbequem empfunden, und die Nachstellungen der beiden rechtskundigen Bürgermeister, die ihn vor allem haßten, brachten ihn endlich so weit, daß er die Stadt verließ. Man könnte sich denken, es hatten zwei Engel um sein Geschick gekämpft, und der eine, der sein irdisches Glück wollte, hätte ihn von da hinweg geführt, wo der Schatten eines furchtbaren Blutgerüstes überirdischen Augen schon sichtbar war. Eine sonderbare Verschlingung der Ereignisse war es, daß der neue Bischof, Dietrich von Fürstenberg, dem verfolgten Manne zu Hilfe kam, indem er ihm gestattete, sich auf seinem Grund und Boden vor der Stadt anzubauen; vielleicht weil er den Feind des regierenden Rats als seinen Freund betrachtete. Allein der Haß der Ratsherren duldete seine Nähe nicht: sein Haus wurde überfallen und niedergerissen und er gezwungen, ins Elend zu gehen. An dem unversöhnlichen Haß, der ihn zu verderben suchte, kann man ermessen, wie stolz und herbe er sein konnte, wo er haßte und verachtete. Der Verarmte und Heimatlose begründete in der kleinen Stadt Scherfede eine Gastwirtschaft, wurde aber des Orts sowie des Geschäfts überdrüssig, als ihm seine Frau starb, und ging nach Warburg. Dort war ihm neues Glück aufbewahrt: er heiratete eine Witwe, die Anteil an einem reichbegüterten Hospital hatte, dessen Provisor ihr verstorbener Mann gewesen war. Auch hier jedoch geriet er in Zwist mit dem Warburger Magistrat, der ihm das Recht am Hospital beeinträchtigen wollte, so daß er sich entschloß, wieder nach Paderborn zu ziehen, wo inzwischen seine erbittertsten Feinde gestorben waren. Fünfzehn Jahre waren verflossen, der Weg schien geebnet; ein anderer Engel, ein stolz und düster blickender, der nicht Glück, sondern Ruhm für seinen Schützling wollte, stieg auf und verscheuchte den sanfteren. Wieder war es der Bischof, der sich Wichards in seinem Streit mit dem Warburger Magistrat angenommen hatte. Mit seiner Frau und sieben Söhnen kehrte er in die Vaterstadt zurück, vielleicht durch dasselbe Tor, neben welchem vier Jahre später sein Haupt, auf einer Stange befestigt, den Ankommenden den Sieg des bischöflichen Herrn und die Erniedrigung der Stadt verkündigte.
Er wurde sofort in die Erregung hineingezogen, welche die Stadt seit dem Regierungsantritt Fürstenbergs ergriffen hatte. Noch hatte der Bischof nichts Wesentliches ausgerichtet, sowenig wie die Jesuiten. Er verlangte, gestützt auf irgendwelche Abmachungen früherer Zeit, einen gewissen Anteil an der Gerichtsbarkeit, den ihm die Stadt vorenthielt; er hatte einmal die Marktkirche, die im Besitz der Protestanten war, geschlossen, sich aber nicht gerührt, als sie gewaltsam wieder geöffnet und wie zuvor benutzt wurde. Er war kein Mann, der leicht Gewalt brauchte, auch konnte er sich nicht wohl darüber hinwegsetzen, daß er die Rechte und Privilegien der Stadt beschworen harte. Auf allen Seiten von Gegnern umgeben, hielt er es für das beste, Gelegenheiten abzupassen; diese Politik, die ihm vielleicht auch von den Jesuiten geraten wurde, entsprach am meisten seinem Charakter. Die Verblendung seiner Feinde zeichnete sie als zum Untergange bestimmt. Die Bürgerschaft war mit Recht entrüstet über den Rat, der in seinem Schlendrian fortfuhr; es bedurfte nur eines Mannes wie Liborius Wichard, damit der aufgehäufte Unwille Tat wurde. Seine Tatkraft und Beredsamkeit vereinten die Bürger zu einem Geheimbunde, an dessen Spitze er stand; sein treuer und kluger Gehilfe war der junge Paderborner Rechtsgelehrte Wolfgang Günther, eifrig protestantisch, scharfsinnig, tätig und gewandt mit der Feder. Von der zusammengefaßten Bürgerschaft zur Rede gestellt und bedroht, ergriff der Rat den unseligsten Ausweg, sich dem Bischof zu nähern und ihm denjenigen Anteil an der Gerichtsbarkeit einzuräumen, den er als sein Recht beanspruchte. Als städtische Obrigkeit und Protestanten hätten die Ratsherren vor allen Dingen das Interesse der Stadt wahren müssen; aber sie gaben es lieber preis, als daß sie sich mit der Bürgerschaft vertragen hätten. Ihrerseits begingen Wichard und Günther eine Unklugheit, indem sie die Vermittlung des Bischofs anerkannten; denn nun hatte dieser Fuß gefaßt und stand als Schiedsrichter über der zerspaltenen Stadt.
Wenn der Bischof von Anfang an einen bestimmten Plan verfolgte, besaß er eine Schlauheit, die man jesuitisch nennen könnte; vielleicht aber ließ er sich nur im allgemeinen von dem Grundsatz leiten, stets die Entzweiung seiner Gegner zu schüren und einen durch den andern zu schwächen, bis sich Gelegenheit böte, einen durch den andern zu vernichten. Er ließ zunächst die Ratsherren verhaften und leitete einen Prozeß ein, der ihre Schuld offenbar machte; es wurde ihnen nachgewiesen, daß sie ihre Pflicht vernachlässigt und die öffentlichen Gelder in strafbarer Weise verschleudert und veruntreut harren. Es harre den Anschein, als wolle Fürstenberg schlechtweg Gerechtigkeit üben, als plötzlich der Prozeß unterbrochen wurde, ohne daß irgend etwas, auch nur Amtsenthebung gegen die Schuldigen unternommen worden wäre. Dieser auffallende Schritt, der den Eindruck hervorrief, als habe der Bischof die Bürgerschaft irregeführt, erregte die Leidenschaften aufs neue. Wichard und Günther, welch letzteren der Bischof eine Zeitlang gefangenhielt, faßten den Entschluß, den Entscheidungskampf herbeizuführen. Sie legten ihren Handlungen nun ein Privileg Kaiser Friedrichs III. zugrunde, ohne gewisse Rezesse zu beachten, durch welche später einige Bischöfe Vorteile über die Stadt erlangt hatten. An der Spitze eines ihm ergebenen Haufens hielt es Wichard für möglich, die verlorene Freiheit und Macht der Stadt zu erneuern.
Die leise Arbeit des Bischofs ging indessen weiter. Bei der neuen Ratswahl setzte er es durch, daß alle ausgeschlossen wurden, die mit den alten Ratsherren verwandt waren; indessen kamen, wie es heißt, lauter gute, fromme, einfältige Handwerksleute in den Rat, die sich wohl von Wichard leiten ließen, aber auch dem Bischof keinen nachdrücklichen Widerstand entgegensetzten. Als er, erzürnt über Wichards Berufung auf das Statut Kaiser Friedrichs III., dessen Auslieferung verlangte, forderte der Rat ihn auf, gutwillig die Stadt zu verlassen; auf diesem gelinden Wege hofften sie sich Ruhe zu schaffen. Noch einmal wurde dem leidenschaftlichen Manne das Tor geöffnet: das Verhängnis war schon nah über seinem Haupte, als Warnung und Befreiung zugleich ihm winkte; aber er hielt sich nach seinen eigenen Worten der Stadt mit Leib und Leben verbunden und war zu sehr mit ganzer Seele in diesen Kampf verstrickt, als daß er sich noch hätte herausreißen können. In den ersten Januartagen des Jahres 1604 wurde Wichard zum Bürgermeister, Wolfgang Günther zum Stadtsekretär gewählt; er stand nun an der Spitze des Gemeinwesens und dem fürstlichen Landesherrn als Herr der Stadt gegenüber, die zwar nicht reichsfrei, aber doch von manchem König und Kaiser urkundlich gefreit war.
Wichards Regiment begann damit, daß er einen vornehmen Bürger, der eine Prozession beschimpft hatte, ernstlich tadelte; der Bischof sprach befriedigt die Vermutung aus, daß er den neuen Bürgermeister etwa noch zu Tische laden würde. Man möchte meinen, Dietrich von Fürstenberg habe Sympathie für Wichard empfunden. Gefiel ihm etwa die tatkräftige, freimütige, unbekümmerte Persönlichkeit, die der seinigen, behutsam schleichenden, berechnenden entgegengesetzt war? Schwankte er noch, mit welcher Partei er sich verbinden solle? Wichard sicherlich schwankte nicht; er wollte es zum offenen Kampfe kommen lassen. Zu diesem Zweck setzte er die Stadt in Verteidigungszustand und entfaltete eine bewundernswerte Umsicht und Organisationsgabe. In kürzester Zeit wurde die Mauer hergestellt und die gesamte Bürgerschaft auf den vernachlässigten Wachtdienst eingeübt. Dabei mußten auch die Jesuitenschüler und die Geistlichkeit sich beteiligen, niemand durfte sich entziehen, alles gehorchte. Weil Wichard alle Kräfte in den Dienst des bevorstehenden Freiheitskampfes stellen, allen Bürgern, Männern und Frauen, den Geist der Selbstverleugnung und Todesbereitschaft einpflanzen wollte, verfuhr er mit ungewöhnlicher Strenge gegen Missetäter. Einen Dieb ließ er nach beschleunigtem Verfahren hängen, ohne den Bischof zugezogen zu haben; es kam ihm wohl darauf an, seine Einmischung abzuschneiden und von vornherein zu zeigen, daß er sein Recht dazu nicht anerkenne. Seine Härte vermehrte den Haß seiner Feinde und brachte sogar Anhänger gegen ihn auf. Vielen waren die Anstrengungen, die er der Bevölkerung zumutete, unbequem, überall zeigte sich Widerstand. Seinem Feuer gelang es doch noch einmal, die Menge hinzureißen, als er vom Balkon herab das Privileg Friedrichs III. vorlas, das er als Rechtsgrundlage der Stadt anerkannt wissen wollte. Es war ein Augenblick, jenem ähnlich, als Esra dem Sklave gewordenen Volk Israel das Gesetz des Moses vorlas und ihm seine große Vergangenheit erzählte, bis es in Tränen ausbrach und sich drängte, einen neuen Bund mit Gott zu schließen.
Der Aufschwung einer Stunde hinderte nicht, daß die Unzufriedenheit fortwühlte. Von einem Häuflein Getreuer, zum äußersten Bereiter umgeben, beachtete Wichard die um sich greifende Feindseligkeit nicht. Die Annäherung spanischer Truppen verschärfte die Spannung; denn die protestantisch städtische Partei glaubte, der Bischof habe die Fremden gerufen, um sich ihrer gegen die Stadt zu bedienen. Jedenfalls bereitete er endlich eine Tat vor, indem er die Eroberung der Stadt dem Grafen Johann von Rietberg anvertraute, der sich dadurch besonders empfahl, daß er erst kürzlich katholisch geworden war und in spanischem und polnischem Kriegsdienst gestanden hatte. Wie nun Wichard sich nach Bundesgenossen umsah, zeigte sich, daß er allein war; denn die Stände, obwohl sie dem Bischof feindlich gesinnt waren und der Stadt den Sieg gönnten, wollten sich doch nicht auf offene Teilnahme einlassen. Wieder zeigte sich die Steuerfreiheit der bevorzugten Stände als Hindernis; als der Bischof den Einfall der Spanier mit Geld abkaufen wollte, lehnten Kapitel und Ritterschaft den Beitrag ab, um die Kosten den Städten allein aufzuhalsen. In dieser Not wandte sich Wichard an den Landgrafen Moritz von Hessen, von dem er wußte, daß er gern einen seiner Söhne auf den Paderborner Bischofsstuhl gebracht hätte; aber der Landgraf, ein ungewöhnlicher, denkender Fürst, der das Zwiespältige der Verhältnisse tief empfand, konnte sich keinen Entschluß abringen und versagte sich dem Bittenden. So stand Wichard nicht an der Spitze einer einmütigen Bürgerschaft, sondern eines verzweifelten Haufens. Doch hielten sie sich so tapfer, daß der erste Versuch des Grafen Rietberg, mit Hilfe von Verrätern die Stadt zu überfallen, abgeschlagen wurde. Da setzte sich der Bischof mit dem Rat in Verbindung und erzielte die Übergabe in der Weise, daß ein Scheinvertrag geschlossen wurde, demzufolge alle Rechte und Freiheiten der Stadt gewahrt bleiben sollten; in Wirklichkeit jedoch übergab sich die Stadt auf Gnade und Ungnade und wurde die Auslieferung des Bürgermeisters zugesagt.
Wichard ahnte nichts, die Bürgerschaft jubelte über die vermeintlich glückliche Lösung. Erst als der Graf von Rietberg einrückte, begriff der unglückliche Bürgermeister, was vorging, stürzte zornig auf das Rathaus und fand dort alles gegen sich; als er sich auf seinen Stuhl setzte und rief: »Den will ich sehn, der seinem Bürgermeister Gewalt antut!« traf ihn ein Faustschlag ins Gesicht. Es war um ihn geschehen. Nachdem er unerträgliche Stunden lang an eine Säule gebunden dagestanden hatte, dem Hohn und Anspeien des Pöbels ausgesetzt, wurde ihm in Eile der Prozeß gemacht, dessen Ausgang von vornherein feststand. Das Urteil wurde sofort an ihm vollzogen: der Leib ihm aufgeschnitten, das Herz herausgerissen und ihm ins Gesicht geschlagen; dann wurde er gevierteilt. Uns, die wir kaum fähig sind, die Beschreibung einer solchen Schlächterei zu hören, erscheint es als unfaßbarer Heldenmut, daß das Opfer sich ruhig selbst entkleidete, mit Fassung sich auf den Martertisch binden ließ und unter Anrufung Gottes die Qual erlitt. Der Bischof, der die Fällung und Vollziehung des Urteils kaum hatte erwarten können, soll dem fürchterlichen Schauspiel aus seinem Garten vor dem Westertor, denn da fand die Hinrichtung statt, zugesehen haben. Der zerstückte Leichnam wurde auf einen Karren gelegt und an seinem Hause vorübergefahren, seiner Witwe und seinen Söhnen, wie es heißt, zu Jammer und Schimpf. Die Jesuiten rühmten sich, Wichard vor seinem Tode zum katholischen Glauben bekehrt zu haben, und der berühmte Paderborner Bildhauer Heinrich Gröninger, der den Gefangenen zusammen mit dem Jesuiten Wachtendonck im Turme besucht hatte, bestätigte es in einer Denkschrift. Von protestantischer Seite wurde die Behauptung heftig bestritten, und man möchte auch glauben, der Bischof hätte in diesem Falle das Gedächtnis des Besiegten weniger schonungslos verfolgt. Erst Christian von Braunschweig ließ im Dreißigjährigen Kriege die Gebeine des letzten Bürgermeisters von Paderborn ehrenvoll bestatten.
Wichards Freund und Kampfgenosse Wolfgang Günther fand beim Landgrafen Moritz von Hessen Schutz und Beschäftigung. Der Fürst schätzte ihn so hoch, daß er ihn zum Generalauditor und Kanzleidirektor machte und sich stets von ihm beraten ließ; aber er konnte das schreckliche Ende, das auch ihm bevorstand, nicht abwenden. Als Moritz zugunsten seines Sohnes abdankte, empfahl er diesem Wolfgang Günther, da er wußte, wie seine Feinde, namentlich die hessische Ritterschaft, ihn haßten; aber Wilhelm gab ihn ihrer Rache preis, und er wurde, nachdem er grausame Tortur erlitten hatte, enthauptet, 24 Jahre nach dem Tode Wichards. Dietrich von Fürstenberg starb im Jahre 1618 dreiundsiebzigjährig. Ein Jesuit hielt ihm die Leichenpredigt über den Text: »Wie der Morgenstern im Hause der Nacht, also hast du geleuchtet im Hause Gottes.« Der Bildhauer Gröninger, von dem die eindrucksvoll-phantastische Statue des heiligen Christophorus im Dome stammt, errichtete ihm das figurenreiche Grabdenkmal.
Die unterworfene Stadt wurde ihrer Freiheiten beraubt und zu einer Landstadt herabgedrückt; die Bürger mußten ihre Waffen abliefern, wobei es sich zeigte, daß eine große Menge vorhanden war, die alle in die fürstbischöflichen Burgen gebracht wurden. Diese Entwaffnung, die nicht nur in Paderborn, sondern überall so oder so vollzogen wurde, hätte nicht so allgemein stattfinden können, wenn nicht eine Erschlaffung der bürgerlichen Kraft eingetreten wäre, mit der wieder die neuen Erfindungen in Einklang waren, die im allgemeinen darauf zielten, den Kampf von der Person abzuziehen und in die immer selbständiger werdenden Kampfmittel zu verlegen. An die Stelle der wehrhaften, trotzigen, mit Leib und Seele am Leben der Stadt beteiligten Bürgerschaft traten ängstliche, pedantische, unpraktische Philister. Es geriet so sehr in Vergessenheit, wie es einst gewesen war, daß die Beschäftigung mit politischen Dingen einen Anstrich von Vermessenheit oder Lächerlichkeit erhielt, daß man sich gewöhnte, sich selbst für unzulänglich und die Deutschen für unpolitisch zu halten, und man kann ja auch sagen, daß nach dem Dreißigjährigen Kriege eine andere deutsche Nation auf die Bühne trat.
Die neue Lehre war in der Bürgerschaft Paderborns so befestigt gewesen, daß trotz aller Verfolgungen und Ausweisungen noch viel Evangelische vorhanden waren, als der Dreißigjährige Krieg ausbrach und die Anwesenheit des tollen Christian ihnen glücklichere Aussichten eröffnete. Der junge Herzog, der im Jesuitenkollegium am Kamp Wohnung nahm, rächte die Leiden seiner Glaubensgenossen auf die wildhumoristische Art, die ihm eigentümlich war, und die ihn zu einer volkstümlichen Figur, halb Held, halb Wildfang und Popanz machte. Er entnahm dem Dom den silbervergoldeten Schrein des heiligen Liborius und ließ daraus Münzen schlagen mit der Umschrift: Gorres Freundt der Pfaffen Feindt. Die Gebeine, die er auf die Dauer nicht mitschleppen konnte, kamen später nach Paderborn zurück und erhielten einen neuen, prächtigen Schrein, den Meister Hans Krako zu Dringenberg verfertigte.
Nachdem Paderborn im Laufe des Krieges sechzehnmal bald von protestantischer, bald von katholischer Seite erobert worden war, hatte es das letzte an Kraft und Wohlstand eingebüßt, was ihm noch geblieben war. Im Lande waren verschiedene Ortschaften verwüstet und bis auf den Namen untergegangen, der etwa an einem Felde haften blieb. Die Sage erzählt von Glocken zerstörter Kirchen, die die Soldaten, da sie sie nicht mitnehmen konnten, in Teiche versenkten, und deren Läuten aus der Tiefe zuweilen so betörend erklingt, daß es die, die es vernehmen, auf den Grund zieht. Die einst blühende Stadt war so ausgesogen, daß nicht einmal der Wunsch, sich aus dem Elend zu erheben, die Bewohner belebte. Die Fürstbischöfe, nun unbeschränkte Landesherren, taten nichts für ihre Hauptstadt, außer daß sie ihre Katholisierung vollendeten. Im Maße wie die Bürgerschaft in Armseligkeit versank, schlossen sich die Domherren als adelige Korporation ab, was sich schon im 15. Jahrhundert vorbereitete. Ferdinand II. von Fürstenberg erhob zum Gesetz, daß jeder Adlige, der ins Domkapitel eintreten oder dem Landtage beiwohnen wolle, 16 adlige Wappen vorlegen müsse. Diese Bestimmung gab Anlast zu der besonders reichen Ausschmückung der Epitaphien, die wir im Kreuzgang des Domes bewundern, wo die vielen Wappen mit ihren geschnörkelten Helmen, Tieren und Blättern die Fläche arabeskenhaft ausfüllen.
Das Ende des Reichs war auch das Ende der Bischofsherrschaft; aber der Übergang an Preußen bedeutete keine Erneuerung der früheren Blüte. Was hätte die neue Zeit zunächst auch bringen können als einen Bahnhof, Fabriken, Postgebäude, Strafanstalten und ähnliche Errungenschaften? Den Schwung und künstlerischen Trieb der früheren Jahrhunderte konnte sie nicht wiedererwecken. Befremdet sieht man an der imposanten Front des Jesuitenkollegs zwischen den in neuerer Zeit dort angebrachten Kaiserfiguren zwei moderne Erscheinungen, Wilhelm I. und Wilhelm II. mit Mantel und Krone mittelalterlich maskiert. Immerhin regt sich neues Leben in der alten Stadt, wenn es auch sehr verschieden ist von dem, aus dem sie hervorging.