
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
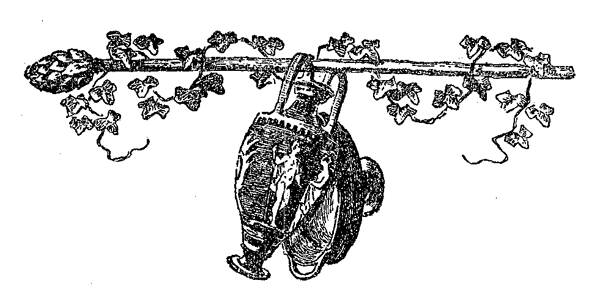
»Ich habe unrecht gegen ihn,
und mich nagt's am Herzen, daß
er es so lebendig fühlt. Kann ich
doch nicht anders.«
(Goethe, Klärchen im Egmont.)
Der Sonntag, an dem die Schölls den Besuch der Frau von Dietrich erwarteten, war gekommen. Heimlich wurden allerhand Vorbereitungen dafür gemacht, Kuchen gebacken, der Salon sorgfältig gesäubert, Blumen in die Vasen gesteckt, Kleider frisch garniert, aber gesprochen wurde kein Wort darüber. Das hätte man unschicklich gefunden. So als könne man die Werbung nicht rasch genug erwarten. Margret ging mit roten Wangen umher, Jeanne verdrießlich, Vater und Mutter sehr zufrieden. Frau Brion hielt es für richtig, die Familie an diesem Tage allein zu lassen. Sie hatte ohnehin jetzt abreisen wollen. War aber durch den Tod einer Verwandten zurückgehalten worden, bei deren Begräbnis sie nicht fehlen durfte. Salome war bereits mit Christian und Sophie, deren Ferien zu Ende gingen, nach Sesenheim zurückgefahren, die Mutter und Friederike wollten morgen folgen. Für diesen letzten Tag hatte – nicht unbeeinflußt durch Frau Brion – Gottlieb sie auf sein Pachtgut geladen. Er selbst holte die Damen ab in einem Einspänner, den er selbst kutschierte.
Es war schon den ganzen Morgen schwül gewesen. Jetzt regnete es. Man mußte Schutzdach und Schutzdecke benutzen und saß gefangen, nur Gottliebs Rücken vor sich, stumm nebeneinander. Friederike hatte glänzende Augen. Sie hustete ein paarmal. Seit dem Dietrichschen Abend war sie in einem beständigen leichten Fieber, das ihr den Schein blühendster Fröhlichkeit gab. Mit Goethe war sie fast jeden Tag zusammen gewesen: im Theater, im Schöllschen Salon, auf Spaziergängen. Freilich niemals zu zweien. Aber das störte sie jetzt nicht. Es war im Gegenteil, als sei es ihnen willkommen, an allzu intimen Aussprachen gehindert zu sein.
Goethe war lebhaft wie immer. Diese Lebhaftigkeit wäre aufmerksamen Beobachtern vielleicht etwas erkünstelt vorgekommen. Aber die Familie freute sich unbefangen an ihr. Der junge Mann gefiel ihnen täglich besser. Man fand Friederike unbegreiflich töricht, die nicht alles daransetzte, den Unruhigen fester zu binden. »Sie dürfe ihn auf keinen Fall ohne Eheversprechen abreisen lassen«, sagte ihr die Tante. Vater Scholl, der sonst nicht recht mit der Jugend auskam, unterhielt sich gern mit Goethe. Er interessierte sich für seine Promotion, tadelte ihn, daß er sie lässig betreibe, ließ sich von ihm die Thesen bringen, über die er zu disputieren dachte. Und begann dann ihm die Zeremonien zu beschreiben, die ihn erwarteten: Die Versammlung aller Standespersonen der Stadt im Zunfthaufe »Zum Spiegel«; dann feierlicher Aufzug mit Musik nach dem Chor der Neukirche; die Pedelle in kostbaren Talaren mit ihren Szeptern; Knaben mit Lichtern; Knaben, die den Doktorhut trugen; die Kandidaten in der Mitte, je drei und drei; endlich die Dekane, Rektoren und Professoren in den Farben ihrer Fakultäten. Dann im Auditorium die Reden, die lateinischen Dispute, an denen sich auch Studierte aus der Korona beteiligen durften. Und dann der Eid. Zum Schluß Chorgesang und Glockenläuten. Der alte Herr wurde warm dabei. Friederike hörte bedrückt zu. Ihre Phantasie, noch immer argwöhnisch in den Wegen des »Zwergenringes« umherspürend, sah in dem Vorgang etwas unendlich Trennendes. Etwas, das den Zeremonien beim Ablegen der Klostergelübde glich. Eine Entführung des vertrauten Freundes aus ihrer kleinen Welt in eine fremde, große, in die sie keinen Einlaß fand.
Seltsam verlassen fühlte sie sich, wie sie da über die Landstraße fuhr und ihr der Nebelregen feine grauen Fäden über das Gesicht spann. – – –
Auf dem Gütchen dann war es behaglich. Zwei große Hunde kamen ihnen freundschaftlich entgegen, es roch nach Obst und Feld, der Misthaufen im Hof blühte. Die Hühner suchten sich ihr Futter darin, Ein weißes Kätzchen sprang im Hausflur direkt in Friederikes Arme. Weich und warm und seidig. Sie lachte, um nicht zu verraten, wie ihr rätselhafte Tränen dabei in die Augen stiegen. Gottlieb hatte die Zimmer mit Blumen geputzt. Überall große, farbige Sträuße. Die Mamsell brachte noch zwei Extrasträußchen für die Damen zum Anstecken, zierliche Blüten aus dem Gewächshaus, blau mit fremdem Duft. Frau Brion sah auf Friederike, die sich vertraulich im Eßzimmer in den Polsterstuhl am Fenstertritt setzte, das Kätzchen mit der Zeitung rascheln ließ, die dort auf dem Fenstersims lag. Und sich zu Hause fühlte. Sie tauschte einen Blick mit Gottlieb: »Sagt' ich's nicht?«
Inzwischen war ein herrliches Frühstück aufgetragen. Gottlieb war ein liebenswürdiger Wirt. Das Herrsein hier im Hause stand ihm gut. Gesprochen wurde nicht sehr viel. Gottlieb war darin schon ein wenig Landmann geworden. Friederiken war es recht so. Alles gefiel ihr hier. Es roch so angenehm nach trockenen Früchten, Vorräten und Leinenschrank. Das Leben schien so einfach, wahrend man mit Gottlieb in seinem Hause war. »Ich bin nicht krank gewesen,« sagte sie mit einmal sinnend, »und fühle mich wie eine Genesende. So schwach und dankbar.«
Nach dem Essen besichtigte man die Ställe, Vieh und Geflügelhof. Zuletzt das Haus. Die Pächterwohnung bestand aus dem Erdgeschoß des ehemaligen »Schlosses«. Die erste Etage, sorgfältig im alten Stand gehalten, blieb für den etwaigen Besuch des Gutsherrn bewahrt, der seit dem Tode seiner Frau das ganze Jahr auf Reisen war.
Auch hier unten in der Pächterwohnung gab es ein paar große, gemütliche Stuben, die leer standen, »Es ist ja freilich eine Familienwohnung«, sagte Gottlieb. Und errötete über sein ganzes braunes Gesicht.
Sie gingen in den ersten Stock hinauf, die schönen Rokokomöbel der Salons und Boudoirs, das schöne Schlafzimmer und die sogenannte »Galerie« zu sehn, ein langer, schmaler Raum mit vielen Fenstern, in dem verbräunte Landschaften, Tierstücke, Schlachtenbilder und Porträts hingen. Vor dem Bilde einer blonden jungen Frau in weißem Idealgewande machte er halt. »Hier stehe ich oft.« Und nach einer Weile zur Mutter: »Finden Sie nicht auch: sie gleicht unserm Riekchen?« – – –
»Du stößt ihn immer weg, den treuen Menschen«, sagte die Mutter, als sie wieder im Wägelchen saßen. Diesmal fuhr ein Knecht. »Er tut mir leid! Und du auch«, fügte sie nach einer Weile leiser hinzu.
Friederike drückte ihr im Dunkeln die Hand. »Ich habe keine Wahl mehr«, erwiderte sie.
Sie schwiegen. Friederike sagte dann nach einer Weile warm und raunend: »Ihr sorgt euch alle so um mich, ihr guten alle. Vertraut mir noch. Ich bin von jeher meinen stillen Weg gegangen. Munter genug freilich. Aber so wird's auch bleiben. Zum Trübsal blasen eigne ich mich nicht. Warum schon vorher tausend Tode sterben, weil man weiß, daß man doch einmal sterben muß? Laßt mich nur, wie ich bin. So bin ich recht.«
Die Mutter nickte einst. »Das gebe Gott!«
