
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das Flyschgebirge, das unter dem Münchner Boden liegt, wird gewöhnlich von seiten der Forschung dem Tertiär zugerechnet. Wenn es trotzdem in diesem Werke teilweise schon mit den Gebilden der Kreidezeit zusammen behandelt wird, so geschah dies, weil seine Entstehung bereits am Ausgang der Kreide anhebt und die Übergänge sich nicht immer leicht feststellen lassen. Zwar im Allgäu gibt es Nummulitengestein (am Grünten), das seinen Petrefakten nach eigentlich dem Eozän angehört, aber unmittelbar auf der Kreide lagert, so daß hier der Flysch ausschließlich dem Tertiär zugehört; aber von hier ab gegen Ost bedeutet der Ausdruck Flysch nicht mehr eine geologisch begrenzte Formation, sondern nur eine gleichmäßige Gesteinsablagerung, welche, je weiter man nach Osten geht, immer älter wird, schon bei Tölz, am Inn und am Ruhpoldinger Teil kretazeische Formen in sich schließt Nach Guembel (Geologie von Bayern) ist der Flysch von Reit im Winkel der Lagerung nach zwar in den oberen Schichten eozänen Ursprunges, da er aber auch charakteristische Leitfossilien der Kreide einschließt (Inoceramen), muß seine Bildung schon zur Kreidezeit begonnen haben., und im Sandstein des Wiener Waldes, der, ein echtes und rechtes Flyschgebirge, ganz altkretazeisch ist. Immerhin ist der überwiegende Teil des in unser Gebiet fallenden Flyschgebirges unteroligozän, soweit er nicht dem Eozän angehört. Denn südlich des norddeutschen Oligozänmeeres bestand ein schmaler Festlandrücken, der von England bis Böhmen reichte und die deutschen Mittelgebirge mit umfaßte. An seinem Südrand war die große Schollensenkung eingetreten (vgl. S. 59), in der sich in einem Flachseekessel der Flysch niederschlug.
Ein ganz großes Drama der Erdgeschichte hatte sich abgespielt, bis es zu diesem Szenenwechsel gekommen war, und es hatte wirklich die »Morgenröte« ( Eozän) einer neuen Zeit gedämmert, die, wie jede neue Zeit, auf dem Leichen- und Trümmerfeld des Alten stand. Die Saurier waren mit Ausnahme der Krokodile und kleinen Echsen ausgestorben; von der Ammoniten tausendgestaltigem Heer lebten nur mehr zwei Gattungen ( Nautilus und Argonauta), von den Brandungsschnecken (Rudisten) war nichts mehr übrig geblieben, die Haarsterne ( Crinoideen) waren am Aussterben, ebenso die Brachiopoden.
Dagegen drängten nun neue Gestalten sich auf die freigewordenen Plätze. Die Säugetiere, die seit der Trias eigentlich nur vegetierten, in Gestalt weniger Beutler, harmloser Insektenfresser und einiger kleiner Raubtiere, beginnen sofort sich auszubreiten. Schon leben Paarhufer, auch sehr ansehnliche Rüsseltiere, Seekühe, Vorläufer der großen Raubtiere. Bald entstehen Fledermäuse, die Vorläufer der Wale – mit einem Wort: der wunderbare Prozeß der Eroberung aller Lebensräume, der den Sauriern im Mesozoikum die Herrschaft über die Erde verliehen hatte, wiederholt sich nun auf höherer Lebensstufe. Auch die Schnecken und Muscheln kommen jetzt zu ihrer höchsten Blüte, gegen die ihre heutige Vielgestaltigkeit nur mehr ein Nachklang und Überbleibsel ist. Die Pflanzenwelt tritt in die Phase ihrer höchsten Entfaltung und berechtigt mit ihrer Entwicklung im Miozän zu dem merkwürdigerweise von der Botanik nicht genügend beachteten Satz, daß sie den Höhepunkt ihrer Gesamtentwicklung überhaupt bereits überschritten zu haben scheint. Und noch eine Tiergruppe tritt nun aus dem Dunkel eines unbeachteten Seins plötzlich zu der Geltung hervor, eine »gesteinsbildende Macht« zu sein, die Felswände von Hunderten Meter Höhe aufbaut. Das sind die Nummuliten, jene Foraminiferen, die im Eozänmeer von England bis Afrika und zum Himalaja, Hinterindien bis Australien und Neuseeland in merkwürdiger Übereinstimmung mit dem einstigen variskischen Faltenwurf der Erdrinde in seltener Gleichförmigkeit die Flachseeküsten mit Formen bevölkerten, deren größter Durchmesser mit 6 cm etwa das hundertfache der größten Foraminiferen von heute betrug. Es waren also Riesenformen in dem Verhältnis, wie wenn damals Menschen von 200 m Höhe gelebt hätten! Dazu lebten sie in derartigen Mengen, daß ihre zu Boden sinkenden Kalkschalen, durch wenig Kalkschlick verkittet, ein Gestein bildeten, das (wenigstens in den eozänen Nummulitenkalken des ägyptischen Mokattam, die ich untersucht habe) reichlich Coccolithoporiden einschließt. So entstehen die harten, oft mehrere hundert Meter dicken, bankigen Nummulitenkalke, deren Wände auch das Münchner Becken umsäumen. Imkeller H. Imkeller, Die Kreide- und Eozänbildungen am Stallauer Eck und Enzenauer Kopf bei Tölz. Ein Beitrag zur Geologie der bayerischen Alpen. München, 8°, 1896. hat in seiner schönen Abhandlung über den Alpenrand bei Tölz die wahrhaft wunderbar reichen Aufschlüsse im Eozän des Enzenauer Grabens beschrieben, wo in den Marmorbrüchen eine unbeschreibliche Fülle von Nummuliten inmitten einer reichen Fauna von Krebsen, Seeigeln (besonders charakteristisch für das Eozän ist Conoclypeus conoideus) aufgeschlossen ist.
Ein anderer Fundort, dessen Profil E. Fraas mitgeteilt hat, befindet sich bei Neubeuern am Inn und hat für eine Geschichte des Münchner Bodens schon deshalb besondere Bedeutung, weil die Werksteine der Sinninger Granitmarmorbrüche in vielen Münchner öffentlichen Bauten Verwendung gefunden haben. Sehr schön sieht man hier zugleich in die Vorgänge hinein, welche diese ersten Erhebungen am Rande des Münchner Beckens geschaffen haben. Man sieht, wie ungeheuerlich aufgefaltet und gestört diese ursprünglich wagrechten Schichten sind, außerdem, in welcher mannigfachen Ausprägung hier die Bildungsverhältnisse vom Ende der Kreide an über das Eozän bis zum Flysch abwechselten. Der Felsen von Neubeuern, welcher das Schloß trägt, besteht aus festem, eisenhaltigem Nummulitensandstein. Daran schließen sich gewesene Dünen, heute weiche, sandige Mergel an, erfüllt von großen Nummuliten und Versteinerungen, besonders Austernbänke, Spatangiden und andere Seeigel; darunter auch der bereits genannte Conoclypeus. Gelegentlich vorhandene Haifischzähne, Schnecken, Nautilusarten, Korallen und Krabben geben unserer Phantasie weitere Anhaltspunkte, sich das Bild der Münchner Gegend um den Übergang von der Kreide- zur Neuzeit auszumalen. Hier findet sich dann auch, in großen Steinbrüchen abgebaut, der Granitmarmor (den man jetzt besonders im Treppenhaus und an den Säulen der Pinakotheken studieren kann). Er erscheint wie ein Granit, grau und hell, erweist sich aber bei näherer Betrachtung als das Material eines mächtigen Kalkriffes, gebildet aus kleinen, kugeligen Kalkalgen ( Lithothamnien), zwischen denen ein schlammiges Bindemittel (Ton) liegt, in dem zahlreiche Nummuliten eingeschlossen sind. (Vgl. Abb. 10.)
Alle diese Bildungen deuten auf eine Flachsee, einen relativ schmalen Meeresarm zwischen dem Atlantischen und Stillen Ozean, der auch an den Alpen vorüberzog. Vieles von den Sedimenten dieses seichten Meeres, dessen Ufer wohl von München an allen Stellen sichtbar waren, dessen blaue Gewässer die Glut eines südlichen Himmels widerspiegelten (die Nummuliten sind Warmwasserformen), ist infolge ihrer Jugendlichkeit und durch die ihnen folgenden Ereignisse überhaupt nicht mehr verfestigt worden. Wohl gab es noch jahrtausendelang nach ihnen Meeresbedeckung, aber nur mehr relativ geringfügige Sedimente, und dann folgten nur mehr Süßwasser-, Sumpf- und Landbildungen, die nur noch wenig Material niederlegen. Infolgedessen sind die tertiären Kalke und Sandsteine, also die Gebirge des Eozäns, der Flysch- und Molassezone zumeist weich (geeignet als Bausteine), oft sogar gar nicht verfestigte Sande, Tone und Mergel. In dieser Form, als Nummulitenkalke, Sandsteine, da und dort als Granitmarmor, Mergel (Zementmergel) und freier Sand, muß das Eozän auch unter München ausgeprägt sein und kann in schief gerichteten und gefalteten Schichten, da es von der Gebirgsbildung mit erfaßt wurde, mehrere hundert Meter der Tiefe nach erfüllen.
Die Gebirgsfaltung setzte zwar im Eozän auf der Hochebene selbst noch nicht ein; auch im eigentlichen Alpengebiet beschränkt sie sich nur auf ähnliche vorbereitende Vorgänge, wie wir sie eigentlich seit der Karbonzeit, energischer vor sich gehend, seit der Kreidezeit verfolgt haben.
Erst am Ende des Eozäns und bei Beginn der Oligozänzeit tritt die für die gesamte Alpenbildung wichtigste Phase ein. Die früher durch leise Prozesse schon gelockerten Schollen stauchen sich jetzt auf einmal durch einen Schub von Süden her auf, werden übereinander geschoben, hoch empor gepreßt und mehrfach an 100 km weiter nördlich transportiert. Schollen aus dem Pustertal finden sich dann in der Nordrandkette wieder (die Benediktenwand wird z. B. als eine solche angesehen), die so lange Zeit rätselhafte »Überschiebung« beginnt im Oligozän und wird bis zum Miozän beendet.
Der gleiche Prozeß, den man an den Sedimenten des Triasmeeres verfolgen konnte, setzt wieder ein mit den Ablagerungen der Flyschzone. Unmittelbar nach ihrer Deponierung werden sie auch schon aufgefaltet. Gerade an ihren weichen, plastischen Massen fand die erdbildende Kraft ein besonders dankbares Betätigungsfeld: sie wurden zerknittert, verbogen, aufgeblättert und gefaltet wie die Blätter eines Buches. Jetzt erfolgte die erste Aufwölbung der Hochebene, die das Eozänmeer hinausdrängte; dann kam das mechanisch unvermeidliche (in der Geologie nur von Heim genügend berücksichtigte) Zurücksinken, das eine oligozäne Transgression zur Folge hatte. Nummulitenkalke und Flysch wurden abgetrennt von dem eigentlichen Gebirgsland und für sich gefaltet im Osten; im Westen dagegen so energisch in den Strudel der Ereignisse gezogen, daß sozusagen keine Schichte mehr ungestört blieb. Im Mittellandstrich, zu dem das Münchner Feld gehört, halten sich beide Erscheinungen den Wagbalken; der Flysch, das Eozän und die Kreide, teilweise sogar noch der Jura (Liaskalke), wurden tief aufgewühlt, wie nach rückwärts (also nach Süden) gebogen, und von triassischem Material überlagert.
So kommt es, daß fast alle Voralpenberge mit Hochgebirgscharakter (vom Wendelstein bis zum Ammergebirge in unserer Zone) auf einem Sockel jüngerer, manchmal jüngster Gesteine ruhen; so entstand eine Komplikation des tektonischen und des geologischen Baues, der das bayrische Hochland mit seinem besonderen Reiz der Mannigfaltigkeit schmückte, die aber in Kürze darzustellen über die Kraft geht, so daß ich fürchte, daß es mir nicht gelungen ist, ein nur annähernd übersichtliches Verständnis dafür zu erwecken.
Von den Alpen ging eine Art Weltrevolution aus, die sich fortschreitend im Verlauf des Tertiärs gegen Osten verbreitete und nach und nach alle großen Kettengebirge von heute nach sich zog. Dadurch wurde ein uraltes, auch in unseren Betrachtungen schon seit vielen Seiten immer wieder die Münchner Verhältnisse beeinflussendes Gebilde beseitigt, nämlich der Weltozean Thetys. Von da ab, als das »Dach der Welt«, der Kaukasus, die Alpen, der Apennin, die Pyrenäen aus ihm emporstiegen, wie um das große Gesetz des Schollengleichgewichts zu bekräftigen, ist er als Weltmeer verschwunden und zurückgedrängt auf das kleine Mittelländische Meer, das heute noch als sein letzter Rest erscheint.
Ein flachgründiges Überbleibsel der Thetys war auch der Meeresarm des Münchner Oligozäns, in den von großen, alpinen Strömen mit starkem Gefälle aller Erosionsschutt der Nordabdachung der Alpen geleitet wurde. Dieses Meer brandete an den Küsten der Tölzer Berge (es finden sich dort in den Tälern der verschiedenen Lainen Brandungskonglomerate). Die Flüsse der Alpen konnten daher nur kurzen Lauf, sie mußten notwendigerweise ein um so steileres Gefälle besitzen. Hand in Hand damit ebenso intensive Erosionskraft. Wieleitner H. Wieleitner, Schnee und Eis der Erde. Leipzig 1913, 8°. gibt Zahlen, durch die man sich anschauliche Vorstellungen von der dadurch erzielten Denudation machen kann. Die Erosion erniedrigt bis zu Höhen von 600 m das Gebirge erst in 14 300 Jahren durchschnittlich um einen Meter. In Höhen von 1800-2400 m arbeitet sie rascher. Zur Erniedrigung der Kammhöhe um einen Meter braucht sie nur 11 000 Jahre. In Höhen von rund über 3000 m verlangsamt sich das auf 4000 Jahre.
Da man nun aus gewissen Anzeichen Grund hat zur Annahme, daß von der Kammhöhe der Alpen an 10 000 m fortgenommen worden sind und der Großteil dieser Leistung in das Tertiär fallen muß (weil dem gesamten Diluvium auch die ausschweifendste Schätzung nicht mehr als eine Million Jahre zubilligen kann), so hat man doch gewisse Anhaltspunkte dafür, um die Länge der Zeit, die seit dem Oligozän verflossen ist, und die Mächtigkeit der tertiären Berggewässer zu beurteilen. Einer dieser beiden Faktoren muß außerordentlich gewesen sein.
Dieser Erosionsschutt lagert als Molasse in dem oligozänen Münchner Becken. Er war es, der die entstandene Mulde (vgl. S. 73) hauptsächlich auffüllte.
Woraus bestand dieser Erosionsschutt? Das ist mit Sicherheit und unschwer zu sagen. Aus den zerriebenen Gesteinen der Hochalpen. Und zwar kommen im Unteroligozän viel weniger die Kalkalpen (sie waren zum größten Teil noch nicht an Ort und Stelle), wie die kristallinischen Massive in Betracht. Von ihnen führten die Ströme das tausendfach zerkleinerte Schuttmaterial herunter und lagerten es in der Flachsee als Sand, weiter draußen als Schlamm (toniger Schlick) ab. Demzufolge besteht die oligozäne (auch noch die miozäne) Meeresmolasse aus Sandstein oder sogar noch aus losen Sanden, die bald sehr grobkörnig sind ( Graupensand), was sich sehr wohl mit dem kurzen Lauf der Flüsse eint, bald wieder, weit draußen in der heutigen Ebene, durch den Wellenschlag zerrieben und fein ( Pfohsande In sonstigem schwäbischen Gebiet unterscheidet man im Bodenseegebiet einen untersten Horizont als Austernnagelfluhe- und Citharellenschichten, weiter nördlich (in der Ulmer Alb) als »jurassische Nagelfluhe«. Höher liegt die Erminger Turritellenplatte, dann jene des Rorschacher Bausandsteins, die als Tiefseebildung anzusprechen ist. Hierauf folgen die echten Strandbildungen entlang dem Donaurand (Küste des oligozänen Meeres), mit den ins Miozän reichenden Gesimssanden (vgl. S. 66). Als Leitfossilien gelten in Schwaben: Ostrea crassissima, Cardium commune, Turritella turris, Balanis pictus, Tapes Ulmensis und Haifischzähne. (Nach Th. Engl, Geolog. Exkursionsführer durch Württemberg. Stuttgart 1911, 8°).) und Gesimssande, weil sie oft kalkreichere, mergelige Lagen in sich bergen, die dann bei ihrer schwereren Verwitterung gesimsartig vorkragen, oft aber auch Konglomeratcharakter tragen, was auf besondere Verhältnisse hinweist. Es müssen gleich nach der Alpenerhebung gewaltige Überschwemmungen und Hochfluten eingesetzt haben, die das gelockerte und zertrümmerte Gesteinsmaterial mit Schlamm und Kalksand noch unverarbeitet zu Tale brachten. Das Schuttmaterial der Bergabhänge und Täler wurde bei diesen Katastrophen, die wir uns sehr großartig denken müssen, ins Meer gerissen. Großartig müssen sie deshalb gewesen sein, weil diese (im besonderen ist die Schweizer Meeresmolasse damit ins Auge gefaßt) Konglomerate viele hundert Meter dick, die einzelnen Steine außerordentlich groß (also die sie bewegenden Wassermassen sehr gewaltig) sind. Es fehlen in dieser zu einer lockeren Nagelfluhe verkitteten sog. unteren Meeresmolasse fast alle Versteinerungen, was auf ein wenig besiedeltes, weil viel aufgestörtes Meer schließen läßt. Die ab und zu vorhandenen Austern, Natica, Cythereaarten und anderen Muscheln sind vornehmlich solche, die in Trübwasser zu existieren vermögen; sie bestimmen das Alter dieses fruchtbarsten Schweizer Gebietes, das vom Elsaß und Basel bis ins tiefe bayrische Becken übergreift, als mitteloligozän und läßt sie sich sofort an den Flysch anschließen.
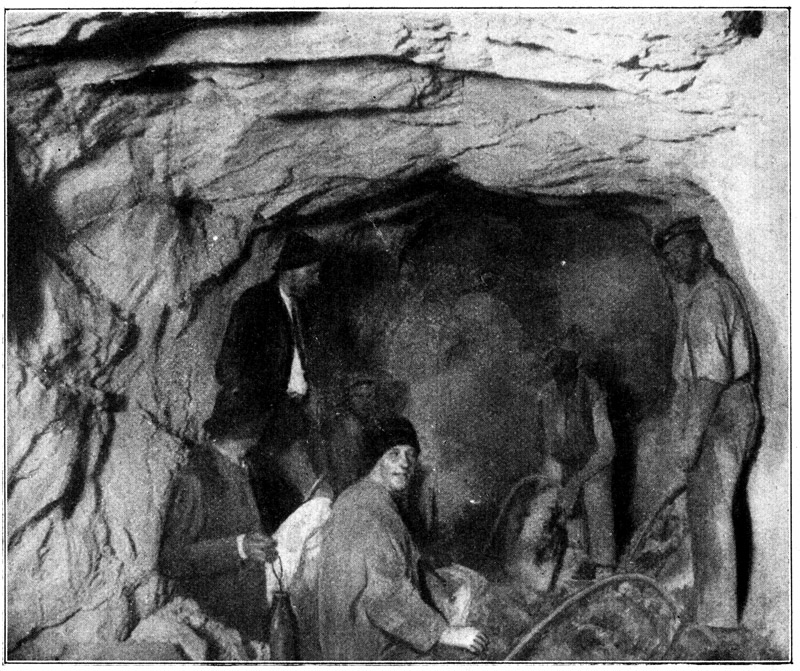
Abb. 18. 700 Meter unter dem Boden Münchens. Der Charakter der oberoligozänen Molasse unter der oberbayerischen Hochebene. Bohrstollen in dem Kohlenbergwerk von Hausham. (Originalaufnahme von Frau Dr. A. Friedrich.)
Die Molasse erscheint demnach als eine unmittelbare Konsequenz der Gebirgsbildung, die uns die Berechtigung gibt, auch als Hangendes aller großen Auffaltungen der Vergangenheit, die zu unseren Füßen begraben sind, stets eine solche Schuttmasse einzuzeichnen (vgl. Abb. 9). Drei dieser Konglomerate ruhen bereits unter der Molasse, von denen jene, die unter den Tonschiefern der oberkambrischen Thetys liegt und aus dem Erosionsmaterial des archäischen alpinen Kernes zusammengesetzt ist, noch am ehesten ähnlichen Charakter wie die Meeresmolasse haben mag; die anderen tragen limnischen Charakter, wie er auch der oberen Molasse des Tertiärs zukommt.
Über die Tektonik und Versteinerungen der oberbayrischen Meeresmolasse sind zahlreiche Aufschlüsse gesammelt worden durch Tiefbauten und Kohlenbergwerke am Gebirgsfuß, so daß sich ein viel befriedigenderes Bild von diesem Teil des Münchner Untergrundes entwerfen läßt, denn von jedem der bisher betrachteten.
Guembel, Weithofer, Koehne u. a. haben gezeigt, daß in der oberbayrischen Molasse zwischen Salzach und Lech drei Hauptfaltenzüge verlaufen. Die südliche, aus Cyrenenschichten und »unterer bunter Molasse« bestehende Auffaltung reicht aber nur bis an den Kochelsee, wo sie an einer vorspringenden Alpenstaffel abstößt. Die mittlere, die als untere Meeresmolasse und als brackische Cyrenenschichten bei Tölz zutage tritt, reicht bis zum See. Die nördliche verläuft bis zur bayrischen Grenze. Von ihnen ist namentlich die mittlere Faltenzone durch die Haushamer, früher Miesbacher Grubenbaue, in etwa 15 km Erstreckung aufgeschlossen. In drei Förderschächten sind hier Profile bis etwa 800 m Tiefe aufgenommen worden und ein genaues Bild der oberbayrischen Erdrinde entworfen.
Um 1911 wurde dazu für Zwecke der oberbayrischen Überlandzentrale bei Miesbach im Leitzachtal noch ein etwa 7 km langer Wasserstollen quer auf die Molasseablagerungen getrieben, durch den die gesamte Schichtenfolge des oberen Oligozäns und unteren Miozäns im Voralpenland zur Anschauung gebracht wurde.
Außerdem haben die Aufnahmen der staatlichen Braunkohlengruben von Penzberg und Peissenberg genaue Aufschlüsse gewährt, so daß das Tertiär des Münchner Beckens zu den beststudierten Teilen der Erdrinde gehört.
Wenn man aus den auf diesem Weg erlangten tausendfachen Detailkenntnissen jene Einzelheiten heraushebt, die im Rahmen unseres großen Zieles von Bedeutung sind, so mag es vor allem die Tatsache sein, daß die Molasse eine Mächtigkeit von 800-1000 m besitzt. Die Reihenfolge der Schichten im Leitzachstollen setzt diese Zahl (vom Liegenden zum Hangenden) in folgender Weise zusammen: 1. Bausteinzone, 2. Cyrenenschichten (Brackisch – identisch mit dem Hangenden der Haushamer Flöze), 3. Penzberger Glassande, 4. Bromberger Schichten (graue Mergel mit Turritellen, Cyprinen usw.), zusammen etwa 320 m mächtig, 5. Wieder Cyrenenschichten (entsprechend den Penzberger Flözen) etwa 150 m mächtig, 6. Eine Störungszone von 250 m, bestehend aus Cyrenenschichten, weichen Fleckenmergeln (jüngere bunte Molasse) und fast lose Quarzsande, 7. Obere Meeresmolasse mit Sanden, etwa 435 m mächtig, bereits miozän, 8. Obere Süßwassermolasse mit Landschnecken. Zusammen entfallen auf die marine und brackische Molasse 1150 m, von denen man etwa 200 m der Störungszone abziehen darf. (Vgl hierzu K. Weithofer, Über neuere Aufschlüsse in den jüngeren Molasseschichten Oberbayerns. Verhandlungen der Geolog. Reichsanstalt. Wien 1912.) Das Oligozän und Miozän umfaßt demnach eine außerordentliche Zeitspanne, in der überaus bemerkenswerte Naturkräfte am Werke waren.
Die Haushamer Molassebildungen, die mir durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Bergrates Weithofer aus wiederholter eigener Anschauung bekannt wurden, umschließen nebst vielen geringen auch zwei bauwürdige Pechkohlenflöze (Großkohl und Kleinkohl), welche höchst Vielsagendes über die Störungsvorgänge verraten, denen der Untergrund des Münchner Beckens ausgesetzt war und noch ist (vgl. Abb. 18).
Nicht nur, daß der Südflügel dieser Flöze überkippt ist, also von einer ungeheuren Pressung von den Alpen her weit über die Mulde, in der die Flöze liegen, nach Norden überschoben wurde, sondern das ganze Gebiet ist außerdem noch von zahlreichen Verwerfungen durchzogen, daß die Schichten oft wie Schuppen übereinander gepreßt sind. Die zwei Flöze, welche abgebaut werden, verlaufen streckenweise parallel und sind 5-9 m voneinander entfernt. Sie sind oft in ansehnlichem Winkel aufgerichtet, so daß der Abbau schon dadurch sich höchst mühevoll gestaltet. Ihre Mächtigkeit beträgt selten mehr denn einen Meter und man ist vielenorts gezwungen, vor Ort sich liegend durch enge Gänge von nur 60-80 cm Weite, die steil abfallen, hindurchzuschieben und kletternd von Stempel zu Stempel Halt zu suchen. Immer wieder trifft man hierbei zerknickte Stempel, als Zeichen, wie intensiv die Kohle »arbeitet«. Es herrscht ein außerordentlicher Gebirgsdruck, der auch von Zeit zu Zeit den Stinkstein und harten Kalkmergel hereindrückt und Anlaß zu plattigen Ablösungen des Hangenden, und dadurch zu Unglücksfällen gibt. Am 21. Dezember 1910 erfolgte durch die enorme Gebirgsspannung ein 200 m langer Zusammenbruch mit solcher Gewalt, daß das dadurch erzeugte Erdbeben von den seismographischen Apparaten Münchens aufgezeichnet wurde; ähnliches ereignete sich am 21. August 1912 und 12. Dezember 1912. Näheres hierüber in K. A. Weithofer, Über Gebirgsspannungen und Gebirgsschläge. Jahrbuch der Geolog. Reichsanstalt. Wien 1914.
Diese Gebirgsschläge wären nicht möglich, wenn nicht der einseitige Schub nach wie vor im alpinen Gestein des Vorlandes andauern würde, als sicheres Zeichen, daß die Alpenfaltung noch immer nicht beendet ist. Sie gibt sich schon rein äußerlich an den zahlreichen Erdbeben kund, die den ganzen Alpenzug Jahr um Jahr durchschüttern und meist auch in München merkbar sind. Sie brauchen keineswegs immer so katastrophal aufzutreten, wie das große, noch in allgemeiner Erinnerung stehende Erdbeben von Klagenfurt; dem aufmerksamen Wanderer in den Hochalpen treten allerorten auch sonst die Zeugnisse von Wandspaltungen, Schichtenlösungen und Felsschlägen als Folge dieser kleinen Beben entgegen. Im Münchner Ausflugsgebiet sei nur an solche Erscheinungen am Wendelstein, ganz besonders an den »Durchschlag« am Weg vom Lafatscher Joch zum Halleranger Haus erinnert.

Abb. 19. Muschelablagerung aus den Cyrenenschichten in der oberbayerischen Braunkohle als Beweis der brackischen und teilweise auch Süßwassernatur der Waldsümpfe, in denen sich diese Kohle bildete. Das erdige Kohlenstück ist im Profil aufgeschlagen, so daß man die Muscheln im Querschnitt sieht. Ihre große Zahl verrät, daß hier der Schlammgrund eines Weihers vorliegt, in dem sich Generation um Generation toter Bivalven anhäufte. (Original im Bergwerk zu Hausham.) [Näheres s. S. 73.]
Von diesen Störungen wurde ein relativ weiches Gestein erfaßt, als sie die Molasse angriffen. Dadurch kam es in ihr zu viel weitergehenden Aufstauchungen und Dislokationen als im zentralen Kern der Alpen selbst. Als Gesteine kommen dabei in Betracht vorwiegend Kalke, Mergel, Sande und Sandsteine.
In der immerhin ansehnlicheren Senke des bayrischen Voralpengebietes schlugen sich im Mitteloligozän Sande, Tone und Kalke nieder, deren Leitfossil die schöne Auster Ostrea callifera ist. Dieses Meer wurde von den schon mehrfach erwähnten ungeheuren Stromeinbrüchen des Gebirges ausgesüßt, da es vom Verkehr mit dem Weltozean ziemlich abgeschnitten war. Daher liegen schon im Oberoligozän brackische Schichten und sogar Süßwasserkalk Süßwasserkalke sind See- und Sumpfablagerungen von geringer Mächtigkeit, in denen als Kalkbildner nur Conferven und Characeen in Betracht kommen. Ueber die Rolle der ersteren s. meine Abhandlung: Francé, Die Flora des Gánóczer Confervites. (Mitteil. der K. ung. geolog. Gesellsch. 1896.) darüber. Da in ihnen massenhaft als Leitfossil die Muschel Cyrene semistriata eingeschlossen ist, werden diese Kalke und Mergel mit Recht als Cyrenenschichten bezeichnet. In Hausham erblickt man oft dieses »Muschelblatt« über seinem Kopf mit Hunderten von Muscheln gespickt (Abb. 19). Die Pechkohle von Penzberg, Peissenberg und Hausham ist an diese Cyrenenschichten gebunden.
Über ihnen liegt die obere Meeresmolasse und wieder ein Süßwasserhorizont, der reichlich Helix sylvana einschließt. Von diesen » Sylvanakalken« (oberer Süßwasserkalk), die im allgemeinen etwas lichter und weicher sind, als die unteren Süßwasserkalke, nimmt man an, daß sie Kalksinterabsätze aus Quellen (im Westen auch aus heißen Quellen nach Art der Karlsbader) sind. Ihr Material ist übrigens nicht immer Kalk, oft genug Mergel und Ton, auch (gegen das südliche Oberschwaben) reiner Sand, der nach den vielen zapfenförmigen Einschlüssen den Namen Zapfensand erhalten hat. Versteinerungen führt dieses obermiozäne Material kaum, außer den genannten Weinbergschnecken und einer Art » Blätterkohle«, in der man fast immer das dreinervige Blatt des Zimtbaums unterscheiden kann. In den oberen Lagen folgt dann allenthalben jener weiche, mergelreiche Sand ( Flinz), den die Münchner Brauereibrunnen angebohrt haben.
E. Fraas E. Fraas, Szenerie der Alpen. 8°, 1892, S. 280 gibt hierfür eine sehr übersichtliche Tabelle, welche den tertiären Münchner Untergrund in seinem Aufbau auf das klarste so verständlich macht, daß ich nicht umhin kann, sie mutatis mutandis hierher zu setzen:
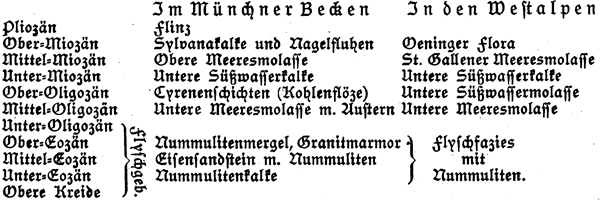
Wenn ich dieses Bild im einzelnen noch ausmalen darf, so möchte ich einiges über die sehr vielsagenden Lagerungen hinzufügen, die durch den Peissenberger Kohlenbergbau erschlossen wurden:
Im Vorland erheben sich gleichsam als Schaugerüste der Alpen vereinzelte, fast 1000 m Seehöhe erreichende Bergzüge (Auerberg, Peissenberg, Taubenberg), welche, aus tertiärem Material aufgefaltet, nach einer bestechenden Ansicht Guembels bei den tertiären Krustenbewegungen an dem noch stehenden Wurzelstock des vindelizischen Gebirges aufgestaucht sind. Manche von ihnen durchbrechen heute noch die glazialen Decken (dies gilt namentlich für den Peissenberg), andere stecken als Aufwölbungen unter ihnen (so erklärt sich z. B. die beträchtliche Seehöhe (700 m) der Ammerseeufer).
Am Auerberg ist nun die obere Meeresmolasse, welche an diesen Gebirgsbildungen hauptsächlich beteiligt ist, in eine große Falte zusammengebogen; sie schließt dadurch auch die jüngere Molasse ein und zieht dann zum Peissenberg. Als Zeugen ihres Alters birgt sie bei Stötten eine prachtvolle Bryozoenbank und im Stöttner Graben in Sanden eine reiche Meeresfauna, sowie auch Reste von verkohlten Baumstämmen ( Lignit).
Der Peissenberg selbst besteht aus der mittelmiozänen Meeresmolasse, auf die sich im Süden eine limnische Nagelfluh lagert. Man erkennt sie gut im tief eingeschnittenen Ammertal. Der Bergrücken ist fast ganz mit dem Schutt der Eiszeit wie mit einer löcherigen Decke umhüllt: nur am Gipfelrücken stehen, steil aufgerichtet, als Beweis der enormen Faltung, die festen Konglomeratbänke der Molasse selbst an.
Was sich an einzelnen Aufschlüssen im Ammertal und Kohlgraben verrät, ist wie in einer Übersichtszeichnung aufgeschlossen, wenn man in das staatliche Bergwerk Peissenberg, das seit 1836 besteht und mit einer Kohlensortieranstalt verbunden ist, einfährt.
Der Unterbaustollen durchörtert zunächst Schutt, Sandsteine, Mergel, Stinkstein mit Land- und- Süßwasserkonchylien, die in Kalk eingebettet sind, dann Mergel mit Cyrenen, auffallend weiße Sandsteine und gelangt dann gleich zu mächtigen, fast 1-1,5 m reiner Pechkohle führenden Flözen im Beginn der oberen Meeresmolasse. Auch hier ist das Abbaufeld durch Verwerfungen gestört und aufgestellt wie in Hausham.
So wie dort lassen sich auch hier im Hangenden Eichenblätter sammeln, im Liegenden große Malermuscheln ( Unio) und dicke Austern im Sandstein. Die oberoligozänen trefflichen Zementmergel, auf welche der Abbau wiederholt stößt, werden sogar ausgenützt. Die Kohle selbst findet sich in den Cyrenenschichten, über denen obere Meeresmolasse und Sylvanakalke, dann weiche, mergelreiche Sande lagern. Ab und zu trifft man auf bituminösen Stinkstein, welcher mit dem Sandstein und den kohligen Mergeln die Flöze begleitet, die eine von einer mageren Steinkohle nicht zu unterscheidende gute Kesselkohle (Abb. 20) mit etwas Schwefelkies von 6527 max. W. E. liefern.
Allenthalben bot der Bergbau eine reiche Flora und Fauna, aus der sich das Bild des oligozänen Münchner Beckens farbig und plastisch erhebt. Austern, Mießmuscheln, Wandermuscheln, Sumpfschnecken, Kreisel-, Schließmundschnecken und Weinbergschnecken deuten auf eine seichte Meeresbucht, die sich allmählich aussüßt und zu einem pflanzenreichen Sumpf wird, in dem sich in buntem Gemisch ein Dickicht von Feigen- und Zimtbäumen, Faulbaumsträuchern, Nußbäumen, Eichen und Birken erhebt, zwischen dem große Adlerfarne und Sauergräser wuchern, während an stillen Armen Lotosblumen Idyllen in dieser grünen, halb tropischen Wildnis Im Besonderen ergab die Fauna von Peissenberg: Dreissena, Ostrea, Mytilus, Arca, Cytherea, Cyrene arcuata, Corbula, Dentalium, Neritina, Paludina, Melanopsis, Cerithium, Cyclostoma, Buccinum, Planorbis, Helix, Clausiliaarten. Als Spezialitäten: Arca Guembeli, Cytherea subercynoïdes, Cerithium Sandbergeri. In den Cyrenenmergeln auch die 2 m lange rätselhafte Daemonhelix Krameri, in den Zementmergeln ein prachtvoller Stachelflosser ( Ephippites Peissenbergensis vov. gen.). (Vgl. Ammon in den Geognost. Jahresheft. 1900.) Die Flora umfaßt vorwiegend Arten von Cassia, Cinammomum, Juglans, Quercus, Sapindus, Dryandroides, Nelumbium, Pteris, Cyperus, Chara, Ficus, Acerates, Rhamnus, darunter Ficus Martiusi, Acerates Guembeli usw. einschieben.
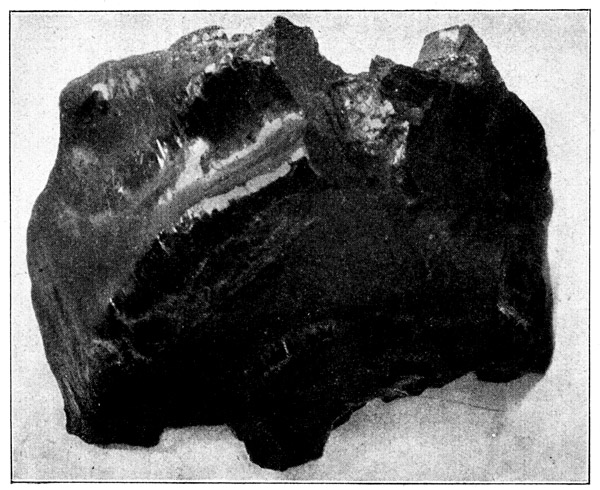
Abb. 20. Haushamer hochglänzende Pechkohle als Beispiel der hochwertigen Braunkohle im Untergrund der Münchner Hochebene. (Original.)
Es besteht also große, eigentlich völlige Übereinstimmung mit den Verhältnissen von Hausham, so daß in weiter Verbreitung die gleichen Lagerungen auch unter dem Münchner Untergrund selbst angenommen werden können, abgerechnet hierbei die lokale Bedingtheit der Braunkohlenwälder und die gegen die Ebene zu ausrollenden Bodenwellen. Näher zu München bestehen verschiedene Aufschlüsse, welche das Behauptete erhärten können. Wenn die mitteloligozäne Molasse von Hausham meist Sande und Gerölle (aus Gneisen und Glimmerschiefern) führt, welche kleine Flöze in sich schließen und von Meeresmuscheln ( Cardium) und brackischen Formen ( Cyrenen) durchsetzt sind, gewinnt man auch da den Eindruck eines ganz seichten Meeresarmes, in den maßlos viel Erosionsschutt durch sich immer wieder folgende Hochwässer herabgeschleppt wurde, bis er ausgesüßt war, worauf dichte Wälder an seiner Stelle grünten. Diese marine Molasse streicht aber auch noch zwischen Schäftlarn und Rimslrain an der Isar (also ganz nahe zu München), ebenso bei Tölz aus; sie besteht auch hier aus Sandsteinen, die Herzmuscheln ( Cardium), Corbula, Natica-Arten und dergleichen führen. An anderen Stellen trifft man hier aber auch wieder die im Brack- und Süßwasser gebildete obere Molasse. Und an zahlreichen Brüchen kann man erkennen, wie diese Massen noch im Diluvium durcheinander geschoben wurden.
Faßt man alles zusammen, so ergibt sich also etwa folgendes Bild. Die Meeres- und Brackwassermolasse keilt von der Schweiz gegen Oberbayern zu aus und hört in Oberösterreich wirklich auf. Im Allgäu wurde sie so mächtig von der Gebirgsbildung erfaßt, daß sie sogar noch ins Hochgebirge hinein gefaltet wurde. In Oberbayern wurde sie an einem im Norden liegenden Riegel noch immer zu so ansehnlichen Bergkuppen, wie der Auerberg, Peissenberg, Taubenberg, Irschenberg, aufgestaucht. Zwischen diesem und dem Alpenfuß war die Niederung am ansehnlichsten. Das von Westen eindringende Meer hielt sich hier zwischen Lech und Salzach am längsten und setzte die versteinerungsreiche ältere Meeresmolasse ab. Aber die großartigen Flüsse, die sich aus dem Alpengebiet brausend darein ergossen, verwandelten diese See bald in einen Brackwassersumpf (Oberoligozän), in dem Sumpfwälder, teils nach Art der Taxodienwälder der amerikanischen Swamps (Föhren sind erhalten in dem kleinen Bergwerk von Groß-Weil bei Schlehdorf), teils ein subtropisches Dickicht von Laubbäumen grünten, was auf ein Klima von 18-20° C, also das Klima Ägyptens bei reichlichem Regen, hinweist. In diesen Sümpfen setzten sich auch Kalktuffe ab und bei Unwetterkatastrophen fanden wahre Murbrüche von Geröllen aus den Alpen statt. Dadurch kam es zur Braunkohlenbildung.
Im Miozän ereignete sich ein neuer Meereseinbruch, der ebenso ausgesüßt wurde, wie die älteren, bis auf kleine Buchten bei Simbach, Günzburg a. Donau. Jetzt lagerte sich die obere Süßwassermolasse in einem Sumpfland ab, die heute noch (Oeninger Stufe) die Hauptgrundlage des Bodens in Oberschwaben und des Landes zwischen dem Alpenrand, von der Iller bis zur Salzach und der Donausenke ist. Auch in ihr wiederholten sich noch die Bedingungen der Kohlebildung (Trauntaler Kohle) und die Bildung von Süßwasserkalken, sowie die Überschüttung mit Quarzgeröllen. Die Aufschlüsse um Augsburg, Günzburg, sowie die geologischen Verhältnisse der Umgebung von Dachau geben hierüber alle wünschenswerten Kenntnisse.
Bevor ich mich ihnen aber zuwenden darf, muß ich den großen Rahmen des Begriffes der Oeninger Stufe ausfüllen und vor allem versuchen, in einigen Strichen die Verhältnisse des Jungtertiärs zu skizzieren.
Soweit es noch eine marine Fauna hat, charakterisiert sich diese vorwiegend durch einen unglaublichen Reichtum von Schnecken und Muscheln, während die Zeit der Nummuliten im Miozän definitiv abgeschlossen ist. Dagegen erhebt sich die Säugetierwelt zur Ausbildung von Landriesen, namentlich Dickhäutern, von denen Mastodon und Dinotherium (Abb. 22) eine weit über den Kreis der Geologen hinausreichende Popularität erlangt haben. Die Entwicklung der Urpferde setzt ein, die großen Raubkatzen ( Machairodus) (Abb. 21) werden zahlreich, die zierlichen Muntjakhirsche ( Dicroceros) schweifen in Rudeln umher; kurz, es entsteht jenes Elysium der vordiluvialen Welt, das E. Fraas in seiner berühmt gewordenen Rekonstruktion des Steinheimer Thermalbeckens so plastisch entworfen hat.
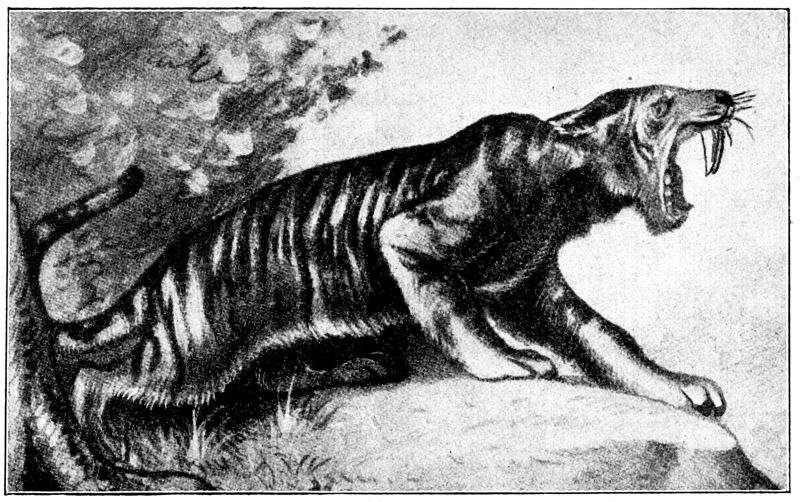
Abb. 21. Säbeltiger ( Machairodus), eine Riesenraubkatze der Braunkohlenzeit. Rekonstruktionsversuch.
Dieser Reichtum steigert sich womöglich noch im Pliozän zu einer ähnlichen Blüte und Riesenhaftigkeit der Säuger, wie die Blüte der Echsen in der Kreide, um (nach dem Depèret-Gesetz) ebenso unvermittelt, fast dramatisch zu erlöschen, wobei die einsetzende Eiszeit keineswegs der ausschlaggebende, höchstens der auslösende Faktor sein kann, da dieses Aussterben von Dinotherium, Siwatherium, Megatherium, Mammuth und ähnlichen Riesen auch dort erfolgte, wo keine Vereisung eintrat.
Den Übergang vom Alttertiär zum Miozän kennzeichnet auch eine ebenso reiche Entwicklung und Gliederung der Pflanzenwelt, die im Miozän ihr Optimum nach jeder Richtung erreicht. Es ist viel zu wenig gewürdigt, daß die Flora seitdem keinen Fortschritt mehr gemacht, dagegen in ihren Formationen an Reichtum und Gliederung erheblich verloren hat, wie auch eine Fülle von Arten der wärmeren und der heißen Zone erheblich an Verbreitungsgebiet eingebüßt haben. Als Ganzes genommen, ist demnach die Pflanzenwelt heute gegenüber dem Miozän schon in einer Art Rückentwicklung begriffen. Jedenfalls wäre sie heute nur an ganz wenigen Stellen (vielleicht nur im Amazonas- und Orinokobecken) imstande, solche Mengen von Braunkohlen zu hinterlassen, wie sie das Miozän des Rheins, Sachsens, Böhmens, Steiermarks usw. kennzeichnen.
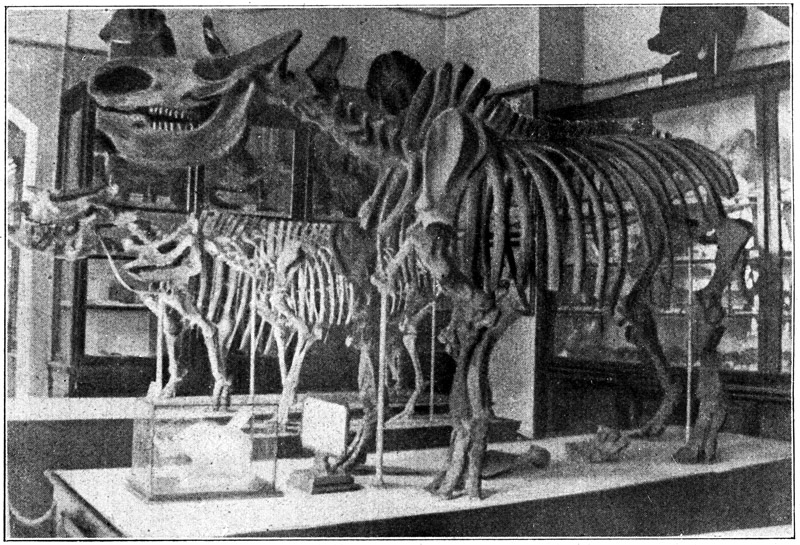
Abb. 22. Ein Nashorn ( Rhinoceros tichorrhinus) der bayrischen Hochebene, gefunden bei Kraiburg am Inn, in der palaeontologischen Staatssammlung zu München. Eines der besterhaltenen Skelette dieser Art. Auf dem Glasschrank rechts im Hintergrund sieht man den Kopf eines Dinotherium bavaricum. (Original.)
Das alles war nur möglich durch eine mächtige Regression der Meere, welche die Thetys auf das heutige Mittelmeer und ein syrisch-nordpersisches Becken beschränkte, mit dem nördlich davon ein schmaler Meeresarm in Verbindung stand, dessen kapriziöser Verlauf die Gegenden von der Rhône mit der Nordschweiz, Oberschwaben-Oberbayern, Österreich bis Wien unter Wasser setzte. In der schmalen Lücke zwischen den Ausläufern des Leithagebirges und der Karpathen waren eine Art miozäner Dardanellen gegeben, durch die das Meer in die weite, ungarische Ebene eindrang. Durch die Marchsenke umging es aber auch die Karpathen im Norden, überflutete Galizien, fand an der unteren Donau wieder Anschluß an das ungarische Meer und weitete sich nun mächtig zu noch einem Meer, das über den Kaspisee zum Aralsee reichte.
Das stille Wasser, in dem sich an Stelle Münchens im Jungtertiär die Alpen spiegelten, war also, wenn auch kaum 100-150 km breit, so doch weitgedehnt und nicht zu unterschätzen. In ihm lagerte sich die mächtige Schweizer Meeresmolasse ab, aus der sich fast alles, was im Schweizer Unterland an Taggesteinen sichtbar ist, zusammensetzt, also die Rorschacher Sandsteine, aus denen so viele Bauten bis zur Donau hin errichtet sind, die Muschelsandsteine am Bodensee, die St. Galler Molasse, die mit ihren Konglomeraten, Sandsteinen und weichen Sanden mehrere hundert Meter mächtig ist und schon ein Drittel jener Meerestiere enthält, die jetzt noch im Mittelmeer leben, als Zeichen dessen, daß sie ähnliche Lebensbedingungen aufwies. Aber diese obere Molasse hat schon Süßwassercharakter. Wenn die Aussüßung bereits dort, wo die Quelle des Salzwassers herkam, begann, mußte das ganze lange, schwäbisch-bayrische Becken nachfolgen. Der lebendige Zusammenhang war zerrissen. Am Alpenfuß, wo die Ströme, deren Macht man sich selbst mit blühender Phantasie kaum übertrieben vorstellen kann, stets für Nachfluß sorgten, entstanden natürlich Süßwasserseen, als deren Entwässerungsrinne mit vielen Nebenarmen (deren einer das schon gestreifte Urisartal war) immer deutlicher die große Bruchspalte am Jurarand, nämlich das Urdonautal, erkennbar wird. Wo diese stete Auffrischung fehlte, wie z. B. im ungarischen Flachland, in den Ebenen Galiziens, auf der sarmatisch-asiatischen Riesenfläche, da mußten entweder gewaltige Salzseen übrig bleiben, oder das Meer verdampfte und hinterließ Steinsalzlager (Bergbau zu Wieliczka) oder Sandebenen und Salzflächen (ungarische Pußta und die Einöden um den Kaspi- und Aralsee); oder sie verwandelten sich in unermeßliche Sümpfe entlang der Entwässerungsrinnen. Die einsam schönen Sümpfe an der Theiß und unteren Donau gehören dem letzten Teil dieses Prozesses an, und Kaspisches Meer, sowie der Aralsee spiegeln Jahrhunderttausende später in unseren Tagen die Welt des Miozän.
In der Schweiz und den bayrischen Grenzen hatte sie freilich unter der Anhäufung des Alpenschuttes die Lokalausprägung der Nagelfluhe des Pfänders, des Rigis, auch des Schwarzen Grates und anderer Alpenaussichtsberge angenommen, denn die miozäne Molasse wurde später noch gefaltet. Gerade sie hat unfern des Rheins in der zur Weltberühmtheit emporgestiegenen Fundstätte von Oeningen eine der schönsten vorweltlichen Floren und Faunen hinterlassen, an der ich nicht vorübergehen darf, da sie zum Verständnis der Münchner vorweltlichen Verhältnisse gehört.
Zu Oeningen fand seinerzeit Andreas Scheuchzer jenen miozänen Riesensalamander ( Andrias Scheuchzeri), den er als »betrübtes Beingerüst eines armen Sünders vor der Sintflut« ( Homo diluvii testis) beschrieb und dadurch der Paläontologie einen Anstoß gab, dessen Auswirkungen noch heute nicht ausgependelt sind. Mit ihm deckte man eine reiche Fauna von Fischen, Fröschen, Lurchen und Säugern auf, die in einem Walde lebten, der aus Ulmen, Pappeln, Eichen, aber auch Lorbeer, Palmen und anderen Gewächsen bestand, wie sie heute etwa um die Bucht von Neapel grünen. Vielleicht ist das Klima des mitteleuropäischen Miozäns noch etwas mehr zum subtropischen neigend anzunehmen, denn die vielen Palmen, Krokodile und Affen bringen reichere Züge in das Bild und die miozäne gleichalterige Flora von Grönland unter dem 70. Breitegrad beherbergt noch immer Magnolien, Edelkastanien, Platanen, Eichen und Weinreben. Erst im Pliozän setzt eine bemerkenswerte Erniedrigung der Temperatur ein; erst jetzt weisen Pflanzen der märkischen Braunkohle wieder Frostspuren auf ( Schlechtendahl).
Über die Sonderzüge unseres Gebietes in diesem allgemeinen Bild geben uns die Funde von Günzburg höchst erwünschten Aufschluß.
Die Heimat der »Blitzschwaben«, ein behäbiges, altertümliches Städtchen, liegt auf hohem Uferrand unfern von Ulm, in einem reichen Lößboden und anmutiger Umgebung. An diesem Uferhang, gegen die malerische Reisensburg und am Leibi, befinden sich einige Hauptaufschlüsse über obermiozäne Säugetiere und Pflanzen aus genau der Homo diluvii-Stufe von Oeningen. Man hat hier 576 Pflanzenarten des Tertiärs bestimmt, mit Fächerpalmen, Zimtbäumen, Feigenbäumen, Eichen, Lorbeerbüschen, Ahorn, Pappeln und dergleichen mehr. Die Flora Günzburgensis umfaßt z. B. Acer trilobata, Cinnammomum polymorphum, Flabellaria oeningensis, Laurus, Ficus, Quercus, Ulmus, Populus. (Nach Guembel.))
Diese Flora deutet auf ein genau umschreibbares Klima, dessen Jahrestemperatur auf 18¼° C bestimmt wurde.
Mit ihr zusammen finden sich die Reste von 45 Säugetierarten, also eine überaus reiche Fauna, zu der sich noch zahlreiche Vögel, Amphibien, Reptilien, Fische und auch Krebse aus den Sümpfen gesellen. Von den Säugern, die im Tertiär besonders interessieren, sind 17 Arten spezifisch: darunter befinden sich Wildhunde, Fischottern, Wildschweine, Mastodonten und Dinotherien. Im besonderen finden sich hier: Canis palustris (der Torfhund), Hyaenailurus Sulzeri, Lutra Valetoni, Hyotherium, Sus wylensis, Dorcatherium Naui, Orygotherium, Mastodon, Dinotherium bavaricum, Chalicomys, Palaeomeryx, Anchitherium Aurelianense, Chalicotherium Wetzleri, Aceratherium incisivum, Steneofiber Jaegeri, Hystrix Wiedemanni, Amphitragulus. Ein ganz besonders schönes Profil unter der Reisensburg weist folgende Schichten auf. Unter Löß und Schotter liegen 10 m hoch Sande, 6 m graue Mergel mit einigen Vertretern der Oeninger Flora, Konchylien und Zähnen von Mastodon angustidens. Dann kommt bis 13 m eisenschüssiger Zapfensand, ferner viele Pflanzenstengel mit Unionen, Planorbis, Helix sylvana, Neritina und noch tiefer auffallend viele Säugetierreste (Mastodon, Hyotherium, Anchitherium, Palaeomeryx, Chalicomys), Schildkröten und Krokodile. In 27 m zeigen sich Sande voll von brackischen Konchylien, Dreissensa und Cardium, also brackische Schichten. Hier zeigen sich auch Ueberreste der merkwürdigen Rana diluviana. Damit ist die Talsohle erreicht. Auf das warme Klima deuten außer den letztgenannten noch die Krokodil- und Schildkrötenreste.
Derartige Sumpfwälder und Dickichte an Flüssen, belebt von Krokodilen, ein ähnlicher subtropischer Regenwald, in dem sich Moschustiere, Rudel von Muntjakhirschen herumtreiben, Stachelschweine und Dickhäuter hausen, an deren Flußrändern Biber ihre Bauten aufführen, können auch für München angenommen werden, vielleicht mit der einzigen Einschränkung, daß die Nähe der alten Meeresniederung hier alles mehr an das Wasserleben gewöhnen ließ.
Im oberen Miozän ging das alles in die Zapfensande (Pfohsande) und die Bildung der Sylvanakalke über, auf denen auch Günzburg unmittelbar gebaut ist. Mit diesen Zapfensanden sind alle Höhen im Nordosten der Hochebene bis etwa Freising bedeckt, wozu sich noch Gerölllager von Quarzen gesellen, die einigermaßen rätselhaften Ursprunges sind (Vindelizischer Schutt?). Mit ihnen versippt finden sich auch die schon erwähnten Süßwasserkalke. Namentlich zwischen dem Flüßchen Paar und der Ilm zieht sich ein unabsehbares Gewirr von solchen Tertiärhügeln hin, in deren Sanden (Dinotheriumsande) man immer noch reichliche Wirbeltierreste, darunter auch einen echten Gibbon, also einen tertiären Menschenaffen (bei Stätzling b. Friedberg, also unfern von München), dann Säbeltiger, Urpferde, Nashörner, Mastodonten, Krokodile, Schlangen und Schildkröten gefunden hat. Vgl. O. Roger im Bericht des Naturwiss. Vereins von Schwaben 1898. Im besonderen erwähnt Roger: Pliopithecus antiquus, Hemicyon, Mustela, Machairodus, Dinotherium bavaricum (16 Backenzähne), Mastodon angustidens, Rhinocerus Goldfussi, Macrotherium, Anchitherium (Urpferd), viele Arten von Palaeomeryx Diphocynodon (Krokodil) und die Schlange Tamnaphis Poucheti. An vielen Punkten der Umgebung Augsburgs ist ähnliches in der Sylvanastufe zu finden. Aus ihnen stammen die wunderbaren Exemplare der Augsburger naturwissenschaftlichen Sammlungen, deren Dinotherien in ihrer Vollkommenheit von keiner anderen Sammlung übertroffen werden (namentlich Breitenbronner und Friedberger Exemplare Augsburg ist eine typische Lößstadt. Der Lehm liegt hier mehrere Meter hoch über den Schottern (Lechterrasse), die wieder 10-12 m mächtig auf dem Flinz (hier Tegel genannt) lagern. In diesen Tegeln bei Stätzling fanden sich die reichen Wirbeltierreste der Augsburger Sammlung, bis etwa zur Friedberger Anhöhe, wo man bei der Friedberger Brücke den Quellhorizont des Flinzes, in Gestalt von Quellen, die sich in den Fluß ergießen, erkennt.).
Die gleiche Welt spricht zu dem Beschauer auch aus dem Hügelland zwischen Dachau, Pfaffenhofen und Aichach, wo die obere Süßwassermolasse (Obermiozän) sandige Mergel und Gerölle hinterließ. Sie sind allerdings durch die eiszeitlichen Ereignisse mehr mit diluvialen Schottern, Lehm und Löß zugedeckt worden, während in den Tälern das Alluvium schon seine eigenen Schichtungen, als Sand, Torf und Kalktuff breitet.
Die Sande sind entweder reiner Pfohsand (z. B. bei Hohenwart) oder auch sandsteinartig (Beispiel: Tegernbach b. Pfaffenhofen). Die Gerölle bestehen aus Gesteinsbruchstücken der Zentralalpen (Quarze, Kieselschiefer Verrukano, Glimmerschiefer, Gneise, Granite, Quarzporphyr, Werfener Sandstein, rote Hornsteine), zwischen denen Kalke ganz demonstrativ fehlen. Wenn man nicht wie Guembel annehmen will, daß sie zerrieben worden sind, muß man daran glauben, daß sie entweder von zentralalpinen Flüssen herbeigeschleppt wurden oder daß diese Gerölle mit dem Vindelizium zusammenhängen.
Aus diesen Konglomeraten bildet sich manchenorts (bei Dachau, zwischen Aichach und Pfaffenhofen) sogar eine miozäne Nagelfluhe.
Großartig entwickelt sind die Sande, teils als Mergelkalke, noch mehr als reiner Mergel, oft in Form von Blättersandsteinen, dessen Lokalbezeichnung: Flinz oder Schlief auch im Münchner Dialekt wiederkehrt. Die Mergel werden als Dünger verwendet, auch die gelegentlich vorkommenden Töpfertone werden ausgenützt und das plastische Material in Hunderten von Ziegelhütten, namentlich in der Gegend von Petershausen und Reichertshofen, zu Ziegeln verarbeitet. Bei einem Spaziergang, besonders durch die älteren Vorstädte von München, wandern wir durch das obere Miozän, das in den Häusern steckt.
Dementsprechend finden sich im Flinz, der deshalb den Fachnamen Dinotheriensand auch mit Recht führt, immer wieder die Reste der Dinotherien (besonders die gut erhaltbaren Prämolaren); ab und zu auch als Zeugen von Süßwassersümpfen Unionen (z. B. Unio flabellatus bei Roggenstein).
Horizonte sind in diesen Sanden schwer nachzuweisen, da die Schichten nirgends zusammenhängen und jede Lokalität sozusagen ihr eigenes Gepräge hat. Wo Kalk (Sylvanakalk) vorkommt, der meist in der Form eines Tuffes erscheint, deutet das meist auf die unteren Lagen; die Zapfensande nehmen die mittleren Lagen ein, und die Unionenschichten und der Flinz die oberen. Leitfossilien sind außer der schon genannten gefalteten Malermuschel noch Helix sylvana, Planorbis, Ancylus, Neritina, Cyclostomaarten, dazu Charastengel, Knochen und Zähne von Dinotherium, Mastodon, Dicroceros, Hyotherium, ab und zu auch Fische (Barben und Leuciscus), manchmal auch Aragonitscheiben.
Einige überaus lehrreiche Aufschlüsse über die Beschaffenheit des Flinzes unmittelbar unter München gibt das Profil (Abb. 9) einer Versuchsbohrung, die man in Garching, nördlich von München, im Jahre 1905 zum Zwecke der Wasserversorgung vornahm.
In Garching fehlt das Diluvium völlig, denn weder die Gletscher noch die fluvioglazialen Schwemmgebilde reichen bis zu den Heiden, die München nördlich umsäumen; darum liegt der alluviale Kies und Sand unmittelbar auf dem tertiären Flinz. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die etwa 4 m Kies, die in dem Profil als postglazial angesprochen werden, die Ablagerungen der Eiszeit ebenfalls in sich fassen. Unter diesem Kies strömt nach Nordwesten gerichtet der Grundwasserstrom, da der Flinz als wasserundurchlässiger Tegel den tieferen Untergrund hermetisch schließt. Dieser Flinz entspricht dem Pliozän, ebenso wie die ihn unterlagernde Sandsteinplatte, während die grauen und gelben Sande dem Freisinger Miozän gleichalterig erscheinen. Tiefer liegen noch blaue Tone und bald lose, bald verfestigte graue und blaue Sande, die sämtlich dem Miozän (Pfohsande) angehören. In 37 m Tiefe endigt der gewonnene Aufschluß.
Die Deutung dieses Profiles macht keine Schwierigkeiten. Die Sand- und Tonschichten sind Absätze der letzten miozänen Überflutung, deren oberster Horizont, der freiliegende Flinz, stark abgetragen, zersetzt und abgeschwemmt erscheint. Schichte III läßt sich mit ihrer 4 m dicken Kiesdecke kaum anders deuten, als eine von den Schmelzwassern der Zwischeneiszeiten und des Postglazials zusammengeschwemmte Kiesschicht, aus der sich auf eine ungeheure Überschwemmung der Münchner Gegend schließen läßt. Der ihr auflagernde Sand kann nur das Sediment eines Süßwassersees sein, der nicht allzulange Zeit bestand (die Schicht ist nur 30 cm stark); ihm folgte wieder fließendes Wasser mit Geröllen (Schichte I ist offenbar ein Urstrombett, vermutlich eine größere Isar), die langsam in der obersten Schichte mit Humus, Lehm und Dammerde durchsetzt werden.
In diesen Boden haben die Münchner Tiefbrunnen hineingestoßen Die Bohrung im Leistbräu in der Sendlingerstraße drang bis 74,28 m, die in der Sedlmayerschen Brauerei 87,6 m., in ihn wühlte das Isarbett so tief ein, daß er stellenweise auch im Stadtgebiet ans Tageslicht stieg.
Der Münchner Flinz und Tegel ist vorwiegend ein glimmerreicher Sand von mergeliger Beschaffenheit, dessen tiefere Teile dem oberen Miozän (Süßwassermolasse) angehören, während die pliozänen Ablagerungen fast völlig weggeschwemmt sind. Er ist entweder von der alpinen Pressung mit erfaßt oder von den ihn durchwühlenden alpinen Gewässern profiliert, so daß er durchaus wie ein unterirdisches Hügelland unter den eiszeitlichen Schottern Höhendifferenzen von etwa 15 m aufweist. Im allgemeinen senkt er sich gegen die große, alpine Depression zu etwas, wird dort auch von immer gewaltiger sich aufbauenden Eiszeitgeschieben überlagert, so daß man bei Solln, im Süden der Stadt, bereits 20 m tief gehen muß, um ihn anzuschneiden, während er kurz vor Dachau offen zutage liegt. (Vgl. Abb. 9.)
Die heutige Profilierung des Stadtbodens wird immerhin nicht ganz von dem Tertiär unbeeinflußt gelassen; in leisen Zügen schimmert durch das glaziale Gewand auch noch etwas von dem »Dinotherien-München« durch. So erscheint eine Art Urisartal, dessen auf S. 79H. Stieglitz, Der Lehrer auf der Heimatscholle München. 1909. 8°. S. 48. schon Erwähnung getan wurde, im Subterrestrischen als Grundwasserfluß, der vom Südbahnhof durch die Theresienwiese zum Westende des Bahnhofes zieht, sich zwischen der Gegend der Pettenkoferstraße verzweigt und vertieft, und vom Sendlingertorplatz über den Maximiliansplatz zum Siegestor weit hinaus nach Schwabing leitet. Auch dieses Flußbett hat seine Abzweigung in die Gegend der Kurfürstenstraße. Dieses Becken hat gegen seine Ufer etwa 6-8 m Tiefe.
Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, daß es, so wie es heute noch von den nach Norden ziehenden Grundwässern durchsickert wird, einst unter dem blauen, sonnigen Himmel des Miozän einen heiteren Strom an grünen Hügelgeländen umschloß. Von diesen Hügeln sind, wenn auch abgeschwemmt, verschiedene noch erhalten. Ein etwa 6 m hoher unter dem Wittelsbacherplatz, ein 9 m hoher in der Gegend des Odeonsplatzes, ein etwas steiler Uferrand, parallel mit der Straße verlaufend und fast 12 m hoch, in der Kaulbachstraße. Dazu kommt eine ziemlich allgemeine Erhebung unter dem Englischen Garten und dem Stadtviertel, das noch den alten Namen: Lehel, wenigstens im Munde des Volkes, trägt.
Diesen Höhenzügen stehen auch einige unterirdische Seen entgegen, namentlich erwähnenswert ist von ihnen jener, der sich zwischen Theresienwiese und Sendlinger Tor dehnt und auch gegen die Ludwigsbrücke sich verbreitert. So kommt es, daß gerade die Isar, welche einen tertiären Hügelrücken durchschneidet, an zahlreichen Stellen den Flinz entblößt hat; besonders hübsch und leicht ist das zu sehen an der Südspitze der Praterinsel, am Bogenhausener Brückenkopf und an dem Damm, der gegen Föhring zu führt, obzwar dort der Aufschluß durch die Uferschutzbauten wieder etwas zugedeckt worden ist.
Aus der Tatsache, daß überall dieses unterirdische Hügelland dem Einsickern des Regenwassers Widerstand entgegensetzt, daß es aber im allgemeinen eine ziemliche Neigung gegen Nordwest besitzt, folgt, daß das Grundwasser in den einzelnen Teilen der Stadt in sehr verschiedener Höhe steht, im allgemeinen aber als frischer Strom das Erdreich durchzieht und nur an wenig Stellen Stauungen und Stillstand aufkommen läßt.
Im Süden der Stadt, im Isartal selbst, tritt der Flinz, von der Isar entblößt, zwischen Thalkirchen und Großhesselohe an vielen Stellen heraus; nördlich von Pullach fällt sogar eine Tertiärwand senkrecht in das Flußbett ab. Im Münchner Stadtgebiet selbst ist das Miozän durchwegs von den Schottern zugedeckt, sowie auch auf der gesamten Hochebene, soweit nicht Flußrisse sich bis zu ihm durchgenagt haben. In Sauerlach bei Holzkirchen ist die glaziale Auflagerung 40 m mächtig; hier ist die Gegend, wo Wasser nur an gewissen Tiefbrunnen aus dem Boden geholt werden kann, um die sich dann naturgemäß die Ortschaften ansiedelten, was noch aus ihren Namen: Hohenbrunn, Putzbrunn, Wörnbrunn usw. hervorgeht.
Schon in Fürstenried, südlich der Stadt, liegt das Tertiär und damit der Grundwasserspiegel nur mehr 22 m unter dem heutigen Boden, in Mittersendling, also im Stadtgebiet selbst, 12 m, im Zentrum der Stadt durchschnittlich 7 m (Karlstraße), unter dem Rathaus 13 m, Odeonsplatz 4 m, Ohmstraße 1½ m, ebenso Moosach, in der Gegend des Gaswerkes, auf Oberwiesenfeld 3,5 m. Demzufolge tritt das Grundwasser im nördlichen Teil der Stadt überall in zahlreichen und starken Quellen zutage, wo eine Böschung den Grundwasserspiegel anschneidet.
Dies ist der Fall an der Isarleite in den Bogenhauser Anlagen. Dort hat sich die Stadtgärtnerei dieser Quellen bemächtigt und hat sie gefaßt und in das hübsche Gartenbild eingegliedert. Anders etwas weiter nördlich, in dem urwüchsigen Gebiet, das sich von dem idyllischen St. Emmeraner Kirchlein bis zur Föhringer Brücke zieht. Dort sprudeln aus dem Hang viele kleinere und größere Quellen in ungebundener Wildnis. Das Bild wiederholt sich links der Isar bei Biederstein und draußen am nördlichen Stadtrand bei der Georgenschwaige.
Auf der gleichen Tatsache beruht endlich die Bildung einer Naturerscheinung, welche für die Entwicklung des Münchner Lebens von jeher von allergrößtem Einfluß war und noch ist, nämlich die großen Moore, die das Stadtgebiet im Norden und Nordosten abgrenzen (vgl. die Karte von München).
Die Decke der fluvioglazialen Geschiebe reißt gerade an diesem Rande ab mit einer etwas unregelmäßigen Grenze, entlang deren der Quellhorizont das Tageslicht erreicht. Von Moosach bis Unterschleißheim dringt das Wasser hervor, das auf dem ganzen Gebiet viele Stunden lang immer wieder Kalkgeröll durchsickert und sich fast bis zur Grenze seiner Aufnahmefähigkeit mit kohlensaurem Kalk beladen hat.
Die Münchner Hausfrau weiß aus eigener Erfahrung nur zu gut, wie kalkhaltig das Wasser ist, das ihr die Wasserleitung aus dem Mangfallgebiet liefert, wo die aus den Waldhängen des Taubenberges zusammensickernden Quellen eine viel geringere Decke glazialer Gerölle passieren, als sie das Grundwasser von München durchläuft. Daraus mag man ermessen, wie schwer erst dieses mit Kalk beladen ist und wie rasch es ihn absetzen muß, wenn es bei dem Austritt an die erwärmende Luft die Kohlensäure, die allein den Kalk in Lösung hielt, abgibt.
Die weite Ebene zwischen Moosach und den tertiären Hügeln von Dachau, ebenso zwischen Johanneskirchen und dem Erdinger Hügelland, besitzt reinen Flinzboden, der das Wasser, das diese Quellen auf ihn ergießen, nicht einsickern läßt, hier sind also die Notwendigkeiten zur Entstehung großer Quellmoore gegeben, die man zwar drainieren, auf ihre natürlichen Grenzen eindämmen, niemals jedoch völlig trockenlegen kann. So entstanden das Dachauer, Schleißheimer und Erdinger Moos, deren Unterlage überall eine aus dem Wasser sich absetzende Kalkschicht, der sog. » Alm« ist, der früher in München auf den Straßen als sog. » Münchner Weißsand« zum Scheuern der Wirtstische feilgeboten wurde. Kristallisiert dieser weißgraue Schlamm, so verwandelt er sich in Kalktuff. Derartige Kalktuffe gehören seit dem Tertiär zu den Charakteren aller Süßwasserablagerungen vor den Kalkalpen. Neugebildete sieht man im Moorgebiet bei Olching und Lochhausen an der Eisenbahn, oder auch um Schleißheim.
Unter dem Alm und Tuff oder den gebildeten Torfschichten liegen natürlich überall die Tone, Mergel und Sande des Flinzes, und sowohl im Münchner Stadtgebiet, wie nördlich davon enthalten sie die für sie kennzeichnende spättertiäre Fauna, allerdings nur in wenig Vertretern.
Noch am häufigsten sind Landschnecken (besonders Helix rugulosa) vorhanden, auch Blattreste der Oeninger Stufe, die sich ganz mit der reichen Flora decken, die man beim Brunnengraben im oberen Miozän von Freising gefunden hat. Dort fanden sich Blätter von Populus latior, Acer, Podogonium Knorri, Grevia. Am Domberg beim Brunnengraben zeigten sich besonders häufig die Blätter der breitblätterigen Pappel. Freising selbst ist auf den weichen, feinsandigen Mergeln des oberen Miozäns erbaut, die bis Regensburg reichen und hier, sowie bei Moosburg noch im Hügelgelände mit viel quartären Schottern und prädiluvialer Nagelfluh (aus zentralalpinen Gesteinen!) bedeckt sind. In den Kiesgruben finden sich nicht selten Zähne von Mastodon angustidens, bei Vötting auch Dinotherium- und Dicrocerosknochen und -Zähne. Dazu gesellt sich noch ein verkohlter Baumstamm aus dem Tertiär des Isarbetts. In den gleichen Schichten wurden Reste von Mastodon angustidens unter der Stadteisenbahnbrücke gefunden, solche der kleinen Muntjakhirsche in Bogenhausen, Hypotherium sömmeringi im Miozän des Isardammes von Bogenhausen gegen Föhring. Bei Grabungen am Tivoli im Englischen Garten fand man Reste von Rhinoceros incisivus. Bei solchen an der Maximiliansbrücke kamen Sylvanaschichten mit Helix sylvana zutage. Diese Funde befinden sich sämtlich in der paläontologischen und geologischen Staatssammlung Bayerns.
Das obermiozäne Alter des Münchner Tegels ist dadurch zur Genüge festgelegt, namentlich, wenn man dazu die schöne Tertiärfauna rechnet, die aus den gleichen Dinotheriensanden von Freising zutage kam. Namentlich Mastodon angustidens, Mastodon turicensis, Dinotherium bavaricum, Dicroceras furcatus und Chalicotherium antiquum. Vgl. damit die Günzburger Fauna S. 80.
Das entworfene Bild des Tertiärs wird vielleicht noch plastischer, wenn man noch mit einigen Pinselstrichen die Tatsachen des ostalpinen Miozäns einfügt. Um Wien gab es im Leithalkalk im Oligozän noch reichlich Korallenriffe, die ebensoviele Kalkalgen enthalten. Das Miozän bedeutete für das Wiener Becken immer noch ein Meer (sarmatische Stufe), das sandige Tone absetzte, in denen massenhaft Herzmuscheln, Cerithien, Tapes und Erviliaarten vorkommen.
Auch im Pliozän brandeten noch Meereswogen gegen den Flysch der Wiener Höhen; allerdings kann es nur mehr ein im Abziehen begriffenes Meer gewesen sein, da die Mießmuscheln dieser Kongerienstufe nur am Flachstrand vorkommen. Schon die obere Fazies dieser Stufe, der Belvedereschotter, mit seinem Quarz- und Urgebirgsgeröll, das in langen, flachen Streifen den Wiener Boden bedeckt, ist ein Süßwassergebilde, das viele Ähnlichkeit mit den Quarzgeröllen der bayrischen Molasse und der tertiären Hügel von Dachau und Aichach besitzt. Nicht anders ist es zu deuten, denn ein Niederschlag riesiger Alpenströme, die ihre Geschiebe beim Austritt in die Ebene absetzen.
In den steirischen Grenzgebirgen, in deren Tälern große Süßwasserseen übrig blieben, schlug sich Schieferton und Sandstein nieder, in denen man eine reiche Flora von völlig subtropischem Charakter findet, dazwischen die bekannten miozänen Riesensäuger (Dinotherium, Mastodon, Hypotherium). Die Flora hinterließ sogar bei Leoben und im Murtal Braunkohlenflöze von 9-12 m Mächtigkeit.
Mit dem Ende der Miozänzeit waren die Hauptkräfte, welche die Alpen errichtet hatten, erschöpft und beschränkten sich nur noch mehr darauf, die Molasse aus ihrem Lager zu heben und aufzufalten und das Meer auf die Gestade zu begrenzen, die es im großen ganzen heute noch hat, wenngleich, wie der allgemein bekannte Serapistempel im Golf von Bajae beweist, die Küstenlinie Italiens sogar noch in historischer Zeit mehrfach schwankte. In den Alpen war vom Pliozän an kein Meer mehr, außer an ihrem Südrande (Istrien, Riviera), und ihr Gefüge hatte im allgemeinen nur noch eine Durchmodellierung durch die Kräfte des Eises, mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine allgemeine Aufwölbung im Diluvium erfahren, aber keine fundamentale Neugruppierung mehr. Nur die hydrographischen Verhältnisse waren von den heutigen gänzlich verschieden. Die Wasserscheiden waren anders verteilt, der Rhein scheint ein Nebenfluß der Rhône gewesen zu sein, das Klima war unvergleichlich milder und etwa jenes, das heute die Hänge des Atlas oder der korsikanischen Berge verklärt. Ungeheuere Laubwälder schmückten die Täler und das Vorland, in denen merkwürdige Tiere hausten: der zwischen Bär und Hund stehende Amphicyon, die Scharen der zierlichen Muntjakhirsche, das etwa schafgroße Anchitherium, das sich als einer der Vorfahren des Pferdes erwiesen hat, und dazu die Herden der phantastischen Dickhäuter, der Riesentapire, Nashörner, Schreckenstiere und Vorläufer der Elefanten (vgl. Abb. 22).
Die Münchner Ebene selbst war wohl eine Parklandschaft, vielleicht nicht unähnlich der südlichen Nillandschaft, deren Klima mit dem häufigen Regen und den unregelmäßig wiederkehrenden Föhnlagen gewaltige Bewässerung brachte, Riesenströme, weitgedehnte Sumpfflächen auf den Sanden, die gegen die Donau zu vielleicht Steppencharakter annahmen. Besiedelbar für den Menschen war diese Wald- und Wasserwildnis mit ihrer reichen Tierwelt jedenfalls, und der pliozäne Mensch ist für Südamerika, wie von Rutôt für Westeuropa nachgewiesen. Vom Gibbon, der ähnliche Existenzbedingungen fordert wie der Mensch, weiß man, daß er die Münchner Ebene belebte; vom tertiären Münchner Menschen wissen wir gar nichts.
Wenn aber etwas da war, so wurde es mit allen Knochenresten, Eolithen und sonstigen Zeugen des Pliozäns von der großen Vereisung hinweggeschoben, die sich schon in den letzten Jahrtausenden des Tertiärs vorbereitet.
Alle Erklärungen der diluvialen Eiszeit außer der Pendulationstheorie lassen die Tatsache vollkommen unberücksichtigt, daß seit dem Ende der Kreidezeit ein zunehmendes Sinken des klimatischen Niveaus die eiszeitlichen Zustände Mitteleuropas vorbereitet. Wenn auch das Eozän für Bayern noch Korallenriffe ermöglicht, so ist Oligozän und Miozän doch nur mehr durch subtropische Vegetation gekennzeichnet, während das Leithabecken wenigstens im Oligozän noch Korallen am Leben duldet. Daraus geht hervor – was bisher noch nicht berücksichtigt ist –, daß unter dem gleichen Breitegrad ein erheblicher klimatischer Unterschied bestand, der ziemlich gebieterisch verlangt, anzunehmen, daß das Kältezentrum nicht nur südwärts, sondern auch gegen Osten gewandert war.
In dieser Übergangszeit vom Tertiär zum Diluvium waren die Umrisse der großen Erdteile ganz in heutiger Form festgelegt und nur mehr geringfügige Unterschiede trennen das voreiszeitliche Bild der Erdkarte von dem heutigen. Asien hing noch mit Amerika zusammen, das Becken der Ostsee war noch nicht eingestürzt, auch die Nordsee bestand noch nicht in ihrem heutigen Umfange, ebensowenig der Kanal zwischen Frankreich und England, die nördliche Ägäis und das Schwarze Meer.
Es ist ausnehmend wenig gearbeitet worden über das präglaziale Diluvium, obschon eine ganze Reihe Anzeichen dafür vorhanden sind, daß Wandlungen bereits eintraten, denen die Vereisung nur nachfolgte. So wurde z. B. die Lotos- und Zimtbaumvegetation in Bayern nicht von den Gletschern überrascht, sondern wanderte schon vorher durch das Rhônetal ab. Der kleine Kohlenflöz, der unter der Kohleninsel der Isar mitten in der Stadt liegt und den das Deutsche Museum abbauen wollte, um seinen Bedarf an Kohle zu decken und zugleich an einem lebenden Beispiel den Betrieb eines Bergwerks zu demonstrieren, ist im Dinotheriensand eingelagert und zeigt nichts mehr von seiner südländischen Flora als Zeichen, daß sich mit dem Ende des Tertiärs ein Wandel vollzieht, in dem die Vereisung nur Folgeerscheinung, nicht aber Ursache sein kann.
Man darf doch hierbei nicht die Zeugnisse der tertiären Vereisung übersehen, die in der Gegend des Beringsmeeres bis heute noch fossile Gletscher hinterlassen hat. Solches, unter einer Decke von Erde und Lehm trefflich konserviertes Eis ist aus Alaska und von den neusibirischen Inseln bekannt, sein tertiäres, etwa miozänes Alter wird durch die Lagerung und das Fehlen aller tertiären Faunen in dem in Frage kommenden Gebiet bezeugt. Dagegen leben gleichzeitig hochnordische Tiere am Baikalsee und in Japan.
Auf diese Tatsachen muß mit größter Beharrlichkeit immer wieder hingewiesen werden, da sie die Eiszeit in einem ganz anderen Licht zeigen, denn die populäre Auffassung, die kurzerhand vom Diluvium spricht, wo sie Spuren einer Eisbedeckung aus junger Zeit findet und scharf ihren Schnitt am Rande dieses Phänomens zwischen dem Tertiär und einer neuen Zeit durchführt.
Auch über diese Vereisung selbst haben sich längst gewisse übertriebene und phantastische Begriffe in den Köpfen festgesetzt, die im diluvialen Bayern ohne weiteres ein zweites Grönland oder Franz-Josefsland sehen wollen. Um das hat es sich nie gehandelt, sondern das Eiszeitphänomen war wenigstens in der Münchner Gegend von ganz spezifischer, mit nichts vergleichbarer Ausprägung, deren Folgeerscheinungen bis heute andauern und in vielem nachhaltig den Charakter von München prägen.
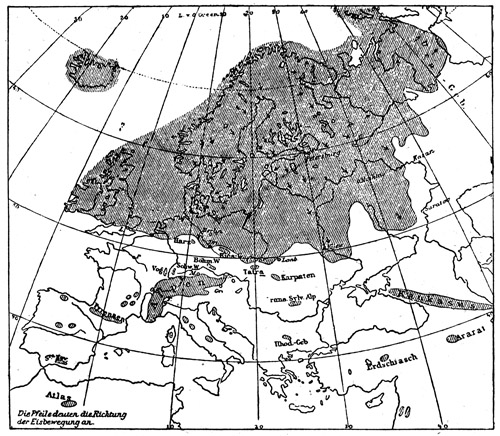
Abb. 23. Karte der größten Ausdehnung der diluvialen Vereisung. Man beachte, wie geringfügig die alpine Eisdecke gegen das palaearktische Vereisungsgebiet ist. (Nach Frech.)
Natürlich nehmen alle diese Erscheinungen ihren Ausgangspunkt von dem Gletscherphänomen, oder richtiger gesagt: die heute vorhandenen Gletscher sind Überbleibsel einer jetzt noch andauernden lokalen Eiszeit, die auch auf einem fast ein Fünftel der gesamten Erdoberfläche einnehmenden Territorium herrscht. In diesem Sinne ist es ganz unrichtig, unter Eiszeit die »Periode der deutschen Flachlandgletscher« zu verstehen, welcher Sinn dem Worte gegenwärtig tatsächlich untergelegt wird. Ebensowenig ist es richtig, den Begriff Eiszeit für eine bestimmte geologische Periode anzuwenden. Denn die einzelnen Vereisungen, welche die verschiedenen Teile der Erde betroffen haben, sind keineswegs synchroner Natur. Es ist nicht wahr, daß »die Eiszeit« eine bestimmte Reihe von Jahrtausenden andauerte. Alles das sind verschwommene, oberflächliche, ungenaue Begriffe, die Quelle zahlloser schiefer Meinungen und Irrtümer, mit denen endlich einmal aufgeräumt werden muß.
Eine Vereisung der Pole gab es schon seit der Miozänzeit, und die Frostspuren an Blättern im deutschen Flachland in der Kreidezeit, später noch in der Braunkohlenzeit zwingen mit Notwendigkeit, anzunehmen, daß es in dem damals schon stehenden Zentralstock der Alpen ebenfalls Frost, damit Gletscher und Vereisungen gegeben hat. An die Tatsache einer nordsibirisch-amerikanischen Eiszeit im Miozän wurde schon auf S. 88 erinnert. Die Untersuchungen von Geikie ergeben auch für England bereits im Miozän eine Vereisung, die amerikanischen Geologen haben uns davon überzeugt, daß in Nordamerika seit dem Tertiär vier Eiszeiten einander folgten, bevor die skando-deutsche Vereisung anbrach, und für diese muß die Chronologie wieder anders rechnen, wenn sie die Alpen betrachtet, wie wenn sie Norddeutschland durchforscht. Die norddeutsche Ebene kennt nur zwei Vereisungen (mit dem oberen und unteren Blocklehm), und erst Geikie hat nachgewiesen, daß noch eine dritte nachkam, die allerdings weder Innerrußland noch England erreichte. In Süddeutschland läßt sich dagegen an den vier Eiszeiten Penck-Brückners nicht zweifeln, deren Dauer und Intervalle selbstverständlich weder mit den norddeutschen, noch mit den fünf bis sechs nordamerikanischen Vereisungen zusammenfallen können. Wer kann dagegen mit Recht sagen, daß mit der Würmeiszeit das Eiszeitphänomen in den Alpen abgeschlossen sei, wenn noch jetzt Tausende von Quadratkilometern in den Alpen vereist sind und mit ihren Auswirkungen z. B. gerade das Klima und die Wasserverhältnisse von München auf das nachhaltigste beeinflussen? Noch viel weniger, wenn man die Erde in ihrer Gesamtheit betrachtet, auf der ganze Kontinente (Südpolarland, Grönland) unter einer ewigen Eisdecke liegen.
Der Begriff »Eiszeit« schlechthin in dem Sinn, wie ihn alle, auch die wissenschaftliche Welt, im Munde führt, ist sinnlos. Er deckt sich weder mit dem Begriff Diluvium, noch ist er überhaupt eine »Periode« in geologischem Sinn.
Es ist mir daher nicht möglich, anders als von lokalen Vereisungen zu reden, und in diesem Sinn ist es zu verstehen, wenn hier gesagt wird, Relief, Bodenbeschaffenheit, Klima, Besiedelung und Kultur von München sind auf das nachhaltigste beeinflußt durch eine zu Beginn des Quartärs sich aus den Alpen auf München zu bewegende Eisdecke, welche in verschiedenen Vorstößen und Rückzügen bald näherrückte, bald ganz in die Hochalpen zurückkehrte, in denen sie jetzt noch immer fortwährenden Schwankungen unterworfen, in den Zillertaler und Ötztaler Alpen, mit einigen Vorposten im Zugspitzgebiet und Karwendel, in etwa 100 km Luftlinie von der Stadt halt macht.
So präsentiert sich das gesamte Eiszeitphänomen, vom Münchner Standpunkt aus gesehen.
Um den Münchner Boden in seiner obersten Schicht zu verstehen, muß man daher die Gletscher, welche ihn geschaffen haben, an ihrem Entstehungsort aufsuchen.
Wenn man eine Karte des Alpengebietes südlich von München zur Hand nimmt, erkennt man leicht, daß eine Reihe Parallelfurchen die Gewässer von heute, die Gletschermassen von einst in die Ebene hinausleiten. Im besonderen sind das die Täler des Lech, der Amper, des Starnberger Sees und das Würmtal, die Loisach-Isarfurche und dann in weitem Abstand der Innweg.
Unmittelbar das Münchner Gebiet berühren von all diesen nur Würm und Isar, mit einiger Weitherzigkeit der Auffassung auch die Amper. Sie sind die Ableitungsmulden aller sich abwärts bewegenden Massen, die von dem Zugspitzgebiet oder über den Fernpaß aus dem Oberinntal, dem Pitztal und Ötztal kommen. Die Gletscher der Wildspitze, der Weißkugel, des Venter und des Gurgler Talschlusses, auch des Zuckerhütls aus den Stubaiern müssen, wenn sie andauernd weitergleiten, über den Fernpaß ins Loisachtal gelangen und können von dort entweder die Ammerseemulde, dann die Amper oder das Starnbergerseebecken und dann die Würm erreichen.
Mit ihnen vereinigen sich die kleineren Gletscherbecken, die in die Nischen des scharfgekanteten Wetterstein- und Karwendelmassivs eingesenkt sind. An dessen Ostrand bedeutet der fjordartig eingeschnittene Achensee eine Scharte, die ihre südliche Fortsetzung im Zillertal findet und das Eismaterial der Hohen Tauern, im besonderen der Gletscher des Hochfeiler, des Löfflers, des Schwarzensteins, etwas auch aus der Venediger-Gruppe ableiten kann. Dieser gesamte Eisstoß muß das Achental hinauswandern und trifft dann wieder das Isartal, ein Seitenarm gelangt durch das Kreuther Tal zum Tegernsee und von da in die Ebene. Natürlich werden Vorberge, wie Halserspitz, Vorderkarwendel, Sonnwendjöcher, Benediktenwand und dergleichen ebenfalls in den Firnmulden Schnee sammeln und ihre kleineren Sondergletscher tragen, wenn die Verhältnisse einer Vereisung günstig sind.
Von diesen vielen Fernern, welche das Münchner Glazialgebiet speisen, sind die Ötztaler und Zillertaler die ansehnlichsten. Im Ötztaler Gebiet versetzen das Gepatsch im Kaunsertal oder der die Weißkugel herabkommende Hintereisferner, der in die Finailspitze eingelagerte Hochjochferner, über den der Weg ins Schnalsertal führt, im Gurglertal der Große Gurglerferner heute noch völlig in eine Eiszeitlandschaft. Die mittlere Temperatur von Gurgl (1927 m), dem höchstgelegenen Pfarrdorf Europas, kommt der des Nordkaps gleich; in der Umgebung wächst kein Baum, noch Strauch. Der Ferner selbst (er heißt nicht umsonst der Große Ötztaler Ferner) ist der drittgrößte in den Ostalpen und fast 8 km lang. Im Tal selbst kommt ein ganzes Labyrinth von Eiswüsten zusammen. Ein ähnliches Bild gewährt der hinterste Winkel des Venter Tales, etwa vom 6 km langen Hochjochferner aus, wo man auch die raschen Wanderungen des Vernagtgletschers beobachten kann. Im Kaunsertal birgt sich endlich der über 8 km lange Gepatschferner, der nur wenig hinter dem größten Gletscher der Ostalpen (die Pasterze am Großglockner, 9,4 km lang) zurücksteht. Weniger vergletschert ist die Umrahmung der vielen Gründe, die im Zillertal zusammentreffen, obschon auch da die Umgehung der Berliner Hütte oder der »Schwarzensteinkees« mit allen Erscheinungen der Eiswelt bekannt machen kann.
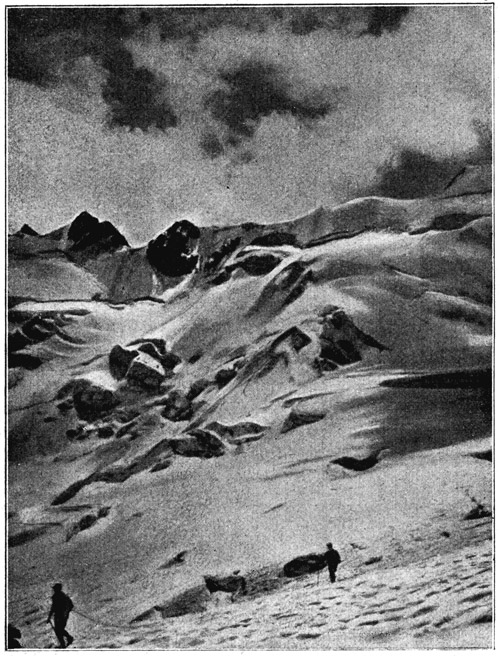
Abb. 24. Ein Stück lebendiger Eiszeit. Ein Firnbecken im Kaukasus (Adai-Choch-Gruppe), in dem sich das »Magazin« der talwärts wandernden Eismassen befindet. Nach Dr. G. Kufahl. (Ztschr. D.-Ö. A.-V.)
In diesen Bergen ist man im Zentralmassiv der Alpen in einer Welt von Gneisphyllit und Glimmerschiefer daheim Die Berge des Ventertales bestehen aus Gneisphylliten und Hornblendeschiefern, mit porphyrischen Flasergneisen, die des Schnalsertales aus Gneis und Hornblendeschiefern, im Gurglertal aus Glimmerschiefer und Phylliten, die des für München in besonderer Bedeutung wichtigen Sellrains aus kristallinen Schiefern, Gneis, Hornblendeschiefern, im Lisenzer Tal Hornblende und Glimmerschiefer mit großen Andalusitkristallen. (Vgl. J. Blaas, Geolog. Führer d. Tirol 1902.) Die Hohen Tauern setzen sich vorwiegend aus Gneis zusammen, der östlich vom Hochfeiler, am Großvenediger, um den Großglockner von Diabas, Gabbro, Amphibolit, Serpentinen überlagert ist.], während nördlich der Inntalfurche überall das Reich der Triaskalke anhebt, die in einer schmalen Zone, von Lias- und Flyschgebilden begleitet, in die Ebene hinausleitet. Die herrschenden Gesteine sind Wettersteinkalk, Hauptdolomit-Plattenkalke, Hornstein, Werfener Sandsteine, Flyschsandsteine, rote Liaskalke, während im Urgebirge Gneiße, Quarzite, Glimmerschiefer, Amphibolite, Granite die Hauptmasse ausmachen.
In diesem Milieu spielten sich die Gletscherphänomene ab, welche den Münchner Boden umgestalteten und sich heute nur mehr in die weltverlorenen Täler und Gründe der Ziller und des Otzbaches, in einsame Karnischen und verschwiegene Wüsteneien des innersten Gebirgsheiligtums zurückgezogen haben.
In den reinen Höhen dieser Berge fällt der Schnee immer als feinstäubendes, kristallinisches Pulver, das auch dem Sommer Widerstand zu leisten versteht und eher in Staublawinen von den Hochgipfeln abfährt, ehe es zu simplem Wasser zergeht.
Die wahre Ursache der Gletscherbildung sind die Staublawinen. Nur durch diese sammelt sich am Fuß der steilen Wände in genügenden Mengen Tauschnee an, um beim Abschmelzen eine so große Menge Eis zu geben, daß sie in nennenswerter weise durch ihr Gewicht zu Tale gleiten und mechanische Wirkungen ausüben kann, bevor sie endgültig sich in Wasser auflöst. Mit Ausnahme der Gegenden mit polarem Klima ist daher Gletscherbildung nur in einem Gebirge mit steilen Hängen denkbar.
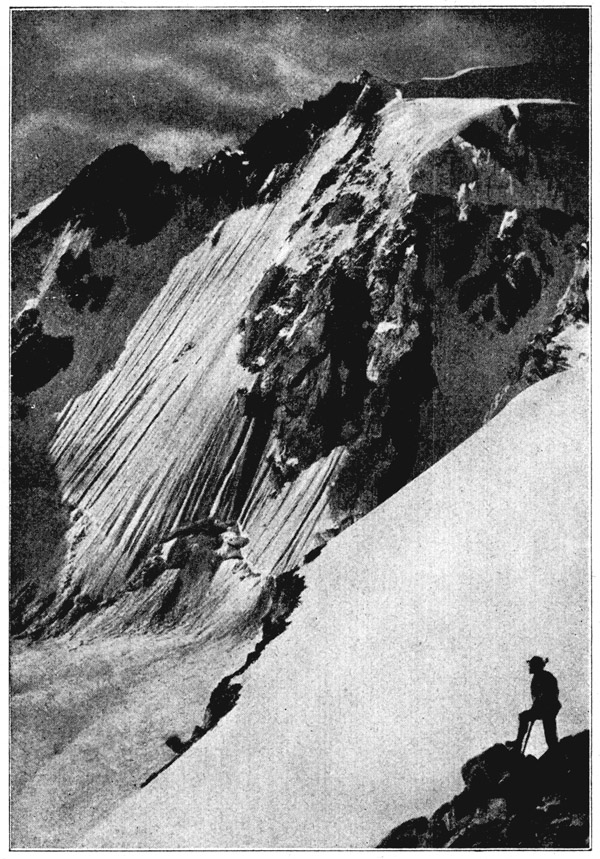
Abb. 25. Ein Staublawinenfeld, die Entstehungsstätte der Gletscher. Von den übersteilen Hängen sammelt sich der Firnschnee in den Kesseln und wandelt sich dort durch seinen eigenen Druck und das Schmelzen in Eis, das als Gletscher talwärts wandert. Motiv vom Hochgall in der Rieserfernergruppe (Zentralalpen). Nach Dr. F. Benesch. (Ztschr. D.-Ö. A.-V.)
Das Eis, das gleichsam wie eine vereiste Schneedecke auf einem Steildache abgleitet, übt dadurch einen mechanischen Druck aus, der sich sowohl in Pressungserscheinungen, wie in einem Vorsichherschieben des Materials auf dem Wege des Gletschers, desgleichen in einem Schrammen und Glätten, kurz gesagt, in einer Abhobelung der Unterlage und Seitenwände besteht.
Die Pressung gibt sich vornehmlich durch Zusammenschieben und Faltung des weicheren Untergrundes, ferner in einer Verkettung feiner, loser Bestandteile zu festen Breccien kund, welche die schweizerische volkstümliche Bezeichnung Nagelfluhe nicht mit Unrecht verdienen, da Profile solcher unter Eispressung stehender Trümmerwände wirklich den Eindruck einer Wand machen, in die man Nägel geschlagen hat.
Das Ausheben und Zusammenschieben der vor dem Gletscherende liegenden losen Steine und der Vegetation bedarf keiner Erörterung, außer vielleicht des Sich-darauf-Besinnens, daß die gesamte Sohle des Gletschers an dieser Arbeit beteiligt ist. Die rein mechanische Wirkung kombiniert sich hierbei mit einer physikalischen Sonderleistung. Das Eis läßt den Grund, auf dem es gleitet, immer wieder gefrieren. An seiner eigenen Oberfläche aber schmilzt es und die Schmelzwasser wissen sich sehr wohl den Weg zu dem Grund zu bahnen und den Boden wieder aufzutauen. In diesem Wechselspiel zermürbt er sich, und so führt das über ihn hinrieselnde Schmelzwasser einen feinen Schlamm (Till) und gröberen Grus mit sich. Diese mechanischen Bestandteile sind nun unter der Gewalt des Eisdruckes wahrhafte Werkzeuge zur Bearbeitung der Berge. Der Schlamm wirkt wie Bolus in der Hand des Marmorschleifers, er glättet, ja er poliert wahrhaft den Felsenkern des Untergrundes. Der Gletscher dringt nämlich immer bis zum unverwitterten Kern der Erdrinde vor; er denudiert mit einer Kraft, Schnelligkeit und Präzision, die den Kräften des Wassers weit überlegen ist. Darum verrät sich das Vorhandensein eines Gletschers für immer an den Schliffflächen, die er hinterläßt. Allerdings wird der Stein, der dadurch geglättet wird, durch die auf ihm mit Gewalt entlang gezogenen größeren Gesteinsbrocken auch wieder zerkratzt und geschrammt. Der Gletscher hinterläßt auf diese Weise eine Schrift, aus welcher in der Sprache der Natur zu lesen ist, wie groß, wie mächtig der Gletscher war, welche Art von Material er mit sich führte, wie rasch er sich bewegte, welchen Winkel also sein Gehänge einnahm, welche Richtung er einschlug und ob er diese Richtung abänderte.
Alle diese Erscheinungen der » Grundmoräne« werden in der Mitte des Gletschers intensiver sein, da nach einem einfachen, mechanischen Gesetz da die Oberflächengeschwindigkeit des Eises am größten ist. Es wird daher der Aushub in einem Streifen, der etwa der Gletscherachse entspricht, viel kräftiger sein. So wirkt der Gletscher talbildend. Er verleiht der Mulde, die er vertieft, die Form eines Troges, drückt ihr für immer die jedem Alpenreisenden so vertraute U-förmige Gestalt auf und prägt so dem Hochgebirge neue Züge ins Antlitz (vgl. Abb. 26).
Die Geschiebemergel der Grundmoräne rollen im Zuge des Eises mit; sie haben die Tendenz, sich vor dem Gletscher anzuhäufen, da namentlich die kleineren Bestandteile von den Eisbächen dort zusammengeschwemmt werden. Es wird daher die Zunge des Eises von einem Wall umgeben werden, in dem sich die großen Blöcke unvergleichlich länger konservieren, als die Masse der kleinen und kleinsten Brocken, welche immer die Tendenz aufweist, in Sand (Geschiebesand) und Lehm zu zerfallen, wobei namentlich die Kalkstücke rasch von den Atmosphärilien aufgezehrt werden. An diesen Stirnmoränen beteiligen sich natürlich auch die eckigen Steine, die, auf der Oberfläche des Eises mitgeführt, nach und nach von dessen Harnisch abwärts rollen.

Abb. 26. Die Charaktererscheinungen eines Gletschers. Man sieht die an der Oberfläche seitwärts abgeschobenen Geschiebemengen der Seitenmoränen, das durch den Eisstrom eingetiefte |_| förmige Trogtal, die durch das Eis scharf zugespitzten Bergformen. Motiv aus der Montblanc-Gruppe.
Zur Grundmoräne und Stirnmoräne gesellen sich dann auch noch die Randmoränen, welche nur durch den Steinschlag auf dem Weg des Gletschers zustande kommen und von der meist gewölbten Eismasse nach beiden Seiten abgeworfen werden. Sie begleiten daher den ganzen Verlauf, so weit, bis er in die Ebene tritt, wo sie sich verlieren.
Die Gesamterscheinungen sind sehr mächtig, namentlich die Pressung und Abschleifung, da z. B. an dem vorhin genannten Hintereisferner Heß und Blümcke durch Tiefenlotungen eine Dicke des Eises von 224 m ermittelten und eine Gesamtdicke von 320 m wahrscheinlich machten.
Es läßt sich auf Grund der erwähnten Phänomene, im besonderen der Moränen, nach der Art ihrer Zusammensetzung, nach den großen Blöcken (Findlingen), den Gletscherschliffen und geschrammten Geschieben, ebenso nach den alten Trogtälern mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit die frühere Verbreitung von Gletschern feststellen. Auf dieser Grundlage ruhen die Angaben, daß im Kambrium das Nordkap schon einmal eine Eisdecke getragen hat, aber so, daß damals Pennsylvanien, China und Australien unter Eisesdecken lagen. Im Permokarbon treten neuerdings Eisspuren in Südafrika, Indien und Australien auf. Diese beiden Vereisungen sind an Umfang und Dauer denen überlegen, die seit dem Miozän an den heutigen Polen beginnen und von Zeit zu Zeit großen Umfang annahmen. Als Maximum dieser Vereisung sind etwa zwei Drittel von Europa mit beiläufig 6 Millionen km², in Nordamerika annähernd 10 Millionen km² mit Eis bedeckt gewesen. Gegenwärtig ist die vereiste Zone etwa auf ihrer Maximalausdehnung reduziert.
Spuren dieser Vorgänge sind nun auch im ganzen Südteil von Münchens Umgebung, sowie in den gesamten Westalpen bis gegen die steirisch-niederösterreichischen Grenzberge wahrzunehmen, sowohl als Moränen und ihre Reste, Gletscherschliffe, Findlingsblöcke, Trogtäler und Eiserosionserscheinungen in den Bergen selbst. Hieraus ist zu schließen, daß zur Zeit der Vereisung die diluvialen Gletscher bis nahe vor die Tore Münchens reichten.
Hierauf beschränkt sich im Wesen alles, was das Diluvium an den Münchner Bodenverhältnissen schuf. Es überschüttete das Tertiär mit einer Decke von, durch Schmelzwässer abgetragenen, daher fluvioglazialen Schottern der Moränen und grub in diese zusammengeschwemmten Massen einen großen, sowie mehrere leichter profilierte (Würmtal, Hachingerbach, Gleißental) Wasserrisse. Es schuf also sowohl die Bodendecke, auf welcher der Münchner baut, wie auch das Relief dieser Decke.
Im einzelnen bedeuten freilich diese einfachen Sätze eine Überfülle von merkenswerten und anziehenden Details.
Um sie ganz zu verstehen, ist es vielleicht nötig, sich zuerst das Bild in Erinnerung zu rufen, das namentlich von Penck und Brückner A. Penck und E. Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter, 8º, 1901-08. in rastloser Arbeit aus tausend Einzelfakta über den Ablauf der Eiszeit in den Alpen zusammengesetzt wurde. Wohl zu merken ist, daß dieses Bild ganz erhebliche Differenzen, sowohl in der Chronologie der Ereignisse, wie in ihrer Einzelauslegung (Fehlen der Åsar, minimale Entwicklung einer Seenplatte usw.) von den norddeutschen Verhältnissen abweicht.
Penck unterscheidet Vorstoß- und Rückzugperioden als eigentliche Eiszeiten und Interglaziale, beziehungsweise in kleinerem Maßstab als Stadien oder zuletzt als periodische Schwankungen, für die eine allgemeine Gültigkeitsdauer von 35 Jahren ermittelt wurde. Die Gletschervorstöße werden nach den vier Zuflüssen der Donau und Isar, in deren Gebiet die Spuren dieser Eiszeiten besonders ausgeprägt sind, bekanntlich als Günz-, Mindel-, Riß- und Würmeiszeit unterschieden, die Stadien als Achenseeschwankung, Bühlvorstoß, Gschnitzstadium, Daunstadium, dem dann noch Fr. Frech als Übergang zur Gegenwart ein Tribulaunstadium interkaliert.
Die von Frech modifizierte Tabelle, welche Penck-Brückner von den näheren Umständen dieser Schwankungen geben, ermöglicht die übersichtlichste Kenntnis der alpinen Diluvialvereisung, weshalb sie hier eingefügt sei (mit einigen Modifikationen):
| Schneegrenze | ||
| I. Eiszeit ( Günzeiszeit) Spuren nur in Schwaben als Deckenschotter | um 1310 m tiefer | |
| II. Eiszeit ( Mindeleiszeit) Spuren im Salzach-Krems-Trauntal als Deckenschotter | um 1400-1500 m tiefer | |
| III. Eiszeit (
Rißeiszeit) Spuren im Ill- und Lechgebiet (Hochterrassen)
Großes Interglazial, wobei die Gletscher bis zum Alpenrand zurückgingen. |
um 1400-1500 m tiefer | |
| IV. Eiszeit ( Würmeiszeit) steht hinter der II. und III. zurück (Niederterrassen) | um 1300 m tiefer | |
| Achenseeschwankung, Stausee im Inntal. Nur mehr Talgletscher im Stubaital, Ridnaun, Pfitschtal | um ca. 700 m tiefer | |
|
Bühlvorstoß, wieder ein Inngletscher bis etwa Kufstei.
Dann Zerfall der Gletschermasse in einzelne Talgletscher. |
um 900-1000 m tiefer | |
|
Gschnitzstadium, Talgletscher im Gschnitztal, Stubai usw., aber Inntal, Wipptal, Zillertal sind eisfrei.
Der Rückzug dauert fort, wird aber wiederholt unterbrochen. |
um 600 m tiefer | |
| Daunstadium. Eis bis zur heutigen Schneegrenze | um 300-400 m tiefer | |
| Tribulaunstadium (von Frech). Größere Gletscher als heute, | um 200-250 m tiefer |
Periodische Schwankungen (35 jährig), als deren Beispiel der Gurgler- und Vernagtgletscher (Ötztaler) dienen möge.
Unmittelbarer, denn aus allen Behauptungen geht aus dieser Tabelle hervor, daß das Glazialphänomen noch mitten in der Entwicklung und in lebendigem Flusse ist und die Wissenschaft ein Recht hat, die Gegenwart als Alluvium einer neuen Periode zuzuordnen. Wir leben nach wie vor im Diluvium, und zwar nach dem gebräuchlichen Jargon in einem (dem vierten) Interglazial von besonderer Intensität.
Als Haupteiszeit ist die Rißeiszeit anzusehen, während deren Dauer die Eismassen zusammengeflossen, das flache Vorland bis über den Jura, der Rhônegletscher sogar in vielhundertkilometrigem Erstrecken bis zur Gegend von Lyon das Land überzogen ( Falsan et Chantre). Der Rheingletscher drang nicht weniger weit bis Schaffhausen und Sigmaringen vor, der Isargletscher bis in die Gegend von Hohenschäftlarn, der Würmgletscher bis zum Hügelzirkus von Leutstetten.
Die Interglaziale produzierten natürlich ungeheure Wassermassen (der Hochjochferner, dessen Zunge nur 556 ha umfaßt und der 84,5 m Tiefe besitzt, hat seit dem Jahr 1848 8 m seiner Höhe verloren. Das aber beträgt 166 700 000 cbm Eis! [ Dalla Torre]), welche nicht nur den Moränenschutt vertrugen, sondern auch den Untergrund überaus kräftig erodierten. Dadurch wurden in den Schottern vorhergegangener Eiszeiten (damals wurde durch die Wasser des Günz-Mindel-Interglazials nicht nur das Moränenmaterial der Günzvereisung verschleppt, sondern auch das Pliozän im Münchner Gebiet abgetragen) tiefe Mulden ausgehöhlt, in denen dann die Schotter der nächsten Eisperiode wieder aufgenommen wurden. So liegen in den großen Glazialtälern die vier fluvioglazialen Schottermassen wie Schalen ineinander gekeilt (Abb. 27) und man trifft, von der heutigen Talsohle aufwärtssteigend, immer ältere Schotterterrassen, für die sich eine allgemein angenommene Terminologie eingeführt hat.
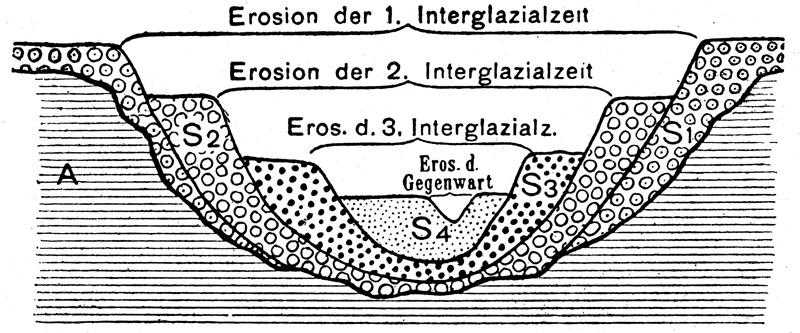
Abb. 27. Schema der fluvioglazialen Schotterdecken in der Voralpenlandschaft. Das Bild versucht die Lagerung der Terrassenschotter im Profil eines Flußtales zu erklären. A = die vorglaziale Erdrinde, in der sich der Gletscher der ersten Eiszeit ein Bett ausgewühlt hat, in dem die Erosion der ersten Zwischeneiszeit dann ihre Schotter [S 1] ablagerte. Auf ihnen liegen dann jene der folgenden Interglaziale bis zum Alluvium [S 4], in dem sich das Flußbett der Gegenwart einsenkt. Nach Sieber. Näh. S. 96.
Die Moränenschotter der ersten (Günz-)Eiszeit werden als ältere Deckenschotter (S 1) bezeichnet, die der darauffolgenden als jüngere Deckenschotter, die also aus der Mindeleiszeit stammen (S 2). Hierauf folgt die Hochterrasse (S 3) der Rißeiszeit, und als jüngste die Niederterrasse (S 4) der Würmeiszeit, in welche die Gegenwart eingreift und auf denen sie ihre postglazialen Kiesmassen ablagerte. Auch die Interglazialperioden sind beteiligt, wenn auch nicht an den Ablagerungen selbst, so doch an deren teilweiser Umwandlung. In den Jahrtausenden, in denen die jeweils vorgetragenen und durch die Schmelzwässer zerstreuten Moränenschotter frei der Verwitterung ausgesetzt waren, sonderte sich aus ihnen der Gletscherschlamm und Sand aus, wurde durch Regen und fließendes Wasser verschleppt und als Lehm, Löß und Sand wieder abgelagert. Eine lehmige, öfters auch sandige, sogar moorige, immer fruchtbare Verwitterungsdecke breitet sich über jede der Terrassen und gestattet, sie dadurch relativ leicht auseinander zu halten.
Die älteren Deckenschotter führen so gut wie gar keine Tierreste, dagegen sind in den Hochterrassen-, und besonders in den Niederterrassenschottern relativ häufig Tierreste eingeschlossen, deren Leitformen, wenigstens auf dem für uns in Betracht kommenden Gebiet vor allem das Mammut ( Elephas primigenius), das Rhinozeros mit der Nasenscheidewand ( Rhinoceros tichorrhinus und Merckii) (Abb. 22), im Lehm und Kalktuff ferner eine typische Schneckenfauna ( Succinea oblonga, Pupa muscorum, Helix arbustorum, Helix nemoralis und andere Arten) sowie Characeennüßchen sind.
In den Höhlen Württembergs und des übrigen Deutschlands gesellt sich dazu noch eine merkwürdige Welt von Renntieren, Elchen, Torfrindern, Bisons, Höhlenhyänen, Höhlenlöwen, Riesenhirschen, Höhlenbären, auch fossilen Pferden, so daß man sich ein ziemlich plastisches Bild der Interglazialzeiten unseres Gebietes machen kann.
Alle diese Schotterfelder sind in verschiedenster Entwicklung auf dem weiten Plangebiet vom Bodensee bis Salzburg aufgeschüttet und durch spätere Vorgänge entweder vertragen oder verfestigt. Die ausgedehntesten gehen von den Endmoränen des bodanischen Gletschers (Bodensee) südlich von Biberach und bei Leutkirch aus und reichen fast bis zur Donau bei Ulm. In komplizierter Weise sind die Altmoränen mit den Hochterrassenschottern ineinander gelagert, förmlich verzahnt. Auch zwischen Iller und Lech sind die verschiedenaltrigen Schotter völlig ineinander geschaltet, die jüngeren Deckenschotter in die älteren eingesenkt, die sie auch wahrhaft zudecken, während die jüngeren ihren Namen, der von hier abgeleitet wurde, durchaus rechtfertigen, indem sie sich als höhere und niedere Terrasse entlang der Flüsse lagern.
Die Allgäuer und Bayrischen Alpen schoben nur wesentlich kleinere Gletschermassen in das Vorland hinaus. Die den Weg ins Flachland findenden Iller-, Wertach- und Lechgletscher sind dort zu einer Eisbarrière verschmolzen, wie sie heute noch in Grönland, noch schöner aber im vergletscherten Vorland des südpolaren Hochgebirges zu sehen ist. Nur die große Gletschermasse unmittelbar südlich von München (Ammer-, Würm-, Loisach- und Isargletscher) erhielten von dem ungeheuren Inngletscher, der aus dem Zillertal und der Ötztaler- und Stubaier- sowie Sellraingruppe gespeist wurde, ganz erhebliche Zuschüsse, weil das Eis über die relativ niedrigen Pässe (Fernpaß, Seefeld) quoll und sich dann über die Senke des Garmischer Tales, die Mulde des Walchensees und über den Kesselberg schob.
Dadurch entstand ein ausgekeilter Eiswall, der sich bis zur Gegend von Gauting im Würmtal und etwa Bayerbrunn im Isartal, demnach bis zur Breite von München vorschob. Der Ausgang des Gleißentales mit dem Deininger Filz umzirkt ebenso ein altes See- und Gletscherbecken, wie der Moränenzirkus von Leutstetten den Starnberger See. Am weitesten in die Ebene vorgeschoben war übrigens der Ammergletscher, dessen Zweigbecken noch in der Umwallung des Pilsen- und Wörthsees, dessen Endmoräne bei Gilching noch wohl kenntlich ist.
Die Ablagerungen der letzten Eiszeit unterscheiden sich von allen vorhergehenden durch ihre Frische und die besonders gute Erhaltung ihrer Formen. Fast alle gut erhaltenen Endmoränen gehören der Würmeiszeit an. Ihre Niederterrassenschotter (eigentlich Hvitåglazialbildungen) fügen sich fast durchwegs den heute noch benutzten Talrinnen ein und lassen nirgends Löß als Verwitterungsdecke, als Zeichen der schon weit vorgeschrittenen Zersetzung erkennen. In sie sind die Flüsse am tiefsten eingeschnitten, obschon deren wahre Erosionsarbeit immer wieder durch sich neuerdings überlagernde Decken beeinträchtigt wurde.
Interessanterweise gibt es an mehreren Stellen des Vorlandes und des alpinen Grenzwalles auch Anhaltspunkte, um auch die interglazialen Ablagerungen in ganz bestimmter Weise einordnen zu können. Die nennenswertesten davon, die Höttinger Breccie und die diluvialen Kohlebildungen, vervollständigen so wesentlich das Bild der Eiszeit und sind für die Beurteilung ihrer Entstehung so wichtig, daß ich nicht umhin kann, auch sie wenigstens in Kürze hier zu werten.
Bekanntlich ist nahe dem Innsbrucker Vorort Hötting zwischen zwei Moränen der Mindel- und Rißeiszeit eine Breccie erhalten geblieben, in der eine Anzahl Pflanzenblätter abgedrückt sind, die R. Wettstein untersucht hat. Darunter befinden sich auch (von 38) folgende Arten: Rhododendron ponticum, Buxus sempervirens, Rhamnus hoettingensis, Arbutussp. 70 Prozent der gefundenen Arten leben auch jetzt noch in der Umgebung der Fundstelle und nur 6 der gefundenen Arten fehlen in Nordtirol und kommen auf den Kanaren, in Südtirol und am Schwarzen Meer vor.
Man hat daraus den Schluß gezogen, daß es in Tirol wenigstens in dieser einen Zwischeneiszeit nicht unerheblich wärmer war, als gegenwärtig.
Nun hat man gegen die viel Aufsehen erregende Deutung dieses Fundes eine Reihe schwerwiegender Einwendungen erhoben. Schon A. v. Kerner sprach der Hoettinger Breccie die Möglichkeit zu, präglazial oder postglazial zu sein, welch letzterer Ansicht sich auch Wettstein anschließt. Ferner entspricht diese Flora nicht so sehr einem wärmeren, wie viel mehr einem ozeanischen Klima. Gerade das Hauptbeweisstück der Höttinger Flora, das pontische Rhododendron, erträgt auch auf seinen heutigen Standorten im Vilajet Trapezunt schwere Schneelasten.
Es ist demnach wohl anzunehmen, daß die Zwischeneiszeiten immer wieder ein dem unseren ähnliches Klima mit sich brachten, nicht aber eine Wiedererwärmung, welche der Gegenwart stark überlegen ist. Nicht das ist die Hauptbedeutung des Höttinger Fundes, wie vielmehr sein Zeugnis der reichen Wiederbesiedelung des Landes, die sogar die Grundlagen für Kohlenbildung abgeben konnte. Als Übergang hierzu dienen die Torflager von Lauenburg a. Elbe, in denen nebst Kiefern, Fichten, weiden, Pappeln, Ahornen und Linden auch Samen der jetzt ausgestorbenen südlichen Seerose Brasenia purpurea gefunden wurden. In ähnlicher Gesellschaft fanden sich Brasenien auch bei Klinge (bei Kottbus), wo auch Stechpalmen und Eiben zusammen mit Nashörnern, Mammuten, Riesenhirschen und Renntieren lagern. In dasselbe Interglazial (nämlich Riß-Würmzei) ist aber auch der Taubacher Kalktuff zu verlegen, der die älteste sichere Fundstätte des eiszeitlichen Menschen in Deutschland darstellt. Auch dort ist sowohl die Mammutfauna wie eine ausgedehnte Laubwaldflora mit Walnußbäumen, Eichen, Stechpalmen und Eiben festgestellt.
Dem entspricht in den Voralpen nun die Schieferkohle von Dürnten mit ihrer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Wieder steht darin an erster Stelle das Mercksche Rhinozeros und das Mammut. Auch die » Schieferkohle« von Uznach zeugt für das gleiche. Reste von Lärchen ( Larix europaea) und Buchen bilden die Kohle, zwischen der Hirschknochen ( Cervus elaphus), Reste des Urs ( Bos primigenius) und des Höhlenbären diesen Wald als nicht gerade behaglichen Aufenthaltsort des Urmenschen erscheinen lassen. Es handelt sich auch hier mehr um eine »Moorkohle«, also ein Waldmoor, wie bei Lauenburg.
Der anziehendste dieser Funde für die Münchner Naturgeschichte aber ist die Braunkohle, die im sog. »Löwentobel« oder dem Dorfe Imberg bei Sonthofen im Allgäu vor gerade 120 Jahren auch bergmännisch erschlossen wurde. Der Bergbau wurde jedoch bald wieder eingestellt, weil die Kohle zu geringwertig war und in zu kleinen Mengen vorhanden ist.
Der Flöz ist immerhin 2-5 m mächtig und liegt auf einer gewaltigen diluvialen Nagelfluhe. Sein Hangendes ist Sand, Ton und wieder feste Nagelfluh. Darüber erstreckt sich noch ein Flöz von 1½ m Dicke mit sehr unreiner, sandig-lettiger Kohle, dessen Hangendes aus 2 m Nagelfluh und etwa 20 m hohem, wirren Moränenschutt mit gekritzten Geschieben besteht.
Die Kohle selbst setzt sich »aus mulmigen Massen zusammen, in denen plattgedrückte Holzstücke, Zweige, Koniferennadeln, Zapfen (ähnlich wie von Pinus Cortesii) liegen, untermengt mit kleinen, rundlichen, labkraut-( Galium)ähnlichen Früchten, ferner Moose (ähnlich wie Hypnum fluitans), auch Käferflügel mit noch erhaltenem Farbenglanze« ( Guembel).
Nach diesem Befund läßt sich das Ganze deuten als ein interglaziales Torfmoor, in das gefallene Bäume eingeschwemmt wurden.
Es zeigt sich an diesem Ort übrigens auch prachtvoll, welch relativ geringfügige Zeit des Eisdruckes dazu gehört, um die Moränenschotter zu der harten, in München auch oft als Werkstein verwendeten (besonders sinnig und in gewisser Hinsicht rührend ist z. B. seine Verwendung an der Basis der Münchner Frauentürme) diluvialen Nagelfluhe zu verfestigen, welche für die Gesteine der Deckenschotter kennzeichnend ist und überall im Münchner Stadtgebiet bereits an der Isar ansteht. Sie kam nicht allein dadurch zustande, daß die Eiswalze der sich über sie schiebenden, an 700-1000 m hohen, daher wie eine gigantische hydraulische Presse wirkenden Gletscher die lockeren Massen mit dem kalkigen Till verkittete. Findet sie sich doch auch noch an den Föhringer Hängen, wohin nie ein Gletscher kam. In ihren lockeren Formen entstand sie auch bereits durch das Gewicht der fluvioglazialen Schottermassen, welche sich bei dem Abschmelzen über den Untergrund wälzten, weshalb sogar schon die Münchner Niederterrasse, soweit sie unter postglazialen Kiesen liegt, eine gewisse Verfestigung aufweist.
Faßt man das Gesagte zusammen, so mag für die Sonderausprägung des Glazials auf Münchner Boden etwa folgende Tabelle gültig sein:
Präglazial. Wald- und Sumpfgebiete mit Quarzgeröllen, alpinem Erosionsschutt (durch die fluvioglazialen Geschiebe völlig weggeräumt).
Postglazial. Rückzugsschwankungen (Bühl-, Daun-, Gschnitz-, Tribulaunstadium. Die Gletscher verlassen endgültig das Vorland. Postglaziale Schotter. »Schieferkohle« von Uznach. An der Alpengrenze (in Thayingen, am Schweizerbild, in Schussenried Menschenspuren des Paläolithikum (Magdalénien). Das Postglazial führt auf der Ebene zu großen Moorbildungen und dauert bis zur Gegenwart.
Betrachtet man diese Übersicht aufmerksam, wird man finden, daß der gesamte Ablauf der vier Eiszeiten sich in einer Kurve darstellen läßt, die nur eine einzige große Steigerung (die Rißvereisung) aufweist. Von einem großen Gesichtspunkt aus gesehen kann man daher sehr wohl von einer einzigen Eiszeit sprechen, welche verschiedene Schwankungen besitzt, gleichwie auch das Postglazial sich in einzelne Stadien gliedert. Schon das macht die neueren Bestrebungen, namentlich von H. Geinitz und F. Frech verständlich, welche reiches Material zusammengetragen haben, um eine klimatische Einheitlichkeit des Glazials, mit anderen Worten: eine einzige Eiszeit nachzuweisen.
Frechs Argumentation Vgl. Fr. Frech, Aus der Vorzeit der Erde. IV. Gletscher. Leipzig, 8°. 1911. stützt sich dabei auf die meteorologischen Arbeiten von Harmer, nach denen die Höhepunkte der Vereisung in Europa und Nordamerika unmöglich zusammenfallen können. Vielmehr fällt stets eine Vereisung hier mit einem Interglazial dort zusammen, so daß die dadurch zu erfolgernde Achtzahl (in England sogar Zwölfzahl) der Eiszeiten eine ununterbrochen wirkende Ursache, also letzten Endes eine einzige Eiszeit ergeben.
Mit dieser Ansicht reimt Frech die Tatsache zusammen, daß die Tierwanderungen in der Eiszeit viel einheitlicher vor sich gehen, als sich mit solch gewaltigen Umweltsänderungen verträgt, wie sie die herrschende Lehre von der Wiedererwärmung in den Interglazialen voraussetzt.
Wir sehen in der gesamten Fauna im Diluvium nur einen zweimaligen Wechsel. Die Tierwelt tritt vom Tertiär her in die Vereisung ein, mit einer Schar wärmeliebender Tiere, wie den Elefanten ( E. antiquus), das Flußpferd ( Hippopotamus), die gestreifte Hyäne, den Leoparden. Zu Beginn der Günzeiszeit beginnt die Abwanderung, das große Sterben, die Neubildung von Formen, mit einem Wort die umfangreiche Entwicklungswelle, wie wir sie stets im ganzen Verlauf der Erdgeschichte als gesetzmäßige Folge der Milieuänderungen kennen gelernt haben. Es treten auf die arktischen Tiere, das Renntier, der Elch und Bison; die Formen des warmen Klimas bringen nun an die Kälte angepaßte neue Arten hervor: das Mercksche Rhinozeros, das wollhaarige Mammut. Die südländischen Tiere: die Flußpferde und Leoparden verlieren sich.
Es ist eine ganz selbstverständliche Voraussetzung, daß mit dem ersten Interglazial sofort wieder die wärmeliebenden Tierarten hereinströmen, zumindestens wieder Neuanpassungen erfolgen. Aber statt den verwickelten Tierwanderungen trifft man in den Interglazialen nur immer wieder die kälteangepaßte Tierwelt, obschon es sonst allgemein bekannt ist, daß Kältetiere für Wärme weit mehr empfindlich sind, denn die Wärmeformen für Abkühlung. Als im Postglazial eine Erwärmung eintrat, die vielleicht noch über das gegenwärtige Klima hinausgeht, starben die Mammute und Rhinozeren sofort aus. Sämtliche drei Interglazialzeiten aber haben sie überdauert und sind während dieser Jahrtausende auch gar nicht von Ankömmlingen aus wärmeren Klimaten verdrängt worden. Die Hochgebirgstiere (Steinbock, Gemse, Murmeltiere), die während der Eiszeit kühnlich von den Bergert herunterstiegen und die deutschen Mittelgebirge besiedelten, kehrten sofort nach der letzten Eiszeit in ihre Heimat zurück, während der Zwischeneiszeiten fiel ihnen dies jedoch in keiner Weise ein.
Merkwürdig ist auch das Verhalten der Renntiere, an deren Verbreitung die Existenz des eiszeitlichen Menschen dermaßen geknüpft war, daß mit dem nacheiszeitlichen Abzug der Renntiere auch der Mensch für einige Zeit aus Europa verschwindet und in allen Stationen der vielbestaunte Hiatus der Funde auftritt. Dieser Abzug hätte mit jedem Interglazial einsetzen müssen; er ist aber nicht erfolgt, dagegen sind sichere Belege vorhanden, daß die Renntiere auch in den Zwischeneiszeiten in Europa lebten. Gerade ihre Verbreitung liefert noch einen Beweis zugunsten der Ansicht, daß es nur eine einzige Eiszeit gegeben habe. In Italien finden sich weder Mammute noch Renntiere, Moschusochsen oder wollhaarige Rhinozerosse. Diese Tiere konnten sehr wohl wandern, sind doch in Nordamerika eiszeitliche Elefanten von der Arktis bis nach Mexiko vorgedrungen. Warum beschränken sie sich also in Europa auf die Nordseite der Alpen? Die Antwort ist unschwer und fast zwangsläufig. Weil die Alpen niemals, auch in den Zwischeneiszeiten nicht, eisfreie Übergänge hatten, woraus zu schließen ist, daß die Interglaziale keineswegs an das heutige Klima herankamen.
Es besteht also nur der Höttinger Fund, der auf der anderen Wagschale dem Schwergewicht dieser Erwägungen entgegenwirkt. Daß auch er nicht ganz beweiskräftig ist, wissen wir bereits, und so bleibt auch mir die Annahme, daß dies Diluvium nur von einer einzigen Eiszeit erfüllt sei, welche ihren Höhepunkt um die Zeit erreichte, als die Moränen an der Riß abgelagert wurden, sonst aber fortwährend kleineren und größeren klimatischen Schwankungen unterworfen war, überaus diskutabel.
Dadurch aber ist die Erklärung der Vereisung wesentlich erleichtert, da allen Hypothesen die Tatsache der fortwährenden »Wiedererwärmung« ins Gesicht schlug. Nach vielen phantastischen Versuchen verdichten sich ja alle Meinungen heute um die Pendulationstheorie, sei es in der Simrotschen Form einer bloßen pendelartigen Schwankung der Erdachse oder in der Kreichgauerschen Annahme einer förmlichen Wanderung des Nordpoles über alle Breitegrade. W. Eckardt W. Eckardt, Das Klimaproblem, S. 89-95. hat vom Standpunkt des Meteorologen hierfür eine sehr anmutende Modifikation gefunden, welche der besonders von Geinitz vertretenen Ansicht, es sei eine südliche Verlegung der Isothermen für die Vereisung verantwortlich zu machen, ebenso gerecht wird, wie den Lehren von der Polverlagerung.
Das Wetter Europas ist natürlich die Mutter der Vereisung, denn ohne große Schneefälle ist keine Eisbildung denkbar. Dieses Wetter war aber auch im Diluvium abhängig von den über den Kontinent laufenden Zyklonen, die heute von dem konstant bei Island lagernden thermischen Minimum ihren Ausgang nehmen. Wenn man nun annimmt, daß der Golfstrom etwa bei 50° C bereits abschwenkt, weil zwischen Island und Schottland eine Landbarre existiert, so ist es ohne weiteres gegeben, daß dieses thermische Minimum dann um so viel südlicher verlagert wird und die Minima dann nicht mehr über Skandinavien laufen wie heute (vgl. Abb. 17), sondern mitten durch Deutschland-Italien (besonders wichtig war die Zugstraße V auf der Abbildung). Dadurch waren reichliche Niederschläge gewährleistet. Wenn man dazu noch eine Polverschiebung annimmt, welche den Jahresdurchschnitt der Temperatur um etwa 3-4° herunterdrückt, dann genügen diese Voraussetzungen, um für folgende Erscheinungen den Schlüssel der Erklärung zu bieten. Es fällt dann in den Hauptniederschlagsmonaten (September–April–Mai) nur Schnee, und namentlich in den Alpen ist dadurch die Schneegrenze um mehr als 100 m gesenkt. Die Gletscherzungen erreichen alsbald die Täler und treten den Weg an, der im Vorstehenden so ausführlich betrachtet wurde.
Diese eklektische Deutung des Eiszeitphänomens dünkt mich derzeit die am meisten mit den Tatsachen in Einklang stehende zu sein. Ihr bereitete die »Tatsache« der Zwischeneiszeiten erhebliche Schwierigkeiten, denen die Pendulationisten dadurch auszuweichen suchten, daß sie annahmen, die Wanderung des Poles habe sich in einer Schraubenlinie bewegt. Das ist reichlich gekünstelt und geht der Schwierigkeit einfach nur dadurch aus dem Wege, daß es genau so viel behauptet, als erklärt werden soll. Auch müßten dann alle vorhergegangenen paläochronischen Klimate einer steten Schwankung ausgesetzt gewesen sein, wofür zum mindesten in der Kreide-, Jura- und Triasepoche aber auch schon gar kein Anhaltspunkt zu finden wäre. Über diese fatale Lage hilft nun die Beweisführung zugunsten einer einzigen Vereisung auf das trefflichste hinweg.
Ich verhehle nicht, daß die ganze Deutung des Eiszeitproblems heute noch im Gebiet luftiger Spekulation liegt und habe diese, in keinem inneren Zusammenhang mit meinem Problem stehende Frage auch nur nebenbei gestreift, angesichts des sehr begreiflichen Wunsches, sich auch darüber ein Bild zu machen.

Abb. 28. Typus der Moränenlandschaft vor München. Das mannigfaltig gebuckelte Terrain der Jungmoränen ist meist von Fichten bestanden oder wird als Weide benützt. (Original.)
Es sei aber die Ursache der Eiszeit wie immer beschaffen, an den Tatsachen läßt sich nicht zweifeln, daß eine Eiswalze wiederholt über die Gegend südlich der bayrischen Hauptstadt hinwegging und Stirnmoränen bis vor Gauting und Bayerbrunn vorschob. Wie gewaltig dieser immer wieder unendlich langsam vor- und zurückwandernde Eiswall, dessen Rekonstruktion Prof. Zeno Diemer in einem Kolossalgemälde im Deutschen Museum zu München versuchte, gewesen sein muß, dafür gibt es einige Anhaltspunkte. Die ihn begleitenden Moränen überziehen als Schuttdecke die Vorberge der Alpen bis in ansehnliche Höhen. Auf dem Rabenkopf bei Kochel finden sich z. B. erratische Blöcke des Isargletschers noch in 1500 m Höhe, also rund 900 m höher, als die gegenwärtige Talsohle. Es ist also sicher nicht übertrieben, wenn man sich die Vorstellung macht, die Eismasse sei 700-1000 m dick gewesen (die heutigen Alpengletscher sind über 300 m mächtig). Aus diesem kuchenförmig abgeflächten Flachlandseis, dessen Enden stets die Tendenz hatten, sich strahlenförmig auszubreiten, weshalb auch alle Endmoränenzüge fächer- und bogenartig verlaufen, erhoben sich die Tertiärberge des Vorlandes (Taubenberg, Peissenberg) entweder gar nicht oder nur als flache Aufwölbungen und Kuppeln, die letzten Glieder der Alpenkette dagegen (Zwiesel, Rabenkopf, Benediktenwand, Jocheralm, Herzogstand usw.) nur als »Nunatakr«, wie heute noch die Berge in Grönland.
Das nördliche Ende dieser Eisdecke, aus der sicher zahlreiche und ansehnliche Gletscherbäche, eigentlich wahre Flüsse, entsprangen, die sich teils neue Betten schufen (Gleißental, Glonntal bei Glonn scheinen solche zu sein), teils die vorhandenen Urtalrinnen benützten und vertieften (was auf das Isartal und wohl auch das Würmtal zutrifft), war zweifelsohne stark abgeschmolzen, aber angesichts seiner Masse doch nicht so unansehnlich, wie die Enden der heutigen Gletscher zu sein pflegen. Es ist vielmehr die Vermutung gerechtfertigt, daß es einen Eiswall darstellte (vgl. Abb. 24), wie er in Grönland, aber namentlich vor dem südpolaren Kontinent mehrfach lagert. Vor ihm türmten sich die Moränen, von denen nur mehr die Jungmoränen des Würmvorstoßes sich am ursprünglichen Orte ihrer letzten Lagerung befinden und einigermaßen ein Bild dieser Verhältnisse gewähren. Alle anderen Moränen wurden durch das wiederkehrende Eis abgehobelt, nur ihre Rümpfe wurden zur Nagelfluhe verdichtet, nachdem sie schon bei der Abschmelzperiode gründlich erodiert und vertragen wurden. Es ist demnach anzunehmen, daß ihre ursprüngliche Höhe mehrere hundert Meter betragen mochte; wenn sie heute kaum 30 m, im besten Fall (Schönberg bei Leutstetten, Ampermoränen) 60-80 m ausmacht, so sind das nur mehr Moränenruinen, so wie auch das Alpengebirge selbst nur mehr das Trümmerfeld seiner einstigen Herrlichkeit ist.
Zu Beginn der Interglazialperioden gerieten diese aus kantigen und gerollten Geschieben und größeren Blöcken bestehenden Massen in Bewegung durch die Schmelzwasser, von deren überwältigender Kraft man sich kaum einen genug anschaulichen Begriff machen kann. Tag und Nacht sprangen am Eiswall brausende Bäche nieder, vereinigten sich zu von Tag zu Tag ihr Bett wechselnden Flüssen und Strömen, rissen Gerölle mit, schliffen sie ab, rollten Blöcke weiter und setzten wechselweise Sand, Schlamm und Kies in stilleren Seitenarmen ab. Dann kam wieder neue Kraft in ein solches Stilleben, wieder ergossen sich grobe Gerölle darüber, und so entstand nach und nach die Aussortierung und die Kreuzschichtung, die für alle diese, nach dem nordischen Wort hvitu = Gletschertrübe sehr richtig als hvitaglazial, gemeinhin aber als fluvioglazial bezeichneten Bildungen so charakteristisch ist.
Gewöhnlich lassen sich vor den Moränen vier Zonen und Endprodukte dieser Tätigkeit unterscheiden.
Zu innerst liegen in einem Schuttkegel, der bis zur übrig gelassenen Höhe des Moränenwalles hinaufreicht, die groben Geröllkiese (die Niederterrasse Pencks) mit erratischen Blöcken, die das Wasser nicht bewegen konnte. Auch diese Schotterebene setzt die Tendenz des Gletscherendes fort, sich fächerförmig auszubreiten. Gewöhnlich schließt sich die Arbeit eines der Haupttäler des fluvioglazialen Systems an der Moräne gleichsam als Spitze eines Dreieckes an, das sich gegen Norden zu verbreitert. München liegt auf einem solchen Schotterdreieck, und die im großen ganzen noch immer beibehaltene Dreieckform des Stadtbildes folgt nur dem Naturgesetz.
Außerhalb werden die Sande, Mergelsande und Tone ausgeschieden, die vorzugsweise die obenhin erwähnte diskordante Parallelstruktur aufweisen. Sie entsteht dadurch, daß die Gewässer fortwährend durch Aufschüttungen in ihrem Unterlauf sich ihren Weg verlegen und sich dann genötigt sehen, frühere Kiesbände und Sande neuerdings anzuschneiden und abzutragen. Man sieht das heute unmittelbar an den Gletscherflüssen Islands, die auf diese Weise große Sandflächen aufschütten. Deren isländischen Namen: Sandr hat man auf diesen Teil der fluvioglazialen Anschwemmungen überhaupt übertragen.
An den Kiesflächen arbeitet jedoch das Wasser und der Wind nicht nur in dieser Weise. Es erfolgt auch eine Aussiebung der gelösten Gletschertrübe, die teils an den Seitenrändern, teils vor dem Sandfeld endgültig abgesetzt werden, als Lehm und Löß. Dadurch wird die große Verarmung und Verödung, welcher durch die Schotterbildung ein vom Eis verlassener Landstrich anheimfällt, einigermaßen ausgeglichen, wenn der Ersatz auch nur ein karger und in keiner Weise genügender sein kann.
Alle diese Abtragungs- und Ausschlämmungserscheinungen zeigt die Münchner Gegend in reichstem Maße; sie bestimmen das heutige Naturbild immer noch. Was für die Randgebiete der großen, nordeuropäischen Vereisung länderweit Segen bedeutet und die Fruchtbarkeit des russischen »Tscherno sem«-Gebietes, der Magdeburger Börde, der goldenen Aue und vieler ähnlicher Gebiete sichert, hat sich hier allerdings nur in kleinem Maßstab bilden können und hat mehr die Form des kalkarmen Lehmes, als des nichtentkalkten und viel fruchtbareren Löß' angenommen.
Der Lehm entstand ursprünglich aus dem Mergel, der den Geschieben fluvioglazialen Ursprunges beigemengt war, unter dem kalklösenden Einfluß des kohlensäurehaltigen Wassers, wobei die Eisenoxydulverbindungen von dem ebenfalls reichlich gelösten Sauerstoff oxydiert wurden. Dadurch bildet sich aus dem gelblichen oder bläulichen Mergel ein eisenrosthaltiger, brauner, mehr oder minder kalkarmer Lehm. Das gleiche erfolgt auch ohne Zutun der Flüsse durch Luft und Regenwasser allein auf der Oberfläche der Moränen, welche daher, wenn sie etwas älter sind, immer mit einer Decke von Verwitterungslehm überkrustet werden.
Wenn dagegen die Aussiebung nicht durch das Wasser, sondern durch den Wind erfolgt, behält der im Windschatten nach Art von Dünen zusammengewehte Lehm seinen Kalkgehalt und wird dann als Löß durch seine Porosität und sonstigen, der Fruchtbarkeit durchaus günstigen Qualitäten ungemein hoch geschätzt.
Der Unterschied zwischen Löß und Lehm ist auch schon rein äußerlich angedeutet durch den fast absoluten Mangel an Versteinerungen im Lehm, während der Löß bekanntlich reich von einer ganz bestimmten Schneckenfauna durchsetzt ist. Pupa muscorum, Helix hispida und Succinea oblonga sind die charakteristischen Lößschnecken. Sie und die typischen »Lößkindel« Die »Lößkindel« oder Lößpuppen sind durch die Auslaugung im Regen und nachherige Wiederabscheidung entstandene Konkretionen., sowie manchmal eine reiche Säugetierfauna und Reste des diluvialen Menschen geben jeder Lößlandschaft das Gepräge.
Daß der wahre Löß nur äolischen Ursprungs ist, geht schon daraus hervor, daß in allen glazialen Lößgebieten, manchmal als wahres Pflaster, Dreikanter, also vom Wind geschliffene, größere Gesteinstrümmer vorhanden sind (prachtvoll entwickelt z. B. in der Dresdner Heide). Daß aber solche in der Münchner Umgebung fast fehlen, ist ein weiterer Beweis für den (ausgeschwemmten) anderen Ursprung der kärglichen Lößdecke, wenngleich auch in ihr mehrfach die typische Begleitfauna vorhanden ist.
*
Alle diese Phänomene haben in der Münchner Gegend ihre lokale Ausprägung gefunden, die, viel studiert und sich auch auf jedem Schritt vor die Tore der Stadt den Blicken darbietend, keinem Münchner, der die Gesetze seiner Vaterstadt verstehen will, fremd sein dürfen.
Einzelnes davon – wie fast immer die Kuriositäten – ist ja auch der großen Menge geläufig; das große Gesetz, das gemeinsam hinter allem steht, was wir hier in dieser Stadt erleben und tun, ist freilich noch niemals in seinen, von den Tiefen der Natur bis zu den letzten Ausläufern der Kultur hinauf reichenden Verzweigungen einheitlich betrachtet worden.
Weitbekannt sind von allen Münchner Glazialphänomen nur die Findlingsblöcke, die da und dort in der südlichen Umgebung zerstreut liegen, und einiges von den älteren Nagelfluhbildungen, die namentlich im Isartal auffälliger anstehen. Eine davon, im Volksmund »der Georgenstein« (auch der »Große Heiner«) genannt, wird vielfach fälschlich für den größten erratischen Block der Münchner Gegend gehalten. Er ist nichts anderes, als ein vom Isarland in das Bett des Flusses abgestürztes Stück älterer Deckenschotter, eine echte Nagelfluhe, um deren Durchsägung das Wasser eifrig bemüht ist (Abb. 29). Schon hat es darin eine tiefe Hohlkehle ausgenagt, deren Betrachtung für den, der Abrasionserscheinungen aus eigenem Augenschein kennen lernen will, nicht ohne Wert ist. Die größten Findlingsblöcke hat die Eiszeit mit dem Würmgletscher in das Vorland herabgeschleppt. Die ansehnlichsten liegen bei Percha am Starnberger See, bei der Haarkirchener Mühle, bei Kempfenhausen und im Haarkirchener Walde.
Der an der Mühle liegende besteht aus Glimmergneiß, ist 5 m breit und 2½ m hoch, also sehr ansehnlich. Auf ihm wächst das Farnkraut Asplenium septentrionale, das ausschließlich auf Urgestein lebt und sonst um München nicht vorkommt.
Den anderen trifft man, wenn man zwischen Buchhof und Wangen von der Ausmündung des Haarkirchener Sträßchens in die Hauptstraße etwa 250 Schritte nordwärts in den Wald geht. Er ist bereits teilweise zerfallen, besitzt aber immerhin noch die Dimensionen von 1,6 × 1,75 × 1 m. Besonderen Wert verleiht ihm das sehr hübsche Gestein, ein granatführender Hornblendegneis mit 12 mm großen Granaten. Vgl. L. Ammon in Geognost. Jahresheften, 1900.

Abb. 29. Das Isartal im Winter mit dem Nagelfluhkoloß des Georgensteins. Man beachte an ihm die vom Fluß ausgeschliffene, dunkle Hohlkehle. (Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.)
Einen viertel Kilometer südlich von der obigen Straßeneinmündung liegt ein hellgrauer, glimmerreicher Gneisblock von 3 × 2,5 × 0,5 m Größe. Ein ähnlich großer aus Flasergneis liegt bei Leutstetten, wo der Weg nach Wangen abzweigt. Vgl. L. Ammon in Geognost. Jahresheften, 1900. Man trifft ihn nordwärts davon im Bergwald.
Insgesamt besitzt die Münchner Umgebung acht ganz große Findlinge, aber zahllose kleinere, z. B. zahllose Gneisblöcke im Wangener Wald. Diese Blöcke tragen eine ganz spezifische Flechtenflora, die aber keinesfalls vom Urgebirge mitgewandert ist, da die Formen nicht hochalpin sind ( Rhizocarpon distinctum, Imbricaria prolixa, Lecanora polytropa). (F. Arnold.)
Vielleicht der merkwürdigste von ihnen ist der große Block von Percha, auf dem ein Kreuz steht. Es ist ein quarzreicher, granatenführender Block aus Amphibolit, in einem Wiesentälchen nördlich von der Straße nach München, zwischen dieser und dem Pfad nach Buchhof. Früher war er wohl doppelt so groß wie jetzt, ist aber mit 3,75 × 2 × 2,5 m noch jetzt überaus ansehnlich. Dieser Hornblendeschiefer-Block muß aus dem Sellrain hierhergeschleppt worden sein, denn sein Gestein findet sich dort wieder, und man kann seltsamerweise an heiteren Frühlingstagen auch noch durch die Lücke der Kalkkette den Lisenzer Ferner in weit über 150 km Luftlinie erblicken, von dessen Eismassen er einst auf einer langen Schneckenreise an die Ufer des Starnberger Sees, der selbst wohl nichts anderes als ein altes, in der Nagelfluhe der Rißzeit eingeschürftes Gletscherbecken ist, getragen wurde.

Abb. 30. Ein Findlingsblock als Zeuge der Eiszeit im Trockentälchen zwischen Neufahrn und Wangen, zwischen Isartal und Starnbergersee. (Original.)
Viele andere Blöcke Solche gibt es bei Rieden im Würmtal, bei Hadorf (Gneis), bei Mühltal selbst (Weg zur Station Leutstetten), bei Martinsholzen (Amphibolit), um Farchach (Gneis), bei Mörlbach (Hornblendeschiefer), westlich von Niederpöcking, auch westlich von Perchting (Flyschsandstein und Kalk mit Dachsteinkorallen, Gneis und Amphibolit). Einer steht am Tutzinger Bahnhof mit der Inschrift: Ein Zeuge der Eiszeit. der Endmoränen des Würm- und Isargletschers bestehen meist aus schönem Glimmergneis, Amphibolit und nur selten aus den Gesteinen der Trias- und Flyschzone, da diese sich an sich schon schneller zersetzen. Sie bezeugen unwiderleglich, daß Material aus dem Sellrain, den Ötztalern, vielleicht auch aus den Zillertalern bis zum Starnberger See vorgeschoben wurde und daß der Gepatsch- und Vernagtferner und das Hintereis, so bizarr das auch klingen mag, ihre Eiszunge mehrere hundert Kilometer lang ausgestreckt und wieder zurückgezogen haben.
Diese Eiswalze ist ebenso bezeugt durch die berühmten Gletscherschliffe von Aufkirchen und im Isartal, wie durch eine wenig bekannte Kritzstelle im Würmtal, endlich auch durch die unzweideutige Anordnung der Moränen.
Die Kritzstelle findet man im Bahneinschnitt von Rieden, wo die Moräne sehr deutliche Schrammen aufweist.
Viel bekannter ist der durch den Deutsch-österreichischen Alpenverein geschützte Gletscherschliff von Berg, der allerdings künstlich bloßgelegt wurde. Auf dem Wege von Kempfenhausen nach Berg steht Kalktuff an, über dem die Deckenschotter liegen, die auch mitten durch den Ort gehen. Auf der Höhe gegen Aufkirchen zu ist die Nagelfluhe geschrammt und poliert. Dieser bedeutendste aller alpinen Gletscherschliffe stammt zweifelsohne von der Grundmoräne der jüngsten Eiszeit. Übrigens wurden (nach Zittel) gerade hier in dem Deckenschotter die Reste eines Pferdes gefunden ( Equus caballus fossilis).
Der Isartaler Gletscherschliff, an sich ziemlich unansehnlich, befindet sich bei Schäftlarn, oberhalb dem sog. Bruckfischer an der Straße nach Deining, wo die Nagelfluhwand an etwa 60 m Höhe hat. Er ist nicht ganz leicht zu finden und zeigt etwa eine meterbreite Schlifffläche.
Auch er kann nur der letzten Eiszeit angehören, da alle früheren, sicherlich zahlreich vorhandenen Gebilde dieser Art von den neuen Vorstößen des Eises weggewischt werden mußten.
Diese tiefgreifenden Zerstörungen sieht man ja auch den Moränen an, deren Bild dadurch so kompliziert geworden ist, daß es eines besonderen, übrigens noch nicht geschriebenen Werkes bedürfte, um ihre Topographie auszubreiten. Ich beschränke mich daher auf das Wesentlichste, was über die zwei, München durch ihr Material unmittelbar berührenden Amphitheater des Starnberger Seeendes und von Schäftlarn zu sagen ist. Einfacher gebaut ist von diesen der Moränenzirkus von Leutstetten.
Nähert man sich mit dem Dampfer dem auf und an einem Moränenwall erbauten, an Heiterkeit reichen und großstadtnahes Leben widerspiegelnden Orte Starnberg, sieht man nach Norden einen ganzen Kranz teils von wiesengrünen, teils mit schattigen Wäldern bedeckten anmutigen Höhen, die ein mooriges Tal, offenbar eine verlandete Bucht (das Wildmoos bei Leutstetten) umschließen.
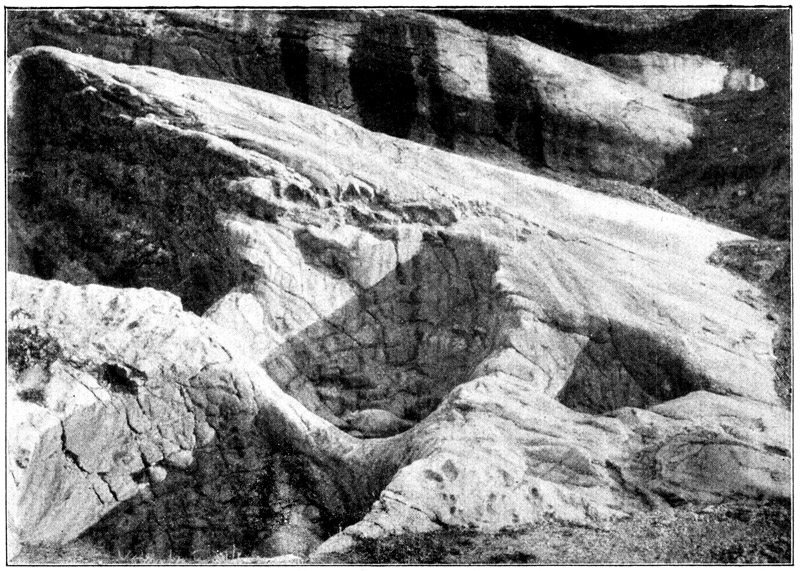
Abb. 31. Zeugen der Gewalt, mit der die Eiswalze über den Boden dahinschritt. Riesentöpfe aus der Grundmoräne, in der »Reibsteine«, von der Gewalt der Gletscherschmelzwasser umhergetrieben, tiefe Kessel aushöhlten. (Motiv von Nago.) An den glattgescheuerten Felsen erkennt man auch Gletscherschliffe, gleich denen am Starnbergersee. (Original.)
Bunt durcheinander gemischt sind in diesem Bilde alle Elemente landschaftlicher Schönheit. Der bald blau schimmernde, bald köstlich grüne See, die reichen Landhäuser, gruppiert um den Würfelbau eines alten Schlosses, die braungrüne Moorfläche, aus der leichter Höhenrauch emporsteigt, das lichte Grün der vielen Buchenwälder, der dunkle Saum der großen Fichtenforste im ferneren Grunde hinter Wangen, das gutgeschnittene Profil der Himmelslinie, die mit ganz kleinen Bergen und dem malerischen Einschnitt von Mühltal das Auge beschäftigt, das alles vereinigt sich zu einem berückenden Bild und rechtfertigt den Satz, daß die Eiszeit nicht nur das Gebirge, sondern auch weithin die Ebenen an seinem Fuß verschönte.
Der See selbst ist eingebettet in die jüngeren (inneren) Moränen, welche die Würmvergletscherung aufgetürmt hat und deren Schotterkegel als Niederterrasse bis München reicht. Auf ihnen liegen auch die Findlinge von Haarkirchen, Wangen und Rieden; dieser Gletscher schliff die zur Nagelfluhe verfestigte Moräne der Rißeiszeit bei Berg an. Sie ist es auch, die den Wall bildet, auf dem das Starnberger Schloß steht, und sie reicht über die Max Josefhöhe und das Hofbuchet bis zum Riedener Berg, wo sie von 584 m (Seespiegel) bis zu 637 m, südlich von Hanfeld sogar bis 698 m aufgetürmt ist.
Das zwischen diesen beiden Höhenzügen des Seerahmens liegende moorige Tal, dem sich der Schönberg im Norden als Riegel entgegenstellt, ist nichts als das verlandete Seeende selbst, in dem die Würm mit freundlich-braunem Moorwasser allerliebste Idyllen einschiebt.
Diese Jungmoränen umrahmen den Durchbruch, den sich der Seeabfluß in einem engen, kañonartigen Tal (Mühltal) erzwungen hat. Durch die Erosion wurde beiderseits der Hänge die diluviale Nagelfluhe, die unter den Niederterrassenschottern liegt, angeschnitten. Besonders hübsch bloßgelegt ist sie an dem Sträßchen, das von Leutstetten zum Forsthaus Mühltal hinausschlängelt Die große Kiesgrube an der Straße gehört nicht dazu, sondern ist nach Penck eine Linse von Niederterrassenschotter, die in eine Senke der älteren Schotter eingeschwemmt wurde., ebenso an dem rasch steigenden Pfad, der von diesem Forsthaus an der linken Talseite zur Königswiesener Kapelle führt. Im Engtal ganz unten ist sogar die dritte Schicht: der Deckenschotter, bei Leutstetten selbst sogar das Tertiär, der Dinotheriensand von dem Flüßchen bloßgelegt worden, so daß hier, an einem Orte, den ich unbedenklich nach 17jährigem ständigen Durchwandern der Münchner Gegend für den lieblichsten im ganzen näheren Umkreis erklären muß, eines der geologisch lehrreichsten Profile zur Entstehung der Münchner Landschaft dem Auge offen liegt.
Eine deutsche Idylle, würdig der Feder eines Stifter oder Eichendorff, ist der Platz. Namentlich vom Hochrand aus gesehen (sogar vom fahrenden Zug erschließt sich etwas von seiner Schönheit), leitet er den Blick weit über Buchenwälder, die auf schöngewellten Hügeln stehen. Unten glitzert der Silberfaden des Flüßchens, ein paar Fischteiche schlagen klare Augen auf, das Waldhaus liegt eingefaßt von frischem Grün. Sonst ist keine Spur der Menschen sichtbar; einfach, duftig, still, vom leis melancholischen Hauch, der über aller unberührten Natur webt, umwittert, liegt das Tal, über dessen fernen Himmelsrand ganz schwach und grau da und dort ein Hochberg lugt. Die Wolken ziehen wie weiße Schwäne durch den weiten Raum und nichts verrät, daß kaum fünfzehntausend Meter weiter die kranke Hitze einer Großstadt pocht und nach Erlösung von der Qual verrannten Lebens seufzt.
Der Nagelfluhrand begleitet im Osten das Tal bis zur sagenumwobenen Reismühle, wo unfern ein paar Trockentäler abzweigen, wendet dann zurück im Bogen nach dem Ober-Dill und Wangen. Er umschließt damit ein Halbrund, das, ganz von Wäldern bedeckt, durch seine Flora (es sind fast ausschließlich Buchen), so wie die tiefen Wasserrisse verrät, daß es aus Lehm aufgebaut ist. Die fluvioglazialen Wässer arbeiteten hier an der Jungmoräne; ihr Abzug ist in den trockenen, tiefen Einschnitten, in denen man jetzt bequem spazieren gehen kann, noch deutlich sichtbar.
Ähnliche Deckenschotterränder umgeben auch das sehr freundliche Tal, das von dem Örtchen Neufahrn an einem erratischen Block vorbei (Abb. 30) nach Wangen leitet; von dort führen sie wieder teils nach Percha, teils zum oberen Dill, auch hier mehrfach von Erratika begleitet.
Von den älteren (äußeren) Moränen ist nördlich dieser Gegend nicht das Geringste erhalten, sondern alles Gebiet von Gauting bis München ist nur mehr mit den Niederterrassenschottern überschüttet, in die das flache und nun immer reizloser werdende Tal der Würm eingeschnitten ist.

Abb. 32. Ein Teil des Moränenzirkus von Mühltal im Isartal mit dem Blick auf die Isar. Man blickt auf die Höhen von Hornstein und in die Mulde des Isartales. (Original.)
Daß darunter das Tertiär liegt, verrät die Quelle des Elfriedabades, ein erdig-alkalisches Schwefelwasser, das wohl einer Schwefelkieseinlagerung entspringt.
Anders westlich der Würm. Dort, wo die Nagelfluhe den Bahneinschnitt quert und der Gletscherschliff von Rieden aufgedeckt ist, zieht ein Deckenschotterrand am Nordhang der Jungmoräne bis in den Winkel der Straßen, die von Starnberg und Mühltal nach Handorf streben. Dort sind gleichfalls (nach Ammon) die Spuren eines Gletscherschliffes vorhanden. Nördlich von dem letztgenannten Orte ziehen sich auf einem flachen Rücken, der bis Hausen und den beiden Brunn reicht und landwirtschaftlich ausgenutzt ist, die stark verwaschenen Altmoränen der vorletzten Vergletscherung mit ihrer Lehmdecke, die dann bei Argelsried-Gilching verläuft. Alles Nördliche, also vor allem der große Kreutzinger Forst, der mit seinen Ausläufern eigentlich bis in die Gatterburganlagen von Pasing reicht, trägt wieder die Decke der Niederterrasse.
Noch komplizierter sind die Ausläufer des Amphitheaters der Jungmoränen des Isargletschers, die sich von der, jedem Münchner Spaziergänger wohlbekannten »Birg« bei Hohenschäftlarn über diesen Ort nach Ebenhausen, dann rechts der Isar über Beigarten-Kleindingharting bis Ebertshausen als Stirnmoränenwall ziehen.
Den schönsten Anblick dieses Höhenzirkus genießt man wieder von einem Mühltal, nämlich von der einsam gelegenen Mühle an der Isar nördlich vom Bruckfischer aus, die durch ihren hundertjährigen Kornelkirschbaum ohnedies schon eine der bayrischen Naturmerkwürdigkeiten ist. (Vgl. Abb. 32.)
Gegen Abend zu ist dieser Blick von klassischer Ruhe und Abgeklärtheit. Über den Isarhöhen im Süden das sinkende Licht, in immer zarteren Farben verklärt, bis zum weißschimmernden Gletscher des Zugspitzstockes, der das Bild abschließt; unten die rauschende Isar mit Wellensilber und blinkenden Altwasserspiegeln, an denen wuchernde Auvegetation vielgestaltige Blätter breitet. Der breite Wiesenplan, den eine besonders schöne Frühjahrsvegetation ziert, tiefe Schatten naher Wälder und darum der Rahmen hoher (die Ludwigshöhe ist 690 m hoch, die Reschenauer Höhe, der Ickinger Steilrand 705 m), mit sehr ruhiger Hand gezogener Hügelketten – das ist das Bild des Schäftlarner Endmoränenkessels, von dem der meiste Schotter stammt, auf den Münchner Füße treten. Auf diesem Moränenrücken liegen natürlich auch Findlinge. Einen solchen kennt man bei Icking, über der Straße östlich von Irschenhausen, einen anderen nördlich von Ebenhausen, östlich vom Pfad, der nach Hohenschäftlarn führt. Dieser Block muß die Aufmerksamkeit besonders fesseln, denn er ist ein Dreikanter, so ziemlich der einzige Beweis in der Gegend, daß im Postglazial auch hier die Steppenwinde bliesen. Auf dem Stirnwall der Erdmoräne liegen auch noch bei dem Tälchen, das von Heilafing nach dem oben genannten Mühltal herausführt, am Waldgehänge drei Blöcke eines biotithaltigen Augengneißes, die die ansehnliche Länge von zwei und fünf Meter erreichen. Weitere Gneisblöcke liegen am Ausgang des Gleißentales südlich von Dingharting und östlich von Deining, ein an dieser Stelle besonders interessanter, weil weit in die Ötztaler zurückverweisender Amphibolitblock südlich von Ebenhausen. Auch der für die Eiszeitzeugnisse unerläßliche Gletscherschliff (vgl. S. 113) fehlt an der Straße nach Deining nicht. Er ist durch besondere Wegweiser ausgezeichnet und erweckt dadurch mehr Erwartungen, als er erfüllt. Eine sehr merkwürdige Tatsache erwähnt übrigens Guembel von den Deckenschottern, die bei Höllriegelskreuth von der Isar erodiert sind. Er sagt von dieser Stelle, sie sei hier »vom Gletscher spiegelblank geschliffen« und vielleicht »präglazialen« ( sic!) Ursprungs. Ich konnte die Stelle nicht finden und gebe die Angabe Guembels nur der Kuriosität halber wieder. Die Rißvergletscherung reichte sicher nicht bis Höllriegelskreuth und das Wort präglazial ist hier an sich sinnlos.
Die jüngere Moräne begleitet hier schon von Wolfratshausen, am rechten Ufer von Ascholding an, die Isar und ist im besonderen am linken Uferrand von der Isar überaus steil profiliert, so daß hierdurch mehrfach das Tertiär entblößt wurde.
Eine solche Strecke zeigt sich, kurz nachdem die Bahn von Wolfratshausen die »Schletterleiten« emporklimmt und dabei die vom Bruckmaier-Gehöft an bis dorthin reichende Deckenschotternagelfluhe, die immer wieder in steilen Bänken abbricht, quert. Wo diese aufhört, tritt am Isarbett selbst das obere Miozän der Helix sylvana-Stufe hervor.
Das sehr breite Bett der Isar mit der Pupplinger Au und Abendau, sowie der Schotterfläche, auf denen Weidach und Nantwein liegen, ist von den Alluvialgeröllen und Sanden des Flusses erfüllt und eingeebnet, der hier noch ungezügelt allen Launen der Sedimentation nachgeben kann. Jeder Reisende nach Kochel kennt das merkwürdige, und unter den sonst so zahmen Naturverhältnissen Deutschlands wie urweltlich anmutende Bild, das man sieht, wenn der Zug von Icking her von den stattlichen Moränenhöhen zum Alluvium heruntersteigt. Über den Nebeln des Flusses streben drüben auch die Hügel bewaldet und kahl, und in der Ferne klar, dunkel und gewaltig die ernsten Linien des Hochgebirges auf. Das Flußbett selbst aber ist ein Labyrinth von Sandbänken und Schotterinseln, und dazwischen schäumt der Fluß in sechs und zehn Arme gespalten, milchig-grün, oft nur so seicht, daß man ihn durchwaten kann. Nicht unähnlich sahen wir ihn noch vor wenigen Jahren von der Höhe der Großhesseloher Brücke aus, was seitdem durch die Regulierung geändert wurde. Und ähnlich müssen wir uns auch die Münchner Isar der prähistorischen Zeit vorstellen, die sich auf weitem Sandr-Fjeld zwischen den Giesinger Höhen und dem Steilrand der Theresienhöhe in Dutzende von Inselchen und Schotterbänken zersplitterte.
Überschreitet man bei Wolfratshausen diese Alluvialebene, gelangt man bald wieder zu einem allerdings flacheren Steilrand, an dem auch die Deckenschotter anstehen, der aber alsbald mit dichtem Wald bedeckt auskeilt. Dort, wo sich seine Südspitze bei dem romantischen Wasserschloß von Ascholding verliert, ist neuerdings das Miozän entblößt. Ein dritter derartiger Aufschluß enthüllt sich am Isarhang unterhalb von Bayerbrunn, der nächste, wie wir bereits wissen (S. 84), im Weichbild der Stadt selbst, bei der Bogenhausener Brücke, wo die Dinotheriensande angeschnitten sind. An kleiner Stelle auch nahe zur Schäftlarner Brücke, unterhalb von Beigarten.
Begleitet werden diese tertiären Aufschlüsse stets von Nagelfluhwänden, die der Fluß erst über ihnen abnagen mußte, um sie freizulegen.
Sie ziehen dann entlang der ganzen Isarschlucht hin in die Stadt, abgelöst von den Hochterrassennagelfluhfelsen, die malerische Hänge bilden, an dem reizenden Spazierweg, den man von der Marienklause bis zur Großhesseloher Brücke unter ihnen, und sogar in einem Tunnel durch sie führte. Sie kehren wieder an den Hängen von Harlaching und sind in Spuren noch in den Anlagen beim Volksbad, sowie um das Maximilianeum zu verfolgen. Auf dem linken Isarufer sind sie bei Bayerbrunn in mächtigen Steilwänden nicht weniger ansehnlich entwickelt. Bei dem Elektrizitätswerk sind in sie sogar Schlote und »geologische Orgeln« (Abb. 33), gleich den ungleich berühmteren im Gleißental, durch Sickerwasser genagt, und ab und zu erkennt man höchst lehrreicher Weise auch die Terrasse von Verwitterungslehm, die sich zwischen den Deckenschottern der Mindeleiszeit und der Hochterrassennagelfluhe der Rißzeit einschiebt. Gewöhnlich sind diese Löcher, deren schönste man südlich vom Turbinenhaus beobachten kann, und die bis 10 m tief sind, mit Verwitterungslehm angefüllt. Die letzten Bänke der Nagelfluhe stehen auf dieser Seite in Prinz Ludwigshöhe und noch bei Maria-Einsiedel an. Dann verliert sich dieser, an sich weniger ausgeprägte Uferrand unter dem nivellierenden Eindruck der Großstadt.
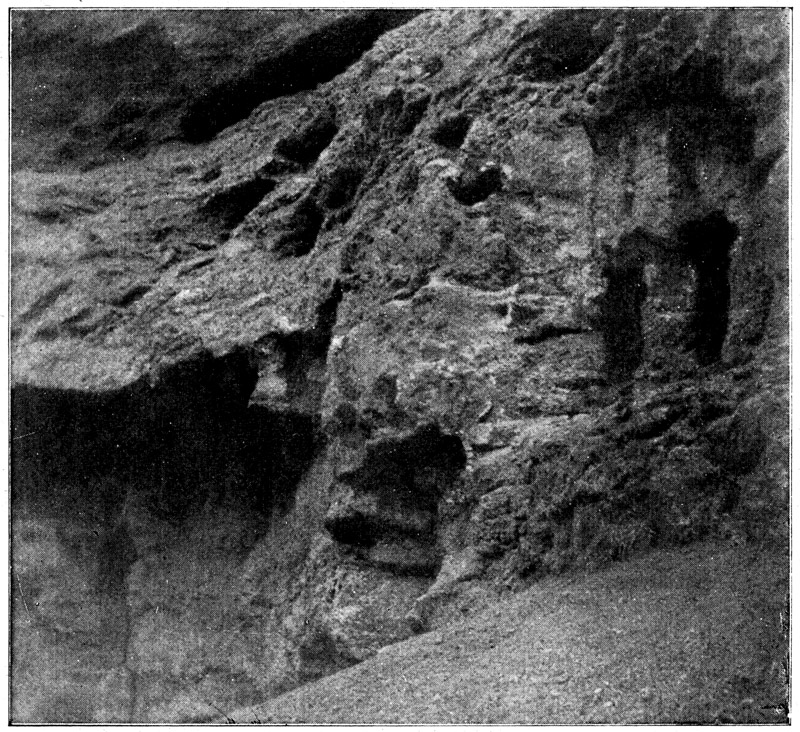
Abb. 33. »Geologische Orgeln« in der Nagelfluhe beim Elektrizitätswerk im Isartal. Man erkennt besonders gut in der Mitte des Bildes die Ansatzstellen der durch Sickerwasser genagten Schlote. (Original.)
Die Isar hat also ihr Bett durch ein Hügelland von Nagelfluhe gerissen und stellenweise, besonders zwischen Harlaching und Bayerbrunn, den Fels mit senkrechten Wänden kañonartig durchgenagt. An vielen Stellen verloren die Wände auch ihren Halt und rutschten nach. So entstand das malerische Trümmermeer zwischen der Birg und Konradshöhe am unteren Weg, desgleichen ein kleineres zwischen Bayerbrunn und den Turbinenhäusern. Auch gegenüber, unter der Römerschanze, wo ständig Abrutschungen stattfinden und wo auch einige größere Nagelfluhtrümmer in der Isar liegen. Sie sind bei jung und alt bekannt als Georgenstein und Michaelstein, vulgo Großer und Kleiner Heiner, und so populär, daß es eine Gesellschaft zur Pflege des Großen gibt (Abb. 29), der unzähligen werdenden Hochtouristen die erste Gelegenheit zu Kletterkünsten und Muterprobung bietet.

Abb. 34. Blick auf den Isarcañon von der Grünwalder Terrasse aus nach Süden. Wenn auch das Landschaftsbild durch die Regulierung der Isar von seiner Ursprünglichkeit verloren hat, so ist es noch immer ergreifend in seiner nordischen Monotonie und Verdüsterung durch die Fichtenwälder. (Original von Frau Dr. A. Friedrich-München.)
Alle diese Szenerien, überwuchert von reichem Grün und einer wahrhaft alpinen Vegetation, verleihen dem Isartal seinen besonderen Reiz, der die Wanderung in ihm zu dem Vorgenuß einer Gebirgstour steigert. Es ist die typische Eiszeitrelikten-Landschaft, in der jeder Stein von der glazialen Vergangenheit zu dem Kenner redet. Sie hat in dieser Art in Europa, ja auf der ganzen Welt, nicht ihresgleichen, und man muß schon gar kein Empfinden für die Physiognomik der Landschaft haben, wenn man, etwa von den Terrassen Grünwalds nach Süden in die Isarschlucht blickend (vgl. Abb. 34), gar nichts von dem besonderen, nur einmal vorhandenen Zauber der Isarlandschaft empfindet, der das Gemüt ergreift wie eine dunkel-süße, von herben Vergangenheiten nur zögernd, aber heiß redende Melodie. Noch immer webt Glazialstimmung um diese äußeren Fichtenhänge, die nur dort der Buchen rundes, glänzendes Grün ziert, wo die Verwitterungsterrassen Lehmboden schufen. (Am schönsten, wahrhaft »heilige Hallen« bildend beim Beerwein, südlich der Großhesseloher Brücke.)
Schon das enge Rinnsal der Isarschlucht erzählt von den alten Geschichten der Eiszeit, denn man kann sich sein Zustandekommen nicht anders vorstellen, als daß die fluvioglazialen Schmelzwässer durch ungeheure Massen von herabgeführten Trümmern am Ausfluß verhindert wurden, so wie der mit ihnen gleichsinnig laufende und auch in Verbindung stehende See des Deininger Filzes vor der Bildung des Gleißentales.
Beide schufen sich ihr Bett gewaltsam. Irgendwo wurde der Schuttberg gegen Norden zu mit Macht durchbrochen und die beschleunigte Strömung sägte dann senkrecht ihr schmales und tiefes Bett heraus.
In diese Welt sind nun gleichsam als letzte Pinselstriche einiges Vorkommen von Tuff und Löß eingesetzt. Kalktuff bildet sich aus Alm, aus einigen unter den Hochterrassen hervorkommenden Viele solcher Quellen überspülen die Pfade am Isarrand bei Pullach, auch Grünwald, hinter der Konradshöhe, an den Hängen zwischen Icking und Wolfratshausen und anderen Orten. Bei der Aumühle unter Hornstein hat sich Kalktuff dadurch in ganzen Rasen und Nestern gelagert, auch beim Aufstieg nach Puppling schreitet man über ein breites Pflaster von Kalktuff. In der Eglinger Niederung sind sogar alte Steinbrüche im Kalktuff angelegt. Quellen unweit von Schäftlarn, und eine noch nicht ganz erklärte Linse von echtem Löß ist bei Höllriegelskreuth in die Nagelfluh eingelagert.
Zu beiden Seiten des Isartales schließen sich in der inneren Zone dazu noch die Bildungen der Rißeiszeit an, in Gestalt von stark veränderten Bodenwelten, die zwischen Hohenschäftlarn-Bayerbrunn in breitem Zuge in den Forstenrieder Park und die anschließenden Wälder eindringen, an ihren Böschungen die Hochterrassenschotter der jüngeren Moränen erkennen lassen, auf ihrem breiten Rücken aber die sattsam erörterte Lehmdecke tragen. Sie ziehen hinüber als 20 und 30 m hohe Hügel gegen den Dill und finden ihren Anschluß an dem schon besprochenen Leutstettener Gebiet. Lauschig, vergraben in tiefe Waldeinsamkeit, selten besucht selbst von den Naturfreunden, da die Zugstraßen der Touristen nicht durch sie führen, verwittern hier langsam die letzten Ausläufer der größten aller alpinen Gletscher; ihre Hügelwelt markiert im »Spitzelberg«, 14 km vom Münchner Dom, einen der weitesten Punkte, den die Ötztaler Eisströme je erreicht haben. Eine ähnliche Altmoränenwelt baut sich auch zwischen Groß-Dingharting und Straßlach und nördlich davon bis gegen Wörnbrunn auf.
Wenn die Jungmoräne bei Klein-Dingharting 130 m über dem Isarufer (690 m mißt der berühmte Aussichtspunkt der Ludwigshöhe) aufgeschoben wurde, so sind die Rißmoränen im Grünwalder Park dagegen nur höchst unansehnliche Bodenwellen, die noch dazu fast ganz unter einem düsteren und einförmigen Fichtenwald begraben sind. Auch ihr Gestein ist sehr gleichartiges Kalkgeröll, während z. B. in dem großen Aufschluß, den kein Naturfreund, den sein Weg an der Kapelle am Weg von Beigarten nach Groß-Dingharting vorbeiführt, zu besichtigen versäumen soll, eine wahre Mustersammlung von Gesteinen (Granite, Gneise, namentlich Flasergneis und Gneisphyllit, Flyschsandstein) ausgebreitet ist. Südlich der Ludwigshöhe sind übrigens auch ansehnliche zwei Meter messende Findlingsblöcke von biotitreichem Gneis übriggeblieben, ähnliche finden sich auch im Frauenholz östlich vom Deininger Filz.
Von hier geht nun ein ganz kompliziertes System zusammengeschobener und ineinander gelagerter Altmoränen und ihrer Verwitterungsdecken bis Wörnbrunn und Laufzorn, sowie in die Gegend der Waldrestauration Deisenhofen. Elf und zwölf Kilometer vom Marienplatz, kaum fünftausend Meter von der Stadtperipherie, lagerte demnach der Eiswall der Rißeiszeit, von dem ein mächtiger Schutt- und Lehmkegel in ziemlich raschem Fall bis zum Erdinger Moos und die Gegend von Schleißheim von den abfließenden Wässern vertragen wurde. Deisenhofen liegt noch 594 m hoch, die Gegend des Hochreservoirs der Münchner Wasserleitung 583 m, das Sanatorium am Rand des Perlacher Forstes in 555 m Höhe, das Gefängnis von Stadelheim 543 m, der Ostbahnhof Münchens 530 m, Berg am Leim 527 m, St. Emmeran 500 m, die Moorwiesen am Föhringer Bach 506 m und die Ismaninger 498 m, das Schleißheimer Moos 479 m. Hieraus möge man den Berg von Geröll ermessen, auf dem sich die östlichen Stadtteile Münchens aufbauen.
Durch das Altmoränengebiet bahnte sich ein tiefer Wasserriß (das Gleißental), den Weg, der natürlich wieder beiderseits die Nagelfluhe bloßlegte, in der mehrfach Steinbrüche angelegt und »geologische Orgeln« (vgl. S. 35) bei Deisenhofen ausgewaschen sind.
Merkwürdig ist es, in einem solchen alten, verlassenen Flußbett zu wandern. Immer wieder dieselben Bilder stellen sich auf im öden Fichtenwald; immer wieder hemmt in der Mulde Brombeergerank den Fuß und immer neue Wegkrümmungen versperren dem begierig nach neuen Naturbildern spähenden Auge den Fernblick und zwingen es in den engen und einförmigen Lebenskreis des Fichtenhochwaldes zurück. Auch hier erteilt die Natur so wie im Isartal historischen Anschauungsunterricht. Denn so wie hier heute noch mag der ganze Schotterkegel im Postglazial mit grämlichen und reizlosen Nadelwäldern bestanden gewesen sein, zwischen denen noch die Flüsse brausten und ab und zu flache Grünmoore, nicht weniger reizlos, immerhin etwas Abwechslung in die Landschaft brachten. Ein solches Moor breitet sich an Stelle eines einstigen Sees, am Südende des Gleißentales als Deininger Filz (vgl. S. 120), ein anderes in seiner nördlichen Fortsetzung ist längst wieder zugedeckt von den Kiesgeschieben. Das merkwürdige Gewässer des Hachinger Baches quillt darin unmittelbar bei Oberhaching auf, durchfließt rasch eine Reihe Ortschaften, treibt eine Reihe Mühlen und versinkt dann nördlich von Perlach nach 12 km Lauf hart an der Grenze des Münchner Stadtgebietes spurlos im Untergrund.
Mit diesem Problem des Hachinger Baches hat sich die lokale Geologie viel beschäftigt und eine sehr einfache Deutung der merkwürdigen Tatsachen gefunden. Durch die Talfurche von Deisenhofen ist nämlich der Grundwasserspiegel bloßgelegt, darum entspringt hier dieser Bach, der nichts anderes als ein seiner Hülle beraubter Grundwasserstrom ist. Bei Unter-Haching beginnt jedoch ein unterirdisches Flinztal, wie wir solche im Münchner Untergrund genügend kennen lernten (vgl. S. 84). Natürlich muß nun auch der Bach bis zur wasserundurchlässigen Sohle hinabsickern und entsagt wieder dem Tageslicht. Aber er erblickt es bald wieder, denn im Erdinger Moos reißt ja die über den Flinz und die Kiese gebreitete Niederterrassendecke und alles Grundwasser strömt nun frei im Moore aus.
Diese von Ammon L. Ammon, Die Gegend von München, geologisch geschildert, S. 120. gegebene plausible Deutung ist so klar, daß ich ihr nichts hinzuzufügen brauche. Dagegen ist es nicht überflüssig, den Umfang der zusammengeschwemmten Schottermassen chronologisch und räumlich verteilt zu umreißen, da sie alles in München Gewordene bestimmten.
Es ist nur natürlich, daß die einzelnen Vereisungsperioden ihren Schotterkegel selbständig und anders gestalteten. Von denen der Günz- und Mindeleiszeit ist nichts erkennbar, da sie wieder durch die folgenden Eismassen zusammengeschoben und niedergewalzt wurden. Im Gebiet der Stadt München selbst gibt es keine Deckenschotter mehr, ihre Nordgrenze ist mit dem Würmtal bei Leutstetten und dem Isartal bei Pullach und Grünwald, sowie der Münchner Stadtgrenze erreicht. Die darüber zutage kommende Hochterrassennagelfluhe aber reicht entlang der ganzen Stadt bis an die letzten Verebnungen der Talränder. Der gesamte Uferrand, der die einzigartige, fast 10 km lange Promenade von der Corneliusbrücke bzw. Hochstraße bis nach Grünwald ermöglicht, welche in keiner Großstadt der Welt an Reiz und Vielfältigkeit, ungestörter Natürlichkeit der Bilder ihresgleichen hat, besteht aus Hochterrassenschottern, an denen noch unter der Menterschwaige die Nagelfluhe des Deckenschotters sichtbar wird. Die Hochterrasse zieht von dort über Harlaching, wo hübsche Nagelfluhe bei der Marienklause ansteht und in den Tierwohnungen des zoologischen Gartens malerisch mit eingebaut ist; sie geht an dem Hang weiter nach Giesing und Haidhausen bis nach Föhring, wo sie dem Isarrand von heute wieder nahekommt. Auch Ismaning wird noch von den Hochterrassenschottern umsäumt, die also wie eine Art Wall oder Zunge in das Flachland vorgeschoben sind. Dadurch sind die Stadtteile rechts der Isar nicht unerheblich erhöht und oft so malerisch profiliert, daß manche dieser alten Stadtviertel Bilder gleich einem Gebirgsort bieten (Abb. 36). Die Gartenkunst hat sich in den Gasteig- (Gacher Steig), den Maximilians- und Bogenhausener Anlagen dieser Talböschung mit so viel Glück angenommen, daß hier mehreren Orts die entzückendsten Parkbilder geschaffen sind, welche München überhaupt aufzuweisen hat. An die Hochterrassenzone aber schließen sich die zu ihr gehörigen Lehmböden an, welche namentlich von Giesing und Haidhausen ab gegen Berg am Laim (= Lehm), Ramersdorf – und dann wieder nach Föhring reichen und eine bis 3 m dicke Decke von braunem Lößlehm, östlich von Ismaning auch etwas echten Löß aufweisen.
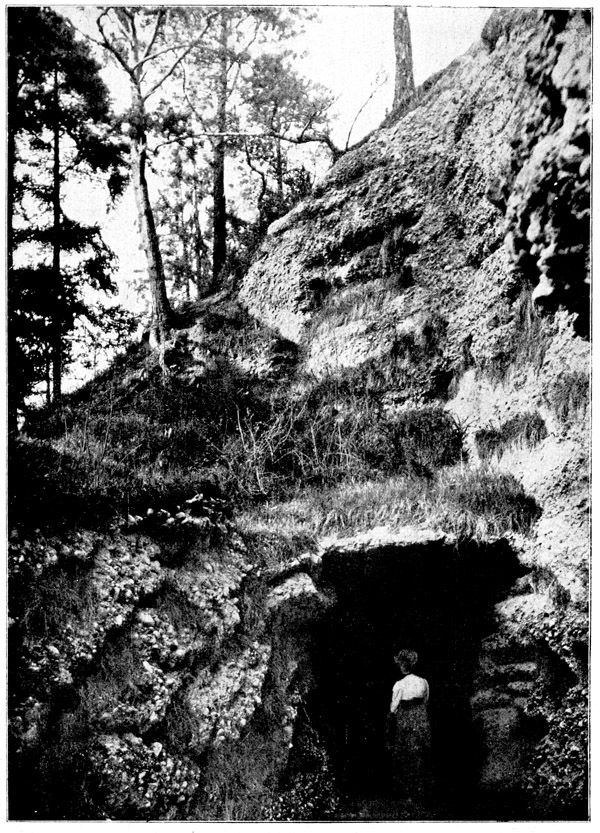
Abb. 35. Die Nagelfluhwände im Isartal im Münchner Stadtgebiet. Motiv vom Hangweg bei der Menterschwaige. Ausgezeichnet sichtbar ist der Charakter des Gesteines, das aus Geröllen mit verkittender Zwischensubstanz besteht. Hier sind die Deckenschotter aufgeschlossen, welche eine Föhren- und xerophile Grasvegetation tragen. (Original.)
Dieser Lehm ist vortreffliches Ziegeleimaterial und ebenso gute Ackererde, so daß der Osten Münchens sowohl die Begleiterscheinungen der Ziegeleigegenden (im besondern bei Echarding, Steinhausen, Bogenhausen, Priel, Zamdorf) in Bevölkerung und Lebensstil, wie eine vorwiegend landwirtschaftlich orientierte Bevölkerung in der weiteren Peripherie, also um Kirchtrudering, Riem, Englschalking, Daglfing aufweist, die hier in einer Art Heide, in waldloser Ebene, nicht viel anders dahin lebt, wie irgendwo auf den Heiden östlich von Wien.
Dieser lößartige Lehm schließt weder Lößmännchen noch Lößkonchylien ein und enthält nur etwa 3 Prozent Kalk. Dagegen ist ziemlich reichlich Quarzsand beigemengt, in dem sich mikroskopisch Granaten, Magneteisen, Zirkone, Turmalin und Rutil nachweisen lassen. Aus seiner Lagerung und dieser Zusammensetzung darf kühnlich geschlossen werden, daß er durchaus jungen Ursprungs ist. Östlich von Ismaning liegt dann auch etwas Kalktuff auf.
Die gleichen Gebilde, nur nicht so plastisch hervorgehoben, finden sich auch auf der westlichen Stadtseite wieder. Die Hochterrasse hat ihre letzte Nagelfluhe ebenfalls bereits im Stadtgebiet, etwa bei Thalkirchen, ausgestellt. Dann zieht sie als grober Schotterhang am Rand der Sendlinger Hochleite, biegt in Sendling, gerade dort, wo das Denkmal des Schmiedes von Kochel steht, aus zur Umrahmung der Theresienwiese und verschafft der Bavaria mit dem Ruhmestempel die imponierende Hochlage und die treffliche Aussicht auf das Gebirge, die durch Unachtsamkeit der Baulinienführung neuerdings leider etwas verbaut worden ist. Dann taucht sie unter das Straßenpflaster und erscheint zuletzt noch mit gewachsenem Boden im Garten des Grundstückes, auf dem das Biologische Institut bis 1919 bestand. Der weitere Verlauf ist nur mehr schwach angedeutet in der Bayerstraße und Maßmannstraße als Bodenwelle des Straßenpflasters, die sich viel früher verliert, als die Hochleite des rechten Ufers. In Riesenfeld taucht sie endgültig unter.
Auch dieser Hochterrasse ist aus den schon genügsam erörterten Gründen eine Lehmfortsetzung beigegeben, die zuerst sehr deutlich erkennbar wird als »Lehminsel« bei Solln und dort sofort Ziegeleien und eine Art Fabrikviertel ins Leben rief. Auch weiter westlich setzt sich in weiter Ausdehnung eine Lehmzunge an, die etwa von Allach, der Fasanerie Moosach, Hartmannshofen, einem Teil des »Kapuzinerhölzls« nach Laim (= Lehm) und von dort auch in das Würmtal bis etwa Maria Eich reicht und ihrem ganzen Umfang nach leicht durch das Gedeihen des Laubwaldes, namentlich der Eiche, kenntlich ist. Und wie um die Symmetrie des Kartenbildes herzustellen, ist Kalktuff in Gestalt von Sandbergen auch im Westen der Stadt abgelagert (bei Olching und Lochhausen), wo er teilweise auch industrieller Ausbeutung unterliegt.
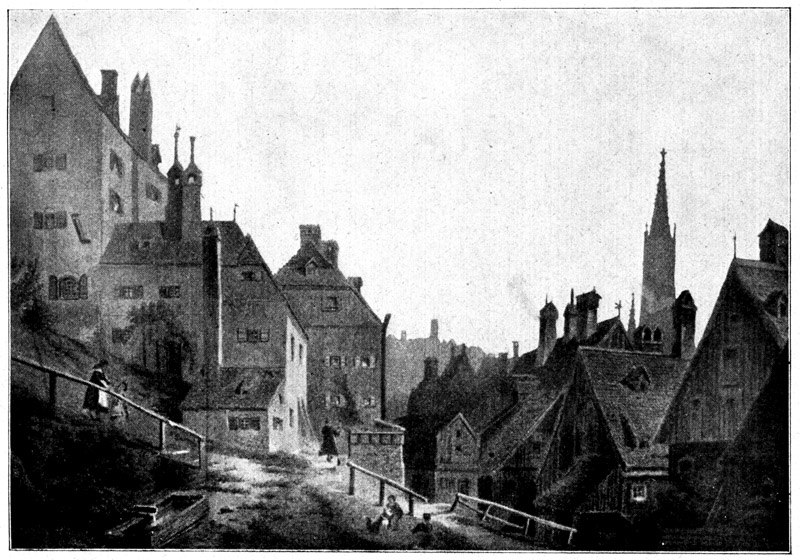
Abb. 36. Partie vom Franziskanerberg aus der Au, nächst der Quellengasse. Ansicht der Stadt aus dem Jahre 1874. Der Hang der Hochterrasse schafft hier Bilder eines Bergstädtchens. Der Turm im Hintergrund gehört zur Auerkirche. Die Holzhäuschen der Quellengasse rechts vorn vertreten den münchnerisch gewandelten »alpinen Baustil« der älteren Zeit. (Nach einem Aquarell von Max Kuhn.)
Alles übrige deckt sich mit einer gleichförmigen Decke von Niederterrassenschottern. Dieses Schwemmaterial der jüngsten Vereisung hat entweder noch keine Zeit gefunden, Lehm abzusondern oder ist dazu überhaupt nicht befähigt; jedenfalls stellt es dadurch einen Boden von hervorragender Unfruchtbarkeit dar, der kaum die Parklandschaft der Fichtenheide ernährt, die ihm eigentümlich ist.
Zusammengesetzt sind diese »pleistozänen Kiese«, wie man den eigentlichen Boden Münchens wissenschaftlich benennen muß, aus einer wahren Mustersammlung sämtlicher Gesteine von den Zentralalpen bis zu den Flyschvorbergen, natürlich alles hundertfach zerkleinert, geglättet, gerundet und abgerieben. Es fehlen nicht die Amphibolite aus dem Ötztal, sogar Gabbro von höchst unbekanntem Ursprung ist da, Diorite liegen neben Graniten, Quarziten und Gneisen. Aus dem Eozän des Alpenrandes weiß der Kenner aus den Münchner Schottergruben Nummulitenkalke aufzusammeln, aus der Kreide und dem Oligozän Flyschsandsteine; die Kreide der Alpen sandte auch die Plattenkalke mit den in Kalkspat umgewandelten schönen Korallen (namentlich Thecosmilia clathrata). Die Jurazone des Hochgebirgsrandes ist vertreten mit roten Liaskalken. Natürlich aber besteht die Hauptmasse aus dem zerschlagenen Gestein der alpinen Trias, wobei Buntsandstein stark in den Hintergrund tritt, dagegen umsomehr Wettersteinkalk mit da und dort kenntlichen Kalkalgen ( Gyroporella). Hauptdolomitbruchstücke sind nur selten vorhanden; sie werden zu leicht aufgelöst.
Die gesamte Gesteinswelt gibt sich auf diese Art ihr Stelldichein in München. Es ist ein geheimes Gesetz der Weltmechanik, das sie dazu zwingt; begründet in der Entstehungsgeschichte der Erdrinde, in den Transgressionen, der Klimamigration, den Schollensenkungen und Hebungen, der Alpenbildung, kurz in der ganzen, langen Kette, die uns vom Dunkel der ältesten Zeit bis zur Gegenwart leitete und deren Glieder lückenlos ineinander griffen. Wenn wir auf den Spazierwegen unserer Stadt wandeln, stehen wir ebenso in einem Fremdenzentrum der unbelebten Natur, wie wenn wir im Herzen dieser Stadt, am Marienplatz, die bunte Menge eines Sommermittags mustern.
So ist auch München in gewissem Sinn ein Kind der Eiszeit und mit tausend Fäden noch an die Tatsachen jener Längstvergangenheit geknüpft, die in seinem Boden sogar eine Menge Lebensreste hinterlassen hat. Der Niederterrassenschotter bestimmt in jeder Weise sein Leben, dieses Schwemmland, das noch bis zur Einmündung der Amper in die Isar das Land verödet hat und in unermeßlicher Eintönigkeit fast ganz Oberbayern und Schwaben erfüllt. Nur ab und zu wagt sich im Stadtgebiet und noch über die Stadt hinaus der Hochterrassenschotter vor, auf der Höhe von Ramersdorf bis Ismaning, am Riegel von Haidhausen, am Hügel in der Aubinger Lohe und noch am weitesten weg im Erdinger Moos.
Dieser Kies der Niederterrasse zeigt aus der schon erörterten Ursache meist Diagonalschichtung und auch viele Sandsteinbettungen, ebenso Streifen lehmig-mergeliger Art. Reste von Lebewesen enthält er natürlich, soweit sie nicht rezent sind, freilich nur zusammengeschwemmt. So sind in einer Kiesgrube bei dem alten Kirchlein St. Emmeran in Schichten, die Guembel als Unteres Mittelpleistozän diagnostiziert, viele Mollusken Hier sind vorhanden: Succinea putris, S. Pfeifferi, S. oblonga, Limnaea truncatulus, S. palustris, Patula pygmaea, Pupa muscorum, P. columnella, Planorbis rotundatus, Pisidium obtusale, Helix sericea. Von diesen ist Pupa columnella eine besondere Charakterform, die sich nicht mehr in der rezenten Fauna Bayerns findet. vorhanden. Der Penck-Brücknerschen Ausdrucksweise nach muß der Ort den Hochterrassenschottern zugerechnet werden, auf denen auch etwas weiter südlich der Ziegeleilehm aufliegt. In einer anderen Kiesgrube, noch unmittelbar in der Stadt (Ungererstraße 19), finden sich in der Niederterrasse als Leitform Limnaea pereger, dazu Charanüßchen, Hyalina cellaria, Valvata piscinalis und Helix pulchella. Hier war also einst ein stillerer Wasserarm mit reichlicher Vegetation. In einer anderen Kiesgrube bei Freimann werden ebenfalls Landschnecken angegeben, wie Pupa dolium, Helix sericea, Hyalina cellaria. Nach L. v. Ammon in Geognost. Jahresheften 1900.

Abb 37. Niederterrasse an der Isar bei Talkirchen. Mehrere solcher teils postglazialer Flußterrassen ziehen sich innerhalb des Hochterrassentales im Weichbild von München. Hier liegt das Urbild des Petersbergls oder des Tales im Stadtweichbild. (Originalaufnahme von Frau Dr. A. Friedrich-München.)
Von höheren Tieren birgt der Lehm, in dem sie am meisten zu erwarten gewesen wären, nichts; dagegen, wenigstens in den Lehmlagern südlich von Ismaning, reichlich Succinea oblonga und in den tieferen, blaugrauen Lehmschichten alle typischen Lößkonchylien.
Dagegen sind in den Niederterrassenschottern von den Gewässern herausgewühlte und verschleppte Säugetierreste in ziemlicher Anzahl bekannt geworden. Relativ häufig sind die Stoßzähne des Mammuts ( Elephas primigenius), von dem es auf diese Weise mit Sicherheit erwiesen ist, daß es zur Eiszeit vor dem Eiswall umherstrich.
Mammutzähne fanden sich bei der Aushebung des Untergrundes der Bennokirche, ebenso bei der Maximilianbrücke, auf dem Marsfeld und in Haidhausen. Das fossile Wildpferd von Berg wurde bereits erwähnt. Befremdend ist es, daß weder Nashörner, von denen doch das wollhaarige der häufigste Gefährte des Mammuts im älteren Diluvium war, noch Renntiere ( Rangifer tarandus), noch aus dem jüngsten Diluvium irgendwelche Nagetiere zutage gekommen sind. Das mag aber seine Ursache darin haben, daß München zu nahe vor dem Gletscherende liegt; die mit Riesengewalt abströmenden Schmelzwasser haben alles entführt und erst viel weiter im Norden liegen lassen. Die unerhörte Menge des Gebirgsschuttes, welche während dem Diluvium nach einer wohlbegründeten Schätzung den gesamten Kamm des Alpenwalles um 36 m erniedrigt hat, liegt zerstreut über dem weiten Vorland; es hat sie nach Abzug der Gletscher in eine lebensleere Wüste verwandelt, so traurig und verlassen von allem, was Leben heißt, daß wir nur in den trostlosen Sandrfeldern Islands dazu ein ebenbürtiges Gegenstück sehen können. Die allmähliche Neubesiedelung des Bodens hat hier allerdings verschiedene, wenn auch keine geologisch bemerkenswerten Zeugen hinterlassen, wie sie namentlich in Norddeutschland so reichlich bekannt geworden sind.
Nach den Untersuchungen von A. Blytt, G. Andersson, Nathorst und verschiedenen anderen, die dann ihren Niederschlag in einem großen Sammelwerk gefunden haben Vgl. postglaziale Klimaveränderungen. Stockholm 1910., hat man heute ein ganz zuverlässiges Bild dieses Postglazials, das in vielen Schwankungen und nur ganz allmählich in die heutigen Verhältnisse hinübergleitet, die, wenigstens im alpinen Gebiet, keineswegs als die Überwindung, sondern nur als starke Reduktion der Vereisung bezeichnet werden dürfen. Sind doch die Gletscher sogar von den Münchner Türmen aus noch immer im Gesichtskreis der Stadt sichtbar. Man erblickt vom Münchner Frauenturm, ebenso vom »Peter« und Rathausturm sowohl den Zugspitzgletscher, wie den Lisenzer Ferner im Sellrain und von den Hohen Tauern zumindestens den Groß-Venediger.
Nichts wäre so falsch, wie anzunehmen, daß sich ein ganz bestimmtes Datum für das Ende der Eiszeit ansetzen läßt. Kein Gletscher gleicht sich, nicht einmal von Jahr zu Jahr, und so muß man sich wohl vorstellen, daß in einem Durcheinander zahlloser Rückzüge und Vorstöße erst lange nach dem Einsetzen besserer klimatischer Bedingungen die Gletscherzungen definitiv das Vorland verlassen haben. Das Klima war auch um diese Zeit noch kalt, und wenn sich dadurch in dem norddeutschen Flachland, wie Nathorst nachgewiesen hat, eine arktische Flora ausgebreitet hat, so mag sich die Phantasie dieses nördliche Deutschland nicht gut anders, denn eine sibirische Tundra ausmalen.
War doch in dieser ersten Phase der deutschen Nacheiszeit Skandinavien noch 150 m hoch über dem Ostseespiegel mit einem Eiswall überdeckt. ( Yoldiaperiode, nach der das Ostmeer in zahllosen Exemplaren belebenden Yoldia arctica, die vom Weißen Meer, mit dem die Ostsee damals in Verbindung stand, einwanderte.)
Nur eine arktische Strauchvegetation konnte unter diesen Umständen aufkommen, deren Charakterpflanzen, die reizende, auf vielen Umwegen München heute noch besiedelnde Silberwurz ( Dryas octopetala), sowie nordische Weiden ( Salix polaris, Salix reticulata) und die Zwergbirke ( Betula nana) waren. Daher erscheint es gerechtfertigt, die Yoldiazeit als deutsche Dryasperiode zu bezeichnen. Das Klima war in Mitteldeutschland damals so, wie im heutigen Süd-Grönland, das heißt, einem arktischen Winter standen wenige, aber heiße Sommerwochen gegenüber, in denen auch in Skandinavien das Abschmelzen des Eises mächtig fortschritt ( De Geer).
Eine Änderung darin wird durch eine geologische Ursache markiert. Eine der Schollenhebungen erstreckte sich von Schweden bis Holstein, Mecklenburg und Pommern und sperrte die Ostsee ab. Schweden hing mit Deutschland zusammen; das Meer verwandelte sich in einen großen See voll süßem Wasser. ( Ancyluszeit, nach den darin lebenden kleinen Ancylusschnecken.) Das Klima dieser Zeit ist relativ wenig bekannt, doch deuten Funde in Gotland auf das Vorkommen von Bäumen. Wenn aber damals in Schweden Zitterpapeln und Birken leben konnten, dann mußte es in Deutschland erheblich wärmer und auch trockener sein, als zur Dryaszeit. Noch viel mehr gilt das in der jüngeren Ancyluszeit (sog. boreale Periode), in der die Kiefer erscheint und die zu einem wärmeren, als dem heutigen Klima führt. Die Esche ( Fraxinus excelsior) war viel weiter gegen Norden zu verbreitet, als gegenwärtig.
Es war die Zeit, in der die großen Moore Norddeutschlands angelegt wurden, die in ihren Resten heute noch bestehen. Gerade sie gewähren Anhaltspunkte, daß Deutschland damals immer noch das Land der Renntierjäger war; in den Mooren lagern Reste von Renen, Riesenhirschen, dem Ur und dem Elch.
Eine neue Klimaschwankung ist wieder von einem erdgeschichtlichen Ereignis von großer Tragweite eingeleitet. Es erfolgt nämlich jene Transgression, die noch in die historischen Zeiten und in die Gegenwart hin andauert. Der Sund und die beiden Belte werden zum Meeresboden, an der Wasserkante geraten in nicht geringer Ausdehnung sogar Torfmoore unter See, so daß es heute dort submarine Torfbänke gibt. Ein breiter Einbruch von Salzwasser erfolgt in die Ostsee, und in seinem Gefolge findet die Charakterschnecke Litorina litorea so weite Verbreitung, daß man den Namen der Litorinazeit von ihr ableiten kann.
Diese Litorinasenkung brachte ein Klima mit fast 1000 mm Niederschlag im Jahr und eine weitere Wärmesteigerung. Damit im Zusammenhang wieder eine Florenänderung, wobei die Eiche zum Charakterbaum Deutschlands wird und die Haselstaude weit nach Schweden vordringt. Dem Menschen bietet dieses atlantische Klima überaus günstige Lebensbedingungen, namentlich als es sich allmählich (subboreale Periode) mehr in ein kontinentales, also Steppenklima mit sehr warmen Sommern umwandelt. Es ist das Klima des Bronzezeitmenschen, dessen Zeitalter, wenn man das gesamte Postglazial auf etwa 25 000 Jahre veranschlagt, etwa in die Jahre 2500-500 v. Chr. fallen mag.
Die Untersuchung der Reste in den Torfmooren, denen die meisten dieser Einsichten entstammen, ergeben aber die betrübliche Tatsache, daß gerade mit dem Beginn des La Têne ein jäher Umschlag dieses warmen Steppenklimas erfolgt: die vielerörterte postglaziale Klimaverschlechterung, in der wir mitten darin stecken. Sie ist es, auf die sich die Ansicht jener stützt, die meinen, daß es sich bei der klimatischen Gegenwart um ein neuerliches Interglazial handle, dessen Höhepunkt bereits überschritten sei. Aber dieser Anschauung widerstreitet, daß der Beginn der subatlantischen oder der Mya-Periode, wie sie nach der für die gegenwärtige Ostseefauna kennzeichnenden Mya arenaria von der Geologie genannt wird, noch rauher und kälter auftritt (Tribulaunvorstoß Frechs), zugleich auch feuchter als die klimatische Gegenwart ist, die den Deutschen wahrlich nicht verwöhnt. Die Seen Norddeutschlands, die in der vorhergehenden Steppenzeit im Begriff waren, auszutrocknen, steigen wieder auf ihr einstiges Niveau, alle Sümpfe und namentlich die Moore nehmen an Umfang zu. Nicht die Eiche, sondern die Buche, in früherer Zeit auch die Erle, wird zum herrschenden Waldbaum. Die Buche bleibt es bis in die historische Zeit, etwa des Dreißigjährigen Krieges, nach der die Buche deutlich von der Fichte verdrängt wird, die alle Aussicht hat, in den kommenden Jahrhunderten zum Charakterbaum der deutschen Flora zu werden, wofür schon die Untersuchung der holländischen und niederdeutschen Torfmoore sehr lehrreiche Fingerzeige gewährt.
Im einzelnen sind diese Verschiebungen territorial sehr kompliziert und die Schwankungen zeitlich ungemein reich gegliedert. Trotzdem aber bietet die Tabelle von P. Menzel Aus F. Frech, Gletscher. Leipzig. 8º. 1911., wenn sie auch vornehmlich norddeutsche Verhältnisse und Funde auswertet und von mir nur in einigem ergänzt und abgeändert ist, eine vielleicht nicht unerwünschte Übersicht der geologisch-klimatischen Verhältnisse von der Würmzeit bis zur Gegenwart.
In diese Tabelle versuchte ich die alpinen Verhältnisse mit hinein zu verarbeiten, wofür in dem Postglazialsammelwerk eine Reihe von wertvollen Angaben von H. Brockmann Postglaziale Klimaveränderungen, S. 71 u. ff. zur Verfügung standen.
Für die Schweiz wird dadurch die Existenz einer xerothermen, also warmtrockenen Steppezeit zurückgewiesen, dagegen die Zeit von der maximalen Vereisung bis zur Gegenwart als eine gleichmäßige Kurve aufgefaßt, die von einem sehr ozeanischen Klima in ein mittleres überleitet.
Nicht zunehmende Temperatur, sondern abnehmende Feuchtigkeit und immer ausgesprochenere Temperaturextreme liest die Verfasserin aus den Wanderungen der Schweizer Pflanzenwelt. Ihr geht das Tertiär in der Südschweiz lückenlos von der Welt der feuchten Subtropen in die Pluvialperiode des Glazials über, um erst beim Übergang in die Gegenwart bis auf geringe Reste auszusterben. Diese Pluvialzeit beherrscht auch das Diluvium des ganzen mittelländischen Beckens und reicht weit bis nach Zentralafrika, jedenfalls über die ganze Sahara mit reichen Niederschlägen und einem tropischen Regenwaldklima, dessen Spuren man im heutigen Wüstenafrika weniger in Pflanzenresten (die versteinerten Nicolien im Wokattamgebirge bei Kairo!), als in der reichlichen Wâdibildung, welche die ganze Libysche und Arabische Wüste durchsetzt, noch wohl erkennen kann. Nach den trefflichen Untersuchungen von S. Passarge Siehe auch w. Goetz, Das Klima am Beginn der neolithischen Zeit Berlin 1907. – Vgl. S. Passarge, Ziele und Erfolge der Polarforschung. Straßburg 1897. herrschten im Diluvium in Afrika Regenverhältnisse, wie etwa heute 30° weiter nördlich, die zur Ausbildung eines reichverzweigten Flußnetzes in der Sahara führten. Es gibt sogar einen noch nachlebenden, unabweisbaren Zeugen jener Pluvialzeit in den Krokodilen im Herzen der Sahara (Miherosümpfe am Fuß des Irrhahargebirges), die nur durch Wasserläufe dorthin gewandert sein können. Speziell für Ägypten ist eine solche diluviale Regenzeit durch viele Tatsachen belegt. Im Niltal gibt es Schotterterrassen von groben Rollsteinen, wie sie dem nur feinen Schlamm ablagernden Nil völlig fremd sind. Da man in ihnen Spuren eines steinzeitlich dahinlebenden Menschen gefunden hat, ist es anzunehmen, daß diese Pluvialperiode sich noch ziemlich in das europäische Postglazial erstreckt hat. Unter diesen Umständen hat es einen gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit für sich, die Kulturblüte und Kulturverschiebung in Vorderasien und Nordafrika und ihren Übergang auf Hellas und Rom mit den klimatisch-geologischen Verschiebungen in Zusammenhang zu bringen, was ja auch in der Literatur bereits versucht worden ist.
Ob dieser Regenreichtum ursprünglich mit den Schmelzwasserdämpfen des spätglazialen (und interglazialen) europäischen Kontinentes zusammenhängt, will ich dahingestellt sein lassen. Tatsache ist, daß die alpinen und die norddeutschen Befunde nicht in einem unlöslichen Widerspruch stehen, wenn wir annehmen, daß die Südschweiz selbst mehr an der Pluvialzeit des europäischen Südens teil hatte, denn an dem harten, eisigen Schicksal des deutschen Nordens.
Schon in den Ostalpen sprechen die Funde eine ganz andere Sprache. Was Hayeck darüber in vier Punkte faßt Vgl. Sammelwerk des Postglazials, S. 115 u. ff., bestätigt das von mir in die obige Tabelle Zusammengefaßte. Diese vier Punkte besagen nämlich:
Faßt man alles dies zusammen, ergibt sich für das Münchner Vorland im Postglazial schon ein ganz bestimmtes Bild (vgl. dazu Abb. 39 auf S. 136), das unmöglich weit von der Wahrheit abweichen kann.
Die mittel- und norddeutsche Klimaschwankung, welche noch um Dresden ausgesprochene Steppenvegetation auf dem Löß (mit Dreikantern), in der Goldenen Aue um Erfurt eine reiche Steppenfauna Im besonderen Lemminge, Ziesel, Pfeifhasen und Murmeltiere. In den Lößsteppen Rußlands und des anschließenden Asiens wohnen noch heute Saigaantilopen, Steppenesel und Wildpferde. Ihnen dürften auch die deutschen Steppen geglichen haben. in Böhmen und Mähren desgleichen übrig gelassen hat, influierte den Münchner Boden ebenso, wie die Zustände der Ostalpen. Zwischen diesen, dem Süden und dem deutschen Norden ist München nun einmal seiner Bestimmung gemäß das verbindende Glied.
Es ist also anzunehmen, daß sich das subarktische Klima der Ancyluszeit hier schärfer ausgeprägt und länger fühlbar gemacht haben mag, als im mittleren Deutschland, daß aber auch das kontinentale, warme und trockene Klima nach dem raschen Rückzug der Gletscher hier nicht fehlte, wenn auch stark beeinflußt durch die unendlichen Wassermassen der Schmelzwässer, die gerade um diese Zeit die Münchner Schotterkegel geschaffen haben müssen. Wenn es auch nicht zu ausgesprochenen Steppenbildungen gekommen sein mag, so muß doch um diese Zeit die Aussonderung des Deckenlehms stattgefunden haben, der in seinem Verbreitungsbezirk auch hier die gleiche Eichenflora zuließ, wie sie im übrigen Deutschland grünte. Und unter der steten, mäßigenden Kontrolle der Alpennähe hat sich auch hier seit dem Vortreten der Italiker auf der apenninischen Halbinsel und der Einwanderung eisenbewehrter Männer im prähistorischen Deutschland die Myazeit angekündigt durch das Überwiegen der Buche und ihre allmähliche Verdrängung durch die Fichte, welche heute auf dem Münchner Boden die absolute Vorherrschaft besitzt.
Im ganzen Postglazial seit der Litorinazeit aber war im Münchner Rayon die Seenbildung, die ja auch hier zu einer gewissen »Seenplatte«-Bildung führte (Osterseen südlich des Starnberger Sees!), abgeschlossen. Die Verlandung, sowie die Moorbildung begann; die 126 Seen, die seitdem am Südfluß der Alpen verlandet sind und deren ausgedehnteste der Rosenheimer und Wolfratshauser See (der große, die gesamte Isardepression vor dem Gebirge erfüllende See, dessen Rest der Rohrsee bei Kochel ist) und der Deininger See waren, bezeugen diese Tätigkeit ebensogut, wie die Vermoorung des Leutstettner Winkels, die Bildung der großen Filze bei Fletzen im Isartal, des Dachauer, Schleißheimer, Erdinger Mooses und vieler anderer, von denen nur die letztgenannten drei, sowie der Isarsee und Deininger See Einfluß auf die Münchner Biologie gewannen. Die ersteren dadurch, daß sie in das Stadtgebiet selbst hineinreichen, an dessen Entwässerung und Versorgung teilnehmen und sich unmittelbar durch klimatische Beeinflussung geltend machen, die angestauten Massen der Schmelzwasser hinter den würmzeitlichen Moränen dagegen durch die Schaffung der Isarschlucht (vgl. S. 119) und die Ausstreuung des Schottermateriales auf dem Münchner Flinz.
Ein ähnlicher Ausbruch muß durch das Gleißental vom Deininger See her erfolgt sein; seine Schotter haben den ganz merklichen Kegel Der Ausgang des Gleißentales liegt 594 m hoch und fällt in einer sehr wohl kenntlichen Schotterabdachung schon 2 km weiter nördlich auf 583 m, in weiteren 2 km beim Bahnhof Westerham auf 563 m, dann sanfter geneigt auf 553 m (Bahnhof Unterhaching), 543 m (Bahnhof Fasangarten), 539 m (Bahnhof Giesing), 530 m (Ostbahnhof), 527 m (Sternwarte). In diesen Kegel nagte der Hachinger Bach sein Tal, an dessen Ostufer die Schotteraufschüttung noch deutlicher merkbar ist. zusammengeschwemmt, der sich von dort aus der Münchner Schotterdecke an ihrem Ostrande, bis etwa in die Gegend von Johanneskirchen verfolgbar, noch besonders auflagert.
In dieser Welt arbeitete sich nun die Isar durch den Schutt und die Gerölle und legte ihren eigenen Kalkschlamm, Sand und Kies noch dazu, mit jener Eigenwilligkeit, die alle Alpenflüsse, strotzend voll verhaltener Kraft, kennzeichnet. Sie ist es, der wir nach diesen Vorgängen das letzte Relief des Münchner Bodens verdanken.
An sich erscheint der Boden des Münchner Stadtgebietes als völlig eben, wenn auch ziemlich erheblich gegen Norden und Westen geneigt. Die Menterschweige liegt 556 m, Ramersdorf 537 m, die Gasfabrik bei Baumkirchen 528 m hoch, Fürstenried 556 m. Von da aus senkt sich der Boden, so daß die Kapelle St. Emmeran, wo das Münchner Stadtgebiet im NO endet, nur mehr 500 m, das Ludwigsbad 517 m hoch liegt. Die Fasanerie von Moosach im NW liegt in 498 m Höhe, die Moorteile bei Ludwigsfeld 492 m, dagegen Nymphenburg wieder 516 m, Laim sogar 527 m hoch. Das innere Stadtgebiet senkt sich von den 523 m des Südbahnhofs zu 513 m der Prinzregentenstraße und 510 m der Clemensstraße in Schwabing. Das schöne, oft gezeichnete Bild der Stadt, wie sie sich dem von Freising her in sie Einwandernden zeigt (Bild 38), erfüllt die Seele mit dem Eindruck einer dürren Heide, auf der nichts die Ausbreitung dieser Stadt je hemmte. Licht und freundlich dehnen sich alle Weiten, ungehindert eilen die Straßen von allen Richtungen nach dem Herzen dieses großen Organismus, aus dem bis Dachau und an klaren Tagen selbst bis Freising und Landshut sichtbar die seltsame Doppelsilhouette der Frauentürme aufragt. Nicht einmal das Stadtbild, trotzdem es viele und ansehnliche Türme und Kuppeln aufweist, vermag den Eindruck der vollkommenen horizontale aufzuheben und auch die Isarhöhen beeinflussen das Bild nicht im mindesten. Man merkt gar nichts von dem Steilrand, weil das Bett nur eingeschnitten, die kleine Hochterrasse am rechten Ufer kaum höher als die Großstadthäuser ist. Unmittelbar scheint die Ebene zu verschmelzen mit dem schönen blauen, weißgesprenkelten Band der Hochberge, die an dem Himmelsrand hingehen und selber bis zur Täuschung fernen Wolken gleichen.
Man muß in der Stadt selbst weilen, um die zarte Profilierung dieses kargen Schotterbodens zu erkennen. Er stellt ein Tal dar, dessen Sohle in großer Breite von einem mit Lehm und Alluvialkies bedeckten Auengebiet eingenommen wird (Bild 40), dessen Länge nach die Isar fließt, die sich bis zum Tertiär durchgenagt hat. Nur entlang der Kohleninsel hat die steinerne Mauer der Großstadt das Isarbett völlig eingeschnürt. Sonst ist die Au als Hirschau, Englischer Garten und Isarauen im Süden in bemerkenswerter Ursprünglichkeit erhalten geblieben. An diesen Stellen, namentlich im Nordviertel, steht das Grundwasser fast unmittelbar unter der Grasdecke; hier haben wir das feuchteste und ungesundeste Territorium der Stadt vor uns. Es ist kein Zufall, daß gerade diese Teile nicht der Bebauung zugeführt wurden. Wo es geschah (im Lehel), da bedeutete das schwere Gesundheitsschädigung der Bewohner; im besonderen war hier bis Pettenkofers Bemühungen um die Sanierung der Stadt der Typhus endemisch.
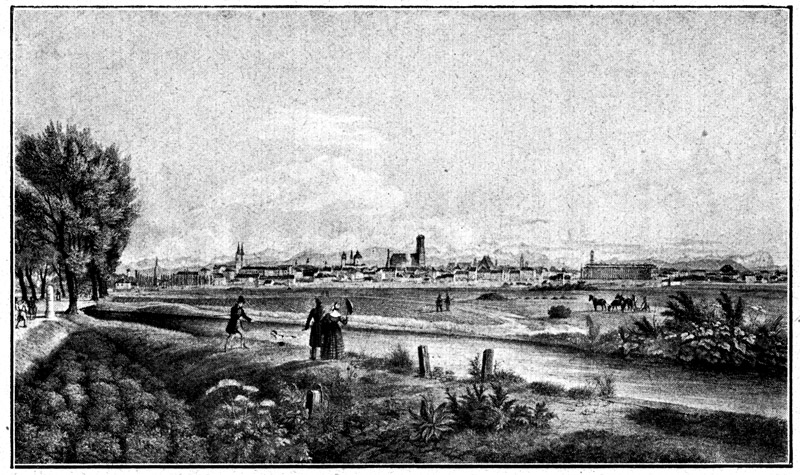
Abb. 38. Ansicht von München im Jahre 1837 von der Schwabinger Flur und Freisinger Landstraße. Im Vordergrund zieht die Würm (von der Georgenschweige kommend). Von der eine Stunde weit entfernten Stadt erkennt man von links nach rechts die Ludwigskirche, Theatinerkirche, Frauentürme (vor ihr die Salvatorkirche), den großen Baublock der Michaelskirche, Hl. Kreuzkirche, die Pinakothek (dahinter die protestantische Kirche). Vom Gebirge sind deutlich erkennbar Karwendel, Benediktenwand, hinter Theatiner- und Frauenkirche Herzogstand und hinter Pinakothek Zugspitz mit dem Höllentalgletscher (rechts). Nach Zettlers Alt-Münchner Bilderbuch.
Die etwas pathetische Inschrift auf der Exedra im Englischen Garten, der nach des Grafen Rumford weitschauenden und sehr organischen Plänen von 1799 an hier angelegt wurde: »Hier, wo du wandelst, war Sumpf nur und Wald«, ist ein Naturdenkmal, denn sie spiegelt den wahren und unabänderlichen Charakter des Englischen Gartens, so sehr ihn auch eine weitberühmte Gartenkunst umgeändert und in eine der schönsten Parkanlagen Europas umgeschaffen hat. Den gleichen Charakter trägt ein Teil der mit vollem Recht »Au« benannten Vorstadt, deren Boden nur den einen Vorzug genießt, daß er infolge der höheren Schotterdecke bei der Auer Kirche das Grundwasser schon 4 m tiefer in sich birgt. Je weiter südlich man schreitet, desto besser wird dieses Verhältnis. Schon in der »Birkenau« trägt er ein »Birket« und im Anschluß daran, in den sehr schönen, einsamen, in solcher Urwüchsigkeit bei keiner Großstadt vermuteten Auen gegen Hellabrunn zu, eine Kiefernheide, deren Grundwasserspiegel an 10 m tiefer liegt, als im Englischen Garten.
Dieses Tal wird auf der rechten Isarseite vom Hochterrassenrand des Gasteigs in wechselnder Höhe umsäumt. Am Friedensdenkmal beträgt die Differenz nur 10 m, in der Au bereits das Doppelte, bei Harlaching, wo die Eremitage steht, an der Claude Lorrain seine schönsten Bilder sah, an 30 m, und an der südlichen Stadtgrenze, wo das Isarbett in 532 m liegt, die ansehnliche Differenz von 34 m, um welche die Großhesseloher Brücke den Fluß überhöht.

Abb. 39. Schmelzwasser im Isartal, ein schwacher Nachklang der postglazialen Überschwemmungen, die trotzdem massenhaft Schotter im Isarbett zurücklassen. Motiv von den »Überfällen« in den Isaranlagen. Original.
Dieser Steilrand setzt dem durch die Rotation der Erde bewirkten Wandern des Flusses seit Urzeiten einen Damm entgegen, der nur sehr langsam abgetragen werden kann. Um so zahlreicher sind dagegen alte Uferterrassen am Westufer. Die erste, zugleich der Rand der Niederterrasse, ist jedem Münchner bekannt als Steilhang am Saum des Englischen Gartens an der Königinstraße. Dieses alte Isarufer zieht dem Park unverrückbar seine natürliche Grenze und läßt sich von hier gegen Norden weithin verfolgen, entlang der Mandlstraße, am alten Schwabinger Kirchlein, im Biedersteiner Park und an der Schwabinger Flur, wo überall der Saum von sumpfigen Niederungen begleitet wird, da aus dem Alluvium in dieser Zone das Grundwasser als Quelle von selbst hervorbricht (vgl. S. 85). Nach Süden ist der Niederterrassenrand durch die seit mehr denn einem Jahrtausend ihn immer wieder umwühlende Verbauung fast unkenntlich geworden. Nur im Zuge der alten Stadtmauer, des Eisbaches, der Tore der ältesten Stadt und in einzelnen Straßennamen, dann am »Petersbergl« läßt er sich verfolgen (Bild 40) und dann im Süden, am Sendlinger Unterfeld, wieder erkennen, wo ihn die Wolfratshauser Straße begleitet und er von Maria Einsiedel an wieder als baumumschatteter Hang die linke Talseite des Isartales markiert (vgl. Abb. 37) und sich mit dem anderen Uferrand der Hochterrasse vereinigt. Am ehesten ist dieser Abhang von der Niederterrasse ins Alluvium zu erkennen, wenn man vom Marienplatz durch die wunderlichen Bögen des alten Rathauses tritt. Die breite Geschäftsstraße senkt sich noch immer merklich und führt nicht umsonst den alten, anschaulichen Namen des Tales. Noch erinnern sich Münchner der älteren Generation daran, daß im Tal einst Wasser floß, eine Pferdeschwemme die vielbestaunte Sehenswürdigkeit ihrer Kinderzeit bildete, an deren Brücke heute nur noch mehr der Namen der Hochbrückenstraße erinnert.
Das alles war das älteste Isarbett. Eigentlich flutete das Wasser unter den Mauern des leoninischen Münchens vorbei und nur langsam wurde das weite, wüste Bett bis zur heutigen Breite eingeengt.
Vor dieser Zeit, also in der Prähistorie, aber gab es eine andere, eine Urisar, deren Rand die Hochterrasse anzeigt. Am Ufer dieser vorgeschichtlichen Isar fanden alle die fröhlichen Feste des Biedermeier-München und die manchmal mit Blut besiegelten Massenversammlungen der Münchner Revolution statt, zu Füßen der Bavaria. Der ganze Rand dieser großen Oktoberfestwiese, welche die neue Zeit wohl in Volkswiese umbenennen wird, ist durch Hochterrassenschotter gebildet. Die Höhendifferenz ist nicht erheblich und beträgt maximal nur 10 m. Schon an der Bayerstraße, deren scharfen Abfall jeder Straßenbahnschaffner und Radfahrer kennt, taucht sie unter das Straßenpflaster und verliert sich im Gewirr der Gassen, wird aber auf Oberwiesenfeld noch einmal kenntlich und verschwindet in der Gegend von Riesenfeld definitiv in den Niederterrassenschottern, welche diesen alten Talrand später überschüttet haben. Südlich von der Bavaria nimmt der Steilhang das alte Sendling gewissermaßen schützend in seinen Arm, bildet dann die Sendlinger Hochleite und vereinigt sich mit dem Rand der Niederterrasse.
So liegt, wenigstens das historische, München ganz der Isar im Arm: alles, was hier lebte, arbeitete und verging, war auf Flußkiefen geboren und zu Grabe getragen worden und an das Schicksal und Leben des Flusses geknüpft. Aber auch darüber hinaus ruht alles, was heute München heißt und im Banne dieser Stadt steht, immer noch auf den fluvioglazialen Schottern, deren Geschichte und Leben ihr eigenes Leben bestimmt.
Ein großes Schotterdreieck ist von dem Bogen der Jungmoränen abgeschwemmt worden und liegt nun ausgebreitet wie ein kalter Teppich über den warmen, weichen Sanden glücklicherer Vergangenheit. Auch diese erschienen uns nur als letztes Glied an einer uralten und endlosen Kette, deren Schmied längst nicht mehr der Genius loci, sondern das Weltenschicksal eines ganzen Gebirges, ja eines Erdteils selbst war. In je fernere Zeiten wir zurückblickten, desto gewaltigere Kräfte reckten sich auf und sprachen ihr Machtwort, um auch diese Enge, diesen Punkt im All zu bestimmen. Ferne Meere verbanden ihr Schicksal mit dem seinen, der Weg des ganzen Erdballs, das Blühen und Verwelken ganzer Erdzeitalter stand Pate an dem Lager, in dem die Zukunft Münchens beschlossen lag. Und jeder dieser Demiurgen sprach seinen Spruch; Klimamigration, Transgressionen und Regressionen, Eiszeit und Gebirgsbildung, Kalkgesetz und Polverlagerung, und wie sie alle heißen, deren dunkel über uns waltende Macht wir erforschten, bis in die geheimen Sternengesetze hinein, – sie alle bestimmten den Weg, auf dem der Boden Münchens entstand, und nicht einer dürfte fehlen – dieser Boden wäre anders, wenn auch nur einer der vielen, kleinen und großen Einflüsse, denen wir hier mit so heißem Bemühen nachgingen, ausgesetzt hätte.
Wenn irgendwas das Gefühl tiefster Gebundenheit an das Weltganze im Menschenherzen anzünden kann, so mag es der Augenblick einer solchen ergreifenden Einsicht in die Gesetzeszusammenhänge des Weltenseins sein. Alles, was auf diesem Boden sproßt, ist mit tausend Fäden an eine ganz bestimmte Weltkonstellation geknüpft, und es ist nur die Enge seiner Einsicht, wenn ein Mensch von einem fernen und weltenweiten Ding irgendwo da draußen glaubt, es sei ihm völlig fremd und habe seinem Schicksal gar nichts zu sagen.
Wer das, was ich mit dem Fleiß vieler, glücklicher Stunden hier über das Werden und Sein des Münchner Bodens zusammengetragen habe, auch wirklich tief aufgenommen hat, dem ist die Welt seiner Vaterstadt verwandt und sie ein notwendiger Bestandteil im ganzen. Die Steine reden zu ihm vom ganzen Erdenrund und die segelnde Wolke über seiner Gasse bringt die Grüße jeder Vergangenheit. Er erkennt sich selbst eingeschmiedet in einen unzerbrechlichen, eisernen Ring, aus dem gar nichts heraus kann, was zu dieser Stadt gehört. Diese tiefste Gebundenheit heißt Gesetzmäßigkeit der Natur. Und aus diesem schweren Ernst des Empfindens heraus möchte ich verstanden sein, wenn ich alles, was dieses erste Buch des vorliegenden Werkes erarbeitet hat, zusammenfasse in dem schwerwiegenden Satz: Die historisch gewordenen Grenzen von München decken sich gesetzmäßig mit der natürlichen Umgrenzung seines Lebensbezirkes! Ein Blick auf eine Karte des Münchner Stadtbezirkes und auf die hier ausgebreiteten Grenzen der Bodenbeschaffenheit genügt, um diesen merkwürdigen Satz, dem zuliebe dieses erste Buch ausgearbeitet werden mußte, zu beweisen (vgl. Abb. 40).
Das heutige Groß-München ist weit über die Grenzen seines bebauten Gebietes hinausgewachsen und nimmt dadurch in der Reihe der deutschen Großstädte die dritte Stelle ein. (Es reicht sowohl mit dem Stadtgebiet in die Moorlandschaft des Schleißheimer Mooses im Norden, wie in die Isarschlucht im Süden, während Ost und West überall heute noch an die Lehmdecken der Niederterrasse angrenzt. Dadurch umfängt der Stadtbesitz zusammen viererlei voneinander grundverschiedene Bodenformen: die eigentliche Schotterterrasse, welche auch den Stadtkern trägt und neun Zehntel des gesamten Areals bedeckt. Im Norden wurde erst durch die Einverleibung von Milbertshofen und Moosach der Rand des Moorlandes angeschnitten, von dem sich die Stadtgrenze sonst ängstlich fern hält. Im Westen schneidet die Stadtgrenze bis auf den Meter genau im Gehölz von Hartmannshofen die geologische Grenze zwischen Schottern und Deckenlehm, was sich auch in der Pflanzenwelt ausprägt; ähnliches gilt für den Nymphenburger Park und namentlich Laim, Neufriedenheim und Holzapfelskreuth mit dem anschließenden Weichselgarten, welche das Stadtgebiet wieder (z. B. in der Gegend des Waldfriedhofes ganz genau) von dem anderen Bodentypus des Würmtales abgrenzen. Im Südwesten besitzt die Stadtgrenze eine sehr auffällige Einkerbung. Die Grenzlinie wendet sich beim Unter-Dill nach Nord zurück und umkreist den leichten Hügel, auf dem Solln steht. Sie folgt dabei wieder der geologischen Karte, nämlich der Grenze zwischen den Schottern und einer Lehminsel, die bei Solln auch eine Ziegeleiindustrie ins Leben gerufen hat.

Abb. 40. Die Übereinstimmung der natürlichen Grenzen Münchens mit seiner politischen Abgrenzung. Die dunkle Linie gibt die Grenzen der eigentlichen Münchner Niederterrassenschotter an, welche in West und Ost von einem Lehmgebiet flankiert werden. Dieses ist im Osten und Süden [bei Solln] dunkel gehalten. Im Nordwesten reicht die Grenze Münchens gerade in das Moorgebiet des Dachauer Moores. Eingezeichnet in die Karte sind als dunkle Streifen auch die wichtigsten Grundwasserläufe im Weichbild der Stadt. Hierüber sowie über die Grenzen s. Einzelheiten auf S. 84 und 140.
Im Süden schneidet der Stadtbesitz gerade vor dem Beginn der Isarschlucht an der Großhesseloher Brücke ab und nimmt nur ein einziges Stück der subalpinen Landschaft des Nagelfluhrandes bis zur Harlachinger Eremitage in sich auf. Dagegen umfaßt er aus leichtverständlichen ökonomischen Gründen die gesamte Lehminsel des rechten Isarrandes von Ramersdorf bis Föhring, schneidet aber streng ab, wo auch diese endet. Namentlich auffällig deckt sich Stadt- und Naturgrenze wieder im Nordost-Winkel, wo Deining, Englschalking und Johanneskirchen von der Einverleibung ausgenommen sind. Gerade bis in ihre Gemarkung reicht aber der Moorboden von Ismaning, bzw. von Erding her. Und so wie hier vermeidet die Stadtgebietsgrenze auch links der Isar den Moorboden, und endet eigenwillig oft ganz genau dort, wo die Schotterdecke abreißt und der Almboden, also ein neuer Bodentypus beginnt.
So unverkennbar ist dieser Zusammenhang zwischen Stadtgrenze und Bodengrenze, daß sich niemand dem Eindruck des Gesetzmäßigen entziehen kann, der einmal darauf aufmerksam geworden ist. Es gälte einen ungeheuren Aktenfaszikel von Verhandlungen aufzuschlagen, wollte man im einzelnen dem nachgehen, aus welchem Mosaik von Erwerbungen und Einverleibungen sich die regellose Linie der heutigen Stadtgrenze zog. Schon der erste Versuch von Nachforschung ergibt das Erwartete, daß die scheinbar so mysteriöse Erscheinung eine sehr glatte ökonomische Ursache hat. Jeder Grundbesitzer komassiert seinen Betrieb derart, daß er die geologischen Bodengrenzen, die ihm durch die Bodenleistung noch viel feiner angezeigt werden, als sie der Agronom aufnimmt, auch als Feld- und Betriebsgrenzen wählen wird. Zur Sollner Gemarkung oder zum Johanneskirchner Bauernbesitz gehörten auf diese Weise die gesamten Lehmäcker, denen zuliebe sich die ersten Bauern von Solln einst niedergelassen haben, oder die gesamten Moorlandkulturen gerade bis zur Grenze dieses Bodentypus. Pflog die Stadt dann in der Nachbarschaft Verhandlungen, so war die Einverleibung natürlich nur möglich entweder, indem die ganze Gemarkung zu München kam oder ganz draußen blieb, wie im Fall der gewählten Beispiele.
Das aber erklärt nur den Verlauf der Grenzlinien entlang der »organischen Linien« des Bodens. Bestehen bleibt nach wie vor das Gesetz, ja, es prägt sich jetzt sogar noch schärfer aus, daß die menschlichen Siedelungszentren ihre natürlichen Grenzen in den natürlichen Bodengrenzen finden. Ganz besonders anschaulich wird das, wenn man die Entwicklung des Münchner Stadtbesitzes an Hand der historischen Urkunden verfolgt. Da zeigt sich, daß die älteste Siedelung, welche unmittelbar an den Flußkiesen, dem »Isargries«, wie diese alluvialen Schotterinseln noch bis ins 19. Jahrhundert hinein genannt wurden, angelegt wurde, ausschließlich auf der Niederterrasse stand, und sowohl das Alluvium, wie die Hochterrasse mied (Bild 40). Bekanntlich waren die Grenzen dieses ältesten Münchens das noch stehende Burgtor im Norden, das alte Rathaustor im Osten, der Löwenturm an der Mündung der Sendlingerstraße in den Färbergraben, dessen bogig gekrümmter Verlauf den alten Stadtgraben des leoninischen Münchens anzeigt, der heute fehlende Turm (Schöner Turm), dessen Andenken nur mehr ein Relief am Hause Kaufingerstraße Nr. 22 bewahrt. Den weiteren Verlauf der Stadtmauer kennzeichnen Ettstraße, Löwengrube und die Burgstraße, die zum Block der alten Residenz führt.
All das stand auf der Niederterrasse, und auch der dazu gehörige Besitz an Gärten und Feldern reichte, soweit sich das heute noch feststellen läßt, nicht über die Niederterrasse hinaus.
Als man nach dem 13. Jahrhundert an die erste große Stadterweiterung ging und das »kurfürstliche München«, wie es bis zur Aufhebung der »Festung München« im Jahre 1791 offiziell, tatsächlich aber bis ans Ende des Biedermeier bestand (vgl. den Plan auf S. 139), umflocht man nur die Stadt mit einem Kranz von Wasserarmen, die aus den Gewässern des Isargrieses abgeleitet waren; aber wieder hielt sich die Stadt von den Alluvionen geflissentlich fern und vermied ebenso die Hochterrasse, die sogar um 1840 noch als deutlicher Hang vor dem damaligen »Eisenbahnhof« entlang der Sandstraße nach Norden strich. Kaum einige Häuser erhoben sich jenseits dieses »fremden Bodens« und erst fünf Gassen waren in den Stadtplänen der Zeit westlich vom Bahnhof ausgesteckt.
Die Hochterrasse rechts der Isar und gar das Lehmplateau waren noch um 1667 kaum besiedelt; auf dem Plan von 1840 ist erst die Au in den Alluvialschottern ausgebaut, »auf den Lüften« dagegen und in Haidhausen stehen erst wenige Straßenzüge entlang der vielfrequentierten Straßen nach Wien, Rosenheim, Wasserburg und Mühldorf.
Nur widerwillig begab sich der Münchner auf anderes Territorium, als seine altgewohnten Schotter; die Auer, Haidhauser und Giesinger galten dem erbgesessenen Münchner Bürger als Fremdlinge, sie selbst fühlten sich als ein »Volk« für sich und die Vereinigung mit der Stadt in politischer Beziehung vollzog sich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Eingemeindung der letzten »Fremdorte« (Berg am Laim usf.) erst in den letzten Jahrzehnten.
In diesen vorläufig nur gestreiften Dingen und Tatsachen liegt das Problem, dem die weitere Analyse des Münchner Lebens dienen soll. Wie gestaltet sich die Besiedelung der erkannten vier Bodenarten, die sich
charakterisieren lassen, wobei als Unterabteilung sich die Nagelfluhränder des Isartales nur durch ihre Höhenlage und den unmittelbaren Zusammenhang mit dem Hochgebirge vielleicht dem allgemeinen Begriff der Schotterlandschaft subsummieren lassen, während innerhalb dieser gewisse feinere Unterschiede der Niederterrasse, der Hochterrasse sowie der rezenten Schotter ebensowenig aus dem Auge verloren werden dürfen, wie die allgemeine Gegenüberstellung des eiszeitlich beeinflußten Naturtypus gegenüber den sich gleich hinter den Mooren anschließenden Tertiärlandschaften?
Noch nie wurde die Biologie und noch viel weniger die Kulturgeschichte eines Landstriches unter diesen Gesichtspunkten durchforscht und auf ein einziges Gesetz gebracht. Jedes Resultat, sei es negativ oder positiv, ist also von ursprünglichem Wert und bringt Kunde aus dem Neuland einer Erkenntnis, die statt der unfruchtbaren Zersplitterung in viele, einander unbekannte Wissensgebiete die gesamte Summe des Seins unter einem Gedanken in eine lebende wirksame Einheit, das höchste Ideal menschlichen Strebens überhaupt, verwandelt.