
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Es wollte Leni zuerst gar nicht wieder in London gefallen.
Als das Häusermeer mit den schwarzen rauchenden Fabrikschloten und der große, gläserne Kristallpalast, der schon außerhalb des Weichbildes Londons sichtbar wird, wieder vor ihr auftauchte, hätte sie am liebsten kehrt gemacht.
Daheim in der Cottage hatte sich inzwischen ein Wechsel vollzogen. Das weiße Automobil war verkauft, der kostspielige Chauffeur abgeschafft, das erste Stubenmädchen entlassen worden, nur old Margaret, die Köchin, und ein servant-maid erwarteten die Herrschaften.
Tante Jane hatte sich mit bewunderungswürdiger Gelassenheit in die notwendigen Veränderungen gefügt. Ja, sie war ihrem Gatten, der gezagt hatte, sie auf verschiedene kleine Einschränkungen aufmerksam zu machen, sogar mit diesen Vorschlägen entgegengekommen. Nur daraus, daß sie ihn bat, alles in ihrer Abwesenheit zu ordnen, weil es ihr sonst vielleicht nahe gehen würde, erkannte er, wie schwer es ihr wurde. Sie war ein lebensfrohes Weltkind, an vornehmen Luxus und kostbare Eleganz gewöhnt. Aber als ihr Mann mit bitterem Tone seufzte: »Jane, daß du mir solche Opfer bringen mußt!« da wies sie mit ernsten Augen in das Nebenzimmer, in dem Lizzie fröhlich mit Leni lachte. »Uns ist noch viel geblieben, Dick!« sagte sie leise.
Leni war der jetzige Zuschnitt des Hauses bedeutend sympathischer. Die viele Dienerschaft hatte sie nur scheu und unselbständig gemacht; sie fühlte sich jetzt viel mehr zu Hause.
Am wenigsten von dem Wechsel merkte Lizzie. Sie hatte bisher immer auf der Schattenseite des Lebens gestanden; nun, da die ersten Sonnenstrahlen der Mutterliebe ihr junges Dasein erwärmten, blieben ihr die kleinen Äußerlichkeiten gleichgültig. Gar nicht hineinfinden aber konnte sich Bobby in die neue Hausordnung. Das erste Verständnis dafür war ihm aufgegangen, als er den Vater bat, ihm ein solches Pony zu kaufen, wie Charles Edward es besaß.
Noch nie war Bobby in seinem sechzehnjährigen Leben ein Wunsch abgeschlagen worden. Ungläubig sah er jetzt den Vater an. Aber als dieser, ihm die Hand auf die Schulter legend, ernst und liebevoll zu ihm sprach, nicht wie man mit einem unerwachsenen Sohne, sondern wie man zu einem Freunde spricht, da zeigte Bobby, daß er dessen nicht würdig war. Er weinte vor Ärger über das versagte Pony, ballte die Hände und fand das Leben schal und ekelhaft.
Der Vater furchte die Stirn.
»Du bist ein ganz unreifer fellow! Ich habe nicht gewußt, daß du auf dem besten Wege bist, ein nettes Bürschchen zu werden. Für dich freut es mich, daß du jetzt nicht mehr das Kind eines reichen Mannes bist; du sollst arbeiten lernen, mein Sohn!«
Bobby aber machte wenig Anstalten dazu, und Tante Jane, so einsichtig sie auch sonst sich bewies, war ihrem darling Bobby, dem Goldsöhnchen, gegenüber schwach.
Er war gewöhnt zu befehlen. Wenn Master Bobby klingelte, stürzte die Dienerschaft herbei, denn jeder fürchtete seine Grobheit. Jetzt mußte er oftmals fast die Klingel abreißen, bis jemand erschien; dann tobte er und schimpfte, gleichviel wer es war, ob die Miß, Leni oder gar seine Mutter.
Leni, die in Liebe und Ehrerbietung zu den Eltern groß geworden war, konnte das auf die Dauer nicht mitanhören. Mit flammenden Augen trat sie ihm eines Tages entgegen.
»Wenn du mich so anranzst, well, ich lasse es mir einfach nicht gefallen; aber wenn du ebenso zu deiner Mutter bist – fye upon you! Das erlaube ich nicht!«
»O, du hast nothing to allow, little thing« antwortete Bobby mit unnachahmlich hoheitsvollem Gesicht, »you are here only on sufferance!«
»Was? Ich bin hier nur geduldet?« Das Blut wallte Leni jäh zu Kopf; ehe sie sich dessen versah, hatte sie an dem langen Vetter emporgelangt und ihm eine schallende Ohrfeige in das sommersprossige Gesicht versetzt.
Sie wurde ganz blaß vor Schreck, nachdem es geschehen war. Dann eilte sie auf ihr Zimmer und weinte eine ganze Stunde lang, ohne zu wissen, warum.
Das hatte sich am ersten Sonntag nach ihrer Heimkunft abgespielt; seitdem sprach Leni mit Bobby kein Wort mehr, nicht mal das Notwendigste, und auch er ging ihr scheu aus dem Wege.
Lizzie war mit der Mutter in die Kinderklinik des Mr. Humpty übergesiedelt. Das junge Mädchen hatte sich auf Wight so gekräftigt, daß man mit der Operation nicht länger zögern wollte. Lizzie selbst trieb dazu. Endlich, endlich sollte sie ja vollständig gesund werden!
Leni hatte tapfer die Tränen hinuntergeschluckt, als Lizzie ihr zum Abschied zuversichtlich um den Hals fiel. »Leni, wenn ich wiederkomme, springe ich ohne Stock die Treppen herauf!«
»Gott geb's, mein' Dirn!« hatte Leni nur leise geantwortet, aber als der Mietwagen davonrasselte, da sah sie sich mit schwimmenden Augen in dem Kinderzimmer um, das sie mit der kranken Lizzie geteilt hatte. Wie leer es plötzlich hier war! Ach, Leni graute vor den einsamen Wochen, die vor ihr lagen. Und die Sonntage, wenn die bloß nicht gewesen wären! Die Miß sprach wenig, Onkel Richard noch weniger, besonders wenn er seine Newspaper studierte, und Bobby schmollte andauernd weiter. Das mußte ja höchst gemütlich werden!
Der Aufenthalt in der Schule war jetzt noch am angenehmsten; da wenigstens hatte sie junge Mädchen, mit denen sie lachen und fröhlich sein konnte.
Ihre »drei besten Freundinnen«, May, Gerty und Eveline, hatten schon ungeduldig auf die lustige Deutsche gewartet, die stets Leben in den Schulaufenthalt brachte. Zu vieren eingehakt, zogen sie über den Hof, ob Miß White sie auch noch so oft auseinander scheuchte.
Leni gab ihre Seeabenteuer zum besten, und ihr Ansehen in der Klasse stieg dadurch ungeheuer. Wer mit einem Fuß bereits im Jenseits gewesen ist, den umstrahlt immer eine besondere Glorie.
Aber auch die Londoner school-girls wußten viel zu berichten, nicht nur von ihrem Landaufenthalt und den vier Wochen fleißiger Schularbeit, die Leni versäumt hatte. Die alljährliche Preiswettprüfung für Sportübungen stand im nächsten Monat bevor; man sprach in den Pausen von nichts anderem mehr.
»Ellen, du mußt dich tummeln, denn du hast viel nachzuholen! Denk nur, wir radeln schon eine Acht! Was meinst du, ob Gerty diesmal den ersten Preis im Tennis davonträgt? Ich glaube, Anny wird sie schlagen; was wetten wir?« flüsterte May ihr in einer französischen Stunde zu.
»Ich wette nicht; mir ist das alles gleich. Ich weiß nur, daß ich bestimmt reinplumpse und mich unsterblich blamieren werde,« gab Leni tiefsinnig zur Antwort.
»Taisez-vous, Ellen, ich bemerke avec beaucoup de plaisir, daß das Mundwerk noch ebensogut funktioniert wie vor der Reise. Allerdings, in der Grammatik bekomme ich wenig davon zu hören!« Monsieur strich sich den dunklen Spitzbart. Leni runzelte die Augenbrauen. Sie stand mit Monsieur noch immer nicht besser.
»Ich habe die Lektion über den Konjunktiv nicht mit durchgenommen,« gab sie zur Antwort.
»Dann würde ich raten, es bald nachzuholen, vite-vite!«
Leni schüttelte den Kopf.
»Qu'est-ce à dire?« Monsieur glaubte nicht recht zu sehen; er setzte den Kneifer fester.
»Cela ne dit rien!« Leni warf die Haare in den Nacken und blickte Monsieur herausfordernd an.
»Ellen Sürsen, Sie scheinen auf der Reise noch mehr verlernt zu haben als nur Grammatik, auch wie sich eine junge, wohlerzogene Demoiselle dem Lehrer gegenüber zu benehmen hat!«
»Das brauche ich nicht erst zu verlernen; das habe ich nie gewußt,« gab Leni gleichmütig zur Antwort. Es war, als ob ein böses Teufelchen ihr die ungezogenen Worte auf die Lippen lege.
Die Klasse brach in ein lautes Gelächter aus. Aber als die Mädel sahen, daß Monsieur sehr zornig dreinblickte, wurde das Lachen leiser, scheuer und gedämpfter.
»Ellen Sürsen, folgen Sie mir zu Mrs. Smith,« gebot Monsieur mit bebenden Nasenflügeln.
Leni schlug ihr französisches Buch zu und erhob sich.
»Oh, Ellen, dear me, poor Ellen!« flüsterte ihr May teilnahmvoll zu.
Ein geringschätziges Lächeln antwortete ihr, dann schnappte die Tür hinter Monsieur und Leni ins Schloß.
Tiefe Stille herrschte in der Klasse.
Die lustigen Backfischchen, die sonst jede Gelegenheit zum Lärmen ergriffen, sahen sich stumm und betroffen an. Seit Jahren war es nicht vorgekommen, daß eine Schülerin zur Vorsteherin geführt wurde. Das war eine Schande für die ganze erste Klasse, und außerdem war Ellen Sürsen allgemein beliebt. Da war nicht eine, die nicht warmes Mitleid mit dem armen Mädel hatte.
»Wenn man sie nur nicht von der Preiswettprüfung ausschließt!« sagte eine Stimme endlich in scheuem Flüstern. Das erschien als die schlimmste Strafe, die Mrs. Smith erteilen konnte.
Leni folgte inzwischen Monsieur durch lange Korridore und über viele Treppen. Hart schlugen ihre Absätze auf dem Steinfußboden auf.

Der höfliche Franzose ließ Leni zuerst eintreten.
»Gehen Sie leise, Sie stören den Unterricht in den Klassen,« befahl Monsieur.
Leni trippelte auf den Fußspitzen, wobei ihre Stiefel ein lautes Geknarr hören ließen, das den nervösen Monsieur innerlich noch mehr erregte.
Mit dem Fingerknöchel pochte er an das Zimmer der Schulvorsteherin. Wie das in dem stillen Korridor hallte! Lauter aber pochte Lenis Herz. Ob sie noch auskratzen sollte?
Da ertönte bereits ein helles »Come in!« aus dem Zimmer. Der höfliche Franzose öffnete die Tür und ließ Leni zuerst eintreten. Das elegant möblierte Zimmer mit Mrs. Smith verschwamm vor Lenis Augen; sie machte eine tiefe Verbeugung. Wenn sie doch überhaupt nicht wieder hätte in die Höhe zu kommen brauchen!
Mrs. Smith richtete ihre langgestielte Lorgnette schweigend auf die beiden.
»Ah, Monsieur le docteur? I don't hope –« eine Handbewegung auf Leni vervollständigte den Satz.
Monsieur nickte bedeutungsvoll.
»Leider, Mrs. Smith, ich fühle mich genötigt –« Er öffnete den Mund und suchte nach den passenden Worten.
Mrs. Smiths sympathisches Gesicht, das weder jung noch alt erschien, zeigte einen traurigen Ausdruck.
»Ellen, was hast du wieder angestellt? Erzähle es nur selbst,« sagte sie mit klangvoller Stimme.
Leni sah auf; es war ein trotziger und zugleich angstvoller Blick. Aber die Ehrlichkeit in ihr siegte.
»Ich habe gesagt, daß ich nicht weiß, wie man sich einem Lehrer gegenüber benimmt,« stieß sie schnell hervor.
Mrs. Smith biß sich auf die Lippen.
»Schlimm genug, daß ein so großes Mädchen wie du es nicht weiß; but that will not be all, I think – was war sonst noch, Monsieur le docteur?«
»Ellen Sürsen hat sich höchst ungebührlich benommen; sie hat den Gehorsam verweigert – –«
»Das ist nicht wahr!« fuhr Leni empor.
»Ellen, gehe aus dem Zimmer! Ein Mädchen, das sich so wenig beherrschen kann und so wenig Achtung vor seinem Lehrer hat, mag draußen warten!« Mrs. Smith verlor niemals ihre vornehme Ruhe.
Leni stand wieder auf dem Korridor. Sie zitterte vor Erregung am ganzen Körper.
»Leiwer Gott – du min leiwer Gott,« murmelten ihre Lippen, ohne daß sie es wußte, wohl zehnmal hintereinander.
Auskneifen? Wie eine Erlösung kam ihr plötzlich dieser Gedanke. Einfach durchbrennen! Aber nein! Leni richtete sich in ihrer ganzen »stattlichen Größe« auf; was sie sich eingebrockt hatte, wollte sie auch ausessen!
Aus den umliegenden Klassen schallten monotone Stimmen; jetzt wurde die Monsieurs für einen Augenblick laut, und dann wurde die Tür schon wieder geöffnet.
»Entrez!« Monsieur kniff die Augen zusammen und ließ das ziemlich blasse Mädchen an sich vorbei in das Zimmer treten.
Leni zupfte an ihrem Gürtel und heftete das Auge starr auf die Kronenkuppel.
»Ellen Sürsen, du wirst Monsieur um Entschuldigung bitten!«
Leni schwieg.
»Ellen, I wish you to excuse yourself.«
Leni preßte die Lippen fest aufeinander.
»Monsieur le docteur, darf ich Sie bitten, mich mit Ellen allein zu lassen? Ich hoffe, die betrübende Angelegenheit zur Zufriedenheit zu ordnen.«
Monsieur dankte mit einer eleganten Verbeugung und ging. Leni war mit Mrs. Smith allein.
»Ellen,« begann die würdige Dame, »are you not ashamed of your behaviour?«
»Nein, ich – ich – – –«
»Ruhig Kind, ruhig! Dein Benehmen schmerzt mich tief, Ellen. Du bist mir immer eine liebe Schülerin gewesen; auch die anderen Ladys und Gentlemen sind mit dir zufrieden, nur Monsieur – immer Monsieur hat über dich zu klagen. Woran liegt das, Ellen?«
»Weil – weil – – –« Leni brach jäh ab. Jemand hinter seinem Rücken »verpetzen«, nein, und wenn es selbst »Monsieur« war!
»Wenn du mir keine Antwort gibst, Ellen, nehme ich an, daß du dein Unrecht einsiehst. Entweder wirst du dich bis zum Schulschluß heute entschuldigen, oder ich muß, so leid es mir tut, deine Angehörigen brieflich von deinem Benehmen in Kenntnis setzen.«
Die Schulglocke hallte dröhnend durch das stille Gebäude und verkündete die Zwischenpause. Leni konnte gehen.
Diesmal lief die erste Klasse nicht wie sonst sogleich auf den Hof hinunter; alle erwarteten die Mitschülerin.
»Ellen, wie war's? Was hat's gegeben? Was für eine Strafe hast du bekommen? Darfst du die Preiswettprüfung mitmachen?« Mit derlei Fragen umringte man sie.
Leni schüttelte auf alles nur stumm das Haupt. Mit zusammengekniffenen Lippen ergriff sie den Arm ihrer Freundin May und zog diese die Treppe hinab zum Hof.
Es war ihr zumute, als ob man ihr die Kehle zuschnüre.
»Well,« sagte May endlich, als Leni andauernd schwieg, »will you not tell me? Ist es sehr schlimm?«
»Ich soll mich entschuldigen,« preßte Leni heraus.
»Weiter nichts?« fragte May erleichtert.
Leni ließ den Arm ihrer Freundin los. Wie wenig verstand May sie doch!
Alles in ihr bäumte sich gegen die Zumutung der Vorsteherin auf. Jeden anderen, aber Monsieur – – – nein!
Wenn Mrs. Smith nun an den Onkel schrieb? Ach, vielleicht gar an die Tante, der man jetzt in der Klinik doch jeden unnötigen Ärger ersparen mußte? Morgen früh würde der Brief ankommen, gerade am Sonntag! Wie würde Bobby höhnisch grinsen, wenn er von der Sache erfuhr! Nein, bloß das nicht! Das durfte erst recht nicht geschehen!
Die letzte Stunde, französische Literatur, hatte Monsieur zu geben. Er nahm keine Notiz von Leni, und sie zeigte ebenfalls wenig Teilnahme.
Sie dachte unaufhörlich: »Soll ich – soll ich nicht?«
Der Riesenzeiger der Uhr von Westminster, den man durch das Klassenfenster sehen konnte, rückte unerbittlich vorwärts. Ach, du leiwe Tid! Noch eine halbe Sekunde – wie von unsichtbaren Händen geschoben stand Leni plötzlich am Katheder.
»Excuse me, please!« Mehr drohend als bittend rangen sich die Worte von den trotzigen Backfischlippen.
Es läutete.
Ehe sich Monsieur von seiner Verwunderung erholt hatte, war Leni schon längst zur Tür hinaus.
Von diesem Tage an war scheinbar Waffenstillstand zwischen Monsieur und Leni. Er verschonte sie mit seinem Spott und behandelte sie mit eisiger Höflichkeit. Leni aber konnte »ein Kröt« sein, wie Vating behauptete; sie vergaß es ihm nicht, daß sie sich seinetwegen hatte demütigen müssen.
Als Leni auf die Straße trat, sah sie sich vergebens nach Miß Brown um. Sie wartete, aber die Miß kam nicht. Ein plötzlicher Schreck durchzuckte Leni. Es würde doch in der Klinik alles gut gegangen sein? Sie hatte keine Ahnung, wann die Operation stattfinden sollte. War sie am Ende nicht geglückt? Das junge Mädchen wußte nicht, wie es schnell genug nach Haus kommen sollte. Als es das Kinderzimmer betrat und die Bücher gewohnheitsgemäß in die Ecke schleuderte, sah es durch die geöffnete Tür Miß Brown auf dem Bett hocken. Sie hielt sich den Kopf.
»Miß Brown, what is the matter?«
»Oh, I caught cold! Ich habe solche Schmerzen im Kopf und in den Gliedern; ich kann kaum die Augen offen halten!«
»Das ist Influenza,« rief Leni, mit verblüffender Sicherheit die Diagnose stellend, »kenn' ich ganz genau! Unsere olle Dörthe hat's im vorigen Winter gehabt und ein paar von unseren Dorfjungen auch. Und Jöching Swart sein Großmutter ist sogar daran gestorben! Sie müssen ins Bett, Miß Brown, und schwitzen! Schwitzen ist gut gegen alles, sagt Mutting; ich bring' Ihnen gleich heißes Zitronenwasser.«
Wenn es irgendwo zu helfen galt, war Leni sofort bei der Hand. Sie packte die sich nicht länger sträubende Miß, der wirklich jämmerlich zumute war, unter fünf dicke Decken, daß sie fast ersticken mußte.
Aber als Onkel Richard nach Hause kam, gab er sich doch nicht mit Lenis ärztlicher Behandlung zufrieden, sondern hielt es für geratener, den Doktor kommen zu lassen. Wie stolz war Leni, als dieser wirklich Influenza bestätigte, die heftig in London hauste.
»Sie Kurpfuscherin,« drohte er Leni lächelnd, fand aber ihre Verordnung recht vernunftgemäß.
»Ich pflege die Miß,« äußerte Leni mit Selbstgefühl, als darauf die Rede kam. »Wenn ich so lange in der Schule gefehlt habe, kommt's auf ein paar Tage mehr nicht an!«
»Nein, Lenchen, du sollst die Schule nicht länger versäumen! Vormittags kann Margaret das besorgen; nachher magst du sie ablösen,« entschied der Onkel.
Sie aß heute mit Onkel Richard allein. Das servant-maid stellte die Suppenterrine wie selbstverständlich vor ihren Platz. Leni wurde rot und sah den Onkel fragend an.
»Nur, zu, Lenchen! Du bist jetzt hier die Hausfrau,« sagte dieser ermunternd.
Leni füllte mit Zagen die Suppe auf.
»Ganz wie Mutting!« dachte sie und ertappte sich zugleich auf den weiteren Gedanken, es sei doch eigentlich recht nett, daß die Miß erkrankt war. Aber sie schämte sich dessen sofort.
Einen schwippenden Teller reichte sie für den Onkel.
»Hast du auch genug?« fragte sie ängstlich.
»Ich glaubte, wir sollten alle von dem Teller essen, Kind,« neckte er und lachte.
Wirklich, reizend war es mit Onkel Richard allein, wenn Leni auch jetzt so ladylike aß, daß sie Tante Janes und Miß Browns prüfendes Ange nicht mehr zu scheuen brauchte. Sie fühlte sich völlig erwachsen, und das tat ihr nach dem Vormittag in der Schule, der sie recht klein gemacht hatte, besonders wohl.
Onkel Richard brachte ihr Grüße von Lizzie; Leni sollte sie noch nicht besuchen. Die Operation hatte bereits stattgefunden; ob sie jedoch gelungen war, ließ sich erst später bei einem Gehversuch feststellen. Aber der Arzt hatte dem Vater durchaus Hoffnung gemacht. Vorläufig lag die arme Lizzie im festen Gipsverband und konnte sich nicht bewegen.
Leni nahm es mit der Krankenpflege sehr ernst. Ja, sie erhob sich sogar ganz verschlafen mitten in der Nacht, um die kranke Miß durch einen Trunk Limonade zu erfrischen. Freilich mußte Leni sie zu dieser Erquickung erst aus dem wohltuenden Schlaf wecken, den Miß Brown endlich gefunden hatte.
Die Miß tat Leni wirklich leid. Jetzt, da sie so hilflos dalag, und nicht mal »shocking!« rufen konnte, kam es dem jungen Mädchen zum Bewußtsein, daß sie mit all ihrem »Mäkeln und Kräkeln« doch nur ihr Bestes wollte.
Sie wich den ganzen Sonntag über nicht von ihrem Bett, und die Miß drückte ihr dankbar die Hände.
»You are a good little girl,« sagte sie immer wieder.
Leni aber fand gar nicht, daß sie gut war; sie handelte doch aus einem gewissen Eigennutz. Bobby strich heute drunten in allen Zimmern umher; es war gräßlich, wie der Jung' sich in Tante Janes Abwesenheit herumlümmelte.
Sie vermied jedes Zusammentreffen mit ihm, aber beim dinner freilich war das unmöglich. Am liebsten hätte Leni ihm heute wieder eins versetzt, und zwar mit der Suppenkelle. Er lächelte »so entfamtig«, als Leni mit wichtigem Gesicht ihren Hausfrauenpflichten nachkam. Natürlich, das allein war schuld, daß sie einen großen Klecks auf das weiße Tafeltuch machte! Wütend war sie, daß sie sich so blamiert hatte.
»Lenchen,« sagte Onkel Richard nach dem Essen, »daß du mir nicht etwa deine schönen roten Wangen wieder verlierst! Du mußt in die frische Luft! Ziehe dich an; heute wird der Onkel mal seine Nichte ausführen. Margaret mag bei Miß Brown bleiben.«
Leni hätte, wenn Bobby nicht dabei gewesen wäre, sicherlich einen Luftsprung gemacht; so aber flog sie dem Onkel nur freudestrahlend an den Hals, das war more ladylike.
»Bobby, gehst du mit?« Onkel Richard griff nach seinem Panamahut.
Bobby schüttelte brummend den Kopf; er war immer noch beleidigt, daß er das Pony nicht bekommen sollte.
So zog Leni seelenvergnügt mit dem Onkel allein los. Es war das erstemal, daß sie mit ihm ausging; stolz hing sie sich an seinen Arm.
»Jetzt denken die fremden Leute sicher, ich bin deine Frau, nicht Onkelchen? Wenn das dumme weiße Kleid nur nicht schon wieder so ausgewachsen wäre!«
Heute ging es nicht zum Hydepark, wie sonst immer. Onkel wollte Leni etwas Neues zeigen. Sie fuhren mit dem Dampfschiff nach Hampton Court, dem alten Palast der Könige. So einen herrlichen, großen Garten hatte Leni noch nie gesehen. Wie aber staunte sie erst, als Onkel ihr den Riesenweinstock zeigte, und ihr erzählte, daß es der größte auf der ganzen Erde sei. Und dann – nein, das war aber snaksch! Die Kronen der Bäume waren zu drolligen Figuren verschnitten, allerlei Tiere, Katzen, Hunde und Vögel, ja, sogar einen Eisenbahnzug konnte Leni erkennen. Schließlich aber zeigte sich doch wieder das Naturkind. »Weißt du, Onkel Richard, das ist ja alles recht ulkig; aber ein gewöhnlicher Lindenbaum, wie der liebe Gott ihn auf Nedderdorf wachsen läßt, ist mir doch zehnmal lieber als all das Zeug hier!«
Als Leni am nächsten Mittag aus der Schule nach Hause kam, öffnete ihr Kitty, das servant-maid, mit roten, verschwollenen Augen.
»O, Miß Ellen, wie gut, daß Sie kommen! Margaret hat sich bei Miß Brown angesteckt; sie mußte sich ins Bett legen. Und ich – ich kann doch nicht kochen! Nun ist kein lunch für Miß Ellen fertig. Und was wird bloß heute abend mit dem dinner?« Das Mädchen war ganz aufgeregt.
Auch Leni bekam im ersten Augenblick einen Schreck. Dann aber siegte ihr gesunder Humor.
»Nur keine Angst, das werd' ich alles schon besorgen!« dachte sie bei sich, laut aber sagte sie: »Dann werden wir uns eben mal mit sandwiches zum lunch begnügen,« Sie hatte die »Sandwichse« inzwischen essen gelernt.
Nun war es doch gut, daß Mutting ihr die derben Wirtschaftsschürzen eingepackt hatte! Leni entwickelte eine fieberhafte Tätigkeit. Bald war sie im ersten Stock, bald im Dachgeschoß, in dem die servants-rooms lagen, und bald im Souterrain, wo sie unternehmungslustig an die Vorbereitungen zum dinner ging, Was hatte denn der Schlächter geschickt?
Chops. Leni fühlte ihr Herz ungeheuer erleichtert; sie hatte die Mamsell daheim oft Koteletten braten sehen. Aber die Suppe machte ihr noch heftiges Kopfzerbrechen. Zu einer Bouillon gehört Fleisch, so viel wußte sie; aber das hatte sie nicht. Also was nun?
Das Stubenmädchen verstand noch weniger vom Kochen als sie selbst. Das hatte Leni schon inzwischen herausbekommen, Ob sie sich von Margaret Bescheid sagen ließ? Nein, ein solches Armutszeugnis durfte sie sich nicht ausstellen.
»Wir wollen heute nur einfach kochen,« sagte sie möglichst unbefangen zu dem Stubenmädchen, »Pflaumensuppe mit Grießklößchen; die mag der Onkel gern« – und sie selbst nebenbei auch – »und dann, ja dann nach dem Fleisch vielleicht einen apple-pie.«
Du lieber Himmel, wie machte man den bloß?
Aber sie ging jedenfalls mit Feuereifer ans Werk. Zuerst mal die Ärmel aufgekrempelt, das ist ja die Hauptsache bei jeder Kocherei, Pflaumen waren im Hause, Leni setzte den größten Topf, den sie finden konnte, mit unausgekernten Pflaumen und Wasser auf den Gasherd. Sie war von Nedderdorf her an Riesenkübel gewöhnt.
Was mochte sonst wohl noch »in« kommen?
Zucker? Nein, die Pflaumen waren ja süß. Na, eben bloß die Grießtüte!
Leni ließ sich von dem Mädchen, das ihr mit wohltuender Bewunderung zuschaute, den Grieß reichen.
Eifrig begann sie das pulverige Zeug zwischen den sauber gewaschenen Händen zu drehen. Aber das wurden keine Klöße; der Grieß zerrann ihr unter den Fingern. Da stimmte etwas nicht. Halt, Eier! Leni legte den Finger gedankenvoll an die Nase. Die Dinger sahen ja immer gelb aus, sicher gehörten Eier dazu. Sie schlug ein paar in den Grieß.
Na also, nu wurde die Geschichte schon breiig! Aufs neue begann Leni zu formen und zu drehen; jetzt zerrann der Grieß nicht mehr, aber er klebte ihr dafür wie Kleister an den Fingern. Das versprach wenig Erfolg und war obendrein ein unangenehmes Gefühl.
»Wat steihn Se denn un kieken?« fuhr sie das Stubenmädchen an, das zum Glück kein Wort von ihrem Plattdütsch verstand. Wenn jemand einem immerzu auf die Finger guckte, konnte es doch auch nicht gelingen.
»Sie könnten vielleicht Salat holen; Onkel ißt Fleisch nicht ohne Salat!« So, nun war sie das Mädchen für 'ne Weile los!
Mit den dämlichen Klüten gab sie sich nicht länger ab; die wurden einfach mit dem Löffel abgestochen – was roch denn bloß mit einem Male so gräßlich? Herrjemine, die Pflaumensuppe kam aus dem Pott heraus! Margarets sauber gescheuerter Herd sah lustig aus! Warum wurde sie auch krank!
Leni kostete ihre Suppe. Pfui, wie saures Pflaumenwasser schmeckte sie! Doch Zucker war ja genug im Hause, und dick würde sie wohl nachher von den Grießklüten werden. Wenn nur nicht die ollen Pflaumensteine wie breite braune Karpfen in dem mattrosa Obstsee herumgeschwommen wären! Leni versuchte, sie mit einem Löffel herauszufischen. Da konnte sie aber bis morgen früh dabei stehen bleiben, und in einer halben Stunde kam der Onkel zu Tisch! Zum apple-pie war es zu spät geworden – sie atmete auf. Aber die Koteletten mußte sie nun panieren. Das Kunststück gelang über Erwarten gut.
»Wenn Mutting mich doch so sehen könnte!« dachte Leni in heimlichem Stolz.
Wo bloß die Kitty mit dem Salat blieb? Braten durfte sie die chops noch nicht, das tat man ganz zuletzt; aber die Suppe konnte sie fertigmachen. Sie begann, ihren Grießbrei löffelweis mit dem heißen Pflaumenwasser zu verbinden.
Was gerann denn da? Das mußte das Ei sein! Dicker wurde die Suppe auch nicht; nein, statt »Klüte« wurde es »klüterig«. Sonst schmeckte es aber recht gut.
Als Onkel Richard nach Hause kam, trat ihm Leni mit feuerroten Wangen entgegen. Sie strahlte; es war alles wundervoll geraten. Den Salat verstand Kitty zum Glück anzumachen, und die Koteletten hatte Leni eigenhändig goldbraun gebraten; nur einmal war ihr die Pfanne heruntergepurzelt.
Onkel klopfte Leni die heißen Wangen.
»Lenchen, so angestrengt hast du dich? Wir hätten doch ins Restaurant gehen können! Nun wollen wir mal sehen, was unsere junge Köchin fertiggebracht hat!«
Der Onkel kostete die Suppe. Leni sah ihn erwartungsvoll – er sie fragend an.
»Pflaumensuppe mit Grießklößen, die du doch sehr gern ißt, Onkel Richard,« beeilte sich Leni, ihm das seltsame Gericht vorzustellen. »Wir kochen sie wohl in Mecklenburg ein bißchen anders als ihr in England, was?« setzte sie schon etwas kleinlauter hinzu.
Onkel Richard suchte in seinen Erinnerungen nach. Hatte denn die Pflaumensuppe in seiner Kindheit immer so gräßlich geschmeckt? Kerne und das gelbe, geronnene Zeug war jedenfalls niemals darin gewesen. Er schob mit plötzlichem Entschluß den Teller fort. Fünf Löffel voll hatte er schon hinuntergewürgt.
»Schmeckt es dir nicht, Onkel?« Leni machte ein enttäuschtes Gesicht. Sie löffelte mit Todesverachtung.
»Vorzüglich, wirklich vorzüglich! Aber man soll des Guten nicht zuviel tun. Ich muß doch deinen Braten auch noch versuchen, Lenchen,« antwortete der Onkel, obwohl er auch gegen diesen ein geheimes Mißtrauen nicht unterdrücken konnte.
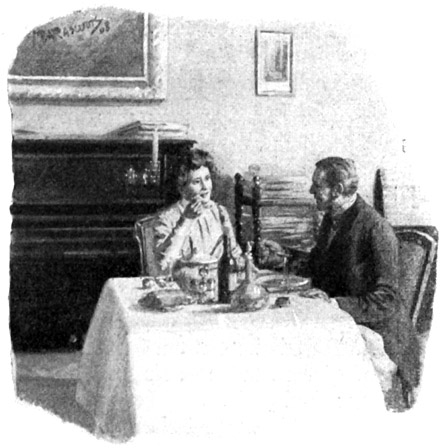
»Schmeckt es dir nicht, Onkel?« . . . »Vorzüglich, wirklich vorzüglich!«
Aber er hatte der Nichte unrecht getan. Die Koteletten sahen tadellos aus. Mit Salz und Pfeffer allerdings war Leni etwas verschwenderisch zu Werke gegangen; das Fleisch brannte auf der Zunge.
»Heute schmecken die Koteletten mal pikant, nicht, Onkelchen?« fragte Leni, die jedem Ding im Leben die beste Seite abgewann. Der Onkel, der an die englische Würzlosigkeit der Speisen gewöhnt war, hatte eine andere Meinung.
»Der Salat ist wohl noch ein bißchen sandig, was? Ich muß der Kitty sagen, daß sie ihn morgen mittag vorher waschen soll.« Er knirschte nämlich ordentlich zwischen Lenis weißen Zähnen.
»Nein, Lenchen,« – der Onkel wehrte sich mit allen Kräften gegen diese Zumutung – »nein, morgen mache ich dir nicht wieder die Last, mein Kind! Ich speise irgendwo in der City; da spare ich auch Zeit. Und du, willst du mitkommen?«
»Ich habe doch zwei Kranke, und muß die ganze Wirtschaft führen; ich kann nicht von Hause weg!« Noch nie im Leben war Leni so von der Wichtigkeit ihrer Person überzeugt gewesen wie heute. Heimlich aber dachte sie: »Nur gut, daß ich Margaret bloß 'ne Wassersuppe gekocht habe! Die olle Pflaumensuppe hätte mich am Ende doch 'n beten vor ihr blamiert.«
Das Schlimme aber war, daß die Pflaumensuppe ewig zu sein schien. Sie wollte kein Ende nehmen; drei Tage aß Leni davon! Am vierten endlich goß sie das olle Zeug, das gar nicht weniger wurde, in den Ausguß, denn Margaret hielt wieder ihren Einzug in das Souterrain.
Dazwischen aber lagen noch drei schwere Tage für das Backfischchen.
Pünktlich wie immer, um halb sieben, erwachte Leni am anderen Morgen und wartete auf Kittys Klopfen. Dieses blieb aus; Leni fühlte sich daher verpflichtet, noch bis sieben Uhr im Bett liegen zu bleiben, wenn sie auch deshalb zu spät in die Schule kam. Man mußte sie doch wecken!
Totenstille herrschte im Hause. Keine Spur von Margaret und Kitty! Leni ging der Sache endlich auf den Grund.
Da lag auch das servant-maid, ihre einzige Rettung, die gestern schon so »herumgequient« hatte, mit heißem Kopf und geschlossenen Augen im Bette; auch sie hatte die Influenza nicht verschont.
»Nu komm' ich 'ran,« dachte Leni ergeben, und nahm für alle Fälle eine Aspirintablette, eingedenk der Worte ihres Heimatdichters: »Was dich nachher not tut, kann dich vorher nich schaden!«
Sie setzte Teewasser auf, deckte den Frühstückstisch und begann, mit dem Besen und dem schweren Bohner zu Felde zu ziehen. Denn praktisch war die Leni, wenn sie auch noch nicht alles verstand. Sie bürstete dem Onkel die Kleider und bearbeitete, als er zum breakfast herunterkam, gerade seinen Stiefel. Sie hatte ihn auf die linke Hand gezogen; mit der Rechten fuhrwerkte sie lustig darauf los und sang dabei ein plattdeutsches Lied.
»Lenchen, das brauchst du doch nicht zu tun! Ich lasse mir die Stiefel unterwegs bürsten. Doch was soll nun werden, Kind? Ich werde dir eine Hilfe besorgen.«
»Aber Onkel,« erwiderte Leni abwehrend, »das bißchen Arbeit schaffe ich doch! Die Miß ist ja bald wieder gesund!« Sie wollte zu gern allein wirtschaften.
Onkel Richard war es zufrieden; er fühlte sich in diesen häuslichen Dingen ziemlich unbewandert. Nachdem er ihr das Versprechen abgenommen hatte, daß sie sich auch was Ordentliches zum Mittagbrot koche, ging er.
Niemand war glücklicher als Leni, denn sie brauchte nicht in die Schule.
Ihr Lazarett, Station eins, zwei und drei, machte ihr nicht zuviel Mühe; das Dumme war nur, daß die Miß schon wieder anfing, Hunger zu empfinden.
Leni war aber eine strenge Krankenwärterin. Sie setzte ihre Patienten ganz auf Milchkost, und gab der hungrigen Miß ernsthaft zu bedenken, daß man von Fleisch Fieber bekomme.
Leichte Bouillon hatte der Arzt verordnet; die konnte Leni aber nicht kochen, Pflaumensuppe hatte die Miß einmal versucht, und fand dann, daß es ihr schädlich sei.
»Eine Hausfrau hat es wirklich schwer!« seufzte Leni kummervoll.
Das Beefsteak, das sie sich zum dinner briet, schmeckte wie Schuhsohle, Leni nährte sich in der Folge nur noch von Eierspeisen.
»Nächstens werde ich noch selber ein Huhn,« dachte sie.
Das Schlimmste aber war das Rechnen. Das Backfischchen kam mit dem »verflixten englischen Geld« nicht zurecht; bittere Tränen vergoß sie beim Abrechnen. Die Wirtschaftskasse stimmte nie. Manchmal wünschte sie ganz im Ernst: »Ach, wenn ich doch bloß auch krank würde!« Aber sie blieb kerngesund.
Als Margaret endlich wieder auf der Bildfläche erschien, war Leni innerlich recht froh, daß ihr die Hausfrauenpflichten abgenommen wurden. Denn erstens bekam man doch wieder ein anständiges Stück Fleisch in den Magen, und dann – »wirtschaften ist ja recht schön, aber nur – – – mit Mutting!«