
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Kein empörenderes Schauspiel, als sehen zu müssen, wie unsere leidige Allerweltsschulmeisterei es fertig gebracht hat, die süßesten Früchte mittels pädagogischer Bakterien ungenießbar zu machen und Geschenke, die dazu ersehen waren, uns zu beglücken, in Buß und Strafe umzusetzen. Die Kunst ist großherzig und menschenfreundlich wie die Schönheit, welcher sie entspringt. Sie ist ein Trost der Menschen auf Erden und erhebt keinen andern Anspruch, als innig zu erfreuen und zu beseligen. Sie verlangt weder Studien noch Vorbildung, da sie sich unmittelbar durch die Sinne an das Gemüt und die Phantasie wendet, so daß zu allen Zeiten die einfache jugendliche Empfänglichkeit sich im Gebiete der Kunst urteilsfähiger erwiesen hat, als die eingehendste Gelehrsamkeit. So wenig man Blumen und Sonnenschein verstehen lernen muß, so wenig es Vorstudien braucht, um den Rigi herrlich, ein Fräulein schön zu finden, so wenig ist es nötig, die Kunst zu studieren. Gewiß, die Empfänglichkeit ist beschränkt, die Begabungen sind ungleich zugeteilt, die Sinne, welche die Kunsteindrücke vermitteln, beobachten schärfer oder stumpfer. Indessen habe ich noch keinen Menschen von Gemüt und Phantasie – denn Gemüt und Phantasie sind die Vorbedingungen, aber auch die einzigen Vorbedingungen des Kunstgenusses – gekannt, welcher nicht an irgendeinem Teil der Kunst unmittelbare Freude empfunden hätte. Und darauf kommt es allein an. Jeder suche sich an dem himmlischen Fest diejenige Speise aus, die seine Seele entzückt, und weide sich daran nach Herzenslust, so oft und so viel er mag, im stillen oder, wenn ihm das Herz überläuft, mit gleichgesinnten Freunden. Das ist Kunstgenuß. Das ist aber auch Kunstverständnis. Wer sich aufrichtig und bescheiden an einem Kunstwerke erfreut, der versteht es ebensowohl und wahrscheinlich noch besser, als wer gelehrte Vorträge darüber hält; wie denn auch ewig die Künstler selbst sich unmittelbar an das einfache Publikum wenden und alle Vormundschaft und gelehrte Zwischenträgerei zwischen Kunstwerk und Publikum verabscheuen.
Eine Kunstfron entsteht, sobald der Kunstgenuß als eine Pflicht aufgefaßt wird. Es ist so wenig die Pflicht des Menschen, Schönheit und Kunst zu lieben, als es eine Pflicht ist, den Zucker süß zu finden. Die Kunst ist eine gütige Erlaubnis und eine menschenfreundliche Einladung, mehr nicht; man kann es nehmen oder lassen. Glücklich, wer ihr zu folgen und sie zu schätzen weiß; wer das nicht vermag, den mögen wir bedauern, aber wir haben kein Recht, ihn deshalb zu schelten. Berechtigt die Tatsache, daß die Kunst erfahrungsgemäß veredelnd wirkt – echte Künstler und naive Kunstliebhaber sind stets gute Menschen –, dazu, die Kunst als Erziehungsmittel zu verwenden? Ja, unter der Voraussetzung, daß man Erziehung im Sinne des vorigen Jahrhunderts (Erziehung zu einem rechten Menschen) versteht und daß man nicht mit Pädagogik hineinpfusche. Wenn im Deutschen Wilhelm Tell gelesen wird, verwandelt sich die Schulstube in ein freies grünes Bergland, und aus Lausbuben wird eine liebenswürdige, begeisterte Gemeinde der Poesie. Besprich nachher Wilhelm Tell, laß ihn analysieren, vergleichen, in Aufsätzen wiederkäuen, so ist ein guter Teil des Gewinnes wieder dahin. Nein, unter der Voraussetzung, daß Erziehung das Examen zum Ziele hat, daß es gleichbedeutend ist mit Lehren und Lernen. Zu lehren gibt es in der Kunst überhaupt nichts, außer von Künstlern für Künstler, zu lernen wenig. Die veredelnde und erzieherische Kraft der Kunst beruht eben nicht auf dem Wissen, sondern auf dem Genießen. Ja, das Wissen über die Kunst kann unter Umständen sogar die Empfänglichkeit zum Genuß der Kunst beeinträchtigen, dann nämlich, wenn Wissensdünkel entsteht; denn Dünkel ist das Gegenteil jener Seelenverfassung, welche jeder Kunstgenuß voraussetzt: bescheidene, selbstvergessene Hingabe. Vollends den Begriff ‹Bildung›, das heißt das Wissen in die Breite und im Kreise, in die Kunst herüberziehen zu wollen, ist eine unglückselige Verirrung. Bildungsmäßige Aufnahme der Kunst erzeugt im besten Fall Oberflächlichkeit, im gewöhnlichsten Fall Selbsttäuschung, im schlimmsten Fall Empfindungsheuchelei. Man entschlage sich doch ein für allemal der Hoffnung, das Unmögliche zu erreichen; die Kunst ist viel zu reich, der einzelne viel zu arm, als daß er die übermächtige Summe von Seligkeiten bewältigen könnte; es gilt, sich entschlossen auf die seelenverwandten Lieblinge zurückzuziehen und mit ihnen in traulichem Umgang zu verkehren. Mit einem solchen Entschluß befreit man sich von der drückendsten Sklaverei der modernen Welt, der Bildungsfron, jener ebenso lästigen als gemeinschädlichen Kopfsteuer. Der Entschluß kostet übrigens nicht mehr als die Entsagung auf den allseitigen Genuß sämtlicher Sonnenstrahlen; es bleibt für das Bedürfnis des einzelnen noch immer im Überfluß da, wenn er sich mit seinem Teil bescheidet. Das Bedürfnis aber ist der richtige Regulator des Kunstgenusses; solange dasselbe schweigt, möge jeder die Kunst in Ruhe lassen.
Viele versehen es nun darin, daß sie den äußeren Anlaß, die Einladung, mit dem inneren Bedürfnis verwechseln. «Wir müssen die Gelegenheit benützen.» Dieser Schluß ist so falsch, wie wenn jemand glaubte, essen zu müssen, sobald ein köstliches Menu in der Zeitung angekündigt wird. Das Kunstbedürfnis hat bei normalen Menschen seine Pausen; es stellt sich periodisch ein; der fortwährende Wolfshunger nach Kunst ist schon ein Zeichen eines ungesunden Zustandes, welcher die Diagnose auf Verbildung stellen läßt. Man muß an Konzertzetteln und Theateranschlägen, an Museen und selbst an Campi santi vorübergehen lernen wie an Schaufenstern; denn damit, daß uns etwas augenfällig angeboten wird, ist noch nicht bewiesen, daß wir dessen bedürfen. Sogar die Seltenheit einer Gelegenheit ist kein Grund für ihre Ausnützung; denn der Mensch ist kein Pelikan; er kann die Eindrücke nicht unverdaut aufstapeln, bis sich das Bedürfnis regt.
Wer statt des jeweiligen Bedürfnisses sein Bildungsgewissen zu Rate zieht, wer jeder Kunstgelegenheit auf jedem Gebiet in jedem Augenblick glaubt Folge leisten zu müssen, der ist kein neidenswerter, wohl aber ein meidenswerter Mensch, vor welchem jeder Erfahrene im weiten Bogen vorüberzieht; denn nicht die Kunst, die freie, edle Göttin ist es, welche ihn inspiriert, sondern die Kunstscholastik. Diese anspruchsvolle und im Grunde doch so fruchtlose Wissenschaft hat die falsche, krampfhafte Kunstbildungswut auf dem Gewissen. Es gibt jedoch ein vortreffliches Heilmittel dagegen, nämlich das schöne Wort: «Ich verstehe nichts davon.» Wie erlösend für den Hörer wie für den Sprechenden wirkt dieses Wort, wo es jemals ertönt! Eigentlich sollte jedermann diesen Satz, dessen Aussprache ein wenig schwierig zu sein scheint, sprechen lernen; denn derselbe sagt die volle Wahrheit, da sich niemand anmaßen darf, in allen Gebieten der Kunst mit dem Herzen zu Hause zu sein. Freilich setzt man sich mit jenem Geständnis der Gefahr einer Unhöflichkeit von seiten schlechterzogener Menschen aus; allein das ist im Grunde ein neuer Gewinn, indem es uns lehrt, nicht mit dem ersten besten in ein Gespräch einzutreten. Eine schlechte Erziehung aber nenne ich es, wenn einer dem andern wegen dessen wirklicher oder vermeintlicher Unempfindlichkeit oder Unwissenheit in Kunstsachen glaubt etwas Unangenehmes bemerken zu dürfen, denn so wie niemand zum Kunstgenuß verpflichtet ist, so darf sich auch niemand unterfangen, seinem Nächsten ein Kunstexamen abzufordern. Es wäre wünschenswert, wenn sich in dieser Beziehung die Begriffe von Höflichkeit etwas verfeinerten, denn bei den meisten stammt das ruhelose und ruhestörende Kunstbildungsbedürfnis einfach aus der Furcht vor der gestrengen Allerweltsinspektion in Gesellschaften, Eisenbahnwagen und Gasthöfen. Sobald wir jedoch die kunstgebildeten Grobheiten den ungebildeten Grobheiten gleichstellen, wird der erschreckend hohe Spiegel der Bildungsflut urplötzlich sinken, wie denn diejenigen Völker, bei welchen ein schärferer Höflichkeitstakt im Gespräch waltet, die Kunstheuchelei kaum kennen.
Wie die Kunst zum Genusse und nicht zur Buße der Menschen da ist, so darf man sich auch den Meister, und wäre er noch so tot, nicht als einen Popanz vorstellen, der geschaffen wurde, um uns zu imponieren oder gar uns zu erdrücken, sondern als einen Freund und Wohltäter. Liebe ist das einzig richtige Gefühl gegenüber einem Meister, und zwar unbefangene Liebe, ohne Scheu und vorsintflutliche Ehrfurcht. Mit diesem Gefühl begnügt sich jeder Schaffende gern, selbst der größte; denn die Huldigung des Herzens bleibt immer die feinste Huldigung. Zur Liebe wird sich von selbst der Dank gesellen, und in ihm findet gewissenhafte Arbeit die schönste Entschädigung für ausgestandene Mühe und Gewissenskämpfe. Die Bewunderung bedeutet den Tribut ausübender Künstler an den Meister. Der Laie ist von ihr entbunden; sie steht ihm auch schlecht zu Gesicht, da er keine Ahnung von den Schwierigkeiten hat, die in einem Kunstwerk überwältigt, von den Aufgaben, die in demselben gelöst worden sind; er begnüge sich mit Dank und Liebe; das ist natürlicher und zugleich bescheidener. Eine Vergötterungspflicht, ein ängstliches Tabu vor berühmten Namen, ein Verbot, erlauchte Auswüchse der Unsterblichen ehrlich Kropf zu nennen, anerkennt kein Künstler. Das sind unverschämte Erfindungen anmaßlicher Seelen, welche sich unbefugterweise an einen toten Meister heranschleichen, um ihn als ihr Monopol in Beschlag zu nehmen und sich mit seinem gestohlenen Glanze vor den Menschen unleidlich zu machen. Indem sie sich vor einem einzigen auf dem Bauche wälzen, glauben sie damit das Recht zu erkriechen, allen übrigen die schuldige Ehrerbietung zu verweigern. Jeder schöpferische Geist haßt sie von Herzen.
Man mag es drehen, behandeln und benennen wie man will, es kommt doch schließlich auch in der Kunst und Poesie auf den Glauben oder Unglauben hinaus. Glauben bedeutet auf diesem Gebiete die Überzeugung von einem ewig gegenwärtigen werkkräftigen Geiste des Schönen und Unglauben die Meinung, jener Geist marschiere getrennt von der jeweiligen Gegenwart, um in der Entfernung von mindestens einem Menschenalter zu biwakieren. Und beiderlei Überzeugung stützt sich auf die Erfahrung. Den einen erfüllt es; wie sollte ers nicht spüren? In dem andern gähnt eine graue Öde; da muß er wohl die Gegenwart für eine Jurakalkperiode ansehen.
Gläubige im höchsten Grade sind natürlich diejenigen, deren ganze Tätigkeit den Glauben als Triebkraft voraussetzt: die schöpferischen Menschen, die Urkünstler, die Meister. Wo ein Meister wohnt, da glänzt die Hoffnung, da winkt die Aufmunterung. Auf das bloße Gerücht seines Vorhandenseins erheben die Mutigen den Kopf; bis in die fernsten Winkel der Mitwelt zündet sein Beispiel; sein Name wirkt auf den Edeln als Herausforderung; sein Ruhm versiegelt den Lügen vom Minderwerte der Gegenwart das Maul. Naht man vollends einem Meister persönlich, so badet man in einem Jungbrunnen. Während in allen Gassen die Klageweiber das Siechtum des Talentes bejammern, während jeder Katheder den Torschluß der Poesie verkündet, jede Dorfzeitung den Bann über den Weinberg verhängt und jede Glocke Vesper läutet, zeigt er auf die Sonne Homers, deutet nach ebenbürtigen Adlern am Horizont, redet von der Unerschöpflichkeit des Schönen, von der Kürze des Lebens, von dem wenigen, was schon gesammelt, von dem Unabsehbaren, was noch zu ernten übrig bleibt. Unaufhörlich krächzt die Jahrmarktspolizei an den Kreuzwegen sich heiser: «Zurück! Die Hände weg! Ihr kommt zu spät! Es bleibt nichts mehr übrig!» Freundlich grüßt der Meister von seiner gastlichen Pforte: «Alles bisher Geleistete ist nur ein Anfang.»
Doch nicht allein zur Erzeugung des Schönen, sondern ebenfalls zu seiner Annahme bedarf es des Glaubens, wohlverstanden: zur unmittelbaren Annahme, zur Wertschätzung vor der Legende; denn nach der Legende könnens die Wichte. Auch nach dieser Richtung stehen die Künstler wiederum weit den übrigen voran, denn sie sind nicht bloß Schöpfer und Instrument zusammen, sondern zugleich Resonanzboden. Alles Schöne findet bei ihnen ein volltönendes, durch kein grämliches Mißtrauen, durch keine mäkelnden Vorbehalte gedämpftes Echo. Ein besonderes Seelenorgan befähigt den Meister, im Sande der trostlosesten Sündfluten die Goldkörner zu erkennen, aus den verheerendsten Bücherschwärmen das Bedeutende zu unterscheiden, ich meine jenes Verwandtschaftsgefühl, welches sich unangefragt meldet, sobald etwas Großes in den Gesichtskreis tritt. Außerhalb der Künstlergemeinde gebraucht das Urteil selbst des gescheitesten Mannes Krücken: Vergleichungen mit Vorbildern, Grundsätze, Aussprüche früherer Meister und ähnliches; schätzenswerte Krücken, immerhin Krücken; die überdies den Übelstand haben, gerade dann zu versagen, wenn man ihrer am dringendsten bedarf, nämlich dann, wenn das Originelle nicht den vorhandenen Mustern gleicht, wenn das Große nicht den Kleinen behagt, wenn das Neue kein durch das Alter geheiligtes Ansehen mitbringt. Das Urteil der Künstler ist ferner zugleich ein liebevolles, auf jede wertvolle Eigenart freundlich eingehendes; kein dankbareres Publikum für den Begabten, als große Männer; je größer, desto besser. Auf Grund dieser Eigenschaften bilden zu jeder Zeit die älteren, bereits anerkannten Meister die natürlichen Beschützer der jüngeren, noch um Anerkennung ringenden. Das Bedürfnis, einem Nachfolger die gröbsten Hindernisse aus dem Weg zu räumen, was bloß ein offenes Wort der Empfehlung kostet, ist auch ein zu nahe liegendes, als daß es nicht die Regel bilden sollte; das Gegenteil findet sich daher in der Geschichte der Kunst und Literatur nur als eine seltene Ausnahme. Über das Gegenseitigkeitsverhältnis der ausgereiften Künstler wird mancherlei Unrühmliches gemunkelt. Untersuchen wir jedoch die Akten genauer, so werden wir in jedem besonderen Falle das Zerwürfnis von den Hetzereien der beiderseitigen Anhängsel herrühren sehen. Mit unablässigem Sieden und Schüren, mit Wasserstoff, Chlor und Schwefel kann man bekanntlich sogar das Gold in eine Säure verwandeln.
Jenseits der Künstler sind noch zwei Klassen von Gläubigen zu verzeichnen, oder, genauer gesagt: eine Klasse und ein Zustand. Die Klasse besteht aus der Auslese der Frauen. Die berühmte vorurteilslose Empfänglichkeit der Frau für das Schöne jeder Art, jeder Form und jeden Namens ist Natur, gehört zum Wesen; in ausgezeichneten Persönlichkeiten offenbart sie sich sogar als ein sehnsüchtiges Bedürfnis, als ein Durst. Zwar möchte auch die übrige Menschheit das Schöne, behauptet es zu begehren und vermeint es zu suchen; doch einzig die Frau stößt einen unwillkürlichen Freudenruf aus, wenn sies erblickt. Das weibliche Urteil beruht wie das künstlerische auf dem Instinkt, was von allen Grundlagen stets die köstlichste bleiben wird, weil sich der Instinkt nicht beeinflussen läßt; doch ist der Instinkt des weiblichen Urteils auf das ‹Schöne› im engeren Sinne beschränkt; zur Unterscheidung des Nachempfundenen vom Ursprünglichen, des Anspruchsvollen vom Großen taugt er wenig. Herrliche Titanien, die sich an einen ungeschlachten Esel oder einen parfümierten Affen anklammern, in der Meinung, einen göttlichen Genius festzuhalten, werden stets von neuem sich unsern erstaunten Augen vorstellen. Wenn indessen die Frau nicht selten einen Frosch für einen Fisch ansieht, so hält sie doch kaum jemals einen Fisch für einen Frosch; noch weniger macht sie dem Fisch zum Vorwurf, daß er kein Frosch sei: es ist dies ein edler Zug und kein gemeiner Vorzug; man darf ihn zur Nachahmung empfehlen. Und dann, gegenüber dem einmal erwählten Gegenstand des Glaubens, was für eine Treue! Was für eine Selbstlosigkeit! Was für ein unerhörter Mangel an moralischer Feigheit! Die Frau wartet keine Zeichen und Erlaubnisscheine ab, achtet kein Verbot, ja spottet selbst des Hohns. Nach den hoffnungslosesten Niederlagen erlischt dieser Stern nicht, in den schwärzesten Sturmnächten beharrt sein milder, glückverkündender Glanz; später, nach dem Siege, wenn die andern, die sich während der Schlacht in den Gebüschen versteckt, mit zudringlichem Jubel hervorbrechen, zieht sie sich zurück; denn sie stritt nicht um den Lohn. Die Philosophie mag über die Frau urteilen, wie sie will oder muß; die Kunst schuldet ihr Ehrerbietung, Dank und Liebe. Ohne die Frau würde die Menschheit schon längst die Kunstwerke mittels Logarithmen ausrechnen und die Dichterkraft mit dem Koprometer messen.
Der Zustand ist jene wundersame Lazur, welche einige Jahre lang selbst die Seelen von gemeinem Schrot mit einem duftigen Hauch verklärt: die Jugend. Freilich nur die männliche Jugend, da die weibliche mit dem Modellstehen für die Phantasie und mit der Heiratsfähigkeit anderweitig beschäftigt ist; die männliche aber bis ins zarteste Knabenalter. Das Wechselspiel zwischen begeistertem Empfangen und schöpferischem Ahnen, zwischen bescheidener Bewunderung und keckem Selbstgefühl verleiht dem Pubertätsidealismus seinen Reiz und seinen Wert; die gewaltige Zahl der Teilnehmer und der stürmische Charakter der Überzeugungsäußerungen seine Macht. Die Ankunft neuer Jünglingsregimenter bedeutet stets eine Unterstützung des Künstlers, eine Vermehrung der Pietät für das Schöpferische, eine Verstärkung des Ruhmes für unvergängliche Werte. Dem Sauerstoff ähnlich greift die Jugend nur altes Eisen und faules Holz an, die edeln Metalle schützt sie vor dem Staube. Heilsam vor allem aber wirkt die Jugend dadurch, daß sie die babylonischen Türme der Scholastik in die Luft sprengt. Zwar beginnt das Wühlen und Schanzen sogleich von neuem; immerhin war es doch ein hübsches Schauspiel, wie die Pagoden samt den Pfaffen umherflogen.
Damit ist die Liste der Lämmer erschöpft, und wir geraten zu den Böcken. Und zwar haben die Böcke eine auffallende Familienähnlichkeit mit den im Neuen Testamente geschilderten. Das Neue Testament unterscheidet zwei Hauptklassen von Ungläubigen, die eine: das Volk, die andere: die Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten mit ihrem Anhang. Das Volk nennt man in der Kunstsprache ‹Publikum›. Unter jedem Namen betätigt es seine bekannten Eigenschaften. Einerseits Wankelmut des Urteils und der Bedürfnisse und geistige Schwerfälligkeit, andererseits Gutartigkeit und brachliegende, nutzbare Bereitwilligkeit. Das Publikum in seiner Gesamtheit zu schmähen, ist weder geziemend, noch gerecht, noch vernünftig; denn erstens hilft es nichts, zweitens hat der Mensch noch dringendere Pflichten auf Erden als den Auftrag, Publikum zu bilden, drittens befinden sich in der buntscheckigen Gesellschaft sehr vornehme Seelen, zum Beispiel die ersten Meister der Nebenkünste, überdies Persönlichkeiten, denen man mindestens Höflichkeit schuldet, zum Beispiel Königinnen, endlich Personen, die kein wohlerzogener Mensch öffentlich schulmeistert, zum Beispiel die eigenen Geschwister. Unheil stiftet das ‹Volk› oder ‹Publikum› höchstens durch seine Blindgläubigkeit gegenüber seinen Lehrern; gesellt sich nämlich zu der Blindgläubigkeit der Eifer, dann ergibt sich der ‹Anhang› der Pharisäer. Je weiter man sich von den Schulen entfernt, desto mehr schwindet diese Gefahr, desto harmloser und bereitwilliger erscheint das Publikum. Darum bekunden heute noch wie vor zweitausend Jahren die Meister eine merkliche Vorliebe für den Umgang mit Zöllnern und Fischern.
Für die Namen ‹Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrte› je einen genauen Paralleltitel in der Kunstwissenschaft zu finden, wäre eine leichte Aufgabe; sie wird mir übrigens gar nicht gestellt, da ich es nicht mit der Trennung, sondern mit der Zusammenfassung zu tun habe. Für die Zusammenfassung nun wähle ich mit Bedacht denjenigen Namen, welcher auf die gemeinsame geistige Heimat hinweist, den Namen Alexandriner. Wer immer von den Alexandrinern handelt, muß, will er nicht zur Ungerechtigkeit hingerissen werden, das natürliche Gesicht dieser Leute von ihren sauertöpfischen Mienen beim Anblick eines Wunders oder Werkes unterscheiden. An sich waren und sind ja die Alexandriner würdige Männer, achtbar und geachtet, verdient um Bildung und Wissenschaft, und darum mit Titeln und Ämtern ausgezeichnet, an antiquarischen Kenntnissen die Ersten ihrer Zeit, und darum «zu oberst in den Schulen» sitzend, voll von Eifer für die Erziehung des Volkes und der Jugend, Hüter des Tempels und des Gesetzes (der Kunst und Literatur), von schrankenloser, fast abgöttischer Pietät vor den heiligen Schriften (den ‹Klassikern›) erfüllt, an begeisterten Huldigungsbezeugungen für die Verfasser derselben sich niemals genugtuend; «sie bauen den Gerechten Denkmäler und schmücken die Gräber der Heiligen»; jede Kritik der Schriften, jede von den Propheten abweichende Meinung verabscheuen sie als einen Greuel der Gotteslästerung. Sie haben überhaupt nur den einzigen Fehler, daß sie meinen, der Quell der Offenbarung wäre ausgetrocknet, daß sie lehren, der heilige Geist mache zu ihrer Zeit eine kleine Generalpause von einem Jahrhundert, daß sie die fröhlichen Weissagungen an das Ende der Welt adressieren, daß ihr gesamtes Fühlen und Denken von der Voraussetzung beherrscht wird, die Gegenwart habe keinen vornehmeren Beruf, als der Vergangenheit die Fingernägel zu putzen, und der lebendige Mensch keine wichtigere Aufgabe, als die Toten zu balsamieren. Den einzigen echten Balsam liefert natürlich die Firma Kaiphas & Cie.
Die Frage, aus welchem Seelenwinkel der sonderbare Trieb entspringt, bei abgöttischer Verehrung der Vergangenheit die Gegenwart zu entwerten und die Kinder der nämlichen Propheten, vor welchen man sich auf den Bauch wirft, schlecht zu empfangen, ein Trieb, der sämtlichen Alexandrinern so natürlich ist wie Pulsschlag und Atemzug, ist leicht und bündig zu beantworten: er entspringt aus dem Instinkt der Selbsterhaltung; darum ist er so zäh und störrisch. Das ganze Ansehen und die hohe gesellschaftliche Stellung der Alexandriner beruht eben auf einem Interimszustand, auf einer Sedisvakanz, auf der Tatsache oder Annahme, daß zu ihrer Zeit keine großen Männer vorhanden seien. Sonst müßten sie ja von ihrem Thron heruntersteigen und das Lineal, das sie so meisterhaft schwingen, in ein Futteral stecken; sie haben sich aber da oben eingenistet und den Stuhl behaglich gefunden. Daraus erklärt sich ihre unbewußte, darum jedoch nicht minder eifrige Feindseligkeit gegen jede lebendige Kunst und gegen jeden Anspruch auf schöpferischem Gebiete. Ein Gleichnis soll diese Stimmung noch verdeutlichen. Wenn nach dem Tode des Herrn die Dienerschaft sich seines Erbes bemächtigt hat und in seinem Namen schaltet und waltet, wird sie wohl die Nachricht, daß ein Verwandter des Verstorbenen anrücke, mit Freuden begrüßen und dem jungen Herrn demütig mit dem Schlüsselbunde entgegenziehen? Nein, sie wird sich zwar bereit erklären, das Erbe dem Erbberechtigten auszuliefern, aber in jedem besonderen Falle den Ankömmling für unecht ausgeben; mit der Zeit wird sie sogar Aktenstücke vorweisen, welche bezeugen sollen, daß der Herr kinder- und verwandtenlos gestorben sei. Der nämliche Satz in den unbildlichen Gedanken übersetzt, lautet: Die Alexandriner müssen allem Ursprünglichen und Großen, wenn es lebendig, wenn es gegenwärtig, wenn es persönlich auftritt, den Krieg ansagen, weil es sie bedroht, weil es sie von ihrer Stellung neben dem heiligen Gral herunternötigt, weil der angekündigte junge Herr voraussichtlich einen Blick und eine Stimme, ein Urteil und einen Befehl und überdies allerhand unheimliche Abneigungen haben wird. Die ganze Sorge der Alexandriner ist daher darauf gerichtet, die Ankunft einer überlegenen Persönlichkeit zu verhüten und für den unglücklichen Fall, daß sie trotzdem herannahe, Wellenbrecher zur Abwendung der schädlichen Folgen anzubringen. Der Instinkt der Selbsterhaltung erfindet zu diesem Zwecke weitläufige Verteidigungssysteme, mit vorgeschobenen Werken, kunstvoller als der vollendetste Biberbau und Termitenhügel.
Man verfaßt vor allem einen Kalender, welcher auf Grund der Stellung des Mondes zur Erde ausrechnet, daß in den nächsten hundert Jahren überhaupt keine Talente möglich seien; die Kritik übernimmt die Verantwortung dafür, daß dieses Naturgesetz nicht übertreten werde. Ohnehin hat sich ja die Natur mit der Hervorbringung der Klassiker dermaßen angestrengt, daß man ihr unbedingt eine Erholung gewähren muß. Man schickt sie also in die Ferien, ob sie will oder nicht will. Die Diagnose ist da; die Gefahr der Schwindsucht ist dringend; der Spruch der Ärzte erlaubt keinen Spaß. Zur untrüglichen Erkennung außerordentlicher Begabung, die man so gut zu schätzen weiß wie ein anderer, wird der Mitwelt eingeschärft, daß erfahrungsgemäß jedes echte Talent mit einem Denkmal unter den Füßen einherzuspazieren pflegt; die Anwendung dieses Satzes auf das falsche Talent ergibt sich durch Umkehrung von selbst. Das Gesundheitsamt veröffentlicht ein Gutachten, laut welchem verdiente Anerkennung oder gar Ehre und Ruhm, in der Jugend oder im rüstigen Mannesalter genossen, giftig wirkt; es wird demnach jedermann ermahnt, denjenigen, der sich etwa unnatürlicher Weise schon in jungen Jahren auszeichnet, vor der Berührung mit den genannten Stoffen ängstlich zu behüten. Den Pfuschern im Gegenteil bekommt jede Auszeichnung in jedem Lebensalter wohl, da es ihnen zur Aufmunterung dient. Junge und auch ältere noch rüstige und zuviel versprechende Meister sollen demgemäß bei ihrer Ankunft sofort isoliert und einer lebenslänglichen Quarantäne unterzogen werden, bis eine Medizinalkommission ihren nahe bevorstehenden Tod, beziehungsweise ihren vollendeten siebzigsten Geburtstag bezeugt. In diesem Falle versammelt sich der Prüfungsausschuß der Alexandriner, um über ihre Aufnahme in den literarischen Senat zu beraten. Es darf immer nur einer auf einmal in den Senat aufgenommen werden; auch ist bei der Aufnahmefeierlichkeit strengstens darauf zu achten, daß die Anerkennung des einen ja den Charakter einer Zurücksetzung der übrigen enthalte; darüber muß in jedem einzelnen Falle der Takt entscheiden. Das Empfangsgeschrei muß so laut angestimmt werden, daß niemand es überbieten kann; so sichert man sich das Vorrecht der Verehrung. Der Verfassungsrat der vereinigten Pharisäer, Sadduzäer und Schriftgelehrten beehrt sich, einer löblichen Gegenwart und Zukunft mitzuteilen, daß Höchstdieselben beschlossen haben, die aristokratische Republik der Künstler und Dichter in eine Wahlmonarchie zu verwandeln. Wählbar sind nur tote Senatoren. Allfällige Bewerber um die Stelle eines Dichterfürsten haben ihre Zeugnisse, ihre nachgelassenen Werke und ungedruckten Briefe nebst Curriculum vitae, Namen, Wohnort und Nummer des Grabsteins bis spätestens zu Ende des Monats bei Endesunterzeichneten einzureichen. Jedes Gesuch, dem nicht ein amtlich beglaubigter Todesschein beigegeben ist, bleibt unberücksichtigt. Künstler, Schriftsteller und Dichter sind von der Abstimmung ausgeschlossen. Insubordinationen gegen den einmal erwählten Dichterfürsten in Form unbefugter Vergleichung desselben mit einem ihm an Rang und Kommando Nachstehenden soll als Hochverrat geahndet werden. Dem verewigten Dichterfürsten ist eine mit unumschränkter Vollmacht ausgerüstete, aus der Zahl der Alexandriner zu ernennende Regentschaft beigegeben, welche in seinem Namen die Regierungsgeschäfte besorgt.
Soweit die Alexandriner. Was sagt hierzu der Künstler und Dichter? Nun, der geht seiner Wege und tut seine Wunder und Werke. Treiben es jene gar zu dreist, so wendet er auch wohl einmal das Haupt nach ihnen und macht sich mit einer poetischen Metapher Luft. Heutzutage wählt er hierzu mit Vorhebe Bilder aus der Klasse der höheren Wirbeltiere. Ehemals hieß es: «O, ihr Schlangen, Heuchler und Otterngezüchte!» Im Grunde sind es ja keine Ottern, sondern bloß Blindschleichen. Zum Unglück der Alexandriner unterstreicht jedoch die Nachwelt solche Exklamationen, selbst wenn sie unbillig sein sollten, doppelt und dreifach mit innigem Behagen. Deshalb, weil sie den Dichtern so unendlich viel und ihren Gegnern so unendlich wenig verdankt, weil ferner jene so überaus liebenswürdig und diese es so ganz und gar nicht sind. Man wird immer von neuem versucht, im Namen der Gerechtigkeit ein gutes Wort für die verwünschten Alexandriner einzulegen. Wer verfolgt indessen ihr Andenken am wütendsten? Die Alexandriner der jedesmaligen Gegenwart. Und das ist der Humor des Unglaubens. Lächelt er auch nicht zwischen Tränen, so beißt er doch in sein eigenes Bein. Mit diesem versöhnenden Bilde will ich schließen.
Es gibt eine Unmenge von Stimmfehlern in der Presse; wir kennen sie, wissen aber auch, daß sie in den meisten Fällen unheilbar sind, weil sie nicht aus dem Kehlkopf, sondern von tief innen stammen, von geistigen Mängeln oder Charakterbresten. Daneben glaube ich aber auch solche Stimmfehler zu bemerken, die reine Berufskrankheiten sind, solche, die beim besten Willen und reinsten Streben auch den Befugtesten schleichend bedrohen, wenn er in regelmäßiger Folge wiederholt in der Presse öffentlich redet. Er selber pflegt sie nicht zu hören, der Öffentlichkeit dagegen fallen sie unangenehm auf.
Da ist vor allem der schulmeisterliche Ton. Dieser unangenehmen Tongabe zu entweichen ist für jeden, der durch die Presse ‹erzieherisch› wirken will, außerordentlich schwer; während anderseits die Lesewelt gerade gegen diesen Ton ganz besonders empfindlich ist. Gibt es doch eine erhebliche Anzahl von Menschen – ich gehöre auch dazu –, die es überhaupt wie eine Ungehörigkeit verspüren, daß irgend jemand sich unterfange, erzieherisch auf sie wirken zu wollen. Es gibt Menschen, welche schlechterdings als Männer nicht mehr pädagogisiert werden wollen und gelegentlich auch vergessen, daß keine Zeitung und keine Zeitschrift sich allein an Menschen ihrer Art wenden kann. Daraus folgt der Rat, die erzieherische Absicht niemals gar zu auffällig auf den Hut zu stecken. Belehrung hingegen, die ist jedermann nötig und jedermann willkommen; belehrende Aufsätze oder Zeitschriften werden auch von keinem Vernünftigen als schulmeisterlich verspürt. Die Frage drängt sich also auf: Wo liegt der Unterschied zwischen belehrendem und schulmeisterlichem Ton? Ich habe mir diese Frage oft gestellt und schließlich folgende Antwort gefunden: Schulmeisterlich wirkt die Belehrung, wenn neben der Belehrung der Leser zu dringend ermahnt und zu heftig gescholten wird, oder wenn der Verfasser bei der Belehrung mit unverhältnismäßigem Eifer Nebensächliches mit Gewalt einpauken will, bis der dumme Bub es endlich weiß, oder wenn er eine Privatmarotte hat, auf der er immer und immer wieder herumreitet, wie auf einem Aufsatzthema; und dergleichen mehr. Kurz, schulmeisterlich gegen seinen Willen wirkt derjenige Belehrende, der sich durch seinen achtbaren heiligen Sacheifer hinreißen läßt, seine Mitmenschen wie eine Schulklasse von Unmündigen abzukanzeln, während er doch, höchstens ein primus inter pares, erwachsene Leute vor sich hat. Etwas besser wissen berechtigt ja nicht dazu, den Unwissenden auszuzanken. Dieser zänkische, polternde Belehrungsstil ist, beiläufig gesagt, in andern Sprachen als der deutschen nicht in solchem Maße gebräuchlich. Als Heilmittel und Vorbeugemittel gegen die Gefahr, in den Schulmeisterton zu verfallen, möchte ich folgenden Spruch der Beherzigung empfehlen: Es gibt keine Sache, die so wichtig ist, daß nicht die Hochachtung vor dem Leser noch wichtiger wäre. Schon weil er nicht ‹folgt›, wenn er sich geringgeschätzt fühlt.
Der päpstliche Ton stammt nur zur kleinern Hälfte aus einer fehlerhaften Stimmgabe des Schreibenden; das meiste davon ist Ohrensausen des Publikums, welches den Vorwurf ‹Literaturpapst›, ‹Kritikpapst› und so weiter ziemlich freigebig austeilt. Wie kommt ein Kritiker, ein Zeitungsredaktor und so weiter in den Ruf des Papsttums? Fanatismus, Engherzigkeit, Absprecherei, Bösartigkeit und dergleichen bewirken das nicht; damit wird einer ein widriger, verhaßter Despot der Kritik, nicht aber ein Papst der Kritik; die Päpste der Kritik sind im Gegenteil ernste, würdige, milde Herren, die unter anderm auch zu segnen verstehen. Mir scheint, die Sache liegt folgendermaßen: Jeder Mensch, der eine Überzeugung hat und in den Fall gesetzt ist, seine Überzeugung öfters lehrhaft auszusprechen, also ein Kritiker, ein Redaktor, ein Professor, erstrebt natürlich möglichste Verbreitung seiner Überzeugung; er will das Publikum, wenn nicht belehren, doch jedenfalls beeinflussen. Mehr begehrt er nicht, falls er kein Streber ist; er predigt seine Überzeugung, will sie aber niemand durch Edikte oder Bullen aufdrängen. Nun kommt aber bei hervorragenden Leistungen eines Kritikers oder sonstigen Literaten oder Professors mit den Jahren ein Zeitpunkt, wo sein Name Autoritätskraft erhält und sein jedesmaliger Ausspruch fortan vom größten Teile der Leser wie ein Richterspruch ungeprüft hingenommen wird; während der kleinere Teil, der nicht mit dem Ausspruch einverstanden ist, nicht gerne mit einer anerkannten Autorität anbindet und lieber schweigt. Mit diesem Augenblick hat derjenige, dessen bloßer Name schon überzeugend wirkt, eine ganz ungeheure Macht über seine Leser, ja sogar weit über seine Leser hinaus: bis in alle Schichten der Nation. Eine solche Übermacht ist nun dem Eigner dieser Macht, falls er wirklich etwas taugt, durchaus unerwünscht. Ja, er weiß meistens nicht einmal, wie gewaltig seine Macht ist, wie denn überhaupt die berühmten Leute der Feder nicht wissen können, wie berühmt sie sind. Und diese gewaltige Macht wird je länger, desto mehr zwar nicht vom großen Publikum, das ganz froh ist, einen Leithammel für sein Urteil zu haben, wohl aber von denen, die diese Macht zu fühlen bekommen, als lästig verspürt. Nicht ganz mit Unrecht; denn daß ein einziger und immerfort der nämliche, und wäre er noch so tüchtig, den Leistungen die Note erteile, ist ja eigentlich ein Unfug und ist auch, ich behaupte es nochmals mit Nachdruck, dem Eigner solcher Macht ganz unerwünscht. Der kritischen Autorität wird der Unfehlbarkeitsnimbus von seiner gläubigen Lesergemeinde geradezu aufgedrängt. Da nun die Autorität, einmal erlangt, mit jedem Jahre wächst, so braucht einer bloß in seinem Amt noch älter zu werden, um schließlich der Opposition als ‹Papst› oder, falls er noch Kameraden der Autorität hat, als ‹Bonze› zu erscheinen. In demselben Maße wachsen dann auch die Umsturzgelüste der Opposition; die Grollenden, die lange Jahre nur gemurrt haben, fangen an, sich zu verständigen; die Urteilsbeschränktheiten der allmächtigen Autorität – und jedes Menschen Urteil hat ja seine Schranken – werden besprochen und bespöttelt, oft im geheimen, endlich öffentlich; plötzlich, eines Morgens, viel früher, als jemand vermuten konnte, liegt der Papst am Boden; indem das Publikum für seine langjährige Überschätzung sich durch völlige Wegwerfung rächt. Es ist interessant, an der Hand der Geschichte das Schicksal der literarischen Päpste und Bonzen zu studieren; man wird finden, daß immer wirkliche Verdienste da sind, daß diese Verdienste aber überschätzt wurden und daß schließlich das Geld für die Überschätzung mit Zinsen zurückverlangt wird.
Ein anmaßender Unfehlbarkeitston ist viel seltener, als man gewöhnlich glaubt. Es ist eine große Ausnahme, wenn etwa in der «Revue des deux mondes» ein mittelmäßiger Kritiker einen Flaubert oder einen Guy de Maupassant hoch von oben herab selbstbewußt abkanzelt. Als Beispiel für die Regel kann etwa ein Gottsched für Deutschland, ein Sarcey für Frankreich dienen: hochgebildete, hochverdiente, überzeugungseifrige und wohlmeinende brave Herren, denen aber unbillig und unleidlich viel Autorität zugemessen wurde und die nicht früh genug starben.
Um das Gesagte zusammenzufassen: Wer sich einer überstrahlenden Autorität oder einer hervorragenden Macht erfreut, also solch ein Hauptkritiker oder Hauptredaktor an einer sehr einflußreichen Zeitung oder ein Literaturprofessor an einer großen Universität, hat viel Bescheidenheit nötig, damit man ihm seine Autorität und Macht verzeihe. Und neben der Bescheidenheit das Talent der Selbstverjüngung.
Die allgemeine Annahme, nicht wahr, lautet, daß jede Förderung der Literatur zugleich einen Dienst für die Poesie bedeute, daß man im Volke den Sinn und das Interesse für Literatur wecken müsse, daß jede gediegene literarische Zeitschrift, jeder neue literarische Verein, jede Shakespeare- oder Goethe- oder Heine-Gesellschaft, jedes treffliche Buch über einen bedeutenden Dichter oder über eine Literaturperiode schlechthin als ein Gewinn dürfe verzeichnet werden, daß man überhaupt nie zu viel Literatur haben und treiben könne, vorausgesetzt, es handle sich um vorzügliche Literatur, und nie zu viel Wege nach Weimar bauen, vorausgesetzt, es seien die richtigen Wege.
«Dieses Land liest wenig gute Bücher», folglich muß hier die innere literarische Mission nachhelfen. «In dieser Stadt ist der Theaterbesuch kläglich», also muß man Hebel ansetzen, damit er besser werde.
So wird allgemein geurteilt. Diese Annahme nun halte ich für einen Irrtum. Ich bestreite nicht, daß die schrankenlose, mit allen Mitteln betriebene Literaturpflege der Literatur nütze, aber ich zweifle, ob sie auch der Poesie nütze; ich glaube vielmehr, sie schadet ihr mehr, als sie ihr nützt. Ich hege nun zwar wenig Hoffnung, daß es mir gelingen werde, Sie binnen einer halben Stunde zu meiner Ansicht zu bekehren – ein Mensch ändert ja seine Ansichten immer nur nachträglich und allmählich, daheim, wenn er mit sich selber allein ist –, aber es war mir ein Gewissensbedürfnis, hierüber meine Meinung einmal öffentlich auszusprechen; und nachdem ich sie hiemit vor Ihnen ausgesprochen, habe ich Ihnen gegenüber die Pflicht übernommen, meinen Satz auch zu rechtfertigen. Ich will daher versuchen, ob es mir gelingt, meine intuitiv geschöpfte, aber feste Überzeugung in logischer Rede zu begründen.
Die nächste Wirkung einer eifrigen, über die ganze Nation verbreiteten Pflege der Literatur ist die Vorherrschaft der Literaturgeschichte. Der Hauptstock der Literatur, also ungefähr das, was man die klassische Literatur zu nennen pflegt, tritt einem als eine historisch gegebene, mithin vergangene Tatsache gegenüber. Jede Nation verspürt das, was sie ihre Literatur nennt, im Präsensperfektum. Das ist ganz unvermeidlich, weil man doch nur über vorhandene Werke nachdenken, urteilen, sprechen, schreiben und abhandeln kann. Die zukünftige Literatur tritt äußerst selten in den Horizont (als Sehnsucht), niemals in das Bewußtsein einer Nation, sie kann vollends ganz unmöglich der Gegenstand der Literaturpflege sein.
Nun ist ja gewiß an und für sich die literarhistorische Tätigkeit aller Achtung und aller Ehren wert. Aus echter ehrfürchtiger Pietät entsprungen, leistet ihr stiller, geduldiger und selbstvergessener Fleiß eine Unsumme von verdienstlicher und nützlicher Arbeit, die wir alle kennen und anerkennen. Allein so von Jahr zu Jahr und von Jahrzehnt zu Jahrzehnt fortgeführt, entsteht, wenn die Umstände ungünstig liegen, ich meine, wenn eine Nation ohnehin mehr zum Betrachten und Forschen als zum künstlerischen Empfinden neigt, nach und nach unmerklich eine Verwechslung des literarischen Interesses mit dem poetischen Interesse und jenes natürlich zuungunsten des letztern. Es kann schließlich sogar so weit kommen, daß alle Poesie nur noch vom literarhistorischen Standpunkt aus betrachtet wird, daß alle Welt unbewußt von der Annahme ausgeht, Ziel und Zweck der Poesie wäre die Bereicherung der Literaturgeschichte.
Von diesem Zustande sind wir nun im gegenwärtigen Deutschland, dank der allgemeinen Literaturpflege, nicht mehr weit entfernt. Oder, offener und redlicher gesprochen, wir stecken schon mitten in diesem Zustande. Ich will Ihnen hiefür einige Symptome nennen, welchen der Wert von Beweisen zukommt. Vergleichen Sie doch einmal das Schicksal der Bücher, welche ein Dichter schreibt, mit dem Schicksal der Bücher, welche über diesen nämlichen Dichter geschrieben werden. Die Dichter treffen die größten Hindernisse auf ihrem Wege, die andern, die sie literarhistorisch verarbeiten, finden sofort alle Türen offen. Dieselben Zeitschriften, dieselben Verleger, die die Arbeit des Dichters ablehnen, greifen mit beiden Händen flehentlich nach Abhandlungen über die Arbeit des Dichters. Oder vergleichen Sie das Aufsehen, das eines Dichters Hauptwerk erzielt, mit dem Aufsehen, das ein Fund in seinem Nachlaß erregt. Jedes nachgelassene Manuskript, und wäre es poetisch noch so wertlos, wird heutzutage von der literarischen Welt als ein sensationelles Ereignis begrüßt, während vielleicht das Hauptwerk des Dichters, der das Manuskript hinterließ, unbemerkt vorbeiging. Das wichtigste, was die Gegenwart überhaupt kennt, ist ein ungedruckter Brief. Davor beugt jeder andächtig die Knie.
Beiläufig eine Frage als Anmerkung zur Sache. Halten Sie es für möglich, halten Sie es für denkbar, daß jemals wieder in Deutschland ein poetisches Werk, und wäre es das bedeutendste, sofort bei seinem Erscheinen die ganze Nation in freudige Aufregung versetzte? Ich nicht. Eine zweite Frage: Halten Sie es für möglich oder für wahrscheinlich, daß in Deutschland einem Meister der Poesie bei Lebzeiten eine allgemeine nationale, von niemand, ohne Ausnahme, verweigerte Ehrerbietung dargebracht werde, wie das im Auslande geschieht, wie sie auch Deutschland für einen Herausgeber oder Biographen übrig hat?
Doch wieder zu unseren Symptomen. Wenn ein Dichter todkrank wird oder wenn sich sein Geist umnachtet, erheben sich allerorten hervorragende literarische Köpfe, merkwürdig viele Köpfe, welche mit gespannten Blicken nach dieser Richtung spähen, als ob es jetzt dort bald etwas zu holen gäbe. Und wenn vollends der Tod eines Dichters gemeldet wird, so geht durch die Literatur ein tiefes Atemholen, das so ziemlich das Gegenteil der Trauer ist. Ich will nicht gerade behaupten, es ist ein Gefühl der Erlösung, aber es ist das Gefühl einer Erbschaft, eines nationalen Gewinnes. «Gottlob, jetzt haben wir ihn, jetzt ist er unser.» Mit andern Worten: «Jetzt können wir ihn literarhistorisch ausschlachten, ihn dozieren, ihn besser verstehen als andere.» Und sofort beginnt eine massenhafte Spezialliteratur über den noch warmen Leichnam, die sich bald zu einer Bibliothek auftürmt. Und zwar wird ohne Selbstironie und ohne jede Scham von solchen Spezialliteraturen über die Dichter gesprochen, als ob das die natürlichste Sache wäre, ja man rühmt sich noch ihrer. Man sagt mit wichtigem wissenschaftlichem Ernst: Mörikeliteratur, Kellerliteratur, Meyerliteratur, wie man sagt: Botanik, Zoologie und Mineralogie. Es wird also geradezu vorausgesetzt, daß jeder bedeutende Dichter seine ‹Literatur› bekommen müsse, und diese Voraussetzung beruht ihrerseits auf der andern Voraussetzung, der Dichter selber mitsamt seinen Werken wäre nur der Rohstoff, der erst verarbeitet werden müsse, um genießbar zu munden.
Ich könnte noch andere Symptome aufzählen. Zum Beispiel, daß wir alles, was sich auf Poesie bezieht, ‹interessant› finden. Als ob jemals Poesie interessant sein könnte! Interessant ist die Wissenschaft, mithin auch die Literaturgeschichte. Indem wir also Mitteilungen über Poesie und Poeten ‹interessant› finden, verraten wir damit, daß wir Poesie und Poeten literarhistorisch bewerten.
Nachdem dann einmal eine Nation literarhistorisch infiziert ist, stimmt sich ihr ganzes Daseinsgefühl der Poesie gegenüber epigonisch. Das heißt, sie verspürt sich als nachgeboren, verliert die Fühlung mit dem ewig gegenwärtigen und ewig jugendkräftigen Geist der Poesie. Und mit der Fühlung verliert sie zugleich den lebendigen, triebkräftigen, schöpferischen Glauben, den Glauben daran, daß heutzutage so gut wie jederzeit, so gut wie früher, Dichter ersten Ranges erstehen könnten. Zuerst, in den ersten Jahrzehnten nach den ‹Klassikern›, wirkt die epigonische Glaubenslosigkeit niederschlagend; man möchte, man sehnt sich, aber wagt nicht zu wollen. Die Dichter beginnen vor den klassischen Vorfahren zu scheuen, entsagen den höchsten Zielen und Aufgaben, weil vermutlich unerreichbar, und begnügen sich mit Kleinerem; oder sie biegen und weichen aus dem Wege, schlagen sich in Seitenpfade, um nicht in die Nähe der Vorbilder zu geraten, deren Vergleichung sie fürchten.
Indes mit der Zeit gewöhnt man sich allmählich daran, und abermals über eine Zeit, siehe da, findet man es ganz behaglich und angenehm, in einem Übergangszeitalter zu leben, und möchte um keinen Preis tauschen. Die literarische Weisheit kann nämlich in einem entwerteten epigonischen Zeitalter viel ungestörter ihr Wesen treiben als in einem klassischen Zeitalter, und der mittelmäßige Dichter kann unbefangener, seliger und mit mehr Gewinn und Ehre pfuschen, wenn kein Großer danebensteht. Und wieder über eine Zeit verbittet man sich geradezu das Wiedererscheinen eines großen Dichters; denn so einer würde ja für eine epigonisch gesinnte Literatur geradezu eine Kalamität bedeuten. Ich sage für die Literatur, nicht für die Nation. Denn das sogenannte Publikum heißt einen Großen jederzeit mit jubelndem Herzen freudig willkommen. Nicht also die literarische Welt.
Nun zu einem andern, verhängnisvollen Punkt.
Wenn die Literaturpflege einer Nation sämtliche Schichten der Gesellschaft gewonnen hat, wenn das Interesse für Poesie und Literatur eine allgemeine Bildungspflicht geworden ist, der sich kein Mensch mehr zu entziehen wagt, bei Strafe der Verachtung, dann geschieht das, was ich die ‹Invasion› nenne. Ich will diesen Ausdruck ‹Invasion› erklären.
Gesetzt der Fall, ich fragte Sie, für wie zahlreich Sie die Menschen hielten, die sich aus innerem Herzensbedürfnis um Poesie kümmern, so würde mir wohl jeder von Ihnen antworten: nur eine kleine Minderheit. Zur Zeit unserer Klassiker schätzte man sogar diese Minderheit äußerst klein, die poetischen oder für Poesie empfänglichen Menschen galten für spärliche Ausnahmsmenschen. Da nun heute alle Welt sich um Poesie und Literatur kümmert, was beweist das? Das beweist, daß Hunderttausende um die Poesie und in der Literatur sitzen, die von Natur wegen nicht dahin gehören und besser wegblieben. Das nenne ich die ‹Invasion›.
Ja, wenn diese Hunderttausende, die nicht hineingehören, sich begnügten, bescheiden zu lesen und zu lernen, wenn sie sich zum Beispiel zur Poesie so verhielten wie die Hunderttausende der Franzosen sich verhalten, die ebenfalls kein Verhältnis zur Poesie haben und die nichts anderes tun, als ihre Klassiker auswendig lernen und ewig rezitieren, und sich im übrigen still verhalten, dann wäre die Invasion kein sonderliches Übel.
Allein der Deutsche huldigt dem Satze: Schreiben ist seliger als Genießen und Dozieren seliger als Lernen. Die Folge davon ist, daß jedermann Literatur fabriziert und jedermann Poesie doziert. Mit der Million schreibender Dilettanten haben wir es hier nicht zu tun; es ist zwar ein närrisches Schauspiel, eine Nation, wo so ziemlich jeder Mensch Verse macht, aber es schadet verhältnismäßig wenig. Dagegen die dozierenden Dilettanten sind schauerlich. Sie sind es, die den ungeheuren Lärm in der Literatur verführen und mit ihrem Geschrei die Ohren der öffentlichen Meinung betäuben. Die dozierenden Dilettanten müssen Sie aber nicht auf den Kathedern suchen, denn auf den Kathedern muß man wenigstens etwas wissen – das ist schon viel –, sondern in zugänglicheren Gegenden. Und mit welcher beneidenswerten Sicherheit da tagtäglich über Poesie doziert wird! Keine Buchbesprechung, kein Theaterbericht des grünsten Journalisten, der nicht die Gelegenheit benützt, um uns über die wichtigsten Angelegenheiten der Poesie Aufschluß und Oberurteil zu schenken. Und wenn Hunderte von solchen Privatdozenten jahraus jahrein täglich am Werke sind, so können sie etwas leisten. Sie kennen den Satz – ist er übrigens auch wirklich wahr? –: Alles Gescheite ist schon einmal gedacht worden. Lassen Sie mich diesen Satz ergänzen: Es gibt keine Dummheit über Poesie und Literatur, die nicht im Verlaufe eines Jahres gesagt und gedruckt wird. Die Unwissenheit und Unbefugtheit der dilettierenden Literaturprediger ist übrigens nicht das Schlimmste. Schlimmer ist ihr Eifer. Der Eifer schützt zwar den Deutschen vor Frivolität; es ist ihm immer heilig Ernst mit literarischen Dingen, er verhandelt sich nicht, er verkauft sich nicht, er grinst nicht überlegene Überzeugungslosigkeit. Anderseits verführt ihn der Eifer zur Unduldsamkeit, bis zum Fanatismus. Das ist ein atavistischer Zug aus verschimmelten Zeiten, aus den Zeiten der Scholastik, Humanistik oder Pfaffistik. Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, daß ein Deutscher, sobald er über Poesie und Dichter, Ästhetik und Literatur zu sprechen kommt, feindselige Gedankenbewegungen ausführt und den Nebenmenschen verketzern möchte? Wenn Sie vor einem Italiener den Namen Dante aussprechen, so verdreht er die Augen gen Himmel und ruft: «Quant' è bello»; nennen Sie den Namen Racine vor einem Franzosen, so macht er ein Gesicht, als ob er Austern äße; sagen Sie aber vor einem Deutschen: «Goethe», so antwortet Ihnen sein Blick: «Was verstehen denn Sie Esel von Goethe?» Die Pflege der Literatur in Deutschland erinnert mich immer ein wenig an die Pflege der Theologie zur Zeit der Calvinisten und Wiedertäufer. Es regt sich immer das Bedauern, den anders Meinenden nicht ersäufen zu dürfen.
Dann gibt es unter den unzählbaren Völkern, welche die literarische Bildungspflicht in die Literatur geworfen hat, ein paar kleine, aber ungemein rührige Trüpplein, die eine besondere Beachtung verdienen. Da sind zum Beispiel die Feinde der Poesie. Ich erzähle Ihnen kein Märchen, ich berichte aus der Wirklichkeit: Es gibt Menschen, denen die Poesie im Grund der Seele zuwider ist, dermaßen zuwider, daß sie, wenn sie nur könnten, die Poesie ausrotten würden. Sie werden mich fragen: Wo sind denn diese abenteuerlichen Menschen anzutreffen? Ich antworte: Mitten in der Literatur. Natürlich gestehen sie weder sich noch andern die Feindschaft ein, sondern sie bemühen sich, aus dem Begriff der Poesie alles zu entfernen, was das Wesen der Poesie ausmacht. Eher haben sie nicht Ruhe. Das sind die Köter in der Literatur.
Ferner gibt es Menschen – und auch das ist kein Märchen –, welche alles Große hassen, welche in förmliche Wut geraten, wenn sie den Atem der Größe wittern. Auch diese müssen Sie nicht außerhalb, sondern innerhalb der Literatur suchen. Auch sie gestehen ihren Haß natürlich nicht ein; im Gegenteil: sie gebärden sich sogar als Apostel und Propheten des Genies, aber sie benützen das falsche Genie zum Angriff gegen das echte Genie, das sie mit allen Fibern der Seele hassen, weil es echt und groß ist. Das sind die Vipern in der Literatur.
Das ist der äußere Gegensatz von Literatur und Poesie. Es gibt aber auch einen inneren Gegensatz: Es läßt sich nämlich fühlen, läßt sich auch nachweisen, wenn es nötig ist und wenn man Zeit und Lust dazu hat, daß das literarische Klima die poetische Schöpferkraft schädigt, und zwar heillos schädigt. Vielleicht übernehme ich einmal diesen Nachweis.
Sie kennen alle die übliche Erklärung des Epigonentums, ich meine der Tatsache, daß unmittelbar hinter einem glänzenden Aufschwung der Literatur ein schroffer Niedergang stattzufinden pflegt. Die Natur soll sich ‹gleichsam› durch die ‹Überanstrengung› ‹erschöpft› haben und einer Erholungspause bedürfen, wie ein Acker, der nach überreichen Ernte jähren eine Zeit brach liegen muß.
Allein abgesehen davon, daß die Natur nicht wie ein Acker an endliche Vorräte gebunden ist und daß eine Kraft wie das Genie nicht mit Stoffen verglichen werden kann, abgesehen ferner davon, daß eine Natur, die sich ‹gleichsam erschöpft›, eine etwas bleichsüchtige Vorstellung ist, welche zu der bekannten robusten Verfassung der Wirklichkeit nicht wohl stimmt, bleibt es noch fraglich, ob die Hervorbringung vollkommener Geschöpfe mehr Naturkraft verbrauche als die Hervorbringung unvollkommener. Ich habe nie gehört, es müßten nach einigen Adlern von außerordentlicher Spannweite lauter geringe anrücken oder nach einer Reihe von auffallend schönen Frauen lauter häßliche, der Erholung wegen. Und wenn denn ein einziger Shakespeare oder ein paar Schiller und Goethe die Natur erschöpften, wieso findet sie Kraft, während dreier Jahrhunderte ununterbrochen Maler und Musiker ersten Ranges zu erzeugen? Das ließe höchstens schließen, ein einziger Dichter wöge Dutzende von Malern und Musikern auf, wofür sich unsere geehrten Herren Kollegen höflich bedanken werden.
Oder kommen wir vielleicht mit dem Bilde nationaler Erschlaffungsperioden der Sache näher? Also mit dem beliebten Gleichnis, ähnlich wie die Pflanze bekunde jedes Volk Wachstum, Reife, Niedergang und Tod? Indessen, hat denn jemand ein Volk entstehen oder sterben sehen? Es gibt der Geschichtsschreiber genug, und nicht von den schlechtesten, welche die Möglichkeit bestreiten, daß ein Volk untergehe. Was aber nicht untergeht, das hat auch keine organische Entwicklung. Überhaupt ist die Welt viel zu jung, als daß wir eine Naturgeschichte der Völker entwerfen dürften: wir kennen auch nicht ein einziges zuverlässiges Naturgesetz über das Leben der Nationen. Auf dem Felde des Nichtwissens aber läßt sich zwar ein prächtiger Strauß von rhetorischen Blumen, schwerlich jedoch die bescheidenste Frucht der Erkenntnis pflücken.
Lassen wir die Gleichnisse. Denn mit Gleichnissen, wo es sich darum handelt, einen verwickelten Tatbestand zu erklären, hat es eine invalide Bewandtnis: wenn sie zuweilen hinken, so schielen sie immer. Wir müssen uns also schon die Mühe nehmen, ehrlich und rechtschaffen zu denken.
Die unendlich vielfältigen Bedingungen, welche zur Entstehung einer literarischen Größe gehören, lassen sich in drei Hauptgruppen ordnen: die angeborenen Fähigkeiten, die persönliche Selbsttätigkeit und die äußern Einwirkungen.
Von diesen pflegt, beiläufig bemerkt, die zweite Gruppe weit unterschätzt zu werden: die Autobiographien der Dichter belehren uns, daß unsägliche Summen von Leiden und Anstrengungen vorangegangen sein müssen, ehe die Seele denjenigen Zustand erreicht, in welchem etwas Ewiges zu gelingen vermag, und wäre es der kleinste Vierzeiler. Doch das kümmert uns hier nicht. Es fragt sich: Welches ist die historisch veränderliche Ziffer? Und da kann die Antwort nicht verschieden lauten: Es ist die dritte Gruppe, also die Summe der Rückwirkungen der Zeitgenossen auf den Dichter. Sämtliche übrigen Bedingungen sind zwar selten in zureichendem Maße vorhanden, doch die Möglichkeit ihres Vorhandenseins ist jederzeit gegeben.
Nun wird gerade gegenwärtig der Wert der zeitgenössischen Einwirkungen überaus hoch angeschlagen: soll doch der Dichter geradezu das ‹Produkt seiner Zeit› sein.
Diese Ansicht hat etwas Verführerisches. Es ist angenehm, wenn einer nichts kann und nichts ist, behaupten zu dürfen, die Zeit sei daran schuld. Auch ist es erhebend für die Zeitgenossen, sich als Aktionäre an einem internationalen Kompaniegeschäft zur Gründung von Dichtern zu fühlen.
Anderseits liegt wiederum etwas Unerbauliches in der Vorstellung, als wäre der Dichter eine schleimige Seequalle, welche je nach der Umgebung bald grün, bald rosenfarbig schillert und in welcher jeder vorübergehende Zeitgenosse den Eindruck seiner Finger zurücklassen kann. Auch kommt schließlich der Dichter, der nur der Spiegel seiner Zeit ist und wieder seiner Zeit den Spiegel vorhält, doch gar zu optisch heraus.
Wenn ich daher von bangen Zweifeln gepeinigt werde, ob der Dichter das ‹Produkt seiner Zeit› sei, so bin ich hingegen heilig davon überzeugt, daß die Verpfuschung des Dichters das Produkt seiner Zeit ist. Und hierin hegt kein Widerspruch, denn das Experiment, daß einer zwar nichts produzieren, wohl aber etwas verpfuschen kann, gelingt nicht so selten. Die Verpfuschung des Dichters samt der Dichtkunst nun pflegt systematisch, wenn schon unbeabsichtigt in solchen Zeiten zu geschehen, welche unmittelbar den sogenannten ‹klassischen› folgen, also in den epigonischen. Ich stelle den Satz auf: In epigonischen Zeitaltern fehlt nicht das Genie, sondern eine ausnahmsweise ungünstige Geistesbeschaffenheit der Zeitgenossen erstickt es. Oder, mit anderen und genaueren Worten: Das Epigonentum beruht weder auf einer Erschöpfung der Natur noch auf einer Erschlaffung der Nation, das Epigonentum ist vielmehr eine umsonst, auf sträfliche Weise akquirierte Krankheit. Diese Krankheit aber entsteht, sobald eine Nation beharrlich rückwärts denkt und rückwärts fühlt. Was für eine Unsumme von Unheil hierdurch über eine Literatur hereinbeschworen wird, dies Ihnen Punkt für Punkt zu zeigen, mögen Sie mir erlauben.
Es gibt zweierlei Perioden in der Literaturgeschichte: vorwärtsschauende und rückwärtsschauende. Seitwärts blickt der Mensch niemals, weil er sonst zugleich emporblicken müßte, eine Gebärde, die ihm von jeher wider den Strich gegangen ist. Man lebt entweder im Bewußtsein einer literarischen Morgenröte oder einer literarischen Abendröte, niemals im Bewußtsein des Mittagglanzes. Die Konjugation der Völker kennt bloß ein Imperfektum und ein Plusquamperfektum, kein Präsensperfektum. Klassiker hat es zu keiner Zeit gegeben, es hatte bloß solche gegeben. Um Werke, welche sofort nach ihrer Veröffentlichung für klassisch gelten, steht es bedenklich; es sind diejenigen, welche am ehesten veralten, und wenn ein Dichter bei Lebzeiten ein Klassiker heißen will, so muß er sich selber überleben.
Von diesen beiden Perspektiven nun, der Perspektive nach vorn und der Perspektive nach hinten, ist die erstere unstreitig die natürliche, weil man dahin schauen muß, wohin man sich bewegt. Die Menschheit bewegt sich aber nicht rückwärts, ins Bekannte, sondern vorwärts, ins Unbekannte. Ja, die Geschichte lehrt uns, daß sogar das Außerachtlassen der Vergangenheit nicht im entferntesten diejenigen Einbußen mit sich bringt, die man befürchten sollte. Mit den frivolen Griechen beginnt Europa. Pietätvolles Sichversenken in die Vorzeit ist ein Charakterzug orientalischer Kultur; das hervorragendste Kennzeichen europäischer Kultur ist der Zukunftsmut.
Wenn nun ein Zeitalter vor staunender Bewunderung täglich und stündlich nach seinen Klassikern zurückblickt, so entsteht zunächst eine Verschiebung der natürlichen Verhältnisse zwischen den geistigen Mächten, indem die Poesie in den Vordergrund des nationalen Bewußtseins rückt. Dies scheint auf den ersten Blick lauter Gewinn, ist es jedoch keineswegs. Es gibt Geistesbetätigungen, welche dann am besten gedeihen, wenn sich niemand um sie kümmert; und je länger ich die Erfahrung prüfe, desto mehr kräftigt sich meine Überzeugung, daß die Poesie hierzu gehört. Ein Beispiel: Jedermann weiß, was die Griechen für die Poesie bedeuten. Nun, bei den Griechen stand keineswegs die Poesie im Vordergrunde des Bewußtseins und der Sorge, sondern Politik, Handel, Wirtschaft und die virtuose Ausbildung des Verstandes: die Sophistik. Worauf beruht das? Es beruht darauf, daß verständige, praktische, nüchterne Denkungsart Gesundheit eines Volkes bekundet und daß unter gesunden Verhältnissen sämtliche Dinge am besten geraten, die Poesie mit inbegriffen. Nicht wo man den Dichter am höchsten schätzt, sondern da, wo man ihn vernachlässigt, leistet er das Beste. Er braucht eben weder Aufmunterung noch Anregung. Seine Aufmunterung ist der innere Zwang und seine Anregung das Leben. Je reicher, je kräftiger, je vernünftiger sich dieses vor seinen Augen abwickelt, desto besser. Es ist auch ersprießlicher, als Mensch unter Menschen herumgewürfelt und meinetwegen sogar ein bißchen mißhandelt zu werden, als mit halbgöttischen Vorrechten und halbäffischen Ansprüchen ein langhaariges Lorbeerbewußtsein mit sich spazieren zu führen. Es verhält sich mit der Poesie wie mit dem Glück: das sicherste Mittel, sie zu verfehlen, besteht darin, sie zu erstreben. Geht hingegen ein Geschlecht seiner Pflicht und seiner Arbeit nach, so stellt sich die Poesie von selbst ein, denn das Material dazu ist ewig vorrätig.
Durch den Glanz des Klassikerruhms wird ferner die Jugend einer Nation geblendet, wie Käfer durch die Lampe, und zu massenhafter, unglückseliger, dummdreister Nachahmung verlockt. Begreiflich, da der Dichterruhm zugänglicher scheint als jeder andere, selbst als der Künstlerruhm. Es wird nicht so leicht jemand einfallen, zum Geburtstage seines Vaters eine vierstimmige Fuge in Cis-Moll zu komponieren oder zum Polterabend seiner Schwester die Anbetung der drei Könige auf Glas zu malen. Falls daher keine gebieterischen Hemmnisse dazwischen treten, wird eine Unmasse von Unberufenen die Literatur unsicher machen. Gebieterische Hemmnisse nun erheben sich in den romanischen Ländern, weil dort die sprachlichen Anforderungen an den Dichter derart sind, daß der Dilettant gern oder ungern die Finger davon lassen muß. Darum treffen Sie zum Beispiel in Frankreich so wunderselten ein Gedicht in Zeitschriften, darum hat dort der Dichtername seinen vollen Ehrenklang behalten, darum hören Sie niemals einen Franzosen über den Dichter spötteln, niemals, selbst nicht in Witzblättern.
Bei uns im Gegenteil erscheint der Zugang zur Poesie bequemer, als dies anderswo der Fall ist und als es jemals zuvor der Fall gewesen ist. Die Ursachen hiervon ließen sich nennen und aufzählen; die Folge aber ist, was wir wissen und leiden. Im Grunde dürfen wir uns nicht allzu bitter beschweren, denn wer von der Volkspoesie ausgegangen ist, muß es hinnehmen, wenn das ganze Volk sich gütigst an der Poesie beteiligt. Daß jedoch durch die verdankenswerte Kollektivmitarbeit der Poesie ein zweifelhafter Dienst geleistet wird, darüber sind wir alle einig.
Die Masse des Untüchtigen raubt dem Tüchtigen Platz, Luft und Licht. Die Bereitwilligkeit der Aufnahme, tausendmal getäuscht, versagt schließlich oder schlägt gar in höhnische Zweifelsucht um, worunter der junge Meister nicht weniger leidet als der junge Stümper. Das ist jedoch noch das geringste Übel; ein unheilschwereres ist folgendes: Um in dem literarischen Getümmel bemerkt zu werden, glaubt man sich mit Gewalt bemerkbar machen zu müssen. Man erhebt die Stimme zum Fortissimo, oder, deutsch gesprochen, man brüllt, man doziert sich selbst, man verbündet sich zu Banden, man wirft schnarchende Tendenzen oder rasselnde Schlagwörter in die Höhe, man predigt himmelstürmende Revolutionen, alles, um auf seine armseligen Verdienste aufmerksam zu machen, bis einem schließlich die Erkenntnis dämmert, daß es auch ohne alle Verdienste geht. Das Theater, da es plötzlichen und durchschlagenden Ruhm verspricht, erhält jetzt den Hochton in der Literatur, welcher durchaus nicht so natürlich und so gefahrlos ist, wie man wohl annimmt. Das laute Gebaren steckt allmählich selbst die bessern Elemente an, wie unter anderm die fieberhafte Häufigkeit der Produktion und die sensationellen, verlogenen Titel unserer Bücher und Theaterstücke bezeugen. So erhält die gesamte Literatur etwas Unfeines, Unedles, Vorlautes und Unruhiges. Man dichtet mit den Ellenbogen, und man singt einander auf die Absätze.
Die unfeinen Gewohnheiten können wiederum in einer Kunst, in welcher die zartesten Seelenschattierungen abfärben, unmöglich ohne Rückwirkungen auf den Produktivstil bleiben. Die Vornehmen aber, angeekelt von dem unschönen Lärm, ziehen sich zurück, und die Vornehmen werden schwerlich die schlechtesten sein. Kurz, in einem literarischen Chaos herrscht naturgemäß die laute, rücksichtslose, talentvolle Mittelmäßigkeit.
Nun gibt es freilich eine Behörde, von welcher die Sage erzählt, daß sie das Chaos ordne, nämlich die Kritik. Schade nur, daß die Kritik gerade dann, wenn man sie am dringendsten nötig hat, den Bankerott erklärt. Vorab wird ja die Kritik nicht minder von Unberufenen heimgesucht als die Poesie, wobei natürlich ihr Kredit in die Brüche geht. Eine Kritik ohne Kredit aber ist ein Messer, das in die Luft schneidet. Dann spottet ja die Unmasse des Stoffes selbst der riesigsten Arbeitskraft. Bedenken Sie, daß der Stoff nicht unter die Kritiker verteilt wird. Vielmehr stürmt gegen jeden einzelnen der vereinigte Gewalthaufe sämtlicher Verlagsanstalten. Entweder wird nun der Kritiker sich eine harthäutige Sorglosigkeit anzüchten, welche mit Gewissenlosigkeit Geschwisterkind ist, oder er wird überhetzt, gereizt und bekümmert, so daß er schließlich in jedem Buch einen Feind seiner Lebenskraft erblickt, was nicht eben die wohlwollende Empfänglichkeit erhöht. In beiden Fällen ist er gezwungen, eine Auswahl des zu prüfenden Stoffes zu treffen. Was nun? Die guten Bücher tragen keine Schelle um den Hals. Ein Glück noch, wenn die Auswahl nach Laune und Zufall geschieht. Sie geschieht meistens nach andern Motiven. Wo es aber schon eine Gunst bedeutet, wenn ein Buch nur zur Prüfung gelangt, da schwebt die Gefahr einer Günstlingswirtschaft in der Kritik erschreckend nahe. Ich phantasiere nicht, ich rede von der Wirklichkeit. Man erhält gegenwärtig in Deutschland ungefähr so viele Kritiken, als man Bekannte oder Beziehungen hat.
Den Bankerott der zünftigen Kritik könnten wir am Ende noch verschmerzen, wenn nur nicht gleichzeitig der Oberkassationshof seine Entlassung einreichte, ich meine die Meister der Dichtkunst. Sie allein vermögen die Größe von der Scheingröße zu unterscheiden, kraft jenem Zauberringe, welchen jeder Meister am Finger trägt und welcher sofort einen schönen Ton der Freundschaft erklingen läßt, sobald ein Ebenbürtiger naht. Diese nun werden in Zeiten literarischer Überschwemmung kopfscheu, weil sie die Folgen eines Präzedenzfalles besorgen. Sie schweigen also vorsichtig, die Nation aber geht ihres einzigen zuverlässigen Kompasses verlustig.
Während die literarische Kritik ihren Augiasaufgaben erliegt, gedeiht die geschäftliche um so erfreulicher. Ihr Beruf ist freilich auch ein leichterer, da ihr Horizont einen zierlichen Miniaturbogen um die eigenen Verlagsartikel beschreibt. Das Urteil bietet hier ebenfalls keine Schwierigkeiten, da eigene Artikel bekanntlich immer Primaqualität sind. Billiger als ‹Dichter von Gottes Gnaden› gibt man es da schon nicht. Die geschäftliche Kritik muß aber der literarischen den Rang ablaufen, weil sie rühriger ist, weil sie sich auf Publikation versteht, weil ihr große Mittel und viele Wege zu Gebote stehen, weil sie ihre Stimme gleichzeitig in sämtlichen Gegenden und wiederholt erschallen lassen kann. Zu den vielen Wegen gehört der, den Redaktionen mittels gedruckter Zettelchen, die jeder Kritiker kennt und zuweilen nur zu gut kennt, Leitmotive in den Mund zu legen. Die Geschäftskritik ist mithin der Vorsänger der literarischen Kritik.
Leider zugleich auch ihr Kapellmeister. Haben Sie jemals überlegt, was für eine Ungeheuerlichkeit in dem Brauche liegt, daß unsere literarische Kritik sich ihren Arbeitsstoff von den Buchhändlern aufs Pult legen läßt? Daß sie nur dasjenige und alles dasjenige berücksichtigt, was den Verlagsanstalten jeweilen Gewinn verheißt? Daß einerseits ein Buch, welches aus irgendeinem Grunde, vielleicht aus Faulheit der Kritiker, in den ersten Monaten unbesprochen geblieben, hiermit bis an der Tage Abend die Anwartschaft auf eine Prüfung verliert, falls nicht etwa ein anderer Verleger es aufkauft, wodurch es dann plötzlich wieder zu einer literarischen Tatsache wird? Daß anderseits ein längst verschollener Schmöker als eine literarische Novität behandelt wird, sobald es einem Geschäftsmann einfällt, ihn abermals zu verlegen? Oder daß anläßlich einer wiederholten Auflage das nämliche Buch sich nochmals der Gunst einer Anzeige und Besprechung erfreut? Was in aller Welt hat denn das mit der Literatur zu schaffen: eine neue Auflage? Das bekundet doch nichts weiteres, als daß einem Buchhändler sein Lagervorrat ausgegangen ist, wie dem Delikatessenhändler seine Salami. Wer aber dem andern den Arbeitsstoff vorschreibt, der ist tatsächlich des andern Herr. Unsere literarische Kritik ist deshalb nicht viel mehr als eine freiwillige Agentur des Buchgeschäftes. Ich erzähle Ihnen keine Märchen, ich berichte von der Wirklichkeit. Der Ruhm eines Schriftstellers pflegt erfahrungsgemäß mit dem Moment zu beginnen, in welchem ein großer Verleger sich seiner annimmt. Es müssen also duftige Feengespinste aus den Verlagsanstalten durch die Kritik in die Nation laufen.
Die Gesamtbilanz der Kritik lautet wie folgt: Die Berufensten schweigen. Wenige sagen über wenige Bücher viel Gescheites. Sehr viele reden über sehr viele Bücher sehr viel Albernes. Alle melden über manche Bücher nichts. Sämtliche Verlagshändler jauchzen über sämtliche Verlagsartikel in tausend Zungen. Und da soll ein armes Publikum klug daraus werden!
Ein Wunder, daß in diesem Charivari schließlich das Tüchtige dennoch durchdringt. Das Wunder aber verdankt das Publikum sich selber, nämlich seiner instinktiven Urteilskraft, welche auf chemischem Wege gleich dem lebendigen Wasser mit Hilfe der Zeit das Nichtige ausscheidet und das Gediegene kristallisiert. Freilich bewunderungswert kann diese wunderliche Kritik keineswegs heißen. Sie wirkt zwar unfehlbar und bequem: man läßt die Dinge gehen, wie sie gehen, und sieht alle dreißig Jahre einmal nach, was etwa übriggeblieben ist. Was übrig blieb, ist gut, das andere war nutzlos. Also eine Kritik im Futurum exactum. Allein von dreißig zu dreißig Jahren werden diejenigen, welche das Gute hervorbrachten, sachte ein wenig älter, und das Schauspiel zuzusehen und abzuwarten, bis das Faule gütigst die Gewogenheit hat zu verfaulen, gehört nicht zu den kurzweiligsten. Die Literatur aber bekommt durch die enorme Verspätung der Anerkennung einen muffigen Beigeschmack. Die unmittelbare Wechselwirkung von Leistung und Dank gehört zu den Grundlagen ersprießlicher literarischer Zustände.
Die bisher berührten Schädlichkeiten hatten sämtlich ihren Ursprung in einer krankhaften Überreizung der poetischen Nerven einer Nation. Ich komme nun auf die Geistesgebrechen des Epigonentums zu reden.
Die typische Geistesverfassung des Epigonentums ist ein Zustand, den ich mit dem unmittelbar verständlichen Namen Gottschedismus belegen will. Man müßte ihn auf den Namen Boileau taufen, wenn die Wortbildung es zuließe. Kein Volk ist dem Gottschedismus völlig entgangen. Dauernd hat er sich in Frankreich niedergelassen; am meisten blieb Deutschland von ihm verschont, obschon auch bei uns der Gottschedismus nicht gar so mausetot ist, wie man sich das gerne vorschmeichelt. Ein Geschmäcklein desselben verspüren wir hier und da in Lehrbüchern der Poetik, und allerneuestens besitzen wir an einem bestimmten Orte der Literatur den Gottschedismus sogar in seiner üppigsten Strohblüte. Ich meine den Anstands- und Regelnkodex unseres Lustspiels. Diese Gespensterfurcht vor der gesunden Lustigkeit, diese geometrische Winkelmesserei, wie weit der Mund zum ‹feinen› Lächeln aufgemacht werden dürfe, diese pedantische Rangetikette von ‹Lustspiel›, ‹Schwank› und ‹Posse›, das ist Gottschedismus vom reinsten, filtriertesten Leitungswasser, welcher sich nur um so pikanter ausnimmt, als er im Namen desjenigen verübt wird, der den Gottschedismus aus Deutschland verjagte.
Denn was ist Gottschedimus? Gottschedismus ist die ängstliche Rücksichtnahme auf den sogenannten ‹feinen› ‹gebildeten› Geschmack, die peinliche Sorge um die Reinheit des Vorstellungskreises, des Stils und der Sprache, das wichtigtuerische Bemühen um äußerliche Vollendung, also um Formglätte, nebst dem Streben, diese Güter durch feste Regeln der Nation bleibend zu sichern. Ein solcher Geisteszustand ist den epigonischen Zeitaltern vorbehalten, weil erst unantastbare Tatsachen vorhegen müssen, damit die Theorie unanfechtbare Normen und Gesetze schöpfe. Solche Tatsachen aber sind die Klassiker.
Der Begriff ‹Klassiker› ist ja selber schon ein Gottschedismus. Sehen wir uns einmal diesen inhalts- und folgenschweren Begriff, den wir den Franzosen entlehnt haben und merkwürdigerweise bis auf den heutigen Tag mit uns schleppen, nach seiner ursprünglichen Vollbedeutung an, wie er dieselbe noch gegenwärtig in Frankreich besitzt.
‹Klassisch› will in der Literatur ursprünglich sagen: etwas schlechthin Vollendetes, nicht etwa bloß etwas überwältigend Großes, sondern Fehler- und Schlackenloses. Als ein solches schlechthin Vollendetes betrachtete nun bekanntlich die Renaissance-Menschheit und betrachtet noch jetzt der Renaissance-Epigone, nämlich der Franzose, alles und jedes, was Griechen und Römer hinterlassen haben. Die letzte Zeile des letzten Hellenen oder Lateiners galt und gilt da als über der Kritik stehend, als absolut vollkommen, als normal, als klassisch. Die neuere Zeit kann dieses Ehrentitels nicht selbständig teilhaftig werden, sondern bloß durch direkte Nachahmung des Altertums in allem und jedem, unter anderm auch im Stoff.
Corneille und Racine haben Stoff und Stil dem Altertum entnommen, sie haben die Regeldetri des Aristoteles getreulich befolgt, folglich sind sie ‹Klassiker›. Molière hat die antike Komödie zum Vorbild, er gibt seinen Personen griechische Namen, folglich ist er ‹Klassiker›. Voltaire hat neben antiken Stoffen mit Vorliebe mittelalterliche behandelt, folglich ist er nur ein Dreiviertelsklassiker.
Hieraus können Sie erraten, warum es dem gottschedistischen Franzosen rein unmöglich ist, selbst beim besten Willen, unsern großen Dichtern den Titel ‹Klassiker› zuzugestehen. Das denkbar größte Genie und die bewunderungswerteste Vollkommenheit mißt er ihnen bereitwillig bei, allein es fehlt das direkt Antikisierende, das er von jedem Klassiker verlangt. Das Stoff- und Formgebiet, in welchem sich unsere Dichter bewegen, erscheint ihm von vornherein als minderwertig, und diesen vermeintlichen Minderwert vermag ihm kein Genie wettzumachen, genau wie unsern deutschen Gottschedianern die beste Posse niemals ein Lustspiel wert ist. Das ist der ursprüngliche Vollbegriff des Wortes ‹klassisch›. Sie sehen, daß er Gottschedismus die Fülle enthält. Ob übrigens in unserem abgeschwächten Sprachgebrauch nicht dennoch Überbleibsel von Gottschedismus mitwandern, das wäre wohl einmal einer besondern Untersuchung wert.
Die Nachteile des Gottschedismus nun kennen wir alle aus der Literaturgeschichte und können sie neuerdings wieder an der Quelle studieren: Der Gottschedismus vereitelt die Urwüchsigkeit und die Tiefgründigkeit der Poesie. Weniger wohl wegen der Regeln, da sich mit jeder Regel leben läßt, wenn sie nur klar ist, als wegen der Geschmackstüftelei. Ein Genie erscheint den Zeitgenossen immer geschmacklos.
Allzuhäufig dagegen vergißt man die Verdienste und Vorzüge des Gottschedismus. Ich erlaube mir deshalb, daran zu erinnern: Der Gottschedismus erhöht auf Kosten des Ausnahmedichters die literarische Durchschnittsstufe, er verfeinert den Geschmack und rottet die Roheit aus, er schafft Stilgefühl und Sicherheit der Sprache; er verhindert den pfuschenden Dilettantismus, lehrt das Volk reden und den Gebildeten schreiben, bietet der Kritik faßliche Handhaben, so daß in Frankreich das Tüchtige durchschnittlich in drei Monaten zur Geltung kommt, statt in fünfundzwanzig Jahren wie in Deutschland; endlich: er befähigt die Nation zur geistigen Weltherrschaft. Denn nur was einfach, klar und glatt auftritt, imponiert dem Fremden.
Dem Gottschedismus verdankt Frankreich seine unversiegliche literarische Exportkraft. Überdies schützt der Gottschedismus, indem er über die gelehrte Universität eine literarische Behörde (in Frankreich die Akademie) setzt, vor dem Alexandrinismus, und das ist nicht sein kleinstes Verdienst.
Was ist Alexandrinismus? Kurz und klar gesprochen: die Aufzehrung der schöpferischen Literatur durch die literarische Gelehrsamkeit. Böswillige Absicht ist hierbei keineswegs vorhanden, wie überhaupt nirgends im Epigonentum; im Gegenteil: die Gelehrsamkeit leistet sogar anfänglich durch ihre sammelnde, ergänzende und sichtende Tätigkeit erhebliche Dienste, frißt jedoch vor lauter Diensteifer allmählich der Poesie das Herz und die Eingeweide, bis schließlich nichts als die Haut übrigbleibt. Wie beim Baron von Münchhausen, welcher unversehens einen Wolf im Pferdegeschirr hatte. Das geht folgendermaßen zu: Weil die wissenschaftliche Forschung an Tatsachen, an Quellen gebunden ist, gewinnt für die Klassikerforschung wie für jede Spezialforschung das klassische Quellenmaterial ausschließliche Wichtigkeit. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto heiliger erscheint die Quelle und desto wertloser das übrige. Zu dem übrigen aber gehört die lebendige Poesie.
Hierzu gesellen sich noch andere seelische Triebfedern, vor allem der Selbsterhaltungstrieb.
Überdenken Sie einmal, was für eine Landeskalamität das wäre, wenn einer der Marmornen plötzlich von seinem Sockel herunterstiege, um leibhaftig unter seinen geschäftigen Bewunderern zu wandeln. In solchem Falle müßte man ja die glänzende Forschertätigkeit jählings einstellen wie ein Mühlenrad. Da sei Gott vor! Große Dichter sind ferner keine Waisenkinder; sie haben ihre Idiosynkrasien, und eine ihrer hartnäckigsten Idiosynkrasien pflegt sich gegen die Zunftgelehrten zu richten. Da sei abermals Gott vor! Mit nagelneuen jungen Größen wäre das Zusammenleben noch unheimlicher, da der frommste Christ nicht vorauszuerraten vermag, wes Geistes Kind sie ungefähr sein werden.
In alexandrinischen Zeiten erscheinen deswegen keine literarischen Größen mehr, weil zu viele Menschen ein Lebensinteresse daran haben, daß keine erscheinen. Punktum. Nun hegt ja selbstverständlich ein bewußter Widerstand fern; allein Sie kennen das Phänomen des Gedankenlesens: wird einer aufgefordert, mit verbundenen Augen eine Zahl hinzuschreiben, so schreibt er nicht diejenige Zahl, die er will, sondern diejenige, die er mag. Die Alexandriner nun schreiben in solchem Fall sämtlich eine Null. Auch ist der Fall immer gegeben, denn ihre Augen sind stets verbunden.
Der Alexandrinismus ist erblich. Und zwar wird das Gift beständig stärker, der Bazillus bösartiger. Nach einer Generation von einfachen Alexandrinern kommt eine von doppelten, hernach von vierfachen. Denn die Jugend ist den Alexandrinern überliefert, indem in epigonischen Zeitaltern sämtliche Lehrstühle der Literatur in Lehrstühle der Literaturgeschichte und Literaturphilologie ausarten, womit sie von selbst den Gelehrten anheimfallen. Man erwirbt sich in solchen Epochen das Recht, die heranwachsende Nation über das Wesen der Poesie zu unterrichten, indem man eine ungedruckte Handschrift mit philologischen Anmerkungen drucken läßt. Der Staat nämlich ist ewig alexandrinisch gesinnt, aus dem einfachen Grunde, weil er nur das Wissen examinieren kann. Das Examen aber ist bekanntlich der Endzweck aller Erziehung.
Und der Ertrag des Alexandrinertums für die Nation?
Auf der Lichtseite:
Ein vollständiges Klassikermuseum. Ferner: eine glorreiche Klassikerwissenschaft, welche sämtliche Umstände, die sich von nah und fern auf die Klassiker beziehen, feststellt. Endlich: die Unterweisung der Jugend in dieser Wissenschaft.
Auf der Schattenseite:
Die Gewöhnung der Nation an den Gedanken, daß ein anständiger Dichter vor allem tot ist. Der Reim auf die lebendigen Dichter läßt sich hiernach ohne Mühe durch den Gegensatz finden. Ferner: die Anregung für das Buchgeschäft, sämtliche Urgroßväter immer wieder neu aufzulegen, während den Enkeln mehr oder minder höflich bedeutet wird, sich zu bescheiden. Ferner: die Verwechslung der Literatur mit der Literaturwissenschaft, wodurch schließlich das Interesse an der erstem von dem Interesse an der letztern unmerklich weggestohlen wird. Ferner: die Einführung des Begriffes ‹Bildung› in die Poesie, wo derselbe genau so viel zu schaffen hat wie in der Religion oder in der Liebe. Ferner: die Erfindung einer Literaturbildungspflicht, einer Hochschule der Selbsttäuschung, um einen milden Ausdruck zu gebrauchen. Endlich: das Abhandenkommen des Verständnisses der Klassiker. Denn nur der Tätige versteht die Tat, und nur wer auf der nämlichen Höhe steht, kann den Standpunkt erklären. Auf wissenschaftlichem Wege die Klassiker zu verstehen, ist so unmöglich, wie auf gelehrtem Wege einen großen Feldherrn zu begreifen. Man muß zuvor Offizier sein.
Der Alexandrinismus, sich selbst überlassen, führt zuletzt unvermeidlich zum Byzantinismus. Byzantinismus ist Alexandrinertum, welchem entweder der Stoff oder der Geist ausgegangen ist, oder auch beides miteinander. Es ist die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Nebensächlichen und der äußerliche Kultus. Statt der Arbeit der Fleiß, statt des Gottesdienstes das Zeremoniell.
Byzantinismus haben Sie, wenn die Gelehrsamkeit das ursprünglich Heilige, also die Werke der Klassiker, verläßt, um die Heiligkeit im Umkreise derselben aufzuspüren: in der Persönlichkeit der Dichter und in den Beziehungen zu ihnen oder gar in den Beziehungen zu den Beziehungen, wie wenn man zum Beispiel die Tanten, Verwandten und Bekannten der Dichter mit einem Nimbus garniert. Byzantinismus haben Sie, wenn emendierte Ausgaben oder vervollständigte Register und Kataloge als nationale Angelegenheit behandelt werden. Byzantinismus haben Sie, wenn ein Geschlecht zwar die klassischen Werke nicht mehr liest, aber ihre Namen beständig im Munde führt. Byzantinismus haben Sie, wenn in einem Buche über die Verdauungswerkzeuge des Regenwurmes beiläufig dem Dichterfürsten das Kompliment abgestattet wird.
Urteilen Sie nun, ob heutzutage Byzantinismus zu finden ist, und wo ungefähr auf Erden.
Das Epigonentum kann sich ausnahmsweise auch mit Überbleibseln fremdartiger, vorklassischer Geisteszustände verquicken, zum Beispiel mit der Scholastik oder dem Doktrinarismus oder zu deutsch: der Schulweisheit. Dieselbe hat eine ordentliche Geschichte hinter sich, seit ihrem ersten Auftreten in Europa gelegentlich der Theologie bis auf den heutigen Tag. Damit kann ich mich jedoch natürlich nicht aufhalten; genug, wir haben sie noch, oder, richtiger gesagt: wir haben sie von neuem.
Scholastik ist auf der einen Seite das Besserwissen, der unwiderstehliche Drang, das Lineal über des Nächsten Haupt zu schwingen, der Instinkt, zu beweisen, daß jedermann außer ihm Unrecht habe. Scholastik ist auf einer andern Seite die Lust am gegenstandslosen Denken, also am Abstrakten und Begrifflichen, die Spekulationswut, die Methodik, die Systematik. Disputation ist hier Zweck. Ein Scholastiker ist immer anderer Meinung. Darum ist dem doktrinären Kopf am wohlsten im Abstrusen, im Unergründlichen und Unerschöpflichen. Kenntnisse sind nicht seine Schwäche; das ist ihm zu gering. Sein zyklopisches Bewußtsein geruht höchstens mit enzyklopädischen Resultaten sich zu befassen, indem er die riesigsten Vorstellungen von überall her abschöpft. Während der Alexandriner das Wissen auf Kosten des Lebendigen bevorzugt, bevorzugt der Scholastiker das Nichtwissen. Unbestimmtheit ist der Ausgang und vermehrte Konfusion der Triumph, welche wieder zu erneuter Besserwisserei den willkommenen Anlaß bietet. Bei aller Kühnheit der Gebärde ist der Gedanke überaus zahm. Die Luftreise in den blauen Äther erscheint zuerst schwindelhaft; allein beim nähern Zusehen entdeckt man, daß das Gedankenschifflein vorsichtig mit einem Strick festgebunden ist. Den Strick aber liefert die jeweilen für unantastbar geltende Autorität.
Sie werden mich fragen, was die Literatur mit der Scholastik zu tun habe? Verzeihen Sie, die Frage ist schief gestellt. Die Literatur hat freilich nichts mit ihr zu tun, aber sie hat mit der Literatur zu tun. Nämlich die Literatur gießt Tinte in ihr Faß. Ermessen Sie doch die himmlischen Katzbalgereien, welche hier möglich sind: über das Wesen des Schönen, der Kunst und der Poesie, über die ‹Auffassung› der Klassiker und ihrer Werke, über jeden einzelnen Teil eines jeden einzelnen Werkes, über die Charakteristik jedes ‹Helden› und jeder Nebenperson und vor allem über die dramaturgischen Probleme. Die letzteren für sich allein genügten ja, um bis an der Tage Abend Abhandlungen gegen Abhandlungen zu schreiben, was bekanntlich der Daseinsgrund aller Poesie ist. In der Tat hat sich die dramaturgische Schulweisheit bei uns derart entwickelt, daß ein künftiger Geschichtsforscher neben jagenden, nomadisierenden und ackerbauenden Nationen eine besondere Rubrik für dramaturgische wird eröffnen müssen.
Schließen Sie einmal auf zehn Sekunden die Augen und öffnen Sie dieselben wieder, so erblicken Sie die Scholastik an jedem Punkte der Literatur tätig.
Haben wir doch bereits einen förmlichen Heiligenkalender von erlösenden ‹Frauengestalten›, eine Ophelienmetaphysik, ein Gretchenevangelium, ein Noramysterium.
Und jedes Ding muß natürlich sein bestimmtes Plätzchen auf der Schulbank haben. Der eine Klassiker erhält 1 a, der andere 1 b. Die zeitgenössischen Dichter wiederum müssen sich Promotionen unterziehen, in welchen sie von den Schuldirektoren ihre Rangnummer zugesprochen erhalten.
Die Poesie, deren allererste Voraussetzung die Gutartigkeit ist, kann vorab durch das gehässige Wesen nicht gewinnen. Es ist Ihnen nämlich gewiß schon aufgefallen, daß, wer über eine literarische Kontroverse schreibt, allemal einen isegrimmigen Ton anschlägt, als ob ihm ein Knochen aus dem Munde gezerrt würde. Ich habe lange Zeit umsonst nach der Erklärung dieser wütenden Stimmung geforscht, bis ich endlich beobachtete, daß Füchse öfters, Schulfüchse immer wütend sind. An den Herren sind Kirchenväter verlorengegangen.
Sodann leidet die Poesie Gebietsverengerungen, ja geradezu Amputationen durch die doktrinäre Engherzigkeit. Doktrinäre können aber nicht anders als engherzig sein, weil sie von historisch Gegebenem abstrahieren, das historisch Gegebene aber sich zur Poesie verhält wie eine begrenzte Zahl zur Unendlichkeit. Wäre es auch nur deswegen, weil sie der Neuzeit das Epos wegdisputiert haben, so müßten wir die literarischen Schulmeister verabscheuen. Denn was heißt das, das Epos? Drei Vierteile der Poesie, samt ihrem Herzen.
Daß die Unfreiheit nicht etwa bloß auf den Horizont beschränkt ist, sondern einen seelischen Hauptcharakterzug des Doktrinarismus bildet, können Sie an folgendem Symptom sehen: Der poetische Messias – man konstruiert nämlich in diesem Lager neben andern Fabelfiguren auch poetische Messiasse –, der ‹poetische Messias› also erhält jetzt schon, ehe er nur in Sicht ist, sein Pensum vorgeschrieben. «Das wird der poetische Messias sein, welcher ...» Oder: «Der poetische Messias wird ...» Wie gefällt Ihnen ein Messias mit gebundener Marschroute, der sich sein Kärtchen soll von den literarischen Schulmeistern kupieren lassen? Daß man sogar die Freiheit selbst zur Fessel verwandeln könne, scheint unmöglich. Nun, den literarischen Doktrinären gelingt selbst dieses Kunststück. Die Meinung war, das Pariser Theaterstück solle uns von der Rabulistik der Schuldramaturgie befreien; und siehe da, wir erhielten einen Talmud der ‹Bühnentechnik›, gegen welchen die alte ‹Schuld und Sühne› eine Erlösung gewesen war. Es galt also wieder, sich von der ‹Bühnentechnik› zu befreien: Was haben wir erlebt? ‹Freie Bühnen›, deren Freiheit mit einem vierkantigen Lineal zur Welt kam.
Was ein Doktrinär anrührt, wird unvermeidlich zur Fessel oder zur Schablone. Die Klassiker? Jede ihrer Tatsachen eine ewige ‹Grundwahrheit›. Jedes Beispiel ein ausschließliches Gesetz. Jeder Rat eine Regel. Jeder Trost ein Verbot. Alles wird hier dogmatisch aufgefaßt. Durch den literarischen Dogmatismus aber geht die lebenspendende Wirksamkeit der Klassiker nicht minder verloren als die Wirksamkeit der biblischen Schriften durch den theologischen Dogmatismus des konstantinischen Zeitalters.
Interessant wird die Sache, wenn die Scholastik populär wird, wenn jeder Mensch eine Volksausgabe des literarischen Katechismus in der Tasche führt, wenn die Kritik die neuen Werke auf ihre stoffliche, formale und inhaltliche Orthodoxie examiniert, wenn das Publikum die Bücher als ästhetischer Privatdozent liest, dem Dramatiker die Proportion der Szenen nachrechnet und dem Schriftsteller die Koordination der Charaktere, oder wenn gar die Geschäftsleute vom Geiste der Weisheit inspiriert werden, so daß der Theaterdirektor ein Stück ablehnt, weil die Peripetie nicht an der richtigen Stelle sitzt oder die Exposition in den zweiten Akt hinüberreicht, oder daß ein Verleger einen Roman nicht nimmt, weil ihm ein Charakter irgendwo nicht richtig ‹durchgeführt› zu sein scheint. Wahrlich, den Dichter beneide ich, der in einem solchen Schulstubenzeitalter zur Welt kommt!
Wer aber mit der Scholastik ein ernstes Wort zu reden hat, das ist die deutsche Nation. Nämlich jene schmähliche Fremdendienerei, die wir nun schon so lange ohnmächtig beklagen, sie stammt von dem Dünkel des doktrinären Besserwissens. Hier sitzt die Wurzel des Übels: nicht im Mangel an nationalem Selbstbewußtsein, sondern im Mangel an Bescheidenheit des einzelnen gegenüber der Nation. Um vor seinen Landsleuten Schulmeister spielen zu können, stöbert man in der Fremde herum, spielt dort eine ziemlich bescheidene Figur und entschädigt sich dafür, indem man mit geschwollener Dozentendrüse heimkehrt.
Seit siebenzig Jahren nun schon erleben wir periodische Wanderzüge der literarischen Lemminge nach Paris, mit stetig zunehmender geistiger Untertanenschaft. Heute, hundert Jahre nach Lessing, steht es so, daß unsere Literatur, daß unsere Bühne eine Filiale der französischen geworden ist und daß, wenn der letzte exotische Schriftsteller in einem Winkel der Landkarte hustet, Deutschland Emser Wasser trinkt.
Da ziehe ich vor Gottsched ehrerbietig den Hut ab. Gottsched hatte doch wenigstens so viel Achtung und Liebe für seine Nation, daß er ihr aus der Fremde das Beste aussuchte. Auf der Höhe der französischen Literatur wählte er sein Vorbild. Gegenwärtig sticht man blindlings in den ersten besten fremden Suppentopf, und was zufällig an der Gabel hängen bleibt, ist für uns zum Muster noch gut genug! Das ist das Werk des literarischen Doktrinarismus. Wir müssen ihn als unsern geistigen Erbfeind ausrotten.
Nun, Sie kennen die Gewohnheit der Natur, jedem Geschöpf, insonderheit den nagenden, strohfressenden und wiederkäuenden, einen scharfen Todfeind erwachsen zu lassen. Auch die Scholastik hat einen solchen Todfeind, welcher mit ihr so sicher fertig wird wie das Wiesel mit den Ratten, wenn man ihm nur nicht die natürlichen Waffen künstlich stutzt. Dieser Todfeind ist die Frau und ihre natürliche Waffe der Spott. Man streitet gegenwärtig so viel über den Beruf der Frau. Einen vergißt man: den Beruf, den Schulweisen auf der Nase herumzutanzen.
Nach den geistigen Gebrechen des Epigonentums sollte ich Ihnen auch die Charakterschäden desselben darlegen. Ich muß mich jedoch auf Andeutungen beschränken.
Das auffälligste sittliche Merkmal des Epigonentums ist der Mangel an Mut und Edelmut bis zu dem geraden Gegenteil dieser Tugenden, für welche es bloß übellautende Namen gibt. Ist doch schon die Willensentäußerung, das Höchste zu erstreben, ein unedler Zug, weil es Aufgabe eines jeden Geschlechtes ist, alles neu zu betätigen. Man zehrt nicht ohne schweren Charakterverlust einzig von dem geistigen Erbe der Vergangenheit. Sodann verlernt ein Geschlecht, indem es sich gewöhnt, stets am Gängelband der Autorität zu bewundern, die Selbständigkeit der Schätzung. Da man das rückwärtsliegende Große mit blendendem Glänze umgeben sieht, verlangt man allmählich immer erst den Glanz, ehe man sich entschließt, etwas anzuerkennen. Hiermit wird einem feigen Namenskultus Vorschub geleistet, welcher jedesmal die jüngere Generation systematisch an allen Enden und Ecken übervorteilt, weil die Jugend keinen Nimbus mitbringt. Der Namenskultus seinerseits ruft wieder einem Protzentum, wo mächtige Plutokraten des literarischen Geschäftes den Anfänger ihre Macht wollen fühlen und das Genie möchten antichambrieren lassen. Der Ruhm aber, das Höchste, was eine Nation für Verdienste zu vergeben hat, verliert seinen edlen Goldklang und verdunkelt zum Ruf, wonach derjenige, der am häufigsten genannt wird, einerlei wie und von wem, in die erste Reihe rückt.
Da kann es zum Beispiel vorkommen, daß ein Schriftsteller, der alljährlich etwas Schlechtes veröffentlicht und alljährlich von der Kritik verurteilt wird, durch die unermüdliche Wiederholung dieser Leistung und dieser Verurteilung sich einen ‹Namen› erwirbt und hiermit alle Türen offen findet. Da ferner das ewige Im-Staub-liegen vor den Klassikern eine gewisse Entsagung der Eigenliebe fordert, versucht man sich dadurch schadlos zu halten, daß man verlangt, der Nebenmann solle sich noch tiefer in den Staub drücken, und paßt mit polizeilichen Blicken auf, ob das auch richtig geschehe. Man übernimmt also die Rolle eines päpstlichen Türknechtes und wird dadurch servil. Oder man verketzert jede freie Meinungsäußerung hinsichtlich der Klassiker und gerät hierdurch ins Pfäffische.
Wenn man nicht gar den Übeltäter mittels des beliebten ‹Brandmarkens›, ‹Festnagelns› und ‹Tieferhängens› der Nation als Majestätsverbrecher denunziert, eine unehrliche Beschäftigung, mit welcher man den Sykophanten und Henkern ins Handwerk pfuscht.
Ein zweiter Hauptschaden, innig mit dem Alexandrinertum und der Scholastik verwachsen, ist der Verlust der Wahrhaftigkeit auf dem gesamten weiten Gebiete des Denkens.
Schon die tägliche Klassikerwäsche bringt ja eine große Versuchung zur Unwahrhaftigkeit mit sich. Man setzt sich nämlich sehr bald unbewußt zur Aufgabe, die Klassiker von allen Fehlern reinzudestillieren; dies aber ist schon eine unehrliche Aufgabe, deren Lösung Advokatenkniffe und sophistische Kunststückchen nach sich zieht. Hiermit verwandelt sich die literarische Weisheit in Apologetik. Man doziert mit Balsam und urteilt mit Benzin.
Da jeder, der sich an diesem Anilingeschäft beteiligt, zum voraus des Beifalls sicher ist, entsteht ein literarhistorisches Strebertum, welches sich anstrengt, zu den bekannten Vorzügen immer wieder neue hinzuzutüfteln. Auf diesem Wege geschehen dann byzantinische Entdeckungen, wie und wasmaßen ein berühmter Dichterfürst zugleich eine Autorität ersten Ranges in der Musik oder in der bildenden Kunst oder in der Zoologie, in der Botanik und so weiter gewesen sei.
Der schlimmste, leider zugleich häufigste Mißbrauch aber ist folgender: Man zieht vor den Klassikern seine sämtlichen Grundsätze ein oder biegt ihnen eine Ecke um, bis sie passen; ohne deswegen im mindesten den Anspruch fahren zu lassen, daß die Grundsätze heilig und unbeugsam wären. Es ist eine fortwährende Maß- und Gewichtsfälschung des Urteils, eine beständige Verleugnung der eigenen Bekenntnisse, ein ewiger Selbstwiderspruch zugunsten der Autorität, wobei man mit dem Wörtchen ‹zwar› glaubt, seine Seele gerettet zu haben. Der Selbstwiderspruch muß sich beständig vergrößern, weil der Hiatus der Zeit zwischen der Autorität und uns sich vergrößert und der Epigone, in allen Dingen schlaff, nicht den nötigen Mut besitzt, der Zeit zu widerstehen. So kutschiert er wie der Page im Zirkus auf zwei Pferden, aber wohlverstanden ohne Zügel; schließlich reißt ihn die Zeit mit, allein er behauptet, noch immer auf beiden Pferden zu reiten. Und mit dieser Behauptung lügt er. Verlogenheit, das ist das Ende desjenigen Geisteszustandes, welcher scheinbar so harmlos mit einer entzückten Achsendrehung der Augenmuskeln begonnen hatte. Wo aber Verlogenheit herrscht, da ist jede Änderung eine Besserung, da muß selbst der Feind als Erlöser begrüßt werden. «Und der Herr sandte Heuschrecken über Ägypten», müssen wir da inbrünstig beten.
Wäre es mir nun vergönnt, Ihnen eine Kur gegen den Epigonismus vorzuschlagen, so würde ich Ihnen ungefähr folgendes verordnen:
Als Gymnastik: die Angewöhnung, in aufrechter Stellung zu bewundern und nach jedem Kunstgenuß den Mund sorgfältig zu schließen. Ferner: das Bestreben, das Gesicht nach vorn einzustellen; auf griechische Manier. Nur die ersten Male werden Sie einen leichten Schwindelanfall verspüren. Ferner: alle zwanzig bis dreißig Jahre einmal im Garten das Oberste zu unterst zu kehren; das gibt freilich einen Umsturz, allein Pflügen ist auch Umsturz.
Als Diät: mäßige Enthaltung von dem irreführenden Begriff ‹Klassiker›. Nehmen Sie statt desselben lieber irgendein gutes ehrliches deutsches Wort; Sie werden sich gesünder dabei befinden. Ferner: ja nicht mehr literarische Speisen zu sich nehmen, als das Herz verarbeiten kann. Der Appetit ist hierin stets der sicherste Berater. Ferner: strengste Enthaltung von allen weisen Scharteken.
Endlich empfehle ich Ihnen das Ant-Epigonin. Wissen Sie nicht, was das ist: das Ant-Epigonin? Es ist die lebendige Größe.
Wenn es gilt, den Irrtum eines ganzen Zeitalters, also einen herrschenden, übermächtigen Irrtum zu bekämpfen, so muß man sich mit der ganzen Kraft dagegenstemmen, man muß angriffsweise verfahren, man muß den Gegner befeinden, man darf seine Blößen ausspähen und braucht sich nicht einmal davor zu scheuen, ungerecht zu verfahren. So haben die Bahnbrecher unsrer deutschen klassischen Literatur getan, die Herder und Lessing. Ihre kriegerischen Urteile brachten uns Erlösung, und dafür segnen wir sie und danken wir ihnen.
Allein wenn der Gegner längst niedergeworfen ist, brauchen wir keineswegs in der Kampfstellung zu verharren und die im Kampfeseifer gefällten Urteile unbesehen zu den unsrigen zu machen. Tun wir das, so schädigen wir unsre Einsicht und handeln auch nicht in der Meinung unsrer Erlöser. Lessing würde über einen unschädlichen, ich meine, einen unser deutsches Drama nicht mehr bedrohenden Corneille andere, gerechtere Aussprüche getan haben als damals über den von ganz Europa gepriesenen König der Tragödie. Wir haben nicht mehr nötig, Corneille die Größe abzusprechen, Boileau einen Pedanten zu schmähen und die einfältige Behauptung vom eintönigen Humpeltrapp des französischen Alexandriners ewig zu wiederholen, nicht mehr nötig, auf Euripides und Seneka herumzutreten, Virgil herunterzusetzen und Ovid und Horaz den Dichtertitel abzusprechen; wir brauchen nicht, weil Herder uns den Wert der dichtenden Volksseele offenbart und das Volkslied als Medizin gegen den klassischen Kunstdünkel empfohlen, die großen Kunstformen verächtlich beiseite zu schieben und in alle Ewigkeit das Heil des Dichters in den kleinsten Kunstformen zu suchen. Es bleibt ja gewiß wahr: in der Lyrik erweist sich am deutlichsten, ob einer eine echte Dichterseele hat oder nicht; aber ebenso wahr bleibt, daß eine Nation von der Lyrik allein nicht leben kann, daß jedes Volk sich nach großen Kunstformen sehnt, und zwar mit Recht, daß es darbt, wenn diese fehlen.
Was Poesie ist, das weiß heutzutage der Deutsche gründlich und weiß es wohl besser als jeder andere, aber was Dichtung ist, haben wir unterwegs ein bißchen vergessen und verlernt.
Ich habe ihn auch einst dafür gehalten, als ich ihn nur aus unseren deutschen Darstellungen kannte. Nachdem ich mir ihn aber selber ein bißchen angesehen, lautet meine Meinung anders. Heute sage ich: Möchten wir doch recht viele solche ‹Pedanten› haben, wie Boileau einer war! Wir wären freisinniger und großherziger, als wir sind. Gleicherweise die Größe von Corneille, von Racine und von Molière zu erkennen, und zwar zu Lebzeiten Molières, und Molière den Weg zur Anerkennung zu bahnen, das ist schon kein Kleines. Und nun obendrein noch, obschon auf dem Boden des französischen und römischen Klassizismus stehend, Homers poetischen Wert zu begreifen und zu verteidigen, dessen Wert damals noch nicht allgemein anerkannt war, und endlich zu allem noch die Größe der biblischen Sprache zu fühlen, also sich auf den Standpunkt zu stellen, den später Herder einnahm, ein solcher Mann ist alles, was Sie wollen, aber ein Pedant ist er nicht.
O die ausgefahrenen Geleise! O die Urteile, die hinter großen Autoritäten blindlings immer und immer deren Irrtümer wiederholen! Man trennt Molière, weil er von Autoritäten gepriesen wurde, von Corneille und Racine, die von Autoritäten verdammt worden sind; und um das zu können, leugnet man ihre innere Zusammenhängigkeit, ihre gemeinsamen Kunstprinzipien, behauptet, bei ihm blühendes Leben zu erblicken, während man bei den gleichzeitigen Tragikern nur tote starre Glieder sehen will, duldet oder rühmt gar bei ihm den gereimten Alexandriner, den man Corneille und Racine als Fehler vorwirft, und dergleichen mehr. Es ist durchaus nicht meine Absicht, Molière herabzusetzen, aber ich erlaube mir, das Kunststück, ihn von den französischen Tragikern zu trennen, als eine künstliche Machenschaft und die Gewohnheit, ihn auf Kosten seiner Kollegen von der Tragödie in alle Himmel hinauf zu rühmen, als eine Unbilligkeit zu bezeichnen. Seine Kunst hat genau die Vorzüge und die Fehler seiner pathetischen Kollegen, und seine Komödien sind von dem blühenden Leben der Shakespeareschen Komödien wenigstens ebensoweit entfernt, wie die Tragödien Corneilles und Racines von den Shakespeareschen Trauerspielen, nach meinem Urteil sogar noch viel weiter. ‹Steif›. Auch Molière ist ‹steif›; er konjugiert ja seine Stücke förmlich durch und konstruiert seine Hauptcharaktere nach Adjektiven. Man sehe sich doch einmal seinen «Dépit amoureux» an; das ist ja förmlich mit dem Lineal gedichtet. ‹Mager.› Molière ist nicht weniger mager als Corneille. Und seine Satire ist zahm und dabei überaus vorsichtig. Der «Tartuffe» tut der Geistlichkeit nicht weh, und die «Précieuses ridicules» sind keineswegs gegen die vornehmen, mächtigen «Précieuses» gerichtet, sondern bloß gegen die niedrig geborenen, mithin unberufenen Nachahmer. Die «Précieuses» sind eine Satire gegen die Parvenus. Wenn uns aber Molière besser mundet als die Römer der Tragiker, so liegt das bloß am Stoff, der unserm Geschmack besser zusagt. Ist aber unser stoffliches Geschmacksurteil das Urteil der letzten Instanz?
Mit dieser Meinung von Molière stehe ich allerdings einzig da. Indessen was tut das? Übrigens doch nicht so ganz einzig. Jacob Burckhardt – es tut mir leid, immer Jacob Burckhardt anführen zu müssen, allein was kann ich dafür, wenn einem so oft bei einer seltenen Wahrheit Jacob Burckhardt einfällt? das ist seine Schuld – also Jacob Burckhardt hatte genau die nämliche Meinung von Molière. Einen leblosen, steifen Gesellen nannte er ihn, mitten im Kolleg. «Aber sagen Sies ja nicht laut», fügte er launisch hinzu, zwischen Scherz und Ernst. Ich sage es aber laut, nicht aus ihm, sondern aus mir.
Daß die Kritik selbst vor den erlauchtesten Namen nicht die Augen in die Tasche stecken soll, sondern sehen, was zu sehen, und sagen, was zu sagen ist, das ist nicht bloß meine Überzeugung, sondern auch meine ernste Mahnung und eindringliche Warnung. Denn eine kniefällige Kritik schädigt mit dem Wahrheitsmut auch die Einsicht in die Wahrheit und die Unterscheidungsfähigkeit zwischen richtig und unrichtig. ‹Die Kritik verstummt›, das heißt mit andern Worten: ‹Der Geist verdummt.› Schlimmer noch: kritiklose Bewunderung ist knechtische Bewunderung; wo aber knechtische Gesinnung einreißt, da erleben wir auch bald die Kehrseite davon, nämlich die Frechheit. So wie ein Gasthofportier dem in glänzender Karosse Anfahrenden eine Verbeugung bis zur Erde abstattet und dafür den schlicht Daherkommenden hochfahrend behandelt, so entschädigt sich der Kotausüchtige für seinen Bauchfall vor dem Ruhme durch freches Benehmen vor solchen Menschen, die ihm noch nicht vom Ruhme als unantastbar vorgestellt sind.
Ich will nun mit dem guten Beispiel zahlen, indem ich es wage, eine der berühmtesten und seit dem ehrwürdigsten Altertum von den höchsten Autoritäten gepriesene Stelle Homers zu beanstanden. Ich meine die Stelle der Ilias, wo von dem bloßen Nicken der Augenbrauen des Zeus die Höhen des Olympos erbeben. ‹Großartig›, ‹erhaben›, lautet über diese Stelle das allgemeine Urteil. Einverstanden, aber unter einer Bedingung; nämlich der, daß Zeus in Ewigkeit unbeweglich sitzenbleibt. Denn wenn ein Gott, dessen Brauenzwinkern schon den Olymp erbeben macht, aufsteht und umhergeht oder gar sich zornig gebärdet, so fällt ja die Erde in Stücke, und die Sterne purzeln vom Himmel herunter.
Es paßt also diese Stelle auf einen Marmorzeus in einem Tempel; Phidias durfte daher den Vers zum Motto nehmen; sie würde auch auf einen Baal oder einen Jehova passen, der beständig auf seinem Wolkenstuhl thront, die Erde als Schemel und die Sterne als Krone benützend; sie paßt aber nicht in das homerische Epos, in welchem die vermenschlichten Götter sich unbefangen bewegen und mit freien Ellenbogen frisch und fröhlich handeln. Hier bedeutet der Vers eine bombastische Hyperbel.
Und das erinnert daran, daß die Plastik der Gottheiten bei Homer nicht ausgeglichen ist, daß wir, namentlich in der Ilias, Göttervorstellungen aus verschiedenen Zeitaltern des Mythus und von verschiedenen Geschmacksstufen durcheinander erhalten. Der genannte Vers aber schmeckt nach dem Euphrat.
1886
Deutschland feierte diese Woche das Jubiläum des Geburtstages Börnes. Sonderbar, wieviel warme Gefühle noch für diesen Schriftsteller leben, der im tiefsten Staube vergraben schien und dessen Ideale dem gegenwärtigen deutschen Geiste so oppositionell als möglich sind. Es spricht für die Größe des deutschen Horizonts, daß er auch seine politischen Gegner zu umspannen vermag. In der Tat übersteigt die Wärme der Anerkennung, wie wir sie in allen deutschen Zeitungen jeder Färbung treffen, bei weitem den mittleren Grad literarischer Jubiläen. Man huldigt Börne als dem geistvollen Feuilletonisten, als dem begeisterten Vorkämpfer politischer und humaner Ideale und nicht zum wenigsten als dem großherzigen Charakter von echter Güte, welcher, obschon beinahe alle seine Werke Streitschriften sind, keinem Menschen übelwollte. Es dürfte schwer halten, auch nur eine Seite von Börne zu lesen, ohne den Autor wegen seiner anmutigen und ritterlichen Fechtart liebzugewinnen. Merkwürdigerweise lassen sich die meisten Nachreden durch einige monströse Paradoxen des Autors dazu verleiten, das ästhetische Urteil Börnes geringzuschätzen. Welch ein Irrtum! An Feinfühligkeit für alles Schöne sucht Börne unter den Lebenden seinesgleichen. Nur überwog bei ihm der musikalische Sinn bei weitem die übrigen. Was die Poesie betrifft, so verleitete ihn allerdings seine Antipathie gegen die affektierte und, gestehen wir es doch, lächerliche Vornehmtuerei des alten Goethe zu einer völligen Verkennung der Goethischen Muse, während wir dicht nebenbei als Kompensation eine richtigere Würdigung italienischer Dichter finden, als heute in Deutschland üblich ist. Börne hatte eben, wie jeder echte Verehrer der Künste, seine Vorlieben und seine Abneigungen. Übrigens dürften seine Ausstellungen Schiller gegenüber trotz Vischer Recht behalten. Es ist ein dankbares Amt, einen klassischen Meister gegenüber dem Tadel in Schutz zu nehmen, und gewiß kommt dem Verstand allein, dessen sich Börne in seiner episodischen Kritik einzig bediente, kein kompetentes Urteil in poetischen Dingen zu. Andererseits sind die Menschen, die einem Dichter in seine rhythmische Werkstatt mitunter mit dem hellen Verstande hineinleuchten, von unersetzlichem Werte. Was für ein greuliches Pathos erhielten wir gereimt, wenn nicht der Spott der Verständigen Polizei spielte! Vor wehrlosen Anfängern vermag diesen Polizeidienst jedermann auszuüben, und man verfährt gegenwärtig dabei mit einer Schonungslosigkeit, welche dem Charakter der Kritiker wenig Ehre macht. Man schlage doch einmal die ‹Bücherkästen› oder ‹Korrespondenzen› unserer Monatsschriften nach; wie unbarmherzig da diejenigen verhöhnt werden, die sich einen logischen oder metrischen Fehler zuschulden kommen lassen! Dagegen einem Meister gegenüber gibt es nur stumme Subordination. Diese Taktik ist weder schwierig noch rühmlich; da lobe ich mir Börne, der an Schiller heranzutreten wagt, um ihm zu sagen: «Hier haben Sie sich durch den idealen Schwung verleiten lassen, eine kapitale Dummheit zu sagen.» Überhaupt: was waren das für glückliche Zeiten, als man die großen Dichter noch unbefangen besprach, kritisierte und analysierte, meinetwegen auch verkannte! Denn die Einzelheiten einer Dichtung mit dem Gefühle und aus dem Gefühl mit dem bewußten Verstande wägen, das bedeutet wahrhaftes Lesen, und so wirken die Dichter lebendig. Sobald aber ein Zeitalter angefangen, die Klassiker in Weihrauch und heiligen Schränkchen aufzubewahren, vor denen männiglich schon von weitem knien und beten muß, da herrscht Byzantinismus, das heißt der poetische Tod. Wäre ich ein Dichter, so würde ich einen Börne, der mir aus Liebe zur Poesie tüchtig die Verse puddelte, als meinen lieben Gast ehren, aber gelehrte Gesellschaften, die Weihrauchfässer vor meine Türe schleppen, unsanft empfangen.
Goethe der Dichterkönig.» «Goethe der Dichterfürst.» «Goethe, der größte Dichter der Deutschen.» «Goethe unstreitig der erste deutsche Dichter.»
Wenn ich das lese, und ich lese es täglich wenigstens dreimal, so muß ich mich staunend fragen: Woher wissen das die Leute? Wer hat ihnen das gesagt? Jedenfalls keiner von denen, die zum Urteil berufen sind, ich meine, keiner, der selber etwas Rechtes kann.
Einst galten Goethe und Schiller für ebenbürtig. Auch habe ich persönlich während meines Lebens nicht einen einzigen bedeutenden Mann gekannt, der anders geurteilt hätte. Ich kann Ihnen sogar Leute von gutem Namen nennen, die Schiller entschieden für größer hielten als Goethe, zum Beispiel Gottfried Keller und Jacob Burckhardt.
Mögen nun auch Millionen von Unberufenen täglich und stündlich den Dichterkönig ausschreien im Reklamestil, nach dem Rezepte: «Odol unstreitig das beste Zahnwasser», so bedeutet das kein Urteil, sondern bloß eine Anmaßung. Lassen Sie sich von den kleinen Kingsmakern nicht beirren. Wenn alle gegenwärtigen Dichter aller Nationen zusammenständen, so brächten sie alle miteinander nicht eine einzige Strophe zustande von dem Werte, wie eine Schillersche Strophe wert ist, und keine sieben Jambenverse von der Stilgröße, wie Schillersche Jambenverse tönen.
An dem Grade der Bewunderung, mit welcher einer Schillers Namen nennt, können Sie schließen, ob er selber etwas kann oder nicht. Wer Schillers Namen anders als mit der größten Ehrfurcht und Bewunderung nennt, kann selber nichts. Darauf können Sie sich verlassen.
Für Deutschland aber ist es unrühmlich, daß es sich, ohne zu mucksen, seinen Schiller hat in den zweiten Rang hinunterdrücken lassen.
Wenn ich warnend sage, daß Deutschland zufolge der Allerweltsredseligkeit über Poesie und Literatur, ferner zufolge des mehr und mehr überwiegenden Interesses für das Biographische und Literarhistorische auf dem Wege ist, vor lauter Weisheit die elementarste Einsicht zu verlieren, so daß die Nation bald nötig haben wird, wieder das ABC über die Poesie zu lernen, so werde ich als ein Schwarzseher abgetan. Nun bitte ich einmal folgenden Satz zu lesen, der mir heute, am 7. Juli 1912, aus den Bücherbesprechungen einer der allerersten deutschen Zeitungen entgegengrinst: «Wenn Kants Ästhetik falsch ist und so weiter, so bliebe uns von unserer klassischen Periode nichts anderes übrig als ein paar schöne Gedichte.» Es wagt es also heutzutage ein Mensch, und darf es wagen, öffentlich die sämtlichen Werke von Goethe und Schiller geringschätzig als Nebensachen zu werten und wegwerfend ‹nichts als ein paar schöne Gedichte› zu nennen. Was ist denn wohl die Hauptsache? Dem, der den genannten Satz schrieb, sind die ästhetischen Erörterungen der Klassiker die Hauptsache, andern sind es die biographischen Tatsachen und literarhistorischen Daten, wieder andern die vom Dichter verworfenen Urtexte und Skizzen oder die Nachlässe und ungedruckten Briefe, summa: der ganzen Gebildetheit ist alles mögliche in der Literatur die Hauptsache, nur ja nicht etwa die poetischen Werke der Dichter. Welch eine beklagenswerte Armseligkeit, daß wir von Homer ‹nichts als› die Ilias und die Odyssee haben, von Shakespeare ‹nichts als ein paar› Dramen! Ha, wie ganz anders würde unser poetischer Hunger gestillt, besäßen wir von Homer einen Brief an seinen Schwager über das Urbild der Briseis oder von Shakespeare zwanzig Zeilen über sein Verhältnis zu der dramaturgischen Theorie des Aristoteles! «Nichts als ein paar schöne Gedichte», in wegwerfendem Sinn über «Tasso», «Iphigenie», «Faust», «Wallenstein», «Wilhelm Tell» und so weiter ausgesprochen! Ist es angesichts solch einer symptomatischen Tatsache eine Übertreibung, wenn ich sage: Deutschland wird bald nötig haben, wieder das ABC in poetischen Angelegenheiten zu lernen? Jenes ABC, von welchem das A lautet: ‹Schöne Gedichte› sind für die Poesie nicht Nebensache, sondern die Hauptsache, und nicht bloß die Hauptsache, sondern die Alleinsache; und von welchem das B besagt: Ein einziges ‹schönes Gedicht› vom Range einer «Göttlichen Komödie» oder eines «Faust» ist für die Menschheit ein wertvolleres Besitztum, als was der vereinigte Scharfsinn sämtlicher Ästhetiker und Biographen und Literaturhistoriker in Tausenden von Bänden zutage fördert, höchstdieselben Aussprüche der Dichter über ihre eigenen Werke miteingeschlossen.
Es wird in guten Treuen viel geredet und viel geschadet. Aber eins ist unverantwortlich, eins darf man sich nicht zuschulden kommen lassen: Es soll kein Vater, kein Lehrer zu einem Kinde sagen: «So hoch wie dieser oder jener wirst dus freilich nie bringen», und es soll kein Schriftsteller zu seiner Nation sagen: «Punktum, fertig, Türe zu; die große Zeit der Literatur ist vorüber, es wird nie mehr einen Goethe oder Schiller geben».
Das ist erstens eine Torheit, denn die Zukunft weiß man erst nachher, und die Natur liefert keine Programme. Hat man etwa Anno 1740 prophezeit: «Gebt acht, stäubt ab, zieht euch sonntäglich an, denn jetzt fängt nächstens die klassische Literatur an, jetzt wird bald der große Goethe geboren?» Oder hat jemals ein Schullehrer einen Buben mit den Worten der Klasse vorgestellt: «Geht mir säuberlich mit dem da um, denn das gibt einmal das große, weltberühmte Genie X?» Nein, sondern er hat zu allen Zeiten den Geniebuben einen Esel genannt.
Zweitens ist es eine Anmaßung; denn andere herabdrücken heißt nicht bescheiden sein, sondern unverschämt.
Drittens ist es eine gewissenlose, schlechte Handlung. Niemand hat das Recht, dem heranwachsenden Geschlecht den Mut totzuschlagen und dem nachkommenden Geschlecht zum voraus in die junge heilige Hoffnung zu spucken. Das ist bethlehemitischer Kinderseelenmord.
Daß unserer Zeit das Epos verwehrt wäre, dieser Satz gehört zu den kostbarsten Edelsteinen im Phrasenkästlein jedes Gebildeten. Klopft man dann schüchtern an die Pforten der Gehirne, bittet man um gnädige Begründung, so erhält man ein verdrossenes Munkeln von Primitivzeitaltern der Völker, Jugend der Menschheit, Naivität der Weltanschauung als der alleinigen zuträglichen Atmosphäre für das Epos. Übrigens verstehe sich die Sache gewissermaßen von selber, wie ja schon die völlige Abwesenheit dieser Kunstform in der Neuzeit beweise, verbunden mit der glänzenden Entwicklung des Romans, der eben für das neunzehnte Jahrhundert das wahre echte Epos wäre. Item, es ist eine ewige Grundwahrheit.
Also, weil das homerische Zeitalter die genannten Vorbedingungen erfüllte, darum? Weil sie uns fehlen, darum nicht?
Gut. Der Gedanke läßt sich hören. Aber zu prüfen, nicht wahr, ob denn auch die Tatsache, mit welcher man um sich schlägt, zutreffe, ob wirklich das homerische Zeitalter jene Vorbedingungen erfüllte, das fällt niemand ein. Das ist vermutlich ebenfalls eine ewige Grundwahrheit. Oder wozu hat man denn sonst Schlagwörter, als daß sie einem das Denken, das Wissen, das Lernen und ähnliche Unbilden ersparen? Und wenn einer über ein Zeitalter nicht einmal das Primitivste weiß, so muß es doch ein Primitivzeitalter sein.
Ich habe hier nicht Geschichte zu dozieren. Allein wenn die kecke Art, wie Homer mit seinen Göttern umspringt, eine naive Weltanschauung bekundet, wenn die über und über blasierte verfaulte Kultur des ionischen Kleinasiens einen Kindheitszustand vorstellen soll, wenn die unaufhörlichen Klagen über die Gegenwart, die wehmütige Sehnsucht nach der Vergangenheit, die Verzweiflung an der Zukunft Jugend der Menschheit bedeuten, dann beanspruche ich das Recht, das neunzehnte Jahrhundert einen Kindheitszustand und die Barrisons naiv zu nennen.
Das ist das linke Bein, auf welchem die ewige Grundwahrheit hinkt. Nun das rechte Bein:
‹Urzustand, Kindheitszustand, Jugend der Menschheit›, ‹Naivität der Weltanschauung›, ‹Blüte, Reife, Alter der Völker›. Wer vermißt sich, hiermit zu disputieren wie mit bekannten Größen? Wenn ich nun behaupte, daß die Menschheit niemals jung und kein Zeitalter jemals naiv war? Und ich behaupte das in der Tat. Gibt es denn eine Biologie der Völker? Weiß etwa jemand, wann ein Volk jung und wann alt ist? Getraut sich einer zu entscheiden, ob zum Beispiel die gegenwärtigen Deutschen oder Russen ein altes Volk oder ein junges sind? ob sie am Anfange oder in der Mitte oder vor dem Ende stehen? oder wo sonst?
Mehr noch! Oder vielmehr noch weniger!
Wir wissen ja gar nicht einmal, was das ist, ein ‹Volk›; ob das mit Muttersprache und Tradition oder mit Staatsverfassung, Politik, Grenzen und Vaterland oder mit Sitten, Gebräuchen, Festen und Religion übereins läuft. Geschweige daß wir auch nur ein einziges Lebensgesetz der Völker kennten, vorausgesetzt, daß eine abstrakte Kollektivperson ‹Volk› überhaupt Lebensgesetze habe. Darum ist alle Weisheit von naiven Weltanschauungen, von Kindheit und Jugend der Menschheit, von jungen und alten Völkern Aberwitz.
Übrigens geht es mit dieser ewigen Grundwahrheit wie mit den andern ewigen Grundwahrheiten. Nimmt man sich die Mühe, sie etwas genauer zu untersuchen, so entdeckt man unfehlbar rechts unten in der Ecke mit kleinen Buchstaben einen Eigennamen, ein ‹fecit› daneben und eine Jahreszahl dahinter. Die ewige Grundwahrheit, daß das Epos nur jugendlichen Völkern eigne, diese ewige Grundwahrheit hat im Tübinger Stift studiert und spricht schwäbischen Dialekt. Vor Vischer wußte kein Mensch ein Sterbenswörtchen von ihr. Noch im achtzehnten wie in sämtlichen früheren Jahrhunderten galt das Epos für das nächste und höchste Ziel jedes Dichters. Lessing stellte es obenan, Goethe versuchte, Schiller ersehnte es. Und die berühmte Sonne Homers, wo ist denn die geblieben? Die hat vermutlich Sonnenfinsternis?
Ich weiß so gut wie ein anderer, was Vischer wert ist. Allein daß nun dem wackern Schwaben-Jesaias zuliebe hinfort alle Welt den verkauzten Einfall, den Roman für das Epos zu kaufen, durch Zuchtwahl weiter fortpflanzen sollte, das wäre doch wahrlich ein Schwabenstreich der Menschheit.
Warten sollten wir mit dem Epos, bis wieder einmal Primitivzustände, naive Weltanschauungen und Völkerjugend sich gnädig herbeibequemten? Da könnten wir bis an der Tage Abend warten. Denn dergleichen wird niemals wiederkommen, weil es niemals dagewesen ist.
Es wird nachgerade unheimlich. Der harmloseste Mensch ist nicht mehr davor sicher, nächtlicherweile, während er an nichts Böses denkt, heimtückisch zu einem unsterblichen Dichter bombardiert zu werden. Hosiannen sie uns doch wahrhaftig schon allen Ernstes meinen biedern Landsmann Gotthelf als eine Art burgundischen Homer über die Berge!
Daß der wackere Herr niemals im entferntesten den Namen eines Schriftstellers, geschweige denn eines Dichters beanspruchte, hilft ihm gar nichts. Im Gegenteil. Denn das ist ja eben der wahre Jeremias, aus reinem Versehen Unsterblichkeiten fahren zu lassen, ohne daß man selber eine Ahnung davon hat. Die epische Poesie nämlich, wissen Sie, die heftet sich einem nur so hinterrücks an die Rockschöße, wenn man unvorsichtig vorübergeht, wie eine Klette. Gestatten Sie, Herr Pfarrer! Ihr Paletot ist voller Epen! Gewiß sind Sie wieder zu nahe an dem Gesundbrunnen des echten, unverfälschten Volkslebens vorübergestreift!
Jüngling, strebst du nach den Lorbeeren Homers? Nichts leichter als das! Auf, ergreife einen bukolischen Dreizack, und wo du im Menschenlande eine heilige Stätte findest, da die Flüche am schauerlichsten donnern, da pflanze ihn nieder; das weitere kommt von selbst. Das ist die burgundische Methode. Daneben gibt es noch die schwäbische: Setze dich in die erste beste Wiege der Kultur, und brüte naiv vor dich hin. Ehe du dich dessen versiehst, cocorico, entschlüpft dir ein Epos. Aber wohlverstanden, alles nur unter der Voraussetzung, daß du eine hausbackene Nudel seiest; wo nicht, so bist du für das Epos überhaupt verloren.
Immer von neuem kehrt in deutschen Betrachtungen der alte Spruch wieder: «Wir Germanen wollen vom Dichter seine Gestalten nicht als fertige Gebilde eingeführt erhalten, sondern unsre Hauptlust besteht darin, der Entwicklung eines Charakters zu folgen; diesen Entwicklungsgang soll uns deshalb der Dichter zeigen.» Zunächst erlaube ich mir, die Tatsache, also die Allgemeinheit der Entwicklungsforderung zu bestreiten; ich bin zum Beispiel auch ein Germane und habe nie ein Bedürfnis danach verspürt; vielmehr ziehe ich die reifen Früchte auf der Tafel den unreifen vor und die fertigen Menschen in der Poesie den unfertigen. Und wie mir wird es wohl Tausenden ergehen. Ich glaube deshalb, es handle sich hier nicht um ein volkstümliches, sondern um ein den Büchern von der Literaturdogmatik angezüchtetes phraseologisches Bedürfnis. Aber selbst angenommen, es wäre ein allgemeines germanisches Bedürfnis, so ist damit noch keineswegs gesagt, daß es auch ein poetisches Bedürfnis sei; es könnte auch eine nationale Beschränktheit vorliegen, ein Überbleibsel scholastischer Sinnesart aus früheren unpoetischen lehrwütigen Jahrhunderten. Mit deutlichen Worten ausgesprochen: Ich halte die Lust, die Gestalten der Poesie statt fertig lieber im Entwicklungszustand vorgeführt zu bekommen, für ein Schulmeistervergnügen.
‹Faust-Idee›, ‹Prometheus-Idee›, ‹Ewige-Juden-Idee›, ‹Don-Juan-Idee›. Ich habe Leute gekannt, welche behaupteten, sich etwas dabei zu denken. Nun, in jedem Falle ist es eine hübsche Entdeckung, daß man bloß hinter einen beliebigen Eigennamen das Wörtchen Idee zu setzen braucht, um ein Riesenei von erhabenen Gefühlen, ein wahres Vogel-Rock-Nest von Tiefsinn ins Leben zu rufen. Natürlich, jetzt, da das Geheimnis einmal gefunden ist, kann es ein Schulbube. Semiramis-Idee, Zeus-Idee, Herakles-Idee, Cäsar-Idee, Brutus-Idee, Hohenstaufen-Idee, Karl-der-Zwölfte-Idee – ein Pfänderspiel ist schwierig dagegen. Ich mache mich anheischig, an einem Regennachmittag zweitausend neue Ideen zu gebären.
Am besten gefällt mirs, wenn die -Ideen ihrerseits mit andern -Ideen zu einem gemeinsamen Ideenzug zusammengekoppelt werden wie Harmonikawagen: Antinous-Achilles-Mozart-Raffael-Idee. Das ist ja ein wahrer Omnibus. Laß sehen, ob ich es auch kann: Uranos-Kronos-Titan-Hannibal-Spartakus-Michelangelo-Beethoven-Rembrandt-Goethe-Napoleon-Idee. Geht das?
«In gewissem Sinn, wenn Sie wollen, – es kommt darauf an, wie Sie es verstehen – geht es allerdings.»
Nun gut, es gereicht mir zum Troste, daß ich es auch kann.
Dieser philosophischen Dampfmaschine durch den Nebel der Jahrhunderte möchte ich beileibe keinen Knüppel auf die Schienen werfen. Ich verstehe, es ist ein Vergnügungszug. Nur an einer einzigen Idee nehme ich ein Ärgernis. Sagen Sie mir: Was ist eine ‹Don-Juan-Idee›?
«Nun, die Idee der Unwiderstehlichkeit, wie sie sich auf Grund einer genialen Persönlichkeit – –» Sind Sie fertig? Verzeihen Sie, daß ich Sie unterbreche. Bitte, zeigen Sie mir in Don Juan irgend etwas Geniales oder Unwiderstehliches. Zwei Notzuchtversuche, beinahe vor den Augen des Publikums, das eine Mal unter feiger Verkleidung, Ermordung eines Greises, Verlassung und Verhöhnung einer treuen Geliebten, mit Beigabe von ein bißchen Galgenmut Matthäi am letzten – das sind die Akten. Eine merkwürdige Unwiderstehlichkeit, wenn einer in der Notzucht sein Heil suchen muß, ja wenn ihm diese nicht einmal gelingt, trotzdem er Graf ist, in einem feudalen Zeitalter, im Lande der ‹primae noctis› und eines der Opfer sein leibeigenes Bauernmädchen.
Also Notzucht, wenn man sie nur fleißig übt, ist genial, ist eine geniale Idee. Eine geniale Idee! Und wenn sie einem hartnäckig mißlingt, so ist das die Idee der Unwiderstehlichkeit. Nun, solcherlei Ideen gibt es Gottseidank einen reichen Segen in unsern Zuchthäusern, mit abstehenden Ohren am Kopf und Ketten an den Beinen. Sagen Sies ihnen doch, daß sie Ideen sind, es wird sie freuen, es wird sie trösten. Nur bitte ich um Konsequenz. Wenn Don Juan eine Idee ist, dann müssen wir die interessanten Individuen, welche im Rebberg oder im Eisenbahnwagen eine Frau überfallen, zu Doktoren der Philosophie ernennen, damit sie uns ein Kollegium über die reine Vernunft lesen, nebst einem Stipendium zur Weiterausbildung ihrer genialen Anlagen.
Meinetwegen, im Grunde läßt sich ja alles auf einen einfachen Sprachunterschied zurückführen: gefällt euch das Wort ‹Idee› besser als ‹Schuft›, so habe ich nichts dagegen. Warum aber ‹Idee›, wenn einer etwas in Andalusien, und ‹Schuft›, wenn er das nämliche in Deutschland tut, das ist mir nicht klar. Oder wird vielleicht Notzucht dadurch ideal, daß man Bariton dazu singt?
Dieses also in Friede und Freundschaft. Man kann ja andrer Ansicht sein, nicht wahr, und einander doch von Herzen lieb haben. Wo ich aber Friede und Freundschaft künde, wo ich meine Gegner nicht mehr so völlig von ganzem Herzen lieb haben kann, wie ich sollte und wollte, das ist vor dem Unternehmen, dem andalusischen Ideenwicht zuliebe den andern, den Tenor, den Ottavio für lächerlich auszugeben. Wo und wann, meine Herrn und Damen, war jemals Liebestreue und Vertrauen eines Edelmannes gegenüber seiner Braut etwas Lächerliches? Etwa in Deutschland, dem gelobten Lande der Treue? Man nenne mir doch eine einzige Stelle der Oper, wo Don Ottavio sich lächerlich benimmt. Gewiß, wenn deutsche Darsteller singen ‹ich schwäche›, statt ‹ich schwöre›, dann ist das schwach, dann wird er lächerlich. Ich meine, der Darsteller, nicht Ottavio.
Nein, sowohl der Librettist wie der Komponist haben Ottavio ernst genommen und sympathisch gemeint; das ließe sich beweisen, und wenn ich gut unterrichtet bin, ist es mittlerweile auch bewiesen worden. Die Oper «Don Juan» bedeutet eine Verherrlichung der Treue, wie «Fidelio.»
Oder wäre etwa Ottavio auf Umwegen lächerlich, dadurch, daß Anna im geheimen nicht ihn, sondern Don Juan liebte? Das ließe sich zur Not behaupten, falls sie ein verheiratetes Paar wären, doch auch dann nur, wenn einer zuvor alle seine Moral und seine Grundsätze in die Tasche steckt, um dafür Anschauungen fremder Völker und Zeiten hervorzukramen. Dagegen ein Bräutigam lächerlich, weil seine Braut ihn hintergeht, weil sie ihm verschweigt, daß sie einen andern hebt, – nein, selbst die frivolsten Zeitalter verabscheuen in solchem Fall die falsche Braut. Übrigens ist es ja gar nicht wahr, daß Donna Anna Don Juan liebt, erstens, weil das Gegenteil wahr ist, ich meine, weil im Texte auch nicht der mindeste Anhaltspunkt dafür, hingegen eine Menge ausdrücklicher Aussagen des Gegenteils stehen; zweitens, weil es unmöglich ist. Niemals und nirgends erwidert eine anständige Frau einen feigen Notzuchtversuch mit Liebe.
Ich habe gesagt, wo meine Entrüstung anfängt; ich will nicht verschweigen, wo sie den Gipfel erreicht. Sie erreicht den Gipfel, wenn ich lesen muß, wie deutsche Ästhetiker uns mit triumphierendem Schmunzeln, als handle es sich um einen ästhetischen Gewinn, ins Ohr zischeln, so rein, wie sie sich anstelle, wäre Donna Anna schwerlich aus dem Attentat losgekommen, vielmehr verschweige sie ihrem Bräutigam das Saftigste. Diese Vorstellung soll uns die Oper versüßen. Es ist übrigens nützlich, daß diese anmutige Insinuation ausgesprochen und gedruckt wurde. Denn sie dient zum Exempel, in welche Abgründe des Geschmackes literarische Kuppelsucht und literarhistorische Geniedienerei ein Zeitalter unmerklich führen können.
‹Dantesymphonie›, ‹Tassosymphonie›, ‹Faustsymphonie›, ‹Zarathustrasymphonie›, ‹Böcklinsymphonie›. Warum nicht auch ‹Grüneheinrichsymphoni›, ‹Leberechthühnchensymphonie›, ‹Biberpelzsymphonie›? Ich sehe kein Hindernis. Und wenn Sie die ganze Literatur- und Kunstgeschichte durchkomponiert haben, was haben Sie damit gewonnen? Und was meinen Sie eigentlich, hat Ihr Orchester einen literarischen Paß nötig, um musizieren zu dürfen, oder glauben Sie, die Literatur bedürfe Ihrer Baßgeigen? Ich verstehe ja: Sie wollen uns Ihre Bildung beweisen. Aber wer paukt denn seine Bildung so mit dem vollen Orchester in die Welt hinaus? Wissen Sie was? Komponieren Sie doch einfach ein für allemal Ihr Abiturientenzeugnis. ‹Abiturientensymphonie›, das wäre ein Titel, den ließe ich mir gefallen.
Oder wollen Sie uns etwa beweisen, daß Sie den Zeitgeist wittern, indem Sie jeweilen das komponieren, was nebenan in der Literatur und der Kunst dieses Jahr obenauf ist? Unnötig; denn daß Sie den Zeitgeist wittern, merken wir schon an Ihren Harmonien.
Mit den Goethezitaten hat es besondere Bewandtnis. Sie können mit andern nicht verglichen werden. Die übrigen großen Dichter zitiert man wegen des Inhalts des Spruchs, Goethe aus loyaler Andacht, wie man das Bildnis unseres lieben gnädigen Landesvaters aufhängt. Denn Goethe ist regierender Dichterfürst und Oberkommandierender aller deutschen Versfüße mit dem Lorbeer erster Klasse. Wie es nun auffallen würde, wenn das Bildnis seiner Majestät des Kaisers in eines Deutschen Hause fehlte, so nähme es sich unnatürlich und unanständig aus, wenn ein deutsches Buch, worüber es auch handle, nicht wenigstens einmal Goethe zitierte. Das Gefühl sagt es einem schon. Man müßte geradezu an demonstrative Absichtlichkeit denken. Es soll auch niemand sich damit entschuldigen, er könne nichts Passendes auffinden, weil er über die Eingeweidewürmer schreibe und Goethe uns kein Gedicht noch Spruch zu deren Gunsten hinterlassen. Wenn man aufrichtig will, so fügt sichs schon. Als treffliches Muster und Vorbild, wie man selbst in den scheinbar verzweifeltsten Fällen Goethe mit Glück herbeiziehen kann, empfehle ich das Verfahren eines Heuschreckologen in der wissenschaftlichen Zeitschrift «Der zoologische Garten».
Der geehrte Zoologe hatte über irgendeine amerikanische Heuschrecke Rapport zu erstatten; geben wir genau acht, auf welchem Wege er Goethe hineinbringt, damit wirs auch lernen. Der Verfasser beschreibt zunächst die heu-schrecklichen Verheerungen von ehedem; darauf weist er nach, wie die fortschreitende Ansiedlung der Menschen und das ökonomische, staatliche und polizeiliche Gedeihen der betreffenden Provinz den Heuschrecken beinahe den Garaus machte. Dann schließt er ab: «So erfuhren die Heuschrecken die Wahrheit des Goetheschen Wortes: ‹Nichts auf Erden ist schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen.›»
Ich schlage vor, diese Art von Logik ‹Zoologik› zu nennen.
‹Altmeister Goethe›, ‹Altvater Homer›, ‹Vater Herodot›, ‹Papa Haydn›, das geht ja wie in der «Puppenfee». Warum nicht ‹Tante Sappho›, ‹Mama Dido›?
Mit welchem Recht, bitte, tun Sie so familiär, so verwandt, so gnädig mit den erlauchten Herren? Sie mögen noch so zärtlich Papa rufen, er nennt Sie doch nicht Emil.
Beiläufig eine indiskrete Frage: Sie sind ohne Zweifel der nämliche, der da schreibt: ‹Freund Lampe›, ‹Bruder Grimmbart›, ‹Gevatter Storch›, ‹Onkel Petz›, denn beiderlei stammt aus demselben Familiensinn, aus dem gleichen veronkelten Gemütsschatz. Eine ausgedehnte Verwandtschaft, fürwahr, von väterlicher Seite mit Homer und Haydn, von mütterlicher mit der Arche Noah verschwägert! Ich gratuliere.
Nun gehört es ja gewiß zu den unveräußerlichsten Menschenrechten, ab und zu ein bißchen läppisch zu tun. Und zur Verdauung, nach dem Essen, wenn einem just nichts Gescheites einfällt, leistet etwas Albernes den gleichen Dienst. Aber drucken lassen sollte mans besser nicht. Dazu ist denn doch der Einfall, alles, was da kreucht und fleucht, Papa zu nennen, nicht bedeutend genug. Auch schiene es mir geschmackvoller, den Scherz nicht auf die großen Herren der Kunst auszudehnen. Ihr Bild gewinnt sicher nicht dadurch, daß der erste beste sich ihnen auf die Knie setzt.
Allerdings, es macht sich ja gewissermaßen von selber. Ein Künstler wird alt, junge kommen heran, die den alten niemals jung sahen; denen gehört die Vorstellung dieses Herrn unzertrennlich mit der Vorstellung weißer Haare zusammen; und der ‹Altmeister› oder ‹Papa› ist fertig. Ist das auch nicht besonders gescheit, so ist es doch verzeihlich.
Hingegen ist es unverzeihlich, nachdem jener das Zeitliche gesegnet, ihm seine weißen Haare in die Ewigkeit nachzutragen, ihm seinen wohlverdienten Ruhm auf alle Zeiten mit Schlafrock und Pantoffeln zu verunzieren. Denn der Tod verjüngt; nachdem der Leib verschwunden, tritt die Seele mit dem Antlitz der Jugend vor die Erinnerung.
Übrigens, er rächt sich grausam, der tote Kunstpapa, für den Unglimpf. Damit, daß er euch den Schlüssel zu seinen Werken verweigert. Wer mit der Vorstellung eines kindlichen Altvaters Homer an die Ilias tritt, trägt mit seinen Händen einen muffigen Beigeschmack in den Text, den er nicht mehr los wird. Die Sonne Homers schlägt ihm in einen Altweibersommer um. Wer sich einmal angewöhnt hat, ‹Papa Haydn› zu sagen, der hat das Benefiz des Haydnschen Frühlings Jubels auf immer verloren. Beobachten Sie doch nur das Konzertpublikum bei einer Haydnschen Symphonie. Wie sie da wohlwollend lächeln, wie sie gnädig schmunzeln! Als wollten sie sagen: «Er kanns noch recht gut, für sein Alter.» Das kommt vom ‹Papa Haydn›.
In denjenigen Gebieten des Anstandes, in welchen die Sitte versagt und der Takt entscheidet, kommt es etwa vor, daß selbst hochgebildete, ja feinfühlige Menschen den Takt verfehlen und eine Unschicklichkeit begehen, dann nämlich, wenn an einen Punkt die Einsicht noch nicht hingedrungen ist. In solchen Fällen muß man nun der Einsicht nachhelfen.
Zwei Beispiele über eine nämliche Unschicklichkeit: Man erhält einen Brief, in welchem der Absender mit den höflichsten und ehrerbietigsten Worten bescheiden bittet, ihm über einen Menschen oder ein Buch, die ihn interessieren, aber auch mit Zweifeln erfüllen, unser Urteil zu gönnen. Nachdem wir etwas naiverweise seine Bitte erfüllt und nach gewissenhafter Überlegung unser wohlerwogenes Urteil, das nicht immer leicht ist, abgegeben, stellt es sich in der Antwort plötzlich heraus, daß der Fragende keineswegs zweifelte, sondern sich schon seine eigene hübsche Meinung gebildet hatte, die er sich von unserm Urteil nicht mag trüben lassen.
Oder der Herausgeber einer Zeitschrift erläßt eine Rundfrage bei den angesehensten Schriftstellern über irgendeinen fraglichen Punkt. Nachdem die Schriftsteller sich geäußert haben, spielt er den Oberrichter, setzt sich in die Waagschale, macht neutrale Gebärden und kassiert einfach sämtliche Urteile.
In beiden Fällen haben sich die Fragesteller einer Unschicklichkeit schuldig gemacht. Denn wer über einen Gegenstand sich bereits eine Meinung gebildet hat und entschlossen ist, sich von dieser Meinung nicht abbringen zu lassen, hat nicht das Recht, einen Mann, den er selber als sachverständige Autorität anerkennt, um sein Urteil anzugehen.
Nebensächliches zu wichtigen Hauptsachen aufbauschen, ist das nicht vielleicht ein Merkmal unsrer Zeit? Da vernehmen wir von einer grundstürzenden Revolution im Buchgewerbe. Papier, Druck, Buchdeckel, alles ist herrlich verbessert; ich sehe in den Zeitungen, in Bücherbesprechungen die ‹prächtige Ausstattung›, die ‹wirklich vornehme Ausstattung› rühmen; ich lese von ‹Liebhaberausgaben›, ‹Prachtausgaben›; lese von Velinpapier, Büttenpapier, und alle möglichen Letternsorten marschieren mit inhaltvoller Miene vor meine Augen. Es scheint, das muß man bewundern; und ich bemühe mich, mitzubewundern; aber es gelingt mir nicht.
Daß die geehrten Herren Verleger alles mögliche tun, um ihre Erzeugnisse, also die Buchausstattung, zu verbessern, ist natürlich, denn es ist ihre Berufsbefriedigung. Es ist sogar löblich; ich beglückwünsche sie von Herzen dazu. Und wenn mich ein Verleger freundlich fragt, ob mir die Ausstattung gefalle, so gefällt sie mir schon zum voraus.
Also mit allem einverstanden. Allein warum solch ein Aufheben davon machen? Vor ein paar Jahren mal eine Weile lang, ja, das versteh ich – die Leute sollten zum Aufmerken und zu guter Arbeit gebracht werden. Aber Bücher sind keine Schmuckgegenstände, die auf einen Ziertisch gestellt werden sollen. Man wendet mir ein: «Es wird Ihnen doch selber nicht gleichgültig sein, ob –». Verzeihung! Mir für mein Teil ist es vollkommen gleichgültig, mehr als gleichgültig sogar, ich verabscheue geradezu jede auffallende Ausstattung; je schlichter, desto lieber. Ich will nicht gestört werden beim Lesen, nicht durch Häßliches, aber auch nicht durch Auffallendes, das an sich schön sein mag. Vielleicht kommt das daher, daß ich so oft im Leben die nichtswürdigsten Schriften in den pompösesten Prachteinbänden gesehen habe: liederlich hingeschmissene französische Sensationsromane, unmögliche deutsche Dilettantenlyrik; nur mit dem Unterschied, daß man früher die Dilettantenlyrik in Goldschnitt präsentierte, jetzt dagegen in Nibelungenrunen. Nein, ich verwahre mich gegen diese Wichtigtuerei mit dem Papiergesicht sowohl als Schriftsteller wie als Leser. Als Schriftsteller sage ich: Ein Buch ist nicht ein Gerät, das neben seinem Dienstzweck zugleich Anmut anstreben sollte, wie etwa ein Tisch oder ein Stuhl, sondern ein Buch ist ein Verwandlungsapparat, der hinter den Verwandlungsszenen möglichst zu verschwinden hat; je weniger man den Apparat bemerkt, um so besser. Ein gut geschriebenes Werk will, daß die schwarzen Sätze sich in Gedanken oder in Bilder verwandeln; der Leser soll gar nicht mehr spüren, daß er ein Buch in den Händen hat.
Als Leser wieder verlange ich nichts weiter, als daß ein Buch mir die Verwandlung vermittle, also daß es leicht lesbar sei, ohne antiquarische Kunststücke, ohne daß ich es vor lauter wundervollen teutonischen Majuskeln kaum zu entziffern vermag, ohne daß es mir allerhand aufdrängte, was an sich hübsch sein, was ich aber nicht ansehen mag, da es mich vom dichterischen Gebilde abzieht. Möchten Sie einen Shakespeare in Prachtausgabe lesen? Ich nicht.
Hingegen möchte ich bei diesem Anlaß als Leser zwei kleine Wünschlein an die geehrten Herren Buchvirtuosen richten: daß sie uns die gehefteten Bücher so heften ließen, daß einem die Blätter nicht auf die Knie fallen, und daß sie die gebundenen Bücher so binden ließen, daß, wenn man eine Seite aufklappt, einem nicht das Buch von selber wieder boshaft an die Nase zuklappt. Diese Reform würde ich freudig begrüßen, namentlich bei Musikalien.
Jetzt weiß ich: ich bin ein Barbar; mir fehlt der sechste Sinn, der Sinn, mit dem Handrücken auf einen Buchdeckel zu schlagen und stolz zu verkünden: «Liebhaberausgabe! Leinwandpapier!» Auch fürchte ich, für eine Bibliothekarstelle werden mich diese Zeilen nicht empfehlen. Wogegen ich bescheiden erwidere: Fürchten Sie nicht Ihrerseits, mit Ihrer gewaltigen Buchreformation ein bißchen unerwachsen zu erscheinen? Doch ich verstehe: es geht zum übrigen. Mit den Regisseurkunststückchen im Theater macht man ja ein ähnliches Wesen. Überhaupt die Bühnen- und Szenenreformationen, als hinge das Heil der dramatischen Poesie davon ab! «Buchreform! Theaterreform!» lautet das Feldgeschrei. Meine leise Meinung dagegen heißt:
Einfach etwas schreiben, was hält. In welcherlei Buchform, auf was für einer Art Bühne es nachher dem Volk vermittelt wird, ist eine untergeordnete Sache.
An Herrn Ix, Schriftsteller in En.
Wegen Raummangel ist es uns leider nicht möglich, Ihren «Merlin» –
An Herrn Prof. Dr. Ypsilon in Em.
Ihren hochinteressanten, gediegenen Aufsatz über ein nachgelassenes eigenhändiges Konzept zu Ixens «Merlin» nehmen wir mit dem größten Danke an, und bitten wir Sie, uns auch ferner –
Ich bin nicht der einzige, der den Jubel nicht nachzufühlen vermag, welcher eine Nation in dem Augenblicke heimsucht, da ein verdienter Mann sechzig oder siebenzig oder achtzig Jahre alt wird. Vielmehr befinde ich mich in vorzüglicher Gesellschaft, nämlich in der Gesellschaft der Gefeierten selber. Denn wer an einem Jubiläum am allerwenigsten zum Jubeln aufgelegt ist, das ist allemal der Jubilar. Dem ist ganz besonders zumute, wehmütig und bitter. Die Geduldigen halten ergeben still, die Trotzigen retten sich vor der zugedachten Operation durch schleunige Flucht ins Gebirge, falls sie nicht gar Feuer und Schwefel herunterknurren wie Grillparzer.
«Es tut ihnen aber im Grunde doch wohl; trotz aller Wehmut.» Gewiß, Wehmut tut wohl, wie jedes erweichte Leid. Und sie zu erweichen, sie zu rühren, vielleicht bis zu Tränen zu rühren, das mag euch mit euren massenhaften Liebes-, Dankes- und Bewunderungsbeteuerungen unschwer gelingen. Da schwindet mancher unbewußte Groll, da lösen sich allerlei böse Spannungen. «Es hat mir doch wohl getan.» Wenn das euch genügt, vortrefflich. Nur erinnert mich dieses ‹Dochwohltun› fatalerweise an einen Fall, der nicht eben nach Jubel schmeckt, nämlich an einen Trauerfall. Dort tut es den Beteiligten auch ‹doch› wohl, wenn man sie durch Teilnahme zu Tränen rührt. Eure Jubiläen sind demnach Kondolenzjubiläen. Kurz, im Munde des Gefeierten – und der Gefeierte an einer Feier zählt doch auch ein wenig mit – schmeckt das Jubiläum wie eine sauersüße Pastete, angefeuchtet mit Bitterwasser.
Glückwünschen kommt ihr dem Herrn? Glückwünschen wozu, wenn es erlaubt ist? Man wünscht einem Menschen Glück, wenn er soeben etwas Erwünschtes erreicht hat. Also wenn er Major geworden ist oder Regierungsrat, oder wenn er das große Los gewonnen hat oder eine reizende Braut oder einen gesunden, kräftigen Buben (Mutter und Kind befinden sich den Umständen angemessen wohl). Aber ein Jubilar, was hat denn der heute Jubelnswertes erreicht? Das siebenzigste Altersjahr. Ein verwünschter Gewinn! Das heißt einen Erlaubnisschein auf Magenkrebs oder Gehirnerweichung.
Gewiß, ein schöner Gedanke: eine Nationalfeier der Bewunderung einem Lebenden geboten! – wenn sie rechtzeitig käme, wenn sie spontan gediehe, aus naiver, überquellender Begeisterung. Dagegen eine Bewunderung, die aus dem Kalender stammt, die pedantisch ein Datum abwartet, und zwar ein möglichst spätes Datum, um ja nicht zu früh, das heißt rechtzeitig, zu kommen, die nach dem Taktstock der Kapellmeister schaut, um den richtigen Einsatz nicht zu verfehlen, eine Bewunderung, die da organisiert wird wie ein Kupfertrust, solch eine gnädige Bewunderung von oben herab, wo das hohe Alter dem Verdienst als mildernder Umstand angerechnet wird, das ist eine ranzige Nationalfeier. Meint ihr denn wirklich, er sähe sie nicht, euer Jubilar, die Schnürchen, welche das Jubiläum ziehen? er mustere und wäge sie nicht, die Impresario, welche die nationale Begeisterung pachteten? die Totengräber, welche ihm die Hand drücken, während ihnen der druckfertige Nekrolog aus der Tasche guckt? Es ist erhebend, König zu sein. Aber ein King aus Gunsten von Kingsmakern! Und von was für Kingsmakern! Sagen wirs doch klipp und klar: Eure angeblichen Dichterjubiläen sind Buchhändlerjubiläen. In zweiter Linie Bio- und Monographenjubiläen. Mit siebenzig Jahren wird ein Dichter nachlaßfähig. Da liegt der Honig.
Wissen Sie, für wen ursprünglich die Altersjubiläen erfunden wurden? wen sie erquicken? wem sie wohltun? ganz und gar wohltun, nicht ‹doch› wohltun? Jenem, der kein anderes Verdienst besitzt als sein hohes Alter, jenem, der zeitlebens keinen anderen Anlaß bot, ihn zu feiern, als seinen Geburtstag. Ein kleiner Kassier, ein untergeordneter Beamter, ein dunkler Schullehrer in einem finstern Städtchen, welche fünfundzwanzig oder fünfzig Jahre treu und bescheiden im Dienst standen, wenn man solchen ein Altersjubiläum oder, was auf dasselbe hinausläuft, ein Dienst Jubiläum stiftet, denen tut das in der Seele wohl. Deshalb, weil sie sich hiermit zum ersten Male ihres Lebens in den Vordergrund des Interesses gerückt fühlen, weil sie nun wenigstens einmal in ihrem Dasein ihr Ehrgeizchen befriedigt spüren, weil sie hinfort die süße Illusion neben sich aufs Krankenbett legen dürfen, etwas auf Erden gewirkt, etwas gegolten, etwas erreicht zu haben. Wer mithin einen großen Dichter an seinem siebenzigsten Geburtstag feiert, erhebt ihn in die schwindelhafte Höhe eines Buchhalters von Brandts Schweizerpillen.
Eines ist sicher: vor dem siebenzigsten Geburtstag hatte der Gefeierte einen sechzigsten, vor dem sechzigsten einen fünfzigsten, vor dem fünfzigsten einen fünfundvierzigsten und dreiundvierzigsten Geburtstag. Warum wurde damals nicht gejauchzt, nicht geredet, nicht gedruckt und nicht gebechert? Ich verstehe, der Ruhm hat keine Jubelouverturen, sondern bloß Jubelzapfenstreiche. Immerhin eine dreißigjährige Generalpause vor Beginn des ersten Akkordes ist etwas lang, und ein plötzliches Fortissimo mit dem vollen Orchester nach den Sordinen ist etwas plump. So instrumentiert der wahre Ruhm nicht. Der liebt das sempre crescendo. Aber freilich, von einem Jubel, der das Tempo verfehlte, darf man auch keinen Takt erwarten.
Ohne Scherz: der Gegensatz zwischen dem Schweigen während langer Jahrzehnte und dem plötzlichen Tutti mit Pauken am Ende des Lebens ist eine so auffallende Erscheinung, daß sie zum Nachdenken auffordert, daß sie eine Erklärung erheischt. Da habe ich mich nun öfters gefragt, ob nicht am Ende doch der blaßgelbe Neid ein klein klein bißchen mit im Spiele wäre. So habe ich mich gefragt, und ich habe mir geantwortet: ja, und antworte mir noch so.
Der Hauptgrund jedoch ist mir zufällig zum Bewußtsein gekommen, damals, als Deutschland das Jubiläum Paul Heyses beging. (Ich sage: ein Jubiläum ‹begehen›, wie man sagt: ‹eine Geschmacklosigkeit begehen›.) Dazumal erschien nämlich in einer der ersten Zeitungen Deutschlands ein Breve, das sich feierlich dagegen verwahrte, es möchte etwa Brauch werden, Dichter so unheimlich früh, nämlich in ihrem sechzigsten Jahre schon, zu feiern. Da stehts ausdrücklich, offen und ehrlich. Greifen wirs, halten wirs fest, und lassen wirs nicht mehr entschlüpfen. Ein sechzigjähriger Dichter zu jung, um gefeiert zu werden! Mithin ist es eingestandenermaßen die Rüstigkeit, die Vollkraft des Schaffens, was die Generalpause des Ruhmes verschuldete, und nicht etwa irgendein anderer Umstand. Ehe der Dichter mit wenigstens einem Fuß im Grabe steht, gebührt ihm keine Feier. Wie gesagt, solch einen goldenen Spruch darf man nicht mehr aus dem Schatze der Menschheit schwinden lassen; er gehört auf ewige Zeiten ins Gedächtnis der Nachwelt, neben den Sprüchen der Sieben Weisen.
Indessen, das ist nun nicht mehr der Neid, der so spricht. Denn so deutlich drückt sich der Neid nicht aus, der munkelt. Nein, es ist vielmehr die liebliche Voraussetzung, als ob die Bedeutung eines Dichters erst dann anfange, wenn er ein ‹abgeschlossenes, fertiges Ganzes› bildet, wenn man seine ‹gesamte Tätigkeit› ‹überschauen›, wenn man ein ‹Lebensbild› von ihm ‹entwerfen› kann, mit anderen Worten: wenn man ihn abhandeln, erklären, herausgeben, kommentieren und emendieren, wenn man ihn, kurz gesprochen, in den literarhistorischen Mörser stampfen kann.
Das ists; das ist das ‹Sesam, tue dich auf›. Nicht die Werke – Gott bewahre, die sind Nebensache – sondern das ‹Dichterbild›, der Platz, die Nummer, die dem Manne in der Literaturgeschichte gebühren, das ist das Wichtige. Wenn wirs sonst nicht wüßten, so wüßten wirs jetzt: Das gegenwärtige Deutschland, trotz allem Getue und Gerede über Poesie und Goethe ist mitnichten literarisch, sondern literarhistorisch veranlagt. Nicht um das Genießen der Dichter, sondern um das Dozieren derselben ist es ihm zu tun.
Auf dasjenige Jubiläum aber, auf welches ich mich freue, an welchem ich teilnehmen möchte, werde ich wohl noch lange warten müssen: auf das Jubiläum zu Ehren eines großen Werkes, das soeben frisch erschien.
Der hundertjährige, der fünfzigjährige, vielleicht auch der fünfundzwanzigste Todestag. Warum nicht der achtundneunzigste oder der neunundvierzigste? Ich begreife, es geht nach dem Dezimalsystem. Wenn die Erde sich so und so vielmal um die Sonne geschwungen hat, dann geschieht plötzlich ein allgemeines Hallo über einen Verschollenen.
Nun ist es ja unstreitig ein erhebendes Schauspiel, diese Popularität der Astronomie und des Dezimalsystems. Nur sage mir doch einer, was hat das Null Komma Null, was hat die Ekliptik mit dem Wert eines toten Schriftstellers oder mit der Freude über seinen Wert zu schaffen?
Wäre das bloß ein harmloses Spiel, wie etwa das Lotto, so hätte ich nichts dagegen einzuwenden. Allein diese Prämienziehung gehört in die Klasse der schlimmen Lose, welche den Abnehmern unfehlbar Schaden bringen. Ich meine Schaden am Wahrheitsgefühl. Denn was da gelogen wird, an den hundertjährigen Weißwaschereien! gelogen! gelogen!
Wenn morgen Wieland, übermorgen Paracelsus, am Dienstag Abälard gefeiert wird, oder wen sonst der Wendekreis des Krebses zufällig aus dem Staub der Geschichte emporwirbelt, so wird das andächtige Europa drei Tage lang staunend vernehmen, wie und wasmaßen Wieland ein Homer von Gottes Gnaden, Paracelsus der Begründer der Naturwissenschaft, Abälard der geniale Vorläufer der Reformation gewesen. Im Grunde, das andächtige Europa vernimmt es durchaus nicht staunend, denn es glaubt ja kein Wort davon. Und die es sagen, glaubens auch nicht, oder, was noch schlimmer ist, sie wissen nicht einmal, ob sies glauben oder nicht. Aber jedermann hält es für richtig, daß mans sage. Das nun, sehen Sie, nenne ich lügen. Oder was heißt denn sonst lügen?
Übertreibe ich etwa? Nehmen wir doch den ersten besten der jüngst Jubilierten. Zum Beispiel Bürger. Haben sie ihn uns da in unverantwortliche Klassikerhöhen emporgeschroben, den armen Bürger, dem anderthalb Balladen passierten, von jenen, die keinen Sommer machen!
Hernach, wenn das Jubiläum vorbei ist, kräht kein Hahn mehr nach dem geräuschvoll Gefeierten. Nämlich es geht wiederum nach dem Dezimalsystem. Man zieht zunächst eilends hundert Prozent von dem Gesagten wieder ab, läßt die Erde sich ruhig weiter drehen, begräbt das geduldige Opfer wieder in die stille Truhe der Vergessenheit und wartet geduldig ab, bis eine neue Null heranwackelt, die dann eine vierstellige Dezimalzahl ergibt. Jetzt wird der Leichnam abermals abgestäubt und noch viel unverschämter aufgeblasen, und so geht es weiter durch die Zeiten der Zeiten in Ewigkeit, Amen.
Eine Nation sollte von Zeit zu Zeit hinter dem Gartenzaun nachschauen, ob es mit dem Ruhm, den sie als höchsten Preis ihren Auserlesenen zu spenden gedenkt, richtig steht. Denn so bequem, wie man meint, geht es nicht, als ob der Ruhm ein natürliches, unzerstörbares Eigentum des Menschengeschlechtes wäre.
Im Gegenteil, es gehört sehr, sehr viel dazu, damit einer Nation der Ruhm gedeihe, und die mindeste schlechte Luft erstickt den Lorbeer. Barbarische, despotische, hyperloyale, militärische, scholastische Völker oder Zeitalter entbehren des Ruhmes, sie können ihre Helden bloß ehren, nicht rühmen. Ehre aber ist die feindliche Schwester oder, wenn man lieber will, die Schlingpflanze des Ruhmes. Ehe man sichs versieht, hat sie ihn verdrängt und erwürgt.
Zum Nachschauen aber dünkt mich gegenwärtig Anlaß vorhanden. Denn ich glaube zu bemerken, daß der deutsche literarische Ruhm der Gegenwart an häßlichen Übeln krankt.
Er ist zunächst treulos geworden, indem, wer vorgestern gerühmt wurde, heute in die Rumpelkammer geworfen wird. Sämtliche gepriesene Namen verbrauchen sich mit einer Schnelligkeit, als wäre die Unsterblichkeit ein Konsumartikel. Kaum in den Mund des Volkes genommen, schmilzt auch schon der Herr. Ja, es läßt sich geradezu logisch ausrechnen: Weil heute einer als Genie verkündet wird, wird er in zehn Jahren abgetan sein, mit verächtlichem Achselzucken. Wer ein feines Gehör hat, vermag sogar während des Jubels schon den Nebenton im Falsett zu vernehmen, der später die höhnische Dominante bilden wird.
Der Ruhm ist ferner frech geworden. Man flüstert einander nicht mehr ehrerbietig einen Namen zu, sondern man brüllt ihn den Leuten um die Ohren, den Hut auf dem Kopf, die Hände in den Hosen. Als handelte es sich um einen sozialdemokratischen Genossen. Ich kenne aber nichts Beleidigenderes als einen Ruhm ohne Ehrerbietung. Erst achtet einen Menschen, dann verbeugt euch, hierauf verbeugt euch noch einmal, hernach rühmt ihn.
Freilich, wenn man als Gründer auf Verabredung ergebene Leute gleich Interimsscheinen an den Börsen ausschreit, wenn man seinesgleichen auf sieben Schultern hebt, damit er groß aussehe, dann hält es allerdings schwer, Ehrerbietung für den allzu verwandten Klienten aufzubringen. Und siehe, das Beispiel wirkt. Andere Gründer unternehmen andere Berühmtheiten. Dann entsteht unlauterer Wettbewerb. Es setzt Papst und Gegenpapst. Und keiner glaubt an seinen eigenen Papst, geschweige denn an den feindlichen.
Da gilt es nun beizeiten vorzubeugen. Sonst könnte es eines Tages widerfahren, daß der oder jener, dem man den Ruhm anbietet, antworte: «Aber nicht wahr, ihr wascht ihn doch erst gründlich mit Karbolseife, ehe ich ihn in die Hand nehme, euren Ruhm?»
Bedeutet der Weltruhm ein endgültiges Urteil, gegen welches es keine Berufung gibt, vor welchem die Kritik abzudanken hat?
Lassen wir den falschen, also den flüchtigen, vergänglichen Ruhm ganz beiseite, der auch einmal über alle fünf Erdteile posaunen kann und angesichts dessen eine verneinende Antwort sich von selbst versteht.
Beiseite auch die gar nicht so seltenen Fälle, wo die Kritik späterer Zeitalter einen jahrhundert-, ja jahrtausendalten scheinbar auf ewig gültigen Ruhm mit Recht oder Unrecht einfach kassiert (so zum Beispiel den Ruhm eines Statius, eines Horaz, eines Vergil) oder wo ein Ruhm nur innerhalb nationaler Grenzen standhält, jenseits derselben aber versagt (Corneille, Racine, Boileau). Nehmen wir den ganz unangezweifelten, den bewährtesten höchsten Weltruhm, also den Ruhm eines Homer, eines Shakespeare, eines Goethe. Besagt ein solcher Ruhm, daß die Werke dieser Großen über der Kritik stehen? Daß vor ihnen das Urteil abzudanken hat? Daß, wer etwas daran bemängelt, sich einer Anmaßung schuldig, sich lächerlich macht? Nein.
Aller Ruhm, selbst der höchste, besagt nur dies eine: Hier ist ein hochbedeutender Mensch, dessen Werke solche Werte enthalten, welche die Menschheit nicht entbehren möchte. Er besagt aber keineswegs, dieser hochbedeutende Mensch wäre fehlerlos, oder alle seine Werke wären es, oder die Art seines Schaffens wäre unbeanstandbar. Nur nimmt man die Fehler gerne mit in Kauf, weil die Werte die Fehler weit überwiegen. Beim Dichter- und Künstlerruhm nun ereignet sich stets folgendes: Die Nation oder auch die Menschheit kümmert sich nicht um die Fehler, braucht das auch nicht zu tun, weil sie die berühmten Dichter und Künstler nur aus der Ferne oder nur im allgemeinen betrachtet; sie genießt kritiklos die Werke und begnügt sich mit einem unbestimmten Eindruck der Persönlichkeit. Anders aber muß der Selbstschaffende verfahren. Er, dessen eigenes Schaffen nur unter der Bedingung gelingen kann, daß er haarscharfe Werturteile über seine Erfindungen zu fällen vermag, also daß er das Wertlose oder Minderwertige beseitigt, er darf nicht die Großen, selbst nicht die Größten und Berühmtesten anstaunen, er muß die Erkenntnis und den Mut haben, zu entscheiden, durch welche bestimmten Werte sie groß sind und an welchem bestimmten Punkte Schwächen oder Fehler vorliegen. Unterläßt er das, so nimmt er Schaden an seinem Wahrheitssinn, ahmt, wenn er einen Großen zum Vorbild nimmt, seine Fehler mit nach – meistenteils sogar mit Vorliebe die Fehler, weil diese leichter nachzuahmen sind –, und ganz sicher wird nichts Großes aus ihm. Es ist daher richtig, ja unbedingt notwendig, daß der schaffende Künstler sich vom Glanz des Ruhmes nicht blenden läßt, sondern scharfen Auges in den Werken selbst der Größten zu unterscheiden wagt. Und dabei wird sich meistens herausstellen, daß die einstigen Widersacher der Großen, jene Widersacher, welche die Geschichte der Künste brandmarkt, eigentlich auch recht hatten; sie sahen in der Tat wirklich bestehende Fehler, sie hatten nur darin unrecht, daß ihnen die danebenstehenden überwiegenden Werte entgingen oder daß sie diese nicht hoch genug einschätzten. Nehmen wir Beispiele! Jüngst unterfing sich Tolstoj, Shakespeare zu bemängeln. Darüber ein überlegenes Hohngelächter in Europa. Ich bin mit aller Welt einig, daß Shakespeare über jedem seinen Wert bezweifelnden Angriffe hoch erhaben dasteht. Aber es gelingt mir nicht, über einen Tolstoj, selbst wenn er grotesk irrt, zu höhnen, weil ich weiß, daß Tolstoj ein ganz bedeutender Schriftsteller ist, dessen Werke in der Gegenwart ihresgleichen suchen, und weil mir der Mut, mit welchem Tolstoj seine Überzeugung ausspricht, achtbar bleibt. Hohn also war eine schlecht angebrachte Antwort auf Tolstojs Kritik. Die richtige Antwort haben Maeterlinck und Avenarius gefunden, indem sie einige Schwächen der Shakespeareschen Dramatik willig zugaben, aber auf die unsterblichen Werte Shakespeares, welche Tolstoj in seiner Moralistenengherzigkeit übersah, hinwiesen. Ein anderes Beispiel: Wagner. Wagnerianer und Antiwagnerianer waren gar nicht so weit voneinander geschieden; beide hatten auch von ihrem Standpunkt recht. Die Wagnerianer wiesen auf die heilsame reformatorische Tat Wagners in der Oper und hatten hiermit recht; Wagners Gegner, und darunter befanden sich fast alle großen Geister der Zeit, sahen in Wagners Beispiel eine Gefahr für die reine ‹absolute› Musik und hatten ebenfalls recht. Der Ruhm entschied: Wir können die reformatorische Tat Wagners trotz den musikalischen Mängeln und Gefahren nicht entbehren, wir möchten sie nicht ungeschehen wissen.
Wenn aber die Ruhmsucht so weit geht, daß sie die Kritik an den Berühmten verpönt und mit Hohn bestraft, dann haben wir den Überruhm, die Vergötterung. Und das ist wohl der größte aller Schäden. Denn mit dem Augenblick, da ein Großer vergötzt wird, ist seine Einwirkung auf die Nation zu Ende. Wiederum ein Beispiel: Höher hinauf als Goethe in Deutschland kann kein Großer vergötzt werden. Und Goethes Wirkung? Entspricht sie dem? Fast die gesamte deutsche Literatur der Gegenwart tut ja gerade das Gegenteil von dem, was Goethe gepredigt und mit seinem Beispiel geheiligt hat. Darum: Der Ruhm, selbst der höchste, darf die Kritik nicht stillstellen; wessen Kritik vor berühmten Namen abdankt, ich sage es mit vollem Bewußtsein noch einmal, der bringt ganz gewiß selber nichts Großes hervor.
Ein interessantes Phänomen vollzieht sich gegenwärtig vor unsern Augen: die Umkehrung des Wertverhältnisses zwischen dem Weltruhm und dem nationalen Ruhm. Ehemals galt es für selbstverständlich, daß der Weltruhm eine Steigerung des nationalen Ruhmes bedeute; man meldete mit ehrerbietigem Staunen, daß ein Goethe, ein Heine ‹sogar› in Amerika, in Japan gekannt und gelesen werde. Wie hat sich das geändert! Mit einer Schnelligkeit, die eher einem Sturze als einem Falle gleicht, sinkt von Jahr zu Jahr der Kredit des Weltruhms. Geradezu eine Schande, weltberühmt zu sein, ist es zwar noch nicht, aber eine höchst zweifelhafte Ehre ist es schon geworden, und es steht heute so, daß der Weltruhm erst vom nationalen Ruhm nachgeprüft und gutgeheißen werden muß, ehe er Anspruch auf Glaubwürdigkeit erheben kann.
Um diese Tatsache, also die Umkehrung des Kredites beider Gerichtsinstanzen, mit andern Worten die Diskreditierung des Weltruhms unter den Nationalruhm, recht inne zu werden, nehme man doch einige Beispiele. Was gilt ein Mörike, was ein Gottfried Keller, was ein Conrad Ferdinand Meyer im Ausland? In Rußland, Italien, Frankreich und so weiter? Diese Namen genießen keinen Weltruhm. Aber ein Zola, ein Gorki, ein Verlaine, ein Wilde, die keinem der obengenannten nur bis an die Fußknöchel reichen, die genießen den Weltruhm. Mir scheint, diese Beispiele könnten schon genügen; übrigens kann jedermann mit Leichtigkeit noch ein paar Dutzend Beispiele hinzubringen.
Und nun die Erklärung dieses Umschwungs? Der Weltruhm wird heutzutage von ganz andern Behörden oder Mächten gemacht als früher, nämlich nicht mehr von den literarischen Kreisen einer Nation den literarischen Kreisen einer andern Nation übergeben, sondern von ganz unliterarischen, wenn nicht gar antiliterarischen Massen plötzlich mit Hilfe von Telegraph und Zeitung an allen vier Enden gleichzeitig angezündet. Das geht so rasch, daß mitunter ein Autor weltberühmt dasteht, ehe man ihn im eignen Lande nur kennt. Wir haben beim modernen Weltruhm also erstens das Gegenteil der Siebung, nämlich das willkürliche Ausschreien eines Namens durch Unberufene. Wir haben zweitens ausländische Gerichtsbarkeit über literarische Werke und Persönlichkeiten, ehe die heimischen Urteile noch gefallen sind. Wenn aber ein Volk über eines andern Volkes Literatur Werturteile abgibt, so erlebt man mitunter die merkwürdigsten Überraschungen: Frankreich, das Hoffmann und Offenbach unter die größten Deutschen zählt, Deutschland, das einem Zola und einer Yvette Guilbert als genialen Größen zujubelt. Drittens darf nicht vergessen werden, daß der Weltruhm ein Pariser Exportartikel ist. Niemand wird weltberühmt, ehe sein Ruhm den Pariser Stempel hat; und alles, was in Paris nur vorübergehend Aufsehen erregt, ist augenblicklich weltberühmt. Von ausländischen Kunstwerken und künstlerischen Persönlichkeiten aber nimmt Paris nur dann Notiz, wenn es ihm in die Nase sticht, wenn es eine einfache beizende Vorstellung erweckt, einerlei, ob eine richtige oder falsche.
Das sind die Quellen des modernen Weltruhms. Kein Wunder, daß nur noch einfältige Gemüter sich von diesen Feuerwerkskunststückchen imponieren lassen. Der nationale Ruhm dagegen sieht seinen Leuten ein bißchen besser auf die Finger; er versteht noch zu sichten, zu sieben und zu urteilen; und darum bedeutet er heutzutage mehr als der Weltruhm.
Die ‹Nachwelt› gehört zu der großen Firma Vorzeit, Völkerfrühling & Cie; gleich diesen schwebt sie im Nebel, nur ist der Nebel verschieden gefärbt. Die ‹Vorzeit› ist ‹grau›, der ‹Völkerfrühling› rosig, die ‹Nachwelt› hat einen goldenen Nimbus; man stellt sie sich gern als eine unbestechliche gestrenge Richterin mit Waage und Schwert vor, und zwar als eine Appellationsrichterin oberster Instanz, deren Hauptgeschäft darin bestehe, die falschen Urteile der Gegenwart wieder gutzumachen. Wobei man unbewußterweise von der Voraussetzung ausgeht, der Geist der Menschheit steige stetig in höhere Gegenden empor und die jeweilige Nachkommenschaft sei immer gescheiter als die vorhergehende Generation.
So verhält es sich wenigstens in der Theorie; in der Rednerphrase und in der Hoffnung des Menschen steht das ‹Urteil der Nachwelt› bekanntlich in höchstem Kredit. In Wirklichkeit sehe ich jedoch heutzutage keinen Menschen sich mit seinen Leistungen im mindesten darum kümmern, was die Nachwelt wohl dazu sagen werde; jedenfalls leben und wirken unsre Künstler und Dichter so, als ob wir Gegenwärtigen das letzte endgültige Urteil über Geschmack und Werte zu fällen hätten. Wir feiern hundertjährige Jubiläen mit dem Anspruch, nach dem Ansehen, in welchem nach hundert Jahren dieser oder jener heute steht, endgültig den Wert des Gefeierten festsetzen zu dürfen. Niemand fragt sich, ob nach zwei- oder dreihundert Jahren unsre Nachkommen unser Urteil bestätigen oder umstürzen werden; wir sprechen von der ‹Neuzeit›, von der ‹Moderne›, von der ‹Jugend›, ohne daran zu denken, daß das alles einmal andern ebenso alt erscheinen wird, wie uns die Vorangegangenen, über die wir das ‹Endgültige› zu sagen glauben. Also in der Theorie schätzen wir die Nachwelt als oberste Richterin, in der Praxis aber gibt es für uns gar keine Nachwelt. In der Praxis treiben wirs, als seien wir die letzten, die einzigen. Ist das Skepsis, oder ist es die Horizontbeschränktheit der Kleinen? Ist es gar Naseweisheit und Vorlautheit? Ich will nicht so unhöflich sein, das zu untersuchen. Sehen wir lieber der ‹Nachwelt› ein bißchen schärfer durch den Nebel.
Was ist das: ‹Nachwelt›? Was für eine Bürgschaft haben wir, daß die Nachwelt Urteile einer früheren Generation nicht nur umstoße, sondern wirklich zurechtsetze? Jede Gegenwart ist ja jeweilen Nachwelt für das vorangegangene Geschlecht. Das Mittelalter war auch Nachwelt gegenüber den Römern und Griechen; hat das Mittelalter die Leistungen der Römer und Griechen in Kunst und Wissenschaft gerechter und vernünftiger beurteilt als die Welt der Jahrhunderte vor Christus? Auch wir sind Nachwelt; sind wir wirklich so bewunderungswürdig gescheit, gescheiter als alle vorangegangenen Geschlechter? Sind wir absolut gescheit und absolut gerecht, weil wir die Nachwelt von etwas sind? So einzig und unanfechtbar gescheit, daß der Nachwelt nach uns nichts mehr zu revidieren übrigbleiben sollte? Ich halte es für möglich, daß die Nachwelt viel gescheiter sein wird, als wir sind, so daß sie deshalb einen ansehnlichen Teil unsrer Urteile und Bewertungen wieder umstoßen wird. Ich halte es aber auch für möglich, daß sie noch viel dümmer sein wird, als wir sind, also zu unsern Abgeschmacktheiten noch viel größere hinzufügen wird; nicht die nämlichen, gewiß nicht, aber ebenbürtige; dasselbe in Grün. Daß die Nachwelt gerechter urteilen werde als die Vorwelt, ist ein begreiflicher Wunsch und ist eine Möglichkeit, aber keine Sicherheit, nicht einmal eine Wahrscheinlichkeit. Es kommt ganz darauf an, wie unsre Nachkommen beschaffen sein werden; sind sie überhaupt gering – und es hat genug geringe Nachwelten gegeben –, so ist gar nicht abzusehen, was für Urteilsmißgeburten sie zutage fördern werden. Ich halte zum Beispiel für möglich, daß eine Nachkommenschaft die gesamte griechische Kultur als Plunder verwirft und irgendeinen Hammelskopf der künftigen Gegenwart oder auch einen staubigen Schmöker längstvermoderter Zeiten als Genius ersten Ranges ausposaunt. So eine Art Umwertung aller Werte ins Barbarische oder Plebejische hin. Kann einer wissen, wie sie urteilen wird? Und wie eine noch spätere Nachwelt über diese?
Wer also auf die Nachwelt zählt, kann sich übel verrechnen. Worauf soll denn aber sonst ein Braver zählen, wenn er bei der Gegenwart zu kurz kommt? Auf sich selber. Man schafft etwas Rechtes weder für die Gegenwart noch für die Nachwelt, sondern damit einem in der eigenen Haut wohl sei, damit man mit seinem Genius und seinem künstlerischen Gewissen in Frieden lebe. Oder, mit andern Worten, weil man nicht anders kann und selbst dann nicht anders könnte, auch wenn man ganz bestimmt voraus wüßte: niemand lohnt und dankt es einem. Und nicht bloß der vom Genius Getriebene handelt so, der Seidenwurm kann das ebenfalls. Was jenen zwingt, rechte Werke zu leisten, und diesen zwingt, gute Seide zu spinnen, ist im Grunde der nämliche Anstoß.
Von Zeit zu Zeit macht sich dieser und jener Geistkopf das Vergnügen, die Sorge um den Nachruhm zu verspotten. «Wenn du im Grabe liegst, was hast du vom Ruhm? Du spürst ja dann nichts davon.» Zugegeben, man spürt nichts davon, so wenig wie ein Offizier etwas davon spürt, daß man sein Andenken ehrt, wenn er im Kampf gefallen ist. Mit dem Verstande gemessen ist eben alles gleichgültig, was nach dem Ableben geschieht, mit dem Verstande gemessen ist alles Torheit, was außerhalb dem eigenen privaten Wohl liegt oder ihm gar widerspricht. So hat einmal ein frivoler Skeptiker von Beruf, der Abbé Galiani – so glaube ich, hieß er – die Tapferkeit eine Lächerlichkeit genannt und die Feigheit empfohlen. Es sei doch gescheiter, meinte er, davonzulaufen und sich in Sicherheit zu bringen, als für ein bloßes Wort, einen abstrakten Begriff wie ‹Vaterland›, sein Leben zu lassen. Der Mann hatte von seinem Standpunkt recht. Allein sein Standpunkt war der des Pavians, der vom Baumstamm heruntergrinst.
Der Nachruhm, wie jedes ideale Gut, bezieht seine Geltung natürlich nicht aus dem Wert, den er für das Individuum hat, sondern aus dem Wert für die Gesamtheit. Er ist eine soziale Prämie. Und zwar die allerhöchste Prämie, die es auf Erden gibt. Darum bedeutet er in einer solchen Gesellschaft, wo dieses Geld gilt, die stärkste Triebfeder zu edlen Tugenden, vor allem zum Heroismus. Der Grieche, der Römer, der an den Nachruhm glaubte, kannte kein höheres Lebensziel als das Streben nach Nachruhm, ähnlich auch in spätern Zeitaltern der König und der Feldherr, der an die Weltgeschichte, der Dichter oder Künstler, der an die Literatur- oder Kunstgeschichte glaubte.
Allein der Wert des Nachruhms hat eine Vorbedingung: die Bedingung, daß die nachrückende menschliche Gesellschaft, die über ihn verfügt, selber etwas wert sei und fähig, gerechtes Urteil zu sprechen. Nur dann gewinnt der Gedanke an den Nachruhm Triebkraft und Opferfreudigkeit. Ein Themistokles, der vom Wert Athens, und ein Regulus, der vom Werte Roms durchdrungen war, konnte nach Nachruhm bei seinem Volke geizen. Auch heutzutage kann ein Soldat vom Werte des Vaterlandes, ein Offizier vom Werte seiner überlebenden Kameraden und Oberen überzeugt sein. Daß er weiß, es sind Ehrenmänner, die über seine Ehre urteilen werden, das verleiht ihm die Kraft, für die Ehre in den Tod zu gehen.
Oft aber hat sich mir die Frage aufgedrängt: Ist die Bedingung auch für den modernen Dichter erfüllt? Kann ein solcher vom Werte des Nachruhms fest genug überzeugt sein? Kann er an die Literaturgeschichte glauben? Darf er mit Sicherheit hoffen, das Urteil der Nachwelt werde vernünftig lauten? Ich weiß, die Meinung herrscht, das verstände sich von selber, das Urteil der Nachwelt wäre untrüglich, bringe mit Gewißheit die gerechte Korrektur des unzulänglichen Urteils der Mitwelt.
Ich gestehe, diese tröstliche Sicherheit nicht zu verspüren. Was ist denn das: ‹die Nachwelt?› Etwa ein erlauchter Areopag von unfehlbaren Weisen vor einem aurorafarbenen Zukunftsvorhang? Bewahre, sondern ein kunterbunter Geburtswurf von Millionen von fehlbaren Menschen, wie wir sind. Jedes lebende Geschlecht ist doch Nachwelt für die vorangegangenen Geschlechter. Auch wir sind ja Nachwelt. Wenn ich aber beobachte, wie unser Urteil mit den Dichtern vergangener Zeitalter umspringt, so muß ich mich bedenklich fragen: Wer bürgt mir dafür, daß unsere Nachkommen erleuchteter urteilen werden und nicht am Ende noch dümmer?
Glücklicherweise dichtet der Dichter nicht für den Nachruhm, auch nicht für den Ruhm bei seinen Zeitgenossen, sondern aus andern, tieferen Beweggründen.
Während einst die Künste von Staat und Kirche, Moral und Philosophie kaum geduldet wurden und zu dieser Duldung einer Entschuldigung bedurften, der Entschuldigung, auf Umwegen andern, angeblich höhern Zwecken zu dienen, erkennt die moderne Welt den Selbstzweck der Künste an, und der Satz, daß sie nichts, was sie auch immer anrühren, entheiligen, ist jedem Gebildeten geläufig. So sehr, daß wir zum Beispiel Bedenken des Staates oder der Gesellschaft gegen dramatische Verarbeitung biblischer Stoffe als Atavismen empfinden.
Allein man kann auch zu weit gehen. Der Ehrenrang, den die Kunst mit Recht behauptet, schließt nicht das Recht in sich, andere gute Dinge nun ihrerseits von dem ihnen gebührenden Platz zu verdrängen. Und wenn die Künste Selbstzweck, ja für den Künstler Lebenszweck sind, so bedingt das noch keineswegs, daß sie darum den Hauptinhalt, den letzten Zweck des gesamten nationalen Lebens bilden sollten. Wo das geschieht, befinden wir uns schon in epigonischen Zuständen, mit andern Worten in geistiger Degeneration. Wenn die Künste oder das Kunstinteresse jenen Rang und jene Plätze fordern, welche dem fürchterlichen Lebensernst des leibhaftigen Daseins zukommt, dann werden sie einfach frivol, trotz allem ihrem Adel.
Es ist zum Beispiel frivol, den wirklichen oder vermeintlichen Literaturwert eines einzelnen Schriftstellers gegenüber dem Wert staatlicher Institutionen, Armee und Justiz und so weiter, in die Waagschale werfen zu wollen, weil eine Nation zur Not einen Schriftsteller entbehren kann – sie erträgt sogar diese Art von Entbehrungen mit bewunderungswürdiger Geduld, hat sogar beträchtliche Mühe, sich an den Leckerbissen zu gewöhnen –, nicht aber die staatlichen Institutionen. Es ist ferner frivol, einer Stadtgemeinde zuzumuten, kunsthistorischen Rücksichten ihre Lebensinteressen zu opfern, also zum Beispiel antiquarische Mauern und Gebäude, die den Verkehr hindern, im Wege stehen zu lassen. Ebenfalls frivol ist es, einer Bevölkerung zugunsten eines ästhetischen Fastnachtsvergnügens die Heilighaltung der Bauerntracht und des Dialektes zu predigen, während doch die Preisgabe dieser Dinge dem Volke nicht unerhebliche Vorteile im wirklichen Leben verschafft, was ich mich nachzuweisen anheischig mache. Wiederum ist es frivol, die Menschheit nur als Publikum, die Jahrhunderte nur als Einleitungskapitel, ein Volk, eine Provinz, eine Stadt nur als Folie und Szenerie für einen einzelnen Menschen aufzufassen, wäre dieser auch der größte. Wessen erster Gedanke bei dem Namen Verona sofort Shakespeare, Goethe und Conrad Ferdinand Meyer jubelt, der verrät zwar eine hübsche Bildung und wohl auch ein liebenswürdiges Herz, aber sein Horizont ist nicht von weitem und sein Blick nicht von hohem her. Nämlich Städte und Völker sind nicht in erster Linie dazu da, um als Illustrationsproben der Klassiker zu dienen, und die Welt ist keine literarische Beilage.
Frivol, unleidlich frivol gerät es endlich, wenn das Heiligste, was es auf Erden gibt, die Pein eines Geschöpfes, einzig unter dem Gesichtswinkel der künstlerischen Verwendbarkeit betrachtet wird. Eine Schauspielerin, die sich in den Spitälern herumtreibt, um das Mienenspiel eines Sterbenden zu erlauern, – nein, um einer Schauspielerin Modell zu liegen, dazu ist doch wahrlich der geringste der Sterbenden zu wichtig. Überhaupt scheint mir die mimisch-realistische Darstellung des körperlichen Schmerzes auf der Bühne eine bedenkliche, nämlich empörende Sache. Und damit gelangen wir zu der Frage: Kommt wirklich alles und jedes, was der Poesie, was der bildenden Kunst erlaubt ist, unbesehen auch der Schauspielkunst zustatten? Ist zum Beispiel für den gläubigen Christen kein Unterschied, ob ein Milton, ein Dante uns die letzten Dinge mit heiligem Ernst vor die Phantasie führt, oder ob ein Schauspieler, ein Opernsänger scheinbar betet und scheinbar ein vom Regisseur konsekriertes Abendmahl genießt? Und für uns andere: Ist kein Unterschied, ob ein Dichter die Leiden eines Kranken erzählt oder ob ein Schauspieler die Mienen und Gebärden desselben Kranken auf der Bühne nachahmt? Vielleicht doch.
Vergangene Woche – war es am Montag oder am Dienstag? nein, es war doch am Montag – erhielt ich unbekannten Besuch: «Professor Glauberecht Goethefest Dünkel von Weisenstein, Geheimerat». Ich nannte auch meinen Namen: «Thomas Denkselber».
«Sehr erfreut.»
«Ganz auf meiner Seite.»
«Den Zweck meines Besuches», begann der Herr Geheimerat, «werden Sie erraten. Sie haben es gewiß wie wir alle schon längst als eine unerträgliche Schmach für sämtliche deutschsprechenden Lande empfunden, daß jene, auf welche der verklärende Strahl des höchsten Dichtergenius gefallen ist, sie, welche im Herzen der deutschen Nation in ewiger Jugend unvergänglich fortleben wird, noch immer eines würdigen Denkmals entbehrt – Sie wissen, wen ich meine: Friederike, die unsterbliche Friederike von Sesenheim.»
«Friederike von Sesenheim? Warten Sie einmal, den Namen glaube ich in der Tat schon irgendwo gelesen zu haben. Aber daß sie Gedichte gemacht hat, ist mir neu.»
Der Herr Geheimerat zog ein Gesicht, als ob mir eine schauerliche Unziemlichkeit entschlüpft wäre, und sah verlegen beiseite. Plötzlich: «Was haben Sie denn da für einen interessanten alten Schmöker hegen? – Boileau? Was wollen Sie mit dem bornierten ledernen Pedanten?»
«Lesen, nicht singen.»
«Der ist ja in Frankreich selber längst veraltet und all der pseudoklassische Plunder seiner Zeit.»
«Meinen Sie? Darüber kann man verschiedener Ansicht sein. Übrigens gehört es zu den Lieblingsbeschäftigungen der Weltgeschichte, sich mit veraltetem Plunder zu befassen.»
«Ach so, das ist etwas anderes: wenn Sie Geschichte treiben! Übrigens könnten Sie sich auch mit einem lohnenderen Thema abgeben. Die Franzosen haben eben leider überhaupt keine Poesie im eigentlichen Sinne des Wortes, vielleicht ein paar Lyriker ausgenommen, deren Wert sie selber nicht –»
«Pumps! weg mit den Franzosen! Raten Sie mir eher zu den Italienern?»
«Italiener? Na! – Italiener? Nun ja, meinetwegen. Die Italiener haben ihren Dante und einige Neuere. Aber die italienische Nation als solche möchte ich doch nicht als eine eigentlich poetische hinstellen.»
«Ariost? Tasso?»
«Ariost? Den jedenfalls nicht. Ariost mußte mit seinem «Rasenden Roland» scheitern, weil eben ein Epos, das nicht durch die Begeisterung eines ganzes Volkes getragen wird, also das sogenannte Kunstepos, an sich ein Unding ist. Was dann Tasso betrifft, so beruht seine Hauptbedeutung in der Literaturgeschichte doch wesentlich darauf, daß er den Anlaß zu Goethes unsterblicher gleichnamiger Dichtung gegeben hat.»
«Also: Hauptbedeutung Tassos: prädestinierter Modellsteher für Goethe. Unbewußt? Oder meinen Sie, daß er eine Ahnung dieses erlauchten Berufes gehabt hat? Kurz, die italienische Nation als solche, wie Sie sagen, gehört nicht zu den eigentlich poetischen. Pumps! weg mit den Italienern. Dann werde ich mich lieber mit den alten Römern befassen.»
«Die können Sie ruhig aus dem Spiel lassen! Denn die Römer waren im Grunde eine kreuzprosaische Nation. Hohle Rhetorik, phantasielose Nachahmung, nüchterne Verständigkeit. Eine einzige Strophe von Heine ist mir lieber, ich meine, enthält mehr echtes poetisches Gold als die gesamte vereinigte Poesie der Römer und ihrer Nachtreter, der Franzosen.»
«Das nenne ich eine Weltliteratur in der Westentasche! Heine, den ich meine. – Ovid? Virgil? Horaz? Das sagt Ihnen also nichts?»
«Jedenfalls nicht der öde Versfex Horaz! Virgil? Nun ja, seine Äneis ist ja in ihrer Art soweit eine recht achtbare Leistung, eine nicht ungeschickte, wiewohl unendlich minderwertige Nachahmung Homers, aber als Ganzes durchaus verfehlt. In seinen kleineren Sachen dagegen ist Virgil manches gelungen; hier hegt seine Bedeutung. Eher noch Ovid. Obschon diese frivolen, geistreichen Spielereien schließlich doch eher alles andre heißen können als Poesie.»
«Daß Virgil anderthalbtausend Jahre lang der ganzen Menschheit für den größten Dichter der Weltliteratur galt, neben Homer oder sogar über Homer, stört Sie nicht in Ihrem abschätzigen Urteil?»
«Ja, aber ich bitte Sie, was für eine Menschheit? Römer! Mittelalter! Pfaffen! Scholastiker! Humanisten! die selber keinen Begriff von wahrer Poesie hatten!»
«Die Ärmsten! Darunter aber Dante, der vielleicht einen Begriff von wahrer Poesie hatte.»
«Dante hat bekanntlich Virgil unendlich überschätzt. Das können wir ihm ja nicht übel nehmen, er kannte eben Homer nicht.»
«Bitte, nehmen Sie es ihm nicht übel. Tun Sie es mir zu Gefallen, wenn nicht ihm. Es wäre zu fürchterlich. Dante, der nicht kannte. Dante, der den Virgil bekanntlich überschätzte. Und Schiller, der ihn bekanntlich übersetzte. Hatte der vielleicht auch keinen Begriff von wahrer Poesie?»
«Na, überhaupt Schiller!!»
«Na, überhaupt Schiller. Unter diesen Umständen müssen Sie jedenfalls ein unbändiges Herzvergnügen an Catull und Tibull haben.»
Der Professor schaute sich erstaunt nach mir um: «Wie können Sie das zum voraus wissen?»
«Nun, wie die Herren Glauberecht über Weltliteratur urteilen, kann man immer zum voraus wissen. Es steht ja bei jedem Namen ein Wegweiser. Entweder ein weißer, zum Beispiel bei Äschylus, Sophokles, Pindar, Theokrit, dann wird angebetet, oder ein schwarzer, zum Beispiel bei Euripides, Apollonius, Seneka, dann wird geschulmeistert. Kurz, wir sagen also: Pumps mit den Römern. Franzosen pumps, Italiener pumps, Römer pumps. Den Griechen wenigstens, hoffe ich, werden Sie die Poesie nicht absprechen.»
«Ah, das ist jetzt etwas anderes! Die Griechen! die Griechen! Das war eine poetische Nation von Gottes Gnaden! Das heißt, wohlverstanden, nicht etwa die Spätgriechen! Die Alexandriner nehme ich selbstverständlich aus, wie überhaupt außer etwa Theokrit alles, was nach der Blütezeit Athens fällt, also nach vierhundert vor Christus, um eine runde Zahl zu nennen.»
«Also die Spätgriechen vom Jahre vierhundert an hatten auch keine Poesie! Pumps mit den Spätgriechen! Ein Glück, daß Sie wenigstens den Frühgriechen Poesie zuerkennen, sonst wüßte ich wahrlich nicht mehr, was übrig bliebe. Also ist vielleicht Euripides Ihr Mann?»
Da zog der Herr Professor ein Gesicht, als ob er auf eine Wanze gebissen hätte: «Euripides? Euripides ist überhaupt gar kein Grieche.»
«Was denn?»
«Euripides ist ein Moderner, der sich aus Versehen ins fünfte Jahrhundert vor Christus verirrt hat.»
«Vielleicht aber war ihm dort wohler als bei unsern Modernen. Ich bin fest überzeugt, er hats absichtlich getan.»
«Euripides bedeutet den tiefsten Zerfall der griechischen Poesie.»
«Die Griechen selber, wie Sie wissen, urteilten anders: nicht den tiefsten Zerfall, sondern den höchsten Gipfel der Poesie bedeutete ihnen Euripides.»
«Ja, das war ja eben der Verhängnis volle, unbegreifliche Grundirrtum der damaligen Griechen, daß sie Euripides über Sophokles und Äschylus stellten. Sie verstanden eben leider das innerste Wesen der Tragödie nicht.»
«Jetzt verstehen wieder die Griechen das innerste Wesen der griechischen Tragödie nicht, und die Zeitgenossen des Perikles stecken in einem verhängnisvollen Grundirrtum über den Wert ihrer eigenen Dichter. Lassen Sie uns doch rekapitulieren. Die Franzosen verstehen die Römer nicht, die Römer verstehen die Griechen nicht, die Griechen verstehen die Griechen auch nicht. Nur die Herren von Weisenstein verstehen natürlich alles. Sagen Sie mir, Herr Geheimerat, wie steht es denn eigentlich mit Ihrer epochemachenden Arbeit über Goethes Fifi oder Mimi oder Lili oder wie sie heißt? Rückt sie vor?»
«Wer hat Ihnen das verraten? Wissen Sie aber auch, daß ich zu einem durchaus entgegengesetzten Ergebnis über Lilis Charakter gekommen bin als die bisherige Literaturgeschichte?»
«Nicht möglich! Ich staune, ich zittere! Das wirft ja alle unsere Begriffe von Poesie um! Das Werk müssen Sie unbedingt vollenden! Das dürfen Sie der Welt nicht vorenthalten! Sie hat ein Recht darauf!»
Wir schieden als die besten Freunde. «Habe die Ehre!» «Auf das Vergnügen.» Auf der Treppe holte ich ihn zurück: «Daß ich die Hauptsache nicht vergesse: War Er kurzsichtig? Trug Er Brillen? Wie stellen Sie sich zu dieser Frage?»
Der Herr Geheimerat stieg mit triumphierendem Lächeln herbei: «Er war nicht kurzsichtig, Er trug keine Brille. Ich habe darüber sogar eine besondere kleine Abhandlung geschrieben; wenn es Sie interessiert, wenn Sie erlauben, so schicke ichs Ihnen gelegentlich zu.»
«Ich bitte dringend darum, ich zähle darauf. Lassen Sie mich ja nicht im Stich.»
Wie der Völker und Jahrtausende zusammensäbelt! Als wärens Disteln! Eines steht mir fest: Wäre der weise Herr zufällig zwei Jahrhunderte früher auf die Welt gekommen, – was wollen wir wetten? – der hätte eine lateinische Lobrede auf Horaz in Hexametern zusammengeschustert! Recht hat er ja in manchem, der hochgebildete Unhold. Oder vielmehr nicht er, sondern die großen deutschen Denker des achtzehnten Jahrhunderts, deren Erkenntnisse er gedankenlos nachplappert, die anstudierten Wahrheiten durch dogmatische Engherzigkeit verkrüppelnd, daß aus der Wahrheit Ungerechtigkeit und dünkelhafte Albernheit wird. Und vorausgesetzt sogar, er habe recht – er hat aber nicht recht, sondern recht und unrecht in einem einzigen schauerlichen Gemüse –, vorausgesetzt also, er hätte recht, darf man denn Jahrtausenden gegenüber, den größten Dichtern und Denkern der Jahrtausende gegenüber in diesem wegwerfenden, süffisanten Stil recht haben? Mir kommt vor, nach meinem Geschmack, wenn einer das Mißgeschick hat, einem Dante über Poesie, einem Euripides über das Drama, einem Virgil über das Epos widersprechen zu müssen, so sollte er es bescheidentlich, mit dem Hut in der Hand tun. Und vor allem erst zwanzigmal nachdenken, ehe er widerspricht. Und wahrlich, zum Nachdenken ist hier Anlaß. Ist es denn wahrscheinlich, ist es überhaupt möglich, daß ganzen Nationen, daß vollen Jahrtausenden eine immanente Eigenschaft der Menschennatur, nämlich die Poesie, einfach gefehlt hätte? Verhält es sich nicht vielleicht vielmehr so, daß jene eine andere Auffassung von Poesie hatten, mithin einem andern poetischen Ziele nachstrebten? Und ist denn so felsenfest gewiß, daß unsere Auffassung die einzig wahre, die in allen Punkten wahre, die absolut richtige ist? Könnte nicht etwa die antike, also die griechisch-römische Anschauung in diesem oder jenem Punkte uns gegenüber recht behalten? Wird nicht vielleicht eine künftige Literaturgeschichte, also zum Beispiel ein Herr Professor Dünkel vom Jahre dreitausend, unsere Anschauungen als einseitig hinstellen, manches, das wir für überwunden ausgeben, wieder ins Recht setzend? Und vor allem: Muß man denn nicht versuchen, zu verstehen oder wenigstens ahnend nachzufühlen, wieso ehedem Hunderte von bedeutenden Dichtern und Denkern, die uns an Talent und Geist himmelweit überlegen sind, zu einer solchen Auffassung der Poesie gerieten, die von der unsrigen radikal verschieden ist? Ach, wenn ich nur ein bißchen Fachkenntnisse hätte! wenn ich nur mit der Logik auf besserem Fuße stände! darüber möchte ich einmal etwas schreiben!
Oder noch besser: Wenn einer aus dem Altertum auferstehen könnte, ein römischer Redner oder griechischer Sophist oder ein griechisch-römischer Grammatiker aus Alexandrien, so ein Euagoras oder Xenagoras oder Protagoras oder was für ein Agoras, der einem persönlich erklärte, wie sie damals die Poesie auffaßten, was sie sollte und wollte, und wie und warum sie sie auf so durchaus anderen Wegen suchten als wir!
Während ich so seufzte, begann mein Schreibtisch, sich unheimlich zu bewegen, mit unverkennbar spiritistischen Gebärden. Hurtig nahm ich Feder und Papier und notierte, was mir der Geist aus dem Jenseits vorsprach. Ich übersetze – ich denke, Sie sind damit einverstanden – aus dem Griechischen ins Deutsche und aus dem Stil des Jenseits in den diesseitigen.
Also folgendes diktierte mir mein spiritistischer Schreibtisch:
«Ixagoras von Alexandrien, der Grammatiker, Rhetor und Sophist, geboren im vierten Jahre des Kaisers Nero in Kyrene, gestorben im ersten Jahre des Kaisers Hadrian in Rom, derzeit in der Ewigkeit sich befindend, an seinen Kollegen Thomas Denkselber in Elegantopolis.
Gruß zuvor!
Es geschieht nur alle hundert Jahre einmal, daß einer von euch den edlen Namen Euripides ausspricht, ohne dem liebenswürdigsten, gemütreichsten Dichter des Altertums eines anzuhängen. Zum Dank dafür will ich Ihren Seufzer erhören und Ihnen erklären, wieso wir Alten zu einer ganz anderen Auffassung der Poesie kamen als ihr.
Empfangen Sie zunächst mein offenes Zugeständnis, daß unsere gelehrte klassische Kunstpoetik auf falscher, die eurige auf richtiger Grundlage ruht. Oh, triumphieren Sie nicht zu früh! Es kann einer aus der besten Wahrheit den greulichsten Unsinn stiften, wie zum Beispiel unser geehrter Kollege Dünkel von Weisenstein, der aus der gesamten Weltliteratur nur die lyrischen Rosinchen herauszuklauben versteht, alle bewußte Kunstpoesie verwirft und die großen Dichter mit seinem kleinen Schulkatechismus mißt. Umgekehrt kann ein anderer aus Grundirrtümern die schönsten Dinge holen, wie zum Beispiel Virgil, Corneille, Gluck, Goethe, Thorwaldsen, die sich über das Wesen des alten Griechentums gründlich täuschten und dennoch Meisterwerke aus diesem Irrtum hervorbrachten.
Also euere Grundanschauung der Poesie ist richtig. Worin besteht sie? In der Erkenntnis, daß die Poesie nicht mit den übrigen Geistesfunktionen übereinstimmt, sondern etwas ganz Besonderes, ja sogar in der Hauptsache, im Kern etwas Gegensätzliches ist. Woher habt ihr diese Erkenntnis bezogen? Aus der Vergleichung der Poesie aller Völker. Eure Erkenntnis ist international. Diese Vergleichung aber war uns unmöglich, weil zu unserer Zeit das Tatsachenmaterial nicht vorlag. Wir wußten nur von einer Kunstpoesie, von einer Dichtkunst, und zwar bloß innerhalb unseres eigenen Volksstammes, des hellenisch-römischen. Erraten aber konnten wirs nicht, daß die Poesie den anderen heilsamen Genien der Menschheit zuwiderwachse, da doch die Annahme, daß alle guten Geister einander verwandt wären, an sich wahrscheinlicher ist als die Annahme des Gegenteils. Aus dieser einen Grunderkenntnis nun, die ihr besitzt und die uns entging, mußten mit Notwendigkeit die erstaunlichsten Differenzen entstehen, je länger, desto größere. Ich will Ihnen die wichtigsten davon zeigen.
Erste Differenz. Ihr begehrt eine unabhängige Poesie, rücksichtslos die erlauchtesten Herrschaften aus der Dichtkunst verbannend: Religion, Moral, Weisheit und wie sie alle heißen.
Das zu tun hatten wir von unserm Standpunkt nicht den mindesten Grund. Wir meinten, alle Musen wirkten am besten vereint, und glaubten, der Poesie nicht im mindesten zu nahe zu treten, indem wir sie im Dienst der Religion und der Moral zur Veredlung und Erziehung des Menschengeschlechtes mitwirken hießen.
Zweite Differenz. Weil ihr die Poesie als etwas Gesondertes erkanntet, habt ihr auch ihr unterscheidendes Merkmal, ihr innerstes Wesen aufgespürt und erkannt. Worin besteht das? Im Unbewußten, im Anonymen der Seele. Um Poesie zu finden, steigt ihr aus eurer Bewußtseinshöhe in die dunkelsten Gründe der Seele, dorthin, wo die Phantasie träumt. Um Poesie zu erforschen, überspringt ihr die glorreichste Kultur eines Volkes und begebt euch in seine barbarischen vorhistorischen Anfänge, in Sagen, Traditionen, alten vergessenen Heldenliedern und Volksliedern stöbernd. Um Poesie zu genießen, legt ihr euer waches Bildungs- und Kulturbewußtsein, allen euren Geist weg und lauscht als naives unwissendes Kind, so naiv, als es euch gelingt. Kurz, eure Poetik ist – verzeihen Sie einem Grammatiker die Fremdwörter – primitivistisch, nativistisch, archaistisch und atavistisch oder, wenn Sie es in einem Wort haben wollen, kindlich. Wir aber mußten die Poesie dort suchen, wo wir auch die übrigen Schätze gefunden hatten: am entgegengesetzten Ende; nicht im geheimnisvollen Dunkel des Unbewußten, sondern auf der hellen Höhe des Geistes, nicht an der Wiege der Völker, sondern auf dem Gipfel ihrer Kultur. Mit einem Wort: im Reiche der Vernunft. Nur was zugleich denkenswürdig erschien, konnte uns dichtenswert erscheinen. Darum kommt euch unsere Poesie nüchtern vor; uns wäre die eurige töricht und trivial vorgekommen. Im klaren Reiche der Vernunft aber war natürlich für die mysteriöse Tochter des Unbewußten, die Phantasie, kein Ehrenplatz vorhanden. Reine Phantasie-Erfindungen, nur um ihrer selbst willen geschaffen, mußten uns kindlich erscheinen, weil sie dem ernsten Gedanken nichts bieten. Wenn wir dann einem durch den Ruhm geheiligten Phantasiewerk der Vorzeit begegneten, also zum Beispiel den Fabeln der Mythologie oder den epischen Dichtungen Homers, so wußten wir aufgeklärten Spätgriechen und Römer nicht mehr recht, was damit anfangen. Daß nämlich der größte Dichter der Urzeit, der göttliche Homer, an solchen Schnurrpfeifereien sollte Vergnügen gefunden haben, wie die Reiseabenteuer des Odysseus, das konnten wir unmöglich glauben. Das macht zwar den Kindern Vergnügen, aber Homer war doch kein Kinderschriftsteller, sonst hätten nicht zehn Jahrhunderte mit den glorreichsten Denkern an der Spitze so viel Aufhebens von ihm gemacht. Was blieb also übrig? Wir mußten einen zweiten Sinn, einen Gedankensinn natürlich, unter seinen Erzählungen voraussetzen, genau so wie eure gescheiten Männer, wenn man ihnen neue Mythen oder Epen bietet, an denen ihr Verstand nicht auf die Kosten kommt, sich mürrisch fragen: «Ja, was soll denn das bedeuten?» Deshalb mußten wir Homer, da wir ihn nicht ablehnen konnten noch wollten, notwendig allegorisch erklären. Und wie mit Homer ging es mit dem Alten Testament und später mit Virgil. Ihr habt ja ein allbekanntes Beispiel dieser Sinnesart in euren Evangelien. Wenn Jesus ein Gleichnis gesagt hat, so setzt der Evangelist hinzu: die Gleichnisform wählte Jesus für das ungebildete Volk, um ihm die Wahrheit mundgerecht zu machen. Also auch hier beim Evangelisten wie bei uns allen der Grundirrtum, daß die logisch vernünftige, abstrakte Darlegung etwas Höheres bedeute, die Phantasieerzählung dagegen bloß eine unwürdige Ergötzlichkeit, gut genug für das gemeine Volk und die Kinder. Das alles war eine grundverkehrte Ansicht, und die Allegorisierung von Homer, Bibel und Virgil eine erbarmungswürdige Lächerlichkeit, zugegeben. Aber wir vermochten eben jenseits der Denkbarkeit überhaupt keine Poesie mehr zu erkennen, genau so, wie ihr jetzt keine Poesie mehr jenseits der Charakteristik, was ebenso lächerlich ist.
Dritte Differenz. Ihr begehrt, eurer atavistischen Auffassung der Poesie zufolge, für die Dichtkunst eine naive, volkstümliche, kindliche Sprache, mithin einen farbigen, bilderschweren Ausdruck. Für das Widerspiel aller Poesie gilt euch das abstrakte Wort, der ‹blasse› Begriff. Wir hingegen, da wir ja die Poesie auf der Höhe der Kultur und der Vernunft einlogiert hatten, mußten, wofern wir nicht einfach die Sprache der geheiligten Vorbilder blindlings nachahmten, die abstrakte Ideensprache für die poesiewürdigere halten. Deshalb, weil ja alles Denken auf der Abstraktionsfähigkeit beruht. Vermehrung der Abstraktionsfähigkeit bedeutet Vermehrung des Geistes, Fortschritt der Kultur. Es hatte eine Riesenarbeit von Jahrtausenden gebraucht, ehe wir Völker des Altertums zum ersten Male in abstrakten Begriffen denken und sprechen konnten. Was einer aber mit unendlicher Mühe und Not errungen hat, das schätzt er auch. Mit dem abstrakten Begriff zog dann unvermeidlich auch die Allegorie in unsere Poesie, da ja Allegorie nichts anderes ist als die Personifizierung abstrakter Begriffe.
Vierte Differenz. Indem ihr das Wesen der Poesie als ein mysteriöses auffaßt, ist es euch möglich geworden, eine strenge Trennung zwischen Poesie und Prosa zu vollziehen, ich meine eine innere Trennung, unabhängig von der Form. Ihr kennt eine Poesie in prosaischer Hülle und eine Prosa in poetischer Maske. Wir aber, nachdem wir einmal die Vernünftigkeit des abstrakten Gedankens auf den Thron erhoben und die Phantasie ausgeschaltet hatten, besaßen kein deutlich unterschiedliches inneres Merkmal der Poesie mehr. Denn Gefühl, Begeisterung, Gedankenschwung, ja sogar Inspiration und rhythmischer Tonfall ist ja auch der Redekunst eigen.
Nur eine Äußerlichkeit blieb uns noch zur Unterscheidung von Poesie und Prosa: das Metrum. Die Dichtkunst wurde hiermit eins mit der Verskunst. Die Verskunst gehört aber in die nämliche Reihe wie Grammatik, Stilistik und Rhetorik. Zu oberst allerdings, als eine Art Rhetorik mit Schikanen. Das mußte natürlich damit enden, daß wir schließlich die Rhetorik ohne Schikanen vorzogen, da sie ja im Grunde denselben Dienst tat. Allmähliche Aufzehrung der Dichtkunst durch die Sprachkünste, so läuft die literarische Entwicklung des griechisch-römischen Altertums. Wie der Wolf eures Baron von Münchhausen, der sich allmählich von hinten in die Pferdehaut hineinfrißt. Und er begann schon früh an der Poesie zu nagen, der klassische Sprachwolf, schon in der Glanzzeit Athens und keineswegs bloß bei Euripides. Das bedarf, ich gestehe es, der Entschuldigung. Aber wir haben sie, die Entschuldigung, eine glänzende sogar. Bedenkt doch, daß die Verwechslung von Dichtkunst und Sprachkunst eine ewige Gefahr für die Menschheit bildet, weil ja leider die Poesie kein eigentümliches Ausdrucksmittel besitzt wie die Musik und die Plastik, sondern sich ihr Mundwerkzeug von der Alltagssprache borgt. Die Poesie wohnt im Hause der Prosa und guckt aus den Fenstern der Grammatik heraus. Für Völker mit stümperhaftem Sprachbewußtsein oder unentwickeltem Sprachkultus ist freilich die Gefahr gering. Ihr Deutschen zum Beispiel werdet kaum jemals Dichtkunst mit Sprachkunst verwechseln, eher Dichtkunst mit Sudelei. Dagegen wir Hellenen und Römer – ich will mich nicht selber rühmen, aber ich denke, Sie wissen, was wir auf sprachlichem Gebiet geleistet haben! – Ich errate, was ihr einwenden wollt: ihr würdet eher noch die Vertauschung der Poesie gegen die nackte, nüchterne Prosa verzeihen – ihr habt auch alle Ursache, das zu verzeihen! – als die Vertauschung der Poesie gegen die Rhetorik. Nicht wahr, hier sitzt der Stachel? Unsere Rhetorik könnt ihr weder begreifen, noch entschuldigen, noch verwinden. Ihr vergeßt halt, daß die Poesie in einem Punkte, der uns sehr wichtig war, gegenüber der Rhetorik im Nachteil ist: Die Poesie, da sie auf die Mittätigkeit der Phantasie des Hörers rechnet, verschweigt ja das Beste oder deutet es bloß an, während im Gegenteil die Rhetorik, weil sie eine expansive Sprache spricht, alle Gedanken und Gefühle bis zum letzten Rest, manchmal noch über den letzten Rest hinaus, volltönend zum ohrenschmeichelnden Ausdruck bringt. Darum werden gefühlskeusche, zurückhaltende Völker die Poesie lieben und die Rhetorik verschmähen, verabscheuen, hassen; wir Griechen und Römer aber und unsere Nachkommen, die Romanen, könnten eher der Poesie entraten als der Rhetorik, deshalb, weil wir mit expansivem Temperament veranlagt waren.
Zu ferneren Diensten gern bereit
Ixagoras.
Etwas schwierig, o Ixagoras! Von alledem tut mir der Kopf weh. Und das nennt der eine Erklärung! Und nicht alles ganz unanfechtbar. Aber mit dem möchte ich doch einmal ein Stündchen zusammen disputieren. Jedenfalls lieber als mit – halt! ein diabolischer Gedanke! Wenn wir Kollega Ixagoras mit Kollega Dünkel von Weisenstein zusammenbringen könnten! Das möchte eine ergötzliche Disputation absetzen! Zum Glück besitze ich ein metaphysisches Telephon. Ting, ting. Hallo! Anschluß mit Metaphysien. Der Herr Sophist Ixagoras aus Alexandrien möchte doch so gut sein und einen Augenblick ans Telephon kommen. Wie? Ich verstehe nicht. Lauter! Wer ist am Telephon? Aha, Sie sinds, Herr Ixagoras. Besten Dank für Ihre gütigen Mitteilungen. Sagen Sie, wären Sie vielleicht so liebenswürdig, nächsten Freitag abend zu einer einfachen Tasse Tee zu mir zu kommen? Sie werden wahrscheinlich Kollega Weisenstein bei mir treffen. Wie? Ach so –. Ja – ja – ja – um Mitternacht? sagen Sie? Gut, um Mitternacht. Also bleibts dabei. Danke. Schluß. Ting, ting.
Hernach verlangte ich Anschluß mit Byzanz, wo unser Geheimerat wohnt, und am Freitag abend um Mitternacht saßen wir richtig alle drei zusammen bei einer gemütlichen Tasse Tee, Kollega Ixagoras, Kollega Weisenstein und ich. Ich hatte eigentlich noch eine Dame dazu eingeladen, eine Freundin des Geheimerats, Frau Schnadra Confusowna Bilderling-Schwatzimmerich, allein sie war leider verreist.
Kaum waren die Höflichkeitshindernisse überwunden, so hatte auch schon der Herr Professor den Sophisten angehackt, in aller Artigkeit natürlich.
«Sie sehen in mir», hub er an, «mein verehrter Herr Ixagoras, einen begeisterten Bewunderer des alexandrinischen Zeitalters – ich sage das ganz ohne jede Schmeichelei –, das heißt natürlich eurer gelehrten und wissenschaftlichen Kultur. Denn was eure Poesie betrifft, so werden Sie mir selber zugeben, daß sie hauptsächlich Stubenpoesie war.»
Der Sophist schaute verwundert auf: «Ja hätten wir denn auf dem Fischmarkt dichten sollen? Tut ihr das? Und wenns regnet, dichtet ihr dann unter dem Regenschirm?»
«Nein, nein!» rief der Professor, «so meine ich es ja doch nicht. Ich meine die Buchpoesie. Poesie sollte eigentlich überhaupt nicht geschrieben und gelesen, sondern persönlich von Mund zu Mund weitergegeben werden, durch Rhapsoden und blinde Sänger, wie in der Blütezeit Griechenlands.»
«Ja sind denn Eure Verleger blind? Und studieren sie auf dem Konservatorium, daß sie so gut singen können?»
«Ach nein, das ist ja ein ganz andres Zeitalter, in welchem wir leben. Sie aber als Griechen waren verpflichtet –»
«Wir waren verpflichtet, meinen Sie, uns den kindischen Anschauungen anzubequemen, welche man zweitausend Jahre später über unser Zeitalter auf dem Katheder konstruieren würde? Auch eine Verpflichtung! Genau wie ihr mit Euripides verfahrt. Erst tüftelt ihr heraus, Skepsis, Leidenschaft und Gemüt sei ungriechisch, und dann mutet ihr allen Ernstes dem Euripides zu, er hätte sich sagen sollen: ‹Halt! Dieses Gefühl ist ungriechisch, das darf ich nicht aussprechen, das wird zweitausend Jahre später ein Shakespeare oder ein Beethoven tun.‹»
Aber mit Euripides kam Ixagoras bei dem Professor schlecht an, der nun mit gereizter Stimme dem Euripides seinen ‹zersetzenden› Unglauben gegenüber den Göttern, den Wundern, den Orakeln vorwarf.
Ixagoras erwiderte: «Glauben Sie, Herr Professor, an Orakel? an heilige Aasvögel? Halten Sie es für wahr, daß griechische Könige Göttinnen zu Großmüttern hatten? Beten Sie zu Poseidon?»
«Ja, aber ihr Griechen mußtet daran glauben, weil Aufklärung das Drama zerstört.»
«Ach so. Wir hätten also dem Drama zuliebe uns eine Religiosität anheucheln sollen, deren Falschheit wir einsahen? Was meinen Sie dazu, Kollega Denkselber?»
«Ich meine, daß erlogene oder anerlogene Gefühle den Dichter schlimmer schädigen als die hellste Aufklärung.»
Dann, von den Chören des Euripides rückwärts mit der Begeisterung wandernd, pries Kollege Weisenstein in enthusiastischer Rede die alten dramatischen Chöre und die religiösen Hymnen der Urzeit als Poesie ersten Ranges. Freilich, setzte er hinzu, dürfe man, um sie in ihrer vollen Schönheit zu begreifen, nie vergessen, daß mit dem Text, den wir besitzen, einst Gottesdienst mit Musik und Tanz verbunden gewesen sei.
«Tanzen Sie mir doch einmal einen Apollohymnus, Herr Professor», bat der Alexandriner. «Nicht? Dann vielleicht eine Dionysospolka? Warum nicht? Wir sind ja unter uns.» Und als der Herr Professor ihn darüber belehrte, daß er leider keine Ahnung habe, wie Musik und Tanz damals lauteten: «Und da machen Sie solch ein verzücktes Getu um den kleinasiatischen Hokuspokus, den Sie gar nicht kennen?»
«Direkt kennen wir leider allerdings die Musik- und Tanzbegleitung zu den Hymnen und Chören nicht, allein wir wissen aus mancherlei Stellen, daß es auf die damaligen Griechen einen gewaltigen Eindruck gemacht hat.»
«Ich begreife, Sie saugen mit Entzücken an einem Birnenstiel, von welchem die Sage behauptet, die Birne, die einst daran hing, habe vormals anderen geschmeckt.»
Da gab es eine kleine Verlegenheitspause. Ich hatte das Gefühl, die Herren verständen einander nicht. «Noch ein Täßchen Tee, Herr Professor? Etwas Zucker vielleicht, Herr Ixagoras? Sie scheinen mir etwas aufgeregt.»
Hernach ging der Disput wieder an.
«Das müssen Sie mir aber doch zugeben, Herr Ixagoras», sprach der Professor, «eure sogenannte Allegorie war doch ein schauderhaft ledernes Ding. ‹Jung›: Hauptwort ‹Jugend›. Man sagt nicht der Jugend oder das Jugend, sondern die Jugend. Die Jugend ist also weiblich; folglich: lange Haare, langes Kleid, zwei Flügel daran, und die Göttin Jugend ist fertig. Diese Sorte von Poesie hat jedenfalls niemanden durch Gehirnüberanstrengung in eine Nervenheilanstalt gebracht.»
«Nun», entgegnete der Alexandriner, «es vergnügt sich jeder, womit er kann. Wir hatten die allegorischen Gedankenspäßlein, die Japanesen haben das Zwergbäumleinzüchten, die Engländer ihre Fußbälle und Grashüpfereien, die Deutschen ihre Hamletklaubereien.»
«Zugegeben, nur beweist das nichts gegen die Abscheulichkeit der Allegorie.»
«Abscheulichkeit? Habt ihr denn Abscheu vor der Allegorie?»
«Na und ob! Diese Vogelscheuche gehört Gott sei Dank bei uns der vorsintflutlichen Vergangenheit an.»
«Euer Abscheu ist jedenfalls kein unüberwindlicher. Ich habe wenigstens, wenn ich aus dem Jenseits herabblickte, niemals bemerkt, daß einer von euch vor dem Gambrinus umkehrte, weil Gambrinus eine Allegorie ist, oder daß jemand ein Zwanzigfrankenstück zurückgewiesen hätte, weil ein geflügelter Genius darauf gestempelt ist.»
«Nun, das sind natürlich Ausnahmen.»
«Ausnahmen? Ihr könnt ja ohne Allegorie keinen Brunnen, keinen Grabstein, kein Staatsgebäude erstellen, nicht einen Prospekt, nicht einen Festzettel, nicht eine Reklame, nicht eine Banknote herausgeben. Wir haben doch wenigstens unsere Allegorien nicht angesungen.»
«Angesungen? Allegorien ansingen? Wer tut denn das?»
Da tat der Sophist seinen Mund auf und sang mit lauter Stimme: «Heil dir, Helvetia.»
«Und stellvertretende Trankopfer», fuhr er fort, «haben wir ihnen auch nicht dargebracht.»
«Stellvertretende Trankopfer? den Allegorien?»
Und abermals tat Ixagoras den Mund auf und rief: «Ich lade Sie ein, dieses Glas auf das Wohl der Alemannia zu leeren.»
«Bravo, Herr Ixagoras», belobte ich, «Sie haben sich tapfer herausgebissen. Nehmen die Herren vielleicht einen Sandwich? Oder lieber etwas Süßes?»
Aber der Herr Geheimerat hatte noch allerlei auf dem Herzen. Man findet nicht alle Tage Gelegenheit, mit einem authentischen griechischen Sophisten zu disputieren, nicht wahr? Die Gelegenheit muß man doch benützen. Also fing er nach einiger Zeit die Angelei wieder an, diesmal von einer anderen Seite:
«Aber der fromme Äneas, in eurem langweiligen Virgil, das ist doch ein unleidlicher Gesell! Überhaupt: Tugendhelden!»
«Immerhin, so jämmerliche Wichte waren sie doch nicht, wie euere psychologischen Romanschufte, die ihr Helden nennt.»
«Ja, aber wozu denn ums Himmels willen überhaupt Tugend und Moral in der Poesie? Die Poesie ist doch wahrlich viel zu gut dazu, um der spießbürgerlichen Philistermoral zu dienen!»
«Sagen Sie mir doch, Herr Geheimerat», fragte Ixagoras, «sind Sie schon einmal wegen unsittlicher Handlungen im Zuchthaus gesessen?» Und da der Geheimerat entrüstet hoch aufsprang: «Verzeihen Sie, ich dachte nämlich, Unsittlichkeit gelte bei Ihnen für eine Ehre, da ihr die Sittlichkeit für eine Schande haltet.»
«Wer hat denn jemals gesagt, daß wir die Sittlichkeit für eine Schande halten? Wo nehmen Sie den kuriosen Einfall her?»
«Nun, von Ihnen. Sie haben da oben von der ‹spießbürgerlichen Philistermoral› mit einer so verächtlichen Betonung gesprochen und so überlegen die Achsel dabei gezuckt, daß ich dachte, Sie hielten sie für etwas Verächtliches.»
«Aber so begreifen Sie doch», fiel ich begütigend ein, «im Leben natürlich huldigen wir alle der Moral, der Herr Professor auch, kein Mensch prahlt damit, daß er im Zuchthaus gesessen sei oder daß er jemand umgebracht habe, auch kann ich Ihnen persönlich für die Harmlosigkeit und moralische Unbescholtenheit von Kollega Dünkel garantieren; nur in der Poesie können wir selbstverständlich nicht die spießbürgerliche Moral dulden.»
«Ach so», bemerkte der Sophist, «jetzt versteh ich. Ihr verachtet in der Poesie, was ihr im Leben als Gesetz achtet. Während ihr dichtet, tut ihr unmoralisch, und wenn ihr das Manuskript dem Verleger übergeben habt, tut ihr wieder moralisch. Dann müßt ihr aber gewissermaßen euer Ich in zwei Hälften spalten, in eine poetische übermoralische und antimoralische und in eine spießbürgerliche philistermoralfromme.»
«In gewissem Sinne, wenn Sie so wollen, ja.»
«Ist das nicht schwer? Tut das nicht weh?»
«O nein, nicht im mindesten. Wir sind nämlich auf Halbheiten eingerichtet; es ist so eine Art Naht in unserer Seele.»
«Aber was für Sicherheitsvorrichtungen habt ihr dagegen, daß nicht etwa ein Gedanke aus dem einen Seelencoupé sich in das andere verirrt und dort Konfusion stiftet?»
«Die Gedankenlosigkeit.»
«Und euer Wille, mit welcher von beiden Hälften hält ders? Mit der poetischen oder mit der spießbürgerlichen?»
«Nun, einen sogenannten Willen in dem strengen Sinn, wie ihr Griechen und Römer ihn verstandet: so eine Art Spannfeder, wo der Gedanke darauf wirkt und die dann auf den Entschluß losschnappt, so daß dem Gedanken entsprechende Handlungen entstehen, das haben wir heutzutage kaum mehr und brauchen es auch nicht.»
«Ich danke für die interessante Belehrung. Allein ich kann mirs noch immer nicht klar vorstellen: ein und derselbe Mensch ist in zwei Hälften gespalten, wovon die eine Hälfte anders urteilt als die andere. Dürfte ich vielleicht um Beispiele bitten?»
«Von Herzen gern. Also zum Beispiel die poetische Hälfte räuchert dem großen Heiden Goethe, und die andere pilgert mit dem Gesangbuch in die Kirche. Oder die poetische Hälfte schreibt einen Roman, worin die urwüchsige, noch von keiner sogenannten Bildung verfälschte gesunde Kraft des Bauernstandes gepriesen wird, die andere Hälfte läßt sich in die Volksschulkommission wählen. Oder die poetische Hälfte begeistert sich über die herrliche unnachahmliche Linienführung des Busens der Venus von Medici, die andere Hälfte nennt die herrliche unnachahmliche Linienführung des Busens der schönen Madame Decoltitzki einen Skandal. Ich kann Ihnen noch mehr Beispiele geben, wenn Sie wünschen.»
«Bemühen Sie sich nicht weiter. Das genügt. Aber wissen Sie, was ich möchte, da Sie beide sich doch so für antike Musik und Tänze interessieren? Einen Satyrtanz zum besten geben. Freilich, Ihre prosaische Hälfte würde ihn, ich fürchte, ein wenig – wie soll ich sagen – derb finden.»
«Dann lassen Sies lieber, Herr Ixagoras.»
Inzwischen hatte sich Herr von Weisenstein erholt und trat neu gestärkt in den Kampf.
«Das Unbegreiflichste von allem», meinte er, «ist mir immer eure Rhetorik gewesen. Rhetorik in die Poesie hineinmischen! oder gar sie der Poesie vorziehen! Was in aller Welt hatten Sie denn überhaupt an der faulen Rhetorik? Wem sollte denn dieser hohle, pompöse, gemütlose Zauber Freude machen? Ich mag mich erkundigen, wie ich will, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Menschen gekannt, der in der Rhetorik irgend etwas Genießbares gefunden hätte; wenigstens unter uns Deutschen gibt es keinen, das kann ich Ihnen getrost versichern.»
Da zog Ixagoras ein feines Gesicht: «Sie haben eine Tochter, Herr Geheimerat, nicht wahr? Heißt sie nicht Berta?»
«Allerdings. Doch verzeihen Sie, das gehört nicht hierher.»
«Bitte gehorsamst, das gehört außerordentlich hierher. Setzen Sie Ihre Berta auf ein Sofa, und führen Sie ihr zwei Anbeter vor, einen nach dem andern natürlich, zuerst einen poetischen Friedrich, also einen, der ihr seine Liebe mit dem naiven Ausdruck des Gefühls erklärt, also einsilbig und stammelnd, das Beste verschweigend, und hernach einen rhetorischen Pomponio, der ihr Ohr mit einem Schwall von wohlstudierten, volltönenden Phrasen überschwemmt, was wollen wir wetten, Herr Professor, Ihre Berta läßt den armen Poesiefriedrich schmählich abziehen und erhört den hochfaselnden Pomponio?»
«Kollega Ixagoras», unterbrach ich, «Sie werden immer persönlich. Das sind wir bei uns zulande nicht gewohnt. Sagen Sie mir lieber etwas anderes. Wie konntet ihr auf den sonderbaren Einfall kommen, euch die Poesie von Grammatikern, Schullehrern, Sophisten, Rhetoren servieren zu lassen? Stilkunst und Rhetorik gehören doch nicht in eine Kategorie mit der Dichtkunst! Das sind ja himmelweit verschiedene Dinge!»
Der Alexandriner drehte sich um und langte ein Büchlein aus meiner Bibliothek. Darauf buchstabierte er mit Stentorstimme den Titel: «Handbuch der Stilistik, Rhetorik und Poetik, herausgegeben in Berlin 1901.»
Eben wollte ich mich ein wenig schämen, da schlug es ein Uhr, und ritsch! verrasselten meine beiden Gäste plötzlich durch den Kamin, der Alexandriner und der Deutsche. So daß ich fast vermutete, es möchten allegorische Kollegen gewesen sein.
Und doch wieder nicht! Denn wissen Sie, was ich soeben vor einer Stunde erhielt? Einen äußerst liebenswürdigen Brief von Kollega Goethefest, worin er mir seinen Dank für den interessanten, genußreichen Abend aussprach. Wenn man auch nicht in allen Punkten übereinstimme, so rege doch gerade der Widerspruch zum Nachdenken an, so daß selbst der Irrtum auf Umwegen die Wahrheit fördere, – und so weiter und so weiter. Dem Brief war eine kleine Broschüre beigelegt, von der ich leider in der Eile nur schnell den Titel habe lesen können: «Waren die Postpferde, mit denen Er von Eger nach Karlsbad fuhr, Braune oder Schecken? Preisgekrönte Abhandlung von Herrn Prof. Dr. Goethefest von Weisenstein, herausgegeben von der Allgemeinen epigonischen Gesellschaft zur Förderung literarischer Petrefaktur und byzantinischen Geisteslebens.»
Sie begreifen, meine Herren und Damen, meine Ungeduld, über die Frage der Postpferde, die von jeher meine Gedanken beschäftigte, endlich ins reine zu kommen, und so bitte ich um Ihre Erlaubnis, hiermit Abschied von Ihnen zu nehmen.
Eine festlich geschmückte Kirche. Auf den Bänken des Schiffes Publikum. Eine Schillerbüste. Feierlicher Einzug der vereinigten Realisten, Naturalisten, Primitivisten, Symbolisten, Jem'enfoutisten, Verlainianer, Baudelairianer, Findesiècler, Dekadenten, Neuromantiker, Modernen, Jungen, Nichtmehrjungen, Freien Bühneler, Überbrettler, Kabarettler und so weiter, hinter ihrem Dirigenten und Regisseur Kapellmeister Streber.
Ein Naiver (im Publikum): Ja, wird denn heute «Wallensteins Lager» aufgeführt?
Zweiter Naiver: Oder die «Räuber»?
Kein Naiver: Warum sind dann einige Rollen mehrfach besetzt?
Die beiden Naiven: Welche denn?
Publikum (gebieterisch): Seht! Stille schweigen!
(Der Zug schreitet an der Schillerbüste vorbei)
Die Schillerbüste: Dies sind meine lieben Söhne, an welchen ich ein Wohlgefallen habe.
(Eine Taube schwebt über den Zug hernieder)
(Der Zug stellt sich als Chor im Halbkreis um die Rednertribüne, die Gesangbücher in der Hand; der Kapellmeister mustert seine Leute, durch die Reihen schreitend)
Kapellmeister Streber (leise): Daß mir heute keiner wieder Goethe singt, statt Schiller, in seiner Zerstreutheit, wie das letztemal!
Eine maulende Stimme: Ja, wenn man aber auch so wenig Zeit zum Einstudieren gehabt hat!
Kapellmeister: Also Schiller heißt der Mann. Merkt euch den Namen: Schiller.
Komtesse Carmencita Türk-Hunyádi-Hysterinsky: Ach, es ist so schwer auszusprechen!
Kapellmeister: Zugegeben. Allein es kann doch nicht jedermann Dostojewsky heißen. – Und Sie dort hinten, Kopromuk, Schmutzle und Wenzel, daß Sie mir dann nicht jedesmal zu grunzen anfangen, wenn der Redner den Namen Schiller ausspricht. Ich begreife ja, es ist ein unangenehmer Moment. Allein es muß sein und geht im Augenblick vorüber. – Aber meine Herren Modernen, so spielen Sie doch nicht immer mit dem Chamäleon! Können Sie sich denn keinen Augenblick von dem Vieh trennen? Tun Sie den Wurm hinaus; der gehört doch nicht in eine Schillervorstellung. Sie können ihn ja nachher wieder holen.
Die Modernen (kläglich): Ach, es ist so ein liebes, süßes, goldiges Tierchen. Mpf! Mpf!
Kapellmeister: Nun, so stecken Sies meinetwegen unter die Tribüne! Aber es soll sich ruhig verhalten! Still jetzt! Das Publikum wird ungeduldig. Also angefangen! Eins, zwei, drei.
(Der Chor singt die Nänie. Ergriffenheit. Man hört schneuzen und schluchzen)
Ein Naiver (im Publikum): War jetzt das also die berühmte Nänie, von welcher das Sprichwort sagt?
Zweiter Naiver: Was für ein Sprichtwort?
Erster Naiver: Oder sagt man denn nicht: Krokodils–
Publikum (gebieterisch): Seht! Ruhig! Seht!
(Dr. Michel Genialowitz Modernefritz besteigt die Tribüne. Sensation, dann brausender Beifall)
Der Redner (Dr. Michel Genialowitz Modernefritz): «Verehrte Anwesende! Es ist ein erhebendes, ein ergreifendes –» (Vertraulich zum Chor:) Nur keine Angst! Es ist uns ja nicht Ernst mit dem ganzen Rummel. Sonst würden wir uns unsere eigenen Tintenfässer untergraben. Es bleibt nachher alles wieder beim alten – pardon, ich wollte natürlich sagen beim Jungen, beim Modernen.
Der Stenograph: Verzeihen Sie, daß ich unterbreche, Herr Doktor, aber soll ich, was Sie vertraulich zum Chor bauchrednern, auch stenographieren?
Der Redner: Besser nicht. (Im Rednerton:) «Es ist also, wie gesagt, ein ergreifendes, ein erhebendes, wir dürfen im gewissen Sinne sogar sagen erstaunliches Schauspiel, diese Einmütigkeit, mit welcher am heutigen Tage Tausende und Millionen Deutscher von den schneebedeckten Gipfeln der Alpen bis zum wogenumspülten Meeresstrande, ohne Ansehen des Standes, des Ranges und der Partei, ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes –»
Ulrich Knurr (im Publikum): In der Tat ein erstaunliches Schauspiel! Es hat ja einer noch vor kurzem kaum mehr den Namen Schiller in Deutschland auszusprechen gewagt.
Kapellmeister: Herr Knurr, bitte den Redner nicht unterbrechen zu wollen.
Stimme aus dem Publikum: Wenn er aber doch recht hat! Ohne ein gnädiges Achselzucken wurde der Name Schiller nie ausgesprochen.
Eine andere Stimme: Verschämt, als ob er eine poetische Unanständigkeit enthielte.
Dritte Stimme: Als Trabant hinter dem Wagen des Dichterfürsten schien er euch leidlich gut genug.
Der Redner: «So weit die deutsche Zunge reicht –»
Knurr: Hat man sie gegen Schiller herausgestreckt.
Kapellmeister: Herr Knurr, wenn Sie mit Ihren geschmacklosen Bemerkungen fortfahren!
Redner: «Mit Stolz können wir sagen: ‹Unser Schiller›. Warum dürfen wir ihn den unsrigen nennen?»
Knurr: Weil ihr ihn zeitlebens angefeindet habt.
Kapellmeister: Jetzt aber, Herr Knurr, wenn Sie noch einmal unterbrechen, werde ich mich genötigt sehen, Ihre Entfernung zu veranlassen.
Knurr (trotzig): Versuchen Sies. Ich habe so viel Recht hier wie ihr, vielleicht mehr.
Der Chor (sich entrüstet umdrehend): Kein Mensch hat jemals Schiller angefeindet.
Knurr: Mit Namen im offenen Kampfe allerdings nicht, dazu fehlt euch der Mut und auch die Aufrichtigkeit gegen euch selbst. Aber hinterrücks, auf Umwegen, unter der Decke. Alles, was ihr tatet, was ihr lehrtet, war ein Angriff auf sein Beispiel, eine Bekämpfung seines Einflusses auf die Nation. Was war denn der Kern eurer geräuschvollen literarischen Revolution? Gift gegen die hohe Poesie, jene Poesie, für welche der Name Schiller das Symbol ist. Und wie lautete denn damals euer Feldgeschrei? Zola gegen Schiller! Und später, was wolltet ihr mit eurer unwürdigen Bauchkriecherei vor Goethe? Ihr hofftet einen Antischiller aus ihm herauszugötzen. Damit man Schiller nicht sehe, damit man ihn vergesse, deshalb mußte Goethe übermenschliche Riesengestalt erhalten. Nicht als Vorbild und Zuchtmeister, sondern einzig als Sonnenschirm gegen Schiller hat euch Goethe gedient.
Das Publikum: Bravo, Knurr!
Kapellmeister (zum Redner): Lassen Sie den Kerl schwatzen, und fahren Sie ruhig weiter. Wir sind zahlreich, wir halten zusammen, wir haben die Macht.
Der Redner: «Worin besteht das Geheimnis, daß bei dem Namen Goethe –»
Kapellmeister (ärgerlich auffahrend): Was? Sie auch, Herr Doktor?
Der Redner: Ich habe mich einfach versprochen. Ich wollte sagen: «Worin besteht das Geheimnis, daß heute bei dem Namen Schiller –» haben Sie gehört, ich sagte deutlich Schiller – «alle Herzen höher schlagen?»
Das Publikum (unisono): Durchaus kein Geheimnis. Kommt vom Dezimalsystem. Neunundneunzig Jahre Grabesschweigen; hundert Jahre: Jubilo.
Blasius Pfeifer (wurstig): Äh was Geheimnis! Flausen! Weil wir exerziert sind, blitzschnell auf Kommando uns jeden beliebigen Enthusiasmus anzulügen.
Ida von Snobenhausen: Training. Schiller hat heute den Rekord. Hipp hipp Schiller! Match!
Redner: «Aber nicht kühle, frostige Bewunderung ist es, nein, innige, begeisterte, dankbare Liebe –»
(Beifall im Publikum)
Der Chor (sich vor Lachen den Bauch haltend): Wenn die dort hinten eine Ahnung hätten, was wir darum gäben, wenn wir den unbequemen Phrasenfriedrich ungeschehen machen könnten!
Redner: «Wenn wir uns nun fragen, welchen Zweck wir mit dieser Schillerfeier verfolgen», (vertraulich:) so ist es der Versuch, wieviel Unverschämtheit sich die Nation von uns bieten läßt.
Kapellmeister: Keine Gefahr! Diese schlappe Generation schluckt alles. Keine Spur von Temperament!
Ein alter Junger (zynisch): Und glücklicherweise auch keine Spur von Gedächtnis! Das ist ja eben der unschätzbare Segen des Wortes ‹Moderne›, daß wir ewig mit dem Heute das Gestern verleugnen können, ohne uns die Mühe nehmen zu müssen, deswegen zu erröten und uns zu entschuldigen.
Ida von Snobenhausen (fröhlich): Der neueste literarische Sport: in sein eigenes Nest – hipp, hipp, Match!
Chor der Modernen (zum Chamäleon): Mpf! Mpf!
Redner: «Was hat uns Schiller gegeben? Ein Wort vor allem ist es, an welches wir denken, so oft wir den Namen Schiller aussprechen; Sie erraten es alle – das Wort ‹Ideal›.»
(Heftiges Ausspucken, Rülpsen und Grunzen der Realisten und Naturalisten. Heulen, Pfeifen und Lachen im übrigen Chor. Unruhe und verschiedene Bewegung im Publikum)
Knurr: Himmelmillionen! Er wagts! Nachdem sie während dreißig langen Jahren das Wort dermaßen in Verruf gebracht, daß kein Hund mehr ein Stücklein Brot von einem Idealisten angenommen hätte!
Baron Lotterich (übernächtig, verschlafen): Ideale Pariser Beauté-s! Balletteusen! Chansonetten! Ideale Hüften!
Ein Fremder: Herr Baron, darf ich mir vielleicht erlauben, Ihnen diese französische Grammatik für Anfänger zum Geschenk anzubieten?
Kapellmeister (zum Redner): Herr Doktor, vermeiden Sie besser das Fremdwort ‹Ideal›, es wird in Deutschland nicht mehr verstanden. Können Sie es nicht durch ein entsprechendes deutsches ersetzen, zum Beispiel ‹Milieu› oder ‹Documents humains› oder so etwas?
Der Redner: «Schillers erhabener Geistesflug konnte nur in den reinen Höhen des Äthers –» aber was riecht denn da so abscheulich! Können denn die geehrten Herren Naturalisten –
Die Naturalisten (grimmig): Bei uns ist doch wenigstens ein ehrlicher, gesunder, sittlicher – und nichts Perverses.
Die Findesiècler, Dekadenten, Verlainianer und so weiter: Oho!
Ulrich Knurr (vergnügt): Das kommt vom Zeitgeist.
Baron Lotterich: Äh wäh! Was wollt ihr lange fragen: die Juden sinds.
(Greulicher Tumult in der ganzen Kirche)
Kapellmeister (sich die Haare raufend): Und das will Goethe feiern! Aber warum lachen Sie denn so eklig, Herr Doktor?
Der Redner: Juchhe! Jetzt haben Sie selber Goethe statt Schiller gesagt! Etsch!
Die Schillerbüste (königlich): Sagen Sie nur ganz ruhig Goethe für Schiller. Wenn Sie nur wenigstens den einen von uns beiden beherzigen möchten, einerlei welchen.
Der Redner: «Soll und kann die heutige Schillerfeier spurlos vorübergehen?» (Vertraulich:) Ich hoffe es nämlich bestimmt. Man wird zwar eine Unmenge von Schillervereinen, Schillerstiftungen, Schillerausgaben, Schillerdenkmälern, Schillermedaillen, Schillerpatati, Schillerpatata, Schiller-was-weiß-ich stiften, man wird künftig an einem Tag Schiller öfter zitieren als früher in zwanzig Jahren – was schadet das?
Blasius Pfeifer: Nichts schadet das. Nützen tuts.
Der Redner: Natürlich. Wir vergötzen Schiller zum Petrefakten, so wird er unerreichbar, unnahbar, unnachahmlich, und sein Einfluß hat ein Ende. Das Kunststück ist uns mit Goethe gelungen, es wird uns auch mit Schiller gelingen. (Laut fortfahrend:) «Wird es jemals gelingen, den Deutschen ihren Schiller wieder zu rauben?» (Vertraulich:) O ja! kinderleicht! Der erste beste ausländische Hans kanns. Je mittelmäßiger, desto besser. Ein Sardou hats gekonnt, ein Zola hats gekonnt –
Ein Dekadent (kläglich): Aber wenn nun einmal kein Ausländer mehr da wäre?
Ein Überbrettler: Bah! Im Notfall tuts auch ein fremder Bänkelsänger. In den Spelunken des Montmartre lungern jederzeit so ein Stücker vierzig herum.
Der Kapellmeister: Unter uns gesagt, ich habe schon wieder einen wunderbaren exotischen Käswurm in der Tasche, für nach der Schillerfeier.
Der Chor (begehrlich zappelnd): Bitte, bitte, Kapellchen, süßes Kapellchen, geben Sie her!
Der Kapellmeister: Pst! Pst! Geduld! Wenn ihr sehr sehr artig seid und das Fest in keiner Weise stört, bekommt ihr ihn.
Das Publikum (aufgeregt): Was gibts? Etwas Exotisches? (Blindlings:) Hurra!
Ulrich Knurr (geräuschvoll seinen Stuhl zusammenklappend): Ich geh. (Geht fort.)
Der Redner: «Aber es genügt keineswegs, Schiller mit leeren Worten zu preisen, wir müssen ihm nachfolgen. Was verstehen wir unter der Nachfolge Schillers?»
Die Schillerbüste (mit Stentorstimme) Das Kleine und das Gemeine, das behagliche Waten in den Sümpfen der Alltäglichkeit, den Blick nicht höher als die Nase, den grinsenden Hohn gegen das Erhabene, das Große, das Gesunde, den Haß gegen das Ideal, die Abwesenheit des künstlerischen Ernstes, die Entthronung der Poesie durch die Prosa, der Ewigkeit durch den Zeitgeschmack, die Vermietung der Literatur in einen knechtischen Fremdendienst, das gierige Aufschlecken jedes Krankheitsstoffes, der in dem letzten Winkel Europas fault, die Tyrannei der impotenten bübischen Frechheit, die Vergötterung kindischer virtuoser Mätzchen, ein nüchternes plebejisches Drama im Joch der Tendenz, der Lehrhaftigkeit, der Politik und Sozialökonomie, welchem die Historie verboten und der Vers verleidet wurde, eine vergigerlte, genialtänzige Lyrik, welche heute mit der Roheit, morgen mit der Raffiniertheit kokettiert, im Vordergrund der Literatur ein mit allen Ansprüchen gespreizter, mit allen Zeitblasen aufgeblasener Prosaroman, dickleibig und vierbeinig –
Der Kapellmeister (entsetzt): Jetzt fängt der Jambenfriedrich noch selber an. Machen Sie Schluß, Herr Doktor!
Der Redner (hastig): «Es sind aber nicht allein seine Werke, es ist vor allem seine Persönlichkeit, sein heiliger Ernst, sein unbeugsamer Charakter. Fahren wir also, ohne nach links oder nach rechts zu sehen –»
Chor (entrüstet): Bitte sehr, im Gegenteil, nach links und rechts und nach allen vier Weltgegenden sehend.
Der Redner: «Fahren wir also, nach links und rechts und nach allen vier Weltgegenden sehend, unverrückt –»
Blasius Pfeifer (wurstig): Mitunter auch verrückt –
Der Redner: «– unverrückt und unbeirrt fort –»
Die Schillerbüste (mit Stentorstimme): – in euren Cliquen, Banden und Reklamen, euren internationalen Geschäftchen und Rückversicherungen, in eurer Überzeugungslosigkeit und Wurstigkeit, in euren Verwandlungskünsten, in eurem pfiffigen Trick, Anstoß erregend, um Aufsehen zu gewinnen, den albernsten Launen der Mode, den Einflüsterungen des lumpigsten Zeitgeistes folgend, jede beliebige Kokarde auf den Hut steckend, die jeweiligen Erfolg verspricht, und das Glaubensbekenntnis von morgen beschwörend, das ihr noch gar nicht kennt. –
Kapellmeister: Schluß! Schluß denn endlich! Herr Doktor!
Der Redner: «In diesem Sinne also rufen wir ein begeistertes, brausendes, donnerndes –» (Das Chamäleon, unter der Tribüne hervorgekrochen, steigt ihm auf den Rücken und guckt ihm über die Schulter:) Ach du süßes, goldiges Chamäleon! (Zum Stenographen:) Was wollte ich doch gleich sagen?
Der Stenograph: Wahrscheinlich: ‹lebe hoch auf ewig!›, oder so etwas.
Redner: Aber wer denn? So helfen Sie mir doch!
Der Stenograph: Der Andere, der Zweiteinzige, Ib.
Der Redner: Richtig, ich danke. Also «Schiller der Unvergeßliche, lebe hoch. Unser Schiller auf ewig!»
(Beifall, Schluß. Trallala)
Draußen vor der Kirche.
Der Chor (zum Kapellmeister): Aber ist er auch faul, der Käswurm, den Sie uns versprochen haben? (Traurig:) Wenn er am Ende nicht faul wäre!
Komtesse Carmencita (verzückt): Faul?! O Gott, ich fürchte, ich bekomme vor Freuden den Botticelli.
Kapellmeister (durch den Zweifel beleidigt): Nicht faul? (Stolz:) Ich sage euch: so faul, daß er sogar schon krepiert ist. So krepiert, daß er bei sich zu Hause längst verstunken und vergessen ist.
Alle Umstehenden (herbeieilend, flehentlich und dringlich): O dann für uns! Für Deutschland!
(Ulrich Knurr geht über den Platz)
Kapellmeister (zu Knurr eilend): Aber! Aber! Aber! Herr Kollega! Unter uns kann ich Ihnen ja schon zugeben, daß vieles von dem, was Sie sagten, das meiste sogar – aber mir scheint, schon die Kollegialität –
Knurr: Es kollegiälelet schon viel zu viel bei euch. Mein Kollege ist das Publikum, das Volk, oder wie Sies nennen wollen.
Kapellmeister: Aber bedenken Sie doch unsere schwierige Lage! Oder wie meinen denn Sie, daß wir die Schillerfeier hätten begehen sollen?
Knurr: Sich einschließen, die Fensterläden zu, und das Schämen lernen.
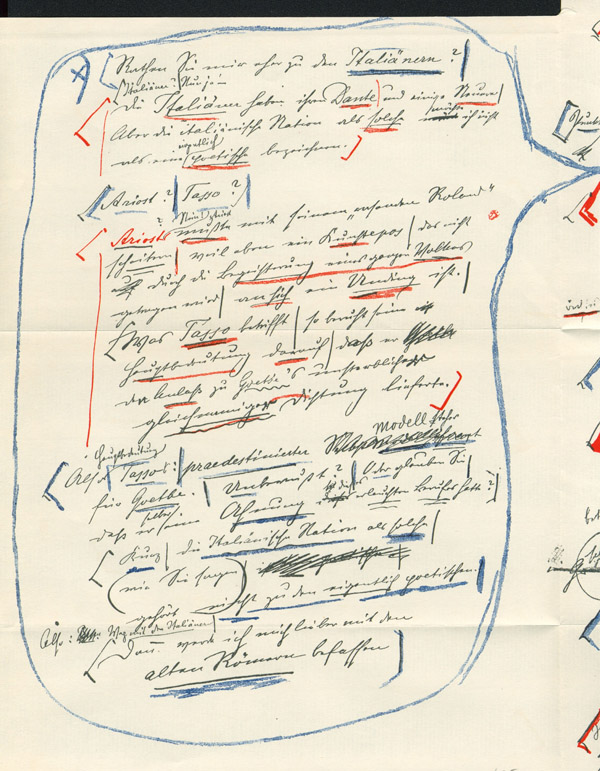
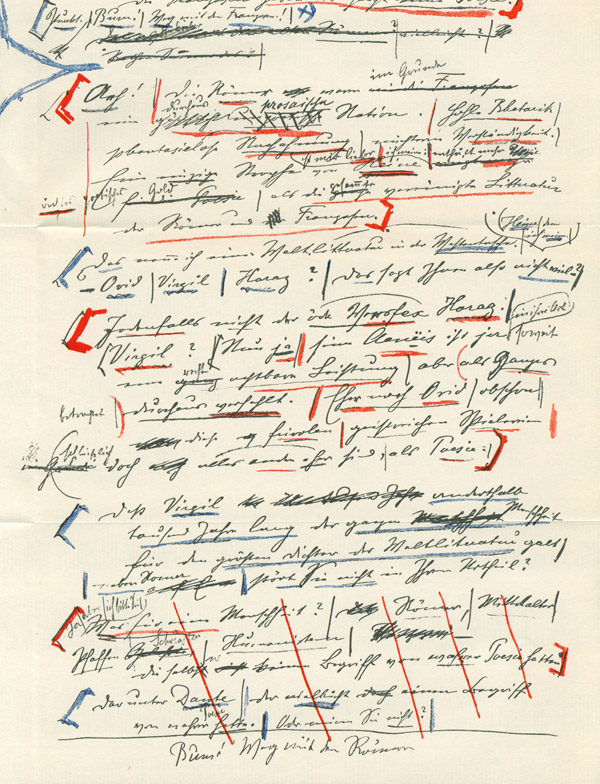
Zwei Seiten aus dem Vortragsmanuskript zu «Professor Glauberecht Goethefest Dünkel von Weisenstein über Weltliteratur», mit Korrekturen und mehrfarbigen Andeutungen für den Vortragenden. Gespräch zweischen Thomas Denkselber (blau) und Professor Glauberecht Goethefest Dünkel von Weisenstein (rot).
Aus dem Spitteler-Nachlaß im Besitz der Schweizerischen Eidgenossenschaft.