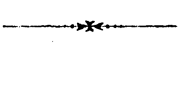|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Die helle Nacht ruht über dem Gebirge…
Die große spiegelklare Wasserfläche wirft den Glanz der Sonne zurück, und eine silberhelle, zitternde Beleuchtung hat sich über das steile Ufer und bis zu dem weißen Pfarrhaus hingebreitet.
Es ist etwas Wunderbares um diese hellen Nächte. Man empfindet sie immer, als stünden sie außerhalb der Gegenwart.
Der helle Tag, die dunkle Nacht – in ihnen findet man sich so natürlich zurecht. Aber die helle Nacht – sie scheint nicht dieser Welt anzugehören. Es ist, als lasse sie etwas ahnen, etwas weit Größeres als den Morgen, der über der Welt anzubrechen pflegt.
Es ist, als öffne sich eine Türe zu lautlosen lichten Gefilden, zu einer Stätte der Erwartung, wo man dem Sonnenaufgang der Vollendung entgegenschaut.
In der hellen Nacht gibt es einen Zugang von einer Welt in die andere. Man fühlt sich dem stillen lebendigen Dasein des Jenseits gleichsam näher als in der lärmenden Unwirklichkeit des Tagewerks.
Über die glänzende Wasserfläche gleitet ein Boot nach dem Ufer des Pfarrhofs. Eine einzelne Gestalt steigt aus und bleibt am Ufer stehen.
Der Fährmann, der an einer kleinen Poststation seinen Wohnsitz hat, rudert nach ein paar Augenblicken wieder weg. Er weiß, daß der Pfarrer auf einer Amtsreise in Sörli ist und erst in drei Tagen um Mitternacht zurück sein kann. Aber die Tür des Pfarrhauses steht offen, – das weiß er auch – wenn die Pächtersleute je schlafen gegangen sein sollten.
Das Boot gleitet dahin wie ein Schatten auf dem glatten Silber der weiten Fläche.
Die Gestalt geht nicht nach dem Pfarrhaus, sondern setzt sich auf einen großen Stein am Ufer und hüllt sich dichter in ihren langen, dunklen Mantel. Sie sitzt unbeweglich, als sei sie eins mit dem Stein. Und sie wartet…
Die helle Nacht steigt lautlos aus dem weißlichen Wasser auf und umzieht alle Berge mit ihrem zarten Glanz.
Die blanke Fläche ist unbeweglich wie ein Glas. Nur drinnen zwischen den Ufersteinen schlägt sie ein paar leuchtende Falten, die sich mit einem leisen beruhigenden Rauschen auf dem weichen Sand glätten, und diese schwache Bewegung, in tausendfacher Wiederholung, ist das einzige, woran man merken kann, daß die Zeit vergeht.
Sonst scheint alles ganz still zu stehen, wie in träumerische Ahnung verloren. Dann ertönt ein Laut, fern und unbestimmt. Ein Laut, der die Stille nicht zu unterbrechen scheint, – selbst als er deutlicher wird, – sondern eher mit ihr zu verschmelzen scheint. Es ist der taktfeste Ton von Ruderschlägen, die sich nähern.
Ein ruhiger Ton. Und doch ist es, als ginge ihm ein gespanntes, von Herzklopfen begleitetes Lauschen mit angehaltenem Atem entgegen.
Um die dunkle, mit Tannen bestandene Landzunge zur Linken gleitet ein Boot und fährt auf das Ufer zu.
Knirschend fährt es auf den Sand und hält.
Der Pfarrer steht auf und steigt aus, – ein einsamer Mann, der in der Nacht in sein einsames Haus zurückkehrt, wie schon hundert- ja tausendmal zuvor.
Plötzlich bleibt er stehen. Er steht wie angewurzelt.
Die Gestalt da vor ihm auf dem Stein, unbeweglich wie dieser…
Der Pfarrer schlägt beide Hände vors Gesicht. Dann fühlt er auf einmal alles Blut zum Herzen strömen, als wolle es dieses zersprengen. Und es wird ihm schwarz vor den Augen…
Nicht, weil überhaupt eine Gestalt dort sitzt, obgleich auch das an und für sich unerwartet ist. Eher weil die schlanken Umrisse der Gestalt – die ganze Haltung – die Art, wie der Mantel gefaltet ist…
Die Gestalt erhebt sich, tritt einen Schritt näher… und gleitet lautlos in den Sand zu seinen Füßen…
Mit einer heftigen Kraftanstrengung geht er bis zu dem Stein hin, setzt sich darauf und bedeckt dann das Gesicht wieder mit einer Hand.
Denn es saust ihm in den Ohren, es schwindelt ihm vor den Augen.
Die Gestalt neigt ihr Gesicht auf seine andere Hand, die schwer und kalt auf seinem Knie liegt.
Und so bleiben sie unbeweglich, lange, lange.
Es ist möglich, daß hinter ihm ein gähnender Schlund von leeren Tagen und qualvollen Nächten ist, der sich nun langsam und besänftigend ausfüllt, so daß die friedliche Verbindung mit der Vergangenheit wieder hergestellt werden kann. Und es ist möglich, daß er einen Weg vor sich liegen sieht, gebahnt hin zur Vollendung des Lebens…
Denn dies ist die helle Nacht, in der die getrennten Welten zusammentreffen – – –
»Halfdan, ich bin es.«
Die Stimme wieder! Der Klang, der unerreichbare, den wieder zu vernehmen seine Ohren auf einer einzigen Sehnsuchtswache gestanden hatten. Jetzt so heimisch und gewohnt, als habe er immer zwischen diesen Höhen erklungen.
»Ich bin es.«
Die Ahnung eines Lächelns zieht über seine Lippen. Als ob es nötig wäre, ihm dies zu sagen!
Noch bleibt er eine Weile sitzen, ohne zu sprechen. Er hat vergessen, was er sagen wollte, wenn er sie einmal wiedersähe. Er hat sich so lange darauf vorbereitet, daß nun alles entschwunden ist – alles.
»Halfdan, darf ich kommen?«
Er will sprechen, kann aber nicht; er legt nur seine Hand auf ihr Haar.
Endlich sagt er: »Du kommst sehr spät. Ich habe gerufen und gerufen.«
Seine Stimme ist so merkwürdig heiser und tonlos, wie die eines Menschen, der im Traum spricht. Und es wird ihm schwer, die Worte herauszubringen.
»Ich habe dich – erwartet. Du mußtest kommen. Ich habe dich gerufen – nicht zu mir – aber ich wußte, wenn du einmal hinüberkämest – und dich selber fändest, dann mußtest du heraufkommen.«
Sie schaut zu ihm auf. »Halfdan, ich habe dich rufen hören, und nun bin ich hinübergekommen. Du hast mich mitgezogen. Aber auf meine eigene Weise – – und nicht auf die eines andern in der Welt.«
Indem sein Blick den ihrigen trifft, ist es, als ob er erwache. Und das zurückgedrängte Leid der vielen Jahre ist im Begriff, loszubrechen, in einem tiefen und bitteren Groll.
Mit bebenden Händen erfaßt er ihren Kopf. »Wie konntest du? – Wie konntest du? – Du wußtest, was du tatest! Du – –«
Aber in demselben Augenblick läßt er sie auch schon wieder los und steht auf. »Nein, nein! Antworte mir nicht – antworte mir nicht. Du bist hier. Das soll mir genug sein – es ist genug. – Komm!«
Sie richtet sich langsam auf.
»Ja, wie konnte ich?« sagt sie.
Durch den Mantel faßt er nach ihrer Hand und steigt mit ihr das Ufer empor. Auf halbem Weg halten sie an, um Atem zu schöpfen.
Er deutet nach dem südlichen Himmel.
»Sieh,« sagt er, »der weiße Streifen über dem Berggipfel dort – wie ein feiner langgestreckter Regenbogen – der steht wieder dort, ganz wie gestern Abend auch.«
»Ja,« sagt sie, als hätte sie ihn gestern Abend auch gesehen.
Er will weiter gehen, aber sie hält ihn zurück.
»Alle die Orte, wo du – um meinetwillen gelitten hast, – zeige sie mir.«
Er schüttelt den Kopf. »Es wären zu viele – es wäre überall.«
Aber er wendet sich nicht dem Pfarrhaus zu. Er geht nach der entgegengesetzten Seite, hinein zwischen die rauschenden Tannen, und führt sie ins Tal Josaphat, zu der blumigen Felsenspalte tief im Wald.
All die bunten Blüten stehen unbeweglich und duften in nächtlich verschleiertem Glanz. Und es ist, als weine das Bächlein im Schlaf.
»Hier,« sagt er, »hier hab' ich gedacht, daß du sitzen würdest. In der Mittagssonne zwischen all den Blumen – und daß ich die Arme um dich und sie legte.«
Sie pflückt ein paar von den Blumen und befestigt sie an ihrer Brust.
Dann gehen sie weiter.
Ein feiner plätschernder Wasserstrahl rieselt aus einer Felsenspalte, gleitet hinab über den harten Stein, wo er eine dünne grünliche Spur hinterläßt, und verschwindet unter kleinen Farrenkräutern und Rentiermoos am Fuß des Felsens.
»Hier hab' ich gedacht, daß du versuchen würdest, von dem Wasserstrahl zu trinken, daß du von den Tropfen ganz bespritzt würdest und – lachen würdest. Und daß ich alle Tropfen von deinem Gesicht trinken wollte. Ich bin immer durstig an diesem Wasser vorübergegangen…«
Sie hält die hohle Hand unter den Strahl und hebt sie an seinen Mund. Er trinkt einen oder zwei der kühlen Tropfen.
Aber indem er ihre Hand los läßt, umfaßt er ihr Gesicht.
»Ich habe gedürstet – gedürstet,« sagte er.
Und er küßt sie.
Da schlingt sie die Arme um seinen Hals.
Es war, als mache sich ihr Herz frei in einem erlösenden Schrei.
Einen Augenblick scheint er am Zusammenbrechen zu sein. Dann richtet er sich jäh auf.
»Komm!« sagt er. »Wir müssen höher hinauf.«
Sie steigen, steigen. Den schmalen Pfad geht es hinauf, der sich am Felsen hinzieht, bis er auf einem großen flachen Felsblock endet, der sich über den dunklen Tannenwald und den glänzenden See zu ihren Füßen hinauslehnt.
»Hier –« sagt er und setzt sich auf eine kleine Bank an der Felswand.
Sie setzt sich neben ihn, und er erfaßt ihre beiden Hände.
»Hier oben –« sagt er, hält aber wieder inne und betrachtet ihre Hände.
»Was ich jetzt sage,« beginnt er kurz nachher, »muß so verstanden werden, als sei es in meinem Innern gesprochen.«
»Ja, ja.«
»Hier oben lernte ich – in einer bittern Nacht, als die Wahrheit mich dazu zwang – von der Höhe aus auf das hinabzusehen, was zwischen uns gewesen war. Und es konnte nicht bestehen – nein, nicht ganz.«
Sie machte eine Bewegung. Und mit stärkerer Stimme fährt er fort: »Es war nicht, weil ich zweifelte, daß du die Rechte, die Einzige für mich seiest, die, die mit ganzer Liebe zu besitzen ich volles Recht hatte. Dessen war ich ganz sicher.
»Auch nicht, weil dies Verhältnis noch Mängel und Schwachheiten zeigte. Das hat so wenig zu bedeuten. Es muß immer so sein zwischen unvollkommenen Menschen.«
Er hält inne. Und sie drückt seine Hände.
»Sondern weil ich außerhalb stand, nicht wahr?« fragt sie leise. »Deshalb wurde ich ein Hindernis für dich. – Sag es nur.«
»Nein, nein. – – Ich will dir nicht die Schuld beimessen. Hättest du anders gestanden, wäre es wohl nicht so gekommen. Aber die Schuld war mein – mein allein.
»Denn das war es, daß ich – dich außerhalb meines Verhältnisses zu Gott hatte. Ich wollte dich haben wie einen Raub. Ich wollte dich mit Gewalt hinreißen, aber zu mir – zu mir allein, dich ausschließlich so in meinen Besitz bringen, – daß nicht allein alle andern ausgeschlossen waren, sondern daß auch der Zugang nach oben verriegelt war. Denn es war – nun spreche ich aus der tiefsten Tiefe meines Gewissens – es war, als fürchtete ich, es könnte für meine Liebe etwas verloren gehen, wenn du unter eine höhere Macht kämest als die meinige.
»Ich war ein Heide in diesem Stück. Ich wollte dich nur für mein eigenes Glück und für nichts anderes, im Himmel und auf der Erde.
»Ich wußte es selbst nicht. Aber als ich in die Einsamkeit hier herauf kam, da erkannte ich es. Da sah ich, wie tief in der Ebene ich gewesen war, obgleich ich davon gesprochen hatte, daß ich auf der Höhe stehe. Es gibt nur einen Weg nach der Höhe, über sich selbst hinaus – zu Gott. Aber ich war unten – tief drunten in mir selbst.
»Da begriff ich, warum dieses Zusammensein aufgehoben werden mußte. Da konnte ich es auf mich nehmen, nicht das, was mir getan worden war, sondern das, was ich dadurch lernen sollte; – ich sollte durch den unnatürlichen Schmerz lernen, ohne dich zu sein. Da konnte ich mich darunter beugen, ja – ihn wollen.
»Und erst da wurde mein Verhältnis zu Gott vollkommen. Denn da ging ich ganz darin auf. Ich übergab meinen Willen bis zum letzten Punkt, – bis zu dem Punkt, wo man bis aufs Blut kämpft, um das Eigene behalten zu dürfen. Da wurde ich zum Pfarrer geweiht, dem Herrn geheiligt.«
Sie beugt sich vor und küßt seine Hände. »Hochlandspfarrer,« flüstert sie.
Er wendet ihr das Gesicht zu.
»Aber da fühlte ich mich fast als deinen Schuldner, verstehst du. Und es nagte an mir, wie wenig ich dir geholfen hatte auf dem Weg nach oben. Da wünschte ich, das Leben einzusetzen, um dich zu rufen. Nicht zu mir, nein nicht zu mir, – zu dem Verhältnis, wozu du dich mehr als sonst jemand, den ich kenne, eignest. Und ich habe es getan – täglich. Und nicht am meisten da, wo der Ruf hinausging in die Welt.
»Hier wollte ich ausharren, bis du kamst. Kamst du, dann wußte ich, das ich dich ruhig aufnehmen konnte. Denn dann warst du eins mit mir im Höchsten. Und wurdest mir aufs neue gegeben. Von oben…
»Und nun – nur das will ich noch sagen, – was du tatest, kann nicht verteidigt werden, – nicht entschuldigt. Es soll es auch nicht. Aber es besteht nicht mehr, wenn du da bist. Und für mich ist es gut geworden. Es zog mich hinauf.«
Sie sitzt eine Weile unbeweglich. Dann sagt sie: »Halfdan – ich habe das alles gewußt. Ich habe es aus jedem Wort, das du schriebst, herausgelesen. Und ich habe es an mir selbst gefühlt, wie weit du gekommen warst. Deshalb wagte ich auch zu kommen.«
Er streicht ihr zärtlich übers Haar. »Wagtest du es früher nicht? Wagtest du es nicht immer, zu mir zu kommen? Was hätte ich nicht ausgelöscht, wenn du gekommen wärest. Auch ehe ich so weit gekommen war!«
Er steht auf.
»Komm!« sagte er. »Ich habe ein Nachtlager für dich. Und bald… bald ein Heim!«
Sie zögert noch auf der Bank. »Halfdan, bist du sicher, daß du auch morgen noch ebenso sprechen wirst?«
»Warum nicht? Was meinst du?«
»Ich meine, – wenn du mich beim hellen Tag siehst, dann – o Halfdan!«
Sie verbirgt plötzlich ihr Gesicht in den Händen.
»Ach, so meinst du es? Laß mich einmal sehen!« Er richtet ihren Kopf auf. »Bist du sehr verändert?«
»Ein wenig schon – ich meine natürlich…«
»In einem Punkt bist du unverändert,« sagt er ruhig. »Du bist noch ebenso töricht wie damals. Du solltest wissen, daß ich auf so etwas nicht antworte.«
»Ach Halfdan! Aber dann – es tut nichts, wenn du mich wieder töricht findest – ich will es dir gegenüber so gern sein, – aber dann gib mir den Namen, der sagt, was ich dir sein soll, – ich muß das jetzt hören, verstehst du. Und niemand kann ihn mir geben, als du allein.«
Sie erhebt sich, läßt den langen dunklen Mantel fallen und steht vor ihm im weißen Gewand.
Er stößt einen Freudenruf aus und breitet die Arme aus.
Sie aber sinkt zu Boden und bricht in Tränen aus.
Er zieht sie in seine Arme.
»Durch Gottes Gnade – mein Weib,« sagte er. »Fleisch von meinem Fleisch, Seele von meiner Seele, ich liebe dich.«
Sie wenden sich dem Pfarrhaus zu. Da bleibt sie stehen.
»Ist deine Kirche offen?«
»Nein, aber ich habe den Schlüssel bei mir. Willst du hineingehen?«
»Ja, einen Augenblick. Mit dir.«
Er öffnet die Tür des Kirchleins. Die helle Nacht gleitet weißlich zu den Bogenfenstern herein und füllt den Raum mit ihrer lautlosen Erwartung. Das große Kreuz auf dem Altar leuchtet wie der erste goldene Streifen des Sonnenaufgangs.
Den Arm um sie geschlungen, geht er langsam darauf zu. Und sie knieen zusammen auf dem Kissen vor dem Altar nieder.
Ohne Worte. Denn das ist der Augenblick, wo alle Worte und Gedanken verstummen, – machtlos. Wo die unaussprechlichen Seufzer die Seele wie mit einem letzten Wogenschlag ins Heiligtum hineintragen…
Ihr ist es, als zittere die Luft um sie her von heimlichem Glockengeläute.
» Sursum corda… sursum corda…«
Und der Herzschlag selbst gibt Antwort: » Habemus ad Dominum!«
– Kurz nachher stehen sie vor dem Pfarrhaus. Sie schaut sich nach allen Seiten um.
»Wie fandest du den Weg?« fragt er, seine Hand an ihre weiche Wange gelegt.
Sie sieht ihn an, lächelt dann zum erstenmal und antwortet mit Solveigs Worten:
»Ich wanderte lang, oft fragt' man mich aus,
Doch immer nur sagt' ich: Ich gehe nach Haus.«
Da lächelt auch er.
Er will sie ins Haus hinein führen, aber sie legt ihre Hand auf seinen Arm und sagt: »Halfdan!«
»Ja.«
»Ich muß dir etwas sagen, ehe ich hineingehe… Ich meine nicht, wie ich hinüberkam. Das kannst du später hören, alles von den langen Jahren, – bis ich sicher war, daß ich nun kommen durfte… Es ist etwas anderes… Ich hätte gewiß nicht den Mut, es zu sagen, wenn du nicht so gesprochen hättest wie vorhin – und – –«
»Was ist es denn?«
Sie steigt auf einen großen Stein, der vor der Haustür liegt.
»Nun sollst du das größte Geheimniß erfahren. Aber du darfst mir kein Wort erwidern – – hörst du! Und niemals später auf das Gesagte zurückkommen. Denn ich weiß, daß sich vieles dagegen sagen ließe… Und ich könnte nicht ertragen, wenn du es tätest… Und ich kann doch von keinem Menschen ein Urteil darüber annehmen… Ich weiß nur, daß es ganz von innen heraus kam – von da, wo die Wahrheit in mir ist… Und daß ich – – ja, ich würde es gerade wieder so machen, wenn ich könnte.«
Er tritt ganz nahe zu ihr.
»Was hast du getan? – Was ist es? Laß es mich hören!«
Sie umschlingt sein dunkles Haupt und zieht es an ihr Herz.
»Halfdan – du weißt, daß nichts in mir war. Ich war ganz leer und ferne.«
Er richtet den Kopf auf, um zu sprechen. Sie aber zieht ihn inniger an sich.
»Nur – nur dein tiefstes, innerstes Verhältnis – – das fühlte ich, das liebte ich, an das glaubte ich, – auch – –«
Sie zögert einen Augenblick. – »Ja, auch wenn ich es nicht sah, wenn anderes dich in Anspruch nahm, – nicht tiefer, aber stärker… Dies klingt vielleicht sonderbar, aber ich glaube, ich hätte mein Leben hingeben können um dein Verhältnis zu Gott. Denn ich wußte, daß du da dein Leben hattest.
»Und dann, – dann merkte ich, – dann wurde es mir klar, – dann bekam ich Todesangst, daß – nein, nein, – nun muß ich flüstern, und du darfst es nicht gehört haben…«
Sie legt ihre Lippen an sein Ohr. Und er vernimmt ihre leisen, bebenden Worte und mit ihnen den starken schnellen Schlag ihres Herzens.
Plötzlich hebt er heftig den Kopf.
»Du? – du? –«
Sie legt ihre Hand auf seine Lippen und flüstert wieder – leise und eindringlich.
Dann ist sie fertig. Vor ihm auf dem Stein steht sie, bebend – und weiß wie ihr weißes Gewand.
Eine Weile steht er stumm und unbeweglich und schaut weit hinaus in die helle Nacht. Findet deren friedliche Klarheit wohl jetzt den Weg zu dem dunkelsten Punkt der Vergangenheit?
Endlich sagt er leise: »Ich kann nicht darauf antworten, – ich soll ja auch nicht. Und das ist gut… Denn niemals könnte ich mich damit einverstanden erklären, daß dies die rechte Weise war. Ich könnte nie einräumen, daß – nein, nein, ich will nichts sagen – das muß zwischen dir und einem Größeren bleiben, bis zu dem Tag, der alles klar machen wird.«
Er richtet seinen Blick auf sie, wie sie vor ihm steht – weiß in ihrem weißen Gewand.
In dem Blick lag sein ganzes Herz.
»Eins, nur eins mußt du hören! Was auch dagegen gesagt werden könnte – ich glaube doch, der – Hochlandspfarrer, der über sich selbst hinausgelangte und eine andere Seele in die Tiefe seines Verhältnisses zu Gott mit hineinzog – –« Er beugt sich nieder und führt den Saum ihres weißen Gewands an seine Lippen – »Der warst du – du, du…«