
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
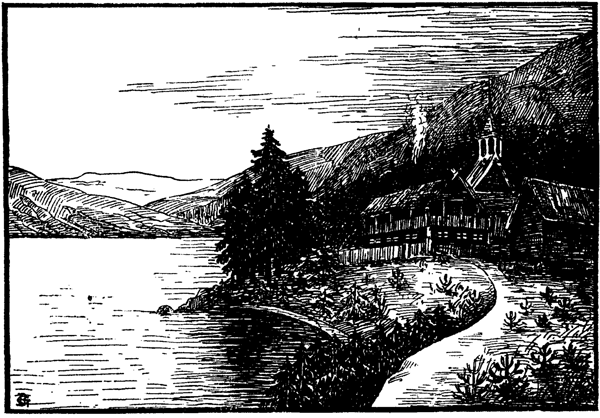
In dem Pfarrhof am Ufer, das jäh aus dem großen Wasserspiegel aufsteigt, wohnt der Pfarrer. Allein – ganz allein. Die Zimmer in dem langen, hellangestrichenen Holzgebäude hallen von seinen Fußtritten wider. So hat er es selbst gewollt, als er, ein noch junger Mann von etwas über dreißig Jahren, hierherkam. Und so ist es noch immer.
Hier, wie an allen solchen abgelegenen Orten, pflegen die Pfarrer nicht lange zu bleiben; in der Regel nur fünf Jahre.
Aber als diese Zeit verflossen war, meldete sich dieser Pfarrer nicht weg. Ruhig blieb er, bis noch weitere fünf Jahre zu den ersten gekommen waren. Und seither ist wieder ein Jahr vergangen, und noch eines, und er ist schon in der Mitte des dritten, also dem dreizehnten, seit er herauf kam.
So lange ist vor ihm noch nie einer dagewesen. Die Frau des vorigen Pfarrers sagte, daß die Stelle am besten nur für junge Leute passe, die jedes Jahr ein Kind bekämen. Denn wenn man nicht dafür sorgte, den Ort zu bevölkern, so könnte man vor Einsamkeit verrückt werden.
Er wurde nicht verrückt. Aber man hätte glauben können, daß er es gewesen sei, als er hier herauf kam, so sonderbar richtete er sich ein. Und so düster und schwermütig, wie er ausgesehen hatte!
In dem Haus rechts von dem Hauptgebäude wohnen die Pächtersleute mit dem Küster, die einzigen andern Menschen, die sich an dem Ort befinden.
Der Pfarrer übertrug der Pächtersfrau sogleich seine ganze Haushaltung. Sie, Kari, konnte diese leicht mit übernehmen. Den Verhältnissen angemessen ist sie hier nicht sehr umständlich.
Milch, Sahne und Eier hat man genug; sein Brot backt man sich selbst. Seine Waren werden einem einmal im Jahr zugeschickt. Fische, herrliche Forellen erhält man im Sommer aus dem See; selbstverständlich lebt man viel von gesalzenem und geräuchertem Fleisch, aber dazwischen schlachtet man auch, so daß man frisches Fleisch hat; um die Weihnachtszeit einen Ochsen, der in dem rotangestrichenen Vorratshaus aufgehängt wird, wo er sogleich gefriert, so daß man bis weit in den Mai hinein frisches Fleisch essen kann. Wildbret bietet zu Zeiten auch manchen Hochgenuß; Schneehühner, Haselhühner und Auerhähne gibt es in Menge; Bärenfleisch und Renntierbraten gehören nicht zu den Seltenheiten.
Die Pächtersleute hielten einen Knecht und eine Magd und hatten selbst zwei Töchterchen mit runden, sonnverbrannten, von weißlichem, an der Sonne gebleichtem Haar umgebenen Gesichtern, die allmählich heranwuchsen und der Mutter flinke Hände zum Mitangreifen bekamen. Von ihrem vierzehnten Jahr an konnte Sigrid, die älteste von ihnen, beinahe ausschließlich die Bedienung des Pfarrers übernehmen. – –
Durch die Küche und das Waschhaus haben die Pächtersleute eine Verbindung mit der Wohnung des Pfarrers, und das Essen wird ihm hinübergebracht. Er sitzt am Tisch in der großen Eßstube. Allein…
Nur im Hochsommer, wo Freunde und Verwandte ab und zu einen Ferienausflug herauf machen, hat er Tischgenossen. Aber die Gäste übernachten im Pächterhaus, wo Platz genug ist. Es ist so am einfachsten wegen der Bedienung.
Im Pfarrhaus selbst findet sich nur ein Bett außer dem des Pfarrers. Dies aber ist immer bereit in der Kammer neben seinem Schlafzimmer. Er sagt, wenn eine wandernde, vielleicht verirrte Seele einmal in der Nacht anklopfe, so solle das Lager ihrer warten, ohne daß die Pächtersfamilie aufgescheucht werden müsse, um einer fremden, vielleicht zweifelhaften Persönlichkeit Obdach zu gewähren.
Aber die umherstreifende Seele ist in all diesen Jahren in keiner Nacht gekommen. Und wo sollte sie wohl auch herkommen? – Hier herauf! – –
Die Zimmer des Pfarrhauses sind groß, und es sind ihrer nicht wenige. Am Platz ist nicht gespart worden. Sie liegen alle in einer Reihe; die Fenster gehen auf die große, silberhelle Wasserfläche hinaus mit der Aussicht auf all die tannenbedeckten, unbewohnten Höhenzüge ringsum.
Die Zimmer sind spärlich und sehr einfach ausgestattet. Von einem Pfarrer zum andern bleiben die Möbel stehen, so daß die neuvermählten Paare, die meistens um diese Stelle einkommen, sich alle Widerwärtigkeiten mit der Aussteuer sparen können, bis sie wieder südwärts ziehen.
Nur sein schönes Harmonium hatte der Pfarrer mitgebracht, – nicht ohne große Schwierigkeiten. Aber einen mußte er doch wohl haben, um sich mit ihm zu unterhalten. Etwas mußte er um sich haben, das die Luft in den öden Zimmern in eine tönende Bewegung versetzen konnte.
Er singt oft zu seinem Spiel, aber er spielt doch noch öfters – manchmal bis tief in die Nacht hinein. Da vertraut er wohl dem Instrument einige von den Gedanken an, die er mit niemand teilen kann und die das Instrument dann in Harmonien ausspricht. – –
Der Morgen nach unserer nächtlichen Ankunft auf dem Pfarrhof wird mit Glockenläuten begonnen, – mit schwingenden Glockentönen, die einen auf- und abschaukeln in einem seligen, halbbewußten Traumzustand, wobei man ohne eine bestimmte Vorstellung von Zeit und Ort ein unaussprechliches Gefühl hat von den »Glocken des Himmelreichs, die da läuten für mich.«
Dann klopft es an der Tür. Die Pächtersfrau tritt ein, und damit nimmt das Dasein festere Formen an. Sie hat uns sehr lange schlafen lassen, will aber nun melden, daß der Frühstückstisch bereit stehe, daß die Kirchenbesucher sich auf dem Wasser gezeigt haben, und daß es zum erstenmal geläutet habe.
Obgleich sie sagt, wir müßten uns beeilen mit dem Aufstehen, bleibt sie doch noch eine Weile stehen und erzählt uns von dem Ort und dem Pfarrer, das meiste von dem, was eben hier mitgeteilt worden ist.
In großer Eile ziehen wir uns an, frühstücken auch in demselben Tempo. Dann geht es hinaus.
Der Hofplatz ist breit und geräumig, von vier Gebäuden im Viereck eingeschlossen. Das Haus nach dem See ist das Hauptgebäude. Von dem Flur vor dem Eßzimmer führt eine Tür, mit großen Renntiergeweihen darüber, nach dem Hof.
Draußen senkt sich die grüne Küste zum See hinab, und hinter dem Pfarrhof steigt sie in die Höhe – hoch und steil.
Aber eine Gruppe kleiner dunkler Holzhäuser, deren Dächer mit Rasenstücken bedeckt sind, – die wir gestern Abend nicht sahen, weil sie sich in der nächtlichen Dämmerung nicht von der Felswand unterschieden – drückt sich dicht bei dem Pfarrhof zusammen.
Also doch ein Dorf im kleinen, – Menschen als Unterbrechung der großen Einsamkeit?
Nein, – es sind keine bewohnten Heimstätten, nur Sonntagshäuser, von den Kirchenbesuchern errichtet. Denn die Kirchengäste kommen weit her, die meisten wenigstens; von dem Gebirge herab, über Moore, über das Wasser. Früh am Morgen, um fünf oder sechs Uhr, müssen verschiedene von ihnen zu Hause aufbrechen, um zu rechter Zeit zur Liturgie um elf Uhr in der Kirche zu sein.
Wenn nun zwei Feiertage nacheinander kommen, wenn schlechtes Wetter eintrifft, oder wenn es dunkle Winterzeit ist, dann wird in den kleinen Hütten übernachtet. Es sind da Bänke an den Wänden, und Felle liegen darauf, um sich damit zuzudecken.
In der hellen Sommerzeit aber wird nur der ganze Sonntag da zugebracht.
In jedem der Häuschen ist ein Pejs (offene Feuerstelle). – Da wird Feuer angemacht, Kaffee und Kartoffeln gekocht und die mitgebrachten Speisen verzehrt. Man macht sich gegenseitig Besuche. Die Männer stehen vor den Häusern und besprechen die Begebenheiten der Woche.
Verhältnismäßig ist es den ganzen Tag hindurch bevölkert und lebendig.
Gegen Abend ziehen alle wieder fort, um in der hellen Nacht noch nach Hause zu kommen, und das Dörfchen ist die ganze Woche hindurch wieder ausgestorben.
Bisweilen verhindert das Wetter oder die Jahreszeit die Kirchenbesucher ganz am Kommen. Besonders in der dunklen, stürmischen Herbstzeit, ehe die weißen Winterwege die Verbindung erleichtern, und während des Tauens im Frühjahr geschieht dies oft eine ganze Reihe von Sonntagen hindurch.
Dann schweigen die Glocken, und die Kirchentüren öffnen sich nicht. In der Stube des Pfarrers versammeln sich die Pächtersleute und der Küster, und da wird der Gottesdienst gehalten.
Wenn aber der spähende Blick, von einem der Fenster aus, den ersten schwarzen Schimmer von Menschen auf der gefrorenen schneeweißen Fläche entdeckt, oder das erste Boot auf dem Wasser, dann öffnet der Schullehrer die Kirchentüren, der Pächter, der zugleich auch Glöckner ist, geht in den Turm, um die Glocke zu läuten, und der Pfarrer zieht den Talar an. – – –
Geradeso geht es auch heute. Die hohe schwarze Gestalt steht schon vor dem Pfarrhaus, um die Kirchenleute zu begrüßen, die sich nun versammeln und drunten am Wasser Grüße auswechseln, um dann in Scharen das Ufer zu ersteigen.
Der Pfarrer drückt jedem die Hand, alle sagen »du« zu ihm. Dann steigt er, die Bibel in der Hand, an ihrer Spitze den steilen aber kurzen Weg zur Kirche hinan.
Wir schließen uns ihnen an. Die Kirche ist nicht sehr groß, aber so hell, daß es einen festlichen Eindruck macht. Und über dem Altar strahlt ein riesengroßes, glattes, goldenes Kreuz anstatt der friedenstörenden Altarbilder, deren wir uns von den letzten Kirchen, die wir drunten gesehen haben, noch erinnern.
Der Kantor singt vor, aber des Pfarrers orgeltiefe Stimme trägt den ganzen Gesang:
»An jenem Tag, Erlöser mein,
Da du vom Tod erstanden,
Strahlt eines neuen Tages Schein
Hell über allen Landen.
Und als mit: »Friede sei mit euch!«
Du grüßtest die voll Sorgen,
Der heil'ge Geist sank nieder gleich
Am frohsten Sonntagsmorgen.«
Wie hier oben gepredigt wird? Kräftig, aber so einfach als möglich. Mit Bildern aus dem Leben, das alle hier kennen.
Er, der Pfarrer, hat gesagt: »Ich kam hier herauf, um den Seelen, – und sei es auch nur einer einzigen, – zu einem Verhältnis zu Gott zu verhelfen. Nicht in erster Linie zu einem Gott; denn einen Gott haben doch die meisten. Aber zu dem lebendigen, zu der unbedingten Gemeinschaft zu ihm.«
Und dieser Gedanke ist der Grundton aller seiner Verkündigung. Wir hören ihn mehreremal predigen, – in der Kirche und bei Versammlungen in seiner Stube, – aber die Erinnerung an das, was er gesagt hat, vereinigt sich gleichsam zu dem einen: »Sie haben doch einen Gott, die meisten Menschen.«
Manche haben ihn freilich nur in der Natur. Da haben sie ihn hingesetzt, um zu regieren und zu leiten. Sie meinen wohl auch, er tue es bisweilen schlecht. Aber sie haben eben keinen andern, dem sie die Leitung übertragen könnten. Und dann halten sie ihn doch außerhalb ihrer Türen.
Andere – die meisten vielleicht – haben ihn in der Kirche. Sie nehmen ihn am Sonntag mit dem Gesangbuch hervor, wickeln ihn mit diesem ein ins Taschentuch, wie einen Verstorbenen, sie schenken ihm ein etwas schweres Gehör und einen schläfrigen Gesang und haben sonst nur wenig mit ihm zu schaffen die ganze Woche hindurch.
Andere haben ihn in ihrem Kummer, in ihrer Not und Gefahr. Da ist er der, der droht. Er erhält einige Klagen, erschrockene Rufe und Gebete und wenig oder gar keinen Dank. Das gibst du wohl auch zu, daß er es war, der »Ola, den Sonnenstrahl dein« genommen hat, oder der, der die Lawine an deinem Hause vorübergehen ließ in jener Frühlingsnacht, als du zu ihm riefst.
Aber, ob du es glaubst, daß er es war, oder ob du meinst, daß es von selber so kam, das macht keinen so großen Unterschied. Denn in all diesem ist kein Verhältnis, kein Verhältnis zu Gott.
Das Verhältnis zu ihm, du, – das ist es, worauf es ankommt.
Das Verhältnis ist da. Du kannst durchaus nicht darum herumkommen. Du bist dazu geboren. Du bist hineingetauft worden… Aber du mußt es selbst aufnehmen, sonst wird es zu einem Nichts für dich. Und nicht nur zu einem Nichts, sondern zu dem, was schlimmer ist, zum Gericht.
Das Verhältnis zu Gott wird auf dieselbe Weise aufgenommen, wie alle persönlichen Lebensverhältnisse – du begibst dich hinein. Nur geht dies tiefer, als das tiefste menschliche Verhältnis, in dem du stehst. Und viel völliger mußt du dich dazu hergeben.
In einem halben Gottesverhältnis kannst du nicht stehen. Denn Gott der Herr selbst hat sich ganz und ohne Vorbehalt in ein Verhältnis zu dir begeben. Da war einer, der sich hier unten zur Welt kommen ließ, sich in Fleisch und Blut kleidete, dir ähnlich wurde, damit du ihn ergreifen könnest, damit er dein werden könnte. Einer, der starb, um seine Gemeinschaft zu dir zu vollenden…
Und ganz will er dich haben, denn er liebt dich. Wäre er nicht die Liebe – auch für dich, dann könnte er sich wohl mit weniger begnügen, mit einem Teil von dir. Aber nun will er kein Atom von dir missen, denn er liebt dich ganz, will dich ganz retten.
Dich selbst – was ist denn das?
Ja, das ist nicht nur deine Überzeugung, wie viele meinen. Es sind nicht nur deine Gedanken, deine Worte, deine Gebete, die Gott verlangt. Es sind nicht deine Sünden, obgleich du sicherlich ihm diese Bürde zu tragen geben mußt! Wer sonst könnte, wer wollte sie tragen? Es ist auch nicht nur deine Liebe, obgleich – wem solltest du sie sonst geben als ihm?
Nein, – dein tiefster Wille ist es, um den es sich handelt. Denn in dem Willen sitzest du selbst. Weißt du das? Ja, du weißt es. Deshalb bist du so langsam, um das Verhältnis in stand zu setzen. Über seinen Willen möchte man selbst herrschen…
Nein, gerade ihn sollst du bringen, ihn übergeben, vollständig und ganz, ohne Vorbehalt, ohne Bedingungen.
Dann bist du selbst in das Verhältnis hineingegeben und kannst es dir ganz zueignen.
Denn, wer sich selbst hat hingegeben,
Erst der erhält das volle Leben.
Der Gottesdienst ist lang. Doch nicht, weil die Predigt es ist, aber es sind mehrere Kinder da, die getauft werden sollen.
Darnach geht der Pfarrer nach Hause, um zu Mittag zu essen, während die Kirchgänger sich in die Häuschen begeben, aus deren Schornsteinen dünne bläuliche Rauchsäulen aufzusteigen beginnen.
Zwischen zwei und drei Uhr kommen die Kinder ins Pfarrhaus. Es kommen sowohl die kleinen, die während des ganzen Gottesdienstes am Morgen ihre Köpfchen an die Schulter der Mutter gedrückt oder in deren Schoß ruhig geschlummert haben, als auch die großen, die in dem Bewußtsein, eine höhere Stufe der Entwicklung erreicht zu haben, mit starren, runden, verständnislosen Augen dagesessen hatten.
Der Pfarrer singt zuerst mit ihnen Liederverse, die sie verstehen können, oder noch öfters kleine Lieder, die er selbst zu bekannten Melodien gedichtet hat. Er gibt genau acht, daß richtig gesungen wird.
Treuherzige, klanglose, aber taktfeste und ganz reine Stimmchen singen in der Pfarrstube:
Den Todesschlaf ein Mägdlein schlief,
Vom Leichentuch behangen,
»Sie ist nicht tot«, der Heiland rief,
»Vom Schlafe nur befangen.«
Den Todesschlaf ein Mägdlein schlief
In fernen Morgenlanden.
»Erwache!« Jesu Stimme rief – –
Und sie ist auferstanden.
Es brach des starren Todes Band,
Sie hob die Augenlider –
Stand auf und ging an Jesu Hand
Gesund und fröhlich wieder.
O Herr, wenn ich einst liege tot
Wie jenes Kind, das bleiche,
So ruf mich aus des Grabes Not
Zu deinem Himmelreiche!
Da löst sich jedes Todesband,
Und während Engel singen,
Wirst du an deiner lieben Hand
Ins Paradies mich bringen!
Und dann erzählt er ihnen von dem kleinen Mädchen, das zwölf Jahre alt war – gerade wie Aslaug und Karen – und das im Sonnenschein umhersprang wie diese auch. Aber dann wurde es krank und starb.
Das können sich die Kinder alle vorstellen. Das eine hatte die »Guri«, das andere den »Per« im Sarg liegen sehen, mit geschlossenen Augen und bleichen starren Gesichtern, die, so oft das Tuch vom Sarg aufgehoben wurde, mit jedem Tag bis zum Begräbnis bleicher und eingefallener geworden waren.
Sie kennen besser als andere, was es heißt, eine Leiche im Hause zu haben, diese Kinder der einsamen, fernen Berge.
Und sie verstehen auch alle, wie lieb man den haben müsse, der den ganzen langen, steilen Weg heraufkommen wollte, der »auf einmal« an der Tür stehen könnte und sagen: »Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft.«
Und der dann hintreten könnte zu dem schwarzen Sarge, der das kalte Händchen in seine Hand nehmen, das rote Blut auf die wachsbleichen Wangen zurückrufen und die kleine zusammengesunkene Gestalt wieder aufrichten könnte, frisch und lebendig, so daß Vater und Mutter nicht mehr weinen würden, so oft sie das Tuch aufheben…
Das ist es auch, was der Pfarrer von ihnen haben möchte. »Das können Kinder verstehen,« sagt er. »Es kommt ihnen ganz natürlich vor… Und damit ist der erste Schritt getan hinein in das Verhältnis, das später ihr ganzes Leben einnehmen soll.«
Die Kinder hängen alle an ihm und freuen sich über die Sonntagsschule bei ihm. Er ist so freundlich gegen sie. Unter den Erwachsenen finden sich allerdings solche, die ihn streng finden, unter den Kindern aber kein einziges. Wenn sie krank werden, verlangen sie immer nach ihm. So war es bei Guri auch gewesen.
Guri, die sonst immer lustig war und wie ein Kätzchen auf den Felsen umhersprang, – aber sich so sehr vor dem Sterben fürchtete, als sie krank wurde – – und dagelegen hatte, und immerfort nach der Tür gestarrt mit großen, vor Angst und Fieber glänzenden Augen, als ob es von dorther kommen müsse, – – sie war ganz ruhig geworden, sobald er nur in die Stube getreten war.
Wenn er an ihrem Bett saß, ihr das Haar zurückstrich und sie fragte, ob sie glauben könne, daß der Eine, der sie am allermeisten liebe – mehr als Vater und Mutter – sie in seinen Arm nehmen werde, so lange ihr so bange vor dem Sterben sei, – da fühlte sie sich ganz sicher und verstand gar nicht mehr, daß sie so große Angst gehabt hatte.
Er war dann auch bei ihr gewesen in ihrer letzten Stunde. Er kam in einem Wetter, so daß man sich bekreuzen mußte, weil er die Fahrt gewagt hatte, um ihre kalten Hände zu halten, bis sie in den seinen erstarrten. –
Wenn die Kinder gegangen sind, bleibt der Pfarrer den ganzen Nachmittag in seiner Stube, um bald den einen, bald den andern der Sonntagsgäste zu empfangen, die ihm mitteilen wollen, wie alles daheim steht, ihn bitten, wenn es ihm möglich sei, einmal zu ihnen zu kommen, um nach einem Kranken, einem Altersschwachen, einer angefochtenen Seele zu sehen – oder auch nur, damit sie ihm von ihren eigenen Zweifeln und Sorgen erzählen könnten.
Am Abend – gegen sechs oder sieben Uhr – versammeln sich dann alle, die noch nicht abgereist sind, in dem Eßzimmer des Pfarrhauses. Da spricht der Pfarrer wieder zu ihnen, betet und singt mit ihnen, während die Kinder draußen auf dem großen Hofplatz spielen dürfen.
Dann gibt es Kaffee, den Kari gekocht hat, und Kuchen – Waffeln, »Arme Ritter« und »Fladen« – die sie im Lauf der Woche gebacken hat.
So hat der Pfarrer es verlangt, obgleich Kari meint, das gehe sehr weit, so viele zu bewirten. Aber er sagt, daß er sich diese Ausgabe erlauben könne, er, der nur für sich selbst zu sorgen habe. Er geht herum und sorgt dafür, daß die Kinder vom Hof hereingerufen werden und auch ihren Teil von den Kuchen bekommen.
Dann begeben sich die Kirchgänger nach dem See hinunter. Und nun muß der Pfarrer müde sein. Aber er sagt, Arbeit ermüde nicht, sie erhalte einen frisch.
Er setzt sich ans Harmonium in seinem Zimmer, dessen Fenster nach dem See hinausgehen. Und während die Boote vom Ufer abstoßen, spielt er ein Lied, in das die Kirchenleute drunten einstimmen. Die Stimmen erheben sich im Chor und vereinigen sich mit der seinigen:
»Wer sind die vor Gottes Throne?
Was ist das für eine Schar?
Träget jeder eine Krone,
Glänzen wie die Sterne klar,
Hallelujah singen all',
Loben Gott mit hohem Schall.«
Ein Boot nach dem andern gleitet hinaus. Über die helle, glänzende Wasserfläche hin tönt es kräftig durch den stillen Abend:
»Es sind die, so wohl gerungen
Für des großen Gottes Ehr',
Haben Welt und Tod bezwungen,
Folgend nicht dem Sünderheer,
Die erlanget in dem Krieg
Durch des Herren Arm den Sieg.«
Allmählich verlieren sich die Stimmen zwischen den Ruderschlägen in der Ferne. Schwächer und schwächer – schließlich hinsterbend – klingt es zu uns herauf:
»Daß mein Teil sei bei den Frommen,
Welche, Herr, dir ähnlich sind,
Und auch ich, der Not entnommen,
Als ein treues Gotteskind,
Dann, genahet zu dem Thron,
Nehme den verheißnen Lohn.«
Viel mehr Ruhe gönnt sich der Pfarrer auch am Werktag nicht.
Eher ist dieser in gewisser Beziehung noch anstrengender für ihn; denn da reist er weit umher.
Sein Boot fährt rasch auf dem Wasser dahin, und sein gelbes Nordlandspferdchen trabt mit ihm über Felsen und Moore. Oftmals kehrt er erst sehr spät in der Nacht zurück. Seine entfernte, weit zerstreute Gemeinde muß er aufsuchen.
An diesen abgelegenen Orten, wo der Bezirksarzt sich nur einmal im Jahr zeigt – in Gesellschaft des Landrichters und des Vogts, die im Hochsommer heraufkommen, um drei Tage lang Thing zu halten und dann wieder aus dem Bereich der Bewohner zu verschwinden, müsse der, der dableibe, für alle zu erreichen sein, sagt er.
Und er muß auch Rat wissen für Seele und Leib zugleich. Denn sie kommen ja zu ihm in allen möglichen Angelegenheiten. Und sie sagen, er habe gewißlich mehr Doktorbücher gelesen, als man zum Praktizieren notwendig habe, und er habe ihnen mit seinem Arzneikasten und seiner Verbandtasche verschiedentlich mehr geholfen, als es irgend ein Arzt hätte tun können.
Es ist unbegreiflich, welchem Wind und welchen Wegen er selbst in der strengen Jahreszeit trotzt, um bei den Menschen herumzukommen.
Oftmals hat man ihm wohlgemeinte Warnungen zukommen lassen, sich doch nicht hinauszuwagen, mit der Begründung, die sonst für entscheidend gilt, daß er sein Leben dabei einbüßen könne.
Hierauf aber antwortet er nur: »Ja, das soll ja eines der Kennzeichen eines rechten Hirten sein; nach der Bibel wenigstens.«
Ein Pfarrer, der nur der Vollstrecker der gottesdienstlichen Zeremonien sei, werde seiner Meinung nach »ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.«
Der Beruf umfasse viel mehr, sagt er. Die Seelsorge sei der wichtigste Teil. Die Seelen müßten aufgesucht werden.
Jeder Mensch habe doch seine Seele; auch hier oben. Tief versteckt könne sie sein – und manchmal an den schlechtesten Orten. Der eine könne sie in seinem alten, schmierigen, ledernen Geldbeutel haben, – der andere in der Flasche. Und selbst viele von den Christen, denen die Glocken zur Kirche läuteten, schienen eine merkwürdige Übung darin zu haben, ihre Seelen während des Gottesdienstes fern zu halten.
»Aber irgendwo ist sie,« sagt der Pfarrer, »und wer jahraus jahrein in die Häuser kommt, wird sie schließlich auch finden, – ohne zu fragen. Denn niemals soll man sich einer Seele durch Fragen nähern wollen. Wer fragt, wird gar leicht von Neugierde oder von der Tadelsucht getrieben, vor denen der Mensch ganz natürlicherweise die Tür verschließt. Wer von wirklicher Liebe getrieben wird, wird es verstehen, sich zu einer Seele hindurchzufühlen, die sich im tiefsten Innern immer darnach sehnt, gefunden zu werden.«
Und so sitzt der Pfarrer jenseits des Wassers bei Peter Fossegaarden, dessen ganzer Stolz seine Schweine sind, und ist sich ganz klar darüber, daß nie ein Schinken so gut schmeckt, als gerade hier. Oder er klettert zu Jens Bakken hinauf, der ein Holzschneider ist, und will genau wissen, wie man das macht. Nicht um die Kunst von ihm zu erlernen, tut es der Pfarrer, sondern um die Arbeit zu verstehen und wertschätzen zu können. Oder er sitzt bei Karen, die zweimal im Jahr Fladenbrot im Pfarrhaus backt, und will dem Backen zusehen, – oder bei der alten Gunhild, die halbblind ist, aber noch immer seine Socken strickt, und sagt zu ihr, er könne sich gar nicht denken, daß sie nicht hundert Jahre alt werde, denn es könne niemals jemand so für ihn stricken wie sie.
Und der Pfarrer meint, was er sagt. Er hat ein menschliches Interesse für alle menschliche Arbeit im großen wie im kleinen.
Aber gleichzeitig sucht er nach der Stelle, wo ein Zugang zur Seele ist, wo diese ihre scheuen und oft so hilflosen Augen zu ihm aufschlägt, – um sich ihrer mit warmer und fester Freundeshand anzunehmen.
In der strengsten Jahreszeit gibt es Wochen und Monate, wo der Pfarrer gezwungen ist, daheim zu bleiben. Den langen, langen schneeweißen Winter hindurch – wie vertreibt er sich da die Zeit? Wenn die Lampe um zwei oder drei Uhr angezündet wird, – und bei trübem Wetter brennt sie fast den ganzen Tag hindurch, – womit füllt er da die Einsamkeit all der nächtlichen Stunden aus? Ja, da spielt er Harmonium, er liest, – oder er denkt…
Er hat alle seine Bücher mit heraufgebracht, und seine Briefe und Zeitungen holt er sich alle acht Tage, wenn das Wetter es erlaubt, in der kleinen Poststation, die drüben über dem See, hinter der Landzunge gegen Westen verborgen liegt. Volle zwölf Tage braucht die Post, um von Trondhjem heraufzugelangen, so viele Seitensprünge hat sie zu machen.
Seine Reisen nach den Filialen unternimmt er auch im Winter so regelmäßig wie möglich; einmal im Monat nach Sörli und dreimal im Jahr nach der Tunsjöer Kapelle, – über Felsen und Seen und Moore, – wie es am besten vorwärts geht, denn zu keinem der genannten Orte führt eine Straße. Es kommt vor, daß er auf halbem Wege wieder umkehren oder im voraus schon die Reise aufgeben muß; aber da muß es schon sehr schlimm sein.
In der Zeit von Weihnachten bis Ostern gibt er den Konfirmanden Unterricht. Diese kommen ins Pfarrhaus, – nicht auf zwei Stunden, sondern gleich auf vierzehn Tage, und da gibt er ihnen jeden Morgen Unterricht. Die meisten von ihnen werden bei Kari einquartiert, und die, die das Pächterhaus nicht aufnehmen kann, übernachten in der Küsterwohnung, von wo sie aber durch die Schneemassen hindurch nicht immer bis zum Pfarrhaus gelangen können.
So geht das Leben seinen Gang, – einen Winter nach dem andern in der aufreibenden Einförmigkeit, die so endlos zu durchleben sein kann, und die doch so merkwürdig kurz ist, wenn man darauf zurückschaut, weil die Jahre in einander fließen, lautlos und ohne Farbe, wie lauter Stunden einer einzigen Nachtwache.
Noch eins hat er, um die langen, einsamen Tage auszufüllen. Er schreibt. Er begann nicht gleich damit; denn er wollte sich zuerst ganz in seinen Beruf hier oben einleben. Der Beruf sollte ihn ungeteilt haben.
Aber in den zweiten fünf Jahren, – nachdem er gleichsam alle in seine Gedanken und in sein Herz aufgenommen hatte, – da begann er die Bücher zu schreiben, die den »Hochlandspfarrer« – dieses Pseudonym hatte er gewählt – zu einem wohlbekannten Gast in vielen Heimstätten machte.
Dann entstand auch sein größtes Werk, die »Briefe an die eine Seele«, das in Heften herauskam, die beständig vermehrt wurden, bis es einen Brief für jeden Tag im Jahre gab.
Es waren längere oder ganz kurze Briefe, immer mit einer Bibelstelle als Ausgangspunkt, und alle mit dem einen Zweck: zu ziehen, zu locken, zu nötigen – könnte man wohl sagen – die eine Seele in ein Verhältnis zu Gott hinein, hin auf den Weg zur Vollendung…
Er hat gleichsam die Bedenken und Einwendungen dieser Seele erlauscht, hat ihre Zweifel, ihren Widerstand erraten und gefühlt, welche Saiten den tiefsten Widerhall bei ihr erwecken würden.
Er schneidet die Nebenwege ab, versperrt den Rückzug, hält aber bisweilen in einer ganz friedlichen Betrachtung plötzlich still, wie um der Seele Ruhe zu gönnen – eine Ruhepause.
Er ist wie ein Führer im Gebirge, der mit einem andern an der Hand hinaufsteigt, und der zwar den Gipfel, der erreicht werden soll, nicht niedriger machen kann, aber die Schwierigkeiten des Aufstiegs zu erleichtern und zu überwinden sucht.
Dies ist der Ton, der durch seine Verkündigung geht, nur ist er gleichsam noch persönlicher.
»Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen!« Matth. 22, 37.
Die Hand aufs Herz – tust du das?
Nein, wirst du sagen, dein Herz sei zu arm, leer und kalt. Das ist wohl wahr, aber das gilt hier nicht als Entschuldigung. Denn es wird darnach gefragt, ob du so liebest, wie dein Herz es vermag, sonst nach nichts.
Und kann denn dein Herz gar nicht lieben? Gibt es nicht den oder jenen, – deinen Nächsten – den es umfaßt, feurig stark, den es fester hält als selbst das Leben? Doch, es gibt jemand… Das läßt du dir nicht nehmen.
Ist es denn dann so, daß dein irdisches Herz nur abwärts lieben kann – zur Erde, auf der Erde – nicht aufwärts? Ja, so ist es wohl. So war es mit mir, das habe ich in einer Nacht herausgebracht.
Dann ist es ja hoffnungslos, das große Gebot zu erfüllen. Ja, du selbst kannst kein Gefühl in deinem Herzen hervorbringen. Aber die Liebe, die du zu einem andern hast, die kannst du hinaufreichen. Das Herz, das einen andern umfaßt, das kannst du in die Hände geben, die das erste Recht daran haben.
Du wirst einwenden, das hieße das Gebot umgehen. Nein, das heißt zu ihm aufsteigen.
» Sursum corda« – die Herzen in die Höhe! – hat es seit den ältesten Zeiten in der Kirche geklungen.
Und die Gemeinde antwortet: » Habemus ad Dominum« – wir erheben sie zum Herrn.
Wenn du dein Herz hinaufgibst mit der großen Liebe, von der es erfüllt ist, dann wirst du das erreichen, was dein tiefstes, unaussprechliches Geheimnis werden wird – das, daß deine Liebe verwandelt wird.
»Wer zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater und seine Mutter und sein Weib und seine Kinder und dazu auch sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein.« Luk. 14, 26.
Ich nehme das stärkste Wort, das ich finden kann, und erkläre es nicht. Ich lasse es dich so buchstäblich verstehen, wie – es nicht einmal verstanden werden soll.
Und ich behaupte, das Wort, das bei denen, die draußen stehen, Anstoß erregt und von vielen Christen übersprungen wird, das ist eins von denen, die dich am stärksten ergreifen, denn niemals wirst du dich mit einem Verhältnis zu Gott begnügen, das nicht unbedingt ist.
In der irdischen Liebe würden es die meisten nicht können. Das wird ohne Einwendung begriffen, und je mehr man liebt, desto mehr will man das andere besitzen, ganz und ungeteilt.
Aber die Forderung, die die Menschen ganz von selbst an einander stellen, – an der nehmen sie Anstoß, sobald sie von oben kommt.
So sei es nicht bei dir. Wo du dich hingeben sollst – auch seelisch –, wirst du verlangt werden, ganz und ungeteilt.
Denn du wirst begreifen, daß, wer alles zu verlangen wagt, auch alles zu geben hat.
»Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser.« Matth. 14, 29.
Aber es war nicht das Wasser, das ihn trug. Auf Wogen kann man nicht treten. Trotzdem – die Menschen sind nicht von dieser Einbildung wegzubringen. Hast du sie nicht auch geteilt?
Was anderes hat die Welt dir wohl geboten, um darauf zu treten – was anderes als Wogen? Was anderes hat dein eigenes schwankendes, kraftloses Herz dir geboten? Und auch du hast wie die andern gedacht, daß sie dich tragen würden. Ist es nicht so?
Petrus ging im Glauben vorwärts. Der Glaube ist Felsengrund unter den Füßen; der einzige, der sich findet. Als er diesen verläßt, da »beginnt er zu sinken«. Denn es gibt nur das eine von diesen beiden; entweder du lebst im Glauben – dann stehst du auf Felsengrund, – oder dein Leben ist ein fortgesetztes Hinausgleiten in die Wogen, – die dir schließlich über dem Kopf zusammenschlagen.
Aber merk dir eines: es sieht aus, als sei es gerade umgekehrt; als ob dieses »im Glauben Vorwärtsgehen« so viel sei, als ein Loslassen des Festen und Sicheren, ein Hinaustreten aus dem Schiff – und mit geschlossenen Augen den Sprung wagen in die unendliche Tiefe.
So wird es immer gefühlt werden, und aus diesem Gefühl heraus muß es getan werden.
Aber in Wirklichkeit setzt man da erst seinen Fuß auf den Felsen, den das Weltmeer nicht erschüttern kann und den die schwarzen, trüben Wasser des Todes nicht zu überfluten vermögen.
»Die, so in den Schranken laufen, die laufen alle, aber einer erlanget das Kleinod.« 1 Kor. 9, 24.
Der eine, der das Kleinod erhält, der sollst du sein.
Ja, wirst du sagen – aber die andern dann? Ist es nicht schrecklich, daß ich auf ihre Kosten gewinnen soll?
Mein Freund, – laß dich dadurch nicht aufhalten.
In der Sache deiner Seligkeit handelt es sich niemals um einen Wettlauf mit andern. Ihr seid nur zu zwei auf der Bahn, du und noch einer, den du ganz genau kennst, nämlich dein »alter Mensch«, – wie wir ihn zu nennen gelehrt worden sind.
Der Einsatz ist das Leben; nur einer gewinnt es. Der andere muß sterben… Von diesen beiden lebt immer einer auf Kosten des anderen.
Und dein alter Mensch läuft furchtbar schnell. Er gönnt sich Tag und Nacht keine Ruhe.
Läufst du so, daß du gewinnen kannst? O stehe eines Tages da – der andere sterbend zu deinen Füßen – mit dem Kleinod in der Hand!
Merkwürdig ist es – doch mit der einen Seele, die er noch immer sucht, für die er noch immer arbeitet, um sie in das Geheimnis der Gemeinschaft mit Gott hineinzuführen! War sie denn hier oben nicht zu finden? Es scheint fast unmöglich, daß von einer so eifrigen, so aufopfernden Wirksamkeit keine Früchte nachzuweisen sein sollten!
Doch darüber erfahren wir nichts, wenigstens nichts von ihm selbst. Und die andern Leute wohnen zu zerstreut, um sie fragen zu können. Nur das sehen wir allerdings, daß die Leute in verhältnismäßig großen Scharen zur Kirche kommen und daß sie den Pfarrer zu ihren Kranken und Sterbenden holen lassen, sobald die Verhältnisse es nur erlauben.
Aber die eine Seele ist vielleicht noch weiter entfernt als nur »jenseits der drei Wasser«, weiter entfernt als hinter dem endlosen Moor –, tief drunten in der Welt, die so merkwürdig fern liegt.
Hat er wohl jemand da drunten, den er rufen möchte?
Da ist ein Punkt, über den wir gern etwas wissen möchten. Der Pfarrer ist in all' den Jahren, seit er hier herauf zog, nie wieder drunten gewesen. Und schon ehe wir ins Pfarrhaus kamen, hörten wir, daß er sich nach einer großen und bitteren Enttäuschung, die er erlebt hatte, für alle Zeiten von der Welt losgesagt habe.
Kari weiß etwas davon, daß es ein »Weltkind« gewesen war, das einmal seine Netze ausgeworfen hatte, um ihn zu fangen, und daß es ihm – dem Weltkind – eigentlich auch geglückt war, daß es ihn dann aber selbst wieder verlassen hatte. Wie die Sache aber eigentlich zusammenhängt, das kann sie uns doch nicht sagen. Sie hat nur so viel verstanden, daß es gut war, »daß er sie los wurde.«
Sigrid freilich, die könnte mehr davon erzählen, wenn sie nur wollte.
Sigrid ist die älteste der Pächterstöchter, die, sobald sie halb erwachsen war, die Bedienung des Pfarrers besorgt hatte. Es war ihm lieb, ihre sanftmütige Erscheinung um sich zu haben, sie kommen und gehen zu sehen mit ihren langen, hellen flachsblonden Zöpfen, ihrem kindlich runden Gesicht und den blauen, schwermütigen Augen, deren Ausdruck in so merkwürdigem Gegensatz mit ihrem taghellen Farbenglanz stand.
Sigrid erriet, wie er es in allem haben wollte. Sie fühlte es gleichsam an sich selbst, wenn er müde oder betrübt war, wenn er allein sein wollte, oder wenn sie kommen durfte. Und sie fragte nie. Deshalb sprach er auch mit ihr mehr, als mit irgend einer der andern.
Dann kam der neue ganz junge Kantor herauf.
Er stammte aus der Gegend und hatte als Kind mit Sigrid gespielt, wenn er Sonntags mit seinen Eltern zur Kirche kam. Er hatte sie schon damals lieb gehabt, das wortkarge Mädchen mit den aschblonden Zöpfen und den schüchternen, niedergeschlagenen Augen. Und nun mußte er ja baldigst eine Frau haben, die seine einsame kleine Kantorwohnung mit ihm teilen sollte, – dort droben auf dem Gipfel des Tannenhügels, etwas rechts vom Pfarrhof.
Als die Eltern Sigrid fragten, ob sie ihn »möge«, antwortete sie, daß sie es nicht recht wisse. Und dies war ja so vielversprechend, daß man gut sogleich mit den Vorbereitungen zur Hochzeit beginnen konnte.
Der Pfarrer wollte Sigrid nur ungern verlieren und sie durch Gudveig ersetzt haben, die zwar ganz dasselbe Gesicht und Haar wie die Schwester hatte, sich aber immer mit Geräusch anmeldete und so froh und gleichgültig aus ihren blauen Augen schaute. Er meinte auch, Sigrid sei zu gut für den kleinen, redseligen Kantor.
Aber als ihm Kari zu verstehen gab, daß es für Sigrid selbst am besten wäre, wenn sie wo anders hinkäme, da sprach er mit dieser nur noch davon, wie gut sie es in dem hübschen, kleinen Häuschen bekommen werde.
Aber Sigrid weinte viel, als sie dorthin gekommen war. Sie sehe auch immer nach dem Pfarrhof, sagte ihr Mann, der glaubte, sie habe Heimweh nach den Eltern. Und des Nachts, wenn es schlecht Wetter war, dann liege sie mit großen, offenen Augen da – wie jemand, der hinaushorcht. Oder sie fahre vom Schlaf auf und frage, ob das des Pfarrers Tür sei, die aufgemacht werde, und ob er wieder heimgekommen sei. – Aber viele haben es ja auch so in der Zeit.
Jetzt im Frühling bekam sie ein Kind, ein kleines »helles Mägdlein«, mit dem sie sich abgeben konnte. Und da kam sie zur Ruhe im Küsterhaus.
Sigrid wußte wahrscheinlich mehr als irgend sonst jemand von den Ereignissen aus des Pfarrers Jugend.
Und einmal hatte sie ein Bild gesehen – von einer, die »so schön, so wunderschön« gewesen war, daß es einem mitten durchs Herz ging.
Aber Sigrid ist ja nun nicht mehr daheim. Und die wenigen Male, wo wir sie in die Kirche oder auf einen kleinen Besuch zu den Eltern kommen sehen, die hellen, schwermütigen Augen unbeweglich niedergeschlagen, da bekommen wir den Eindruck, daß sie zu denen gehört, wo es gar nichts nützt, wenn man fragt.
Außer uns ist zur Zeit noch eine Schwester des Pfarrers in der Pächterwohnung. Sie ist eine schöne, feine Gestalt, einige Jahre älter als er, die bei ihm wohnte, ehe er hier herauf zog, wohin sie ihm aus Gesundheitsrücksichten nicht folgen konnte. Nur während der heißesten Sommerzeit besucht sie ihn auf einige Monate.
Auf ihre gebildete Weise ist sie ganz ebenso verschlossen wie die blonde Sigrid. Als sie daher eines Tages ganz leicht den Punkt berührte, der uns interessiert, geschah es nur, weil es ihr sehr schwer wird, über das ganz zu schweigen, wodurch die Hochachtung vor dem Bruder bei andern vermehrt werden könnte, was ihre größte, vielleicht ihre einzige Schwäche ist.
Eines Morgens führt sie uns nach dem »Tal Josaphat«, wie der Pfarrer eine breite Felsenschlucht tief im Walde genannt hat, wo die Sonne so warm und golden eingefangen wird, daß wie ein leuchtender Abglanz der Sonne selbst eine wirre und farbenprächtige Blumenfülle – gelb, weiß, lila, rot, besonders rot – auf langen wogenden Stielen aus der Erde hervorbricht. Tief unten rieselt ein klares Bächlein, das leise mit sich selber plaudert, so daß man dessen Dasein ganz vergessen kann, – bis man plötzlich mit dem Fuß hineintritt.
Hier nun sagt sie mit einer Anspielung auf jenes Jugenderlebnis des Pfarrers: »Ich schaue in diesem Punkt zu meinem Bruder auf. Niemand von uns rührt je daran – selbstverständlich. Seit er hier herauf gezogen ist, hat er nur ein einziges Mal darauf angespielt. Damals sagte er: ›Ich bin dieser Person großen Dank schuldig. Niemals wäre ich ›alles für alle‹ geworden, wenn ich nicht mit einem Schlag von jeder Rücksicht auf mich selbst freigeworden wäre – von all meinem Eigenen!‹ – Und das ist sicher, ein dauerndes Verhältnis zu dieser Person, über die ich mir kein Urteil erlaube, hätte dem Leben, das sich über sich selbst ganz zu Gott erhebt und in das er jetzt so tief eingedrungen ist, den Weg versperrt.
Aber ihr gar zu danken, dahin können wir andern nicht gelangen! Was damals war, vor dreizehn Jahren, möchte ich am liebsten ganz aus meiner Erinnerung auslöschen.« –
Sie ist ein ausgezeichnetes Wesen, die Schwester des Pfarrers. Wir zweifeln nicht daran, daß sie richtig sieht.
Und doch – – an sie, die »so wunderschön war, daß es einem mitten durchs Herz geht,« und von der los zu kommen ein Glück für ihn war, – – wir können es nicht lassen, wir müssen viel an sie denken.
Die Pächtersfrau vertraut uns an demselben Tag an, daß sie, Alette, diesmal nicht so lange hier bleiben werde wie sonst, sondern bald nachdem wir abgereist seien, auch wieder südwärts ziehe. Sie wird nämlich heiraten, – sie! Einen ausgezeichneten Pfarrer in Christiania, der einmal Missionar und mit einer Freundin von ihr verheiratet gewesen war. Er hat ein paar erwachsene Kinder und einige unerwachsene dazu, so daß sie eine schöne und ernste Aufgabe bekommt. Sie kam hierher, um mit dem Pfarrer darüber zu reden. Und er freut sich nur darüber.
Sie will durchaus, er soll im August hinunterkommen und sie trauen – er soll der sein, der ihr neues Leben einsegnet – und sich dann zugleich nach einer Stelle da drunten umsehen. Auf das erste hat er noch nicht bestimmt geantwortet, aber zum zweiten sagt er, – wie immer, wenn jemand wünscht, daß er sich wegmelde –: »Ich muß zuerst hier fertig sein.«
Wir begreifen nicht recht, woher Kari all dies weiß. Wahrscheinlich gibt es hier im Winter so wenig zu hören, daß sie im Sommer ihre Ohren doppelt gebrauchen muß.
Unser kurzer Aufenthalt ist bald zu Ende. Der letzte Abend ist gekommen.
Nach Sonnenuntergang ist es immer kühl hier oben. Wenn der glühende Sonnenball versunken ist, und ein Silberglanz vom Wasser aufsteigt, da überkommt einen selbst in der heißen Jahreszeit ein eigenes Kältegefühl.
Am letzten Abend, den wir hier zubringen, wo es auch schon den Tag über kühl gewesen ist, sinkt die Temperatur auf einen solch niederen Grad der Sommerwärme herab, daß der Pfarrer uns vorschlägt, auf der Feuerstelle in seinem Zimmer ein Feuer anzuzünden.
Kari trägt trockenes Brennmaterial herbei, Tannenzweige und Tannenzapfen. Und bald knistern und sprühen die Feuerflammen ermunternd und erwärmend in dem offenen Kamin.
Die Studierstube ist uns am liebsten. Hier sind die meisten seiner eigenen Sachen, die sich in dem flackernden Schein des Feuers ganz märchenhaft ausnehmen.
Ein goldener Schimmer spielt auf den weißlichen Renntierfellen des Sofas. Und das große Bild über dem Schreibtisch, die Madonna von Murillo aus dem Palazzo Pitti, strahlt in so warmem Glanz, als ob das junge lebendige Gesicht wirklich aus Fleisch und Blut wäre.
Das große Kruzifix in der Ecke über dem Harmonium ist nicht beleuchtet. Aber auf dem Bild, das darunter hängt, – das Abendmahl in Emmaus von Tizian, – liegt eine Glut, wie von dem Sonnenuntergang des Ostertags selbst.
Nicht weit von diesem Bild entfernt, geht Napoleon mit erhobenem Banner über die Brücke von Arcole. Glühender Eifer flammt in seinen bleichen Wangen auf.
Und plötzlich fällt es uns auf, daß der Pfarrer, wie er dasitzt und das Feuer schürt, diesem Bilde gleicht, – mit dem wallenden schwarzen Haar, dem feingeschnittenen Gesicht und dem Ernst, der mit dem Feuer verwandt ist, in seinen dunklen Augen.
Die Schwester des Pfarrers steht am Tisch, legt kleine Kuchen auf einen Teller und bereitet zur Feier des Abends Glühwein.
Wir hätten nicht gedacht, daß der Pfarrer Wein trinken würde. Es geschieht auch nur sehr selten, aber er hat nichts dagegen, daß seinen Gästen Wein angeboten wird.
So oft neue Tannenzweige auf das Feuer geworfen werden, zischt und knistert es am stärksten, die Flammen schlagen hoch auf, und die roten Tannennadeln fliegen wie glühende Leuchtkäfer umher.
Eines von uns verwundert sich darüber, daß der Pfarrer so wenig von den Früchten seiner Arbeit zu erzählen wisse.
Das könnte er leichter als sonst einer, sagte die Schwester vom Tisch her.
Er aber erwidert: »Ich bin hier, um die Seelen zu rufen, nicht aber, um ihre Bekehrung festzustellen. Außerdem – sein Verhältnis zu Gott, das ist immer eines Menschen tiefstes Geheimnis. – Es hat auch seine äußeren Seiten, selbstverständlich muß es sie haben, wie jedes persönliche Verhältnis. Es gibt Tatsachen, auf die man deuten kann. Aber das ist nicht die Hauptsache. Ob die volle Hingabe stattgefunden hat, im tiefsten Innern, das weiß nur der eine, der in die Seele hineinsieht.«
Er schaut eine Weile schweigend in die Flammen. Dann sagt er: »Ich habe mich oft selbst hier oben beschämt gefühlt. Wie treuherzig und einfältig können diese Menschen in ihrem Gedankengang sein. Wie z. B. Guttorm, weißt du?«
»Der mit dem Haus?« fragt die Schwester.
»Ja, der mit seinem Haus, das er nie ›vergoldet‹ und fein genug bekommen konnte. Zu dessen Ausschmückung er jede freie Stunde verwandte, schnitzte, malte, firnißte, und das er sein Kind nannte. Nur still dasitzen und sich in der Stube umsehen, eine größere Freude kannte er nicht. Und oft kam es vor, daß er gerade am Sonntag die Gicht in seinem Bein spürte, so daß er zu Hause bleiben mußte, – und sich dann nur den alten Knud holte, um ihm zu zeigen, was es seit dem letztenmal Neues in der Stube gab. Ich sagte zu ihm: ›Hüte dich, Guttorm, daß du dein Herz nicht zu sehr an dein Haus hängst, du kommst doch nicht wie eine Schnecke mit ihm auf dem Rücken in den Himmel hinein!‹ Er aber lachte und sagte, da sei keine Gefahr.
Dann mußte er einmal ins Gebirge mit seiner Frau. Sie waren zwei bis drei Tage abwesend. Und als er den großen Schlüssel im Schloß umdrehte, betete er: ›Herr, mein Gott, beschütze mein Haus, so lange ich weg bin.‹
Als er zurückkam, hatte der Blitz hineingeschlagen, und es war bis auf den Grund niedergebrannt.
Eine Weile betrachtete er schweigend die schwarze rauchende Brandstätte. Die Frau jammerte und weinte, aber Guttorm faltete seine Hände und betete: ›Mein Herr, ich danke dir. Ich sehe, daß du mich selbst beschützt hast.‹
Ja, könnten wir wohl sprechen wie er? Sogleich, in demselben Augenblick, wo wir das verloren hätten, woran unser Herz am meisten hing?«
»Niemals wäre er so weit gekommen, so sprechen zu können, wenn du nicht mit ihm geredet hättest – so oft und so viel,« sagt die Schwester.
Aber der Pfarrer hört nicht darauf. Schweigend, wie in tiefe Gedanken versunken, starrt er in die Flammen. Dann sagt er, ein wenig zögernd: »Bisweilen habe ich gedacht, wenn sich hier oben nur ein einziger Mensch fände, der sein Verhältnis zu Gott verwirklicht hätte, – einer, der sich darnach gesehnt hatte, es zu verwirklichen, weil er wußte, wie mangelhaft dies Verhältnis – in Wirklichkeit gewesen war – – – Aber das wäre dann jedenfalls nicht mein Tun.«
Er wirft wieder ein Bündel Tannenzweige auf die Glut. Es knistert und flammt, und eine Feuergarbe von roten Leuchtkäfern schwirrt sprühend auf. Unten, zwischen den großen Holzscheitern, liegen ein paar Tannenzapfen, die mit ruhigen blauen Flammen brennen.
Dann bittet eines der Anwesenden den Pfarrer um ein Märchen; denn das gehöre dazu. »Am liebsten eine Spukgeschichte,« ist ein anderes so keck, hinzuzufügen.
Seine Schwester schüttelt den Kopf. »Das kann mein Bruder nicht. Er hat an anderes zu denken gehabt.«
Aber der Pfarrer antwortet: »Warum denn nicht? Vielleicht könnte ich etwas erzählen, was einem hier passiert ist, hier oben. Wenn ich den Namen nicht nenne…«
Er schaut eine Weile in die Flammen; dann erzählt er: »Ein Bursche ging am Moor entlang, als es von Multeblüten ganz weiß war. Während er so dahin ging, sah er jemand auf dem Moor stehen. Es kam ihm vor, als sei es Ingrid Koppen. Sie pflückte Blumen.
Er rief ihr zu, warum sie denn die Blumen pflücke; dann gebe es ja weniger Multebeeren. Ob sie denn daran nicht gedacht habe?
Da trat sie zu ihm und reichte ihm die Blüten über einen schmalen Bach hinüber, der sie vom Wege trennte.
Lachend nahm er sie. –
Am nächsten Abend überkam es ihn aufs neue, so daß er wieder den Fußpfad dem Moor entlang gehen mußte.
Da draußen war ein Mädchen und pflückte weiße Multeblüten. Sie trat so leicht auf, daß ihre Fußspitzen nie einsanken. Marta Sandvigen war es, so viel er sehen konnte.
Er rief ihr zu, und sie trat näher und reichte ihm die Blumen.
Aber zugleich ergriff er ihre Hand.
Da blieb sie ganz ruhig stehen. Sie war ihm so nahe, daß er sich über das kleine Rinnsal hinüberbeugen und sie küssen konnte.
Sie sah ihn nur an, und da küßte er sie noch einmal.
Der nächste Tag war ein Sonntag. Er begleitete seine Mutter, die blind war, in die Kirche. Er gab aber nicht acht darauf, daß sie sich an den Steinen des Wegs stieß. Er hörte auch nichts von den heiligen Worten, sondern sah nur immer ein Meer von Multeblüten, das im Winde wogte. – Und ein Mädchen, das mitten darin stand –
Am Abend, als er hinauskam, war sie wieder da. Sie – nein, der Name fiel ihm nur nicht ein. Sie war wie alle andern, sie, und auch wie sonst niemand.
Sie stand dicht am Wege und reichte ihm die Hand über das Bächlein.
Mit einem Sprung setzte er hinüber, schlang die Arme um sie und küßte sie. Sie sah ihn nur an, und er hielt sie fest.
Da begann sie, ihn in das Moor hineinzuziehen.
›Wohnst du dort drüben?‹ fragte er und deutete darüber hin. Sie aber nickte nur.
Da begann der Grund unter ihm zu wanken. Er sah sich um und merkte, daß es gerade auf die grundlose Stelle zuging, wo die Kuh im vorigen Jahr versunken war; da rief er: ›Wir müssen zurück! Komm, komm!‹
Sie aber schüttelte den Kopf, als wolle sie sagen: ›Ich kann nicht,‹ und bannte ihm die Augen mit ihrem Blick.
Er sank bis an die Kniee ein. Aber ihm war, als seien es ihre Augen, die ihn zogen, diese Augen, in die er nun wohl versank.
›Im Namen Gottes!‹ schrie er dann.
Er wußte später nie, wie er frei geworden war. Aber als er wieder auf dem Weg stand und auf das Moor hinausschaute, da war niemand mehr zwischen den weißen Blumen.
Jedermann sagte, das sei die Waldnymphe gewesen, die ihn verlockt habe, und es sei gut, daß er losgekommen.
Aber er fand keine Ruhe dabei. Er erinnerte sich wohl, daß sie ihn beinahe in den Sumpf hineingezogen hätte. Und es war ihm doch, als sei es eine gewesen, wie er – ein Menschenkind, wie er auch…
Und er konnte den Gedanken nicht mehr los werden: Ob sie wohl dort versunken war? Es war ihm, als fühle er an sich selbst, wie sie da draußen sank und sank. Dann mußte er zum Moor hinaus, wieder und wieder. Und dann rief er sie mit allen Namen, die er kannte.
Er dachte: Einmal finde ich wohl den richtigen. Dann kommt sie. Und dann ziehe ich sie zu mir herüber. Herüber auf den festen Weg.
Und – ja, er steht wohl noch dort und ruft…«
Die Wanduhr schlägt zehn Uhr. Der Pfarrer steht plötzlich auf und sagt, es sei hohe Zeit für uns, zu Bett zu gehen, für uns, die wir morgen in aller Frühe aufbrechen müßten.
Dann setzt er sich ans Harmonium und stimmt ein Abendlied an:
»Die Sonne sinkt am Himmelsrand, –
Ich sehn' mich nach dem Morgenland,
Dem keine Nacht zu eigen,
Wo frei von Erdenleid und -lust
Sein Haupt an Gottes eigne Brust
Darf der Erlöste neigen.
Nun sinkt die Nacht auf Flur und Au'n,
Ich sehne mich nach Edens Gau'n,
Wo keine Stürme brausen,
Wo in dem tausendfält'gen Tag
Dem eignen Herzschlag Gottes mag
Still der Erlöste lauschen…«
Wir nehmen Abschied vom Pfarrer an der offenen Feuerstätte, deren leuchtende Flammen nun zu einer glimmenden Glut zusammengesunken sind, die uns von der Asche wie mit roten Augen anstarrt.
Der Pfarrer sagt, er wolle für uns wachen, bis der letzte Funken erloschen sei. Und wir verlassen ihn da, wo er alle die roten Augen bewacht, die sich schließen – eins nach dem andern.
Denkt er vielleicht an die Seelen hier oben zwischen den fernen Bergen, an die zerstreuten Funken, die er gerne zu einem flammenden Feuer vereinigen würde? Oder geht sein Gedanke vielleicht noch immer zurück zu dem, was gewesen, – vor dreizehn Jahren?