
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
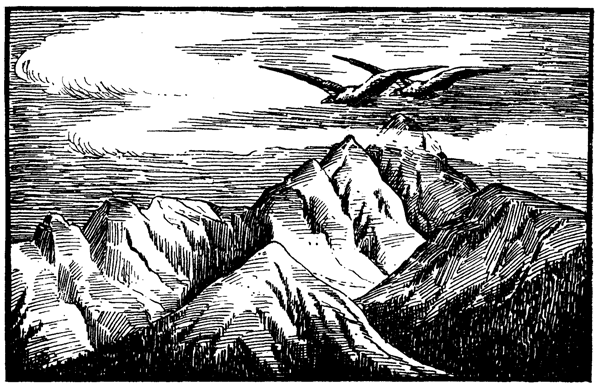
Im Winter vor dreizehn Jahren gab es in Christiania zwei Menschen, die in einem bestimmten Kreis die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich zogen; eine blendende junge Dame aus Kopenhagen und einen asketischen norwegischen Pfarrer, dessen kräftige, begeisterte Verkündigung entweder anzog oder Ärgernis erregte.
Sie war noch in der ersten Hälfte der Zwanziger, elegant, lebhaft und begabt, – die Bühne sei ihr heimlicher Wunsch gewesen, hieß es – unabhängig und reich. Ihren Vater hatte sie als ganz kleines Kind verloren, ihre Mutter vor etwa einem Jahre. Sie hatte seither in der großen Wohnung weitergelebt, mit einem Bruder zusammen, der eine gute juristische Stellung hatte, aber verlobt war; also konnte das Zusammenleben kein dauerndes sein.
Nach Verfluß des Trauerjahres, im Oktober, war sie auf den Vorschlag der aus Dänemark stammenden Frau Konsul Hallager, ihrer Tante väterlicherseits, eingegangen, nämlich nach Christiania zu kommen und den Winter in deren schönem Heim am Drammensweg zuzubringen. Die Kopenhagener Geselligkeit kannte sie ja auswendig, nun wollte sie es einmal mit der norwegischen versuchen.
»Dann werden wir sie schon hier oben verheiraten,« sagte die Tante. »Und das wäre auch in jeder Beziehung die passendste Lösung.«
Er war erst wenig über dreißig, war ein angehender Schriftsteller in freigeistiger Richtung gewesen, hatte aber, wie es hieß, durch den plötzlichen Tod seines besten Freundes mit seiner ganzen früheren Lebensanschauung gebrochen.
Damals hatte er sich dann auf die Theologie geworfen und war nun als Pfarrer mit einem flammenden Eifer aufgetreten, mit dem zweischneidigen Schwert des Wortes, bereit zum Angriff und zur Verteidigung. Bis jetzt war er noch dritter Geistlicher an seiner Kirche, füllte diese aber, so oft er predigte, das ganze Jahr hindurch mehr als seine Oberen.
Die Frau Konsul empfing ihre Nichte, die sie ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatte, mit überströmender Zärtlichkeit.
»Laß mich sehen, ob du noch immer so reizend bist? Ja, wahrhaftig, du hast dich gar nicht verändert!« sagte sie, noch ehe das junge Mädchen aus dem Eisenbahnwagen gestiegen war. »Dann komm und gib deiner alten Tante einen Kuß!«
Reizend konnte sie schon genannt werden – wenigstens in gewissen Augenblicken – viel eher als eigentlich vollendet schön. Sie wirkte wie Sonnenschein. Und die Leute wurden von ihren glänzenden Augen, ihren weißen Zähnen, ihrer blendend schönen Gesichtsfarbe und besonders von dem Ausdruck übersprudelnden Lebens hingerissen, ohne eigentlich zu wissen, wie sie aussah.
»Habt ihr ein besonderes Vergnügen, das ihr mir bieten könnet?« fragte sie, als sie nach ihrer Ankunft am Frühstückstisch saß.
»Jawohl,« sagte der Konsul, dem diese erste Mahlzeit, bei der die Familie versammelt war, die feierliche Veranlassung gab, das Wort zu ergreifen. Sonst hatte er sich angewöhnt, seinen Teil der Unterhaltung seiner Gemahlin zu überlassen, die ihren eigenen und den seinigen dazu mit Glanz besorgte. »Wir haben eine Singhalesentruppe.«
»Die wir eben gehabt haben.«
»Und einen großen italienischen tragischen Helden, vor dem alle weiblichen Herzen schmelzen – –«
»Und den wir auch gehabt haben.«
»Dann haben wir einen Pfarrer, der blitzt und donnert.«
»Die haben wir zu Dutzenden! Das ist nicht vielversprechend.«
»Ja, hör ihn nur erst einmal,« sagte die Tante, die fand, daß der Augenblick gekommen sei, wo sie das Wort übernehmen müsse. »Von seiner Art gehen keine zwölf aufs Dutzend.«
»Hast du ihn gern, Tante?
»Ihn selbst? Ja, mein Kind, er ist ja der Neffe meines Mannes und kommt oft zu uns. Ich habe die ganze Familie meines Mannes sehr gern. Ja wirklich, das darf ich wohl behaupten.«
Der Konsul murmelte etwas, das aber höchstens seine Serviette zu hören bekam.
»Aber seine Art zu predigen,« fuhr die Tante fort, »nein, ich bitte um ein freundliches, mildes Christentum, das trösten kann, aber nicht erschreckt. Das habe ich ihm selbst mit klaren Worten gesagt, – du erinnerst dich doch auch daran, Hallager?«
Die Anrede war mehr bekräftigend als fragend, und die Frau Konsul fuhr fort, ohne eine Antwort abzuwarten: »Aber begabt ist er. Du mußt ihn unbedingt einmal hören, denn du gehst doch wohl noch in die Kirche? Keine Leberpastete gefällig, selbstgemachte?«
»Doch, bitte, sie ist ausgezeichnet. – Ja, ich bin doch kein so ganzer Heide wie Erik. Ich ging mit Mutter immer in die Kirche und tue es auch seither, bisweilen wenigstens. Aber wenn mich jemand ganz vom Christentum abbringen könnte, so wären es diese düsteren, verdammenden Pfarrer! Sie erregen bei mir nur die Lust, ihnen zu widersprechen, und außerdem glaube ich gar nicht an ihre Heiligkeit. Sie versagen sich ein paar gleichgültige Dinge, und im übrigen essen und trinken und freien sie, gerade wie alle andern auch.«
»Ja, aber dies paßt nun nicht auf Halfdan. Er ißt und trinkt so wenig, daß seine Schwester ganz bekümmert darüber ist. Und er ist auch nicht verheiratet.«
»Das ist merkwürdig – für einen Pfarrer! Ist er auch nicht einmal verlobt?«
»Nein, in diesem Stück ist er sehr eigen. Er spricht davon, daß ganz überflüssig viel Heiraterei unter den Pfarrern sei, und daß es recht gut wäre, wenn man sich ein wenig daran erinnerte, daß die beiden größten Apostel unverheiratet gewesen seien. Das ist ja Paulus – und Petrus – – Nein, – mir ist, als stehe irgendwo etwas von dessen Schwiegermutter. Nun, dann ist es eben einer der andern.«
»Vielleicht Johannes,« schlug der Konsul vor; aber es wurde nicht weiter darüber nachgeforscht.
»Wohnt dein Pfarrer mit einer Schwester zusammen?« fragte die Nichte.
»Ja, sie blieben nach des Vaters Tod mit einander in der väterlichen Wohnung. Die Schwester ist etwas älter als der Bruder und wird sich wohl kaum verheiraten. Ich bilde mir immer ein, Alette müsse einmal eine unglückliche Liebe gehabt haben. Jetzt geht sie vollständig in ihrem Bruder auf. Es ist ganz ausgezeichnet für ihn, daß er eine so gesetzte, besonnene und taktvolle Dame im Hause hat, denn die Pfarrer sind gar vielem ausgesetzt! Aber nun ist sie da, um die vielen – – angefochtenen Frauenzimmer, die mit solch leerem Gerede zu so einem Pfarrer kommen, etwas abzuhalten. Die Lust, sich ihm anzuvertrauen, nimmt etwas ab, wenn sie zuerst die Schwester gesehen haben.«
»Sie bewacht ihn – das kann ich mir denken.«
»Ja, das tut sie – und treu.«
»Das ist gewiß ein Paar, das mir nicht gefallen wird,« sagte die Nichte. Dann stand man vom Tisch auf.
– Als die Nichte schon ein paar Wochen in Christiania war, sagte die Frau Konsul eines Tages zu ihr:
»Es ist recht arg, daß wir immer so vielerlei vorhatten, daß du noch nicht einmal Halfdan predigen gehört hast. Nun erwarten wir ihn morgen abend, – so weit man ihn überhaupt erwarten kann. Denn an dem Abend, wo man ihn eingeladen hat, ist dann immer entweder eine Betstunde, die gehalten werden muß, oder es liegt irgend jemand im Sterben! Aber vielleicht kommt er doch, und dann ist es ja ein wenig unangenehm.«
»Im Gegenteil, es ist ausgezeichnet,« sagte die Nichte. »Er meint wohl, man könne keine Stunde in Christiania sein, ohne wenigstens die halbe davon im Vereinshaus zu sitzen und ihm zuzuhören. Ich glaube gar nicht, daß ich mir irgend etwas aus ihm mache. Wie ich höre, soll er ebenso kohlschwarz sein, wie seine Predigten, ein richtiger Halfdan Svarte. Und das ist gar nicht nett. Er müßte gerade recht hell sein, – glänzend hell. Dann wäre es ein pikanter Gegensatz.«
»Ja, schwarz ist er,« sagte die Tante. »Aber er sieht gut aus, eher zu gut, sonst wäre es vielleicht doch nicht so gedrückt voll in seiner Kirche.«
Am nächsten Abend kleidete sich die Nichte mit mehr als gewöhnlicher Sorgfalt an; es war ja eine größere Gesellschaft.
Sie wählte einen ganz neuen Anzug aus dunklem Sammt, der am Hals ausgeschnitten und mit einer indischen Goldstickerei eingefaßt war. Ihr weißer Hals hob sich blendend aus dem dunkelblauen Gewand. Nur eine ganz feine, goldene Kette trug sie dreimal um den Hals geschlungen, und in ihrem lockigen Haar leuchtete eine einzige feuerfarbige, seidene Mohnblüte.
»Wir werden ihm ein wenig in die Augen stechen,« dachte sie und nickte ihrem Spiegelbilde zu. »Das wird ihm gut tun – zur Abwechslung –«
Es waren schon viele Gäste in dem hellen, schönen Salon versammelt. Und auch hier, wie fast überall, drehte sich das Gespräch um den Pfarrer und die Geschichten, die von ihm erzählt wurden.
»Es ist merkwürdig,« sagte die Dänin zu ihrem Nachbar, »daß ein solcher Mönch überhaupt in Gesellschaft geht.«
»Er tut es wohl auch nur bei seinen Verwandten. Vielleicht hofft er Gutes zu wirken, auch auf diese Weise.«
Eine der Damen hatte an demselben Tag eine neue, ganz wahrhaftige und schauerliche Geschichte von ihm gehört.
»Wissen Sie, was er zu der Tochter des Bürgermeisters K. gesagt hat, als sie kam, um das Begräbnis ihres Vaters zu bestellen? War ihr Vater ein gläubiger Mann? fragte er gleich zum Anfang. – Vater pflegte nicht davon zu sprechen, sagte sie. – Ging er in die Kirche? – Vater war mehrere Jahre krank. – Aber ehe er krank wurde? – Nicht sehr oft, glaube ich. – Las er fleißig in der Bibel? – Nicht, so viel ich weiß. Aber gut war er, mein Vater! – Dann ist ihm die Hölle gewiß. – Aber da nahm sie das Blatt vom Mund, sie, die Gudrun K. – Wollen Sie meinen Vater in die Hölle tun? fragte sie. Da danke ich. Da gehe ich lieber zu einem Pfarrer, der ihn in den Himmel tun will. Es wird mir nicht schwer werden, einen solchen zu finden!«
Während des Stimmengewirrs nach dieser Erzählung, mitten unter dem Lachen und der Entrüstung, hörte die Nichte eine Stimme, ruhig wie einen Glockenton, die dicht neben ihr fragte: »Von wem handelt die Geschichte?«
Mit einer sekundenlangen, peinlichen Verlegenheit schaute die Frau Konsul auf. Dann sagte sie entschlossen: »Aufrichtig gesprochen, mein Lieber, sie handelte von dir.«
Blitzschnell wandte die Nichte den Kopf.
Kohlschwarz – ja! Fast blauschwarzes, wallendes Haar von der weißen, von Gedanken gefurchten Stirn zurückgestrichen, schmale dunkle Augen, etwas verschlossene, scharfgeschnittene Züge, das Kinn und der bartlose Mund klassisch fein in den Linien, wie die des großen Napoleon.
»Ja, du mußt entschuldigen, daß du es gehört hast,« sagte die Konsulin, »es ist recht langweilig.«
»Im Gegenteil, sie war ganz unterhaltend, und das pflegen sie sonst nicht zu sein, die Geschichten, die über mich im Umlauf sind.«
Nun stellte ihn die Tante einigen aus der Gesellschaft vor, die ihn noch nicht kannten. Nachdem die Begrüßungen ausgetauscht waren, ließ er sich da, wo er stand, etwas im Hintergrund auf einen Stuhl nieder.
Die Nichte wandte ihm ihr strahlendes Gesicht voll zu.
»Ist sie nicht wahr, die Geschichte?« fragte sie.
Er atmete plötzlich hastig auf, wie wenn er überrumpelt worden wäre. Ja, sie merkte es gut, obgleich er es nicht sehen lassen wollte.
Dann sagte er ruhig: »Finden Sie etwa, daß sie mir ähnlich sieht? Haben Sie mich predigen gehört?
»Nein.« Sie freute sich, so antworten zu können. »Während der beiden ersten Sonntage, die ich an einem neuen Ort bin, gelingt es mir nie, in die Kirche zu kommen. Aber könnte sie nicht wahr sein?«
»Nein, denn es ist gerade eine Eigenheit von mir, daß mir die Verstorbenen so sehr leid tun. Die Lebenden kann ich angreifen, – und das tue ich gerne. Denn es gehört Kraft dazu, einen Menschen von sich selbst frei zu machen. Aber – einen Toten! Den stillen, verteidigungslosen, hilflosen! – Es ist zum Händeringen schwer, daß man nichts für einen Toten tun kann! Aber über den herfallen, der vor dem schlimmsten Gericht steht – nein, etwas so Feiges!«
»Sie wissen ja gar nicht, wie Gott richten wird.«
»Ich glaube doch, daß man dafür einen ganz guten Maßstab hat. – Aber ich dachte vorhin nicht an das Gericht Gottes. Ein Toter steht unter seinem eigenen Gericht. – Mit nackter Seele – –
»Schon von Kind auf wäre ich gerne bis ans Ende der Welt gewandert, wenn ich dadurch einem Toten ein Versteck in meinem Herzen hätte bieten können! Und ich kann diesen Gedanken noch immer nicht los werden, selbst jetzt noch nicht.«
Es fiel ihr auf, wie weich seine Augen doch waren, wie sie gleichsam das sammetweiche, verschlossene Dunkel des Nachthimmels hatten.
Ihr eigenes Gesicht wurde ernst bei seinen Worten. »Ich verstehe dieses Gefühl gut,« sagte sie. »Ich habe sehr liebe Verstorbene.«
»Ich weiß es, Sie Ärmste!«
Dies klang so natürlich, so wenig überlegen, daß es ihr, obgleich sie in diesem Augenblick gerührt war, doch nicht gefiel. Er war so selbstbewußt und unerschütterlich! –
Seine Schwester war mit ihm gekommen; aber sie hatte ein stilles Talent, sich der Aufmerksamkeit zu entziehen, um diese ungeteilt auf den Bruder richten zu können, so daß niemand weiter acht auf sie gab, bis die Nichte zu ihr trat und sie anredete.
Alette glich ihrem Bruder in den Zügen ein wenig, war aber blond und hatte blaugraue Augen, die aus der Entfernung sehr kühl aussahen, in der Nähe aber herzlich sein konnten. Ja, aber nicht immer, wie die Nichte bald entdeckte. Sie hatte geglaubt, das Fräulein werde dankbar dafür sein, daß sich jemand mit ihr abgab, sah aber nach einer kurzen Unterhaltung ein, daß ihre Zurückhaltung voller Selbstgefühl war, und daß sie sich nicht das geringste daraus machte, sich außer mit denen, die sie selbst wählte, einzulassen.
Die Nichte war denn auch rasch mit ihr fertig und mischte sich wieder unter die andern.
Dann kam das Essen, stehendes Büffet, wo sie der Konsulin bei der Versorgung der Gäste behilflich sein mußte.
Hierauf setzte sich eine ältere Cousine, die dreißig Tänze auswendig konnte und deshalb rundum in der Familie eingeladen wurde, ans Klavier, und die großen Tische im Eßzimmer wurden auf die Seite gerückt, damit die jungen Leute ein Tänzchen machen konnten.
Die Nichte besann sich einen Augenblick, dann ging sie quer durchs Zimmer zu dem Pfarrer hin, der an der Salontür lehnte, und verneigte sich vor ihm in all ihrem Glanz.
Er verbeugte sich tief, so tief, daß er noch nicht ganz fertig war, als sie sich wieder aufrichtete.
»Ich danke, aber ich tanze nicht.«
»Sind Sie zu fromm dazu?« Sie hatte sich darnach gesehnt, ihm diese Worte zuschleudern zu können.
»Gefällt es Ihnen vielleicht, wenn ein Pfarrer tanzt?«
»Jawohl,« entgegnete sie schnell. »Ich tanze selbst sehr gern und –«
»Wenn er von einem wilden Galopp – mit flatternden Rockschößen – zu einem krebskranken Mann geht, wie ich nachher? Dann sind Sie genügsamer als ich. Den Pfarrer möchte ich nicht an meinem Sterbebette haben.«
»Nein, natürlich nicht, wenn Sie zu einem Kranken müssen.«
»Übrigens hätte ich das eigentlich nicht von Ihnen gedacht. Ich hätte geglaubt, daß Sie die Pfarrer eher zu weltlich als zu enthaltsam fänden.«
Das war im Grunde auch wahr, so daß sie ihm nicht widersprechen konnte.
»Ihr Kranker,« sagte sie mit etwas röteren Wangen, »wird er bald sterben?«
»Sehr bald.«
»So helfen Sie ihm – vorher.«
»Das ist es gerade, was ich versuche,« antwortete er kurz. Und sie wußte wohl, daß er keinen Gefallen an ihr fand.
Aber die Schwester noch weniger. Sie fühlte es, als sie nach diesem Gespräch an ihr vorüber kam und von der mißbilligendsten Kühle der blaugrauen Augen getroffen wurde. Doch die Huld und Gnade dieses Paares konnte sie wohl entbehren!
Der nächste Sonntag kam herbei. Die Frau Konsul hatte Schnupfen und wagte nicht, in die Kirche zu gehen.
»Die Luft in der Kirche ist am allerschädlichsten, wenn man erkältet ist,« sagte sie. »Und ich möchte die Gesellschaft bei Bödkers nur sehr ungern absagen. Sonst ist es mir sehr leid, wenn ich drei Sonntage vergehen lassen muß, ohne das Gotteshaus zu besuchen. In welche Kirche willst du gehen?« fragte sie die Nichte, die eben den Hut aufsetzte.
»Ich weiß nicht recht,« erwiderte diese, während sie einen weißen Schleier um ihren Hut band, in dem Gedanken, daß dieser sie etwas mehr in die Augen fallend mache. »Vielleicht gehe ich hin und höre Halfdan Svarte donnern,« fügte sie kurz nachher hinzu, »wenn es noch nicht zu spät ist.«
»Nein, zur Predigt kommst du gerade noch recht.«
Sie tat es; und sie kam noch zeitig genug, obgleich sie ihn eigentlich recht gerne bei der Liturgie gehört hätte. Er war ja wegen seiner schönen Stimme bekannt.
Wie sie so dastand, – von sitzen war keine Rede, wenn man so spät kam, – hatte sie die Kanzel gerade vor sich und konnte noch besser als neulich sein Gesicht studieren, konnte sehen, welch feine Linien Mund und Kinn hatten, und wie schön er sie bewegte, wenn er sprach. Die Mundwinkel waren besonders anziehend. Der untere Teil des Gesichts hatte wirklich die Schönheit des großen Franzosenkaisers.
Auf einmal wußte sie es. Hier auf der Kanzel sah er ganz so aus, wie Napoleon auf der Brücke von Arcole. Hier war derselbe Blick, mit dem jener zurückschaut, ob seine Leute ihm folgen, – mit der ganzen Energie des konzentrierten Willens, um sie vorwärts zu treiben.
Ob sie ihm nachfolgen, – – nicht, wer sie sind, nicht, wie sie aussehen… Sie fühlte es, vor diesen Augen verschwanden hundert weiße Schleier wie Nebel vor der Sonne, sie fühlte, daß alle Farben, alle Schönheit eines Gesichts diese Augen nicht aufhalten konnten auf ihrem Wege nach innen, um einzig und allein darnach zu sehen, ob die Seele, ihre ganze Fähigkeit aufs höchste angespannt, ihm folge auf dem Wege dahin, wohin er voranschritt, das Banner über seinem Haupte hocherhoben.
Sie schlug die Augen nieder. Sie fühlte, sie war nicht mit in dem Strom des Wollens, der ihm aus all den aufgerichteten Augen entgegenfließen sollte, als ein Ja und Amen auf das, was er verlangte.
Als er die Kanzel verließ, erst da wurde es ihr klar, daß sie beinahe nichts von seiner Predigt gehört hatte.
Was sollte sie nun der Tante sagen, die es liebte, den Gottesdienst – oder besser gesagt, die Predigt – bei Tische zu besprechen? Natürlich war sie kraß, und sie handelte ja von der Verklärung auf dem Berge, – diese beiden Tatsachen ließen sich vielleicht etwas weiter ausgeführt glücklich verwenden, so daß der eigentliche Mangel verborgen blieb.
Während des Gesangs sah sie ihn wieder an. Da wandte er ja der Gemeinde den Rücken, aber sie war so weit auf der Seite, daß sie ihn ungefähr im Profil hatte. Seine Augen waren auf das große Kruzifix über dem Altar gerichtet.
Und plötzlich sah sie seinen Blick wie einen Blitz aus der dunklen Tiefe der Augen hervordringen. Dieser Blick war ein Feuer – eine Feuersglut, die die gemarterte Gestalt vor ihm umschloß – von den durchbohrten Füßen an bis zu dem dornengekrönten Haupt. In diesem Blick lag die ganze Seele. Und diese Seele war Feuer.
Wo sie im Lauf des Tages stand oder ging, immer sah sie den Blick, wie er sich, einer Flamme gleich, einen Weg brach. Und jedesmal empfand sie ihn wie einen brennenden Schmerz.
War es, weil sie selbst ihren Mangel fühlte, an dem Einen, dem Einzigen, zu dem man solch einen Blick erhebt? Ja, daher kam es wohl!
Bei Bödkers war man nur im kleinen Familienkreis versammelt, aber sie ging der entzückenden Kinder wegen sehr gern hin. Das jüngste der Flachsköpfchen dort hatte bei ihrem ersten Besuch seine runden Ärmchen von hinten um ihren Hals geschlungen und gesagt: »Ach… du dänisches Fräulein!«
Die Erwachsenen in der Familie hatten diese Benennung dann aufgenommen, und nun wurde sie ausschließlich so genannt.
Es war so reizend, die Kinder um sich zu haben, die leuchtenden, goldblonden Köpfchen innig an sich geschmiegt.
Der Pfarrer und seine Schwester waren auch da. Sie kamen spät und mußten natürlich gleich nach dem Essen wieder weg zu einer der ewigen Versammlungen. Er sah müde aus und sprach fast nichts. Überhaupt, wie konnten die norwegischen Männer schweigen! – Die Schwester schien das ganz in der Ordnung zu finden, daß ihn hier niemand dazu brachte, den Mund aufzumachen. Aber das dänische Fräulein wollte mit ihm reden, sie wollte ihn herausfordern. Sie fühlte, daß er sich nichts daraus machte, und das reizte sie.
Bei Tisch unterhielt sie alle die andern – fröhlich und lebendig, – aber beim Kaffee trat sie zu ihm, als er einen Augenblick allein stand.
»Heute habe ich Sie also predigen hören.«
»Ich sah Sie – ja.«
»Sie waren sehr streng.« – Sie konnte wohl annehmen, daß er das gewesen war.
»Stimmte das, was ich gesprochen habe, nicht mit der Bibel überein? Dann können Sie ja meine Worte einfach kassieren, sonst aber müssen Sie Ihre Klage höheren Orts vorbringen.«
»Wie übervoll Ihre Kirche war!« Es war doch wohl besser, von der Predigt abzulenken.
»Ja.«
Entgegenkommend war er nicht. Aber so leicht gab sie ihre Sache nicht auf.
»Wissen Sie, heute ist es mir klar geworden, wie ein Gesicht verklärt, das heißt enthüllt wird. Dies geschieht, wenn das Gefühl, das das tiefste in einem Herzen ist, das die Persönlichkeit enthält, hervorbricht.«
Keine Antwort. Es war ihr, als sehe er ungeduldig aus.
»Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen zu der Versammlung gehen,« begann sie wieder.
»Warum?«
»Weil – hier ist es nicht sehr unterhaltend.«
»Ja, – das ist ein sehr guter Grund.«
Sie merkte, daß er gehen wollte – und da schaute sie ihm plötzlich gerade in die Augen. »Warum versuchen Sie es nicht, mich zu bek…, ja, auf mich einzuwirken? Bin ich vielleicht nicht würdig genug?«
Er hielt ihren Blick mit unerschütterlichem Ernst aus, ohne eine Spur von Weichheit in den Augen.
»Die Unwürdigen sind es, die ich suche,« sagte er. »Und gerade das – ich weiß nicht, ob Sie… Ich habe mir keine Gedanken über Sie gemacht, aber Sie machen eher den Eindruck, als ob Sie überhaupt keine geistlichen Begriffe hätten, im tiefsten Sinne genommen.«
Sie lachte. »Wie schmeichelhaft! Ja, was fehlt mir denn Ihrer Ansicht nach?«
»Die Hilfsbedürftigkeit. Sie haben ja Überfluß, und es fehlt Ihnen nichts.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich höre es, ich sehe es. Sie wissen Auswege, und Sie verstehen auszuweichen. Wo der Ernst des Lebens Ihnen entgegentritt, lassen Sie ihn als Gesprächsthema schnell wieder fallen. Sie lassen sich dadurch nicht in Angst jagen. Wenn die Hilfsbedürftigkeit bei einem Menschen die Oberhand gewinnt, den Kopf hervorstreckt – angstvoll wie ein Ertrinkender –, dann ist die Stunde gekommen, ihm eine Planke zu reichen, die ihn tragen kann. Aber nicht dem, der sich sicher fühlt und nach der Rettungsplanke – nur hintänzeln will.«
Sie hatte aufgehört zu lachen. Denn sie fühlte, daß das Lachen leicht in Weinen umschlagen könnte.
Nun wandte sie sich ab, ohne noch ein Wort hinzuzufügen. – – Und da fühlte sie, daß er sie gerne zurückgehalten hätte, daß er bereute, sich übereilt zu haben. Aber so leicht – – nein, so leicht sollte es ihm doch nicht gemacht werden.
Sie verschanzte sich hinter den Stuhl ihrer Tante und blieb da sitzen, bis er sich verabschiedete. Und da reichte sie ihm nur die Fingerspitzen über die Stuhllehne weg, ohne aufzusehen. Und es half ihm nichts, daß eine zögernde Bitte in seinem Händedruck lag.
An der Tür des Eßzimmers blieb er plötzlich stehen und sagte: »Nicht wahr, gnädiges Fräulein, Sie fragten vorhin nach meinem Krebskranken? Es ist mir etwas eingefallen, was ich Ihnen gerne von ihm erzählen möchte.«
Wie überrascht stand sie auf. »Meinen Sie mich?« fragte sie und folgte ihm langsam und zögernd ins Eßzimmer.
Hier streckte er ihr beide Hände entgegen. »Habe ich Sie verletzt? Bitte, verzeihen Sie mir!« Sie stand unbeweglich vor ihm und erwiderte nichts, wenigstens nicht gleich.
»Nicht ich habe gesucht,« fuhr er fort, »ein Gespräch mit Ihnen anzuknüpfen. Meine Absicht war es, Ihnen auszuweichen. Ich meine – wir beide sind so sehr verschieden – – Aber das ist keine Entschuldigung, das weiß ich. Ich bitte Sie, vergeben Sie mir.«
Jetzt schaute sie auf. »Sie tun mir Unrecht,« sagte sie. »Weil ich lebhaft bin und vielleicht mein Äußeres gegen mich spricht, sprechen Sie mir sogleich jeglichen Ernst ab. Das ist sehr oberflächlich geurteilt.«
»Nein, Sie täuschen sich. Begabung und Schönheit sind keine Hindernisse für das Christentum, und ich würde sie nie als solche betrachten. Es kam mir nur vor, als seien Sie mit so wenig zufrieden, als begehrten Sie gar nicht mehr und nichts anderes. Ist es nicht so, wirklich nicht?«
»Nein, nein, doch nicht ganz.«
Ihre eigene Stimme klang ihr wie die einer Fremden. Sie klang so ängstlich.
»Ich wünschte, Sie könnten jetzt mit mir gehen,« sagte er nach einer Weile. »Dann würde ich mit Ihnen reden. – Aber nicht mit einem weißen Schleier auf dem Hut, der würde dort zu sehr abstechen – da, wohin ich jetzt gehe.«
Sie sah ihn an mit dem Schimmer eines forschenden Lächelns im Auge.
»Ich wollte, ich könnte,« sagte sie. »Ich würde ein altes Tuch um den Kopf binden wie die gewöhnlichste Frau. Aber versuchen Sie so zu sprechen, daß ich es verstehen kann.«
»Ich will sehen, was ich tun kann. – Doch nun adieu!«
Er konnte auch lächeln! Und die dunklen Augen waren so mild, daß sie seinen Blick fühlte wie eine Berührung.
»Doch was macht der Patient?«
»Es geht ihm besser, – in geistlicher Hinsicht.«
Während sie zu den andern zurückkehrte, dachte sie: »Wenn er sich nur das nächstemal auch wieder übereilen würde! Die Verpflichtung, es wieder gut zu machen, wird immer groß bei ihm sein. – Und sonst interessiere ich ihn ja nicht, während doch jede glattgekämmte Vereinsdame dessen ganz sicher sein kann!«
Aber das nächste Mal ließ auf sich warten.
Die Schwester hatte wohl die Scene in der Eßstube bemerkt und ihn gewarnt. Die selbstbewußte Alette hatte ja erklärt, daß die Kopenhagener kein ernsthafter Menschenschlag seien, und sie, das dänische Fräulein, sicherlich als die schlimmste dieser leichtsinnigen Rasse hingestellt. Überhaupt – jemand mit gekräuseltem Haar, schlanker Taille und kleinen Füßen konnte keinen Lebensernst haben. So einer mußte man nur ausweichen.
Und die Männer sind so naiv, so ganz von dem rein Äußerlichen gefangen genommen! Es gibt Frauen, von denen man sie immer glauben machen kann, daß sie sich vor ihnen hüten müßten. Sie kannte Frauen, die geglaubt hätten, sie seien verloren, wenn sie Stirnlocken trügen, die in der Sonntagsschule unterrichteten und das bescheidene Auftreten angenommen hatten, das förmlich um Entschuldigung bittet, daß man überhaupt da ist, und die aber nachher doch ganz gut wußten, was sie wollten. Aber diese waren sicher, stets vollkommenem Zutrauen zu begegnen.
Aber so eine wie das dänische Fräulein, versuchte man nicht einmal zu bekehren. Dazu hatte man ja die Armenhäusler und die Fabrikmädchen! Wie sonderbar, daß Männer, wie dieser Pfarrer, so wenig in ihrem eigenen gebildeten Kreise wirken! Das wollte sie ihm doch das nächste Mal zu bedenken geben. Ja, das nächste Mal, das nicht kommen wollte!
Die ganze Woche verging. Sie wurde es so müde, in Gedanken lange Gespräche zu führen, die immer gelangen, die immer ein erstaunlich günstiges Resultat hatten, daß sie sie gern alle um ein einziges kleines wirkliches, mißglücktes Zwiegespräch hingegeben hätte.
Dann kam der Sonntag. Aber da predigte er nicht einmal!
»Gehst du nie in die Betstunde, Tante?« fragte die Nichte am Morgen, die Zeitung in der Hand.
»Nein, Kind, ich will lieber meine Erbauung in der Kirche haben. Aber ich habe gar nichts dagegen und lasse auch die Dienstmädchen abwechslungsweise hingehen, wenigstens manchmal. Heute abend soll Margit gehen und Halfdan in dem Vereinshaus in der Kalmeyerstraße hören. Ich glaube, er spricht über die Freiheit.«
»Ich hätte beinahe Lust mitzugehen. Ich will es einmal versuchen.«
»Ja, dann begleitet sie dich.«
Es war sehr voll in dem Vereinshaus und sehr heiß. Voll von Menschen, die nicht ganz in derselben Tonart sangen. – Freiheit – ja, um alle hinauszukehren und frische Luft hereinzulassen, das war es, was sie in diesem Augenblick am meisten gewünscht hätte!
Als die hohe, dunkle Gestalt die Rednerbühne betrat und über die Versammlung hinschaute, kam es ihr plötzlich vor, als ob sein Blick kalt und müde werde.
»Er hat mich entdeckt,« dachte sie.
Es war deutlich, daß sie ihn störte. War nicht etwas Gezwungenes, etwas Unwirkliches in seinem Gebet? Riß es denn ihn und alle die andern mit?
Dann kam die Rede. Freiheit, – das Wort, das einem den Atem benimmt, dessen bloßer Ton schon dies und jenes sprengt, das Wort, das das ganze Brausen des entfesselten Sturms hat – würde er von solcher Freiheit sprechen? Er, der nichts wünschte, als die Fesseln um sich und andere fester zu ziehen.
Nun ja, man hätte es sich ja denken können, daß er es so auslegen würde!
Man werde in Knechtschaft geboren und lebe gebunden, – ja, das sei man ja an vielen Orten. Nicht allein von harten Verhältnissen, Krankheit, Kummer, Armut, Tyrannei anderer, von all dem, was man sein böses Schicksal nenne, unter dem man seufze. All dies sei nicht als Fessel zu rechnen. – Ach, sie dächte doch! – Oder besser gesagt, es komme alles von einem her, von dem Joch, dem eisernen Joch, das »die sündige Natur« heiße – von diesem eisernen Joch, das ein wahnsinniger Mensch im Anfang der Zeiten einmal auf seine Schultern genommen habe, in dem falschen Glauben, daß es die Freiheit sei, und der dann damit zusammengewachsen sei, mit dem eisernen Joch, unter dem man nun geboren werde, das mit jedem Tag schwerer werde, immer tiefer ins Fleisch einschneide und einen immer mehr zur Erde hinunterdrücke, schließlich bis in den grundlosen Pfuhl des Todes…
Ja natürlich, es lag etwas Unfreies darin, daß man so viele Fehler hatte! Aber sie hingen doch auch mit den guten Seiten eines Menschen zusammen… Ja, vielleicht war es gerade dieses Verwachsensein, was er meinte. –
Dann ging er dazu über, zu erklären, was Freiheit sei.
»Freiheit ist nur eins, Aufhebung der Knechtschaft. Das eiserne Joch unter die Füße treten. Aber wer ist dazu tüchtig? Wir kraftlose Menschen nicht, die nicht einmal das Geringste bemeistern können – Krankheit, Kummer, Armut, – wer von uns kann aufstehen und das eiserne Joch seiner eigenen sündigen Natur brechen?«
Dann, – dann sprach er von einem, der es getan habe, einer, der selbst nicht unter dem eisernen Joch geboren war, der aufrecht, ganz aufrecht und frei durch die Reihen der Gebeugten schritt, der es aber den andern abnahm, es den niedergebeugten Rücken der Menschheit entriß mit starken, reinen Händen, und es auf blutigen Schultern trug, der seine Handflächen wund riß, um es entzwei zu brechen. – Einer, der Liebe genug hatte, um selbst unter diesem eisernen Joch zu Boden zu stürzen, unter ihm zermalmt zu werden, – aber auch Lebenskraft genug, heilige, ungebrochene Lebenskraft, um eines Morgens aufzustehen und das Joch unter die Füße zu treten, damit du wirklich frei sein solltest.
»Bist du frei? Vielleicht hast du es gar nicht gefühlt, daß du ein Sklave bist. So wahnsinnig töricht ist ja die Welt immer noch, daß sie meint, das eiserne Joch, das sei die Freiheit. Daß sie es wagt, zu behaupten, daß die Freiheit um so größer sei, je tiefer sie einen in den Schmutz hinunterdrücken könne. Die Befreiung von dem Joch dagegen, das nennt sie Knechtschaft.
Doch im tiefsten Innern des Menschen findet sich eine Stelle, wo die Wahrheit ihren Sitz hat, und von der aus er richtig sehen kann, wenn er selbst nur will. Und wenn der Ruf, der große Ruf der Wahrheit durch die Welt geht, wenn er mit dem Flügelschlag des Geistes durch die Welt tönt und laut in Klarheit das bekräftigt, was du selbst dunkel fühlst, dann bist du dafür verantwortlich, wie du wählst. Aus der Weltklugheit heraus, die, wie du im tiefsten Innern wohl weißt, Lüge ist, oder aus der Wahrheit. Entweder Knechtschaft – Knechtschaft unter deine eigene sündige Natur – oder Freiheit durch den einen Einzigen, der das eiserne Joch zerbrechen kann, auch für dich. – Auch hier in diesem Saal gibt es eine Wahl, – merk dir das! Auch in dieser Stunde werdet ihr zur Freiheit berufen, meine Brüder!« – –
Nach der Rede wurde der Pfarrer von all denen, die ihm zum Dank die Hand drücken wollten, förmlich belagert. Das war wohl so Sitte nach den Betstunden.
»Geh du nur heim, Margit,« sagte das dänische Fräulein zu dem Dienstmädchen. »Meine Tante wird dich wohl beim Teetisch nötig haben. Es sind Bekannte von mir da, die ich gerne begrüßen möchte, und ich gehe dann mit ihnen.«
Langsam lichteten sich die Reihen, während sie der Mitte des Saales zuschritt. Es war ihr, als halte er die andern zurück, während sie näher trat. Tat er es, um ihr auszuweichen? Oder – nein, das konnte nicht sein – um sie zuletzt und allein zu haben?
Sie wurde die Letzte.
»Sind Sie allein?« fragte er wie erstaunt.
»Und Sie?« hätte sie beinahe mit einer Art Jubel im Ton ausgerufen, aber sie antwortete nur: »Ja, ich habe das Mädchen heimgeschickt, weil es so spät wurde.«
»Meine Schwester hat einen sehr schlimmen Husten,« sagte er, ohne einen Zusammenhang mit ihren Worten. Aber ihr war es, als verstünden sie eins des andern Gedankengang, und als sei seine Bemerkung ganz selbstverständlich.
Es war auch selbstverständlich, daß er mit ihr den Saal verließ und neben ihr herging.
Sie sprachen die ganze Zeit von der Freiheit – davon, daß man frei werden müsse, frei, von – von dem, »das bindet,« sagte sie. »Bei dem Wort Freiheit – ich liebe es – denke ich meistens an die Freiheit, zu handeln.«
»Das kommt auf eins heraus. Das eine folgt aus dem andern.«
»Ja, das kann wohl sein, aber es ist doch nicht dasselbe. Sie sprachen aber doch nicht von meiner Freiheit – meiner Freiheit, zu… Was Sie darüber sagen würden, das zu hören hatte ich mich gesehnt. Verstehen Sie nicht? Die Freiheit, die gleichsam mit einem fortbraust, fort in einen ungeheuren Raum, wo es keinen Zwang gibt. Die Freiheit, zu – – zu denken, sprechen, fühlen, leben wie ich, gerade ich, will und mag. Das Recht, ich selbst zu sein, dem Drang meiner eigenen Persönlichkeit zu folgen wie der Vogel, der fliegt, und wie der Fisch, der schwimmt.«
»Wo finden Sie diese?« fragte er. »Den Drang kenne ich recht gut. Vielleicht war er es, der mich, mehr als alles andere, hinauswarf, hinaus in die große Freiheit. Den Tummelplatz für seine Persönlichkeit, die Luft für den Vogel, das Meer für den Fisch – das Lebenselement für das Leben des einzelnen – mit dem jubelnden Recht da zu sein, zu atmen, sich zu bewegen als der, der man ist – in seiner tiefsten und wahrsten Bedeutung – – wo findet sich das?«
Unwillkürlich entfuhr ihr – obgleich sie dies früher niemals mit dem Gedanken an Freiheit verbunden hatte: »In dem Herzen eines andern Menschen.«
»Ja, – – ja, da würde man es noch am ehesten finden. Aber dies ist trotzdem ein begrenzter Raum, ein Menschenherz hat Grenzen. Man stößt mit der Stirne an, auch da. Nur ein Herz ist unbegrenzt. Nur an einem Ort kann man aus tiefster Seele aufatmen, in das Weltenmeer untertauchen – –«
»Ja – aber sind Sie denn nicht gebunden, – gebunden – –«
»Von meiner Freiheit? Doch. Aber ihr Joch drückt nicht nieder. Sie ist gleich Flügeln, die tragen, nach oben – unwiderstehlich!«
Plötzlich blieb er stehen und sah sich um.
»Darf ich Sie hier in eine Straßenbahn setzen?« sagte er. »In einem Haus hier in der Nähe liegt ein kleines Mädchen, sterbend, schon tot vielleicht, dessen Mutter ich besuchen möchte.«
»Dann warten Sie um meinetwillen nicht auf die Straßenbahn,« sagte sie hastig. »Gehen Sie nur gleich!«
»Nein, nein – ich lasse Sie nicht allein auf der Straße stehen. Der Wagen könnte ja besetzt sein.«
»Könnte ich dann nicht –?« Sie hielt inne, bange vor einer abschlägigen Antwort.
»Mit hinaufgehen? Doch. Aber es ist ein trauriger Anblick. Das Kind ist taubstumm. Und das erschwert alles so sehr.«
Sie gingen durch ein paar Gäßchen, die sie nicht kannte. »Karl XII Straße«, las sie im Laternenschein an einer Ecke.
Vor einem niederen, alten Haus hielt er an. »Einundzwanzig,« sagte er. »Hier ist es.«
Sie gingen durch das Tor und auf ein dunkles Loch zu. Er zündete ein Streichholz an, und in dessen flackerndem Licht sah sie einen kleinen, dunklen Hof – er schien wie dazu geschaffen, von Ratten zu wimmeln – und eine Treppe, die zu einem Altan führte.
Die morschen Stufen krachten unter ihren Tritten. Der Pfarrer tastete den Gang entlang bis zu einer Tür, wo er anklopfte.
Eine Frau, alt aussehend mitten in jungen Jahren und mit verweinten Augen, machte ihnen auf.
»Ich bin es, der Pfarrer. Ich mußte noch einmal sehen, wie es bei Tulla steht.«
Die Frau schüttelte nur den Kopf.
Sie traten in eine kleine, ganz reinliche Stube. Neben einem großen Bett stand ein kleineres, worin sich etwas bewegte mit tastenden Händchen und einer kleinen stöhnenden Brust. Da lag ein Kind von zwei bis drei Jahren, den Tod im Gesicht, mit großen hilflosen, erschreckten Augen, die nichts von der Qual begreifen konnten, die es überwältigte. Der Atem drang wie ein hartes Zischen über die fiebertrockenen, offenstehenden Lippen, die mit einer bräunlichen Kruste bedeckt waren.
Der Pfarrer und seine Begleiterin traten an das Bettchen. Einen Augenblick betrachtete sie stumm das Kind, – dann wandte sie sich plötzlich zu der Frau und küßte sie.
Die Mutter brach in Tränen aus. »Liebe Tulla,« sagte sie, »liebe Tulla!«
Das Fräulein trat ans Fenster und öffnete einen Flügel.
»Um ihr das Atmen zu erleichtern,« sagte sie. »Hier ist es so beklommen.«
Von dem weiten und ruhigen Sternenhimmel her strich ein Strom reiner und kühler Luft herein. – – Dann nahm das Fräulein ihr Flakon mit kölnischem Wasser, das sie mit in die Betstunde genommen aber nicht benützt hatte, und träufelte von dem Inhalt auf das Kissen um das kleine, fahle Gesicht her. – Das Kind atmete plötzlich etwas hurtiger und tiefer.
Ein Glas mit Wasser und Saft stand neben dem Bett, aber die Kleine konnte nicht mehr schlucken. Das Fräulein befeuchtete ihren Finger in dem Glas und begann dem Kind die harten, vertrockneten Lippen zu netzen. Sie war so froh, daß sie ein klein wenig äußerliche Hilfe leisten konnte, etwas anderes konnte sie doch nicht bringen.
»Sie sind ja eine ganze Krankenpflegerin, Frau Pfarrer,« sagte die Frau, während der Pfarrer seinen Überzieher auf einen Stuhl legte.
Sie nickte nur dazu. Es wäre so umständlich gewesen, die Frau aufzuklären.
»Nein, daß der Herr Pfarrer auch noch seine Frau mitgenommen hat!« fuhr die Frau fort, als dieser wieder an das Bett trat.
Nun kam die Aufklärung mit Blitzesschnelle.
»Dies ist ein dänisches Fräulein, das von der Betstunde aus mitkam. Ich bin nicht verheiratet.«
Die Eile, mit der er diesen belastenden Verdacht zurückwies, trieb ihr das Blut in die Wangen, aber sie fuhr ruhig fort, sich mit der Kleinen zu beschäftigen.
Plötzlich sah der Pfarrer auf den Finger, mit dem sie über den Mund des Kindes strich.
»Tuberkulose,« sagte er leise.
»Ja,« antwortete sie, als ob sie den Gedanken nicht verstünde. Aber sie wünschte, daß sie eine kleine Wunde am Finger hätte, und daß er es sehen würde.
Das Kind rang nach Luft mit den krampfhaft unruhigen Händchen und Füßchen, mit ausgedehnten Nasenlöchern und zuckenden Lippen.
»Meine kleine Tulla, sagte die Mutter, die neben dem Bettchen auf den Knieen lag. »Mutter ist hier. – Kannst du Mutter sehen, Tulla? Mutter würde dir so gern alles abnehmen, wenn sie nur könnte!«
Sachte schob der Pfarrer eine Hand unter das Kissen des Kindes und richtete dessen Köpfchen ein wenig auf.
Während sich die beiden so in vereinter Fürsorge um das sterbende Kind bemühten, stieg plötzlich ein Gedanke in ihr auf, der ihr das Blut noch heißer in die Wangen trieb als vorhin. Stieg vielleicht derselbe Gedanke auch in ihm auf?
»Lasset uns beten!« sagte er – mit einem Ton, als ob er sich selbst unterbreche. »Wir wollen sie im Gebet hinauftragen. Arme kleine Tulla, sie hat es nötig, daß sie nach oben getragen wird.«
Er kniete neben der Mutter nieder und legte die Hand, die er frei hatte, auf deren gefaltete Hände.
Das dänische Fräulein überlegte, ob sie auch niederknieen solle; sie wußte nicht recht, was tun. Sie fühlte, wie sehr er nun wünschte, daß er seine Schwester und nicht sie hier gehabt hätte. Schließlich blieb sie stehen, um die Lippen des Kindes zu netzen und seine Stirne zu trocknen, auf der eiskalter Schweiß ausbrach.
Er betete langsam, mit ganz einfachen Worten, die die Frau gerade nachsagen oder still mitbeten konnte. Aber das dänische Fräulein wurde von der Innigkeit betroffen, von dieser Kraft der Innigkeit, womit jedes Wort das kleine Mädchen umfaßte und wirklich nach oben trug und hinaufhob. »Als sie beteten, da bewegete sich die Stätte.« Sie bekam auf einmal eine Empfindung von einer Macht, die die Welt bewegt.
»Wir heben Herz und Hände
Zum Sternenhimmel auf – –«
Auf diese Weise kam sie selbst mit in die Bewegung hinein, sie konnte nicht draußen bleiben, sie mußte folgen. Der Aufstieg riß sie mit.
»Es reicht die Himmelsleiter
Zum Himmel von der Erd' – –«
Diese stiegen sie nun hinauf, er voraus, das Kind auf dem Arm hoch erhoben und die Mutter an der Hand.
Aufwärts ging es, Schritt für Schritt, bis die letzte Stufe erreicht war.
Diese Gewißheit in der Anrufung Gottes! Nein, diese Worte waren nicht in die leere Luft gerufen, wo Tausende von Gebeten umherflattern, ohne ihr Ziel zu erreichen. Sie waren wie unmittelbar in ein Antlitz gesprochen, – in das Antlitz da oben über der Himmelsleiter, sie waren in ein Herz hineingesprochen, in ein offenes Herz, ein weit geöffnetes, mit Raum für Millionen solcher kleiner gequälter Wesen wie diese Tulla.
Die Atemzüge des Kindes waren in ein Röcheln übergegangen, das stockte und wiederkam, in abgerissenen Stößen.
Das dänische Fräulein hatte erst einen Menschen sterben sehen, ihre Mutter, und sie fürchtete sich vor diesem Anblick. Trotzdem beugte sie nun ihr Gesicht zu dem Kinde nieder, um die letzten Zuckungen der Mutter zu verbergen.
Aber es kamen keine mehr. Es war nur, als ob eine Hand, – eine Hand, die sie dafür hätte küssen können – über das verzerrte Gesichtchen hinstriche und es glättete, jede Spur der Qual auslöschte zu tiefer, tiefer Ruhe.
»Und Gottes Engel halten
Treu' Wache um das Kind – –«
Der Pfarrer sagte Amen, und die Stille jagte die Mutter auf.
»Lieber Gott!« rief sie, und warf sich weinend über die kleine Leiche.
Eine halbe Stunde später traten die beiden den Heimweg an. Die Mutter hatte den ersten Schmerz ausgeweint, und eine Nachbarsfrau hatte versprochen, sie während der Nacht zu sich zu nehmen oder bei ihr zu bleiben.
Stumm schritten sie unter dem tiefen funkelnden Sternenhimmel dahin.
»Kleine Tulla,« sagte sie und schaute auf. »Ob sie jetzt hören kann? Ob sie nun atmen kann?«
»Ja,« sagte er. Aber sie wußte nicht, ob er ihre Frage beantwortet, oder sie nur wiederholt hatte.
Dann herrschte wieder Schweigen zwischen ihnen. Es war so schön, ganz zu schweigen, neben einander zu gehen ohne Worte, mit denselben Gedanken – durch die weite und tiefe sternhelle Nacht.
Da hatten sie das Tor erreicht, und sie bat ihn nicht, mit heraufzukommen. Sie verstand wohl, daß er nicht wollte. Hätte sie es nur selbst vermeiden können, die andern noch zu sehen, sowie alle die Fragen in Beziehung auf ihr Ausbleiben beantworten zu müssen.
»Ich danke Ihnen,« sagte er, indem er ihr die Hand reichte.
»Nein, ich habe zu danken, daß Sie mich mitnahmen,« erwiderte sie, »obgleich ich weiß, daß Sie jede andere Persönlichkeit vorgezogen hätten.«
»Warum?«
Sie schwieg.
»Von allen Menschen hätte ich am liebsten den dabei gehabt, der das getan hätte, was Sie taten.«
»Was denn?« Sie sah ihn erstaunt an.
»Die Mutter zu küssen,« sagte er ernst.
»Ach das –« Glänzende Tränen traten ihr in die Augen. Und es wurde ihr nicht leicht, deren Spur zu verwischen, während sie die Treppe hinaufstieg.
Und sie kamen wieder, die Tränen, als sie allein in ihrem Schlafzimmer war und vor dem großen Spiegel saß, während ihr das aufgelöste Haar über den weißen Frisiermantel hinabfloß.
Ihr Gesicht sah so traurig aus in dem Spiegel vor ihr, mitten in all der dunklen Fülle, daß sie sich selbst darüber verwunderte.
Da klopfte es an die Tür, und die Tante trat ein.
»Ich bin es nur, mein liebes Mädchen. Ich möchte gern ein Wort mit dir reden, ehe ich zur Ruhe gehe. Beim Abendbrot ging es ja nicht an.«
Sie setzte sich auf einen der niederen, mit Cretonne überzogenen Stühle.
»Höre, mein Kind, du bist doch nicht auf dem Wege, dich von Halfdan bekehren zu lassen?«
»Wie kommst du darauf, Tante?«
»Ja, denn es sah ja ein wenig eigentümlich aus, als du ihm neulich ins Eßzimmer folgen solltest, um mit ihm über – Gott im Himmel mag wissen, was für einen Kranken zu sprechen, den du gar nicht kennst. Und nun heute Abend kommst du ganz sonderbar von dieser Betstunde heim, – eine ganze Stunde nach Margit, – und sagst, daß du mit ihm gegangen seist. Und – –«
»Wäre es denn so entsetzlich, wenn der Ernst des Lebens mich auch einmal ergreifen würde?«
»Nein, durchaus nicht. Ich bin weit entfernt, zu denken, daß ein Mensch leicht zu viel bekommen könne von dem Christentum, wenn mir die krasse Form auch etwas zuwider ist. Aber die Sache ist die: wenn es Frauen sind, die von Halfdan erweckt werden, junge Frauen, – ja, ältere übrigens auch, – dann werden sie in der Regel zu ihm selbst bekehrt. Und dabei ist nichts gewonnen. Deshalb möchte ich dich nur warnen. Ich hätte gar nicht gedacht, daß er nach deinem Geschmack sein könnte. Aber nun kommt es mir doch so vor – in einem gewissen Sinne – –«
»Tante, weißt du, daß das, was du sagst, empörend ist! Wenn ein Pfarrer nicht hundert Jahre alt ist, kahlköpfig oder verwachsen, dann soll man gleich in ihn verliebt sein, wenn seine Worte nur den allergeringsten Eindruck auf einen machen.«
»Nein, mein liebes Kind, das soll man gar nicht. Aber man wird es sehr leicht. Wenn ein Pfarrer, besonders einer der ganz strengen, jung und schön ist, dann ist es ein gefährliches Ding.«
»Nun, hier kannst du jedenfalls ganz ruhig sein, Tante. Von allen Mädchen auf der weiten Welt wäre ich wohl das letzte, das er wählen würde.«
»Ja, darin wirst du recht haben, das glaube ich auch. Für so verständig halte ich Halfdan doch. Im ganzen ist er den Frauen gegenüber immer vollständig kalt geblieben. Er gibt sich nicht die geringste Mühe, ihnen zu gefallen, und will ja auch gar nicht heiraten, was ich übrigens am allerbesten für ihn finden würde, wenn es ein besonnenes, gesetztes und christliches Mädchen wäre, wie Alette zum Beispiel. Ich habe schon oft gedacht, wie schade es sei, daß die beiden gerade Geschwister sind. Sie hätten ein ausgezeichnetes Ehepaar gegeben.«
Die Nichte lachte, – laut und zornig abweisend, – und schüttelte ihre langen Locken.
»Nun ja, das kann ja auch nicht sein. – Aber verstehe mich nun recht, mein liebes Kind, ich will durchaus nicht haben, daß er nun hingeht und dich – fanatisch macht, so daß du ganz übersiehst, was sich Gutes für dich in der Welt finden könnte, und denkst, er sei der einzige, nach dessen Weisheit du dich richten müßtest, – und schließlich damit endigst, daß du um seinetwillen Diakonissin oder Krankenpflegerin wirst, – wie ich zwei andere kenne, die es so gemacht haben.«
»Davor brauchst du keine Angst zu haben. Es liegt durchaus nicht in meiner Natur, mich nach der Weisheit eines andern zu richten oder Krankenpflegerin zu werden,« sie hielt inne und dachte nur noch weiter, »obgleich das auch nicht das Schlimmste in der Welt wäre, wo es so viele kleine Mädchen gibt, die sterben müssen, – und Mütter, die das mit ansehen müssen.«
Als die Tante gegangen war, sprang das junge Mädchen auf und ging lange im Zimmer auf und ab, während sie alle Augenblicke ihre wallenden Haare schüttelte. Sie war innerlich empört über alles, was die Tante gesagt hatte. Aber als sie endlich zur Ruhe gegangen war, kamen die Tränen aufs neue. Denn sie mußte wieder hineinschauen in die traurige Welt, in die sie einen Einblick bekommen hatte, die Welt, in der es so viele kleine Mädchen gab, die sterben mußten, – und Mütter, die das mit ansehen mußten.
Wieder endlos leere Tage! Und sie konnte nichts tun, um sie auszufüllen. Überall, wo sie ihn hätte treffen können, sagte er ab, zu großen wie zu kleineren Gesellschaften.
Sie wünschte, mit ihm sprechen zu können. Ganz, ganz anders – im Zusammenhang. Sie sehnte sich darnach, ihm einen viel richtigeren Eindruck von sich beizubringen, gerade weil sie auf ganz entgegengesetztem Grund und Boden stand.
Stand – ja das heißt, einen festen Grund unter den Füßen, in Form einer bestimmten Lebensanschauung, einer festgewurzelten Überzeugung hatte sie wohl eigentlich nicht. Aber sie liebte alle großen Gefühle, alle großen Gestalten. Sie hatte ja auch die Religion nicht ganz über Bord geworfen, nur spielte diese gar keine Rolle in ihrem Leben; sie lebte nicht in ihr. Die meisten Christen haben ja ihr Leben neben der Religion.
Sie wünschte sehr, er solle wissen, daß sie alles Große verstehen könne, auch was es heißt, sein Leben für seine Überzeugung einsetzen. Ja, daß dies auch als das Größte vor ihr stand.
Aber er machte sich wohl gar nichts daraus, von ihr gewürdigt zu werden, oder irgend einen anderen Eindruck von ihrer Persönlichkeit zu bekommen, als den, den er sich selbst gebildet hatte. Den, der ihn – trotz allem – doch eigentlich abstieß.
Sie, nur sie sehnte sich darnach, daß es doch geschehe. Aber nach den Reden der Tante an jenem Abend konnte sie nun in dieser Richtung gar keinen Versuch machen.
Dann war der Konsul so freundlich, sich einen kleinen Influenzaanfall anzuschaffen, der ihn zwar nicht ans Bett, aber doch eine Woche lang ans Zimmer fesselte, und der die Veranlassung war, daß der Neffe ihn besuchte.
Er blieb lange – unbegreiflich lange – drinnen beim Onkel. Dann trat er in das Kabinett, wo die Tante mit der Nichte saß; diese malte eben goldene und broncierte braunrote Chrisanthemen auf einen Ofenschirm aus wasserblauem Atlas für die Tante.
»Ist sie nicht ein Genie, Halfdan?« sagte die Tante. »Komm und setz dich ein Weilchen zu uns, mein Lieber.«
Er begrüßte die beiden Damen, und während die Nichte zu ihm aufsah, war es ihr, als liege jene strahlende Sternennacht, wo sie Seite an Seite gegangen waren, so hoffnungslos weit zurück, daß es ganz unmöglich sei, da wieder anzuknüpfen, wo sie abgebrochen hatten.
Das Anknüpfen wurde hier übrigens nicht ihre Sache; das besorgte die Frau Konsul immer, wenn sie anwesend war.
»Kannst du mir nicht helfen, Halfdan, dieses verstockte Mädchen zu der Einsicht zu bringen, daß es die Bestimmung des Weibes ist, sich zu verheiraten. Ist es nicht so?«
»Doch, ich wüßte nicht, welche es sonst noch für sie gäbe. Sie ist, wie ich gelehrt worden bin, dazu geschaffen, die Gehilfin des Mannes zu sein. Und ich meine, es sei am besten, wenn sie diese Bestimmung erfülle.«
Die Nichte wußte nicht recht, ob dies Ernst oder Ironie war, und erwiderte ein wenig herausfordernd: »Ich glaube doch, daß man dies auf mehr als eine Art kann. Ich habe immer Lust gehabt, zur Bühne zu gehen. Glauben Sie nicht, daß man von da aus eine geistige Gehilfin für Männer und Frauen sein kann?«
Er zeigte keine Entrüstung, wie sie erwartet hatte, sondern antwortete ganz ruhig: »Vielleicht, aber dies wäre doch mehr indirekt.«
»Ja, das ist ein unsicherer, schwieriger Weg,« sagte die Tante. »Und deine Mutter war so sehr dagegen. Jawohl, das war sie. Ihr Wunsch war, dich gut verheiratet zu sehen. Das weiß ich am besten.«
»Ja, liebe Tante, aber dazu gehören ja unglücklicherweise zwei. Und ich weiß absolut keinen, der mich haben möchte.«
»Nicht? Nun, dann weiß ich mehrere. Nehmen wir nur z. B. Dr. Carlsen. Hast du es neulich bei Bödkers nicht bemerkt, Halfdan, wie seine Augen keinen Blick von ihr verwandten?«
»Nein, – – doch – es ist möglich.«
»Ja, Kind, dessen bin ich ganz sicher, daß er nur einen Gedanken hat, nämlich dich zur Frau zu bekommen. Nun heißt es ja, er werde seinem Vater als Oberarzt an der Irrenanstalt in R… nachfolgen, und dann – –«
»Dann kann er sich selbst als ersten Patienten anmelden, wenn du recht hast. Denn dann müßte er ja an Größenwahn leiden.«
Sie konnte der Lust nicht widerstehen, die Tante ein wenig zu necken und den andern wissen zu lassen, wie wenig sie für diesen Dr. Carlsen übrig hatte. Trotzdem aber war es ihr, nachdem ihr die Worte entschlüpft waren, ganz klar, daß sie sich, und zwar gerade hier, für Lebenszeit unmöglich gemacht habe.
Aber gleichzeitig hörte sie neben sich ein Lachen, ein ganz lautes und »bubenmäßiges«, wie die Tante es empört nannte. Und da mußte sie unaufhaltsam mitlachen. Mit ihm zusammen lachen! Das brachte sie um viele Meilen näher! Später erinnerte sie sich mit freudigem Schauder daran, wie es gewesen war, als ihr Lachen in dem seinigen unterging.
»Du hilfst mir ja recht gut, sie zu ermahnen,« sagte die Tante. »Aber du hast ja auch selbst nicht das gute Beispiel gegeben.«
»Entschuldige, Tante, ich bin es ja nicht, der als Gehilfe erschaffen worden ist.«
»Nein, aber du bist dazu geschaffen, eine Gehilfin zu haben, und ohne das hat der Mann es ›nicht gut‹. Das bin ich gelehrt worden.«
»Meinst du vielleicht, er habe es durch die Hilfe der Frau sehr ›gut‹ bekommen – der Mann nämlich? Eine andere Bibelstelle nennt die Frau mit ganz klaren Worten auch ein Hindernis. Und ich bin auch überzeugt, daß ein Mann sehr vorsichtig sein muß, ehe er diese – Möglichkeit in sein Leben einfügt. Besonders ein Pfarrer, bei dem alle Ansprüche verschärft sind, äußerlich wenigstens.«
»Darauf kann ich nur erwidern, daß die besten Pfarrer, die ich gekannt habe, jedenfalls eine oder auch mehrere Frauen gehabt haben. Je mehr ein Pfarrer wie alle andern lebt, um so seelsorgerlicher kann er sein, natürlich auf die rechte Art und Weise.«
»Auf die bequemste jedenfalls.«
»Laß doch den Herrn Pfarrer in Frieden, Tante,« sagte die Nichte ein wenig erregt. »Wenn man in jedem Jahrhundert einmal einen Pfarrer trifft, der nicht verheiratet ist, so muß man doch einräumen, daß – daß der dann dem Ideal am nächsten ist.«
»Nein, das gebe ich auf keinen Fall zu. Bischof H. war dreimal verheiratet. Und einen besseren Seelsorger als ihn verlange ich nicht. Und von einem andern ausgezeichneten Bischof weiß ich, daß er es bis zu vier Frauen brachte.«
»Dann muß ich es wohl aufgeben, Bischof zu werden, mir wird es sicherlich an den entscheidenden Bedingungen fehlen.«
Wieder lachte er, und ihr Lachen flog auf zum Zusammenklang, wie ein Vogel mit befreiten Schwingen. Wer hätte gedacht, daß er so lachen könnte! Sie kannte dieses Lachen ja von Grund aus. Warum versteckte er es denn so gut?
Aber die Frau Konsul schüttelte mißbilligend den Kopf und sagte, mit solchen Würdenträgern dürfe man keinen Scherz treiben.
Später sagte sie noch, so höre man ihn jetzt nur selten lachen. Das sei ein Nachklang aus der Zeit, wo er gar so übersprudelnd gewesen sei.
Und übersprudelnd zu sein, dazu hatte die Nichte an diesem Tag die größte Lust. Ihre Chrisanthemen strahlten wie reines Sonnengold! Und der Konsul war von beispielloser Liebenswürdigkeit. Hatte er es denn nicht so eingerichtet, daß der Pfarrer versprochen hatte, am nächsten Abend mit der Schwester zu kommen, und zwar ganz in der Familie!
Ja, während der ersten Hälfte des Abends hatte man eigentlich nur von ihr etwas. Er vergrub sich ja bei dem Onkel bis zum Abendbrot. Und bei Konsuls speiste man sehr spät zu Mittag und zu Abend, ganz entgegen den sonstigen Gewohnheiten in Christiania.
Die Tante schätzte Alette sehr; sie liebte es, diese hie und da zu einem »ruhigen, vernünftigen Gespräch über den Ernst des Lebens« neben sich auf dem Sofa zu haben, worunter sie all die Armut, Krankheit und Not meinte, in die das Fräulein durch den Bruder einen Einblick erhielt.
Die Nichte saß über eine Handarbeit gebeugt und wurde ganz blaß vor Ungeduld über all die »traurigen Geschichten« aus diesem ewigen Zusammenleben mit »Halfdan«; aber auf einmal ergoß sich eine helle Röte über ihr ganzes Gesicht.
Alette erzählte, daß der Bruder kürzlich bei einer Witwe gewesen sei, die ihr einziges Kind verloren hatte, ein taubstummes dreijähriges Mädchen, an Tuberkulose, und daß es ganz herzzerreißend gewesen sei, sehen zu müssen, wie diese Kleine, die nichts verstand und nichts sagen konnte, all dieses schwere Leiden durchmachen mußte.
»An dem Abend, wo sie starb, ist Halfdan angegriffener gewesen, als ich ihn in langer Zeit gesehen habe. Bis spät in der Nacht ging er in seinem Zimmer auf und ab. Er konnte nach diesem Anblick durchaus keine Ruhe finden. Ich wäre so gerne mit ihm gegangen, aber es war in den Tagen, wo ich wegen meines Hustens das Zimmer hüten mußte. Deshalb mußte er allein gehen.«
»Es war schwer, davon zu hören,« sagte die Tante, »und recht traurig für dich, daß du nicht mit ihm in das Trauerhaus gehen konntest. Eine Frau findet so oft den richtigen Balsam für eine betrübte Seele.«
Da war eine, in der eine jubelnde Freudenstimmung aufstieg. Aber sie saß über ihre Arbeit gebeugt ganz still da.
Alette wandte sich nicht an sie. Diese Sachen lagen natürlich ganz außerhalb ihrer Erfahrung und ihrer Interessen.
Als der Bruder endlich mit dem Konsul eintrat, erzählte die Schwester eben von einem Jungen, der von einem Wagen überfahren worden war und große Schmerzen litt. Es war der Sohn eines Arbeiters, und als der Pfarrer diesen ermahnte, für das arme Kind zu beten, hatte er geantwortet: »Wir haben niemand, zu dem wir beten können.«
»Ist es nicht schrecklich zu denken, daß es Tausende gibt, die wie dieser Mann niemand haben, zu dem sie beten können? Kann man begreifen, wie es möglich ist, ohne Gebet zu leben?«
»Nein, da hast du recht,« sagte die Konsulin. »Es ist erschütternd.«
»Aber schlimmer ist es doch,« sagte der Bruder, »daß es Tausende gibt – auch von denen, die beten, wenigstens dann und wann – die niemand haben, den sie anbeten.«
Beide Damen auf dem Sofa stimmten damit überein, die Schwester wohl aus Ueberzeugung, die Tante vielleicht mehr aus Höflichkeit als Wirtin.
Einen Augenblick später stand er in dem Kabinett, um die Chrisanthemen zu betrachten, die die Nichte an diesem Tag beinahe vollendet hatte.
»Ich weiß, was anbeten heißt,« sagte sie plötzlich, während sie die Lampe für ihn in die Höhe hielt.
»Nun – dann gratuliere ich.«
»Nein, ach nein, so war es nicht gemeint. Ich wollte nur sagen – ich habe es einmal gesehen – in dem Blick eines Menschen. Es ist so viel, als seine ganze Seele hingeben.«
»Ja, so könnte es wohl ausgedrückt werden. Aber es klingt nicht treffend, nicht stark genug. Es heißt gleichsam, seine ganze Persönlichkeit zusammenfassen: alles was man hat, alles was man ist, in ein einziges Gefühl – ein einziges abgrundtiefes Gefühl der Ohnmacht, des Nichts – – und es dann zu den Füßen eines Einzigen ausschütten. David sagt in einem der Psalmen, daß er ›ausgegossen sei wie Wasser‹, das gehört dazu. Seine ganze Seele wie Wasser auf die Erde ausgießen, vor die Füße eines Einzigen – – und dadurch gewonnen – aufgenommen – vertieft – verwirklicht werden.«
»Ja,« sagte sie. »Ich habe dies gesehen.«
»Ich glaube, es ist sehr selten,« sagte er. »Es steht ja geschrieben: Du sollst Gott deinen Herrn anbeten. Und dies ist in dem Verhältnis zu Gott das Höchste und Tiefste, das Erste und das Letzte. Aber sie tun es nicht, die Tausende! Sie erreichen nie den Augenblick, den ganz unentbehrlichen in einem Menschenleben, wo alle Worte und Gedanken, alle Fähigkeiten und Kräfte zur Erde sinken – ohnmächtig. Wo der unaussprechliche Seufzer die Seele trägt, wie eine Woge, hinein ins Heiligtum.«
Während er sprach, schaute er fortgesetzt ihre Chrisanthemen an. Aber sie fühlte, daß sein Blick durch die Blumen hindurch glitt, weit helleren Bildern in der Ferne entgegen, und mit etwas von dem im Auge, das sie von jenem Tag her kannte, wo sie ihn vor dem Altar gesehen hatte.
Und gerade wie damals, berührte es sie wie ein Schmerz.
Sie selbst war ja so weit weg – so fern von ihm in diesem Augenblick – und weit, weit entfernt von dem Tiefsten und Höchsten, von dem ersten und letzten Moment in einem Verhältnis zu Gott.
Und doch – was es hieß, seine ganze Persönlichkeit in ein einziges Gefühl zu vereinigen und ausgegossen zu sein wie Wasser auf der Erde, vor den Füßen eines Einzigen, – wer, ach wer in der weiten Welt konnte es besser verstehen als sie!
Im Dezember wollten Konsuls einen Ball geben, das heißt – die gnädige Frau wollte es.
»Etwas muß man tun, wenn man einen solchen Vogel Phönix im Haus hat,« sagte sie.
Der Konsul sah aus, als ob er dächte, weniger hätte es auch getan. Aber die Aussicht auf eine ungestörte Spielpartie in seinem Zimmer mit einigen der Vettern verlockte ihn zu schweigender Einwilligung.
Großartig sollte es sein. Wenn der Saal ausgeräumt wurde, hatten vierundzwanzig tanzende Paare gut Platz. Was tat es da, wenn man mehrere Tage vor und nachher in seinem eigenen Heim saß »wie Marius auf den Trümmern von Karthago« – oder wie es sonst der Konsul zu nennen pflegte.
Die Nichte hatte nur einen Gedanken, während sie Einladungen adressierte und ihr Kleid anprobierte – ob, ob – –?
Nein, das war wohl unmöglich!
»Es sähe aus, als wollte man Halfdan und Alette zum Besten haben, wenn man sie zu so etwas einladen würde,« sagte die Tante. »Aber hinter ihrem Rücken soll der Ball auch nicht gehalten werden. Ein paar Tage vorher schreibe ich an sie, daß wir eine kleine Tanzgesellschaft geben – für unser liebes ›dänisches Fräulein‹ – und ob sie nicht Lust hätten, sich ihn anzusehen. Aber das haben sie natürlich nicht.«
Und der Tag rückte herbei.
Es geschah – ja, das Unmögliche selbst flutete herein ins Leben mit seiner unhemmbaren Gewalt und machte alle bleichen Möglichkeiten zu Schanden.
Es gab einen Liedervers, der einmal nach einem Begräbnis durch ihr Kinderköpfchen gegangen war und sich da festgesetzt hatte. »Da wird mir das zum Grund, was vorher Dach gewesen.« Diese Vorstellung gefiel ihr als kleines Mädchen. Und nun war es ihr, als würde sie zur Wirklichkeit.
Der Sternenhimmel, den sie hoch über sich in unermeßlichem Glanz leuchten gesehen hatte, der lag eines Abends zu ihren Füßen als der Grund, der ihr ganzes Dasein trug.
Der Augenblick kam, wo alles nicht mehr seinen Gang ging, seinen gewohnten trägen, bekannten, abgemessenen Gang, sondern wo »die Sonne stille stand in Gibeon und der Mond im Tale Ajalon«, wo das ganze große, schwirrende Weltrad still stand, während alles im Weltenraum nur verwundert mit angehaltenem Atem lauschte.
»Und es geschah« – –
Wie es geschah? Ach, tausend, zehntausendmal begann sie immer aufs neue in Gedanken… und kam doch nie damit zu Ende, kam nie an dem Punkt vorbei, wo alles vor ihr aufging in strahlendem Licht… so daß sie immer und immer wieder vorne anfangen mußte…
Es war an dem Ball ihres Onkels.
Sie hatte ihr Kleid gewählt und es angezogen mit der einzigen, beinahe unmöglichen Möglichkeit vor Augen.
Der blaßgelbe, von Spitzen verschleierte Atlas schmiegte sich glänzend und knisternd um ihre schlanke Gestalt und umschloß ihre feine Büste wie ein Panzer. Goldleuchtende Topase funkelten in ihrem dunklen, lockigen Haar, um den weißen Hals und zwischen den Spitzen über der Brust, wo sie dunkelviolette, von schwerem Duft erfüllte Heliotropblüten festhielten.
Sie war spät fertig geworden, und als sie aus ihrem Zimmer in die festlichen Räume trat, waren die Lichter überall schon angezündet. Im Saal war man eben bei den letzten angelangt.
Hier drinnen stand die Frau Konsul in blaßgrauem broschiertem Atlas, eifrig beschäftigt, einem Lohndiener einige nachdrückliche Verhaltungsmaßregeln zu geben, während der Konsul schon mitten im Zimmer stand, wo er mit ihr zusammen die Gäste begrüßen sollte, die sie schon draußen hörte.
Die Nichte wandte an der Tür des Saales wieder um, ging durchs Wohnzimmer zurück und ins Kabinett hinein, wo rosenfarbige seidene Lichtschirme auf allen Lampen einen Dämmerschein wie von einem Sonnenuntergang verbreiteten.
Es war ihr zuwider, sich besehen und bewundern zu lassen.
Und doch war sie die Königin des Abends – das fühlte sie selbst – von der funkelnden Nadel im Haar an bis hinunter zu dem spitzigen Atlasschuh.
Der große Spiegel in der Ecke am Fenster zeigte ihre Gestalt in wirklich hinreißendem Glanz, während sie langsam, – gleichsam in müder Majestät darauf zuschritt.
Da – – nein, nein – – nein – – blitzschnell schloß sie die Augen…
Nein – – es war ein Trugbild –, eine glühende Sehnsucht, die in ihr aufstieg und sie verwirrte, – – es war eine Einbildung, daß sie da vor sich im Spiegel – aus dem Hintergrund des Zimmers ein Augenpaar auf sich gerichtet gesehen hatte.
Zwei Augen, – deren Blick hervordrang wie eine lodernde Glut, die ihre ganze leuchtende Gestalt umhüllte…
Sie hielt die Augen fest geschlossen. Sie konnte es nicht ertragen, sehen zu müssen, daß es nur eine Einbildung war – und war doch nicht sicher, zu glauben, daß die Augen wirklich da waren.
Mechanisch glitt sie näher zu dem Spiegel hin… Wenn aber nun der vergoldete Blumenbehälter, der davor stand, sie aufhielt, – was dann?
Sie stieß mit dem Fuß an das Hindernis – blieb dicht vor dem Spiegel stehen, öffnete die Augen, groß und dunkel vor angstvoller Erwartung – und sah…
Der Blick war noch da. Und der Blick war Feuer.
Langsam, mit blassen Wangen, wandte sie sich vom Spiegel.
Der Blick war da… Näher – näher… loderte er flammend auf, ihr entgegen…
Er kam von einem, der mitten durchs Zimmer geschritten war… und nun zu ihren Füßen kniete…
Ein halb unterdrückter Schrei – – und sie fiel zu Boden in all ihrer leuchtenden Herrlichkeit…
Einen einzigen schwindelnden Augenblick waren Arme um sie – war ein glühender Atem über ihrem Gesicht – war eine kecke Hand da, die die Heliotropblüten von ihrer Brust nahm und sie an der seinigen barg.
Dann kamen die Gäste.
»Wir haben sehr hübsche Damen heute abend, Frau Smit!« sagte die Frau Konsul. »Aber meiner Nichte gebührt doch der erste Preis.«
»Ja, da haben Sie ganz recht. Wenn sie nur nicht so bleich wäre! Ist sie auch gesund?«
Die Nichte sollte den Ball eröffnen mit einem Vetter aus Kopenhagen, der auf acht Tage gekommen war, aus dem sie sich aber nicht viel machte. Er hatte den wenig ehrerbietigen freien Ton des Vetters ihr gegenüber.
»Ist es dir sehr leid, wenn wir nicht vortanzen?« fragte sie, während sie im Saal umhergingen.
»Nein – aber ich glaube, Onkel Hallager hat mich mit der Influenza angesteckt. Es ist mir ganz sonderbar im Kopf.«
»Ja, du siehst auch todesblaß aus. – Nein – um meinetwillen keine Aufregung. – Obgleich – ich bin als Tänzer berühmt.«
Sie traten zur Seite und ließen ein anderes Paar vortanzen, dem sogleich mehrere folgten.
»Es wäre doch recht ärgerlich, wenn du mitten in der Saison krank würdest. Ja, denn es ist doch wohl nicht er, der Halfdan, der dich so verwandelt hat, daß du nicht einmal mehr wagst, ein Tänzchen in Ehren zu machen! – Hast du übrigens gesehen, daß seine Heiligkeit heute anwesend ist? Mitten in all dieser Verderbnis der Welt? Was das nun bedeuten soll! Niemand kann es begreifen.«
»Vielleicht ist eine Seele da, deren er sich annehmen will.«
»Solch eine Affektation! Mitten in einem Ballsaal!«
»Ach – wenn es sich nun ums Leben handelte – ich kann gut verstehen, daß man da eingreifen möchte – selbst in einem Ballsaal.«
Die Frau Konsul kam in all ihrem broschierten Glanz eilig auf sie zu.
»Aber Kind, warum tanzest du denn nicht?«
»Ich habe Fieber, liebe Tante, und fürchte, es könnte schlimmer werden.«
»Mein liebes Kind, das fehlte nur noch. Frage doch Dr. Carlsen um Rat.«
»Nein, nein. Nicht heute abend. Das fällt bloß auf.«
»Dann setze dich wenigstens. Und sieh, daß du etwas Warmes zu trinken bekommst!«
Kurz nachher trat der Pfarrer auf sie zu.
»Haben Sie noch eine Tour für mich frei?« fragte er. »Auf diese Weise kann ich ja auch mittun.«
Sie reichte ihm ihre Tanzkarte, ohne ein Wort zu sagen und ohne die Augen zu ihm aufzuschlagen.
Den ersten Tanz nach dem Essen hatte sie frei gehalten. Er machte ein Zeichen daneben und entfernte sich.
Sie sah auf die Karte – und barg sie in ihrem Gürtel.
»Du siehst aus, als seiest du am ohnmächtig werden,« sagte der Vetter. »Geh hinauf und lege dich in der Pause ein wenig nieder.«
In der Pause war sie vielen teilnehmenden Fragen und Ratschlägen ausgesetzt, die sie nur quälten.
»Ausnahmsweise ist es ja ganz angenehm, nicht zu tanzen,« sagte sie. »Ich habe mehr von der Unterhaltung meiner Herrn.«
»Meinst du damit auch den Tanz, der eben zu Ende gegangen ist? Er, der Nikolai, hat es unserer Ansicht nach doch nur in den Beinen,« sagten die norwegischen Cousinen.
Das Souper war ungewöhnlich früh festgesetzt worden, weil der Konsul ausdrücklich befohlen hatte, daß die, die nicht tanzten, nicht bis Mitternacht hungern dürften. Infolge dessen hatte die Konsulin es so eingerichtet, daß man alle soliden Gerichte bei einer ersten Mahlzeit bekam und sich später dann noch um einen ausgesucht feinen Nachtisch versammelte.
Die Frau des Hauses selbst wurde von einem bekannten schwedischen Professor zu Tisch geführt.
Er mußte die Tischrede halten; und nach einem Hoch auf den Wirt und die Wirtin und einem auf das herrliche Gebirgsland Norwegen, erhob er sich und hielt eine Rede auf »die Frau«.
Nachdem er verschiedene schöne, wenn auch nicht durchaus neue Vergleiche für sie gefunden hatte, erklärte er schließlich, daß er, einer begeisterten Zustimmung sicher, festsetzen wolle, daß die »Frau, wenn sie so ist, wie sie sein soll – –«
»Das ist sie ja nie,« warf der Konsul plötzlich ein.
Dies wurde gehört, und er bekam die begeisterte Zustimmung.
Der Professor lachte mit den andern und sagte, als er endlich wieder zu Wort kommen konnte, daß er, nachdem der Schluß seiner Rede in der ersten Form nun unmöglich gemacht sei, und weil alle mit dem verehrten Gastgeber übereingestimmt hätten, vorschlagen wolle, daß jedermann sein Glas leere auf »die Frau, die nicht so ist, wie sie sein soll, weil sie trotzdem reizend ist.«
Ein lautes Bravo erklang im ganzen Saal.
Aber die Konsulin, die sich ihr Urteil über die Aeußerung des Konsuls vorbehielt, drohte lächelnd dem Professor und sagte, daß sie dieses Hoch nicht annehme, weil sie eine solche Huldigung mehr als zweifelhaft finde.
Da trat die Nichte plötzlich mit dem erhobenen Champagnerglas und fieberheißen Wangen zu dem Professor.
»Darf ich Ihnen für Ihre Rede danken?« sagte sie. »Als die Frau, die gar nicht ist, wie sie sein soll, die aber dem Manne dankt, der hervorhebt, daß sie doch angeht.«
Lächelnd verbeugte sich der Professor vor ihr. Dann trank er ein besonderes Glas mit der Wirtin auf »die Frau, die ist, wie sie sein soll.«
Dann folgte ein Tanz, während dem das dänische Fräulein wieder ruhig bei ihrem Tischherrn sitzen blieb und auf alle seine Bemerkungen immer einsilbigere Antworten gab.
Während der nächsten Pause bat die Tante sie dringend, doch zu Bett zu gehen.
»Du bist wirklich krank. Man merkt es an allem.«
Aber sie erwiderte, daß sie bis zum Schluß aushalten wolle.
Als die Musik den nächsten Tanz anstimmte, hatte sie große Angst, es könne sie jemand beobachten.
Sie fühlte, daß sie ganz kalt im Gesicht wurde…
Lachend und plaudernd zogen die Paare in den Saal hinein, und die Älteren folgten langsam zur Tür, um dem Tanzen zuzusehen. – Ihr Herz stand still –
Er kam und bot ihr den Arm.
Mit niedergeschlagenen Augen legte sie ihre weißen Fingerspitzen darauf.
Und ohne ein Wort, wie auf vorhergehende Verabredung, führte er sie hinaus aus dem Saal, durch die leeren Zimmer nach der großen Veranda, die dem Fest zu Ehren geöffnet und in einen Wintergarten umgewandelt worden war, mit vielen blühenden Pflanzen, über die matte weiße Ampeln ein weiches Opallicht warfen.
Indem er sie zu der Glastüre hinausführte, fühlte er, daß die Hand, die auf seinem Arm ruhte, eiskalt war und zitterte.
Er legte seine Hand darüber. »Warum?« fragte er. »Fürchten Sie sich?«
»Ja.« Dies klang tonlos wie ein kaum vernehmbares Flüstern. Und die bebenden Augenlider lagen tief auf den Augen.
Er hielt an. »Sollen wir umkehren?«
»Nein, nein, – nein!«
Er beugte sich tief herab und drückte seine Lippen auf die weiße zitternde Hand.
Dann führte er sie hinaus – in den Duft und Schatten der blühenden Gewächse…
Schlafen – – nein, von Schlaf war in dieser Nacht keine Rede.
Sie warf sich nur hin und her, wie von einer Feuerwoge gewiegt… die Feuerwoge, die um sie aufgelodert war, die sie mit Gewalt fortgerissen hatte und fortgetragen, weg von sich selbst, – da draußen zwischen all den Blumen…
Die Blumen, die Blumen! Es waren so viele frischerblühte, daran erinnerte sie sich nun. Die hatten sie angesehen wie mit Augen. Sie hätte gern alle die geöffneten Kelche geschlossen – die Hände darüber gelegt –
Sie durften nicht, – durften nicht gesehen haben – das, woran sie sich selbst nur mit geschlossenen Augen zu erinnern wagte, – den Augenblick, den einzigen Augenblick, den sie wirklich gelebt hatte, seit sie geboren war, – den Augenblick, wo sie sich in die Hände eines andern hingab.
Ach, diese Hände, die sie umschlossen – so siegessicher, so gebieterisch und doch so bittend! Die Hände, die nahmen, und indem sie nahmen, ihr tausendfach wiedergaben, sie ohne Maß und grenzenlos bereicherten, sie mit dem unfaßlichen, unergründlichen Gefühl erfüllten, zu sein, zu sein… das, was man nie erreicht, ehe man einem andern gehört.
Denn sein eigen gehören, das heißt sterben. Ja, weniger als sterben, es heißt gar nicht sein.
Aber einem andern zu eigen werden, das heißt leben. Sie drückte beide Hände aufs Herz. Ja, nun schlug es… wie jauchzend schnell, wie lebendig!
So lange die Dunkelheit sie umfing, war das ganze schwindelnde Glück noch da.
– Aber als die Dämmerung sachte herbeischlich und sie mit kalten, nüchternen Augen anschaute, da richtete sie sich mit einem Ruck im Bette auf und fühlte, daß es unmöglich sein konnte. Nein, es konnte nicht sein!
Der anbrechende Morgen, grau und eisig, ohne Farbe, ohne Schatten, ohne Glanz wie die Vernunft selbst, er erinnerte sie immer an eine Hinrichtung. Und auf einmal war es ihr, als sei sie die Verurteilte.
Denn diese Morgendämmerung, sie schlich sich auch zu ihm hinein. Sie weckte ihn aus der Verblendung des gestrigen Tages wie aus einem Fiebertraum. Er würde es unbarmherzig deutlich sehen, daß es das Undenkbarste, das Wahnsinnigste wäre, – daß sie von allen die letzte sei, die er wählen sollte.
Er würde das Todesurteil fällen, – sie fühlte es – und es bestätigen, wenn er beim Kaffee in die blaugrauen Augen der Schwester sah, die nüchtern waren wie die Morgendämmerung selbst, deren ruhiger Blick ihn hell wach machen mußte.
Dann würde der Schwertstreich fallen – es schauderte sie im Nacken – und sie würde die Nachricht erhalten…
Sie stand auf und kleidete sich an – stehend wollte sie den Schlag hinnehmen – und jagte den Mägden durch ihr plötzliches, unerwartetes Eintreten keinen kleinen Schrecken ein. Sie waren gewohnt, daß das dänische Fräulein von allen zuletzt aufstand.
Der Kaffeetisch war bald gedeckt. Und zum ersten und letztenmal trank sie mit dem Konsul zusammen, der zeitig wie immer auf sein Kontor wollte. Die Tante, die sonst eine Frühaufsteherin war, fühlte sich an diesem Tag übermüdet und glaubte, die Nichte ruhe auch noch.
Das dänische Fräulein setzte sich ins Kabinett. In allen andern Zimmern ging man noch immer wie zwischen den Ruinen von Karthago, wie der Onkel vor sich hin brummte, als er sich eilig diesem Anblick entzog.
Hier wartete sie auf den Brief, der kommen mußte – und unwillkürlich begann sie, ihre Antwort zu formen.
»Es ist wahr, daß ich weit entfernt bin, vollkommen zu sein. Wo wollen Sie übrigens den Menschen finden, der das ist? – Aber ich liebe Sie, wie niemand, niemand sonst auf der Welt es kann – –
Gegen elf Uhr klingelte es. Zum zwanzigstenmal stand ihr Herz still – und als sie die Stimme hörte, verstand sie es. Er wollte es ihr selbst sagen.
Das Stubenmädchen öffnete ihm die Türe. Sie erhob sich und stand da – starr und weiß wie eine Bildsäule.
Die Türe wurde geschlossen. Und in demselben Augenblick war sie der Erde entrückt und die Welt um sie versunken – die Feuerwoge ergriff sie…
Das erste, was sie sagte, als es ihr möglich war, zu Wort zu kommen, war:
»Ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert.«
»Die Unwürdigen sind es, die ich suche,« sagte er und wollte nicht aufhören, sie zu küssen.
»Ja, aber nicht dazu – Halfdan – du mußt mich hören!«
Er hielt sie plötzlich auf Armeslänge von sich. »Was hast du gesagt?«
»Es wird mir nie gelingen, es dir zu sagen, wenn – du mich so ansiehst.«
Sie faltete die Hände um seine Schulter, legte ihren Kopf darauf und sagte: »Halfdan – geliebter Halfdan –«
»Nun muß ich dich sehen, – ich muß wirklich.«
»Nein – nein, du mußt mich hören. Halfdan – von dem Scheitel bis zu den Zehenspitzen, von den Augen bis auf den tiefsten Grund der Seele habe ich nichts, das annähernd gut genug für dich wäre.«
Er strich ihr sanft über das Haar. »Ich meine, das könntest du mich entscheiden lassen.«
Der dunkle Nacken wurde energisch geschüttelt. »Nein, denn du kannst es nicht so gut wissen wie ich. – Und du konntest mich auch zuerst nicht leiden.«
»Nicht?« Er strich ihr wieder über das Haar. »Nein – leiden vielleicht nicht.«
»Und siehst du, Halfdan, du mußt dich nicht fürs ganze Leben gebunden halten, weil du gestern abend ein wenig – verwirrt wurdest.«
Er nahm ihren Kopf zwischen seine beiden Hände. »Was wurde ich?« fragte er.
»– oder überrumpelt – von all dem, das doch keine Spur von Wert hat.«
»Was wurde ich?«
Sie brach in Tränen aus; die schreckliche Spannung, in der sie sich befand, mußte sich Luft schaffen. Und sie konnte seinen scherzhaft glücklichen Ton nicht ertragen.
Er ließ sich auf ein Knie nieder und zog sie in seine Arme, er konnte sie nicht weinen sehen und wollte wissen, was er gesagt habe, das ihr weh habe tun können. Sie schmiegte ihr tränenfeuchtes Gesicht an das seinige.
»Was hast du mir vorhin sagen wollen, Geliebte – Geliebte?« fragte er.
»Daß – wenn du es bereuen solltest, Halfdan, – wenn du vor dir selbst einräumen müßtest, daß du eine bessere Wahl hättest treffen sollen, – daß dann niemand« – sie schmiegte ihre Wange fester an die seinige – »hörst du, niemand dir mehr recht darin gäbe als ich – niemand, der dich doch besser verstehen könnte, wenn du nun – es ungeschehen machen würdest.«
»Dann müßte etwas andres zuerst ungeschehen gemacht werden, das, daß du existierst.«
Er stand auf und zog sie mit sich in die Höhe.
»Du bist die, die ich liebe,« sagte er und schlang seine Arme innig um ihren Hals. »Das war keine andere, das kann keine andere je werden. Du bist mir als Gattin zugeführt worden, das glaube ich. Und das, was mir gehört, gebe ich nicht frei. Denn es gehört zu meinem eigenen Leben, zu meiner eigenen Persönlichkeit.«
Er neigte seine Lippen zu den ihrigen.
»Fleisch von meinem Fleisch, Seele von meiner Seele, trotz allem, was anders aussehen könnte, – ich liebe dich.«
Die Frau Konsul war fast verzweifelt, als sie die Verlobung hörte, und machte durchaus kein Hehl aus ihren Gefühlen.
»Es ist der reinste Wahnsinn,« sagte sie zu der Nichte. »So wenig haben noch nie zwei Menschen zusammengepaßt.«
»Aber wir lieben einander, wie sich noch nie zwei Menschen geliebt haben.«
»Ja, das kennt man. Sich so lieben, können alle Männer und Frauen mit nur ein wenig gutem Willen und Gelegenheit. Das ist nichts, um darauf zu bauen. Nein, ob man zusammenpaßt, das entscheidet das Glück in der Ehe.«
Die Nichte schlang den Arm um die Tante. »Die Lieb' ist lauter Freude!« sang sie. »Glaubst du das nicht?«
»Ich glaube, daß ihr einander unglücklich machen werdet. Das glaube ich. Für dich passen nicht die engen und düsteren Falten, in die er nun einmal sein Leben gelegt hat. Du mit deinen künstlerischen Interessen, deinem lebenslustigen Sinn, deinen verfeinerten Gewohnheiten, du solltest einen Mann der Wissenschaft oder einen Künstler heiraten, der ein großes Haus machen würde, wo geistreiche Leute sich versammeln würden! Aber es ist auch um Halfdan schade. Du bist durchaus nicht die Frau, die er haben sollte.«
»Er hat mich aber doch gewählt.«
»Ja – er hat sich in dich verliebt. Das wundert mich nicht. Ursprünglich ist er eine etwas leidenschaftliche Natur. Und er hat sich so eingeschnürt, daß es an irgend einem Punkt losbrechen mußte. Im ganzen genommen sind die Männer ja – zuzeiten – viel heißblütiger, von ihren Leidenschaften viel mehr beherrscht, als wir Frauen. Dann sind sie keinen Vernunftgründen zugänglich. – Aber zu anderen Zeiten sind sie wieder viel nüchterner und überlegter als wir begreifen, und in einem solchen Augenblick kannst du es ja versuchen, ihn zu fragen, ob du seinem eigenen Ideal von einer Pfarrfrau entsprichst. Dazu bist du ja nicht einmal christlich genug.«
»Ich habe ihn gefragt, und er hat geantwortet – nach reiflicher Überlegung. Nie möchte ich ihn durch das binden, was du die leidenschaftlichen Momente nennst. Es gibt nicht viel Gleichartiges in uns, das ist wahr. Aber deshalb kann doch Einigkeit zwischen uns sein. Sie kommt nicht daher, daß man sich gleicht, sondern daß man sich ergänzt.«
Im ganzen Familien- und Freundeskreis wurde die Neuigkeit mit Anklängen an die Aussprüche der Tante aufgenommen.
» Vox populi,« sagte der Pfarrer, »darin können wir uns nicht täuschen. Es ist nur gut, daß sie nicht immer mit vox dei zusammenfällt.«
Sie lachte, aber nicht ganz so freudig wie er. Denn es war eine Unsicherheit über ihr, und diese ließ sich nicht weglachen.
Was die Nächste, seine Schwester, gesagt hatte, erfuhr niemand. Zu allen andern sagte sie nur: »Ich habe seit Jahren gewünscht, daß Halfdan sich verheirate.«
Und wenn man weiter fragte, ob auch die Schwägerin nach ihrem Wunsch sei, antwortete sie: »Ich verlasse mich auf die Wahl meines Bruders, in diesem, wie in allem andern.«
»Alette hat es recht nett aufgenommen,« sagte die Konsulin. »Und sie wird sich auch wohl taktvoll und korrekt aufführen, so lange es dauert. Denn das soll mir doch niemand weismachen wollen, daß die Verlobung nicht wieder rückgängig werde.«
Das Herz klopfte der jungen Braut heftig, als sie zum erstenmal zu Alette ging.
Das waren nun die Zimmer, wo ihre sehnsüchtigen Gedanken so oft in alle Winkel geschlüpft waren, in denen sein tägliches Leben sich abspielte, das Leben, von dem es ihr vorkam, daß sie gern ihr Herzblut hingeben würde, um an dessen kleinsten, unbedeutendsten Vorkommnissen teilnehmen zu dürfen.
Zum erstenmal an seinem Schreibtisch stehen, neben dem Stuhl, den er zu benützen pflegte, – durchs Eßzimmer gehen, wo er bei Tisch saß – sie war so überwältigt davon, daß sie zuerst gar nichts sagen konnte.
Die Schwester war bleich, trat ihr aber mit ausgestreckten Händen entgegen.
»Ich wünsche Ihnen Glück,« sagte sie, indem sie die Braut ernst ansah.
Diese versuchte zu lächeln. »Ich weiß, daß Sie mich nicht lieb haben,« sagte sie.
»Dazu kenne ich Sie noch zu wenig,« erwiderte Alette ruhig, während sie einen Stuhl für die Schwägerin heranzog und sich selbst auch setzte.
Da geschah etwas, was wahrscheinlich alle beide in gleichem Grade überraschte. Die Schwägerin lag plötzlich vor Alettes Stuhl auf den Knieen, den Kopf in deren Schoß.
»Ich bin bei weitem – bei weitem nicht gut genug für ihn. Ich weiß es, ich fühle es.«
Alette strich ihr leicht und nicht unsanft übers Haar. »Wir können alle wachsen,« sagte sie. »Mit Gottes Hilfe! Je mehr wir unsere Mängel fühlen, desto mehr sehnen wir uns nach dieser Hilfe, nicht wahr?«
»Ja, ja.«
Aber dieser Ausbruch, der nicht mit der Wärme aufgenommen wurde, die ihm entsprach, machte die Begegnung noch gezwungener als vorher.
Sie war in seinem Zimmer, – er war ausgegangen. Sie sehnte sich, alles zu berühren, wagte es aber nicht recht. Sie bat darum, alle Bilder von ihm, von seiner frühesten Jugend an, sehen zu dürfen, wagte es dann aber nicht, sich so darein zu vertiefen, wie sie es wünschte. Zwei Bilder von ihm erhielt sie, eins als Kind und eins aus späteren Jahren.
»Dies hier kann ich Ihnen nicht geben,« sagte Alette, als die Braut ihre Blicke von einem nicht abwenden konnte, auf dem die Augen hinreißend waren in ihrem Suchen nach – nach dem Einzigen. »Es wurde für mich allein aufgenommen. Gleich nach dem Umschlag. Er sagte, daß nur ich allein dieses Bild verstehen könne, ich, die dabei war – im Kampf.«
»Waren es schwere Zeiten?« Sie fragte erregt, mit eifersüchtigem Interesse für eine Zeit seines Lebens, wo sie außerhalb stand.
»Es ist immer schwer, wenn die Wahrheit in einem Menschen siegen soll. Sie muß erkauft werden, wissen Sie.«
Alette stockte, als ob sie denke, die andere könne das ja doch nicht verstehen.
Das Schweigen wurde so drückend, daß ihm ein Ende gemacht werden mußte.
»Es gibt so vieles, was ich von Ihnen hören, von Ihnen lernen möchte,« sagte die Schwägerin und ergriff Alettes Hand. »Darf ich ab und zu kommen und Sie fragen?«
»Jawohl, – so oft Sie wollen.« Aber es lag keine Begeisterung in dem Ton und es konnte ja auch keine da sein.
Als das dänische Fräulein heimkam, lag ein Brief von Erik da. Wenn nur wenigstens Erik zufrieden war! Aber das konnte man ja nicht erwarten. Nein, er war wütend.
»Du hättest nichts Schlimmeres tun können, als mir einen der geistlichen Nachtraben als Schwager auf den Hals zu hetzen. Du bist hunderttausendmal zu gut für so einen.«
Na, Erik verstand es ja gut. Mit einem Seufzer legte sie den Brief weg. Um keinen Preis durfte Halfdan ihn zu Gesicht bekommen. Aber es wäre vielleicht ganz angenehm, wenn Alette ihn lesen würde.
Wie eine Oase in der Wüste war allein der Glückwunsch des Konsuls gewesen. Er hatte sie auf die Stirne geküßt und gesagt: »Gott segne dich, mein Kind! Du bekommst einen guten Mann – einen guten Mann. Werde ihm nun auch eine gute Frau.«
Eine gute Frau! Das klang so gleichgültig, so einfach. – Eigentlich sehr wenig begehrenswert, würde sie früher gefunden haben – und doch so schwindelnd hoch über ihr, kam es ihr nun vor.
Und sie konnte sich nicht ganz darüber beruhigen, ob ihm das nicht auch selbst klar würde, ob er nicht zu der Einsicht käme, daß die andern recht hätten? Nein, nicht die andern an und für sich, aber zu der Einsicht, daß vox populi doch hier vox dei sei?
Ach, die Angst jener ersten Nacht, die von Zeit zu Zeit wiederkehrte, besonders am Sonntag!
»Es muß herrlich für Sie sein, wenn Sie ihn jetzt predigen hören,« sagten die Leute zu ihr.
Herrlich – ja. Wer konnte wie sie dem hinreißenden Flug seiner Worte folgen? Und doch saß sie in seiner Kirche in Todesangst und mit Zittern vor dem, was kommen würde. So oft er vor dem Altar stand, wenn sie seinen Kopf zurückgebeugt sah und wußte, mit welchem Blick die Augen aufgehoben waren – da war die Angst am größten.
Nun verstand sie, was der Stich im Herzen gleich beim erstenmal gewesen war: Schmerz, wirklicher eifersüchtiger Schmerz über die Macht, die die stärkste in seinem Leben war. Es war ihr immer, als wolle diese Macht ihn verlangen, allein und ungeteilt. Das flammende Wort aus dem alten Testament: »Ich bin ein eifriger Gott«, traf sie wie ein Stachel. Es war ihr, als würde sich Halfdan am Altar umwenden und sie verwerfen…
Ja, es war ihr, als ob Alette darauf warte, vielleicht darum bete – bei jedem Kirchgang.
Und viel sicherer war sie eigentlich auch nicht, so oft sie ihn mit anderen zusammen sah. Da war er in seinem Wesen beinahe gerade wie früher gegen sie, zurückhaltend und manchmal mißbilligend. Es fiel ihm nie ein, ihr auch nur die Hand zu küssen, wenn es jemand sah. Nun, das war ja begreiflich, natürlich. Aber er sah sie auch kaum an. Besonders nicht, wenn Alette anwesend war.
Auch war sie bei weitem nicht so mit den Ereignissen seines Lebens verwachsen wie die Schwester. Es war ja begreiflich, daß er fand, es sei zu umständlich, ihr all die Leute aufzuzählen, die getauft oder getraut oder begraben werden sollten; auch daß er nicht jedesmal kommen und sie abholen konnte, so oft er zu einem Kranken mußte, obwohl sie ihn darum gebeten hatte.
Aber dadurch hatte die Schwester immer viel mehr Gemeinsames mit ihm. Und das Gefühl, außerhalb zu stehen, war ihr sehr peinlich.
Dann gab es noch etwas, was sie beunruhigte, und zwar beinahe am meisten von allem. Sie bemerkte nämlich nicht den geringsten Versuch von seiner Seite, sie zu ändern, sie zu bekehren.
Wenn er sie sich wirklich als seine Lebensgefährtin, als seine Pfarrfrau dachte, würde er dann nicht ganz unwillkürlich und sobald als möglich versuchen, auf sie einzuwirken, um mit ihm eins zu werden in seiner Lebensanschauung? – Und wenn er das unterließ, war es nicht darum, weil sich bei ihm selbst ein unbewußter Zweifel an der Dauerhaftigkeit des Verhältnisses fand?
Doch gab es auch Stunden, wo alle Angst und Unsicherheit verschwanden, wie krankhafte Träume vor dem lichten Tag, – die Stunden, wo die Feuerwoge sie erfaßte, wo seine Arme, um sie geschlungen, sie in die einzige Welt einschlossen, die es für sie gab, – eine weitere, größere, unendlichere, je näher, je inniger er sie an sein Herz zog. Da lebte sie, da atmete sie. Aber sie mußte wieder hinaus, – hinaus, wo die kalte Angst saß und auf sie lauerte.
»Halfdan,« sagte sie eines Vormittags, »da ist etwas, das du mir so schnell wie möglich sagen mußt. Wie möchtest du mich haben? Ich kann doch noch bei weitem nicht nach deinem Geschmack sein?«
Sie drückte die gefalteten Hände auf sein Herz.
»Das Weib, so wie es deiner Ansicht nach sein soll, will ich werden. Sag mir, wie du mich haben möchtest!«
Er faßte sie unter das Kinn.
»Meinst du, das gehe so: ›Er sprach – und es geschah!‹«
»Versuch es. Soll ich mein Haar glatt scheiteln? Ich sehe dann gräßlich aus. Soll ich meine Nägel ganz kurz abschneiden? Soll ich mich anders kleiden?«
Er begann, ihr das Haar glatt zu streichen. »Laß mich einmal sehen,« sagte er.
Sie verbarg ihr Gesicht. »Nein, nein!« rief sie. »Du gibst mich in demselben Augenblick auf!«
»Möchtest du das vielleicht erreichen?«
»Ich möchte erreichen, daß ich die vollkommenste Gattin würde, die du finden kannst.«
Er schüttelte den Kopf. »Meinst du, das werde auf diese Weise erreicht? – Die Verwandlung eines Menschen! Die innerlichste, die freieste Sache, die es gibt! Von außen her – und auf Kommando?«
»Jedenfalls glaubte ich, man müsse einem Menschen das Christentum bis in die Fingerspitzen anmerken können. Das hast du selbst einmal gesagt.«
»Ja gewiß, gewiß! Aber es soll jedenfalls nicht da beginnen. – All die äußeren Dinge, die du nennst, – ob sie von dem neuen Leben wie verwelkte Blätter abgestreift werden, oder ob die braunen Blätter hängen bleiben hinter all den frischen Trieben, wie an den jungen Buchen in deinen Wäldern, – das ist so unbeschreiblich gleichgültig.«
»Aber wenn die äußeren Dinge ein Hindernis für das neue Leben sind, und das können sie so leicht sein, dann muß man doch anfangen, sie abzustreifen.«
»Ja natürlich. Alles, was im Menschen für den Durchbruch des Lebens ein Hindernis ist, alles was das Wachstum hemmt, und wäre es selbst die eigene Hand, das soll ja abgehauen werden, – wären es auch ›Äcker oder Gewerbe‹, wäre es – –«
Da trat die Tante ein, und er erhob sich, um zu gehen.
Im Flur küßte er plötzlich ihr Haar. »Ich bitte um Gnade für die Locken,« sagte er. »Laß sie so, wie sie sind.«
Ach die Locken! – Wenn sonst nichts da gewesen wäre, worin Gefahr lag! – ›Äcker und Gewerbe‹… Ja, das aufzugeben, was man nicht hatte, darauf konnte man leicht eingehen. Aber – das dritte, das er nicht genannt hatte… das Hindernis, das in sein Leben einzuverleiben ihm so viel Bedenken gemacht hatte, würde es nicht eines Tages – in ihrer Gestalt – ihn so bedenklich machen, daß –
Und wenn es die eigene Hand wäre, so müßte sie ja abgehauen werden…
Seither waren mehrere Wochen vergangen. Das frohe Weihnachtsfest war vorüber, und man hatte schon beinahe den langen Januar hinter sich.
Das dänische Fräulein ging überall hin, wo ihr Verlobter sprach, und auch zu allen Versammlungen, denen er nur anwohnte. Sonst aber ging sie zu keinen großen Festlichkeiten mehr und auch nicht mehr ins Theater; überhaupt nur dahin, wo er auch dabei sein konnte, obgleich er sie nicht mit einem Wort in dieser Richtung beeinflußt hatte.
Sie ging auch sehr einfach gekleidet, und in einigen der Vormittagsstunden, wo sie sonst gemalt oder Klavier gespielt hatte, strickte sie nun grobe, graue Strümpfe für arme Kinder. Und es war ihr, als liebe sie alle die kleinen kalten, nicht immer ganz reinen Beinchen, die hineingesteckt werden sollten…
Sie war auch alle Tage draußen in der Küche bei Trine – mit glühenden Wangen und in einer großen Kattunschürze. Denn eines war sicher, ein gutes Essen sollte Halfdan bekommen, wenn er mit ihr verheiratet war; so gut wie er nie gedacht hätte, daß die täglichen Speisen schmecken könnten, und daß er dadurch Lust bekäme, noch einmal so viel zu essen als jetzt, oder daß er zum wenigsten von dem, was er verzehrte, so gut wie möglich ernährt würde.
»Mach es nur nicht gar zu schlimm,« sagte die Tante. »Ich meine, du übertreibst es. Lieb mich wenig, lieb mich lange, das ist mein Wahlspruch. Man soll niemals verschwenderisch sein, weder mit seinem Eifer noch mit seinen Gefühlen, sonst kommt auf einmal ein Rückschlag.«
»Liebe, kluge Tante, das Weltmeer braucht nicht am Wasser zu sparen.«
»Ja, die großen Worte – an sie glaube ich nicht so recht. Da ziehe ich den goldenen Mittelweg vor – auch hier.«
»Den goldenen Mittelweg? – Der ist in der Regel die vergoldete Elendigkeit.«
»Wer sagt das?«
»Halfdan.«
»Ach er sagt so viel. Wolltest du dich nach allem richten, was er sagt, dann – dann hättest du ihn ja nicht einmal nehmen können. Denn mehr als irgend ein anderer hat er gegen die Schwachheit der Pfarrer, in den Ehestand zu treten, gesprochen.«
»Wenn Halfdan es dennoch tut, dann kommt es daher, daß er jetzt klarer in diesem Punkt sieht. Er handelt immer aus seiner innersten Überzeugung heraus, und nur aus dieser.«
»Ja meinethalb mag er gerne! Du mußt es ja am besten wissen! Ich glaube aber doch, daß es sich auch etwas anders erklären ließe. Wir haben einen guten Liedervers, in dem es heißt:
Auch die großen Heil'gen haben
Adams Fleisch und Kleider an!«
Bei diesen Worten der Tante stieg plötzlich ein Gedanke in ihr auf: Sollte Halfdan in dem Urteil anderer verloren haben? Sollte er in deren Würdigung auf eine niederere Stufe herunter gesunken sein, weil er sich an sie gebunden hatte?
Ach das Urteil der Welt! Wie feig, wie falsch! Hatte nicht jedermann gesagt, daß er zu streng gegen sich selbst sei, ganz unvernünftig asketisch? Und in demselben Augenblick, wo er ein klein wenig mehr nach ihren Anschauungen handelte, wandten sie sich gegen ihn und deuteten dafür mit Fingern auf ihn. Nein – sie war empört!
Aber mochte es so sein! Wie andere ihr und Halfdans Verhältnis beurteilten, war ihr unsäglich gleichgültig. Er nur war es, er allein, der über dieses und über sie zu urteilen hatte. So klar, so klar wie möglich!
»Halfdan!« sagte sie bei einem der wenigen Male, wo er Zeit hatte, mit ihr spazieren zu gehen, an einem schönen Wintertag, wo von weißen Bäumen auf dem St. Hanshügel Schneesterne auf ihr Haar und ihre kleine dunkle Pelzmütze herunterrieselten. »Du fragst mich so wenig nach mir selbst aus. Du solltest mich doch ganz kennen lernen!«
»Um die Kenntnis von einem andern, die man durch Ausfragen bekommt, gebe ich nicht viel. Ich wende eine andere Art und Weise an.«
»Wenn sie dann nur eben so sicher ist! Ich möchte gern, daß du dir ganz klar wärest –«
»Wie viel Gutes sich hinter dem – häßlichen Äußern verbirgt?«
»Nein, gerade das Gegenteil.«
»Immer kommst du mit deinen Fehlern! Wie wäre es, wenn wir zur Abwechslung nun einmal die meinigen nehmen würden? Ich bin hitzig, jähzornig, ungeduldig, herrschsüchtig –«
Sie lachte und drückte seinen Arm fester.
»Ach du abscheulicher Mann! Wie schlimm werde ich es bei dir bekommen! Deine Fehler, Halfdan! Nein, daß du so dumm sein kannst und sie aufzählen! Glaubst du denn, ich hätte an meine Fehler gedacht! Du und ich, – könnten wir uns wohl je unsere Fehler vorwerfen? Wir können ja gleichsam durch sie hindurchsehen! Und wir haben doch auch den großen Mantel, weißt du, um sie alle zu bedecken! Nicht wahr?«
Er legte seine Hand auf die ihrige, die auf seinem Arm lag – mit der Bewegung, die sie von jenem Abend her so gut kannte.
»Geliebte,« sagte er. »Mein Herzlieb!«
Kurz nachher fuhr sie fort: »Nein, was ich sagen wollte, war, daß ja – ein so großer Unterschied zwischen uns beiden sei. Denn du, Halfdan, du bist – ja du stehst in einem Verhältnis zu Gott. Von ihm aus lebst du dein ganzes Leben. Du hast dich hingegeben, bis auf den Grund der Seele, bis in die Fingerspitzen, – einem hingegeben, der für dich in allen Dingen will, weil du selbst aus eigenem freiem Willen nur eines willst, ihn, nur ihn in alle Ewigkeit.«
Er blieb unter den schlanken weißen Bäumen stehen.
»Ja«, sagte er, »so ist es – woher weißt du das?«
»Von meinem Verhältnis zu dir. Aus ihm heraus kann ich das Verhältnis zu Gott wohl verstehen. Und besonders verstehen, daß ich gar nicht darin stehe. – Ich bete wohl, – das habe ich von Kind auf getan! ich gehe in die Kirche, jetzt könnte ich es gar nicht mehr entbehren, dich zu hören, und ich zweifle eigentlich nicht. Ich meine, ich lasse mich nicht auf meine eigenen Zweifel ein. Was mein Verstand einwendet, mit dem kann ich leicht fertig werden. Denn an einen Gott glauben, gegen den er nicht ein klein wenig etwas einzuwenden hätte, das könnte ich doch nicht so recht. Er würde so verdächtig selbstgeschaffen. – Aber all dies ist einfach nichts, das weißt du selbst. Ich – ich bete nicht an, ich stehe nur in einem einzigen lebendigen Verhältnis, mit meiner ganzen Persönlichkeit, und ich will nur eins, dich, dich und nur dich!«
Wieder blieb er stehen. »Ich fühle mich beinahe versucht, zu sagen: du bist verzweifelt ehrlich.«
»Was meinst du damit?«
»Nichts.«
Sie gingen ein paar Schritte weiter; dann sagte er: »Das muß ich doch sagen. Sich klar machen, daß man außerhalb steht, ist die erste notwendige Bedingung, um hineinzukommen. Dieser Standpunkt ist also nicht der schlimmste.«
»Aber auch lang nicht der beste.«
»Nein – selbstverständlich nicht –«
Im Flur hielt sie ihn einen Augenblick zurück, ehe sie ins Zimmer traten.
»Du hast noch etwas vor mir voraus. Aber das muß ich flüstern; es ist leichtsinnig.«
»Kann ich's ertragen, es zu hören?«
»Ich weiß nicht recht. Wir können es ja versuchen.«
Sie legte ihre Lippen dicht an sein Ohr:
»Halfdan Svarte ist so schön –«
»Ja, das ist sicher. Darin ist er dem dänischen Fräulein weit über.«
»– so schön wie ein römischer Kaiser.«
»Das hat man ihm noch nie gesagt.«
»Nein, natürlich nicht! Aber etwas hast du vielleicht noch nie gehört, nämlich wie die römischen Kaiser sich nennen ließen: » Aeternitas tua.« Kannst du soviel lateinisch, daß du verstehst, was es heißt? Und so nenne ich meinen eigenen wunderschönen Kaiser von ganzem Herzen: Aeternitas tua! Er ist der Bleibende, der Seiende, der Einzige für mich! – Und ich bin sein – in Zeit und Ewigkeit.«
– Eine Woche später waren der Pfarrer und seine Schwester in kleinem Freundeskreis bei Konsuls zu Mittag. Die gnädige Frau hatte ein feines Diner bestellt zu Ehren eines durchreisenden dänischen Pfarrers, eines Jugendfreundes von ihr, den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hatte.
Gegen ihre Gewohnheit war die Nichte zeitig fertig und saß in ihrem weißen Gewand mit einem Buch in der Hand da, als Halfdan eintrat.
»Ich dachte an die Sonne,« sagte sie, »und nun scheint sie. Halfdan, warum dichtest du nicht mehr? Ich liebe deine Verse!«
»Sagst du nicht einmal guten Tag?«
Sie sprang auf. »Ich grüße dich, mein Liebster! Guten Morgen! – Nun, warum dichtest du nicht mehr? Hast du keine Zeit dazu?«
»Doch. Aber die Persönlichkeit kann man nur in einem haben.«
»Aber andere Pfarrer tun es doch auch!«
»Mag wohl sein. Ich aber muß mich auf eines konzentrieren, mich nicht zerstreuen, nicht etwas Unwirkliches hineinmischen. Meine Predigt soll keine Dichtung sein. Davon haben wir genug in der Kirche, auch von denen, die keine Dichter sind.«
»Wenn du das Dichten aufgegeben hast, als du dich bekehrtest, dann ist dich dein Christentum wirklich teuer gekommen.«
»Ja, – das Christentum, das einen nichts kostet, ist in der Regel eben so viel wert, wie – der Einsatz.«
»Aber, Halfdan, es kommt mir vor, als habest du nicht einmal das Recht dazu; ein Talent hat man bekommen, um es zu benützen.«
»Bisweilen auch, um es zu hemmen. Wenn es nämlich das hemmt, was mehr wert ist.«
»Nein, dann wäre es sinnlos, daß man es bekommen hätte. Es soll doch Zinsen tragen, das weiß ich.«
»Wenn ein Talent, von einer Überzeugung gehemmt, den ethischen Wert eines Menschen erhöhte, dann hätte es sich verzinst, am reichsten, am tiefsten. Die beste Frucht ist immer Persönlichkeit.«
»Halfdan, nun bist du zum Verzweifeln! Soll man denn allen seinen Talenten und Neigungen entgegentreten? Das ist schließlich nicht auszuhalten.«
»Wie kannst du so töricht fragen? Mit oder gegen seine Neigung, das ist ganz gleichgültig. Aber der Forderung, der persönlichen Forderung der Wahrheit an jeden Menschen, der muß gehorcht werden, was es auch kosten mag. Deshalb dichte ich jetzt nicht mehr. Aber ich tue es vielleicht später wieder. In solchen Dingen kann niemand einem raten oder einen beurteilen. Nicht einmal das dänische Fräulein, das so sehr klug ist.«
Allmählich kamen auch die andern Gäste, und man ging zu Tisch.
Während der Mahlzeit herrschte eine sehr lebhafte und fröhliche Stimmung.
Als die Herren nach dem Essen eine Zigarre rauchten, verließ die Nichte die andern Damen und zog sich in das Kabinett zurück, das doch etwas näher beim Rauchzimmer war.
Während sie da saß, ergriff sie ein ganz überwältigendes Gefühl. Lieber Gott im Himmel! Wie liebte sie Halfdan, der so stark war, so unerschütterlich treu seiner Überzeugung, so schonungslos auf der Wacht vor allen Schlupfwinkeln in seiner Seele, wo sich eine irdische Schwachheit festsetzen und ihn in ihre Fäden einspinnen könnte!
So ganz überwältigend stieg dies Gefühl in ihr auf, daß sie den Kopf auf die Marmorplatte vor sich sinken ließ…
Dann war auf einmal jemand da, der seine heißen Lippen auf ihren Nacken drückte.
»Ich mußte dich einen Augenblick haben. Ich mußte! Und mir war es, als seiest du hier.«
Er saß neben ihr und legte den Arm um sie.
»Halfdan, es ist nicht zu ertragen, daß es Tage, Stunden – Sekunden geben soll, wo ich dich nicht sehe, dich nicht höre, nicht mit dir lebe…«
»Ich glaube auch, daß ich dich jetzt nicht mehr loslasse.«
»Nein – könntest du das? Du könntest es nicht über dich gewinnen. Die Welt geht jedesmal unter. Denk ein wenig daran!«
Näher, inniger zog er sie an sich.
»Ist die Welt jetzt?«
»Ja – o ja! Das Leben ist. Und ich bin!«
»Ja du bist – du bist! Das ist das Lebenswunder. Weißt du übrigens – ich kann es beinahe nicht aushalten, dich in Weiß zu sehen!«
»Und ich hatte gerade gedacht, ich sei so hübsch in Weiß.«
»Das ist es nicht. Eher – eher zu hübsch! Aber wenn ich dich in diesem Gewand sehe, dann ist es mir, als sei der Augenblick gekommen, wo du das weiße Brautkleid trägst und wo du mein bist, mein ganz und gar.«
»Das bin ich in allen meinen Kleidern.«
»Ja. Aber – –«
»Halfdan, verstehst du denn nicht, daß – daß ich nicht noch mehr dein eigen werden kann, als ich es schon bin. Das ist unmöglich.«
»Kannst du es wirklich nicht?«
»Nein, bist du denn nicht so klug, daß du ein klein wenig davon verstehst, wie ich dich liebe? – Nein, die Männer begreifen ja nie etwas. Nun werde ich es dir ein für allemal sagen, aber es ist ein großes Geheimnis: Ich bin – ich bin nur Liebe zu dir. Verstehst du nun, daß ich nicht noch mehr werden kann? Das ist mehr als Braut, ist mehr als Gattin. Sie sagen oft so jämmerlich wenig, diese Namen. Aber, wenn du immer noch mehr ausfindig machen kannst – und ich also noch mehr als – als meine Liebe geben kann, – und dir geben kann, dann machst du mich nur noch glücklicher und immer glücklicher. So, dies sollst du nun studieren, Tag und Nacht, dein ganzes Leben lang, hörst du!«
»Ach, du dänisches Fräulein!«
»Und, Halfdan – ach, ich habe dir noch mehr zu sagen!«
»Nein, nein – nein! Jetzt nicht sprechen! Nur zusammen schweigen. Zusammen sein, die kurzen, kurzen Augenblicke, die wir haben. Steht nicht irgendwo: »Er schloß ihr die Augen, er schloß ihr den Mund!« Nun schließe ich, nun schließe ich deinen Mund, den süßen, unruhigen, reizenden Mund. Dann siehst du nicht, dann sprichst du nicht, – bist nur bei mir, du, mein Lieb, mein Herz!«
Vom Herrenzimmer her näherten sich Schritte.
Sie standen beide auf. »Daß andere auch noch das Recht haben, da zu sein!« sagte sie.
Er lachte und küßte ihr die Hände.
Als die beiden mit den andern in den Salon traten, fragte die Konsulin eben nach einem Missionar in Indien, dessen Frau Alettes Freundin war.
»Ich glaube,« antwortete diese, »daß er sich von dort wegmeldet.«
»Wirklich! Und es hieß doch, daß seine Predigt so viele gewonnen habe.«
»Aber Laura kann das Klima nicht ertragen.«
»Nein, ja dann…«
»Ihre Gesundheit ist vom Fieber vollständig untergraben. Sie kann also dort nicht weiterleben.«
»Was kann sie nicht?« rief plötzlich die Nichte leidenschaftlich.
»In dem Klima dort leben, du hörst es ja, Kind.«
»Dann muß sie eben dort sterben.«
Der dänische Pfarrer nickte seinem norwegischen Amtsbruder lächelnd zu. »Sie bekommen eine Gattin, die kein Hindernis für Sie sein wird. Das merkt man.«
»Nein,« lautete die Antwort ruhig. »Sonst könnte ich sie auch nicht brauchen.«
Sie sah ihn strahlend an. Aber er erwiderte ihren Blick nicht.
»Es ist sehr keck von dir, so etwas zu sagen,« sagte die Tante mißbilligend. »Aber der Mann hat nicht gelobt, seine Frau umzubringen. Deshalb denken wir andern, er tue seine Pflicht, wenn er mit ihr zurückkehrt.«
»Mag er es tun! Aber dann soll er allein wieder hinaus und Mission treiben.«
»Was würde dann aus dem Familienleben?«
»Das muß er opfern, natürlich, wenn es mit seinem Beruf in Streit gerät.«
»Nein, entschuldigen Sie,« fiel nun der dänische Pfarrer ein, »ich stelle mich da wirklich auf die Seite Ihrer Tante. Der Mann hat vor dem Altar gelobt, bei seiner Frau zu stehen in guten und bösen Tagen. Ich glaube kaum, daß es vor Gott recht wäre, wenn er sie verließe.«
»Ich glaubte doch, ein Christ müsse alles verlassen um des Herrn willen. Dieser Mann steht auf, verläßt die Arbeit für das Reich Gottes und folgt seiner Frau. Und in der Bibel steht doch auf jedem Blatt, daß »sie alles verließen und ihm nachfolgten.«
»Allerdings, das steht da – mehreremale. Und das muß auch getan werden, wenn es verlangt wird. Aber das sind nur besondere Fälle, Ausnahmen. Die Zeitgenossen des Herrn konnten sich nicht täuschen, daß dies Verlangen an sie gestellt wurde und daß sie es buchstäblich zu nehmen hatten. Wir andern aber müssen ganz besonders vorsichtig in diesem Punkt sein. Denn in der Regel besteht das Verlangen des Herrn nur darin, daß man allem, was man hat, um seinetwillen absagen soll. Und dies heißt nicht »verlassen.« So fassen es nur die Katholiken auf. Daher kommt alle ihre mißverstandene, krankhafte Askese. Wir andern verstehen, daß wir nur in Entsagung besitzen sollen. Nicht – ja, nicht irgend etwas, das wir haben, über den Herrn und sein Reich stellen, nicht etwas höher achten, weder Reichtum, Heimat, Gattin noch das Leben, – ein Christ soll dies alles nicht verlassen, nicht wegwerfen, sondern es nur besitzen – in Entsagung.«
Gerührt nickte die Konsulin ihrem Jugendfreund zu. »Danke, lieber Berg. Das war so recht klar ausgelegt.«
Alle anderen schienen diese laue Erklärung zu billigen. Aber dazu war das dänische Fräulein zu ehrlich.
Und sie wußte einen, der es auch nicht tat, der seinem älteren Kollegen nur nicht widersprechen wollte. Aber er sollte hören, daß sie ihn verstand.
»Ja, auf diese Weise ist es ja ganz bequem, ein Christ zu sein,« sagte sie. »Aber dann verstehe ich nicht, warum überall in der Bibel die großen Anforderungen gestellt werden, wenn man sich nur davor hüten soll, sie zu erfüllen. Wenn sie so erleichtert und umerklärt werden können, muß man zuerst ehrlich sein und sie lieber ganz streichen. Denn in der Praxis kann ich keine Spur von Unterschied darin sehen, ob man in Entsagung besitzt oder gar nicht.«
»Das muß gefühlt werden,« sagte der dänische Pfarrer. »Und ich hoffe, Sie werden dahin gelangen. Das Christentum ist der Glaube im Geist, nicht im Buchstaben. Man muß suchen, dies verstehen zu lernen.«
Die Frau Konsul schlug nun vor, etwas zu musizieren, um einen passenden Abschluß der Diskussion, bei der die Beteiligung der Nichte durchaus nicht ihren Beifall hatte, herbeizuführen.
Und bald war die Dissonanz auch in Spiel und Gesang aufgelöst.
Als die Gesellschaft aufbrach, hatte Halfdan ein Buch im Kabinett liegen lassen und ging hinein, um es zu holen.
Sie lief ihm nach, sie mußte einen verständnisinnigen Blick, einen Händedruck haben.
Er aber wandte ihr fremde und kalte Augen zu.
»Ein für allemal, sprich bei solchen Dingen nicht mit, bis du sie besser verstehst. Du zeigst damit nur, daß du unendlich weit außerhalb stehst; daß du gar keinen Begriff von geistlicher Auffassung hast!«
Da fuhr sie auf. »Bedeutet geistlich sein so viel, als allen Bibelworten ihren Stachel nehmen, sie beschneiden, beschnipfeln, sie überzuckern, damit man sie ohne Mühe verschlucken kann? – Dann ist das geistliche Christentum die reine Jämmerlichkeit! Und das kannst du doch unmöglich meinen, du, der alles opfert, was es auch sei.«
»Ja, aber du nimmst es so unverständig, weil du so ganz außerhalb bist und bleibst. Und vorläufig sollst du Christentum nur lernen, nicht es lehren.«
Ihr dunkler Kopf richtete sich stolz vor ihm auf.
»Was ich sagen oder nicht sagen soll, das lasse ich mir niemals vorschreiben.«
Er ging nach der Tür, ohne noch ein Wort zu sagen. Und da fühlte sie sich nur noch von einem Gefühl der Angst beherrscht.
»Halfdan – nein, geh nicht so von mir! Ich verstehe es ja nicht wie du. Sag mir nur, wie ich sprechen soll!«
Er blieb stehen und sah sie einen Augenblick an. Dann zog er ihren Kopf an sich und drückte seine Lippen fest auf die ihrigen.
»So,« sagte er.
»Ach, Halfdan, wenn ich auf diese Weise schweigen kann, dann möchte ich am liebsten nie wieder ein Wort sagen!«
Er sah sie an und küßte sie noch einmal.
Februar und März vergingen. Und die Pläne für die Zukunft begannen festere Formen anzunehmen.
Der Plan war, daß sie im Anfang Mai nach Dänemark reisen solle, um ihre Aussteuer zu besorgen, und daß die Hochzeit dann im Lauf des Sommers stattfinden würde.
Glücklicherweise war Alette so gestellt, daß sie sich, wie die Tante sagte, »ein kleines sorgenfreies Heim« einrichten konnte, und die Nichte hatte von ihren Eltern auch so viel geerbt, daß das Brautpaar mit der Hochzeit nicht zu warten brauchte, bis der Pfarrer ein größeres Einkommen hatte.
»Weißt du, ob Halfdan sich um etwas gemeldet hat?« fragte sie im Frühjahr eines Morgens die Nichte.
»Ich glaube nicht. Er sagte neulich, es wäre vielleicht gut, wenn wir ganz von Christiania wegkämen. Aber er sagte nichts davon, daß er sich irgendwohin melden wolle. Warum fragst du?«
»Ach, weil Bödkers Bruder, der im Konsistorium ist, bei Hallager war und sagte, – aber es muß ja ein Irrtum sein –«
»Was denn?«
»Daß Halfdan sich um eine der schrecklichsten, ödesten und nördlichsten Pfarreien beworben habe. Aber das ist ja unmöglich. Denn dorthin könnte er dich doch nicht mitnehmen! Ebensogut könnte er dir den Nordpol anbieten.«
Mit einem plötzlichen Angstgefühl legte die Nichte die Hand aufs Herz, sagte aber nur:
»Und wenn er sich um eine Pfarrei auf dem Monde bewerben würde, für mich könnte es keinen Unterschied machen.«
»Ja, das wäre auch besser, denn diese bekäme er doch nicht. – Aber es muß ein Gerede von Bödker sein. Es ist ja unmöglich. – Das wäre die mißverstandene Askese, gegen die Pastor Berg neulich so klar sprach.«
– Den ganzen Tag hindurch stand nur ein Bild vor ihrer Seele. Ein Bild, von dem sie, wie es ihr vorkam, einmal geträumt haben mußte, und das nun so deutlich vor ihr stand, daß es war, als sehe sie es mit ihren leiblichen Augen – das Bild, das einen zeigte, der hinaufstieg, hinauf, hinauf, bis ihn das strahlende Licht in der Höhe aufnahm. Und unten stand ein anderer, der sich die Hände an den Felsen blutig riß, ohne mitkommen zu können…
Sie war sogleich überzeugt, daß die Nachricht wahr war. Und sie verstand seinen Gedanken vollständig: er brach auf, – er brach auf. Auf diese Weise wurde der Schlag vorbereitet, den ihre geheime Angst erwartet hatte, gleichsam von der ersten Stunde an.
Von droben aus der Höhe, der strengen, weißen, einsamen Höhe, hatte er den Ruf vernommen – der nach »oben« zog – »unerbittlich«. – Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm.
Er schob sie weg, ohne Klage, ohne eine Einwendung, stieg dem starken, klaren, leuchtenden Tag entgegen, ohne sich auch nur ein einziges Mal nach dem umzuwenden, was dahinten blieb.
Nun fiel es, das Damoklesschwert, das sie über ihrem Kopf hängen gefühlt hatte.
Und hinter aller Angst, allem Schmerz war doch wie eine wunderbare, schmerzliche Freude.
Denn das, was ihn so ganz gefangen nahm, sogar weg von ihr zog, es war doch das, was sie am meisten an ihm liebte!
– Der Pfarrer kam an dem Abend zu Besuch und war kaum ins Zimmer getreten, als die Tante ihm entgegenrief: »Hier sind die abenteuerlichsten Gerüchte über dich im Umlauf, Halfdan! Daß du wahnsinnig geworden seiest und dich um Finn-Li beworben habest.«
»Ich glaube beinahe, das Gerücht hat recht, daß ich nämlich wirklich so wahnsinnig bin.«
»Nein, hör mal, das ist zu arg! Es ist vollständig unvernünftig! Du, mit deiner Tüchtigkeit und Begabung, zu diesen einsamen Bauern hinauf!«
»Sollen diese denn nur untüchtige Leute haben?«
»Und das kannst du ihr ja ganz und gar nicht bieten! Ich hoffe, du bekommst die Stelle nicht.«
»Dazu ist wohl keine Gefahr.«
»Nun, dann hoffe ich wirklich, daß sie dich aufgibt, hätte ich beinahe gesagt.«
Da wurde die Tante einen Augenblick hinausgerufen.
Als die beiden allein waren, trat er zu ihr:
»Fragst du gar nicht?«
»Ich bin entschlossen, dir zu folgen – und nicht, dich zu fragen,« sagte sie mit einiger Anstrengung.
»Aber ich möchte doch so gern antworten. Ach, wie kalt deine Hände sind! Ist das Herz so warm?«
Sie fragte leise: »Ist es – um der einsamen Seelen willen?«
»Vielleicht. Obgleich – Seelen gibt es an jedem Ort. Und einsam sind sie alle. Nein – das ist es nicht gerade.«
Die Konsulin trat wieder ein.
»Mein Mann sagt wie ich, daß wir dich davon abbringen müßten. Es gibt Stellen genug hier im Tiefland.«
»Ja, und das ist recht gut für die, die das Hochland nicht ertragen können. Aber es gibt andere, die das Tiefland hinter sich lassen müssen, die hinauf müssen – ganz hinauf – bis zur höchsten Spitze.«
»Ja, das heißt man allerdings eine Sache auf die Spitze treiben, da hast du ganz recht.«
»Halfdan,« sagte die Nichte plötzlich laut. »Du willst Hochlandspfarrer werden, und da tust du recht daran. Dazu paßt du gerade. Du darfst dich nicht aufhalten lassen. Du darfst dich nicht im Tiefland fesseln lassen!«
Er streichelte ihr die Hand. »Es ist zwar nicht so ganz das, was wir unter Hochland da droben verstehen,« sagte er. »Aber dies ist ein schöner Titel.«
»Meinst du?« sagte die Konsulin. »Da weiß ich aber doch, daß geschrieben stehet: Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den niedrigen.«
»Wenn Paulus es so gemeint hätte, wie du – dann hätte er nicht selbst darnach gelebt! Und wir haben noch einen Größeren als ihn, der uns den Weg nach oben gezeigt hat. Einer, der redete und betete, der kämpfte und am Kreuz starb. Einer, der uns gelehrt hat, daß man auf der Höhe leben soll. Von da geht man ein – zur Vollendung des Lebens.«
»Ja, das ist alles ganz wahr. Aber die Nachfolge kann man nicht buchstäblich nehmen – das hast du selbst gesagt.«
»Es schadet nichts, wenn es einer doch einmal buchstäblich nimmt.«
»Ja, aber davon kann nun hier doch keine Rede sein. Sag doch etwas, Kind! Diese Meldung muß zurückgenommen werden.«
Aber sie sagte nichts – auch nicht, als der Konsul herein kam und mit wirklich treffenden, kurzen Worten die Bestrebungen seiner Frau, diesen Beschluß zu ändern, unterstützte.
Nach dem Abendbrot setzte sich der Pfarrer an den Flügel im Saal, um einige Kirchenlieder zu singen, die seine Braut gerne hören wollte.
Sie saß hinter ihm, auf einem niederen, mit Atlas bezogenen Sofa, in der Dunkelheit, die die beiden Lichter auf dem Instrument nicht zu erhellen vermochten, und lauschte auf die glockenreine, schöne Stimme, ohne ein Wort von dem Gesang aufzufassen.
Kurz nachher saß er auf dem Sofa neben ihr. »Weißt du, warum?« fragte er.
Sie dachte die ganze Zeit an nichts als an die Stelle da oben hoch im Norden, um die er sich gemeldet hatte. Nun kam die Erklärung.
»Ich will es dir sagen. Aber es ist ein Geheimnis. Heute bin ich der, der flüstern muß.«
Er schlang die Arme um ihren Hals und legte seine Lippen dicht an ihr Ohr: »Es gibt eine, die ich ganz für mich allein haben muß. Ganz, ganz allein. – Deshalb, glaube ich, habe ich es getan.«
Sie rührte sich nicht, verstand es noch nicht recht.
»Ich muß alle andern, die ganze Welt weg haben. Ich muß einen Ort finden, fern, einsam, verborgen, – wie der, wo der Steinadler seinen Horst hat. Dort das Hochzeitshaus aufrichten! Und dich auf meinen Armen hinauftragen! Zu mir hinauf, zu mir allein!«
Sie tat einen tiefen Atemzug – einen erlösenden.
»Und ich glaubte – ich dachte –«
»Was dachtest du?«
»Daß du – daß du von mir fort wolltest.«
Er lachte und drückte ihr lockiges Haupt inniger an sich.
»Ja, du bist ein Kind! Ein törichtes, törichtes Kind, das nicht das Geringste von allem versteht. Du weißt gar nicht, wie du alles, was sich in mir regt, gefesselt hast. Wie abhängig ich von dir bin, um zu leben. Wie du Lebensbedingung für mich bist. Du bist das Licht meiner Augen! der Schlag meines Herzens! mein Atemzug selbst… das, was man sich nicht entreißen läßt. Das, wofür man bis aufs Blut kämpft. – Denn ohne das kann man nicht leben.«
»Ach Halfdan, sag es noch einmal! Sag es noch einmal!
»Mein Leben – mein Leben! Hast du es jetzt gehört? Verstehst du es jetzt? Weißt du nun, daß ich alles auf die Seite geschoben haben muß, abgeschnitten, weil ich dich so ungeteilt haben will, so endlos, daß niemand anders auch nur einen Schimmer von dir haben darf! Begreifst du, daß ich hoch, hoch hinauf muß, bis zu dem fernsten wolkenverhüllten Gipfel, wo kein spähendes Auge uns sieht – um mein Lieb heimzuführen? – Da hinauf, wo nur du für mich lebst, wo nur du da bist, lebenswarm mit klopfendem Herzen, – für meine Liebe und für mich! Wo wir zusammen hinausgleiten können in die große, schwindelnde Tiefe. Nichts wissen, nichts erinnern, nichts fühlen, als nur einander angehören, – einander angehören!«
Sie schlug die Hände vors Gesicht.
»Halfdan, dann muß ich sterben.«
»Gewiß nicht. Dann sollst du leben.«
»Ja, o ja… Aber begreifst du nicht, daß gleichsam eine Todesangst in dieser grenzenlosen Hingabe liegt? Halfdan, die Freude, mit dir allein zu sein, für dich allein, – sie wird mir das Herz zersprengen! Ich muß daran sterben! Aber es wird trotzdem so sein, wie in dem Liede: Und hätt ich tausend Leben gleich – um eins nicht wollt ich bitten!«
Als die beiden wieder ins Wohnzimmer traten, sagte die Tante: »Hast du Halfdan nun von dem unsinnigen Einfall abgebracht?«
Mit strahlendem Blick wandte die Nichte sich ihr zu: »Nein, nun verstehe ich ihn. Wir sind ganz einig darüber.«
»Ja,« sagte der Pfarrer ruhig, »sie nimmt es wirklich sehr verständig auf, Tante, daß es gar keinen Sinn hätte, das aufzugeben, was mir als das Richtige vorkommt.«
Als er gegangen war, sagte die Konsulin zu ihrer Nichte: »Wenn du in dieser Weise auf alle seine verrückten Ideen eingehst, benimmst du dich sehr unklug.«
»Ich habe auch gar nicht die Absicht, Halfdan gegenüber klug zu sein, ich möchte ihn nur fühlen lassen, daß er auf mich nicht die geringste Rücksicht zu nehmen braucht.«
»Dieser Wunsch kann dir leicht erfüllt werden. Er ist jetzt schon so rücksichtslos, daß es unbegreiflich ist. Sein Betragen gegen dich hat mich schon wiederholt gekränkt. Aber es ist deine eigene Schuld. Und du wirst ihn damit erst nicht glücklich machen.«
»Ja, im Augenblick denkt er natürlich, es sei sehr bequem, eine – Sklavin für alle seine Wünsche zu haben. Aber auf die Dauer wird es ihn langweilen. Er wird immer unvernünftiger in seinen Ansprüchen werden, und die immer weniger achten, die ihm nie einen verständigen Widerstand zu leisten vermag.«
»Du kennst Halfdan nicht, Tante.«
»Liebes Kind, die Männer – wenn man nur einen kennt, kennt man sie alle auswendig.«
Die Nichte schlang den Arm um sie. »Komm und besuche uns am Nordpol, Tantchen! Dann sollst du sehen, wie furchtbar gut wir es bei einander haben.«
»Nein, das wird nicht geschehen. Weder Hallager noch ich können uns darauf einlassen, uns den Hals zu brechen oder in einem Moor bis zum jüngsten Tag stecken zu bleiben.«
– Die Nichte konnte durchaus nicht zur Ruhe gehen.
Von einem Zimmer ins andere flog sie in atemloser Freude.
All die kalte, qualvolle, dumme Angst war von der leuchtenden Siegesgewißheit wie ein Stein von ihrem Herzen gewälzt worden. Die stärkste Macht in seinem Leben war – sie.
Er ließ sie nie wieder los, weil er – nicht konnte! Er war fest, unauflöslich an sie gebunden! Fühlte, dachte, wollte nur sie!
Ach, die jubelnde Sicherheit!
Alette, – ihre Tante, – alle übertriebene Vorsicht, – die ganze Welt – was wußten sie, was verstanden sie, was vermochten sie? Selbst – selbst die Macht, die sie beständig wie eine nach ihm ausgestreckte Hand gesehen hatte, auch sie kam gar nicht in Streit mit ihr! Jene hatte seine Überzeugung, natürlich. Aber sie, die Braut, sie hatte ihn selbst! Ihr gehörte er!
Droben auf der Höhe, wo die Wolken die Gipfel verhüllten, da würde er die Stätte für die große, alles vergessende Götterliebe errichten.
Deshalb, nur deshalb zog er dort hinauf.
Und dies war recht, vollkommen recht, menschlich und natürlich recht. Wer konnte ein einziges Wort dagegen sagen?
Als sie endlich, müde und vor Glück fast schwindlig, in das Reich der Träume hinüberglitt, folgten ihr einige Worte auch dahin, Worte, von denen sie nicht wußte, wo sie sie gelesen hatte: »Königin, Königin werd ich sein in Ewigkeit! – Ich – und niemand außer mir!«
– Am nächsten Tag kam der Pfarrer nicht zu Besuch. Aber er sandte ihr einige Linien, wie öfters, wenn er wußte, daß er sie nicht sehen würde.
Diesmal enthielt der Brief nur ein paar Verse:
Vögelein schnäbelt im blühenden Dorn,
Zwitschert ein Liebeslied leise – –
Dort, wo der Bergwind stößt in sein Horn,
Hoch über Gletscher und Wogenzorn,
Der Adler zieht seine Kreise.
Vögelein fröhlich sein Nestchen schmiegt,
Lauschig in Rosengewinden – –
Weithin der Adler die Luft durchfliegt,
Hoch, wo im Sommer der Schnee noch liegt,
Eilt er die Liebste zu finden.
Schmetternd das Vöglein von Freude singt,
Von Rosen, Liebe und Sonne – –
Hoch, wie kein Echo der Erde dringt,
Birgt, in der Brautkammer wolkenumringt,
Der Adler die Liebeswonne!
Sie barg das Papier an ihrem Herzen. Und so oft sie nur die Hand darauf legte und nur das leiseste Knistern vernahm, durchfuhr sie ein Jubel, der ihr fast den Atem raubte.
Der Pfarrer bekam die Stelle, um die er sich beworben hatte. Im Juni sollte er hinaufreisen, dann ins Amt eingesetzt werden und hierauf die Vorbereitungen zum Empfang der Braut treffen.
Dem dänischen Fräulein näherte sich die Zeit der Abreise von Christiania mit raschen Schritten.
Und so angegriffen und unruhig war sie geworden, daß ihre Tante ganz bekümmert um sie war.
»So nervös habe ich dich noch nie gesehen,« sagte sie. »Ich glaube, es ist gut, wenn du eine Zeit lang ganz von Halfdan weg kommst, um dich in Ruhe sammeln zu können.«
»Ruhe! Ach, mir ist es zum Sterben zu Mut, wenn ich daran denke.«
»Zum Sterben! Wenn du zwei oder drei Monate von ihm getrennt bist!«
»Für mich ist es immer wie ein Sterben, wenn ich von Halfdan getrennt bin, ob es nun Tage, Stunden oder Minuten sind!«
»Darauf antworte ich überhaupt nicht,« sagte die Konsulin. »Ich bin zwei Jahre als Braut in Kopenhagen gewesen, ohne Hallager öfters als jedes Frühjahr einmal zu sehen, aber ich habe mir nie eingebildet, daß ich darüber zu beklagen gewesen wäre.«
An einem der letzten Abende sollte der Pfarrer bei einer Versammlung sprechen, und die Konsulin hatte ihn und seine Schwester gebeten, ihre Nichte von dort nach Hause zu begleiten und den Tee bei ihnen zu trinken.
»Wovon sprach Halfdan heute abend?« fragte die Tante, als sie Alette auf dem Sofa neben sich hatte.
»Über die Worte Esaus, als er sein Erstgeburtsrecht um das Linsengericht verkauft: Gib mir von dem Roten!«
»Das war ein eigentümlicher Text,« meinte die Konsulin. »Was konntest du eigentlich darüber sagen, mein Lieber?«
»Daß diese Worte jeden Tag wiederholt werden.«
»Meinst du? Die Verhältnisse sind doch jetzt ganz anders. Man kann sie doch nicht gut mit denen von damals vergleichen.«
»Aber die Menschen sind noch ebenso wahnsinnig. Sie verkaufen ihr Erstgeburtsrecht, das Recht zum Reiche Gottes, das Recht zu der Liebe Gottes, um ›das Rote‹ in jeglicher Gestalt, um Augenlust, Fleischeslust und hoffärtiges Leben.«
»Ja, auf diese Weise kann man es allerdings sagen.«
»Und nicht nur die ewige Herrlichkeit, auch seinen Beruf, seine Aufgabe, sein eigentliches Leben verspielt man um ›das Rote‹. – – Das ist das Entsetzliche, daß wir das Tiefste, das Wahrste in uns nicht immer als das Stärkste empfinden! Weil die Bewegung an der Oberfläche am stärksten gefühlt wird, deshalb kann das Kleinere dem Größeren die Macht rauben.«
Als die Konsulin mit einer nachdenklichen Miene schwieg, worunter sie ab und zu einmal verbarg, daß sie im Augenblick nichts zu entgegnen wußte, ergriff Alette das Wort.
»Während du heute abend sprachst, mußte ich mehrere Male an jenen Weisen im Altertum denken, der all sein Gold von dem Gipfel eines Berges in den Abgrund hinunterwarf und diese Tat dann mit dem Ausspruch erklärte: ›Ich tat es, damit es nicht mich einmal hinunterstürze.‹ So klug und scharfsichtig sind nicht alle Christen.«
»Nein. Obgleich das, was er getan hat, uns eigentlich vorgeschrieben ist, und zwar aus ganz demselben Grund. Aber in dem Punkt, wo die Lust uns bindet, sind wir oft größere Heiden als jener Weise. Jämmerlich abhängig! Und blind! ›Das Rote‹ flimmert uns vor den Augen und blendet uns. Erst nachher sieht man das klar ein. Dann begreift man nicht, daß man treulos werden und das Größte verleugnen konnte, aus erbärmlichem Hunger nach einem Gericht Linsen. Esau schrie laut und ward über die Maßen betrübt, als er die Folgen sah. Aber was half es? Das Erstgeburtsrecht war verspielt.«
»Wie hieß jener Weise, Alette?« fragte die Tante. »Das war eine schöne Geschichte, ein Wort zum Nachdenken.«
»Ich erinnere mich im Augenblick seines Namens nicht,« antwortete sie.
Dann ging man zum Abendbrot. Die Nichte war so stumm, daß die Tante sie fragte, ob sie sich nicht wohl fühle.
»Die Betstunde war so ergreifend,« sagte sie nur.
Der Pfarrer war von seinem Thema des Abends, sowie von mehreren Zuhörern, die ihm nachher gedankt hatten, und von denen er wußte, daß sie sonst gar nicht kirchlich waren, so erfüllt, daß er sich nicht besonders mit seiner Braut beschäftigte.
Als er und die Schwester aufbrachen, war sie verschwunden.
Er fand sie im Kabinett.
Sie wandte ihm das Gesicht zu und sagte sogleich: »Alles, was du heute abend gesagt hast, in der Versammlung und hier, meinst du das wirklich?«
Er zog die Augenbrauen zusammen. »Ob ich es meine,« sagte er kurz. »Was ist das für eine Frage? – Wenn du dich sonst nicht so ganz auf meine Worte verlässest, so kannst du es ruhig tun, wenn ich aus meinem Verhältnis zu Gott heraus rede. Denn dann spreche ich aus dem heraus, was das Wahrste in mir ist.«
»Ja, ja natürlich. – Es war töricht von mir, so zu fragen.«
Er neigte sich vor, um sie zu küssen.
»Ei, wie blaß die Wangen sind! Und die Lippen auch!«
Er lächelte, indem er ihr Gesicht näher an sich zog. »Wo ist all das Rote – das Rote, das sonst da zu sein pflegt? Ich muß sehen, daß ich es hervorrufe.
Wie in plötzlicher Angst zog sie ihren Kopf zurück.
»Nein – nein.«
»Ach so – – gute Nacht dann.«
Sie streckte die Hände nach ihm aus: »Doch, Halfdan, versuche – versuche, ob du es hervorrufen kannst!«
Als das dänische Fräulein ihre Abschiedsbesuche machte, konnten sich die Leute nicht genug verwundern, wie elend sie aussah.
Sie verabschiedete sich bei allen Bekannten, denn es war ihre Absicht, sich in Dänemark trauen zu lassen, ohne den Tag genau anzugeben; dann durch Christiania und Trondhjem ohne Aufenthalt nach der fernen Heimat zu reisen, von wo sie wohl in langen Zeiten nicht wieder nach dem Süden kommen würde. So hatte der Pfarrer es gewünscht, und wie immer richtete sie sich nach ihm.
Jedermann fand, daß es allerdings eine ernste Sache sei, der sie entgegengehe, aber doch nicht so aufreibend, wie sie sie zu finden schien. Und man begann allmählich, über sie zu tuscheln. War sie vielleicht doch auf dem Wege, den Schritt zu bereuen, den alle Leute so unüberlegt gefunden hatten, und der nun Folgen nach sich zog, die sie nicht mit in Rechnung genommen hatte? Das ernste, einsame Leben auf dem Gebirge, das so gar nicht für sie paßte.
Am Abend vor ihrer Abreise ging sie zu Bödkers, bei denen sie oft mit Halfdan zusammen gewesen war.
Die Flachsköpfchen waren eben zu Bett gebracht worden. Aber sie bat, zu ihnen hineingehen und ihnen einen Abschiedskuß geben zu dürfen. Da ging die Mutter mit ihr in das Kinderzimmer.
»Das dänische Fräulein kommt, um euch Lebewohl zu sagen,« sagte sie. »Nun werden wir sie sehr lange nicht wiedersehen. Und nun wollen wir die Hände falten und alle miteinander für sie beten, nicht wahr? Wir haben sie doch so sehr lieb.«
Aus vier weißen Bettchen streckten sich eifrige Ärmchen ihr entgegen, und jedes Kind wollte ihren schimmernden Lockenkopf auf sein Kissen ziehen, um sich innig an ihn anschmiegen zu können.
Aber als die Rede auf das Gebet kam, das sie mitanhören würde, da wurden die großen verlegen und wagten es nicht. Sie krochen unter die Decken – und taten es erst später alle miteinander, als das dänische Fräulein das Zimmer wieder verlassen hatte.
Nur das kleinste Mädchen rief sogleich: »Ich will!« und setzte sich im Bettchen auf.
Da kniete die Mutter neben ihm nieder und faltete ihre Hände um die dicken rosigen Fingerchen. Dann betete sie langsam, während die Kleine jedes Wort mit ihrer süßen Kinderstimme nachsagte: »Lieber Vater im Himmel! Nun reist das dänische Fräulein weit von uns weg, und wir können nicht bei ihr sein. Aber geh du mit ihr und schirme und segne sie, um Jesu willen, wo sie steht und geht. Aber besonders – besonders wenn sie einmal sterben muß. Amen.«
Der Kopf des dänischen Fräuleins sank plötzlich auf das Fußende des Kinderbettchens nieder. Und die Mutter sah, wie ihr ganzer Körper von heftigem, unterdrücktem Weinen erschüttert wurde.
Sanft und fürsorglich legte sie ihren Arm um die schlanke Gestalt und führte sie ins andere Zimmer.
»Liebste,« sagte sie, »habe ich Ihnen weh getan? Ich weiß, Sie wünschen jetzt zu leben, und da mag es schwer sein, an den Tod zu denken. Das Wort ist mir entschlüpft, denn ein guter Tod ist doch das Beste, was wir einander wünschen können. Aber ich wünsche ja, daß Sie zuerst leben, lange und glücklich mit Ihrem Halfdan.«
Aber, den Kopf an die Schulter der Freundin gelehnt, weinte die andere unaufhaltsam. Und es war, als ob jedes der liebevollen Worte das merkwürdig verzweifelte Weinen nur noch verstärkte.
Schließlich zog Frau Bödker die Schluchzende aufs Sofa nieder und strich ihr über das Haar, ebenso mütterlich, als sei es eines ihrer Flachsköpfchen.
»Meine Liebe,« fuhr sie fort, »es drängt mich, Ihnen eins zu sagen. Ich habe mich über Ihre Verlobung gefreut, gleich als ich davon hörte. Denn ich glaube, daß Sie als eine von Gott gesandte Freude zu Halfdan gekommen sind. Und er nimmt das Leben so ernst, so entsagungsvoll, daß ich ihm alle Freude gönne, die ihm zu teil werden kann. Und ich glaube, daß er Sie – für das Höchste gewinnen wird. Es kann nicht anders sein. Aber auch Sie werden ihn etwas lehren können. Sie sind so ehrlich, daß ich mich oft ganz beschämt gefühlt habe. Und wenn Sie einmal etwas als recht erkannt haben, gibt es nichts anderes mehr für Sie, als es sogleich zu tun; das habe ich mehr als einmal bemerkt. Sie können nichts hinwegerklären und verschleiern, – worin wir andern oft recht gute Übung haben. Ich glaube, Sie werden das, was Halfdan predigt, einmal ins Leben übertragen, – besser als eines von uns.«
Das dänische Fräulein hob ihr verweintes Gesicht und küßte sie.
»Alles, was Sie von mir denken und glauben,« sagte sie, »ist weit – weit besser als in der Wirklichkeit. Aber – das, was Halfdan predigt, das will ich ins Leben übertragen, und wenn mir das Herz darüber brechen sollte.«
Oft, oft, wenn sie später mit ihren Flachsköpfchen betete, mußte die Mutter an jenen Abend denken. Und dann versank sie in tiefe Gedanken, und immer schüttelte sie zum Schluß den Kopf, wie jemand, der das, was er glaubt, nicht mit dem, was vorliegt, in Einklang bringen kann.
Am nächsten Vormittag, dem Tag, an dem sie abends abreiste, ging das dänische Fräulein zu Alette. Der Pfarrer war nicht daheim, und sie wußte es. Die Schwester ergriff beide Hände ihrer Schwägerin und sah ihr ernst und eindringlich in die Augen.
»Der Herr bereite Sie vor und stärke Sie zu der Aufgabe, die Sie übernehmen, der schönsten, die es für eine Frau gibt: die Gehilfin eines Dieners des Herrn in seinem hohen Beruf zu sein.«
»Ich danke Ihnen,« sagte die Braut.
Dann bat sie, einen Augenblick in sein Zimmer treten zu dürfen.
Sie blieb eine Weile still vor dem großen Bilde der Madonna von Murillo vom Palazzo Pitti stehen, das er über seinen Schreibtisch gehängt hatte – weil er fand, daß es ihr gleiche. Ein Bild von ihr, das jedermann betrachten und erkennen könnte, wollte er nicht aufstellen, das trug er nur bei sich. Aber dies sei sie ja doch, hatte er gesagt, heimlich und für ihn allein.
Sie stieg auf den Stuhl vor dem Schreibtisch, kniete auf die Tischplatte und küßte das Bild…
Auf dem Tisch lag ein kleiner Papierstreifen, auf den er in aller Eile die Adresse einer armen Familie gekritzelt hatte. – Sie nahm den weißen Elfenbeinfedernhalter, den sie ihm selbst geschenkt hatte, und schrieb: »Geliebter, geliebter Halfdan Svarte« – mit ihrer schönen, großen Handschrift, die er so sehr liebte – gerade unter die fremde Hausnummer…
Noch ein langer sehnsüchtiger Blick, der gleichsam alle Gegenstände des Zimmers umschloß – dann ging sie wieder hinaus.
Als sie sich von Alette verabschiedete, sagte diese zögernd: »Da ist noch etwas, das ich Ihnen gerne sagen möchte. Sie werden nun ganz allein mit ihm sein, – und werden wohl einen bedeutenden Einfluß auf ihn gewinnen. Das bekommt die Gattin immer. Aber – wollen Sie daran denken, daß Halfdan niemals so recht von Herzen glücklich wird, wenn nicht das eine – das eine, das das Größte und Stärkste in ihm ist, bei allem zuerst kommt? Vor allen Rücksichten, vor allen Freuden – – vor allem Zusammensein mit Ihnen…«
Die andere richtete ihre dunklen Augen auf die Schwägerin und sagte: »Das glaube ich auch. Ja, ich werde daran denken.«
Halfdan sollte bei Konsuls zu Mittag essen und sie dann nach dem Bahnhof begleiten, er ganz allein.
Er brachte ihr einen Strauß von lichten Rosen und dunklen duftenden Heliotropblüten. »Zum Dank für die, die ich mir genommen habe,« sagte er. »Weißt du es noch?«
Bei Tisch trug sie ein weißes Kleid und hatte seine Blumen angesteckt.
Der Konsul hatte Champagner herbeigeholt, und da die Beredsamkeit seiner Frau ganz in Rührung aufgelöst war, weil sie ihre geliebte dänische Perle verlieren sollte, mußte er dem Brautpaar eine kurze Abschiedsrede halten.
»Der Herr sei mit euch – droben auf der Höhe, wohin euer Weg nun geht! Über dich, Halfdan, habe ich ihr schon meine Ansicht gesagt und nun sage ich sie dir auch über sie. Man weiß nicht, wie lieb sie ist, ehe man sie bei sich im Haus hat. Und das will viel heißen. Ich wünsche euch Glück, Kinder!«
Die Nichte weinte, küßte ihn und sagte, er halte sie nur für so gut, weil er sie mit seinen eigenen herzensguten Augen betrachtet habe. – –
Als sie sich später umgekleidet hatte, und der Wagen vor der Tür stand, weinte sie wieder heftig am Hals ihrer Tante. Sie dankte immer wieder für den Winter, den besten, den einzigen, den sie je erlebt habe…
Und die Konsulin weinte von ganzem Herzen mit und bat sie, ja nicht zu vergessen, daß sie und der abscheuliche Mann, der sie so weit wegführe, immer eine Heimat hier hätten.
Der Konsul zeigte sich außerordentlich besorgt, daß all ihr Gepäck gut im Wagen untergebracht wurde, schneuzte sich aber doch verschiedene Male recht verdächtig, und die Mägde weinten im Chor.
Als sie sich von Halfdan auf dem Bahnhof verabschiedete, weinte sie nicht; sie war ganz still und blaß wie eine Leiche.
»In zwei Monaten,« flüsterte er. »Da hole ich, was mir gehört. Und lasse es in meinem ganzen Leben nicht wieder los – nie lasse ich dich wieder wegreisen.«
Als sie an dem Fenster des Wagenabteils stand, und der Zug sich in Bewegung setzte, streckte sie plötzlich die Arme aus und rief laut: »Halfdan!«
Angstvoll klang es – wie ein Hilferuf, so daß er ihr beinahe nachsprang. Aber schon war sie ihm nicht mehr erreichbar. – –
Vier Wochen später wußte man in dem ganzen großen Bekanntenkreis in Christiania, daß das dänische Fräulein ihre Verlobung aufgelöst hatte.
Aber das war auch alles, was man erfuhr. In den Beweggrund oder die Art und Weise, wie es geschehen war, wurde niemand eingeweiht.
Niemand, nicht einmal Alette, sah den Brief, den der Pfarrer erhalten hatte, und den er so verzweiflungsvoll oft durchlas, daß er ihn bald trostlos gut auswendig konnte.
»Was ich heute schreiben muß, will ich so schnell und so kurz als möglich sagen, obgleich es das Resultat langer, langer, ernster Erwägungen und mein unwiderruflicher Entschluß ist. Ich kann Ihnen nicht da hinauf folgen. Sie müssen ohne mich Ihren neuen Beruf antreten.
»Ich wünsche Ihnen, daß Sie ganz und vollkommen die Lebensaufgabe erfüllen, die das Erste und Größte für Sie ist, nämlich Hochlandspfarrer zu werden, wozu Sie, wie ich glaube, berufen sind.
»Ich weiß, – ich weiß, daß Sie jetzt leiden werden… Aber ich glaube auch, daß Ihre Arbeit alle Leere nach meinem Entschwinden ausfüllen kann – – und ich kann nicht bei Ihnen sein.« – – –
An demselben Tag, wo der Pfarrer den Brief bekam, reiste er nach Kopenhagen. Es war am Anfang der Woche, da konnte er sich schon ein paar Tage frei machen.
Am nächsten Abend stand er in ihrer Wohnung, wo der Bruder, dem die peinliche Lage äußerst widerwärtig war, ihn empfing.
Der Pfarrer verlangte eine Unterredung mit seiner Braut. Aber der Bruder sagte, sie sei verreist, zu Verwandten aufs Land, und er habe ihr hoch und teuer versprechen müssen, daß er ihren Aufenthaltsort nicht verraten werde.
Hierauf verlangte der Pfarrer, daß ein Brief, den er noch an diesem Abend schreiben würde, ihr unverzüglich nachgeschickt werde. Und dies versprach der Bruder.
Den Brief seiner Braut legte Halfdan in einen Umschlag, um ihn zurückzuschicken, und außerdem schrieb er selbst: »Ich betrachte Deinen Brief als ungeschrieben, – denn ich habe ihn nicht angenommen. Und ich tue es niemals.
»Das Verhältnis zu mir kannst Du nicht lösen. Niemals davon loskommen! Denn so lange Du und ich existieren, so lange stehen wir in einem Verhältnis zu einander. Es ist ein Teil von uns selbst. Und das weißt Du ebenso gut wie ich. –
»Ich verlange Dich, so wie Du bist, als mein eigen. – Und Du wirst es nicht wagen, Dich Deinem eigenen Lebensberuf zu entziehen.
»Ich nehme Dich an der Hand, – sie ist mein. Ich fasse Dich um das Herz – es ist mein. Und mit dem großen Recht der Liebe, die ich zu Dir habe, sage ich: Komm! Folge mir!« –
Er hatte das Papier schon zusammengelegt, als er es plötzlich noch einmal entfaltete und ihren Namen – nur ihren Namen, ganz zuletzt hinschrieb.
Auf diesen Brief erhielt er umgehend als Antwort nur die drei Worte: »Ich kann nicht!« – – –
Da reiste er zurück nach Christiania.
Aber er verstand und verstand die Welt nicht mehr. Was war geschehen? Wie war es nur so gekommen?
Entweder war er klug und die ganze Welt verrückt, oder – war er derjenige, welcher verrückt war. Eines war gewiß, das ganze Dasein war ein unbegreifliches Chaos.
Die öffentliche Meinung war in diesem Fall, wie nach der Verlobung auch, recht übereinstimmend.
Es sei nur gut, daß die Verlobung aufgelöst worden sei. Die beiden hätten durchaus nicht zusammengepaßt. Und das Leben, in das er sie hineinführen wollte, habe sie sicher zurückgeschreckt, so verwöhnt und verfeinert, wie sie gewesen sei.
Immerhin habe es ja den Anschein gehabt, als ob sie richtig verliebt in ihn gewesen wäre. Und bedauernswert sei es, daß sie so lange gewartet, bis sie ein Ende gemacht habe.
Der Konsulin, die selbst einen Brief von der Nichte erhalten hatte, ging es außerordentlich nahe.
»Mir ist es zu Mut, als hätten wir einen Todesfall im Hause gehabt,« sagte sie. »Hallager ist ganz aus dem gewohnten Geleise. Aber was habe ich gesagt! Es ist geradezu ein Verhängnis, daß ich immer Recht bekomme! Nun werden es die guten Leute selbst einsehen! Aber es ist ein wenig spät. Es tut mir für beide leid, am meisten für Halfdan. Er bindet sich nur sehr stark, und nun vielleicht nie wieder. – Über mein süßes Mädchen bin ich ein wenig ärgerlich. Sie hätte es sich früher besser überlegen sollen. Aber Halfdan betrug sich ihr gegenüber auch nicht immer richtig.«
»Nein,« sagte die öffentliche Meinung in Gestalt einer Dame, die zu Besuch kam. »Er war sehr kalt und recht wenig rücksichtsvoll gegen sie.«
»Kalt? – Ja, darüber können andere nicht urteilen, nach meiner Erfahrung wenigstens. Aber rücksichtslos, das war er. Er überlegte nie, was sie wünschen oder nötig haben könnte. Und nun zuletzt diese Pfarrei! Das hat dem Faß den Boden ausgeschlagen! Ich habe ihm damals gleich gesagt, daß es eine unvernünftige Idee sei. Es ist ja nicht frömmer, ob man an dem einen oder an dem andern Ort predigt.«
»War sie von Anfang an verzweifelt darüber?«
»Nein, da sagte sie, es sei herrlich, und daß sie am liebsten mit ihm auf den Mond ginge, – ich glaube, so sagte sie. Aber so etwas hält nicht vor! Als sie in ihr schönes Heim zurückkehrte, zu ihren Freunden, ihrem künstlerischen Umgangskreis, und dann an die Pfarrei hoch droben auf einer Felsenspitze dachte, ohne einen anderen Umgang als – Bären, wenn es gut geht, da sank ihr der Mut. Und das ist nicht zu verwundern. Aber es tut mir leid, mehr als ich Ihnen sagen kann, Frau Smit.«
Von der Schwester des Pfarrers bekam man von der Auflösung noch weniger zu hören, als einst von der Verlobung.
Zu der Konsulin, die ihr den Brief der Nichte zeigte, um sie etwas milder zu stimmen, sagte sie nur: »Ich verurteile sie nicht. Sie steht eigentlich vollständig außerhalb meines Verständnisses! Ich denke, sie hat sich selbst gerichtet. Und sicherlich ganz richtig. Wenn sie sagt, daß sie Halfdan nicht folgen könne, so wird es wahr sein. Den Weg auf die Höhe an seiner Seite, dazu hat sie nicht die Kraft. Es ist nur so schwer, daß er es glauben konnte und nun den bitteren Schmerz durchmachen muß, sich in einem anderen Menschen so tief getäuscht zu haben.«
Von dem Tage an, wo der Pfarrer von seiner kurzen Reise nach Dänemark zurückkehrte, die einen so schneidenden Gegensatz zu dem bildete, was geplant gewesen war, wurde das dänische Fräulein und die ganze Periode, die sich an sie knüpfte, nicht mehr zwischen den Geschwistern berührt.
Den ganzen ersten Tag und auch die Nacht schloß sich Halfdan ein, – mit einem Ausdruck im Gesicht, daß Alette es nicht gewagt haben würde, ihn allein zu lassen, wenn sie nicht gewußt hätte, mit wem er sich einschloß.
Die ganze Nacht hindurch hörte sie ihn in seinem Zimmer auf und ab gehen, oder sich schwer niederwerfen – auf einen Stuhl, oder auf den Boden. Sie wußte es nicht.
Gegen Morgen trat er bei ihr ein, – und er sah in dem bleichen Tagesgrauen aus wie eine Leiche.
Er trat zu ihr und sagte: »Nun habe ich es durchgekämpft. Ich will es auf mich nehmen und will es tragen. Jetzt gehe ich weiter.«
»Gott sei Dank!« sagte sie leise.
Aber in demselben Augenblick brach er neben ihr zusammen. Und das Bett, auf das er sich stützte, zitterte unter seinem heftigen, furchtbaren Schluchzen.
Sie umschloß seinen Kopf mit zärtlichen Händen, während ihr selbst die Tränen über die Wangen liefen, neigte sich über ihn und begann leise und innig für ihn zu beten. Mit der ganzen Liebe, die sie für ihn fühlte, mit ihrem unerschütterlichen Vertrauen zu dem großen Helfer betete sie.
Allmählich wurde er ruhiger und richtete sich auf.
»Ich danke dir,« sagte er und küßte sie auf die Stirne. »Was getragen werden muß, kann auch getragen werden. Das Hindernis, an dem wir uns die Stirne blutig stoßen, soll uns nicht niederschlagen. Das bedeutet immer nur, daß wir höher hinauf sollen. Darüber hinaus!«
Von dem Tag an erfüllte er alle seine Pflichten wie vorher und bereitete seine Abreise nach der fernen Pfarrei vor.
Das Herz der Schwester blutete, wenn sie daran dachte, daß er in diese Einsamkeit hinaufziehen mußte.
Ihre Gesundheit war viel zu gebrechlich, als daß sie daran denken konnte, sich in einer so rauhen Gegend niederzulassen. Trotzdem hatte sie es ihm gleich vorgeschlagen; sie hätte um seinetwillen gern ihre Gesundheit drangegeben.
Aber er nahm das Anerbieten nicht an; er hätte es nicht für recht gehalten. Das einzige, worauf er einging, war, daß sie im Hochsommer einen Besuch im Pfarrhause machen dürfe.
Ende Juni reiste er ab. Und im Juli kam sie zu ihm. Dies wiederholte sich regelmäßig jedes Jahr.
Sie hatte gehofft, er werde sich wegmelden, als die ersten fünf Jahre um waren, und sich an einen milderen und näheren Ort versetzen lassen.
Er aber sagte: »Ich habe hier oben eine Aufgabe zu lösen.« Da war sie nicht wieder darauf zurückgekommen.
Jeden Winter hoffte sie auf einen Besuch von ihm, wenn auch nur auf kurze Zeit. Aber er sagte, das müsse warten, noch immer würde es ihn nur peinlich berühren, wenn er wieder nach Christiania käme. –
Im Sommer begleiteten manchmal auch andere die Schwester nach dem Norden, Verwandte oder Freunde, Bödkers und einzelne der Kousinen, solche, mit denen der Pfarrer sich gut verstand.
»Ich glaube, ich verstehe Alettes Gedanken, wenn sie die liebe bescheidene Sophie nach dieser Einöde mitnimmt,« sagte die Konsulin. »Wenn man nur bald hören würde, daß sich Halfdan mit einer von ihnen verlobt hätte. Dann könnte man glauben, er habe sein Herzeleid überwunden und bekomme nun eine behagliche Heimat mit einer netten Frau, die ihn auf eine vernünftige Art glücklich machen würde, auf eine Art, die Bestand hat.«
Aber dies bekam man eben nicht zu hören.
Der fremde Vogel, den er einmal an sein Nest fesseln zu können geglaubt hatte, flog weiter und weiter fort aus seinem Bereich.
Anderthalb Jahre nach der aufgehobenen Verlobung erfuhr man, daß das dänische Fräulein nach einer energischen und gründlichen Ausbildung zur Bühne gegangen sei.
An die Tante, die diesen Schritt mißbilligte, schrieb sie, sie müsse eine Aufgabe haben, die sie ganz in Anspruch nehme, damit sie ihr Leben damit ausfüllen könne.
Mehrere Jahre lang hatte sie einen schönen hervorragenden Platz an der Bühne.
Dann hörte man, daß sie sich wieder ganz plötzlich ins Privatleben zurückgezogen habe.
– Weit entfernt von einander waren die Welten, in denen die beiden Leben verliefen, die einmal nahe daran gewesen waren, ineinander zu fließen.