
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Das älteste Berliner Stadtwappen (um 1272). (Noch ohne den Bären als Wappentier.)
Von Wilhelm Bölsche.
Wenn ich an die Berliner Landschaft denke, so meine ich eine Anzahl kleiner, alter, schlichter Bilder zu sehen, alle in ganz armen, aber soliden Holzrahmen, die das Alter gebräunt hat. Sie haben nie zwischen den gleißenden Farben und Goldrahmen einer großen Ausstellung geprunkt. Ein alter Liebhaber in bescheidensten Verhältnissen hat sie besessen. Er hatte nicht einmal den Raum, sie ordentlich nebeneinander aufzuhängen. Sie standen für gewöhnlich mit der Malseite einfach gegen die Wand gelehnt. Wenn er sie vornahm, mußte meist etwas Staub und Spinngewebe entfernt werden. Aber wenn dann für eine stille Stunde ein Strahl Licht auf die alte Fläche fiel, ging es wie ein stilles Aufleuchten von innen heraus darüber, und die Augen des einsamen Kenners leuchteten auch so lange. Als die Bilder später aus seinem Nachlaß in die große Kunstwelt gerieten, machten sie plötzlich ein ungeheures Aufsehen ...
Ein flacher Sandhügel; wo er angeschnitten ist, quillt goldgelber Sand vor; zumeist deckt ihn aber ein stumpfes, blaßgrünes Seidenkleid junger Kornfelder, in das der unablässig leise jagende Wind silberne Zickzacklinien gräbt; Lerchen jubeln immerzu zum weißlich verschwommenen Himmel; unten liegt die Welt unendlich weit; ein blaugrüner Waldteppich so glatt, so weich in die Tiefe, ohne jeden Einzelumriß, wie die Moosdecke eines unermeßlichen Moors; grüne Birkenstraßen schneiden ab und zu als schnurgerade Linien durch die Fläche; dann in hellem Blitz auch da, dort ein wirklicher Wasserstreifen; ein weißes Segel ist riesengroß einen Augenblick darin, dann hat der Waldteppich es jäh verschluckt; es ist, als versinke überall so nach kurzer Strecke das Wasser wieder im Waldgeheimnis, ohne Anfang, ohne Weitergang; bis endlich doch einmal ein großer Streifen Blau sich behauptet, ein wirklicher See, wo das Wasser sich ein Stück Reich frei ertrotzt hat; ganz weit darüber geht alles in flimmernden Glast; ein paar Rauchstreifen werfen das Licht so hell wie schillernder Kristall zurück, ein weißes Lichtband des Sonnenfächers hinter dem bleichen Himmel der Wasserebene steigt gerade zu ihnen herab, wie eine weisende Hand; dort liegt Berlin, so fern wie ein glitzernder Traum, so still, daß der Lerchenjubel wie eine aufdringlich laute Stimme dagegen schallt. – Ein kleiner Moorsee zwischen himmelhohen Kiefern. Schwarz ihre Kronen, schwarz die winzige, eirunde Fläche, wie erstickt von dem viel zu großen Spiegelbild; nur am Ufer ein Streifen stumpfgrünes Schilf, aus dem eine weiße Vogelbrust, ein Haubentaucher, langsam in den schwarzen Spiegel strebt; wenn es Spätnachmittag wird, werden die Stämme in einem zauberischen Rot gleißen wie die Säulen der im Weltuntergang aufglühenden Walhalla; Leistikow hat diese Kiefernglut gemalt, nur er. – Im Nadelwald steht plötzlich eine uralte, graue Eiche, der Stamm grau von Flechten, das Laub grau vom Staub der Landstraße, die neben ihr einsam durch die Kiefernheide geht, jeder einsame Wagen darauf in eine graue Wolke gehüllt; wie ein Wald über dem Walde ragt dieser Eichenkoloß, ein einsamer Überlebender aus einem anderen Walde, der einst hier stand. – Ein kleiner Kirchhof am Waldrain im Herbstgold; Herbstgold der langen, wehenden, trauernden Birken, Herbstgold der Sonnenblumen; auf den alten Gräbern rote und blaue Astern wie ein einziger deckender Kranz; als Mauer aber dahinter ein paar Dutzend riesiger Wacholderstämme, hoch wie Zypressen, mit wirklichen Stämmen, eine rätselvolle, dunkle Totenwacht, dunkel und rätselvoll wie der Tod, uralt, schweigend, rauh; und dann doch wieder mit samtweichen, lichtgrünen Sprossen. – Ein endloser Wiesenhorizont, eigentlich ein Fließ, bloß mit trockeneren Grasinseln; vergißmeinnichtblaue Wasserstreifen wechseln ab mit Farbstreifen des süßesten Smaragdgrüns; dann aber wieder ein Band des fettesten Goldgelbs von Sumpfdotterblumen; eine hohe Brücke geht hinein, zu einem Damm mit silbernen Weiden; Schwalben streifen hin und her, bald ein Schatten, bald ein Blitz. – Eine weite, abendliche Seefläche in weißem Schaum; die Wellen platschen gegen den Sandsaum, wo die Erlen in der unterwaschenen Uferkante wie auf schwarzen Stelzen stehen; das Wintereis hat sie halb zersägt, dennoch dauern sie noch wer weiß wie lange, zähe Ansiedler auf bröckelndem Halligenland; durch den Dunst klingt das Geschnatter ziehender Wildgänse; fern am Horizont ein fahler Schein, wie ein gespenstisches Auge dieser wilden Nacht; dort liegt Berlin, die funkelnde Stadt mit ihrem Lichtermeer; hier draußen weit ist sie nur eine ungewisse Stimmungsfarbe wie der Mond hinter Wolken, wie der letzte Schein eines irgendwo hinter dem Horizont wütenden Brandes. – Ein Dorf in praller Sonne; Akazien mit ihrem lichtgrünen Sonnenlaub leiten hinein und weben ihren üppigen Duft darüber; aber die breite, schattenlose Fahrstraße ist tiefer Sand mit groben Fahrgleisen, man fühlt nach, wie die Pferde hier schwitzen müssen; dunkelgrüne Moosdächer steigen über alten, rissigen Bretterzäunen auf; aber in jedem Gärtchen dahinter ragt ein großer, hochstämmiger Baum spanischen Flieders, im Maienzauber ein einziger violetter Blumenstrauß; ein schwerfälliger Gemeindebackofen und eine magere Friedenseiche; zuletzt verträumt der Blick auf einem endlosen Horizont von sandigen Kornfeldern; die Akaziengänge und Hohlwege mit verwilderndem Flieder verlieren sich unter der sengenden Mittagsglut schattenlos wieder hinein. – Eine Schilfinsel, von allen Seiten ganz eingebettet im Rohr, vor dem sich noch ein schaukelnder Ring von Wasserrosen dehnt, deren Nixenarme selbst einem modernen Motorboot gefährlich werden; Rohrspatzen lärmen mit unablässigem Kirre Kirre Kitt Kitt; es riecht nach Minze und Sumpf; von oben hängen Eichenzweige über Stämmen, die, vom Alter zerborsten, halb versunken, zu kriechenden Ungetümen geworden sind; Efeu spinnt sich hinein; wenn der feuchte Seewind in diesem unentwirrbar verfilzten Pflanzenmärchen raunt, erzählt er von einem alten Zauberer, dem Goldmacher Kunkel, der vor Jahrhunderten hier gehaust hat.
Berlin liegt in einem ungeheuren vorzeitlichen Flußtal. Was sich heute noch an wirklichen kleinen Wasserflächen und Wasseradern durch das alte Sandbett des Riesen spinnt, ist nur ein verzwergter Rest. Nie hat dieser Strom aber die Lieblichkeit unserer echten deutschen Gebirgsflußläufe besessen. Der Berliner Urstrom war ein rohes Zufallserzeugnis in den wilden Fügungen einer schauerlichen Zeit. Weit vor ihm, in einem Morgenrot der Dinge, grünte ja auch in dieser Gegend echter paradiesischer Urwald von unerhörter Pracht; die amerikanischen Sumpfzypressen entfalteten damals hier ihr Fiederlaub wie heute am unteren Mississippi. Das alles erschlug eines Tages die Eiszeit. Die anrückende nordische Gletschermauer walzte alles unter sich zur nackten, lebensleeren Wüste aus. An der kristallblauen Glocke über der völlig verödeten Sohle aber stauten sich die von Süden kommenden Gewässer. Den heutigen Ostseeweg sperrte die Eiswand, ein wahres Gebirge aus Eis. So mußte die Weichsel sich aufgestaut mit der Oder, die Oder mit der Elbe vereinen; erst dort fand der westöstliche Staukanal seinen Abfluß gegen die Nordsee hin. Stufenweise ging dann die Gletscherschranke nordwärts zurück. Mehrfach verlegte sich mit ihr der Staustrom in die wieder freiwerdende Wüste hinein. Und so kam zu einer bestimmten Zeit der ungeheure Wirbel auch gerade über Berlin. Als er auch hier endlich abfloß, erschien das Land als eine doppelte Wüste, nackt wie in den Schauern eines Schöpfungsmorgens noch vor Entstehung des Lebens, versandet, der Sand mit fremden Steinen gespickt, für immer abgeschnitten von der Flora seiner Vergangenheit. Wie dieses Chaos eines Weltuntergangs dann wieder Umrisse einer Landschaft, wie es neuen Pflanzenwuchs, Schmuck, Farben, Stimmung bekommen hat: das ist das eigentliche Märchen der märkischen Natur.
Die Menschen haben zum Teil diesen Pionierkampf erst kommen sehen, Pioniere auch sie, beide tapfer und zäh, beide sparsam und herb. Als die Stadt allmählich heranwuchs, fehlte dem Berliner zunächst jede Vergleichung für den Landschaftscharakter seiner Mark. Er zog wohl gern in die Waldheide hinaus, aber der Reiz lag doch allgemein in dem Gegensatz bloß von Stadt und Land. Als gutmütiger Skeptiker scherzte er daheim über den unendlichen Staub und Sand, in dem der Wagen auf der Sonntagspartie hatte dahinkraxeln müssen, über die Mücken, die noch immer aus den Schilfkränzen der Moorseen schwärmten, wie einst aus der Tundra, der Moossteppe der Nacheiszeit. Noch heute liebt ein gewisser zäher Typus des Berliners nicht eigentlich die Kiefernheide selbst; seine ländliche Freude ist der Übergangsrain von Stadt und Land: ein Stückchen Kartoffelacker mit einem Stande goldener Sonnenblumen und einem selbstgezimmerten Häuschen, wo man in Hemdsärmeln sitzen und eine »Weiße« trinken kann, so nah der Stadt, daß man die letzten Mietskasernen wie eine Mauer ragen sieht, und doch mit dem Gefühl, einen Hauch frischerer Naturluft zu atmen. Die eigentliche märkische Freilandschaft ist erst entdeckt worden, als die Großstadt sich geltend machte, von Augen, die mit anderen Landschaften zu vergleichen verstanden. Zum Teil haben es Fremde gemacht, doch auch der Berliner, der aus der Fremde zurückkam. Nun sah man auf einmal, was für eine Poesie, was für eine Stimmungsschönheit sich hier zäh und ausdauernd durchgesetzt hatte.
Es war freilich jetzt gerade Zeit, daß die Entdeckung kam. Mit ihr gleichlaufend hatte auch schon die Zerstörung der Landschaft durch Menschenhand begonnen. Etwas, wie das Hereinbrechen eines neuen wüsten, ungefügen Wildstroms. Es war schon das Beispiel einer älteren Verwüstung dieser Art selbst, wenn der erwachende Landschaftsblick überall auf die forsttechnisch in Regimenter getrillte Kiefer stieß, an Stelle der rasch verschwindenden Eiche, deren Stubben und reliquienhaften Nachzügler doch heute noch allenthalben den einförmigen Nadelholzstand so bedeutsam durchsetzen. Gegenwärtig geht der Vernichtungskrieg besonders gegen die malerischen größeren Sandhügel, die zu Fabrikbetrieb abgebaut werden, gegen die Moore und Schilfufer der Wassergebiete, mit denen ein Hauptteil der bezeichnenden Tier- und Pflanzenwelt mit Stumpf und Stiel vernichtet wird, gegen einzelne Charakterpflanzen wie den Wacholderbestand, der überall rücksichtslos abgeholzt wird, gegen jeden letzten Rest von urwüchsigem, »wüstem« Wildwald und echtem, versponnenen Dickicht. Im engeren Ring um Berlin wird die Frage der völligen Zerstörung des Waldes überhaupt schon brennend, hier überall führt die Entdeckung der Landschaftsschöne zugleich zu schützendem Eingreifen. Der Zufall hat gewollt, daß neben die Weltstadt Berlin mit ihren siegesgewissen Verstandestriumphen gerade eine der zartesten, duftigsten, verträumtesten Landschaften der Welt geraten ist, ein Landschaftszauber, der nur wie ein feinster Reif und Duft über dem alten Eiszeitbett liegt. Ein paar Griffe des kühlen Verstandesriesen, und dieser Stimmungsduft könnte fortgewischt sein. Und doch hat die Stadt nie dringlicher diesen Gegensatz gebraucht – als seelische Ergänzung. Nie andererseits sind die Verkehrsmittel so glänzend gewesen, die es so spielend leicht machen, das Bild des blauen märkischen Sees immerfort wie ein Seelenbad deutlich und vertraut zu halten auch inmitten der angespanntesten Großstadtarbeit.
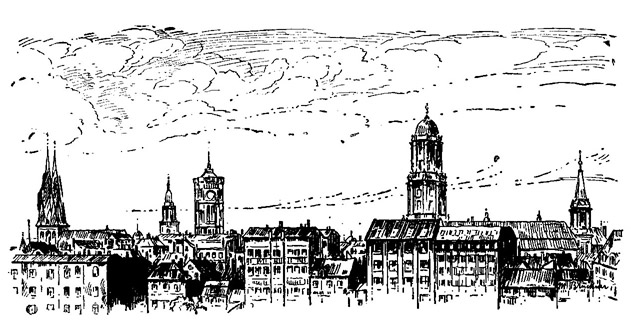
Blick auf Alt-Berlin.
Von W. Pütz.
Das vorgeschichtliche Flußsystem Norddeutschlands zeigt im völligen, fast paradox erscheinenden Gegensatz zu dem heutigen nordsüdlichen Verlauf der Oder und Weichsel eine südost- und nordwestliche, beziehentlich ostwestliche, über Berlin beziehentlich über Eberswalde führende Richtung dieser Flüsse sowie eine Vereinigung beider in der Niederung des Havelluches, von wo ab sie in Gemeinschaft mit den Wassern der Elbe den ältesten Hauptstrom, den eigentlichen Urstrom Norddeutschlands bildeten und in dem weiten, von dem heutigen Elbstrom nur zum kleinsten Teil ausgefüllten Tale der Nordsee zueilten – solchergestalt, in weiterem Gegensatz zu dem heutigen Flußbild, nur ein einziges Flußsystem darstellend.
Die Entstehung dieser nach dem Vorgange Berendts auf drei längere Stillstandspausen während der Rückzugsperiode der letzten Vereisung zurückgeführten, alten Urströme ist durch die Auffindung der zwischen den alten Flußtälern liegenden, die Stillstandslinien des Eises bezeichnenden Endmoränen in ihrer Ursache immer klarer erkannt worden. Der Parallelismus zwischen Endmoräne und den alten Flußtälern kennzeichnet diese als ursprüngliche Sammelrinnen der Schmelzwasser; ein Rückzug des Eisrandes nach Norden mußte folgerichtig eine weitere Verlegung jener Abflußwege nach derselben Richtung hin nach sich ziehen. Hat somit die Entstehung des ältesten und südlichsten dieser alten Flußtäler, des sogenannten Glogau- Baruther Tales, den Beginn der Abschmelzungsperiode zur Voraussetzung, so bezeichnet das hier hauptsächlich in Betracht kommende zweite Tal, das sogenannte Warschau-Berliner Tal, ein bereits über die Gegend von Berlin hinaus vorgeschrittenes Stadium, während dessen zunächst die sämtlichen Schmelzwasser, die bis dahin dem ersten Haupttal zugeflossen waren, hier ihre Vereinigung und ihren Abfluß nach der unteren Elbe fanden, wogegen die Wasser des ersten Hauptstromes das Bestreben zeigten, nach dem neuen tieferen Tal durchzubrechen. Ein solcher Durchbruch gelang zuerst dem Wasser der heutigen Oder in der Gegend von Deutsch-Wartenberg, infolgedessen das erste Haupttal unterhalb des Durchbruches insoweit ein totes Tal wurde, als es jetzt nur noch von Süden her durch Nebenflüsse gespeist wurde. Doch auch ihnen mußte nunmehr der Durchbruch nach dem neugebildeten Hauptstrom um so leichter gelingen, als ihnen hierzu die ehemaligen, nun trocken liegenden nordsüdlichen Schmelzwasserrinnen zur Verfügung standen.
Ein solcher Entwicklungsgang erklärt hinreichend die Herkunft der gewaltigen Wassermassen, die einstmals unser Berliner Tal ausfurchten, um später nach Entstehung des dritten, nördlichsten Haupttales, des sogenannten Thorn-Eberswalder Tales nach dieser wiederum tiefer gelegenen Schmelzwassersammelrinne sich einen Durchbruch zu suchen, der südlich bei der heutigen Stadt Frankfurt (a. O.) vor sich ging und für unser Berliner Odertal von wesentlicher Bedeutung war. Ließ er doch abwärts der Durchbruchstelle in dem breiten Flußbett nur die Spree, den ehemaligen Nebenfluß, zurück, deren schmaler Wasserlauf sich hier, um einen treffenden Vergleich Berendts anzuführen, ausnimmt »wie die Maus im Käfig des entflohenen Löwen«.
In dem von den rauschenden Wassern des Urstromes verlassenen Rinnsal sich ihr Bett ausfurchend, nahm nun die Spree ihrerseits zwei andere bisherige Oderzuflüsse als eigene Nebenflüsse auf, nämlich die in einem breiten ehemaligen Durchbruchtale von Süden kommende wendische Spree (Dahme) und von Norden her die Panke. So verstärkt fand sie selbständig ihren Weg über Spandau und Nauen zur unteren Elbe, eine Selbständigkeit, deren Dauer abhängig war von derjenigen des dritten, nördlichsten Urstromes.
Wie aber nun jeder einzelne dieser diluvialen Urströme nur anzusehen ist als ein Glied in der Entwicklungsreihe des alten Flußsystems, so bildete dies selbst nur das Übergangsstadium zu den hydographischen Verhältnissen der Gegenwart, für die der Zeitpunkt gekommen war, als nach vollständiger Abschmelzung des Inlandeises und infolge der damit wohl gleichzeitig sich vollziehenden nördlichen Allgemeinneigung des Bodens die bisherigen Nebenflüsse der unteren Elbe, des ältesten und eigentlichen Urstromes des nordöstlichen Deutschlands, Oder und Weichsel ihren nördlichen Abfluß zur Ostsee gefunden hatten, und infolgedessen auch das Eberswalder oder alte Weichseltal westlich der in der Gegend von Oderberg zu suchenden Durchbruchstelle ein totes Tal wurde.
Dieses Ereignis, durch welches das heutige Flußnetz im wesentlichen zum Abschluß gelangte, war für das Berliner Tal nur insoweit von Wirkung, als nunmehr die vorerwähnte »Selbständigkeit« der Spree, d. h. ihr Einmünden in die Elbe, in Frage gestellt wurde. Denn die Havel, die als ursprünglicher Nebenfluß des ältesten Urstromes bei Entstehung der beiden andern Haupttäler zweimal in ihrem unteren Lauf gekürzt worden und so nacheinander zunächst zu einem Nebenfluß der über Berlin fließenden alten Oder, sodann der über Eberswalde fließenden Weichsel geworden war, hatte nach Entleerung der beiden nördlicheren Haupttäler endlich ihr altes Bett über Spandau und Potsdam wiedergefunden, stieß aber auf diesem Wege rechtwinkelig mit der Spree zusammen. Zwischen beiden nicht erheblich ungleich starken Flüssen kam es nun zu einem Kampfe um die Oberhand, dessen Zeugen wir noch heute in den Versandungen des unteren Spreebettes sehen; die reichlicheren Wasser der Havel mußten aber schließlich den Sieg davontragen, und damit war auch für die Umgegend von Berlin das heutige Flußbild vollendet.
Das mittlere der drei Haupttäler weist nun auf seiner ganzen Längsausdehnung von der Elbmündung bis nach Rußland hin, gerade an der von unserer Reichshauptstadt eingenommenen Stelle, zwar nicht die engste, aber doch für einen Übergang bei weitem günstigste Stelle auf. Just hier nähern sich nämlich die beiden trockenen Diluvial-Plateaus, der Teltow und der Barnim, auf etwa 400 m gleich einem Drittel der durchschnittlichen Talbreite.
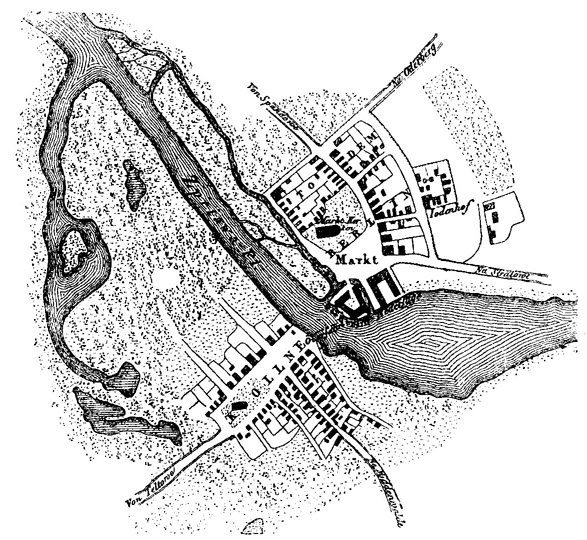
Berlin und Kölln im Anfang des 13. Jahrhunderts. (Nach K. F. Klöden.)
Hier mußte sich also nicht nur ein reger Verkehr zwischen hüben und drüben entwickeln, hier mußten sich auch die Hauptstraßen von Süd nach Nord, wo die Bernsteinküste schon frühzeitig den Handel anzog, scharen und so Bedingungen geschaffen werden, die naturgemäß und nachweisbar die Gründung und das rasche Aufblühen einer Ansiedlung bewirken, im vorliegenden Falle aber um so günstiger waren, als die Gabelung der Spree in zwei das Werder umschließende Arme nicht nur den Ladeverkehr zu wiederholter Rast zwang, sondern auch wohl den Schiffer wegen der wahrscheinlich beengten Durchfahrt zum Aufenthalt genötigt haben mag.
Es ist ein weiter Entwicklungsgang von Fährstelle und Fischerdorf zur Weltstadt. Aber unaufhaltsam wuchsen dem auf dem lebensfähigen Boden des alten Flußtales entsprossenen Gemeinwesen die kräftigen Glieder; denn »ein großartiger Beruf lag auf dieser Sandscholle«, wie Willibald Alexis sagt, ein Beruf, dessen Erfüllung auch die schwerste Not der Zeiten nicht zu hindern vermochte.
Umflutet von dem Wirbel des modernen Straßenlebens, wandeln wir heute, der geringen Steigung nicht achtend, welche die Straßenbahn ohne Schwierigkeit zu nehmen vermag, unbewußt aus dem Gebiete des Talsandes auf das Höhendiluvium. Aber wie sehr auch immer Menschenwerk die Urschrift der Natur verwischt hat, es gelingt doch unschwer, sie auch in dem heutigen Stand der Dinge noch zu erkennen, da sich sowohl für den Süd- wie für den Nordrand des Tales je ein offen zutage liegender Ausgangspunkt einer solchen Beobachtung darbietet.
Als ein derartiger Punkt ist für den Süden der Kreuzberg zu nennen, dessen Anstieg, d. h. die Talböschung, in der Belle Alliance- und Lichterfelder Straße deutlich zum Ausdruck kommt. Von hier aus läßt sich der Talrand nach Osten zu in der Richtung der Bergmannstraße, deren südliche Querstraßen ein merkliches Ansteigen zeigen, um so leichter verfolgen, als er bald hinter dem Marheineckeplatz sowohl in den Friedhöfen der Hafenheide wie weiterhin in den jetzt freilich verschwundenen Rixdorfer Rollbergen offen und zum Teil noch ziemlich unberührt hervortritt. Ähnlich gelingt das Verfolgen der Randlinie nach Westen hin durch die Kreuzbergstraße über die Anhalter und Potsdamer Eisenbahn hinweg nach dem (alten) Botanischen Garten und Schöneberg, von wo ihr weiterer Verlauf über Charlottenburg, Westend, den Spandauer Berg (dessen vorspringende Spitze, der allen Berlinern wohlbekannte Spandauer Bock, eine vorzügliche Beobachtungsstelle bildet), sodann über den Pichelswerder und die Orte Staaken, Dallgow, Nauen zu suchen ist.
Für den Norden dient der Friedrichshain zum Ausgangspunkt. Das unmittelbar hinter dem Landsberger Platz stark ansteigende Parkgelände kennzeichnet recht deutlich das Diluvialplateau, dessen Rand von hier aus im Zuge der Friedensstraße derartig weitergeht, daß diese selbst die obere Kante der Böschung bezeichnet, während ihre Parallele, die Höchste Straße, sich ziemlich am Fuß der Böschung hinzieht, ihren Namen aber mit Rücksicht auf die von hier immer noch bergab gehenden Querstraßen gleichwohl nicht zu Unrecht führt. Jenseits des Königstors, wo sich der Aufstieg der neuen Königsstraße von der Talsohle auf das Diluvialplateau in einer die Böschung durchsetzenden Falte und somit fast unmerklich vollzieht, macht das Gehänge eine Schwenkung aus der bisherigen Südost-Nordwestrichtung in eine genau ostwestliche und tritt zugleich mit einer stärkeren Erhebung etwas südlich vor, so daß die Randlinie einen spitzen Winkel mit der Linie der neuen Königsstraße bildet. An der nun folgenden Prenzlauer Allee erleidet das Terrain wiederum eine Senkung, so daß der Höhenrand zwischen hier und dem Königstor bergartig hervortritt und der früher gebräuchliche, durch die Bebauung aber allmählich fast in Vergessenheit geratene Name »der Prenzlauer Berg« begreiflich wird.
Jenseits des Prenzlauer Tores durchschneidet das Gehänge die nordseitigen Querstraßen der Lothringer Straße, von der es sich allmählich immer weiter zurückzieht, so daß der stark ansteigende Weinbergsweg etwa in seiner Mitte und die folgende Brunnenstraße etwa bei der Einmündung der Veteranenstraße gekreuzt werden. Von hier über den Begräbnisplatz der Elisabethgemeinde und die Bernauerstraße weiterlaufend folgt die Böschung dem Zuge der Hussitenstraße und tritt dann, mit einer Linksbiegung, die Stettiner Eisenbahn überschreitend, in den Begräbnisplatz der Dorotheen- Gemeinde, wo er um den rechts bleibenden Humboldthain nach Norden biegend in den Ostrand des Panketales übergeht.
Die bedeutende Verbreiterung des Berliner Tales, die hier durch das Einmünden zweier ehedem weit ansehnlicheren Wasserläufe, nämlich der bereits genannten Panke und des Hermsdorfer Fließes, entstanden ist, und der sich die große Unterbrechung des Diluvialplateaus durch die Havel unmittelbar anschließt, läßt auch an dieser Stelle auf weit größere Wassermengen der Vorzeit schließen, wie sie andererseits Berlins für seinen Entwicklungsgang so ungemein günstige Lage mit überzeugender Klarheit dartut.
Vom Friedrichshain ostwärts tritt der Talrand zunächst in den Friedhöfen der Petri- und Georgen-Gemeinde hervor, von wo aus er, durch mehr oder weniger starkes Gefälle bemerkbar werdend, über die Weiden- und Thaerstraße und den Baltenplatz in fast paralleler Richtung mit der Frankfurter Allee verläuft. In der Nähe des Talgehänges, wo die Namen Ackerstraße, Gartenstraße, Frucht- und Blumenstraße eine fast vergessene Sprache reden, blühte übrigens ehedem eine reiche Garten- und Ackerkultur, deren Bedeutung schon daraus erhellt, daß die Berliner Ackerbürger sich bereits vor Entwicklung der städtischen Gewerbe zu einer Gilde zusammengeschlossen hatten und in der sogenannten »Wröhe« ein eigenes Gericht besaßen. Die Mitglieder dieses Gerichtes, die »Wröheherren« hielten, wie aus den Satzungen der Ackergilde von 1580 hervorgeht, in Gemeinschaft mit den zugeordneten Ratsdeputierten von der Pflugzeit bis nach Bartholomäi alle Sonntage auf dem Rathause die »Wrüge« Wröhe, Wrüge = Rüge, d.h. also Rügegericht. Die Funktionen dieser Rügeherren hatten sich indes im Laufe der Zeiten geändert und bestanden zuletzt nur noch im Abschätzen von Wiesen und Äckern. ab.
In der Frankfurter Allee war es auch, wo noch im Jahre 1886 ein Grundbesitzer seinen Wein kelterte. – Weinbau in Berlin! In welch hellem Glanze erscheint uns beim Klange dieses Wortes der alte Talrand! Die vereinigten Städte Berlin und Kölln besaßen um die Mitte des 16. Jahrhunderts 70 Weinberge und fast 30 Weingärten, von denen einer 1595 volle 96 Tonnen ergab. Und es war nicht nur schlichter, sog. »blanker« Landwein, den die alten Berliner namentlich an dem nördlichen, nach Süden einfallenden und so die günstigsten Kulturbedingungen bietenden Gehänge erzeugten, sondern auch Muskateller, Malvasier, Petersilienwein und tiefdunkeler, sog. Tintenwein, von deren vortrefflichem Wohlgeschmack die Chronisten des 17. Jahrhunderts viel Rühmliches zu erzählen wissen. Zwar erwähnt der Frankfurter Studiosus Michael Frank, der auf seinen Reisen vor 300 Jahren auch nach Berlin kam, neben den Obstgärten besonders auch den »Weinwachs« an der trebbinischen Seite, also im Süden der Stadt bei dem heutigen Kreuzberge, wo die letzten Weinberge 1740 ausgerodet wurden. Der aus dem Jahre 1757 stammende Schmettausche Stadtplan, aus dem, wie nebenbei bemerkt sei, der Talrand in voller Deutlichkeit, wenn auch in der dem damaligen Stande der Kartographie entsprechenden willkürlichen und systemlosen Manier eingetragen ist, zeigt im Süden der Stadt keinerlei Weinberge mehr. Jedoch befanden sich früher u. a. zwei städtische Weinberge an der heutigen Bergmannstraße, die nach Ausweis der Kämmereirechnungen im Jahre 1695 für 36 Tonnen Wein die Summe von 144 Talern einbrachten. Doch kann der Weinbau hier naturgemäß nur von geringerer Bedeutung gewesen sein als an dem nach Süden und Südwesten gelegenen, der vollen, noch durch keinerlei Mietskasernen beeinträchtigten Bestrahlung ausgesetzten Abhange des Barnim, wo das Andenken an jene glücklichen Zeiten in den Namen zweier, die Hauptzugänge zu jenen Weinbergen bildenden Straßen erhalten geblieben ist. Lag doch an dem heutigen Weinbergsweg der früher nach seinem zeitweiligen Besitzer, dem Feldmarschall Sparr, benannte spätere Wollanksche Weinberg, der das gesamte von jenem Wege und der Zehdenicker, Choriner sowie der Fehrbelliner Straße umschlossene Viereck einnahm und von dem hier besonders stark entwickelten Talgehänge in seiner ganzen Längsausdehnung durchzogen wurde. Die Weinstraße ihrerseits führt zu jenen zusammenhängenden Weinpflanzungen, die sich von ihrem Ausgange am Talrande nach Westen hin über die heutige Barnimstraße, sowie den hochgelegenen Platz der Bartholomäuskirche erstreckten und in noch größerer Ausdehnung jenseits der damaligen Bernauer- (heutigen König-)straße den ganzen südöstlichen Abhang des mehrfach genannten Prenzlauer Berges überzogen. Vielleicht erzählen dort noch heute Sprößlinge jener Rebstöcke, die sich in »hängenden Gärten« leidlicher Daseinsbedingungen erfreuen, von der ehemaligen Bedeutung, die das Talgehänge des »vorsintflutlichen« Urstromes im Leben der Berliner Bevölkerung hatte.
So knüpfen sich die Fäden zwischen den ins Dunkel der Vorgeschichte reichenden Entwicklungsphasen unserer Erde bis zu den freundlichen Gebilden der Kultur und bieten der Heimatkunde reizvolle Anregungen.
W. Pütz in der Brandenburgia, Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 9. Jahrgang 1910. Verlag von P. Stankiewicz' Buchdruckerei, Berlin.
Von George Hesekiel.
Die Städte Berlin und Köln sind zu Anfang wendische Fischerdörfer gewesen. Der Name Berlin kommt aus der wendischen Sprache. Man nannte es das Dorf »to dem Berlin«, d. h. auf dem wüsten Acker, weil das Dorf auf dem sandigen, unbebauten Boden des rechten Spreeufers lag. Der Name Köln kommt ebenfalls von den Wenden, denn Kol bedeutet in ihrer Sprache einen Pfahlrost und »Kolne« ein Haus, welches auf einem solchen Pfahlrost erbaut ist. Köln aber liegt auf dem linken Spreeufer in Sumpf und Morast, und fast alle Häuser dort stehen auf Pfählen. Zwar haben die Gelehrten etliche solche Etymologien oder Ableitungen verwerfen wollen. Es haben ihrer viele gesagt: der Name Köln komme von dem lateinischen Worte colonia, und wolle sagen, daß die Stadt gegründet und benamset worden sei von einer niederländischen Kolonie. Sie führen für ihre Behauptung zweierlei an: erstlich die Stadt Köln am Rhein, so eine römische Kolonie gewesen sei und Colonia Agrippina geheißen habe; zweitens aber zählen sie die Namen derjenigen holländischen Geschlechter auf, die noch heute zu Köln oder Berlin florieren, als da sind: Grävelhout, Brügghe, Assegraap, Krenevout, Ryke, Haydike u. a. m. Was aber das erste betrifft, so ist das wohl ein sehr schwacher Beweis, und was das zweite angeht, so wissen wir aus den Rykeschen Familienschriften, daß Berlin und Köln schon ganz stattliche Orte waren, als die Niederländer hier einwanderten. Auch wäre es seltsam, wenn mitten im wendischen Lande Köln und Berlin allein nicht wendische Namen hätten. Alle Orte ringsum sind wendisch genannt, als: Brennibor oder Brandenburg, welches eine Schutzwehr des Waldes bedeutet; Potzdupimi oder Potsdam, zu deutsch das Eichendorf; Köpenick, das Dorf am Graben; Glienick, an der Lehmgrube; Brietz, das Birkendorf; Buckow, das Buchendorf; Lietzen, das Buschdorf; Spandau kommt von dem wendischen Wort »spanjah« (schlafen) und bedeutet einen Ort der Ruhe; Pankow hat seinen Namen von Panke, welches eine Haselnußschale bedeutet; Stralow von strahla, der Pfeil. Wenn nun fast alle Orte in der Umgegend Berlins ihren Namen aus dem Wendischen haben, so ist wohl anzunehmen, daß die wendische Ableitung der Namen Berlin und Köln die richtige sei. Andere Gelehrte wollen den Namen Berlin aus dem lateinischen Worte » berlia« ableiten, welches ein Weideland bedeutet, oder auch von briolium oder perivolium, wie man einen Tiergarten im Lateinischen zu nennen pflegt. Aber keiner dieser Herren hat vermocht, etwas Stichhaltiges für seine Behauptung aufzubringen. Endlich sind in neuester Zeit noch etliche dagewesen, so gewollt haben, daß Berlin seinen Namen hätte von Alberto Urso, vom Markgrafen Albrecht dem Bären, der die Stadt gegründet und einen Bären in seinem Wappen geführt haben soll. Solche Behauptung haben sie unterstützen wollen durch das Berlinische Wappen, welches einen schwarzen Bären zeigt. Aber es ist dem nicht also. Markgraf Albrecht wird zwar von den Chronisten häufig Albertus ursus, der Bär, genannt, doch nur, weil er tapfer wie der Bär seine Feinde bekämpfte. In seinem Wappen aber führte er keinen Bären, sondern einen Adler und den Ballenstedtischen Balken. Auch hat Markgraf Albrecht Berlin nicht gegründet, denn lange bevor er florierte, lagen diese beiden Orte am linken und rechten Ufer der Spree.
Berlinisches Historienbuch. Berlin, Hermann Hollstein.
Eine neue Ableitung des Wortes »Berlin« findet sich in den »Mitteilungen des Fischereivereins für die Provinz Brandenburg«. Berlin verdankt seine Entstehung bekanntlich seiner Lage an der engsten Stelle des Spreetales, wo sich verhältnismäßig leicht ein Übergang vom Teltow nach dem Barnim herstellen ließ. Derartige Übergänge stellte man in alten Zeiten häufig nicht durch Brücken her, sondern durch breite Dämme, die den Fluß überquerten und als Furt, nebenbei auch noch als Fisch- und Mühlenwehr dienten; zum Beispiel diente in dieser Weise früher der Mühlendamm. Solche Wehrbauten hießen nach den dabei verwendeten Baumstämmen (wendisch »bar«) auch »Bäre«, Fähre, Wuhre, und Burg und Stadtanlage benannten sich dann nach dem kennzeichnenden Wehrbau, dem »Bär«. »to dem Berlin« (d. h. »am Bärlein«) wäre demgemäß eine Verkleinerungsform, die auf einen zweiten, kleineren Dammbau hindeuten würde. Zu dieser Auslegung würde auch die dialektische Aussprache des Wortes Berlin stimmen, die im Volksmund der umliegenden Gegenden wie »Barlin« klingt.
Von Dr. Ernst Karber, Direktor des Berliner Stadtarchivs.
Genau so wie das Dasein Berlins beruht das aller märkischen, ja aller ostelbischen Städte auf der Besiedlung ursprünglich slavischen Gebietes durch deutsche Kolonisatoren, gleichviel, ob sie an der Stelle alter slavischer Ortschaften oder als völlig freie Schöpfungen entstanden. Wären die ausgesprochenen Eigenschaften des Berliners aller Zeiten durch diesen Akt der Entstehung seiner Stadt bestimmt, dann müßten Brandenburg an der Havel, Frankfurt an der Oder und Prenzlau, müßten die altmärkischen Städte wie Stendal und Tangermünde, müßten Meißen und Dresden und die anderen Städte des Freistaates Sachsen, müßten die mecklenburgischen und pommerschen Städte den gleichen » genius loci«, den gleichen Ortsgeist besitzen wie Berlin. Davon kann natürlich nicht die Rede sein, selbst wenn man eine innere Verwandtschaft alles Ostelbiertums zugibt, deren Quelle übrigens weniger in seinem kolonialen Ursprung, als in der besonderen Eigenart der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung namentlich des preußischen Staates zu suchen sein wird. Diese aber ist ohne die Persönlichkeiten der Hohenzollernschen Regenten nicht zu verstehen. Der Große Kurfürst, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. haben die Grundlagen, wie für den preußischen Staat, so für die Eigenart des Preußentums geschaffen, obgleich die Hohenzollern dem alten fränkischen Kulturboden entstammten.
Das Wesen des Berlins der Geschichte wird nur der zu zeichnen wagen dürfen, der nicht in der Einheit, sondern in der Bewegtheit, nicht in der Gleichheit, sondern im Wandel das Wesen geschichtlichen Geschehens sieht. Wohl wird das Vergangene selten völlig ausgelöscht; aber indem Zeiten und Menschen sich wandeln, entsteht plötzlich vor dem Auge des später Geborenen eine neue Stadt. Eine andere ist die Stadt des Mittelalters, ist die werdende Residenz des Ständestaates, ist das Berlin des Absolutismus und die Stadt des zur Herrschaft gelangten modernen Bürgertums. Unmöglich, in den knappen Rahmen eines Aufsatzes die Fülle bewegten Lebens zu bannen, die wir die Geschichte Berlins nennen. Die entscheidenden Charakterzüge nur jeder der vier Entwicklungsstufen will ich anzudeuten versuchen.
Am Anfang steht die mittelalterliche Stadt, die Schöpfung der Kolonisationszeit. Sie verdankt den Urenkeln Albrechts des Bären, Johanns I. und Ottos III. ihr Dasein, und sie beherbergt nicht untertänige Wenden als Hauptbestandteile der niederen Bevölkerungsschichten in ihren Mauern, sondern sie ist rein deutscher Art. Hier hat man nicht, wie zuweilen behauptet wird, einen Mischdialekt aus deutschen und slavischen Elementen, vielmehr reines Niederdeutsch gesprochen. Die Sprache des mittelalterlichen Berlin ist uns durch Hunderte von Urkunden und durch das berühmte Stadtbuch aus dem Ende des 14. Jahrhunderts überliefert und wissenschaftlich durch Agathe Laschs ausgezeichnetes Buch über die Geschichte der Schriftsprache in Berlin bekannt. In diesem Buch werden auch die sprachgeschichtlichen Gründe für die Vermischung von Dativ und Akkusativ in der heutigen Berliner Umgangssprache klargestellt. Sie hat mit wendischen Einflüssen nicht das geringste zu tun. Wenn der heutige Berliner das Plattdeutsche nicht mehr versteht, dann rührt das daher, daß sich in der Residenz der Hohenzollern vom 16. Jahrhundert an und ganz wohl erst durch die Arbeit der Volksschule des 19. Jahrhunderts das Hochdeutsche stärker durchgesetzt hat als in anderen Städten des ursprünglich niederdeutschen Sprachgebietes. Von den wesentlichen Eigenschaften des heutigen Berlin läßt sich kaum etwas in dieser mittelalterlichen Stadt entdecken, deren Blüte zwar auf dem Handel beruhte, die aber bis in die Spitzen des Bürgertums hinein fest mit dem flachen Lande verwachsen war und ein nüchternes, streng an Religion, Recht und Sitte gebundenes Volk beherbergte.
Wie fast alle aufstrebenden Städte des Mittelalters hat Berlin bald eine ziemlich selbständige Politik gemacht, aber nie im Gegensatz zur Landesherrschaft. Mit dieser ist Berlin erst unter Kurfürst Friedrich II. in den vierziger Jahren des 15. Jahrhunderts in jenen Streit geraten, der seine Selbständigkeit für immer gebrochen, es aber dafür zur Residenz der Hohenzollern gemacht hat. Unter Friedrichs Nachfolgern sind es nur die Städte der Altmark, in denen der Widerstand gegen das kurfürstliche Regiment zu blutigen Zusammenstößen führt. Während Berlin in der Zeit zwischen 1448 und 1648 dem landesherrlichen Willen immer gefügiger wird, bleiben doch die Formen der alten Ratsverfassung und auch das äußere Bild der mauerumwehrten mittelalterlichen Stadt erhalten. Aber die Reformation, der Hof und die durch ihn herbeigezogene stärkere Einwanderung aus den westlichen und südlichen Kulturgebieten Deutschlands bestimmen das geistige, kulturelle und wirtschaftliche Antlitz der Stadt in dieser Übergangszeit. Der lutherischen Reformation haben sich die Berliner mit ganzem Herzen ergeben; ihretwegen ist noch einmal nach dem Übertritt des Kurfürsten Johann Sigismund zum reformierten Glauben ein nächtlicher Aufruhr in der Residenz ausgebrochen. Auf die Lebensauffassung der führenden Kreise der Bürgerschaft wie auf die äußere Kultur übte das Beispiel des genuß- und kunstfreudigen Hofes trotz der allmählich schwieriger werdenden wirtschaftlichen Lage der gesamten Mark Brandenburg entscheidenden Einfluß aus. Die ausgesprochen märkische Art Berlins in Sprache, Recht und künstlerischem Gestaltungswillen schwächte sich bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges in den höheren Schichten des Bürgertums immer mehr ab.
Was sich von der Verfassung des mittelalterlichen Berlin noch gerettet hatte, war nicht stark genug, um die Stürme des großen Krieges zu überdauern. Die städtische Selbstverwaltung wich dem absoluten Willen des Preußischen Staates nirgends so früh wie in Berlin, dessen Bürgern politische Widerspruchsgedanken unendlich fern lagen. Dafür gab der Staat oder vielmehr sein Oberhaupt, der absolute Herrscher, der Residenz reichen Ersatz. Er legte ihr ein neues Gewand an, ließ die Mauern und Türme des Mittelalters verschwinden und an ihre Stellen moderne Festungsanlagen treten, vergrößerte sie durch neue Stadtteile und ließ in ihren Straßen jene öffentlichen und privaten Prachtbauten sich erheben, deren Zahl ebenso unsere Bewunderung verdient wie ihre künstlerische Vortrefflichkeit. Berlin, unter Joachim II. in seinen Hauptstraßen eine Renaissancestadt geworden, wurde nun eine Barockstadt. Zugleich übernahm der Staat mit der Sorge für das Wohlfahrts- und Armenwesen, für Pflasterung, Beleuchtung und Reinigung der Straßen die Pflichten, die aus der repräsentativen Eigenart der Residenz flossen. Durch ihre Wirtschaftspolitik erhoben die Hohenzollern Berlin zur ersten Handels- und Industriestadt ihrer Länder. Sie bauten Kanäle, gründeten Fabriken und zogen französische Flüchtlinge und aus Wien vertriebene wohlhabende Juden heran. Das Berlinertum zu Ende des 18. Jahrhunderts war von völlig anderem Schlage als das zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Daran hatte zuletzt auch eine geistige Bewegung ihren Anteil: die durch Friedrich den Großen, man möchte sagen, zur Staatsreligion erhobene Aufklärung. Sie ist es, die dem geistigen Antlitze Berlins bis heute unverwischbare Züge aufgepreßt hat. Von Gegnerschaft wider Staat und Königtum war diese Aufklärung himmelweit entfernt; Berlin blieb noch Jahrzehnte hindurch eine hohenzollernsche Stadt.
Eines hat der Absolutismus seinen Bürgern nicht geben können, staatliches Verantwortungsgefühl. Das entquoll erst der Reformzeit der Stein und Hardenberg und den sie abschließenden Freiheitskriegen. Aus ihnen ging das neue Berlin der bürgerlichen Selbstverwaltung hervor. Daß es, zum ersten Male seit 400 Jahren, in einen politischen Gegensatz weniger zum preußischen Staat als zu der Königsgewalt Friedrich Wilhelms IV. geriet, war die Folge der nach 1815 in Preußen siegreichen politischen und dann auch religiösen Reaktion. Durch die Märzrevolution, und stärker noch durch die Konfliktszeit der sechziger Jahre, kam das liberale Berliner Bürgertum in eine Frontstellung zu den herrschenden Gewalten innerhalb des preußischen Staates.
Diese Dinge gehören genau so zum Wesen Berlins wie die wirtschaftliche und kommunale Arbeit, die es im 19. Jahrhundert geleistet hat. Seine wirtschaftliche Stellung im vorausgehenden Zeitalter dankte es dem Königtum, den von diesem herangezogenen fremden Industriellen und der Erziehung seiner Einwohner zu hochwertiger Arbeit. Als nach dem Zusammenbruch des friederizianischen Staates die Hilfe von oben fortblieb, waren im Berliner Bürgertum die sittlichen und die technischen Kräfte vorhanden, die den wirtschaftlichen Neubau errichteten. Diese Jahrzehnte, in denen es nun schon ganz auf schnelles und selbständiges wirtschaftliches Denken und Handeln ankam, haben die hellen und scharfen Züge in dem Gepräge Berlins noch verschärft, die ihm seit der Aufklärung eigen waren. Die wirtschaftlichen Erfolge wie die kommunale Entwicklung, die in wenigen Jahrzehnten durch den unerhörten Aufschwung des städtischen Schulwesens, durch Kanalisation, Krankenhäuser, Markthallen, Straßen- und Brückenbauten das innere und äußere Bild der Stadt veränderten, haben zusammen mit der neuen Stellung Berlins als Reichshauptstadt den schon unter dem Großen König erwachten Stolz des Berliners auf seine Stadt zu freilich nicht immer liebenswerten Ausmaßen gesteigert. Dieser Stolz beruht auf sehr tatsächlichen Leistungen, und wenn er sich manchmal in »vorlauter Unkultiviertheit« äußert, so dürfen wir nicht vergessen, daß ein immerwährender Strom tatkräftiger, aber bildungsarmer Einwanderer aus den ländlichen Bezirken des Ostens sich nach Berlin ergossen hat. Gerade die unter ihnen, denen es gelang, schnell vorwärts zu kommen, trugen nach außen die unerfreulichen Züge zur Schau, die übrigens mehr oder minder jeder aufstrebenden Großstadt nachgesagt werden können. Dafür wurde die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft vielleicht ebenso stets wieder aufgefrischt durch diesen Zuzug, dem noch nicht in dem kalten Daseinskampf der Millionenstadt die weicheren Empfindungen abhanden gekommen waren.
Eine Kennzeichnung des heutigen Berlins sollen diese Bemerkungen natürlich nicht sein. Schon deshalb nicht, weil Berlin weniger als je eine Einheit ist. Im Mittelalter, und noch in der Zeit etwa bis zum Großen Kurfürsten, einte, trotz der Unterschiede in Bildung, Reichtum und sozialer Stellung, die Religion alle Stände, führte sie allsonntäglich im Gottesdienst zusammen. Ein familienhaftes und nachbarliches Gefühl durchdrang noch die ganze Einwohnerschaft. Das wurde anders, als aus der kleinen die große und am Ende die Millionenstadt wurde. Die sozialen und geistigen Trennungsgräben wurden tiefer, der Charakter Berlins und seiner Bewohner widerspruchsvoller. Für die Eigenart des Berlins unserer Tage wird man kaum eindeutige Fassungen finden können, wenn man sich nicht auf solche Allgemeinheiten zurückziehen will wie auf die Bezeichnung Berlins als Stadt der Arbeit. Aber damit geraten wir auf Probleme, deren Lösung dem Soziologen gehört. Dem Geschichtsschreiber muß es genügen, zu zeigen, wie sich das Schicksal und damit auch das Wesen Berlins im Laufe der Geschichte gestaltet hat.
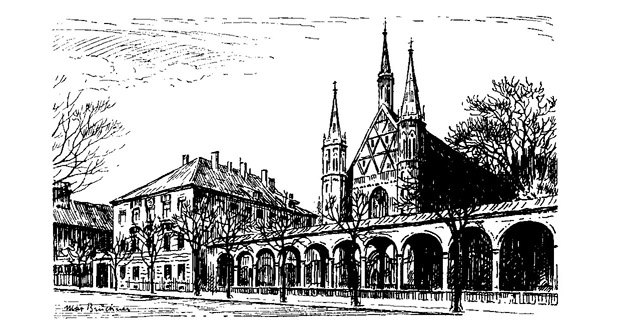
Die Klosterkirche in Berlin vor dem Umbau 1928.
Von Karl Scheffler.
Alle Hauptstädte Europas sind anders entstanden als Berlin. Sie sind geworden wie sie sind, weil sie von Anfang an natürliche Mittelpunkte waren und Sammelbecken, in denen die besten Kräfte des Volkes in dem Maße zusammenflossen, wie das Gemeinschaftsbewußtsein wuchs; weil sie das Herz der Länder waren, zu dem alle Kräfte hinstreben, um gleich auch wieder befruchtet zurückzukehren. Darum finden wir in Hauptstädten wie Paris, Wien, London, Kopenhagen, in Großstädten wie Hamburg, Köln, Dresden oder München immer eine wirkliche, in sich abgeschlossene Stadtwirtschaft und eine Bevölkerung, die einen Volkskern darstellt. Eine Bevölkerung, die bestimmte nationale Eigenschaften in Reinkultur verkörpert und in der alles, was in der Provinz Instinkt ist, Kulturbewußtsein gewinnt. Anders in Berlin. Das ist entstanden infolge eines Vorstoßes pionierender germanischer Stämme ins Wendengebiet. Es ist in der Folge nur gewachsen, wenn neuer Zuzug aus dem Westen, dem Süden oder gar aus fremden Ländern kam. Stieg die Bevölkerungsziffer, so geschah es, wenn Markgrafen, Kurfürsten und Könige neue Kolonisten in die Mark zogen. Berlin ist buchstäblich geworden wie eine Kolonialstadt, wie im neunzehnten Jahrhundert die amerikanischen und australischen Städte tief im Busch entstanden sind. Wie der Yankee das Produkt von deutschen, englischen, irischen, skandinavischen und slawischen Volkselementen ist, so ist der Berliner das historische Produkt einer Blutmischung, deren Bestandteile aus allen Gauen Deutschlands, aus Holland, Frankreich und den slawischen Ländern stammen. Niemals wäre diese künstliche Mischung möglich gewesen, wenn nicht die Eroberung des Neulandes, wenn nicht die Not des Lebens einigend gewirkt hätte. Nur durch den harten Zwang von Gefahr und Not waren die fremdartigen Elemente zu verschmelzen. Auswanderer pflegen nicht der Blüte des Volkes anzugehören. Der Tüchtige, der es zu etwas bringt, ist zu allen Zeiten daheim geblieben und hat zu Hause das Regiment geführt. Die Kolonisten, die nach dem freudlosen Osten zogen, in die freudlose junge Germanensiedlung Berlin oder die sich dahin ziehen ließen, zuerst von den Lokatoren, Siedelungsunternehmern. Mönchen und Markgrafen, später von den Kurfürsten und Königen und endlich von den neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten der Großstadt, das waren im wesentlichen halb oder ganz Enterbte. Es waren energische, willensstarke, beutehungrige und freiheitsdurstige Menschen, erblose Söhne, Unterdrückte, Besitzlose und solche, die zu Hause nicht im besten Ruf standen. Und dann der große Haufe Vertriebener oder Ratloser, die sich von Unternehmern durch die Anpreisung wohlfeilen Anbaulandes herüberziehen oder sich von Voraufgegangenen herüberlocken ließen. Ein Kulturbildner ist solche Mischbevölkerung nicht. Sie kommt spät oder gar nicht zur Ruhe des Genusses, wird schwer nur zu einer geistigen Einheit und findet darum nicht schöne Lebensformen. Aber dafür wird sie widerstandsfähig, praktisch, hart und zähe im Daseinskampfe, wird yankeehaft unternehmend und tüchtig im Wollen und Vollbringen.

Mühlendamm
Nach einer farbigen Zeichnung von Heinrich Zille
Als der Sohn eines bunten Auswanderergeschlechts ist der Berliner also, wie er uns aus den Jahrhunderten entgegentritt, zu betrachten. Als ein Abkomme jener ersten Altfriesen Und Niedersachsen, die im zwölften Jahrhundert aus der Altmark vordrangen, die Wenden nach Alt-Kölln, auf die sumpfige Flußinsel zurückdrängten und sich am rechten Ufer des Flusses festsetzten; als ein Nachfahre jener von den Zisterziensern geführten Germanisierer, jener von dem Wendenbesieger Albrecht dem Bären herübergerufenen Rheinländer und Niederländer, deren Erfahrung in der Kultivierung sumpfigen und sandigen Landes sie als besonders geeignet zur Bewirtschaftung des märkischen Bodens erscheinen ließ. Aber nach den ersten Pionieren, die zugleich mit Pflug und Schwert eroberten, drangen jahrhundertelang dann neue Ansiedler herzu, sie kamen von allen Seiten während der Regierung der Askanier und Wittelsbacher, während der Kämpfe zwischen Bürgern, Adel und Fürsten, während die Mark erobert, verwüstet, verpfändet und von den Reichsfürsten so recht wie ein fernes Meiergut behandelt wurde, von dem nur der Zins interessiert. Sie kamen als Söldner, Abenteurer und Vaganten und blieben als Kolonisten, als Ackerbürger, Handwerker oder Krämer in Kölln und Berlin. In dem Maße, wie die besiegten Wenden dann nicht mehr so sehr als Feinde, als Tieferstehende betrachtet wurden, als man sie nicht mehr so strenge zwang, in Kietzen und Sumpfdörfern den neuen Herren aus dem Wege zu gehen, fand in der Folge auch eine germanisch-slawische Blutmischuug statt. Wie viele Bestandteile der wendischen Sprache in die der Eroberer hinübergenommen wurden, und wie dadurch ein charakteristisches Kolonistenjargon entstand, so mischte sich auch vom Denken und Empfinden der Besiegten manches in das der Sieger, wesentliche Züge dessen ausprägend, was uns in der späteren Geschichte als märkisch und berlinisch entgegentritt. Diese germanisch-slawische Blutmischung hat ja im ganzen Nordosten, bis hinunter nach Sachsen und Schlesien, einen eigenen Typus geschaffen; in Berlin entstand daraus aber eine eigene Spielart, weil die Blutmischung dort früher und gründlicher als anderswo erfolgte. Diese Mischung hatte längst begonnen, als die Hohenzollern in die Mark kamen, als der schwarze Tod würgend durch die schmutzigen Gassen der beiden Spreestädte Kölln-Berlin schritt, die junge Siedlung entvölkernd und immer neuen Zuzug aus dem Reich fordernd. Am Anfange des 16. Jahrhunderts werden charakteristische Schimpfreden, wie »wendische Hunde« oder »wendische Bankerte«, die vorher oft genug bei Tumult und Aufruhr über den Mühlendamm und die Lange Brücke herübergerufen worden sind, bereits vergessen worden sein. Denn zu diesem Zeitpunkt hatten sich die unendlich fremdartigen Bestandteile der Doppelstadt notdürftig schon geeinigt; oder sie hatten sich vielmehr im wahren Sinne des Wortes »zusammengerauft«. Als dann aber der Dreißigjährige Krieg die am Flußübergang allen durchziehenden Soldatenhaufen offen daliegenden Städte schwer getroffen, ja fast vernichtet hatte; als die Bevölkerung infolgedessen so gelichtet worden war, daß man in Berlin nur noch 556 Haushalte und in Kölln 379 zählte; als in der unter schwedischer Oberhoheit sich hinfristenden Stadt so großes Elend herrschte, daß von den Bürgern ernsthaft der Plan einer Massenauswanderung, einer Aufgabe der Stadt erwogen wurde, da waren es wieder fremde Einwanderer, vom Großen Kurfürsten nun herbeigerufen, die die Lücken füllen mußten. Daß Berlin nach dem Dreißigjährigen Kriege so ganz verzagen konnte, ist ein deutliches Zeichen, daß es zu diesem Zeitpunkt sogar eine Stadt mit unerschütterlichem Stadtbewußtsein noch nicht war. Magdeburg ist in schrecklicherer Weise zerstört worden, aber niemand hat daran gedacht, die Stadt aufzugeben. Denn in diesem Falle war die Stadt ihren Bewohnern eine Heimat, eine rechte Vaterstadt; und das eben vermochte selbst das Berlin der Spätrenaissance seinen Bürgern noch nicht zu sein. Die Doppelstadt war einmal kein natürlicher Mittelpunkt, zu dem das Leben des Landes immer aufs neue hinstrebte und in dem sich die Besten des Volkes sammelten, sondern ein vorgeschobener Posten, der von Jahr zu Jahr aufs neue verteidigt sein wollte und zu dem immer neue Menschenmassen, Germanen und Slawen, Franzosen und Juden halb gewaltsam hingeführt werden mußten. Und als sich die Straßen nun unter des Großen Kurfürsten klug ordnender und mehrender Regierung wieder füllten, als die zerstörten Häuser aufgebaut, die leeren Wohnungen bezogen und neue Stadtteile angelegt wurden, da konnte ein schöpferisches Heimatsgefühl selbst von diesem genialen Mann nicht mitgeschaffen werden. Denn nun wurde Berlin von neuem der Ort eines wahrhaft kolonialen Völkergemisches. Die französischen Hugenotten, die in so großer Zahl herbeigezogen wurden, daß man ihnen besondere Stadtteile mit eigenen Schulen, Gerichten, Kirchen und Spitälern anweisen mußte, die lange Zeit mehr als ein Fünftel der ganzen Bevölkerung ausmachten und die französische Sprache in Berlin einbürgerten, brachten fremde romanische Elemente und Kulturformen, die ganz äußerlich bleiben mußten, weil die östliche Stadt für die Segnungen der eingeführten Industrien längst noch nicht ein fruchtbarer Boden war; die einwandernden Holländer suchten dort, wo sie als Baumeister und Unternehmer Wirkungsmöglichkeiten fanden, ihre heimische Lebensart in die Mark zu übertragen, ohne daß ein starker Stadtgeist ihre Eigenart doch hätte verarbeiten können. Daneben kamen dann Scharen von Pfälzern und Schweizern, von Salzburgern und von böhmischen und mährischen Methodisten. Es bedurfte wieder der angestrengten Arbeit einiger Menschenalter, bis die Refugiés Berliner, die Holländer, Waldenser, Österreicher und alle die anderen gute Märker geworden waren. Die Stadtbevölkerung wirkte sogar noch ganz uneinheitlich und setzte sich aus vielen verschiedenen Interessenkreisen zusammen, als Friedrichs des Großen Kriege, als die aus Werbetruppen bestehenden Heere immer neue Volkselemente wieder in die junge Preußenresidenz brachten, als dieser mächtige Wille eine eigene »Kommission zur Herbeischaffung von Kolonisten« einsetzte und seine Gesandten in den fremden Ländern anhielt, »fleißigen und arbeitsamen« Arbeitern alle möglichen Vorteile zu versprechen; als er mit Hilfe von Pfälzern, Schwaben, Polen, Franken und Westfalen den Oderbruch trocken legte, mehr als eine Provinz »im Frieden« eroberte, und als alle diese Fremdlinge von nun an Berlin als ihr Stadtzentrum zu betrachten hatten. Nichts ist bezeichnender dafür, was der jungen Kolonialstadt auch zur Regierungszeit des großen Friedrich noch am meisten not tat, als der fast verzweifelte Ausruf des großen Kolonisators: »Menschen, vor allem Menschen!«
Es leuchtet ein, daß eine so gewordene Bevölkerung nicht schöpferisch in den Dingen höherer Kultur sein kann. Dazu gehört Ruhe, beharrendes Behagen und eine sichere, stetige Entwicklung. Nicht einmal eine Fremdkultur konnte entstehen. Denn die aus alten Kulturbezirken kommenden Fremden, denen in Berlin so bereitwillig Unterkunft gewährt wurde, waren durchweg Vertriebene, Flüchtlinge und Besitzlose. All ihr Sinnen mußte viele Geschlechter hindurch darauf gerichtet sein, ein neues Hauswesen zu gründen, aus dem Nichts neuen Wohlstand zu gewinnen. Sie mochten wollen oder nicht: auch sie waren darauf angewiesen, materiell zu handeln und zu denken. Das heißt: auch sie mußten sich dem Geiste der Stadt unterwerfen, dessen Schicksal von je darin bestand, daß die Bewohner Berlins zuviel immer mit dem Erhaltungskampf, mit dem Ringen um die nackte Existenz zu tun gehabt haben, um zum Gefühl ihrer selbst kommen zu können, um des Überschusses fähig zu sein, woraus Kulturformen erst hervorgehen.
Eine Stadtbevölkerung mit gewissen typischen Zügen tritt dem Betrachter erst in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts entgegen. Um diese Zeit waren die Volksteile und Rasseneinflüsse besser verschmolzen als jemals vorher oder nachher, und man erblickt darum nur in dieser Zeit ein Berlinertum mit eigentümlichem Gesicht. In den Friedensjahrzehnten nach dem Siebenjährigen Kriege und mehr noch nach den Befreiungskriegen kommt endlich der fremde Einschlag als ein bestimmter berlinischer Zug zum Vorschein. Ein leises Bürgerbehagen macht sich bemerkbar. Die Berliner dieser Zeit sind immer noch ein »verwegenes Geschlecht«, wie Goethe sagte, sind nüchtern, praktisch, materiell und schwer einzuschüchtern; aber sie beginnen endlich doch im gewissen Sinne eine Einheit zu werden. Sie beginnen ihre Sendung, den Wert ihrer Eigenart zu begreifen. In dem Berliner, wie er eigenartiger nun hervortritt, ist nichts Faules. Er ist bildungshungrig bis zum Übereifer und eifersüchtig bedacht, alles zu Begreifende zu verstehen; aber er ist als Skeptiker und Ironiker – sogar Selbstironiker – auch der geborene Kritiker aller Werte, die er selbst hervorzubringen nicht imstande ist. Reich an Interessen, aber nicht begeisterungsfähig, überall immer mit seiner bilderlosen Phantasie die Materie berührend; ohne natürliche Anlage für das zwecklos Schöne und musikalisch Klingende, aber tauglich für jede Arbeit fast, die der Tag fordert und die dem Tage nützt. Romanischer Esprit ist in diesem Berliner zur Lust am parodistischen Witz geworden und süddeutsches und niederländisches Kulturbewußtsein zum Kulturehrgeiz. Nachklänge des Slawentums sind bemerkbar, und man entdeckt viele provinzielle Kleinbürgerzüge, die aus Schlesien und Sachsen stammen. Eine trockene Gefühlskälte herrscht vor, und in vielen Äußerungen kommt der spöttische Neid leidenschaftlich sich selbst Belehrender zum Vorschein. Es fehlt das Pathos, das falsche, aber auch das echte, und damit fehlt die Fähigkeit, sich schön darzustellen. Es ist in dieser Stadtbevölkerung keine Großsinnigkeit und keine aristokratische Läßlichkeit; statt dessen ist ihr viel bäuerische Pedanterie, viel Formelwesen eigen. Aber auch die Verschlagenheit und List der jahrhundertelang arm und kümmerlich dahin Lebenden und hart um die Existenz Kämpfenden ist darin. Und damit hängt dann eine weltkluge Heuchelei zusammen, die sich hinter schnoddriger Aufrichtigkeit nur halb verbergen kann. Nichts scheint ursprünglich und natürlich im Berliner der besten Zeit sogar, als nur seine Unliebenswürdigkeit und sein Kolonistendünkel. Keine andere Stadtbevölkerung zeigt so viel Ordnungssinn, Gehorsam und Manneszucht; aber keine hat auch so wenig Sinn für Natürlichkeit. Das Kulturverlangen äußert sich als Unersättlichkeit; aber in dieser Unersättlichkeit ist dann wieder wahre Lebenskraft.
Daß dieser Berliner der besten Zeit, dem die nüchterne Lebenspraxis höher stand als alles andere, sympathisch gewesen sei, kann man also nicht sagen. Aber er hat immerhin endlich ein bestimmtes Gesicht. Die karge Natur seines Landes, die Geschichte seiner Stadt hat ihn zur Sachlichkeit erzogen, hat ihn die Tugenden der Einigkeit schätzen gelehrt und aus ihm ein vortreffliches Material für politische Ordner, einen unübertrefflichen, mannszuchtgewohnten und doch rauflustigen Soldaten gemacht. Dieser Typus, der im Bürgerlichen etwa wie ein provinzmäßiger Yankee wirkt, der bei allem Unternehmungsgeist immer etwas Untergeordnetes behält und dessen Leitwort Pflicht heißt, wirkte auf den Süd- und Westdeutschen fremdartig und unangenehm. Verwandt mit dem Berliner empfand in den Zeiten des deutschen Partikularismus nur der östliche Landsmann, der Schlesier und Sachse, der Westpreuße und Märker, kurz der Bewohner des Kolonialbodens. Denn dieser fühlte, wie sehr seine Interessen mit denen Berlins übereinstimmten. Vom Süden, vom Westen aber sah man mit tiefem Mißtrauen auf das sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu immer größerer Macht emporarbeitende Berlin, sah mit peinlicher Verwunderung auf die Kolonialstadt, die sich eben anschickte, der Reichspolitik bestimmende Wendungen zu geben, und die dem Gefühl des im Mutterland Wohnenden doch immer noch fern und fremd, ja beinahe undeutsch erschien.
A. Scheffler, Berlin. Ein Stadtschicksal. Berlin-Westend, Erich Reiß' Verlag.
Von Karl Scheffler.
Die Geschichte der geistigen Kultur in Berlin ist nichts anderes als die Geschichte eines Willens, der sich unter schwierigen Ausnahmebedingungen bemüht, die Kulturstufe des Mutterlandes zu erreichen. Berlin ist von vornherein zurückgesetzt im Wettkampf um schöne Daseinsformen; darum muß es durch all die Jahrhunderte hinter den Fortschritten der westlichen und südlichen Kultur dienend einhergehen. Erst im 18. Jahrhundert bildet sich langsam und zögernd etwas wie eine Stadtkultur aus; erst als die ursprünglichen Schöpfungskräfte draußen im Reich erlahmen, als die unpersönliche Nachempfindung der neuen Zeit den Siegeszug beginnt, nimmt auch Berlin teil am Kunstleben der Nation. In den ersten fünf Jahrhunderten seiner Existenz kann Berlin in keiner Weise den wichtigsten Kunst- und Kulturstätten zugezählt werden. Aus dem Mittelalter, aus der Renaissance ist kein Bauwerk von höherer Bedeutung erhalten. Nirgend findet man die Zeichen eines mächtigen katholischen Willens oder eines selbstbewußten protestantischen Geistes; es zeigt sich in der Baukunst bis nahe an das 19. Jahrhundert kaum schon ein Zeichen höher gearteter Bürgergesinnung; und es bleibt bis zum Tode des Großen Friedrich die fürstliche Baukunst selbst etwas künstlich Eingeführtes.

An den Zelten im Tiergarten
nach einer Radierung von Daniel Chodowiecki
Ein Hauch des Alters wenigstens, wenn auch nicht der Schönheit, würde von den wenigen mittelalterlichen Kirchen ausgehen, wenn blinder Restauratoreneifer sie nicht umgestaltet, sie nicht umgefälscht hätte. Echt sind heute von den ältesten Berliner Kirchen, der Nikolaikirche, der Marienkirche, der Heiligengeistkapelle und der Klosterkirche, nur noch einzelne Teile des Gemäuers, spärliche Mauerreste, aus Findlingssteinen gefügt, und ein paar ziegelsteinerne Wände aus der späteren Periode märkischer Backsteinarchitektur. Es fehlt den immer wieder skrupellos restaurierten Kirchen darum sogar die Atmosphäre des Alters, die selbst das Nüchterne sonst verklärt; sie stehen fremd im neuen Berlin, in keiner Weise das Stadtbild beherrschend. Vor ihnen kommt selbst der nicht auf seine Kosten, der mit dem Auge des Kunsthistorikers prüft und sich die Bauwerke im Geiste so wiederherstellt, wie sie einst gewesen sind. Denn als Beispiele nordischer Ziegelgotik verdienen diese Kirchen kaum Erwähnung. Überall in der Mark und an der Küste der Ostsee findet man denselben Materialstil weitaus künstlerischer und edler durchgeführt als in Berlin. Die alten Berliner Kirchen sind unsagbar kunstlos. Man geht unberührt an der Fassade der jetzt der Handelshochschule eingefügten Heiligengeistkapelle vorüber; es riecht die aufgeputzte alte Nikolaikirche nach moderner Regierungsbaumeister-Gotik; und kein Hauch musikalisch gefügter Schönheit geht auch mehr von der umgebauten Klosterkirche aus, einer ehemaligen Mönchskirche, die von allen Berliner Gotteshäusern einst am reichsten ausgebildet war. Einen schwachen, arg gebrochenen Nachklang spürt man einzig von der Marienkirche auf dem Neuen Markt. Aber dieser Eindruck geht zum guten Teil dann von der geistreich krönenden Turmarchitektur aus, die Langhans im 19. Jahrhundert dem alten Stumpf hinzufügte. Dabei sind alle diese Kirchen nicht eigentlich klein und armselig angelegt. Sie sind den Maßen und dem materiellen Aufwand nach stattlich genug; aber ihnen allen ist der Stempel phantasieloser Kahlheit aufgedrückt. Nicht puritanischer Geist hat sie gebaut, sondern die Gleichgültigkeit, die das übliche tut, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Diese Kirchen sind wahre Denkmale der Lieblosigkeit. Die Gemeinde, die sie baute, fühlte sich nicht als Persönlichkeit und hatte darum nicht das Bedürfnis, sich selbst mittels der Baukunst höhere Gleichnisse vor Augen zu stellen. Selbst in der Zeit des Bürgerrausches und des städtischen Hochgefühls noch wurde der Tempelgedanke in Berlin klein und geschäftsmäßig begriffen. Man sieht an dieser Kirchenarchitektur, daß eine die Tiefen bewegende religiöse Idee in der Kolonialstadt nie Wurzel zu fassen vermochte.
Etwas anderes als die Grundmauern dieser Kirchen ist aus dem ältesten Berlin nicht erhalten. Es gibt in dem Häuserchaos der Hauptstadt noch ein paar alte Höfe und Gassen, auf denen die Schatten der Jahrhunderte liegen. Aber sie können das Berlin des Mittelalters nicht lebendiger machen. Sie sind mehr eng, schmutzig und rumpelig als charakteristisch und malerisch. Man muß schon in die Museen gehen, ins Märkische Museum, oder nach Potsdam, wo im Babelsberger Park die alte Gerichtslaube allzu säuberlich aufgebaut worden ist. Aber wer geht wohl ins Museum, um eine Stadt kennen zu lernen! Was nicht der Stadtgrundriß, was nicht die Architektur unmittelbar erzählt, das bleibt tot und ist des Anschauens kaum wert.
Die Renaissance, die so vielen Städten im Reich bürgerlichen Charakter verliehen hat, ist an Berlin dann spurlos fast vorübergegangen. Außer einigen Grabdenkmalen und Portalen ist nichts geblieben als der alte Teil des Kurfürstenschlosses an der Spree. In der Ansiedlerstadt Berlin wuchsen zwischen 1500 und 1600 leistungsfähige Baumeister noch nicht heran, trotzdem die Stadt zu dieser Zeit auf einem Gipfel des Reichtums und der wirtschaftlichen Macht stand. Mit dem neuen repräsentativen Baumaterial, dem sächsischen Sandstein, kamen aus Sachsen auch die Renaissancebaumeister. Oder sie kamen als halbe Abenteurer noch weiter her, aus Italien zum Beispiel, Kunstelemente, die in einer fruchtbareren Kulturzone gereift waren, künstlich verpflanzend. Es wurde der Sachse Kasper Theiß herbeigerufen, um die kurfürstliche Zwingburg gefällig auszubauen, es wurde mit großen Ehren der Italiener Graf Rocco von Lynar aufgenommen, es baute an den alten Teilen des Schlosses der Dresdner Peter Kummer und der Italiener Peter Niuron, der dritte Sachse Balthasar Benzelt und der dritte Italiener Giovanni Battista Sala. Jeder brachte etwas Neues und setzte das Begonnene fort, wie er mochte und konnte; und ist dadurch auch ein leidlich malerisches Nebeneinander entstanden, so kann doch der alten Schloßarchitektur gegenüber nicht im geringsten die Rede sein von einer besonderen berlinischen Renaissancekunst. Weder der Fürst noch die Adligen und Bürger waren zu dieser Zeit schon reif dafür, klar wollende Bauherren zu sein. Trotz eines gewissen städtischen Wohllebens in dieser Epoche, trotz kaufmännischer Regsamkeit und weitverbreiteter Handelsbeziehungen war im Wesen von Fürst und Volk noch etwas Verbauertes. Im Adeligen war was vom Raubritter, im Kaufmann etwas Hausiererhaftes, im Ackerbürger etwas vom Squatter und im Handwerker etwas vom Gelegenheitsarbeiter; und der Fürst fühlte sich noch halb wie ein Eroberer im halb erst kultivierten Land. Was die Stadtbewohner dieser Zeit geschaffen haben: die Adelshäuser in der Nähe des Schlosses, die Bürgerwohnungen und große Teile des Schlosses – bis auf spärliche Reste ist alles verschwunden. Und dieser Umstand eben ist ein Beweis dafür, wie bedeutungslos die Werke dieser Renaissancezeit waren; denn aus einem starken Bedürfnis erwachsene, von einem hohen Kulturwillen gebildete Bauwerke verschwinden nicht ganz und gar. In dem Mangel an Pietät alten Bauwerken gegenüber ist immer auch ein Instinkt, daß diese Bauwerke der Pietät nicht würdig sind. Auch in der Renaissancezeit wurde in Berlin im wesentlichen nur für das nächste Bedürfnis gebaut, kalt, gleichgültig und lieblos.
Es kamen dann Jahrzehnte großer Not, die die Stadt dem Untergang nahebrachten. Und dieser schnelle Verfall der verhältnismäßig reichen und mächtigen Stadt ist wieder ein Beweis, wie äußerlich Reichtum, Kultur, Tradition und Stadtgefühl im beginnenden 17. Jahrhundert noch waren. Als der Dreißigjährige Krieg zu Ende ging, muß es in Berlin geradezu trostlos ausgesehen haben. Die kolonisierende Tätigkeit, worauf die Kraft der Stadt nun einmal beruhte, war durch den Krieg jahrzehntelang gehemmt worden. Bürger, die sonst Güter und Ländereien bis an die Oder bewirtschaftet hatten, die mit Korn bis Hamburg handelten und Berlin zum Marktplatz des fernsten Ostens machten, mußten in diesen unruhigen Zeiten jede weitblickende Unternehmertätigkeit aufgeben. Und damit wurde der Stadt eine Reichtumsquelle nach der andern verstopft. Nun ist eine nüchtern und zweckmäßig gebaute Kolonialstadt erträglich, wenn Tätigkeit und Bewegung sie erfüllen; ist sie aber nicht einmal mehr eine Arbeitsstadt, so wirkt sie gleich auch proletarisch. Berlin-Kölln müssen in dieser Zeit darum einen unendlich armseligen Eindruck gemacht haben. Die Doppelstadt sah nicht aus wie eine Acker- oder Handelsstadt und nicht wie eine Haupt- oder Garnisonstadt; die Kirchen erhoben sich kalt und nüchtern als Zeichen einer kalten und nüchternen Vergangenheit, die Fürstenburg lag fremd und leblos da, halb in willkürliche Renaissanceschnörkel gekleidet und halb ein Festungswerk; und die ausdruckslosen Häuser des Adels waren planlos in den Straßen um das Schloß verteilt. Die ungepflasterten, dorfartigen, von Schmutz starrenden Straßen säumten Reihen zerfallender, zur Hälfte leerer, formloser Häuser, halb bürgerlich und halb bäuerlich. Eine Doppelstadt ohne Mittelpunkt, ohne rechte Verbindung mit anderen Städten, verwahrlost und arm: so recht ein im fernen Osten vergessenes und verkommenes Vorwerk des um kirchliche Dogmen sich dreißig Jahre lang bekämpfenden Deutschtums.
Der Große Kurfürst ist nach diesen schweren Jahren der Doppelstadt ein Retter und Erneuerer geworden, wie er es der ganzen Mark wurde. Er erst hat die Kolonialstadt zur wirklichen Residenz, zur Hauptstadt und Fürstenstadt gemacht. Was dieser bedeutende Mann aber architektonisch für Berlin getan hat und was unter seiner Regierung von anderen getan worden ist, auch das wirkt im Stadtbild nicht viel natürlicher als das vorher Geschaffene. Friedrich Wilhelm hat Ordnung gemacht, hat die Stadt mit neuen Befestigungen umgeben und ganz neue Stadtteile für neue Einwanderer gebaut; er hat die Anlage der Fürstenstadt beschleunigt und in den Stadtplan zuerst ein reicheres darstellendes Element gebracht. Aber das war kluge Willkür und konnte unter den gegebenen Verhältnissen nichts anderes sein. Franzosen und Holländer wurden in die Residenz gezogen und damit französische und holländische Kulturelemente. Der Kurfürst dachte an Paris, an das Louvre; aber er dachte an das Repräsentative aus seinen beschränkten, märkischen Mitteln heraus, als überlegender Hausvater und Berliner. Auch der Akt fürstlicher Willkür, der in der Anlage der Linden, in der Gründung der Dorotheenstadt lag, ist bestimmt von berlinischer Gesinnung. Es fehlte von vornherein der große Stil, die geniale Rücksichtslosigkeit, weil das Geld fehlte, das sichere Selbstbewußtsein und die Ruhe des Genusses. Was fürstlich werden sollte, geriet garnisonmäßig; aus der via triumphalis wurde eine Paradestraße, und der Platz des Lustgartens wurde zum Exerzierplatz. Die fürstlichen Baupläne konnten den ganz großen Zug nicht haben, weil es einfach an Material, an Masse fehlte: an einer stark bevölkerten, reichen und dichtangebauten Stadt. Und die Franzosen und Holländer, die in die neuen Stadtteile kamen, hatten zudem das Beste ihres Kunstsinnes daheim gelassen; denn sie mußten vor allem um eine neue Existenz ringen. Wo sie im Sinne ihrer Heimat an der bürgerlichen Architektur mitbauten, wo sie den Bürgerhäusern eine bessere Form zu geben wußten, wo sie Grachten mit Ziehbrücken, Bollwerken und Speichern errichteten, da geschah es in einer gleichgültigen Weise, der siegreiche Kraft nicht innewohnte. In der Folge erst, aus der romantisch-germanischen Blutmischung, gingen selbständigere märkische Kulturarbeiter hervor. Eine Stadt im höheren Wortsinne wurde Berlin darum auch unter dem Großen Kurfürsten noch nicht.
K. Scheffler, Berlin. Ein Stadtschicksal. Berlin-Westend, Erich Reiß' Verlag.
Von Willy Pastor.
Ein verwickelter, aber durchaus organischer Vorgang rief die mittelalterliche Stadt ins Leben. Blicken wir, uns diesen Vorgang zu erklären, auf das Werden des Waldes. In der jungen Schonung können die Bäume noch dicht beieinander stehen, es ist Platz für sie alle da. Wachsen die Stämme aber hoch, so wird eine Auswahl unvermeidlich, und jener Vorgang stellt sich ein, den kurzsichtige Geister einen Kampf ums Dasein nennen. Man vergißt bei einer solchen Deutung, daß schließlich nicht die Bäume selbst einander das Leben schwer machen, sondern daß der Boden den einen Stamm gedeihen, den andern verkrüppeln läßt. Die Erde schuf sich den Baum als ein Organ, tote Stoffe dem Leben wieder nutzbar zu machen. Für einen ersten Abbau genügt da wohl noch seichtes Wurzelwerk. Geht es aber in tiefere Schichten, so bedarf es weitergreifender Wurzeln und kräftiger Stämme, die Stoffe zu sammeln und umzusetzen. Da muß denn das Leben der vielen kleinen Bäume hinübergleiten in das der wenigen großen.
Die Siedelungen des deutschen Urwaldes, die Einzechten und Gehöfe, waren gut für eine erste Rodung. Aber so groß ihre Zahl sein mochte: viel verdauen konnten ihre schwachen Organismen nicht, und das mußte sie über kurz oder lang von Grund aus umgestalten.
Ohne Zweifel sind in den Hütten der alten Siedelungen bereits die meisten der Stoffe nachweisbar, die auch wir heute verarbeiten. Aus Holz und Stroh bauten sie ihre Wohnungen, sie wälzten Steine zusammen für ihre Heiligtümer, und wenn aus ihren Lehmschornsteinen der Rauch ins Blaue stieg, kam er oft genug von einem Feuer, das Metalle umschmolz. Aber in wie geringen Mengen nahmen sie das alles auf, und wie unfähig waren sie, dem gerecht zu werden, was in unzähligen Wagenzügen über die Landstraßen fuhr oder mit vollen Segeln über die Ströme glitt! Die Wurzeln griffen mehr und mehr aus, da mußten auch die Stämme dicker werden. Das heißt: wo irgend günstige Verkehrsbedingungen die Lichtungen in Fühlung brachten, nahm eine größere, feste Landstadt das Leben einer Anzahl kleiner Gemeinden in sich auf.
Das Berlin des 14. Jahrhunderts mag uns zeigen, wie sich der neue Organismus, die Landstadt hinter Wall und Graben, in seiner Gliederung und Funktion darstellt.
Das Fischerdorf Altkölln hatte an Bedeutung gewonnen als Fähr- und Schifferort am Verbindungswege wichtiger slawischer Städte. Zwei weitere Sandhügel der Spree in der Nähe von Kölln (an der Nikolaikirche und am Molkenmarkt) wurden angesiedelt. »Das Berlin« nannte sich die neue Gemeinde, eine Bezeichnung, über die man viel gestritten hat, ohne sich doch einigen zu können. Die Gründung fiel – wahrscheinlich – noch in die slawische Zeit. Beim ersten großen Zusammenstoß zwischen Slawen- und Germanentum, der im Siege Heinrichs I. an der Elbe (927) entschieden ward, wurden die Gegenden unserer Stadt direkt nicht berührt. 983 folgte dann der Gegenschlag und die nochmalige Vertreibung der Deutschen, bis endlich der Sieg Albrecht des Bären 1134 den Slawen für immer das Land entriß. Das Deutschtum konnte wie in der Mark so in Berlin seinen Einzug halten und hier die Kulturarbeit beginnen, mit der es sich jenseits der Elbe so tüchtig bewährt hatte. (Vgl. Plan S. 33.)
Aus Westfalen und den Niederlanden strömen Bauern, Handwerker und Kaufleute herbei. Klöster werden errichtet, Burgen zum Schutze der östlichen Grenze, und wo den Kaufleuten ein Ort günstig am Wege zu liegen schien, sorgten sie, daß ihm eine Kirche gegeben wurde, um deren Turm sie ihre Meßbuden aufschlagen konnten. Der Ort selbst aber wurde geschützt mit Wall und Graben.
Zu diesen Orten gehörte Berlin, oder vielmehr Kölln und Berlin. Denn lange, lange dauerte es, ehe die Schwesterstädte zu einem einheitlichen Ganzen zusammenwuchsen. 1232 erhielt Kölln, 1240 Berlin die Rechte einer Stadt. 1307 erfolgte auch ein erster Zusammenschluß beider Gemeinden, indem sie sich in einer gemeinsamen Gemeinde- und Gerichtsverfassung einigten. Aber es war eine Einigung aus rein äußerlichen Gründen. Für den Fall der Not waren sie gezwungen, fest beieinander zu stehen, im übrigen blieben sie die alten eifersüchtigen Rivalen.
Beide Städte aber, um dies gleich vorweg zu nehmen, waren nach der neuen Kolonisierung durchaus deutsche Siedelungen. Den Slawen war es unbehaglich geworden auf ihrem alten Boden. Nicht genug, daß die zugewanderten Deutschen abgabenfrei blieben, während sie verpflichtet waren, weigerte man sich auch, ihnen das Bürgerrecht zu geben. Die wendische Abstammung galt als Makel, der Wende war so ehrlos wie der Jude, der Scharfrichter, Schäfer und Musikant. Diese gesellschaftliche Ächtung war ein radikales aber sehr sicheres Mittel zur Germanisierung und berechtigt uns, im Berlin des 14. Jahrhunderts die typische deutsche Stadt des früheren Mittelalters zu sehen (des früheren Mittelalters, denn die nordostdeutschen Städte gingen in der Kultur um mindestens ein Jahrhundert nach.)
Wie es in Berlin aussah in jenen Tagen? Nun, allzu anheimelnd für einen modernen Menschen gerade nicht. Wohl zog sich hinter dem breiten Doppelgraben eine solide Mauer hin von 6 Fuß Dicke und 30 Fuß Höhe, die Tore mit Türmen flankiert und von schweren Fallgittern geschützt. Aber was diese Mauer einschloß, war wenig mehr als ein großes Dorf. Nicht einmal einen gleichmäßig sicheren Boden gewährte die Umfriedung. Über den Werder zogen sich noch breite Strecken Sumpfes. An eine Pflasterung war nicht im entferntesten gedacht, und wenn die Häuser in den Straßen sich in etwas von einer Dorfansiedelung unterschieden, so war es nur durch ihre Menge. Im übrigen fand man es durchaus in der Ordnung, vor den der Straße zugewandten Giebelseiten der Häuser hohe Dunghaufen anzusammeln, Schweinekoben an die Mauer zu lehnen und die schmalen Gänge zwischen den einzelnen Häusern als Kloaken auszunutzen.
Dennoch, ganz nur umfriedetes Großdorf war es nun doch nicht mehr. Hier und da bot das Bild der Straßen und Plätze Neuerungen, die den alten Gemeinden unbekannt geblieben waren, an den Ecken der großen Verkehrswege namentlich, wo die Vornehmen sich ihre Häuser errichtet hatten. Diese Eckhäuser waren nicht wie die übrigen bloße Holzbauten unter einem Dach von Schindeln oder Stroh, sondern aus guten Steinen geschichtet und mit Ziegeln gedeckt. Auch bekamen die Einwohner ihr Licht nicht durch die alten Hornscheiben, sondern durch die bleigefaßten runden Glasstücke, die der Handel in das Land gebracht hatte.
Die ersten Steinbauten, so unbeholfen sie sich ausnehmen mochten in der gedankenlosen Übertragung der alten Holzformen auf das neue Material, sind für die Geschichte der menschlichen Arbeit von höchster Bedeutung. In ihnen setzt der junge Organismus der Landstadt eine Art Knochengerüstes an, das sich stark genug erweisen sollte, anderen Neubildungen einen Ansatzpunkt zu bieten.
Eine unscheinbare Einrichtung, die sich auf die steinernen Eckhäuser bezog, ist hier von symptomatischer Bedeutung. Nacht für Nacht standen vor ihren Giebeln kleine Leuchtpfannen mit brennendem Kien, wie sie anfangs nur vom Rathaus niederbrannten. Alle Wohnhausbesitzer waren verpflichtet, derartige Leuchtpfannen bereit zu halten und sie auf die Warnung der Sturmglocke hin auf die Straße zu stellen und zu entzünden.
Wir mögen heute lächeln über die primitive Art solcher Anlagen. Aber sie wollen verglichen werden mit den voraufgegangenen, nicht denen, die folgten. Da kündet sich denn in diesen Spuren das Leben eines Gemeinwesens an, das sich nicht damit begnügt, eine große Anzahl Menschen an einem kleinen Ort zu sammeln, sondern das sie zu einer wirklichen Einheit zusammenschweißt, das ihnen eine bestimmte Gliederung gibt und die Funktionen des Ganzen überträgt auf die einzelnen Teile. Die Teilung der Arbeit beginnt, und damit die Geschichte der Arbeit im engern Sinn des Wortes.
In der altgermanischen Hütte konnte von einer regelmäßigen Arbeit keine Rede sein. Der Germane war vor allen Dingen Krieger. Von seiner Wohnung verlangte er nicht mehr, als der Soldat von seinem Lager. So kam es, daß man, auch wo er bekannt war, gegen den Steinbau eine Abneigung hatte, da er die Bewegungsfreiheit hemmte, und daß die festen Bauten auch auf Jahrhunderte hinaus mit ihren steilen Dächern hölzernen Zelten gleichen konnten. Selbst in ihrer Einrichtung waren sie Zelte geblieben. Die Stallungen hatte man wohl vom Wohnort getrennt, dieser selbst aber mußte (bis ins 12. Jahrhundert hinein) gleichmäßig als Schlafraum, wie als Arbeits-, Speise- und Empfangsraum dienen.
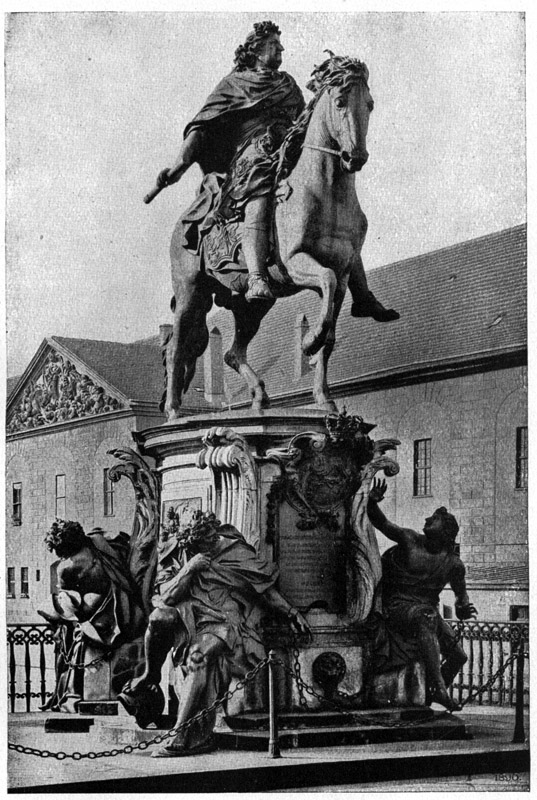
Das Denkmal des Großen Kurfürsten
Von Andreas Schlüter (1793)
Das änderte sich, als die Häuser enger mit dem Boden und untereinander zusammenwuchsen. Es war weniger Kraft für den Krieg nötig, es wurde mehr frei für die Arbeit im Hause. Langsam fing sie an, sich einen Körper anzusetzen in der feineren Gliederung, die sie allmählich dem Hause schuf.
Die Küche war der erste Raum, den man selbständig machte durch eigene Umwandung. Der Arbeitsraum folgte. Wohl ließ sich nicht daran denken, jeder einzelnen Art der Arbeit ihre eigene Werkstatt einzuräumen, doch hier wußte man sich damit zu behelfen, daß man auf die verschiedenen Häuser verteilte, was in den einzelnen Wohnungen nicht zu vereinen war. In einem Haus wurde nur Leder verarbeitet, im anderen nur Tuch, an einer dritten Stelle das Metall für die Waffen oder der Ton für das Geschirr.
Das war in einer Zeit, in der die äußere Gefahr so weit gehoben war, daß die Verteidigung der Städte und Dörfer einem Bruchteil der männlichen Bevölkerung überlassen werden konnte. Der Krieg war zu einem Handwerk geworden. Was lag den Handwerkern da näher, als sich zu Organisationen ähnlich denen der Krieger zu vereinen?
Mit diesen Organisationen, den Zünften (Innungen, Gilden, Gewerken), die sich immer unentbehrlicher und angesehener zu machen wußten, nimmt die Geschichte der deutschen Arbeit ihren Anfang.
Die ersten Zünfte beschäftigen sich noch lediglich mit den Aufgaben der Hausarbeit (Nahrung und Kleidung). Der Hausfleiß mit seinen minder wichtigen Produkten blieb noch auf lange Zeit hinaus Sache der Hörigen und Leibeigenen. Aber das Beispiel, sich selbständig zu machen, war ihnen gegeben, und je mehr das Leben in den festen Städten sich zusammenzog, um so näher rückte der Zeitpunkt, an dem Gewerbe nach Gewerbe sich als geschlossene Zunft loslöste – um als solche überzugehen in den gegliederten Organismus der arbeitenden Stadt.
Wollen wir die ungeheueren Fortschritte erlernen, die die Neuerung mit sich brachte, so müssen wir wieder daran erinnern, daß zum Vergleiche nicht die späteren, sondern früheren Zustände heranzuziehen sind. Die alten Zunftgesetze, auf moderne Verhältnisse übertragen, würden den Tod des Gewerbefleißes bedeuten: in jenen Tagen waren sie dessen Lebensbedingung. Das Handwerk wurde scharf abgegrenzt, die für die Produktion günstigsten Bedingungen wurden festgestellt, man lernte übersehen, was zu leisten war und wie dies geschehen mußte. Das eigenste Interesse der Handwerke, die sich als junge Organisationen erst zu rechtfertigen hatten, zwang ihnen eine strenge Standesehre auf. Es war eine Lebensfrage für sie, jedes unlautere Element unbarmherzig auszuschließen und in der strengen Unterordnung der Gesellen unter die Meister, der Lehrlinge unter die Gesellen Grade zu schaffen, die denen des adligen Waffenhandwerkes an Schärfe nicht nachstanden.
In Kölln-Berlin sehen wir im 14. Jahrhundert vier Zünfte als geschlossene Masse zwischen den herrschenden Adel und die ehrlosen Hörigen eingeschoben, die sogenannten »Viergewerke« der Fleischer oder Knochenhauer, Wollenweber oder Tuchmacher, der Schuster und der Bäcker. Kölln und Berlin hatten jedes ihre eigenen Zünfte, aber zwischen ihnen bestand die enge Gemeinschaft, die über das gesamte Reich hin die Zünfte sich vereinigen ließ, eine Gemeinschaft, von der die Gesellen zu erzählen wußten, wenn sie vor der Meisterprüfung auf ihrer Wanderfahrt in den Zunftherbergen vorsprachen. Jede Zunft hatte das Recht der Vertretung beim städtischen Rat, und diese Vertreter, die »Sechszehnmänner«, umgaben als »äußerer Rat« die aus 18 Adligen bestehende engere städtische Regierung.
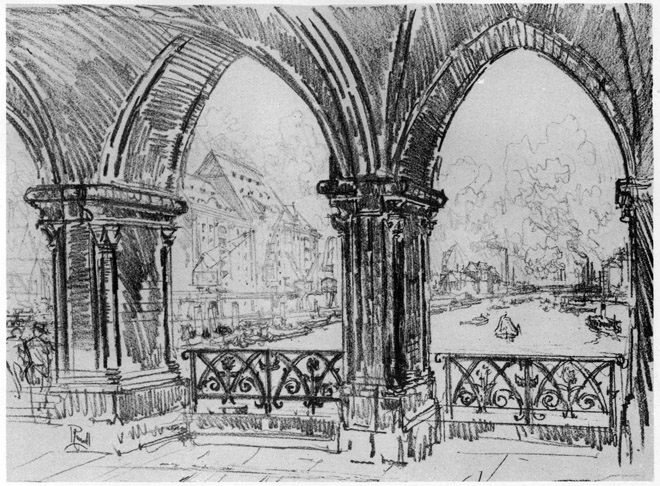
Warschauer Brücke in Berlin
nach einer Kohlezeichnung von Jos. Penell
Es kann uns nicht überraschen, wenn wir die Umwälzungen, die von den germanischen Lichtungen hinüberleiten zu den Städten hinter Wall und Graben, von Erscheinungen gewaltsamster Art begleitet sehen. Die Gräuel des Faustrechts, mit denen die Zünfte sich ihre ersten Privilegien erzwingen mußten, mögen Berlin erspart geblieben sein. Kolonisten ließen sich nicht in unbekannte Gebiete locken, wurden ihnen nicht gewisse Rechte verbrieft. Wir können annehmen (bestimmte Nachrichten fehlen auch hier), daß die ersten Zünfte in Berlin so alt sind wie die ersten deutschen Kolonien an der Spree.
Im übrigen jedoch geben uns die Urkunden Berlins so gut wie die aller übrigen deutschen Städte ein recht vollständiges Verzeichnis aller der für das Mittelalter bezeichnenden Schrecken, und man braucht nur unser ältestes Stadtbuch durchzulesen, um die mittelalterliche Rechtspflege in ihrer ganzen grausamen Härte kennen zu lernen. In den 42 Jahren von 1399-1441 fanden in den jugendlichen Städten, die doch kaum 6000 Einwohner zählten, nicht weniger als 104 Hinrichtungen statt. Und Hinrichtungen für welche geringfügigen Vergehungen oft! Da wird ein Knabe wegen eines Heringsdiebstahls verurteilt zum Strang, eine Frau lebendig begraben wegen Hausfriedensbruches, ein Mann gerädert, weil er mit Brandstiftung gedroht hatte.
Die gesammelte Kraft der Städte bedurfte zu ihrer Leitung und Nutzbarmachung anderer Maßregeln als das über weite Landstrecken hin sich verteilende Leben der alten Siedelungen. Wenn auf den Sandhügeln, die bisher nur zwei kümmerliche Fischerdörfer getragen hatten, sich 6000 Menschen zusammenfanden, so mußten zum Schutze des Eigentums der einzelnen grausamere Gesetze erlassen werden. Das Scharfrichtergewerbe bildete sich nach und nach zu einer fast künstlerischen Feinheit heraus. Der Mann, der die armen Sünder auf seinem Karren durch die Straßen fuhr, an den größeren Plätzen Halt machte, um sein Opfer mit glühenden Zangen in die Brust zu zwicken, der den Scheiterhaufen am Neuen Markt schichtete oder die eiserne Küpe zum Braten eines Brandstifters herrichtete, der Mann war so ohne weiteres nicht zu ersetzen. Er war ehrlos, und niemand mochte mit ihm reden. Aber angesehen und gut besoldet war er darum doch.
Sollen wir empört sein über die Roheit einer Gemeinde, die einer Hinrichtung zulief wie einem Schauspiele? Die Entrüstung liegt ja nahe, aber sie scheint mir nicht berechtigt. Weit eher scheint es mir bewundernswert, wie ein Volk in der kurzen Spanne Zeit von ein bis zwei Jahrhunderten eine solche Umgestaltung möglich machen konnte, wie Deutschland sie damals erlebte. Es war nicht bloße Neugier und Gefühlsroheit, was die Menschen dem Richtplatz zuführte: ihr Instinkt wußte nur zu gut, daß sie solche Grausamkeiten nötig hatten, daß ohne sie niemals die Massen, die den Städten hinter Wall und Graben zuströmten, in lebendiges Fleisch und Blut umzusetzen waren.
Ein Blick auf das landschaftliche Berlin des 14. Jahrhunderts, auf das Werk, dessen die in der Stadt aufgespeicherte Kraft fähig war, und wir sind versöhnt mit allen Unmenschlichkeiten. Auf Meilen hinaus durchziehen den Sumpf und Bruch schon die Wiesen und Felder der Stadt, und immer neue Wiesen und Felder werden dem Boden abgerungen. Es sind kleine Herdenkarawanen, die die Hirten nun zur Weide treiben; die Ernte, die sie im Herbst durch die Tore schaffen, füllt große Speicher. Und doch verlangt das unheimliche Tier hinter Wall und Graben noch immer größere Mengen und größere Arbeit.
W. Pastor. Berlin wie es war und wurde.
Von Willibald Alexis.
Das alte Rathaus zwischen Berlin und Kölln ragte mit seinem bunt verzierten Oberbau und den vielen verzierten Türmchen hoch über die andern Häuser hinaus. Die Türmchen, nicht zur Verteidigung, es war nur Spielwerk, schauten nach allen Stadtteilen; der mächtige, vielfach ausgezackte Giebel aber war dem Spreeflusse zugewandt. Das Holzwerk war nicht überputzt; aber, künstlich ausgeschnitzt und rötlich gefärbt, glänzte es schon von fern, und das Auge sah die ganze Gliederung des wunderlichen Baues. Wie schöne Mohren und Türken und allerhand Ungeheuer zeigten die kunstvoll geschnitzten Balkenknöpfe, und wie grimmig gähnten die Drachenköpfe von den Wettertraufen! Und überall, wo eine Mauerwand sich bloß gab, war sie mit bunten Malereien überdeckt. Die Helden und Weisen aller Zeiten, auch die Königinnen und Schönen der ritterlichen Höfe waren hier zu sehen; alle, Griechen, Römer und Hebräer, in der buntesten, scheckigsten Modetracht des abgelaufenen Jahrhunderts. Da ritt der heilige Georg und tötete den Lindwurm, der heilige Florian goß Wasser über die Feuersbrunst, und der heilige Martin teilte mit dem Schwert seinen Mantel mit dem Armen, der ihn anbettelte. Aber unter den Türen und an den Ecken noch einmal stand, in Holz gehauen, der große Christophel; denn der das Jesuskindlein, das ist die Welt, trägt, des Schultern sind wohl stark genug, um ein Haus zu tragen. An allen Ecken hingen die Wappen von Berlin und Kölln, ihrer Geschlechter und der verbündeten Städte. Der kaiserliche Doppeladler breitete seine Flügel über dem Haupttor aus, der hohenzollernsche hatte nur ein bescheidenes Plätzchen daneben. Am lustigsten sahen die bunten Fahnen aus, so von den Giebeln und Türmchen herab im Spiel der Winde flatterten. Die Würde der Obrigkeit verschmähte es nicht, auch durch ein heiteres Zeichen ihre Gegenwart den Bürgern darzutun. Da wehten die Fähnlein der Städte Alt- und Neubrandenburg und Frankfurt, von Prenzlau, Bernau, von Rathenow und Mittenwalde, und noch viele andere, und auch die Fahne des Hansabundes flaggte hoch auf der Firste; aber das kurfürstliche Banner hing sehr klein neben einem Schornstein.
Also sah das Rathaus auf der langen Brücke dazumal aus, davon jetzt keine Spur mehr ist; man weiß nicht einmal den Fleck genau, wo es gestanden.
W. Alexis, Der Roland von Berlin.
Von Max Osborn. Dieser Aufsatz ist dem im Verlag von E. A. Seemann in Leipzig erschienenen Werk: Berühmte Kunststätten, Bd. 43: Berlin von Max Osborn entnommen.
Andreas Schlüter! Ein Klang, vor dem wir uns bewundernd beugen und voll Dankbarkeit. Der uns Geltung verschafft hat im großen Orchester der Weltkunst, und der als eine Mahnung, fast als eine Strafpredigt, hereindröhnt in die Zerstörungslust und Afterkunst unserer Tage. Was sich für uns in diesem Namen birgt, ist das reichste und höchste Kunstglück, das der neuen deutschen Hauptstadt in den Sandfeldern des Nordens beschieden war. Denken wir ihn uns aus der Geschichte Berlins fort, – so bleibt nicht viel mehr übrig, was die Stadt in die Reihe der großen Kunstmetropolen dieses Planeten emporhebt. Schlüter steht an der Spitze der stolzen Reihe von Künstlern und Dichtern, in deren Werken und Wirken der preußisch-märkische Geist aus der Gebundenheit der Pflicht und des Wollens unmittelbar in die höheren Sphären freien Schaffens empordringt. In seinem Gefolge treten sie alle auf, die Knobelsdorff, Schadow, Rauch, Schinkel, Chodowiecki, Menzel, die Kleist, Alexis und Fontane. Er ist ihr Ahnherr und Stammvater, der fast aus dem Nichts sich die Möglichkeiten schuf, das sprödeste Material ohne wesensfremde Beimischungen zu ästhetischen Gebilden zu formen, deren es kaum fähig zu sein schien. Und er übertrifft sie alle in der Kraft und Großartigkeit, mit der er dies bewundernswerte Wagnis unternahm, und in dem lachenden Glanz und der souveränen Kühnheit, mit denen er es durchführte. Die Selbstzucht und Energie, die unerhörte Fähigkeit, alle angeborene Tatkraft aufs äußerste zu konzentrieren und ins fast Unmögliche zu steigern, das eiserne Zielbewußtsein und das trotzige Vertrauen auf die eigene Zähigkeit, der rücksichtslose Herrscherwille, der sich durch kein Fehlschlagen im einzelnen beirren und durch kein Blendwerk zu gefährlicher Überhast verleiten läßt, die unerschütterliche Entschlossenheit, von dem materiell wie ideell Eroberten nie mehr etwas herauszugeben, – alle diese Züge, die das Wesen der ungeheuren Erfolge des Preußentums in den letzten Jahrhunderten bestimmen, scheinen Leben und Gestalt gewonnen zu haben in Andreas Schlüters Kunstgebilden.
Schlüter wurde am 20. Mai 1664 als Sohn des Bildhauers Gerhard Schlüter in Hamburg geboren. Als Kind kam er mit dem Vater nach Danzig, dessen prächtige Bürgerhäuser dem Knaben und Jüngling entscheidende Anregungen fürs Leben vermittelten. Hier lernte er früh die innige Verbindung von Architektur und dekorativer Plastik kennen, lernte er, wie die Renaissancebaumeister der reichen Handelsstadt mit untrüglicher Sicherheit aus der Zweckmäßigkeit ihrer Häuser charakteristischen Schmuck entwickelten. Ohne Zweifel aber ist es die Plastik und nicht die Architektur, von der Schlüter seinen Ausgang nimmt. David Sapovius in Danzig, ein Bildhauer, gibt ihm den ersten Unterricht. Der Landesherr seiner zweiten Heimat Danzig, der Polenkönig Johann Sobieski, nimmt ihn in seine Dienste; er verwendet ihn bei seinen Warschauer Schloßbauten. In einer späteren Eingabe Schlüters wird ausdrücklich hervorgehoben, daß Kurfürst Friedrich III. ihn mit einem Gehalt von 1200 Talern – nicht wenig, da sein Vorgänger Nering nur 400 erhielt – vom polnischen Königslager als Hofbildhauer nach Berlin berief, wo er zugleich bei der Neueinrichtung der Akademie mitwirken sollte. Übereinstimmend erzählen die historischen Quellen, daß des Neuangekommenen erste Arbeiten plastische Details an Nerings Neubau der Langen Brücke gewesen sind, Reliefs mit Flußgottheiten aus Sandstein, die von der Feuchtigkeit bald zerstört wurden und längst zugrunde gegangen sind. Wahrscheinlich war das Jahr 1694, da jene offizielle Ernennung erfolgte, auch das seiner Ankunft in Berlin.

Masken sterbender Krieger aus dem Hof des Zeughauses von Schlüter. Nach den Radierungen von Bernhard Rode.
Skulpturen in Potsdam, hauptsächlich an der Decke des Marmorsaales, scheinen gefolgt zu sein. Dann aber beginnt Schlüters Tätigkeit für das Zeughaus. Der dekorative Schmuck, den er der Fassade zukommen ließ, ist hohen Ruhmes wert. Doch erst die Masken sterbender Krieger im Innenhof bedeuten den Höhepunkt seiner Arbeiten für das Arsenal. Es ist kein zu hohes Wort, das gesprochen wurde, wenn man den Geist der Laokoongruppe in diesen Köpfen wieder auferstehen sah. Was Lessing dem unbekannten antiken Meister nachrühmt: daß er es verstanden habe, das körperliche Leiden zu einem innerlichen zu stempeln, den Schmerz des Leibes zugleich als Schmerz der Seele auszudrücken und dadurch zu adeln, die ganze Furchtbarkeit der Qual darzustellen und sie doch mit künstlerischer Weisheit zu mildern, hat auch Schlüter hier erreicht. Er modellierte eine Reihe von Köpfen, bärtige Männer- und zarte Jünglingsgesichter, und mit unerschöpflicher Erfindungskraft spiegelte er in ihren Zügen alles Grauen, alle Schrecken, allen Grimm und Haß, alle Wut und Gier des Krieges wider. Draußen an der Front erscholl die Siegesfanfare, hier bannt ein Künstler von unerschrockenem Wahrheitsmut auch das Entsetzen der Schlacht in plastische Gebilde. Welch ein hoher Sinn spricht aus dem Entschluß, in einem Waffen- und Kriegspalast auch der Furchtbarkeit des Krieges das Wort zu geben; es ist, als wenn Schlüters Künstlertum sich dagegen gesträubt hätte, die Erinnerung an Blut und Wunden durch das laute Pathos der Siegesallegorie schlechthin übertönen zu lassen, und es macht der Gesinnung seines kurfürstlichen Auftraggebers alle Ehre, daß er ihn gewähren ließ. In dieser Anordnung des Zeughausschmuckes spricht noch vernehmlich der männliche Geist der Frührenaissance, der keine Weichherzigkeit und keinen leeren Schwulst kennt, der auch in den drohenden Ernst und die Schrecknisse des Lebens ohne Furcht hinabsteigt. Nicht nur in Berlin, auch in andern Kunststätten wird man vergebens nach Werken suchen, die tiefer als diese Masken an die letzten Probleme der Plastik rühren: in der Nachbildung des Körperhaften greifbare Symbole für geistiges, innerlichstes Erleben zu schaffen.
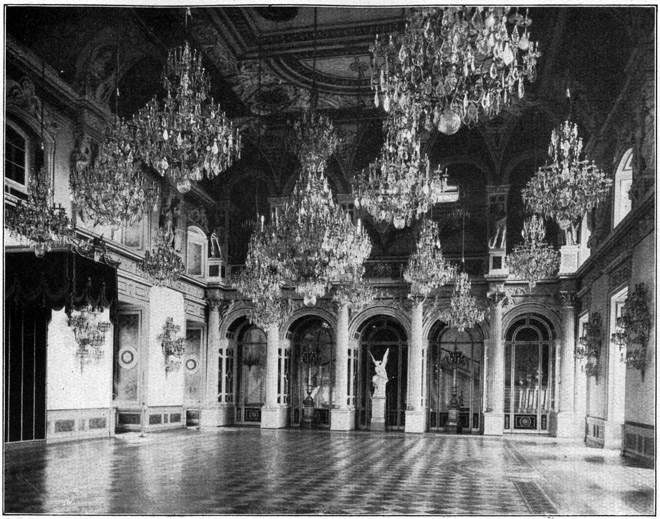
Der Weiße Saal im Berliner Schloß
nach Lichtbild
Zu gleicher Zeit gehen andere plastische Arbeiten nebenher. Im Jahre 1701 entstanden die Arbeiten für das Erbbegräbnis des Hofgoldschmieds Daniel Männlich in der Nikolaikirche, wo Schlüter über den aufgerollten Verdachungen eines Grabtores, neben einer Urne mit den fein behandelten Reliefbildnissen Männlichs und seiner Gattin, rechts einen weinenden Genius, links die Figur des Todes anbrachte, der ein schreiendes Kind grausam erfaßt. Schlüter zeigt sich dabei weit mehr als in den Masken des Zeughauses vom Geiste des Barock erfaßt, der ihm auch beim Entwurf der Kanzel für die Marienkirche (1703) die Hand führte.
Wichtiger war das große Werk, das den Meister von 1697 bis 1703 beschäftigt: das Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten auf der Langen Brücke. Schon vorher hatte Schlüter ein Standbild Friedrichs III. herzustellen, bei dem er mit unvergleichlichem Takt die Figur des Herrschers zu monumentaler Darstellung benutzte; es ist die Statue, die sich heute in Königsberg befindet. Nun galt es, den Plan auszuführen, den der Nachfolger Friedrich Wilhelms von vornherein verfolgte. Wir wissen ja, daß schon auf einer Denkmünze von 1692 der in Wirklichkeit eben begonnene Brückenbau das Reiterstandbild trägt.
Die Auffassung des Großen Kurfürsten, der Schlüter hier Gestalt lieh, war durchaus nach dem Geschmack der Zeit: der Dargestellte erhält ein ideales römisches Cäsarenkostüm, das genug der Glieder freiläßt, um die Formenfreude des Bildhauers nicht zu sehr zu begrenzen, doch er erhält auch eine moderne Allongeperücke, die den Helden aus zeitloser Sphäre wieder in die Gegenwart zurückversetzt. Der Kontrast zwischen diesen Bekleidungsmotiven aber wird gar nicht empfunden, weil die souveräne Kunst Schlüters solche Nebendinge der Hauptaufgabe völlig unterordnete, so daß sie verschwinden. Diese Aufgabe war: die gewaltige Persönlichkeit eines Herrschers zu zeigen, dessen imposante äußere Erscheinung der Energie seines Willens und der Größe seiner Taten entspricht. Und wie in der Figur des Reiters alles diesem einen Zweck zustrebt, so auch in seiner Verbindung mit dem mächtigen Pferde, das ihn trägt: das unaufhaltsam Vorwärtsstürmende des Geistes, der aus den prachtvollen Zügen leuchtet, wird begleitet durch das Schreiten des wundervoll modellierten, kräftigen Tieres. Und beide, Pferd und Reiter, werden von einem groß gedachten Kontur umschrieben, der dem Denkmal auf seinem unvergleichlich schönen Platze von allen Seiten eine frei sichtbare, hinreißende, fast drohende Silhouette gibt, – eine Erscheinung, die der Bedingtheit der Zeit entrückt ist, und die doch tief in historischer Wahrheit wurzelt.
Die Kunstgeschichte der Völker besitzt nur wenige Seitenstücke zu diesem Berliner Reiterbilde. Man muß schon an Verrochios Colleoni in Venedig denken oder an Donatellos Gattamelata in Padua, um würdige Nebenbuhler zu finden. Und gesteigert wird der Eindruck der Hauptgruppe nun noch durch die geniale Erfindung des Unterbaus. Oben ist alles Sicherheit, Ruhe, majestätische Unerschütterlichkeit; das Postament ist bestimmt durch bewegte Formen und geschwungene Linien. Der Reiter ist die Verkörperung der Willenskraft, des Herrschertums, des Sieges; die vier Eckfiguren der gefesselten Sklaven, die gebeugt, zusammengekauert, ängstlich und furchtsam nach oben blickend, absichtlich unruhige Umrisse zeigen, lassen im Kontrast jenen Eindruck doppelt wirksam werden. Das Motiv der gefesselten Sklaven, ein vielfach gebrauchtes Barockthema, dem wir ja auch im Berlin der Renaissance wiederholt begegnen, ist nie von so sinnvollem Leben erfüllt worden wie hier. Man hat früher viel darüber nachgegrübelt, was die Gestalten wohl »bedeuten« sollen, hat in ihnen die besiegten Feinde des Kurfürsten oder auch, philosophischer, die gebändigten Leidenschaften erblicken wollen. Es bedarf nicht dieser spitzfindigen Auslegungen; was Schlüter hier trieb, war lediglich der bildhauerische Gedanke, Ruhe gegen Bewegtheit, das Bild der Kraft gegen das der Ohnmacht zu stellen und aus dem Gegensatz für die Hauptaufgabe eine Steigerung des Ausdrucks zu gewinnen, die so völlig in die Anlage des Ganzen verwachsen ist, daß der Betrachter die Wirkung fühlt, ohne sich über ihre Mittel klar zu werden.
Schon früher wurde auf den Meister des Erzgusses hingewiesen, dem Schlüter die vollendete technische Ausführung seines Werkes verdankt. Was Johann Jacobi bei dem Reiterdenkmal und den Sklavengestalten leistete, wird um so erstaunlicher, wenn man bedenkt, daß die Kunst der Gießerei für solche Aufgaben damals etwas völlig Fremdes in der Mark bedeutete. Wie sehr ihr plötzlicher Aufschwung allein mit Jacobis Persönlichkeit verknüpft war, erkennen wir an der Tatsache, daß er nach seinem Tode wieder vollkommen verschwindet, und daß ein Jahrhundert später, als Schadow seine Quadriga für das Brandenburger Tor schuf, die verloren gegangene Technik allen Bemühungen zum Trotz nicht wiedergewonnen werden konnte.
Als Bildhauer war Schlüter nach Berlin berufen worden, aber bald nach seiner Ankunft ward er auch als Architekt in Anspruch genommen. Es war im Jahre 1695, als der Kurfürst den Entschluß faßte, bei dem nahen Dorfe Lietzow für seine Gattin Sophie Charlotte, der der kleine Ort die Erhebung zu dem würdevolleren Namen Charlottenburg verdankte, inmitten eines prächtigen Parkes an der Spree ein Schloß zu errichten. Den Plan des Schloßgebäudes selbst hat man lange bedingungslos Schlüter zugeschrieben. Heute ist die Forschung mehr geneigt, den Kern des Schloßbaues noch für Nering in Anspruch zu nehmen. Bei der Innenausstattung aber ist Schlüters glänzende dekorative Kunst ohne Zweifel bereits stark beteiligt. – Im Jahre 1694 begann dann die Arbeit am Berliner Schlosse.
Verschwunden ist heute Schlüters Postgebäude an der Ecke der Burg- und Königstraße, an der Stelle, wo bis zum Jahre 1701 das Renaissancehaus des Bürgermeisters Lewin Schardius stand. Die Art, wie Schlüter die architektonische Aufgabe dieses Eckbaues löste, zeigt ihn als einen Meister in der Kunst, jeder Situation gerecht zu werden. Wie fein wußte er zwischen den Forderungen eines Schlosses und eines Bauwerks ganz anderer Art zu unterscheiden! Der palaisartige Charakter, den die Post dennoch erhielt, war keine Attrappe, sondern der Ausdruck für die schön geschmückten Säle des Inneren, in denen sogar das gräflich Wartenbergsche Paar gelegentlich Festlichkeiten veranstaltete, und aus denen man beim Abbruch des Hauses wenigstens einige Details ins Kunstgewerbemuseum und ins Märkische Museum gerettet hat.

Das Charlottenburger Schloß von der Parkseite.
Ein zweites kleineres Gebäude, das Schlüter schuf, hat ein besseres Schicksal gehabt. Es war des Meisters letztes Werk in Berlin: das Gartenhaus des Geheimrats und Staatsministers Ernst Bogislav v. Kameke in der Dorotheenstraße (Nr. 27), das er im Jahre 1712 erbaute, das Haus, das unter Friedrich II. eine Zeitlang von dem patriotischen Großkaufmann Gotzkowski bewohnt wurde, und das 1779 in den Besitz der Freimaurerloge Royal York de l'Amitié gelangte, der es noch heute gehört. Mitten aus den hohen modernen Häusern der Dorotheenstraße erhebt es sich als eins der reizvollsten Denkmäler Alt-Berlins.
Es ist wiederum ein charakteristisches Beispiel für Schlüters Vielseitigkeit und Ideenreichtum. Fast kein Zug erinnert an alles andere, was sonst von seinem Wirken als Baumeister in Berlin erzählt. Hier galt es, ein Landhaus zu schaffen, ein Garten- und Lusthaus; denn das Gelände lag weit vom Mittelpunkt der Stadt entfernt, und zwischen anderen Gärten dehnte sich sein weiter Park bis zur Spree hinab. Bei solchem Zweck durfte der Meister nicht nur von der Wucht des Schloßbaus, sondern auch von der würdevollen Eleganz des Postgebäudes absehen. So schuf er eine kleine Villa, die schon vom Pomp des Barock auf die Grazie des Rokoko vordeutete. Durchaus malerisch plastisch, nicht streng architektonisch in der ganzen Anlage. Ein einstöckiges Gebäude mit niedrigem Attikageschoß, aus dem ein zweistöckiger Mittelbau herauswächst, so daß ein zackiger Umriß von launischer Willkür sich ergibt. Ja, die Straßenfront erhielt eine geschweifte Abschlußlinie und jene weich-beweglichen Formen, die viel später an der Königlichen Bibliothek wieder auftauchten. Mit seinem zierlichen dekorativen Schmuck, mit den besonders schön erfundenen und arrangierten Figuren über dem Dachgesims stellt das Bauwerk einen köstlichen künstlerischen Einfall dar. Treten wir aber ein, so erkennen wir, daß Schlüter auch hier das große Hauptgesetz der Baukunst wohl beachtete: von innen nach außen (nicht von außen nach innen) zu bauen, die Fassade aus dem Grundriß zu entwickeln und nicht umgekehrt. Der zweistöckige Mittelbau enthüllt sich nun als das Gewand eines großen und hohen Festsaales, der in der Abmessung und Abstimmung der Raumverhältnisse ein Meisterstück für sich bildet.
Als Schlüter dies schmucke Bauwerk schuf, war seine große Zeit schon vorüber, seine höchste Kraft gebrochen. In unablässiger Arbeit hatte er im Anfang des Jahrhunderts den Schloßbau zu Ende geführt. Neue, große Pläne tauchten auf, die weitausschauend in die Zukunft blickten. Wie weit er freilich an dem Projekt eines großen Forums für das königliche Berlin Anteil hat, den ein Stich von Broebes ihm zuschreibt, ist nicht aufgeklärt. Doch es ist Schlütersche Phantasie, die hier spricht. Ein Blick auf den Schloßplatz von oben her bietet sich uns, auf einen neuen Schloßplatz, wie er nie zur Wahrheit geworden ist. Das Viereck erscheint hier mit monumentalen Gebäuden umzogen, der Platz selbst, streng flächig gehalten, nur in vier geometrische Rasenfelder geteilt, von rechtwinklig sich schneidenden Wegen durchkreuzt. An der Spree ist das Ufer mit Balustraden geschmückt. Zur Langen Brücke führt ein im Halbkreis hinausgebauter Quai. Dem Schlosse gegenüber erhebt sich eine prachtvolle Marstallfassade, die Ihne zwei Jahrhunderte später für seinen Neubau verwertete. Den Hintergrund aber bildet als Abschluß eine neue Domkirche. Sie ist von zwei Seitengebäuden eingeschlossen, die von ferne an die Prokurazien des Markusplatzes erinnern. Und der Dom selbst trägt, in Form eines griechischen Kreuzes, über einem Mittelquadrat eine stolze Kuppel, die an Michelangelos Peterskuppel mahnt, und die von vier kleineren Genossen begleitet ist. Korinthische Säulen schmücken das Portal, das gleichfalls unmittelbar an römische Vorbilder denken läßt. Weithin gleitet der Blick über die neue Stadt. Und nördlich von dem Prunkdom ragt die schlanke Nadel eines neuen Münzturms in die Höhe – des Münzturms, der Schlüters Sturz herbeiführen sollte.
Schon das Renaissanceschloß der früheren Periode wies am Westflügel, der späteren Schloßfreiheit gegenüber, einen Turmbau auf. Wir sehen ihn auf einer Stridbeckschen Zeichnung, wo er als die »Wasserkunst« bezeichnet wird, d. h. als ein Bassin, das die Wasserversorgung des Schlosses, später auch die Springbrunnen des Lustgartens zu regulieren hat. Dann wechselte die Bestimmung des Turmbaus, und er ward für die Zwecke der Münze in Anspruch genommen, die ihm fortan den Namen gab. Der König wünschte auch hier eine monumentale Umgestaltung. Ein kostbares Glockenspiel, das er in Holland gekauft hatte (und das später in die Parochialkirche kam), sollte hier untergebracht werden, der Turm selbst zu gewaltiger Höhe emporsteigen. Schlüter entwarf einen Renaissanceaufbau von mehreren, sich verjüngenden Stockwerken, dann mit offenen Galerien und kunstvollem Turmdach. Im Jahre 1702, mitten in des Meisters arbeitsreichster Epoche, wird der Bau in Angriff genommen. Aber bald zeigten sich Risse und Senkungen, die auf Mängel in der Fundamentierung wiesen. Zwei Jahre später, da alle neuen Versuche, dem Grundfehler abzuhelfen, fruchtlos geblieben, ward aus der lange verheimlichten Angelegenheit ein offener Skandal. Hilfskonstruktionen müssen angebracht werden, die enormes Geld verschlingen. Alles umsonst. Die Lage wird immer bedenklicher, der Turm neigt sich zusehends, die Erregung und Verwirrung in Berlin steigt, bis man zu dem einzigen Auskunftsmittel greift, den ganzen Bau abzutragen. Doch ehe es so weit kam, hatte Schlüter ein wahres Martyrium zu bestehen. Es gelang, wie schon erwähnt wurde, seinen Neidern, den König weit über Gebühr mit Mißtrauen und Unwillen gegen ihn zu erfüllen. Eine Sachverständigenkommission ward zur Prüfung der Angelegenheit eingesetzt, der neben Eosander und Martin Grünberg der Mathematikprofessor Sturm von der Universität in Frankfurt a. O. angehörte. Wir besitzen das Protokoll der Unterredung, die diese Kommission mit Schlüter geführt hat. Es ist eine Inquisition und Folterung zugleich, die mit ihm vorgenommen ward. Daß er tatsächlich Fehler bei der Konstruktion begangen, vor allem es unterlassen hatte, Tiefbohrungen anzustellen, die eine bessere Kenntnis des schwierigen Baugrundes ergeben hätten, und daß darum der Mißerfolg zum Teil auf sein Konto zu setzen war, steht freilich fest. Doch es empört zu sehen, welcher Pein der Mann ausgesetzt wurde, dem der König und die Berliner so Unendliches zu danken hatten. Es empört nicht minder, im » Theatrum Europaeum«, der angesehensten wissenschaftlichen Zeitschrift jener Jahre, den anonymen Artikel über die Affäre zu lesen, der zweifellos von Eosander herstammt, und in dem mit pharisäischem Augenaufschlag betont wird, daß Schlüter es nur »Seiner Majestät sonderbahrer clémence und Gütigkeit« zuzuschreiben habe, wenn er nicht schwer bestraft worden sei. Eine ungeheure Intrige muß damals den Ruf des Meisters untergraben haben; daß die Kunstgeschichte der Vergangenheit reich an Beispielen ähnlicher Vorfälle war, ward geflissentlich übersehen.
Schlüter selbst hat diesen Schlag nie mehr verwunden. In einem Briefe, den man nicht ohne Erschütterung lesen kann, legte er 1706 die Leitung des Schloßbaus nieder, die dann im folgenden Jahre Eosander übernahm. Er hatte die Achtung des Hofes und damit auch der Bevölkerung verloren. Doch man darf es Friedrich I. immerhin als Verdienst anrechnen, daß er den Künstler nicht gänzlich fallen ließ. Wenigstens als Hofbildhauer behielt er ihn weiter im Dienst. In diesem Amt schuf Schlüter noch eine Reihe von dekorativen Figuren für die Balustrade des Schlosses, Gestalten des Merkur, der Juno, des Bacchus, der Leda, der Flora, der Venus, die jetzt verschwunden sind. Er entwarf noch für das Söhnchen des Kronprinzen, das im zartesten Kindesalter gestorben war, das Grabdenkmal für die Gruft im Dom (1708): die Gestalt des kleinen Prinzen, die auf einem Kissen sitzend den Sarg krönte, lieferte wahrscheinlich noch den Entwurf für den Sarkophag des Königs selbst, wie er vorher an dem der Königin mitgearbeitet hatte. Aber der Glanz und die Freudigkeit waren von seinem Leben gewichen. Wie unerschüttert gleichwohl seine schöpferische Kraft blieb, zeigt das Haus der Loge Royal York von 1712. Doch im Jahre darauf, 1713, starb Friedrich, und sein Sohn, in jedem Betracht der lebendigste Gegensatz zu seinem Vater, strich unmittelbar nach dem Regierungsantritt fast den ganzen Kunstetat des Hofes. Nun gab es vollends für Schlüter in Berlin keine Arbeit mehr, und als einen Rettungsanker ergriff er die Aufforderung, die ihm aus der Ferne kam: Peter der Große berief den weltberühmt Gewordenen an seinen Hof. In Petersburg erwarteten ihn neue Pläne und große Entwürfe. Aber nicht lange überwand seine zerrüttete Gesundheit die Strapazen der Reise und die Gefahren des russischen Winters. Schon 1714 starb er, fern von seiner Familie, die er in den unsichersten Verhältnissen in Berlin zurückgelassen hatte und nun im tiefsten Elend der Gnade des preußischen Hofes empfahl. Doch die Bittgesuche der Witwe an Friedrich Wilhelm I. wurden zurückgewiesen; mit rücksichtsloser Strenge ward auf die Schuld gedeutet, die der Dahingegangene auf sich geladen, und auf die Kosten, die er dem Hofe dadurch verursacht habe. Von keinem Wort und keiner Tat des Dankes hören wir. So sank der Stern des größten Künstlers, den Berlin besaß. Es beginnt die neue Zeit, die ihre großen Meister nicht mehr zu ehren weiß.
Von Schlüters gewaltigster Arbeit aber haben wir noch nicht gesprochen.
Ein malerisches Gemisch aus Elementen der verschiedenen Epochen, die an ihm mitgewirkt hatten, vielfach winklig und düster im Inneren, in seinem Äußeren reich an den spitzigen Türmchen und Erkern – so fand Schlüter den Schloßbau vor. Friedrich I. befahl einen durchgreifenden Neubau, und Schlüters erster Plan lief tatsächlich auf ein vollkommen neues Gebäude hinaus.

Das Berliner Schloß: Der Bau Schlüters.
Doch dieser erste Plan kam nicht vollständig zur Ausführung. Auf der einen Seite wurden die alten Bauteile des Schlosses am Wasser völlig geschont, auf der anderen ward die dekorative Pracht der Ausschmückung ruhiger und geschlossener, als der Künstler es anfangs beabsichtigt hatte. Beides kam dem Bau zugute. Denn wie er nun sein historisches Werden deutlicher und stolzer zur Schau trug, so erschien die architektonische Sprache seiner Fassaden, zu der man sich jetzt entschloß, als der rechte Ausdruck großartiger Würde und sicherster Kraft. Das ganze malerische Gewimmel nach der Spree zu: der Grüne Hut, vor ihm der Turmbau der alten Erasmuskapelle, weiter Lynars Drittes Haus mit seinen Ziergiebeln und Ecktürmchen, daneben Smids-Nerings schlichter Anbau und schließlich der prächtige Flügel der Schloßapotheke, blieb also bis auf kleine Veränderungen unangetastet (so ward der Oberbau des Kapellenturms der Gesamtwirkung zuliebe verkürzt). Der Umbau Schlüters begann mit dem Kaspar Theiß-Bau, also mit der Schloßplatzfront vom Wasser bis zur Mitte, und dem rechtwinklig daranstoßenden Trakt an der Spree bis zur Kapelle, und erstreckte sich weiter auf die entsprechende Lustgartenfront und vor allem auch auf den Schloßhof. Die alten Baulichkeiten an der Ostseite und Nordostecke des Schlosses, die sich um zwei kleine Höfe: den Kapellenhof und den sogenannten Eishof, herumziehen, bildeten und bilden noch heute eine Gruppe für sich: an sie lehnt sich der neue Schlüterbau an, der ebenso wie auf jenem ersten Plan zunächst lediglich das Rechteck der Flügel um den inneren Hof umfaßte. Weiter nach Westen zu, im Viereck um den heutigen äußeren Schloßhof, blieben die alten Altanbauten fürs erste unangetastet. Jenes große Rechteck bildet demnach den Kern, und es bildet die Größe des Schlüterbaus. Hier ist jene gewaltige Einheit seines Werkes am herrlichsten durchgeführt. Draußen die grandiose Würde der Schloßplatzfassade, in vier Stockwerken aufgeschichtet, in der Größe der Fenster, in der Abmessung ihrer Zwischenweite mit höchster Künstlerweisheit berechnet. Der Schmuck der großen Fläche sparsam, doch ausdrucksvoll; die flachen und bogenartigen Fensterbekrönungen schließen sich dem Auge zu großen horizontalen Linien zusammen. Und aller reichere Ausdruck ist auf das mächtige Portal beschränkt, das mit drohenden Vertikalen jene wagerechten Linien durchschneidet: das Erdgeschoß in Rustika gequadert, Rustika: Mauerwerk aus Quadern. mit drei Eingängen, deren mittelster die Nebenpforten überragt, darüber vier freistehende korinthische Säulen, von ihnen umschlossen die Fenster der beiden Hauptstockwerke, die wiederum von eingestellten ionischen und korinthischen Säulen flankiert werden. War hier alles auf die Wirkung nach außen berechnet, stark und imponierend, so ward der Lustgartenfront, bei völlig gleichen Grundverhältnissen der Gliederung, ein eleganterer Charakter gewahrt; denn hier war ja die Gartenfront, deren Tor den König und den Hof in die heiteren Anlagen der Spreehalbinsel führen solle. Das Portal zieht sich mehr in die Fläche der Fassade zurück, die es nicht trotzig beherrscht, und die Wirkung ist ganz auf die behutsam, doch mit belebenden Schatten hervortretenden Details gestellt, auf die Königsadler des Hauptgesimses, auf die Giebel- und Wellenlinien der Fensterverdachungen und die herumgekröpften Architrave. Architrav: untere Abteilung des Hauptgebälkes; Querbalken auf den Säulen. Das Portal selbst ist weit weniger wuchtig als schmuck und graziös; es fehlen über dem Sockelgeschoß darum die Säulen, an ihrer Stelle tauchen atlasartige Karyatiden Karyatide: Tragsäule in Gestalt eines weiblichen Körpers. auf, die einen Balkon tragen, dessen Mittelfenster bogenförmig abschließt. Kartuschen Kartusche: Umrahmung. mit schwebenden und ruhenden Gestalten sind angebracht, Venus, auf einem schlafenden Löwen hingestreckt, Cupido, der mit der Keule des Herkules spielt – sprechende Symbole für das Höfisch-Festliche, das hier, mehr im Privatbezirk des Königs, angedeutet werden sollte.
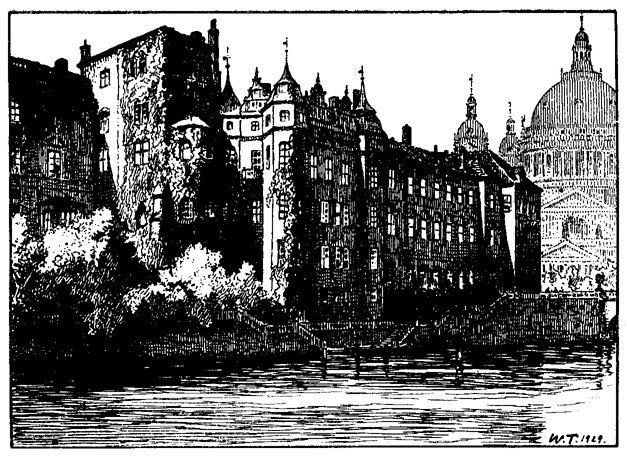
Das Berliner Schloß: Der alte Flügel aus dem 15. Jahrhundert, im Hintergrund der Dom.
Alles ist von größerer Bewegtheit gegenüber der majestätischen Pracht und Ruhe der Stadtseite. Das Wundervollste aber schuf Schlüter in der Architektur des Hofes, wo er mit gleicher Meisterschaft den vorhandenen Grundstock des Baus benutzte und alles doch zu einer unvergleichlichen Einheit zusammenschloß. Ringsum an drei Seiten ziehen sich offene, zweigeschossige Bogenlauben mit gekuppelten Säulen und Pilastern, Pilaster: Halb- oder Wandpfeiler. mit geradem Gebälk im Erdgeschoß, oben von Flachbogen abgeschlossen, und über diesem Unterbau mit seiner Abwechslung von Licht- und Schattenmassen ragen die ruhigen Wandflächen der oberen Stockwerke auf. Und wie hier Wirkung durch Kontrast gesucht wird, so auch durch den Gegensatz, den die durchgeführten Hoffassaden mit den drei vorspringenden Portalrisaliten bilden. Die korrespondierenden Risalite Risalit: aus der Hauptfläche hervortretender Teil. des Nord- und Südflügels, als Rückseiten der Außenportale, wiederholen verstärkt und großartiger das Motiv der gekuppelten Säulen und Pilaster von den Bogengängen, nur daß hier unten die Säulen, oben die Pilaster sich über je zwei Stockwerke hinziehen. Dreiteilig wie die Portalbauten der Außenfront, lassen sie neben der Durchfahrt in der Mitte, rechts und links die Treppenpodeste deutlich erkennen und tragen auf dem verkröpften Gebälk der Säulen plastischen Figurenschmuck. In ähnlicher Weise, nur noch königlicher in der architektonischen Sprache, ist das breite Risalit der Ostseite im Hofe gestaltet, das zugleich den Haupteingang ins Innere beherbergt.
Gerade rechtzeitig zum Einzug des neugekrönten Königs im Jahre 1701 war der Schloßplatzflügel fertiggestellt worden. Aber noch bevor die Lustgartenseite vollendet wurde, tauchte ein neuer Plan auf, an Stelle der alten Altanbauten neue gewaltige Bauteile aufzuführen, die nun auch den Außenhof umziehen oder vielmehr aus ihm einen nach Westen offenen Vorhof machen sollten. Schlüter selbst hat diese Arbeit nicht mehr zu Ende führen können; die Münzturmkatastrophe kam dazwischen, und es blieb seinem Nachfolger Eosander überlassen, nach seinen Plänen, aber nicht ohne eigene Zutaten, den Bau zu vollenden. So entstand die Fortsetzung der Schlüterschen Schloßplatz- und der Lustgartenfront, in engstem Anschluß an die älteren Teile, und doch in manchen Einzelheiten, wie in der Abmessung der Fenster-Zwischenräume, nicht völlig von der alten Sicherheit getragen. Auf beiden Seiten mußte zudem ein neues Portal eingefügt werden, das hier wie dort gleichfalls eine Kopie seines älteren Genossen war; doch durch die Zweiheit wurde hier wie dort die Wirkung abgeschwächt. Ganz Eosanders Eigentum aber ward die Architektur des abschließenden Westflügels, die durch ihre pompösere und prunkvollere Haltung von Schlüters Größe wesentlich abweicht; namentlich durch das triumphbogenartige Portal, das nun nach der Schloßfreiheit zu den Eingang in den äußeren Hof bildete. Hier wollte der Schwede Schlüter übertrumpfen, eine Nachahmung des Septimius Severus-Bogens in Rom sollte des Meisters grandiose Portale in den Schatten stellen; aber es ward doch nur ein äußerliches Prunkstück, in dem der Barockgeschmack, aller Fesseln ledig, seine lautesten Fanfaren ertönen ließ. Nur in Einem überwand Eosander seinen Vorgänger: durch Schlüters unselige Erfahrungen beim Münzturmbau gewitzigt, gab er dem Westflügel eine so kräftige Fundamentierung, daß sie auch den bombastischen Turmbau hätte tragen können, den er plante. Denn immer noch tauchte hier die Erinnerung an den alten Turm der »Wasserkunst« im Schloßbau auf. Aber es sollte noch fast anderthalb Jahrhunderte dauern, bis in den Jahren 1845-46 unter Friedrich Wilhelm IV. Stüler mit Albert Schadows Hilfe dem Eosanderschen Portal die achteckige Schloßkapelle mit der hohen Kuppel aufsetzte, die mit so feinem Verständnis als Abschluß des Triumphbogens und als Krönung des ganzen Schloßbaus gewählt wurde. Schon 1713, nach dem Tode Friedrichs I., ward Eosander seiner Stellung enthoben und verließ Berlin. Erst sein Nachfolger Martin Böhme führte seinen Plan zu Ende, baute 1714 die Südseite des äußeren Hofes aus, stellte im folgenden Jahre das Westportal erst vollkommen fertig, bis dann im Jahre 1716 der ganze Bau endlich so dastand, wie er sich im wesentlichen heute präsentiert. Nur der Flügel der Schloßapotheke wurde vor zwanzig Jahren bei der Anlage der Kaiser Wilhelm-Brücke verkürzt.
Im Innern aber war das Schloß seit dem großen Umbau ununterbrochenen Veränderungen unterworfen. Schlüter selbst hatte hier in der Raumanlage wie in der Dekoration seinen praktischen Baumeistersinn und seine geniale Erfindungskraft fast noch bedeutender entfaltet als im Außenbau. Die Unerschöpflichkeit seiner plastischen und ornamentalen Zier, seine nie versagende Fähigkeit, den Charakter jedes Raumes in allen dekorativen Details zu treffen, seine echte Künstlerfreude an Schmuck und Pracht, alles strömte hier zusammen und konnte sich nach Gefallen ausleben. Mit immer neuem Staunen verfolgt man die verschlungenen Gebilde seiner Reliefdekors in Stuck und in Holz, seine stets frisch quellende Phantasie, wenn es gilt, eine Saaldecke mit barockem Rahmen für farbenfrohe Bilder zu überspannen, durch üppig anschwellende Supraporten Supraporte: gemaltes Feld überm Türsturz. den Platz der Türen zu betonen, reich gegliederte Kartuschen mit Schnörkeln und Rollwerk, von Genien umschwebt, aus den Ecken herausschmettern zu lassen, einen Kamin pompös zu umbauen, im Aufgang eines Treppenhauses den verschwenderischen Luxus fürstlicher Gastfreundschaft zu verkünden, und dann wieder durch Abwechslung und Kontrast zu wirken, die Noblesse der Einfachheit gegen höfischen Prunk, die Ruhe einer schlicht getönten Fläche gegen blitzende und sich drängende Vergoldungen, gegen festliche Bemalungen zu stellen. Die glorreichsten Taten seiner dekorativen Arbeit sind bis heute im Schlosse erhalten geblieben. So das imposante Treppenhaus, in dem der Besucher beim Eintritt in das östliche Hofportal emporsteigt, mit seinem üppigen Reichtum an plastischem Schmuck, mit dem großen Deckenbilde des Titanensturzes, den Belan, ein Schüler Terwestens, malte. Dann der Schweizer Saal über diesem Treppenhause, der als großer Empfangssaal der königlichen Staatszimmer, als Aufenthalt der Garde, gedacht ist und in seinen wundervollen Raumabmessungen wie in der repräsentativen Grandezza seiner Ziergebilde zeremonielle Haltung und reifsten Kunstverstand verbindet. Dann lockt die lange Flucht festlicher Räume mit großartig angeordnetem schmückenden Detail, mit allem Ausdruck des Glanzes, der der Epoche zu Gebote stand. Und doch wird niemals der Schmuck Selbstzweck. Immer ordnet ihn eine sicher disponierende Hand dem Gesamteindruck des Raumes unter. Die schwellende Phantasie des Künstlers sprudelt über und mündet doch nie ins Überladene, bleibt stets von edlem Maß gebändigt. Den Höhepunkt erreicht die dekorative Pracht im Rittersaal, wo Schlüter in den Stukkaturen der Decke, in den jubelnden Eckarrangements, deren gemalte Kartuschen die Gesimslinien kühn überschneiden, das Äußerste wagte.
Südlich vom Schweizer Saal zieht sich die Flucht der Elisabethkammern hin, die einstige Wohnung der Gemahlin Friedrichs des Großen und der Gattin Friedrich Wilhelms IV.
Die östlichen Partien des Schlosses (dessen Säle und Gemächer man im ganzen auf 700 berechnet) zeigen noch vielfach vorschlütersche Dekorationen, Stuckdecken zumal aus der Zeit des Großen Kurfürsten, Voluten mit vergoldeten Akanthusranken, mit Rollwerk, Kartuschen und Putten, allegorische Malereien, Namenszüge Friedrich Wilhelms und Details mit der Kurkrone, die hier noch deutlich auf die ältere Zeit weist, ornamentale und figürliche Holzschnitzereien, die vom Barock in die Hoch- und Spätrenaissance zurückdeuten. Der berühmteste Festraum des Schlosses aber, der Weiße Saal, ist erst nach Schlüter entstanden. Er war das große Prunkstück im Plan des westlichen Flügels von Eosander, der nach der Lustgartenfront zu ein wenig vorspringt und hier in seiner nördlichen Hälfte für die feierlichen Versammlungen und die Festlichkeiten des Hofes einen neuen Mittelpunkt bergen sollte. Erst 1728 ward der Saal ausgebaut. Lange Zeit mußte er sich mit dem nüchternen Schmuck einer weißen Tünche begnügen, der er seinen Namen dankt. Unter Friedrich Wilhelm IV. dann ward er durch Stüler so umgebaut, daß er seine Bestimmung würdiger erfüllen konnte, für die ihn die erneute prächtige Umgestaltung unter Wilhelm II. noch geeigneter zu machen suchte.
Von Prof. A. Amersdorffer.
Was nutzt die glühende Natur
Vor deinen Augen dir,
Was nutzt dir das Gebildete
Der Kunst rings um dich her,
Wenn liebevolle Schöpfungskraft
Nicht deine Seele füllt
Und in den Fingerspitzen dir
Nicht wieder bildend wird?
Die Strophe Goethes, die Gottfried Schadow in seinem Aufsatz »Die Werkstätte des Bildhauers« (1802) zitierte, läßt sich mit Bedeutsamkeit auf Schadow selbst anwenden. Ein Strom des ewigen Urborns aller Schöpferkraft ging durch die Seele dieses genialen Gestalters.
Sechsundachtzig Jahre hat das Schicksal ihm vergönnt. Was ist im Reigen dieser fast neun Jahrzehnte an ihm vorübergezogen! Und er – er blieb immer er selbst, unbeirrt immer das, was er allein sein konnte. Das ist das entscheidend Große an ihm.
Im letzten Jahrzehnt des Großen Friedrich verlebte er seine Kindheit, die ganze Epoche Friedrich Wilhelms II., des Genießerkönigs, Preußens Zusammenbruch und Wiederauferstehung unter Friedrich Wilhelm III. und das bewegte erste Jahrzehnt unter Friedrich Wilhelm IV., dem Romantiker und Kunstträumer, umfaßt dieses Künstlerdasein.
Welche Wandlungen der Geschichte, der Kultur und welche Wandlungen der Kunst in dieser langen Zeit!
Berlin ohne eigene Kunsttradition, ohne den Rückhalt einer eigenen Schule in den bildenden Künsten – die Akademie lag darnieder – war mit dem Hof ein lockender Mittelpunkt für Künstler und Kunstabenteurer aller Nationen. Chodowiecki der Einzige, der deutsches Wesen repräsentieren konnte; die anderen neben ihm unbedeutend.
In solcher Zeit stieg zur Ehre deutscher Kunst der Stern Gottfried Schadow auf.
Wohl ging er in Tassaerts Atelier vom Rokoko aus, aber er übernahm nur die gute handwerkliche Schulung von diesem welschen Stilisten. Der Formalismus des Zeitstils nahm ihn nicht gefangen; er sah die Natur wieder mit eigenen, unbefangenen Augen. Die Antike, die er in Rom in jungen Jahren kennen lernte, machte ihn nicht zum Klassizisten, sie gab ihm nur die Schönheit der Linie, die Reinheit und Verklärung der Form.
Der Klassizismus, der bürgerliche Realismus, die Romantik, sie glitten im Laufe der Jahrzehnte an Schadow vorüber. Er blieb unberührt von allen Zeitströmungen. Sie fanden keinen Eingang in sein Wesen. Er stand über allem und blieb immer der eine, immer er selbst.
Wie Schadow die Natur zum Kunstwerk umschuf, das Vergängliche zum Zeitlosen, zum Ewigkeitswert erhob, das ist das Geheimnis seiner fühlenden Augen und seiner empfindenden Hand, mit kühlen Worten nicht zu deuten, nur in Bewunderung nachzufühlen.
Sein Stil ist kein Zeitstil, er ist allein die Sprache seiner Seele, die ihm keiner nachsprechen konnte.
Es ist kein Zufall, nur folgerichtig, daß er auch äußerlich sein Schicksal eigenwillig selber formte. So haben wenige sich selbst durchgerungen und sich selbst behauptet. Seine Flucht nach Rom, der erste Erfolg des in der Fremde auf sich allein gestellten jungen Künstlers sind bezeichnend. Die Heimat rief den Vierundzwanzigjährigen zurück, um ihn vor große Aufgaben zu stellen, die sonst keiner lösen konnte. Und er löste sie und schritt von Erfolg zu Erfolg.

Das Brandenburger Tor
Aufnahme von Albert Vennemann, Berlin
Das poesievolle Grabmal des Grafen von der Mark, die machtvolle Quadriga des Brandenburger Tors, die stille Anmut der Prinzessinnengruppe, die Manifestation preußischen Geistes in den Feldherrnstatuen, der evangelische Ernst des Luther – jedes einzelne dieser Werke genügte, den Schöpfer für immer unvergeßlich zu machen. Auch auf den zahlreichen Büsten liegt der volle Glanz seiner Meisterschaft. In der frappanten Erfassung des Individuellen und in der unübertroffenen stilistischen Durchbildung ist jede ein künstlerisches Erlebnis für sich.
Wahre Größe ist Schlichtheit. Schadow lag geniales Gebaren fern, so bewußt ihm auch der Wert des eigenen Könnens war.
In seiner märkischen Tüchtigkeit und Sachlichkeit, in seiner Gründlichkeit und Vertiefung, in seinem unerhörten Fleiß war er ein echter Deutscher. Kein schöneres Vorbild gibt es für die Jünger der Kunst als ihn.
Sein umfassender Intellekt zog auch die theoretischen Grundlagen seiner Kunst in den Bereich ernsten Studiums. Mit hellem Blick und gesundem Urteil beobachtete er alle Erscheinungen und Ereignisse. Was er uns in seinen Schriften hinterlassen hat in lebendiger, getreuer, zuweilen humorvoller Schilderung, ist eine höchst schätzenswerte Quelle für das Verständnis der Menschen, der Kultur und Kunst seiner Zeit.
Wie fehlt er uns heute, der »alte Schadow«! Wie würde er, der den Scholaren der Akademie oft in so sarkastischer Form Unterweisungen gab, mit seiner Berlinischen Drastik den Kunstbetrieb unserer Tage beurteilen!
Wie fehlt uns ein solcher unbeirrbarer Hüter der Würde der Kunst!
Doch geblieben ist uns die Versenkung in seine Meisterwerke. Sie mag uns trösten in dieser Zeit der Verwirrung der Geister.
Aus der Zeitschrift »Wachtfeuer«.
Von Theodor Fontane.
Erstes Bataillon Garde. Parad' oder Schlacht
Ihm wenig »Differenzen« macht,
Ob in Potsdam sie trommelnd auf Wache ziehn,
Ob sie stehen und fallen bei Kolin,
Ob Patronenverknattern, ob Kugelpfiff,
Immer derselbe feste Griff,
Dieselbe Ruh. Jede Miene drückt aus:
»Ich gehör zur Familie, bin mit vom Haus!«
Ihrer viere sitzen im Knapphans-Zelt.
Eine Kottbusser hat sich jeder bestellt,
Einen Kornus dazu: das Bier ist frisch,
Ein Berliner setzt sich an den Tisch,
Ein Berliner Budiker, – da währt's nicht lange,
Plappermühl ist im besten Gange.
»Wahrhaftig, ihr habt die schönste Montur,
Litzen, Paspel, Silberschnur,
Blechmützen wie Gold, gut Traktement,
Und der König jeden von euch kennt!
Erstes Bataillon Garde, Prachtkerle vor all'n,
Solch Götterleben sollt' mir gefall'n.«
Drei schwiegen. Endlich der vierte spricht:
»Ne, Freund Berliner! so is es nicht.
Eine propre Montur, was soll uns
die geben?
Unser Götter- is bloß ein Jammerleben.
Potsdam, o du verfluchtes Loch,
Führst du doch heute in die Hölle noch
Und nähmst Ihn mit mitsamt seinen Hunden,
Da wär auch
Der gleich mit abgefunden,
Ich mein den da oben, – uns läg' nichts dran,
Is doch bloß ein Quälgeist und Tyrann,
Schont nicht Fremde, nicht Landeskinder,
Immer derselbe Menschenschinder,
Immer dieselbe verfluchte Ravage, –
Potsdam, o du große Blamage!«
Das war dem Berliner nach seinem Sinn,
Er lächelte pfiffig vor sich hin:
»Ich sag' das schon lange. Was hat er denn groß?
Große Fenstern hat er, sonst is nicht viel los.
Und reden kann er. Na, das kann jeder,
Hier aber, er zieht nicht gerne vom Leder.«
Da lachten all' vier, und der eine spricht:
»Ne, Freund Budiker, so geht es nicht.
Zuhören kannst du, wenn wir mal fluchen,
Aber du darfst es nicht selber versuchen,
Wir dürfen frech sein und schimpfen und schwören,
Weil wir selber mit zugehören,
Wir dürfen reden von Menschenschinder,
Dafür sind wir seine Kinder;
Potsdam, o du verfluchtes Loch,
Aber Er, er ist unser König doch,
Unser großer König. Gott soll mich verderben,
Wollt ich nicht gleich für Fritzen sterben.«

Unter den Linden und Potsdamer Brücke. Nach der Zeichnung von Joh. Stridbeck. (1691.)
Von Willy Pastor.
Friedrich I. war der Schöpfer eines wirklich einheitlichen Berlins. Denn er war es, der 1688 die Gewerke der fünf Städte in der Stadt durch gemeinsame Privilegien verband und das in einer Stadt erworbene Meisterrecht für alle übrigen gültig erklärte. Ja, 1709 führte er durch die Zusammenziehungen der verschiedenen Magistrate in einen einzigen Stadtrat auch eine einheitliche Verwaltung ein.
Bedenken wir ferner, daß Friedrich I. dem Genie eines Schlüter die Mittel schuf zur Ausführung seiner Werke, daß wir ihm das Zeughaus, den neuen Schloßbau und das Denkmal an der »langen Brücke« verdanken, endlich, daß er in dem wirren Jagdgebiet des Tiergartens die ersten Alleen anlegte (vorerst nur die im östlichen Teile, den »kleinen Stern«, die sieben von den späteren »Zelten« ausgehenden Alleen, die große Querallee usw.), so scheint wahrlich kein Grund vorhanden, die Regierungszeit Friedrichs I. im Vergleich mit der seines Vorgängers gering zu achten.
Aber wenn das Leben am Hofe und in der Residenz Friedrichs I. nur strahlende Bilder kannte, so fragen wir erst nach dem Woher von soviel Licht. Und die schlimme Frage nach dem Woher ist es, vor der ein Friedrich I. nicht besteht. Der Große Kurfürst konnte die Einwohnerzahl Berlins von 6000 nur auf 18 000 erhöhen, aber dafür erhöhte er auch die Einwohnerzahl seines gesamten Landes von 800 000 auf 1 500 000. Die 62 000 Berliner Friedrichs I. dagegen rekrutieren sich aus einem Volke von insgesamt nur 1 730 000 Köpfen.
Es lag nichts Gesundes in der schnellen Entwicklung des jungen Berliner Königshofes. Friedrich I. war zu schwach, an den Traditionen seines Hauses festzuhalten. Wir sehen ihn bisweilen Ansätze dazu machen. So, wenn er 1688 die zünftige Verordnung über ein Zahlenmaximum zu privilegierender Meister aufhebt (drei Jahre später übrigens von ihm selbst widerrufen, indem er den Wollenwebern, der wichtigsten Zunft jener Tage, ein Maximum von zwanzig Meistern gestattet); wenn er 1705 den Kindern von Eltern »unehrlicher Stände« das Gewerbe erschließt; wenn er 1693 auch fremden Bäckern und Schlächtern den Berliner Wochenmarkt freigibt. Aber man wird bei allen solchen Verordnungen den fatalen Nebengedanken nicht los, daß ihr einziger Zweck der gewesen sei, den Ertrag der Steuern ergiebiger zu machen, und daß die Hauptsumme der Steuern Dingen zugute kam, die mit der Geschichte der menschlichen Arbeit herzlich wenig gemeinsam haben. Trotz Schlüter und Eosander und Nering wollen wir uns doch freuen, daß in Friedrich Wilhelm I. auf Friedrich I. ein Werkeltagskönig dem Sonntagskönig folgte, der in seiner ganzen langen Regierungszeit nicht einen einzigen kunsthistorisch bedeutenden Bau errichtete, der aber ein scharfes Auge hatte für die ernsten Aufgaben seiner Zeit und mit ganzer Kraft sich ihnen hingab, unbekümmert darum, daß die Geschichtsschreiber der Könige von solcher Arbeit wenig Rühmens machen.
Seit den Zeiten des »eisernen« Kurfürsten wurde noch jedesmal, wenn es galt, das Bild Berlins umzugestalten, der Anfang mit dem Schloß und seiner Umgebung gemacht. Friedrich Wilhelm I. wich von dieser Überlieferung nicht ab. Im Jahre 1715 baute er den »Lustgarten« in einer Weise um, die die Bürger über den Geist der neuen Herrschaft nicht im Zweifel lassen konnte. Der Große Kurfürst hatte hier einen Garten modischen Geschmacks anlegen lassen. Der Garten hatte drei Teile, deren mittlerer um sieben Stufen tiefer lag als die beiden anderen. Für das Malerische einer solchen Anordnung hatte Friedrich Wilhelm keinen Sinn, ebensowenig für die fremdartigen Pflanzen, die Laubengänge und Springbrunnen der Anlagen. Er ließ das Terrain durch Erdaufschüttungen nivellieren, die Bäume wurden gefällt und die Statuen beiseite geschafft. Noch einmal wurde der also verwüstete Platz durch wahre Dünen weißer Sandmassen geglättet, und – der »Umbau« war fertig: aus dem Lustgarten war ein Exerzierplatz geworden.
Friedrich Wilhelm ist dem künstlerischen Programm, das er in der Umgestaltung des Lustgartens gab, zeitlebens treu geblieben. Wohl ließ er einige Kirchen bauen, er führte auch – aus Pietät gegen seinen Vater – den Schloßbau zu Ende, aber das ist auch alles, was er für die Architektur im künstlerischen Sinne tat. Es war zuviel Geld ausgegeben worden, es würde noch viel ausgegeben werden – es hieß sparsam sein.
So gering indessen sein Interesse an den neuen Prachtbauten war, ein so leidenschaftlicher Architekt war er doch, wo es sich um Errichtung nüchterner Wohnhäuser handelte. Nie ist in Berlin im Verhältnis so viel gebaut worden, als unter der Regierung Friedrich Wilhelms. Der Zuzug nach der Residenz steigerte sich allerdings in seiner Regierungszeit ganz ungewöhnlich (die Bevölkerungsziffer betrug in seinem Todesjahre 90 000), aber der Anbau übertraf doch immer noch die Nachfrage. Es heißt, daß der König die Absicht gehabt habe, Berlin in den Stand zu setzen, nötigenfalls das ganze Heer mühelos in seinen Mauern aufzunehmen. Dieses Heer war allmählich zu einer Kopfzahl von 30 000 angewachsen. Da genügte denn freilich nicht das alte Stadtgebiet, das der Große Kurfürst mit seinen so weit gezogenen Mauern abgesteckt hatte, und Erweiterungsbauten größten Stiles wurden notwendig.
In den ersten Jahren beschränkte Friedrich Wilhelm sich auf den Ausbau der von seinem Vater angelegten Friedrichsstadt (ihre Grenzen lagen in der Gegend der heutigen Mauer- und Junkerstraße). Im Jahre 1725 besaß diese Stadt, oder vielmehr – nach Friedrichs I. Reform – dieser Stadtteil neben 719 Häusern noch 149 freie Baustellen. Diese Lücken galt es zunächst auszufüllen. Schon 1732 war dieses Werk vollendet, und nun begannen die Erweiterungsbauten. Die alten Festungsmauern der köllnischen Seite wurden niedergelegt, und in weiterem Umkreis die Mauer errichtet, die noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts das westliche Berlin umgab.
Das architektonische Bild, das Berlin nach Friedrich Wilhelms Willen bieten sollte, war an Abwechslung nicht eben reich. Große Plätze lagen überall im Mittelpunkt. Aber solch ein Platz, wenn er ganz im Geschmacke Friedrich Wilhelms war, sah einem Kasernenhof verzweifelt ähnlich. Nüchterne, kasernenmäßig einfache Häuser umstanden seine sandige Fläche, und schnurgerade Straßen, rechtwinklig gekreuzt von anderen nicht minder geraden, verbanden die Exerzierplätze untereinander.
Einzelne Straßen im alten Potsdam zeigen uns noch heute, wie es damals im Westen unserer Stadt aussah. Da stehen sie unverändert, diese schmucklosen aber reinlichen Bauten mit den zwei Stockwerken von fünf Fenstern Front und dem hohen Ziegeldach, aus dem das Giebelchen einer einsamen Dachkammer vorspringt. Das Giebelchen erinnert an den zugespitzten Helm des altpreußischen Grenadiers. Deshalb liebte der König es so, und es war ihm eine Herzensfreude, mit seinem kleinen Gefolge durch die neuen Straßen zu reiten, deren Häuser sich so untadelhaft nebeneinander aufreihten wie Soldaten nach dem Kommando »Stillgestanden«.
Führt der Weg uns heute durch eine dieser stillen Straßen, so bleiben wir nicht unempfänglich für den persönlichen Zug, der den Häusern hier anhaftet, trotz alles Kasernenmäßigen. Aber wir glauben dann unter einer Art Museumseindruck zu stehen, von dem die ersten Anwohner nichts empfanden. Das ist ein Irrtum. Von allem Anfang an besaßen die Bauten Friedrich Wilhelms dieses Eigenartige, Adrette. Zwar, der verwöhnte Höfling jener Tage mochte das einzige Charakteristikum für die Residenz des Preußenkönigs in dem Mangel modischer Schloßbauten sehen. Man war eben blind für die Häuser des kleinen Bürgers. Man verglich nur Schlösser und konnte so nicht auf die Beobachtung kommen, daß eine andere Residenz durch Subtraktion ihrer Schloßbauten noch kein Berlin oder Potsdam wurde, daß alles das, was anderwärts als der schwere Pomp weniger Kolossalbauten auftrat, hier keineswegs verloren war, sondern sich nur anders umgesetzt hatte: in der peinlichen Sauberkeit, auf die Friedrich Wilhelm soviel gab.
Es lag etwas Demokratisches, etwas durchaus Unromantisches in der Art, wie Friedrich Wilhelm seine Aufgabe als Städteerbauer auffaßte. Dieselben Grundsätze aber, die den Städteerbauer leiteten, waren auch für den Staatsmann maßgebend. Auch hier hat Friedrich Wilhelm mit unermüdlicher Energie um- und neugebaut, auch hier kam trotz allen Schaffens anscheinend nichts Großes zustande – und doch war das Kleine, was wurde, so wahrhaft bedeutend!
Die Residenz, das war der Wunsch Friedrich Wilhelms bei seinen Neubauten, sollte das Aussehen einer einzigen ungeheuren Kaserne annehmen. Es war nur folgerichtig, wenn er dementsprechend keinen Unterschied machte in der Behandlung seiner eigentlichen Soldaten und der »freien« Bürger. Wir sehen ihn mit seinem Krückstock die neuen Straßen durchwandern und die Bauarbeiten beaufsichtigen. Für alles hat er da ein offenes Auge, wie dem inspizierenden Korporal auch nicht die kleinste blinde Stelle am Waffenputz entgeht. Er redet die Arbeiter an, fragt die Unternehmer nach ihrem sonstigen Gewerbe.
Aber nicht nur an den Bauten müssen diese Untertanen ihm Rede und Antwort stehen. Kein Bürger der Stadt ist mehr sicher, irgendwann aus der Straße von ihm angeredet zu werden. Ja nicht einmal das Hausrecht schützt sie mehr. Unangemeldet betritt der König bisweilen ein beliebiges Gebäude und sieht dort in Küche und Werkstatt nach dem Rechten. Wehe dann den Bewohnern, wenn sie ihr Handwerk vielleicht über dem »blauen Montag« vergessen haben, den schwatzenden oder auch nur nachlässigen Mägden! Die Prügelstrafe ist beim Militär noch wohl im Schwange, und für den König ist die Stadt eine einzige große Kaserne.
Wie tief die Bevormundung Friedrich Wilhelms in das persönliche Leben des einzelnen hineingreifen konnte, zeigen am besten seine Verordnungen zur Hebung einer bestimmten Industrie, der Wollweberei. Kommandanturbefehle, die einzelnen Regimentern die Bezugsquelle für ihre Stoffe vorschreiben, machten den Anfang. Einfuhrverbote und entsprechende Befehle wegen Ankaufs inländischer Ware übertrugen das System dann auf das gesamte Volk. Aber es fehlte an Anlagekapital. Hier mußte die kurmärkische Ritterschaft herhalten. Der König zwang sie, sich mit Kapital an einem bestimmten Unternehmen zu beteiligen. Noch immer wollte die Industrie nicht recht gedeihen, da die Bürger sich bei den hohen Preisen der Wollstoffe mit billigen Surrogaten zufrieden gaben. Aber auch hier wußte der König Rat. Ein Edikt vom November 1721 verbot den weiteren Verkauf von Kattunen, des beliebtesten Ersatzstoffes; die vorhandenen Zeuge mußten innerhalb acht Monaten aufgetragen sein. Durch diese und ähnliche Bestimmungen gelang es tatsächlich, die Wollindustrie in einer Weise zu heben, daß sich 1723 ein embarras de richesse herausstellte: es begann an Wollgarnen zu fehlen. Da erfolgte am 14. Juni 1723 jener denkwürdige Befehl, dessen Durchführbarkeit die Kulturzustände unter Friedrich Wilhelm so herrlich kennzeichnet. Die Verkäuferinnen auf den Märkten schienen dem König zu wenig beschäftigt. Nur die geringste Zeit wurden sie von ihren Kunden in Anspruch genommen, und ganze Stunden verschwatzten und vertrödelten sie. Nun wohl, die Hökerfrauen – sollten spinnen! Ein bestimmtes Quantum Wollgarn mußte allwöchentlich von einer jeden eingeliefert werden, wofür sie nach einem von oben her festgesetzten Tarife abgelohnt wurde. Die Strafe des Geschäftsverlustes drohte allen, die der neuen Bestimmung nicht gewissenhaft nachkamen.
Wollen wir uns zurechtfinden in der Psychologie einer Regierungsart wie der Friedrich Wilhelms, so dürfen wir nicht vergessen, daß dieser Monarch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts regierte. Die Arbeit zu bevormunden, in das Recht der einzelnen einzugreifen, war nur der Brauch der Zeit. Man verfolge die Geschichte der Industrie welches europäischen Landes auch immer; überall sehen wir in dem dem großen Kriege folgenden Jahrhundert die Arbeit geregelt von gesetzlichen Bestimmungen willkürlichster Art. Es galt eben mit dem überkommenen Landsknechtswesen der Industrie zu räumen und der neuen Art der Arbeit ein tüchtiges Heer zu schaffen. Daher jene grausamen Gewaltmaßregeln, die in Preußen nicht schlimmer waren als anderswo.
Nun ließe sich hier freilich einwenden, daß in anderen Staaten Maßregeln, die die Industrie betrafen, von Privatunternehmern, nicht vom obersten Landesherrn ausgingen. Mit jenen ließen sich freiwillige Verträge schließen, mit diesem nicht. Das machte die Verordnungen in Preußen, selbst wo sie milder waren, ungleich schärfer, und daß bei einem solchen strengen Regiment kein freier Handel gedeihen konnte, beweist am besten der Umstand, daß unter Friedrich Wilhelm keine der neuen Industrien, die in den westlichen Kulturländern sich so herrlich entfalteten, zur Entwicklung kam.
Die so sprechen, vergleichen wieder nur Paläste, nicht Bürgerhäuser. Friedrich Wilhelm hat sowenig große Manufakturbetriebe gegründet, wie er Prachtgebäude schuf. Aber soviel mehr Sorgfalt er auf die Häuser der kleinen Leute verwandte, deren Reinlichkeit er gern allen Pomp zum Opfer brachte, soviel tüchtiger sollte sich in der Folge das von ihm geschaffene Arbeitsmaterial bewähren, als das anderer Länder. Friedrich Wilhelm hat keine großen Schlachten geführt, und doch können wir von ihm sagen, daß er in den Kämpfen des Siebenjährigen Krieges mitgesiegt hat. So auch wissen wir, wem es zu verdanken ist, wenn sich unter Friedrich dem Großen mit einem Schlage der Sieg des neuen Manufakturbetriebes über das alte Zunftsystem entscheidet.
Fassen wir alles zusammen, was Friedrich Wilhelm, dieser für die Geschichte der Arbeit in unserem Lande so bedeutende Monarch, geleistet hat, so dürfte sich für sein Gesamtwerk kein besseres Symbol finden lassen, als eine neue Tracht, die der König an seinem Hofe einführte: der Zopf.
Der Begriff des Zopfes hat für uns eine etwas fatale Nebenbedeutung. Wir denken an etwas leblos Steifes, Verknöchertes. Aber es ist mit solchen Vorstellungen wie mit den Bildern großer Männer, die nur in der Gestalt, in der der Tod sie antraf, in die Phantasie der Nachwelt übergehen. Der große Mann mag in der Zeit seines Todes die schöpferischen Jahre längst hinter sich gehabt haben, mag müde, ja kindisch geworden sein: mit Falten und Runzeln im Gesicht ist er gestorben, und mit Falten und Runzeln kommt sein Denkmal auf das Postament. Erinnern wir uns nur an die Allongeperücke. Das allgemeine Vorurteil sieht sie auf den Köpfen geschwollener Quacksalber. Aber auch der Große Kurfürst trug die Allongeperücke, und wenn Schlüter sie uns auf seinem Haupte zeigt, scheint uns nichts an ihr bombastisch oder geschwollen.
Ästhetische Gesichtspunkte sind es namentlich, von deren Höhe herunter man alles verdammt, was Zopf heißt. Die gerade Linie soll nun einmal nicht schön sein, alles Korrekte, Regelmäßige ist unkünstlerisch, und ein Geschmack, der sich dafür begeistert, einfach barbarisch. Nun, über Geschmacksfragen ließe sich ja streiten. Soviel aber steht jedenfalls fest, daß in der Freude, die ein Friedrich I. an der barocken Kunst goldüberladener Schlösser hatte, zum mindesten nicht mehr Lebenskraft lag als in der Freude, mit der Friedrich Wilhelm durch seine neuen Straßen ritt, um ihre militärisch genaue Frontlinie zu mustern.
Aber es ist unrecht, die Größe eines Friedrich Wilhelm lediglich mit ästhetischem Maßstabe zu messen. Die Kunstgeschichte will nichts von ihm wissen. Was geht uns ihr Urteil an über den Zopf! Die Kulturgeschichte versteht sich besser auf jenen einzigartigen Monarchen: sie sieht auch mit anderen Blicken auf die Regelmäßigkeit und die gerade Linie der Zopfzeit. Für sie öffnet sich in der geraden Linie ein unendlich weiter Horizont, und in der Regelmäßigkeit glättet sich hier das heillose Durcheinander mittelalterlicher Anarchie.
Denken wir an Land und Leute, die Friedrich Wilhelm als Erbe von seinen Vätern übernahm. Im Zentrum des damaligen Berlins kann es nicht winkliger, unheimlicher ausgesehen haben, als in den Seelen der damaligen Berliner und Märker überhaupt. Die Ansätze zum Besseren, die dem Großen Kurfürsten gelungen waren, hatte die Regierung Friedrichs I. wieder verdorben. Je prächtiger die neuen Prunkbauten gediehen, um so trostloser war das Elend in den kleinen Straßen. Die französische Etikette des Hofes mochte der vornehmen Gesellschaft eine gewisse Erziehung geben, aus der Menge aber waren auf diese Weise die mittelalterlichen Rückstände nicht zu beseitigen, und noch weniger konnte diese Menge, durch das brandenburgische Asylrecht aus allen Teilen Europas herangezogen, dabei zu einem einheitlichen Volke ineinanderwachsen.
Da tritt die Erscheinung eines Friedrich Wilhelm vor uns hin. Er legt Exerzierplätze an, er umgibt sie mit seinen Kasernenbauten und verbindet sie mit Straßen, in denen keine verschnörkelte Barockarchitektur geduldet ist. Zopf, nüchternster Zopf ist alles, was er baut, aber die Nüchternheit gab der Stadt und ihren Bewohnern Luft und Licht. Zopf, nüchternster Zopf ist auch Friedrich Wilhelms Staatsbaukunst. Gönnen wir den höfischen Zeitgenossen des demokratischsten aller Regenten ihren Spott über eine Hofgesellschaft, die sich am wohlsten fühlte in Tabagien: die nüchternen Umbauten, die Friedrich Wilhelm an seinem Staate vornahm, brachten in die Seele seiner Untertanen nicht weniger Luft und Licht, als die Kasernenstraßen in ihre Häuser. Das » suum cuique« der Hohenzollern war für Friedrich Wilhelm keine Phrase.
W. Pastor, Berlin, wie es war und wurde.
Von Leopold Ranke.
An und für sich konnte ein Verein deutscher Landschaften, die sämtlich kaum drittehalb Millionen Einwohner zählten und nicht einmal in sich zusammenhingen, dem französischen Reiche gegenüber, das von den Pyrenäen bis an den Oberrhein, von dem Mittelmeer bis an den Ozean reichte, dem unermeßlichen Rußland, dem unerschöpflichen Österreich benachbart, zur Seite Englands, dem die See gehorchte, nur wenig bedeuten. Was dem preußischen Staate einen gewissen Rang unter ihnen, Ansehen in der Welt verschaffte, war allein das Kriegsheer. Man nahm damals an, daß Frankreich eine Landmacht von 160 000, Rußland von 130 000 Mann regelmäßiger Truppen erhalte; hier fehlte aber vieles an Erfüllung der Listen, dort ward ein großer Teil der Mannschaften durch den Dienst in den Garnisonen der zahlreichen Festungen beschäftigt; das österreichische Heer rechnete man auf 80-100 000 Mann, jedoch von zweifelhafter Streitfähigkeit und zerstreut in allen Provinzen. Was Friedrich Wilhelm I. für die Stellung Preußens in diesem Wetteifer der Streitkraft getan hat, ermißt man sogleich, wenn man bemerkt, daß er die Armee von 38 000 Mann, in welcher Zahl sie etwa mit Sardinien, Sachsen-Polen in gleichem Range stand, allmählich bis auf mehr als 80 000 Mann vermehrte, so daß er Österreich nahe kam. Der König nahm eine ziemlich gleichmäßige Rücksicht auf die verschiedenen Waffen; die Kavallerie ist unter ihm um mehr als die Hälfte, die Artillerie in noch größerem Maßstabe angewachsen. Bei ihm kam kein Widerspruch mit den Listen vor; der Festungsdienst beschäftigte eine verhältnismäßig nicht große Anzahl; wenn wir der geringsten Angabe folgen, so waren 72 000 Mann jeden Augenblick oder wenigstens nach kürzestem Verzuge im Felde zu erscheinen vorbereitet.
Schon aus dem Verhältnis der Zahlen ergibt sich, daß es unmöglich war, ein stehendes Heer von dieser Stärke aus den brandenburgisch-preußischen Landen aufzustellen, wenn man nicht jeder andern Tätigkeit die ihr unentbehrlichen Kräfte entziehen wollte. Es gehörte schon außerordentliche Anstrengung dazu, um nur die Hälfte der erforderlichen Leute aus Eingeborenen zusammenzubringen. Eine Zeitlang schwankte man zwischen Pflicht und Freiwilligkeit, Werbung und Gestellung; die Eigenmächtigkeit der Offiziere, der Wetteifer und gegenseitige Übergriffe der Regimenter brachten unzählige Unordnungen und Beschwerden hervor. Um diesen Übelständen zuvorzukommen, bildete Friedrich Wilhelm eine ältere Einrichtung, nach welcher jedem Regiment ein besonderer Bezirk zu seiner Ergänzung vorbehalten war, systematischer aus. Die Feuerstellen des Landes wurden nach ihrer Zahl bezirksweise unter die Regimenter und Kompagnien ausgeteilt, um sich daraus die erforderlichen Mannschaften anzueignen, insofern diese nicht durch besondere Ausnahmen davon befreit, für die bürgerlichen Gewerbe oder für den Landbau unentbehrlich waren. Man nahm weder ansässige Leute, noch älteste Söhne und Erben; Räte der Provinzialkollegien waren bei den Aushebungen zugegen, um die Verletzung der Rücksichten des Friedens abzuwehren. Den größeren Teil des Zuwachses, der sogleich mit den Kommandeurs in Verbindung trat, bildeten die jüngeren Bauernsöhne. In den geographischen Beschreibungen der brandenburgischen Landschaften merkt man besonders an, wie die Landleute gesund, stark, arbeitsam seien, den Wechsel der Witterung gut ertragen und treffliche Dienste im Felde leisten. Man fand das Wort des alten Cato bewährt, daß der Bauernstand die tapfersten Leute gebe.
Fast die Hälfte der Armee war nun aber durch Werbung zusammengebracht und instand gehalten. Was dabei die größten Beschwerden veranlaßte, war die Vorliebe für hochgewachsene, riesenhafte Menschen, die man aus allen Teilen von Europa – Schweden, Irland, der Ukraine, den österreichisch-türkischen Grenzgebieten von Niederungarn, welche sich besonders ergiebig erwiesen – mit einem bei der übrigen Sparsamkeit in Erstaunen setzenden Aufwande, aus dem Deutschen Reiche, wo es die Landesfürsten nicht gestatten wollten, nicht ohne Gewaltsamkeit und List zusammenbrachte. Noch waren aber nicht alle Gebiete geschlossen; als Kurfürst hatte der König das Recht, in den Reichsstädten und deren Bezirken zu werben, und es fehlte in Deutschland an solchen nicht, welche das Kriegshandwerk liebten und sich gern für einen Dienst anwerben ließen, wo man gut bezahlt und gut gehalten wurde. Dadurch gewann die Armee einen allgemein deutschen Bestandteil; die Verbindung der Eingeborenen und der Angeworbenen erweckte zwischen ihnen Wetteifer und gegenseitige Aufsicht; sie verwuchsen in der strengen Schule militärischer Einübung ineinander.
Es würde jenseit unserer Grenzen liegen, wollten wir entwickeln, wie diese beschaffen war, wie die beiden großen Exerzitienmeister, der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau auf jener kleinen Wiese zu Halle und der König selbst in seinem spartanischen Potsdam walteten, jener den ersten Grund zu legen, dieser die weitere Ausbildung hinzuzufügen. Denn dazu hauptsächlich diente das Regiment der großen Leute in Potsdam, um jede nötig scheinende Veränderung zu erproben und zu vollkommener Fertigkeit auszubilden. Oft schickten die anderen Regimenter ihre Offiziere nach Potsdam, um sich durch Anschauung anzueignen, was sich aus den Instruktionen nicht ergab. Die Hauptsache war Gleichschritt und rasches Feuern; wie der König es einmal ausdrückt: »Geschwinde laden, geschlossen antreten, wohl anschlagen, wohl in das Feuer sehen, alles in tiefster Stille.« Jenen tiefen Kolonnen gegenüber, in welchen einst die spanische Schlachtordnung vorrückte, hatten die ihnen widerstehenden Heere eine breite Front eingerichtet, weniger ausgesetzt der Gewalt des Geschützes und wirksamer durch zahlreicheres Schießgewehr. Wenn Muskete und Pike früher nebeneinander erschienen, so besaß man jetzt in Bajonett und Flinte gleichsam eine Verbindung von beiden Waffen. Sehr nützlich erwies sich der eiserne Ladestock, durch dessen stärkeren Stoß die Patrone auf einmal festgesetzt wurde, während sonst verschiedene Ansätze nötig waren; man zog auch deshalb großgewachsene Männer vor, weil sie zu diesen Handgriffen von Natur geschickter seien. Das ganze Fußvolk der preußischen Armee konnte in vier Linien aufmarschieren, von denen die erste und die letzte aus den größten und stärksten, die beiden mittleren aus etwas minderen, aber immer noch starken und großen Leuten bestanden. In ihren Fahnen sah man den nach der Sonne gerichteten Adler; sie machten einen überaus kriegerischen und militärisch furchtbaren Eindruck. »Freunde und Feinde«, sagt Fürst Leopold in einem seiner Briefe, »bewundern Ew. Majestät Infanterie; die Freunde sehen sie für ein Wunderwerk an, die Feinde mit Zittern.«
Die Führer dieser Scharen, deren Tagewerk es bildete, die Übungen durchzumachen und den Neueingestellten einzuprägen, waren bei weitem zum größten Teile die eingeborenen Landedelleute. Bei einer Aufzählung des pommerschen Adels vom Jahre 1724 wird die Bemerkung hinzugefügt, daß er mit wenigen Ausnahmen aus lauter Offizieren bestehe, die noch dienten oder doch gedient hätten. Eine der vornehmsten Bemühungen Friedrich Wilhelms war nun, sich ein durch und durch lebendiges, brauchbares Offizierkorps zu bilden. Wie sehr ward eben damals im österreichischen Dienste geklagt, daß man die Offizierstelle nicht allein durch Kauf erwerbe, sondern sogar wieder verkaufen könne; man sehe sie nicht als eine Ehre an, sondern als einen Besitz, den man veräußern dürfe; auch wo das nicht geschehe, trete doch überall der verdiente und bewährte Mann vor einem jungen vornehmen Emporkömmling im Dienste zurück. Auch in der preußischen Armee galt früherhin das allgemeine Herkommen, daß die Stellen der unteren Offiziere von den Obersten besetzt, nach ihrem Gutdünken Fähnriche zu Leutnants, diese zu Hauptleuten befördert wurden; zu den Stellen der Stabsoffiziere blieb die Ernennung dem Könige vorbehalten, doch hatten sie auch bei diesen den Vorschlag. Friedrich Wilhelm nun zog alle Ernennungen an sich, nicht allein, weil er selber überall Herr sein wollte, sondern auch, weil er es für wichtig hielt, die erste Anstellung, auf der alles folgende beruht, nicht dem Zufall oder persönlichen Rücksichten zu überlassen, sondern nach eigenem Ermessen darüber zu verfügen. Die jungen Edelleute, welche als Freikorporals bei den Regimentern eintraten, bildeten die Pflanzschule seiner Offiziere; sie wurden hier zur größten Sorgfalt in wesentlichen und unwesentlichen Dingen angehalten, für jedes Versehen mit der strengsten Ahndung, ja Züchtigung belegt; wenn der König zu dem Regiment kam, erkundigte er sich nach ihren Eigenschaften, ließ sie sich vorstellen, bis der glückliche Tag erschien, wo der junge Mann zum Fähnrich angenommen wurde und das Feldzeichen empfing, das er niemals verletzen lassen durfte, und das ihn in gewissem Sinne unverletzlich machte. Der König wollte nur solche anstellen, die das Exerzitium gut verstanden, keine Ausschweifungen begingen, erträgliche Wirtschaft führten und sich auch äußerlich gut ausnahmen. Davon hing auch ihre fernere Beförderung ab. Die Konduitenlisten verzeichneten Jahr für Jahr, wie sich jeder in bezug auf Religion, sein ganzes Hauswesen und den Dienst gezeigt, ob er Kopf habe oder nicht. Aber das Verdienst der Führer selbst gab der Zustand der Regimenter bei der jährlichen Musterung vor den Augen des Königs Zeugnis. Es mag kleinlich erscheinen, wenn nun z. B. bei der Uniform alles und jedes bis aufs geringste vorgeschrieben war, wie groß die Manschetten, wie breit die Halsbinde sein, wieviel Knöpfe die Stiefeletten haben, wie lang das Zopfband fliegen solle. Doch hat dies außer der für das Auge gewünschten Gleichförmigkeit noch den Grund, daß hier in der Armee jeder Unterschied aufhören, nur der Rang im Dienst etwas gelten sollte. Die verschiedenen Rangklassen gingen hauptsächlich nur untereinander mit einer gewissen Vertraulichkeit um. Wie hätte man dulden können, daß ein Abstand zwischen Reich und Arm sich irgendwo hätte kundgeben dürfen! Friedrich Wilhelm wollte nicht leiden, daß jemand außer dem Dienste in bürgerlicher Kleidung einherging; seit dem Jahr 1725 hat er die Uniform allzeit getragen. Man weiß, wie hoch er den Soldatenrock schätzte. Wie in Dresden, so mißfiel ihm auch in Hannover nichts mehr, als daß man dort den Rang nach dem Dienste bei Hofe abmesse: ein General oder Oberster sei wenig angesehen, wenn er nicht zugleich eine Hofcharge habe; ein Jagdjunker gelte mehr als ein Brigadier. Ihm dagegen ging der Waffendienst über alles. Von sich selbst anfangend, rief er in den Offizieren ein Gefühl für den Stand hervor, so daß die Tüchtigkeit im Dienst als der vornehmste Wert des Mannes erschien, die Unterordnung beinahe wie eine Naturnotwendigkeit, die Pflicht als Ehre.
In dem Soldaten suchte er vor allem religiöse Gesinnung zu pflegen. Eine ansehnliche Zahl von Feldpredigern, getrennt von der kirchlichen Verfassung des Landes und für sich in ein besonderes System vereinigt, waren im Heere wirksam, und der König kam ihnen mit Eifer zu Hilfe. Unter anderem ließ er Exemplare des Neuen Testaments mit einem Anhange von Gesängen an die Kompagnien verteilen; er verordnete, daß man beim Gottesdienst nur eben diese Lieder singe, damit der Soldat sich daran gewöhne, sie auswendig lerne. Noch entwickelte man die rechten Eigenschaften eines Kriegsmannes an den Beispielen des Alten Testaments, an Benaja, der mit seinem Stecken den wohlbewaffneten Ägypter erschlägt, oder an Samma, der mitten unter dem fliehenden Volk sein Ackerstück gegen den Feind verteidigt. An den ältesten Urkunden der menschlichen Geschichte nährte sich die künftige Tapferkeit des preußischen Heeres.
Welch eine ganz andere Bedeutung bekam nun die ländliche Bevölkerung, die bisher allein dazu geboren zu sein schien, den Acker zu bauen und untergeordnete Dienste zu leisten, durch ihre Teilnahme an der kriegerischen Haltung des Staates und ihre Unentbehrlichkeit dafür! Der Mensch erhielt einen höheren Wert, sobald er durch sein bloßes Dasein in unmittelbare Beziehung zur höchsten Gewalt trat. Wie weit entfernt von persönlicher Untertänigkeit ist der militärische Gehorsam, dessen Vollziehung persönliche Tüchtigkeit erfordert und der im Bewußtsein der allgemeinen Regel gegründet ist!
Die Aufstellung eines Heeres, wie groß auch immer, bedeutete noch nichts, wenn man nicht ohne fremde Hilfe die Mittel besaß, es jeden Augenblick ins Feld zu führen. Der vornehmste Erfolg der sparsamen Verwaltung Friedrich Wilhelms lag nun aber darin, daß seine Streitmacht allein auf die eigenen Erträge des Landes begründet ward. Was ist der Sinn einer Macht, als daß sie sich frei, nach ihrem eigenen Triebe und Entschlusse bewegen kann? Eben dies war der Zweck und auch der Erfolg des ganzen Systems.
L. Ranke, Neun Bücher preußischer Geschichte.
Von Adalbert Kühn.
König Friedrich Wilhelm I. ging gern in den Straßen Berlins umher, um das Leben und Treiben der Einwohner genauer kennen zu lernen, und besonders gefiel es ihm wohl, wenn er alles recht geschäftig und tätig fand. So trat er auch einst in die ärmliche Hütte eines Goldschmieds in der Heiligen-Geist-Straße, den er schon mehrere Male bis zum späten Abend tätig gefunden, von dem er aber auch zu gleicher Zeit bemerkt hatte, daß er bei rastloser Arbeit nur wenig vorwärts kam. Der König ließ sich nun in ein Gespräch mit dem Manne ein und erfuhr, daß er gern noch mehr arbeiten würde, wenn es ihm nicht gar zu oft an Geld fehlte, um das nötige Gold und Silber zu kaufen. Da befahl ihm der Monarch, ein goldenes Service zu fertigen, und ließ ihm dazu das Metall aus der Schatzkammer liefern. Mehrmals besuchte er ihn nun während der Arbeit und freute sich über die Geschicklichkeit und den Fleiß des Mannes. Als er so auch eines Tages bei ihm weilte, bemerkte er an einem Fenster des gegenüber gelegenen Hauses zwei Frauen, die dem am offenen Fenster arbeitenden Goldschmied, sobald er nur aufsah, die abscheulichsten Gesichter zogen, und erfuhr auf sein Befragen, daß dies die Frau und Tochter eines reichen Goldschmieds seien, die ihm ihren Neid über sein unverhofftes Glück auf diese sonderbare Meise kund gäben. Da beschloß der Monarch, die Mißgunst der Weiber zu strafen, indem er dem Goldschmied nach einiger Zeit ein ganz neues Haus bauen und daran den Neidkopf anbringen ließ, so daß sie nun, wenn sie aus dem Fenster sahen, das Bild ihrer eigenen verzerrten Züge stets darin erblicken konnten. Dieser Neidkopf ist nämlich der Kopf einer Frau, den Schlangen statt der Haare umwinden, und in seinen Zügen ist Neid und Mißgunst auf die widrigste Weise ausgeprägt. Das Haus, welches der König dem Goldschmied bauen ließ, sowie der daran angebrachte, aus Stein gemeißelte Kopf sind noch vorhanden, und wer es sehen will, der gehe nach der Heiligen-Geist-Straße Nr. 38.
A. Kühn. Märkische Sagen und Märchen. (Berlin. G. Reimer.)
Von Dr. Heinrich Pudor.
Auf wenigen Kunstgebieten sind in den letzten Jahrzehnten so tiefgreifende und auch in technischer Beziehung so tief einschneidende Neuerungen zutage getreten, wie in der Keramik. Während man sich früher begnügt hatte, auf der fertigen Vase den Dekor aufzumalen, so daß das, was an der Vase keramisches Produkt war, mit dem malerischen Dekor so gut wie gar nichts zu tun hatte, begann man nach dem Vorgange der Japaner, denen zuerst die königlich dänische Porzellanmanufaktur Gefolgschaft leistete, die Farbe unter der Glasur aufzutragen und die gemalte Vase nochmals zu brennen, so daß die Farbe in die Masse hineinsank und mit ihr verschmolz und eins wurde, mithin von einem Auseinanderfallen von Vase und malerischem Dekor also nicht mehr die Rede war. Was die Farben betrifft, so lag dabei eine große Schwierigkeit vor, indem nur die matte Nuance eine so große Hitze, wie sie der zweite Brand erfordert, aushalten konnte. Die Japaner hatten zwar schon in der Mingperiode es verstanden, auch rote Glasuren herzustellen, und fast alle größeren Kunstmuseen weisen Beispiele davon auf. In Europa dagegen ist es erst in den letzten Jahrzehnten gelungen, auch das Rot für Malerei unter der Glasur zu verwenden. Sowohl die skandinavischen Manufakturen wie die Sevres-Manufaktur und die königlich sächsische Manufaktur haben dabei Erfolg gehabt. Ein weiterer Fortschritt bestand darin, daß man lernte, die sogenannte Kristallglasur herzustellen, bei welcher Metallsäuren unter langsamer Abkühlung zum Erstarren gebracht werden.
Der Berliner königlichen Porzellanmanufaktur sind die angeregten Neuerungen verhältnismäßig schwer gefallen, und spät erst konnte sie sich entschließen, zur Unterglasurmalerei überzugehen. Heute aber vermag sie den Wettstreit mit allen anderen großen inländischen und ausländischen Manufakturen aufzunehmen – ja, sie hat es darüber hinaus verstanden, auf sehr wichtigen Gebieten mit Geschick sogar die Initiative zu ergreifen. Zuvor aber wollen wir auf die Geschichte der Manufaktur einen Blick werfen.
Die Geschichte der Berliner königlichen Porzellanmanufaktur geht auf das Jahr 1750 zurück, in welchem der Kaufmann Wegely auf einem Grundstücke der Neuen Friedrichstraße eine Porzellanmanufaktur errichtete. Die Porzellanfabrikation gehörte zu jener Zeit noch zu den streng gewahrten Geheimnissen. Wegely war in den Besitz der Herstellungsvorschriften durch Angestellte Ringlers, des Gründers mehrerer Porzellanfabriken, gelangt, dieser wieder hatte sie mittelbar – ebenfalls durch Vertrauensbruch eines Angestellten – aus der Meißener Manufaktur erhalten. Wegely gab indessen im Jahre 1757 die Porzellanfabrikation wieder auf und wandte seine Tätigkeit einem anderen Gebiete zu. Vermutlich war sie ihm nicht einträglich genug, da der Mangel an technischen Hilfsmitteln zu jener Zeit die Fabrikation weit schwieriger gestaltete als heute. Auch konnte das Porzellan als Gebrauchsgeschirr beim großen Publikum damals infolge seines noch hohen Preises nicht in Betracht kommen, und da auch die Kriegsunruhen auf das gesamte Geschäftsleben einwirkten, blieb der Absatz beschränkt.
Aus der Wegelyschen Fabrik ging der Bildhauer und Modelleur Reichard hervor, welcher in letzterer Eigenschaft in dieser Fabrik tätig gewesen war. Dieser fing ebenfalls, nachdem er sich die Rezepte aus Sachsen verschafft hatte, eine Porzellanfabrik in Berlin an, konnte sie indessen wegen Mangel an Mitteln nicht weiterführen und verkaufte sie im Jahre 1761, und zwar an den bekannten Gotzkowsky. Reichard blieb als technischer Leiter tätig und verkaufte auch sein Geheimnis gegen eine hohe Summe an den neuen Besitzer. Gotzkowsky verstand es, durch hohe Jahresgehälter die tüchtigsten Fachleute heranzuziehen und den berühmten Emailmaler Jacques Clauce und den Modelleur Elias Meyer aus Meißen als Leiter der Spezialabteilung zu gewinnen. Die gesamte Oberleitung der Fabrik übertrug Gotzkowsky jedoch noch im gleichen Jahre dem Kommissionsrat Grieninger. Da Grieninger aber mit der Fabrikation nicht vertraut war und da auch sonstige Mängel in der Organisation obwalteten, hatte er im Anfang mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch die technische Abteilung bedurfte wesentlicher Verbesserungen. Die damals gebrauchten Öfen erfüllten die Anforderungen der Porzellanfabrikation nur sehr mangelhaft, und die Herstellung der Farben stieß auf erhebliche Schwierigkeiten. Diese Fehler erkannte man sehr wohl und ließ es auch nicht an Versuchen zur Beseitigung fehlen. Andauernder Fleiß setzte Gotzkowsky in die Lage, Friedrich dem Großen in seinem damaligen Hauptquartier zu Leipzig einige gut ausgeführte Tassen zu überreichen, die größten Beifall des Königs wie auch anderer Sachkenner fanden. Die Porzellanerde bezog die Fabrik aus Passau, die Zutaten wie Feldspat, Sand, Gips usw. aus der Umgegend Berlins. Die Porzellane jener Zeit sind grau oder gelblich und zum größeren Teile mit einem G auf dem Boden gezeichnet.
Da Gotzkowskys Tätigkeit sich nicht auf die Porzellanfabrikation beschränkte und seine Barmittel noch auf anderen Gebieten stark in Anspruch genommen wurden, brachten ihn die damaligen Kriegsunruhen häufig in Geldverlegenheiten, so daß er in seinen Vermögensverhältnissen ziemlich schnell zurückkam. Im Jahre 1763 bereits sah er sich genötigt, seine Zahlungen einzustellen, und er bot dem Könige seine Fabrik zum Kaufe an. Friedrich der Große erwarb daraufhin die Fabrik am 8. September 1763 als sein Eigentum gegen die Summe von 225 000 Reichstalern. Der reelle Wert der Fabrik einschließlich aller Warenvorräte und Materialien soll indessen nur etwa den dritten Teil betragen haben, und man schreibt es hauptsächlich dem Edelsinn des Königs zu, daß er die Manufaktur für diesen Preis erwarb. Gotzkowsky hatte sich sehr verdient gemacht, und der König wollte ihn deshalb in den Stand setzen, seinen Verpflichtungen seinen Gläubigern gegenüber nachzukommen. Auch fand der König großen Gefallen an gutem Porzellan und mochte deshalb die Fabrikation echten Porzellans in seinem Lande nicht wieder eingehen lassen. Gotzkowsky beschäftigte sich darauf mit Alchimistik, fiel in die Hände von Betrügern und verlor auf diese Weise den Rest seines Vermögens.
Bei der Übernahme der Fabrik durch den König wies sie einschließlich der Beamten ein Personal von 146 Köpfen auf. Die Beamten wurden sämtlich in ihren seitherigen Funktionen belassen, Grieninger behielt die Direktion und war somit der Chef der Manufaktur. Bald sah man sich aber genötigt, die Räume und Brennöfen der Fabrik zu vergrößern. Zu diesem Zwecke ließ der König bei der Kasse der Kurmärkischen Landschaft eine Anleihe von 140 000 Talern aufnehmen, welche Summe in den späteren Jahren aus den erzielten Überschüssen zurückgezahlt wurde. Bereits im Jahre 1771 arbeitete die Fabrik mit zehn Öfen und beschäftigte mehr als 400 Personen. Das Interesse des Königs für die Fabrik war sehr lebhaft, er besuchte sie oft und machte häufig Bestellungen und Ankäufe. Auch hielt er mit seinem Urteil über die Leistungen nicht zurück, er kargte weder mit dem Lobe, wo er es angebracht fand, noch mit dem Tadel bei Dingen, die ihm mißfielen. Aber ebenso wie er dahin wirkte, den Ruf der Manufaktur durch hervorragende Leistungen zu heben, stand er dem materiellen Ergebnis nicht gleichgültig gegenüber. Um den Absatz zu heben, ließ der König Zweigniederlassungen in Königsberg, Breslau, Magdeburg, Stettin, Halle, Minden und Emmerich einrichten. Der Umsatz der Manufaktur betrug in der Periode vom 24. August 1763 bis 31. Mai 1787 2 188 339 Taler 23 Silbergroschen 6 Pfennige, der Reingewinn 464 050 Taler 7 Silbergroschen 6 Pfennige, welcher Betrag der Königlichen Kasse zufiel.
Die Form und Dekoration der Porzellane wandte sich in dieser Zeit vornehmlich dem Rokoko zu. Erfreute sich doch dieser Stil gerade bei Hofe einer außerordentlichen Gunst. Er eignete sich auch besonders gut für Porzellangegenstände, da er dem Modelleur eine ziemlich große Freiheit in der Formendarstellung bot und den Maler befähigte, mit glänzenden Farben ziemlich unbeschränkt zu malen. So erregen denn auch noch heute die Porzellane jener Periode die Bewunderung des Sammlers und Kunstkenners, wie das Lob des Technikers. Die zahlreichen Porzellane, welche die Potsdamer Schlösser in Nachbildungen zeigen, die zierlichen Figürchen, Vasen, Schmuckstücke und Gebrauchsgegenstände geben Zeugnis von der hohen Entwicklung der damaligen Manufaktur. Als besonders beachtenswert sind anzuführen die beiden großen Spiegelrahmen aus weißem Porzellan in Sanssouci und ein großer Tafelaufsatz, den der König als Geschenk für die Kaiserin Katharina von Rußland anfertigen ließ.
Von Albert Naudé.
Nach der Niederlage bei Kolin von den österreichischen Heeren aus Böhmen zurückgedrängt, bemühte sich König Friedrich im August 1757 vergeblich, den Prinzen von Lothringen zu einer Schlacht in der Lausitz zu bewegen. Bald nötigte den König die große Zahl seiner Gegner, einen anderen gefährdeten Schauplatz aufzusuchen. Franzosen und Reichsarmee waren bis gegen Leipzig vorgedrungen. Friedrich entschloß sich zu einer Teilung seiner Streitkräfte. Während der Herzog von Bevern mit der ehedem vom Feldmarschall Schwerin, später vom Prinzen von Preußen befehligten schlesischen Armee in der Lausitz verblieb, wendete sich der König mit den übrigen Truppen gegen den von Westen andringenden Feind.
Das Kurfürstentum Sachsen mit der Elblinie und dem starken Stützpunkte in Dresden blieb auch im Monat September nach wie vor die preußische Operationsbasis, aber die an der Ost- und Westgrenze Sachsens kämpfenden Heere zogen sich im Laufe der folgenden Wochen sehr auseinander. Durch weite Flügelausdehnung wurde die Mitte, Sachsen und die Lausitz, fast gänzlich von preußischen Truppen entblößt, zu dem Innern des preußischen Staates wurde dem Gegner von Böhmen her ein unbewachter Zugang erschlossen. König Friedrich verkannte das Bedenkliche dieser Gestaltung der Dinge keineswegs. Aber durch die Entsendung des Prinzen Moritz von Dessau hielt Friedrich die Kurmark und die Landeshauptstadt Berlin für hinreichend nach Süden gedeckt, und in der Tat hätte eine Abteilung des regulären österreichischen Heeres schwerlich nach Norden vorgehen können, ohne von dem Prinzen Moritz in der Flanke gefaßt zu werden. Die Lausitz aber war überfüllt von leichten Truppen der Österreicher, welche die Verbindung zwischen dem Herzoge von Bevern und Dresden fortdauernd erschwerten und mannigfachen Schaden im einzelnen anrichteten. Über diese »charmante Kanaillen«, dieses »Geschmeiße von die Grasteufels« machte Friedrich zwar häufig in derben Worten seinem Unmut Luft; aber daß diese Kroaten und Panduren auch weit größeres vermöchten als Proviantwagen zu plündern, daß sie durch die Abwesenheit aller preußischen Truppen auf dem Wege von der Niederlausitz nach Berlin zu einem raschen Vorstoß in das Herz des preußischen Staates ermutigt werden könnten, daran wollte der König zunächst trotz mancher drohenden Anzeichen nicht glauben.
Es ist das Verdienst des Prinzen Karl von Lothringen gewesen, die Unternehmung gegen Berlin angeregt zu haben. Der Prinz fand für die Ausführung seiner Pläne eine geeignete Kraft an dem Ungarn Andreas von Hadik. Mit großem Geschick wußte dieser kühne Parteigänger den Streifzug vorzubereiten und durchzuführen. Von Elsterwerda auf der Poststraße zwischen Berlin und Dresden setzte sich Hadik am 11. Oktober mit 3400 Mann, zumeist leichten Truppen, in Bewegung. In schnellen Märschen durchzog er die Niederlausitz, den Spreewald und die königlichen Forsten von Wusterhausen und traf am 16. eines Sonntags vormittags im Südosten Berlins vor dem Schlesischen Tore ein. Um die Bestürzung unter der hauptstädtischen Bürgerschaft zu vermehren, hatten 300 Husaren einen weiter westlich gelegenen Weg eingeschlagen; sie erschienen gleichzeitig vor dem Potsdamer Tore und nisteten sich, ihre geringe Zahl verbergend, in dem Garten der Akademie ein, dem nun zerstörten alten Botanischen Garten.
Die Stadt Berlin war auf eine ernstliche Verteidigung nicht vorbereitet. Die alten Mauern und Tore, sowie die von der Spree abgezweigten Kanäle vermochten einen energisch auftretenden Feind nicht zurückzuhalten. Wohl waren in Berlin ziemlich 4000 Mann Besatzung, aber als Soldaten konnte man einen großen Teil dieser Leute kaum bezeichnen. Da war ein neuerrichtetes Landregiment von sieben Kompagnien, »die Krazianer« hieß es im Munde des Volkes; seine Mannschaften, mit schlechten Gewehren versehen und auf das dürftigste gekleidet, bestanden zumeist aus alten, schwachen Leuten. Weiter die kümmerlichen Reste eines ehemals sächsischen Regiments, das vor just einem Jahre, am 16. Oktober 1756, in ein preußisches mit Namen »von Loen« umgewandelt worden war. Als besonders unzuverlässig hatte der König im März 1757 dieses Regiment aus Sachsen entfernen und nach Berlin führen lassen; auf dem Marsche war die geplante Empörung zum Ausbruch gekommen, der größte Teil der Mannschaft durchgegangen; jetzt, während des Gefechts mit Hadik, folgten weitere 150 der Sachsen dem im Frühjahr von ihren Kameraden gegebenen Beispiel. Ferner befanden sich in Berlin die noch nicht eingestellten Rekruten verschiedener Regimenter (Bornstedt, Kannacher, Münchow, Baireuth werden genannt), junge Leute, fast alle unter 20 Jahren, die soeben vom Pfluge fortgeholt, zumeist noch keinerlei militärische Ausbildung genossen hatten. Die Rekruten vom Baireuther Dragonerregiment liefen mit ihren Karabinern in Kitteln umher. Es wird erzählt, man habe im letzten Augenblick von den Brauern in Berlin die Pferde requiriert, um die Nachfolger der Hohenfriedberg-Sieger wenigstens beritten zu machen, aber bald habe man sich eines besseren besonnen und die Pferde ihrem friedlichen Lebensberufe zurückgegeben, denn die Dragoner hätten das Reiten ja doch nicht verstanden und mit ihren Brauerrossen die allgemeine Verwirrung nur noch vergrößert. Von der Berliner Besatzung blieben als einzige wirklich brauchbare Truppen die zwei Bataillone vom Langeschen Garnisonregiment.
Trotzdem hätte selbst mit diesen unzureichenden Streitkräften die Stadt wenigstens vierundzwanzig Stunden gehalten werden können, bis der, wie man wohl wußte, vom Könige gesandte Ersatz unter dem Prinzen Moritz von Dessau eintraf. War man doch noch immer um etliche hundert Mann stärker als der Feind, welcher großenteils aus Kroaten und Husaren bestand, und zeigten doch von der Besatzung viele, besonders einige Offiziere, den besten Willen, für die Verteidigung der Residenz jeden Kampf aufzunehmen. Es ist, hierüber kann kein Zweifel obwalten, die Hauptschuld an dem Unglück der verzagten und unentschlossenen Haltung des Kommandanten, des Generals v. Rochow, beizumessen; schon die Zeitgenossen haben übereinstimmend in diesem Sinne geurteilt. Hans Friedrich v. Rochow hatte im Potsdamer Garderegiment unter König Friedrich Wilhelms eiserner Zucht seine militärische Laufbahn begonnen, er war hier bis zum Hauptmann aufgestiegen. König Friedrich hatte den Offizier, der eine so gute Schule durchgemacht, zuerst schnell befördert; 1740 finden wir ihn sogleich als Oberst bei einem der neu errichteten Regimenter (Ferdinand von Braunschweig), 1744 als Kommandanten der wichtigen Festung Neiße. Bald darauf aber war v. Rochow als Generalmajor verabschiedet worden. Als der Siebenjährige Krieg ausbrach und jedermann, der zum Felddienst tüchtig war, in den Kampf hinauszog, hatte der König zunächst dem Generalleutnant v. Wartensleben die Stelle des Kommandanten von Berlin zugedacht; erst in zweiter Linie, als v. Wartensleben durch Krankheit verhindert wurde, richtete der König sein Augenmerk auf v. Rochow, der sich bereits körperlich sehr hinfällig zeigte. Wenige Tage vor dem Ausmarsch der Berliner Garnison war v. Rochow mit dem Range eines Generalleutnants zum Kommandanten der Hauptstadt ernannt worden.
Man war Mitte Oktober 1757 in Berlin keineswegs ohne jede Kenntnis von dem Vorhaben der Österreicher geblieben. Schon am 14. Oktober hatte Graf Finckenstein beunruhigende Meldungen empfangen. Die Minister des auswärtigen Departements und des Generaldirektoriums trafen alsobald ihre Vorkehrungen, ganz besonders Graf Finckenstein, welchen der König für den Fall eines Angriffes auf die Hauptstadt mit einer diktatorischen Gewalt für alle Zivilangelegenheiten betraut hatte, und dem sämtliche andere Minister, sowie die Gerichts- und Hofbeamten zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet waren. Bereits am 15., am Sonnabend, ließ Graf Finckenstein die beiden jungen Prinzen, den nachmaligen König Friedrich Wilhelm II. und seinen Bruder Heinrich, mit ihrem Gouverneur v. Borcke nach der Festung Spandau abgehen. Der Schatz, die verschiedenen Staatskassen, die Kronkleinodien, das Silbergeschirr und unter den geheimen Akten des Staatsarchivs in erster Linie die Papiere des jüngst verstorbenen Generals v. Winterfeldt, alle diese Gegenstände waren bereits seit Wochen für die Fortschaffung nach Küstrin und Magdeburg ausgesondert und verpackt worden; sie fanden nunmehr in der Zitadelle von Spandau eine für die augenblickliche Gefahr näher gelegene Zufluchtsstätte.
Inzwischen blieb die militärische Oberbehörde, vom Kommandanten v. Rochow repräsentiert, welche ein feindlicher Angriff auf Berlin doch am ersten anging, vollkommen untätig. Obschon am 15. immer neue, immer zuverlässigere Nachrichten einliefen, daß die österreichischen Abteilungen bereits bis Wusterhausen und Mittenwalde, drei bis vier Meilen von Berlin, vorgedrungen seien, erklärte v. Rochow diese Angaben für unbegründet und ließ keinerlei Vorbereitungen zu einem wirksamen Empfange der Österreicher treffen.
Bald nach der Ankunft vor dem Schlesischen Tore sandte Feldmarschalleutnant Hadik einen Trompeter an den Berliner Magistrat ab und forderte binnen 24 Stunden die Zahlung einer Kontribution von 300 000 Talern, vor Ausgang einer Stunde sollten vier Deputierte die Antwort des Magistrats überbringen. Noch war der Trompeter nicht zurückgesandt, da schritt Hadik bereits zum Sturm gegen die mit nur geringer Mannschaft besetzte Brücke am Landwehrgraben und gegen das Schlesische Tor. Mit Leichtigkeit wurden, gegen ½2 Uhr des Mittags, die ohne jede Unterstützung gebliebenen Brücken- und Torwachen von den Österreichern überwältigt. Erst als Hadik auf dem freien Felde innerhalb der Ringmauer gegen das Kottbuser Tor vorrückte, trat ihm ein etwas ernsterer Widerstand entgegen. Aber es waren keineswegs zwei schwache Bataillone, wie Hadik rühmte, sondern nur etwa 400 Mann vom Langeschen Garnisonregiment, des Krieges unkundige Leute, ohne Geschütze, ohne Reiterei. Schlecht geführt, nahmen sie in der Nähe des Itzigschen Gartens eine höchst ungünstige Stellung auf freiem Platze, ohne jede Flügelanlehnung, ein. Von der zahlreichen österreichischen Kavallerie, deutschen Reitern und Husaren, wurde die kleine Schar umzingelt, die einen niedergehauen, die andern gegen die Stadtmauer getrieben und nach tapferer Gegenwehr zu Gefangenen gemacht. Eine zweite Abteilung, welche der Kommandant wiederum zu spät und wiederum in zu geringer Zahl entgegenschickte, wurde am Kottbuser Tore von den Österreichern angegriffen; die Loenschen Sachsen gingen sofort zum Feinde über, die preußischen Rekruten erlagen nach kurzem Kampfe der Übermacht.
So war die Köpenicker Vorstadt den Österreichern in die Hände gefallen. Hiermit aber hatten die Erfolge Hadiks bereits ihr Ende erreicht. Der österreichische General wagte es nicht, in das Innere der Stadt einzudringen. Er mußte befürchten, wenn die geringe Stärke seiner Truppenmacht bekannt wurde und die Soldaten sich in die weitläuftige Stadt zerstreuten, daß alsdann die Bürgerschaft sich ermannen und zum Widerstande aufraffen könnte. Diese Besorgnis war wohl auch der vornehmste Beweggrund, welcher den Ungarn eine ziemlich strenge Disziplin beobachten ließ und eine allgemeine Plünderung verhinderte. Es kam hinzu, daß Hadiks Stunde bereits geschlagen hatte. Er, der besser als der preußische Kommandant über den eiligen Heranmarsch des Prinzen Moritz unterrichtet war, er sah wohl ein, daß spätestens in zwölf Stunden die Vorstadt von ihm wieder geräumt werden mußte. Deshalb stellte Hadik zwar an den Magistrat die erneute Forderung, sogar 600 000 Taler Brandschatzung und zur Befriedigung der Truppen noch weitere 50 000 Taler zu zahlen, begnügte sich aber gleich darauf mit der verhältnismäßig geringen, noch nicht einmal die erste Forderung erreichenden Summe von 200 000 plus 15 000 Talern. Schon um vier Uhr in der folgenden Nacht zum Montag hielt es Hadik für geboten, den Heimweg anzutreten.
Auch während der Bestürmung hatte der Stadtkommandant v. Rochow ebenso wie vor der Ankunft der Österreicher seine Pflichten gröblich vernachlässigt.
Um zehn Uhr vormittags ließ der Minister Graf Finckenstein die Königin ersuchen, die Prinzessinnen für die Abreise um sich zu versammeln. Während Wagen und Pferde in Bereitschaft gebracht werden, erfährt v. Rochow, daß der Feind nicht so stark sei, als man anfänglich ihn ausgegeben. Er verschiebt nun den Aufbruch der königlichen Familie, ohne indes für die Verteidigung des angegriffenen Stadtteils etwas zu unternehmen. Als der Feind am Mittag bereits eine halbe Stunde die Köpenicker Vorstadt in Besitz genommen, versteht v. Rochow sich zu der endlichen Abreise des königlichen Hofes. Wenigstens wäre es nun die Pflicht des Kommandanten gewesen, mit ganzer Macht dem eingedrungenen Feinde entgegenzutreten und ihn so lange in der äußeren Stadt festzuhalten, bis die Prinzessinnen durch das unbedrohte nordwestliche Spandauer Tor entkommen waren. Statt dessen sendet v. Rochow zwei unbedeutende Abteilungen nach der Köpenicker Vorstadt, die einzeln und getrennt, so wie sie ankamen, dem sicheren Verderben anheimfallen mußten. Andererseits ist es aber auch Fabel, daß der General v. Rochow die gesamte Garnison benutzt habe, um die königliche Familie sicher nach Spandau zu geleiten. Er ließ vielmehr den Hof und die Minister unter einer geringen Eskorte nach Spandau abgehen und stellte sich selbst mit der Hauptmacht der Besatzung, ohne nach irgendeiner Seite etwas Entscheidendes zu beginnen, im Lustgarten auf. Es kann keinem Zweifel unterliegen: wären die Österreicher in größerer Stärke aufgetreten, hätten sie sogleich in das Herz der Stadt eindringen oder durch den Tiergarten Mannschaften gegen die Spandauer Landstraße vorsenden können, so hätten die königliche Familie und sämtliche Minister dem Feinde ohne weiteres in die Hände fallen müssen. Welche Verwirrung in der Umgebung des Kommandanten herrschte, lehrt die Erzählung eines Augenzeugen, eines vierzehnjährigen Gymnasiasten. Der Junge konnte sich ungehindert in den Palast und in das Zimmer eindrängen, wo der Kommandant mit seinen Offizieren Beratung hielt, und konnte die Worte des Generals hören. Durch körperliches Leiden am Reiten gehindert, ging v. Rochow zu Fuß nach dem Lustgarten: um ihn herum, vor und hinter ihm strömten, gleich wie bei einer Wachtparade, Scharen von Gassenjungen, unser vorwitziger Gymnasiast »so nahe, daß ich befürchten mußte, ihm in den Rücken gestoßen zu werden«. Durch Scheltworte suchte der Kommandant die Leute sich vom Halse zu halten.
Ohne zu einem Entschluß gelangen zu können, verharrte v. Rochow bei der im Lustgarten versammelten Besatzung. Endlich gegen vier Uhr, zwei Stunden, nachdem die Prinzessinnen abgefahren und dritthalb Stunden nach der Erstürmung des Schlesischen Tores, setzte sich die noch immer dem Gegner an Zahl ziemlich gewachsene Garnison in Bewegung, nicht aber, um den Feind von der inneren Stadt zurückzuhalten, – es wäre dies sehr leicht auszuführen gewesen, da die Spreebrücken sämtlich aufgezogen waren, und da das Eintreffen des Prinzen Moritz von den Bürgern stündlich erwartet, von Hadik stündlich befürchtet wurde. Vielmehr folgte v. Rochow nunmehr mit der gesamten Garnison der königlichen Familie nach Spandau und ließ dem General Hadik durch den Platzmajor erklären, daß er die Stadt räume und der Diskretion der Österreicher übergebe. Was wollte v. Rochow in Spandau? Zu eskortieren war nichts mehr, denn der Hof und alle Wagen trafen geraume Zeit vor ihm sicher in der Festung ein. Zur etwaigen Verteidigung der Zitadelle war die Spandauer Besatzung ausreichend. Und wer sollte an das Belagern einer stattlichen Festung durch eine Handvoll Husaren und Kroaten denken, während binnen spätestens 24 Stunden ein preußisches Armeekorps im Rücken der österreichischen Streifpartie erscheinen mußte! Hingegen waren nunmehr die Hauptstadt und ihre reichen Vorräte, der Kriegsbedarf, die Fabriken, die Gelder, der größte Teil der königlichen Behörden, alle diese letzten Mittel des erschöpften Staates waren dem Feinde zur Plünderung und Zerstörung völlig schutzlos ausgeliefert. »Also, daß die ganze Stadt von Garnison nun gänzlich entblößet ist und sich exponieret siehet, von einigen wenigen herumschwärmenden Husaren geplündert zu werden.« Welch schwere Verluste hätten den preußischen Staat treffen können, wenn nicht die Energie des Prinzen Moritz der bedrohten Hauptstadt schon am folgenden Tage die ersehnte Rettung gebracht hätte!
Allerseits war man über das Gebahren des Kommandanten im höchsten Grade entrüstet. Der König äußerte sich in scharfen Ausdrücken über die »schlechte Contenance« des Generals. Die Prinzen des königlichen Hauses und die Behörden hielten mit ihrem Tadel nicht zurück. Der britische Gesandte Mitchell, gewiß ein unparteiischer Zeuge, berichtete an seine Regierung: »Der General v. Rochow hat durch seine Unbesonnenheit und seinen Mangel an Urteil die gesamte königliche Familie der Gefahr ausgesetzt, zu Gefangenen gemacht zu werden, und die Hauptstadt der Gefahr, geplündert zu werden.« Am meisten erbittert waren die zunächst Beteiligten, die Einwohner von Berlin. »Die Bürgerschaft ist sehr gegen den Generalleutnant v. Rochow aufgebracht und vergehen sich um desfalls stark an einem solchen Offizier, den Ew. Königl. Majestät zum Kommandanten gesetzt haben.« Man sah den General als Landesverräter an, die Husaren des Prinzen Moritz mußten ihn vor der Wut des Volkes schützen. »Der General v. Rochow wurde«, so erzählt unser Gymnasiast, »nach seiner Rückkehr aus Spandau von den Gassenjungen verfolgt und mit Steinen geworfen; ›Spion! Spion!‹ schrien sie hinter ihm her, weil sie mit diesem Worte den Begriff eines verabscheuungswürdigen und verfolgungswerten Menschen verbanden.« v. Rochow mußte sich in ein Haus hinter dem alten Packhofe retten und konnte seine danebenliegende eigene Wohnung nur unterm Schutze einer Eskorte von zwanzig grünen Husaren erreichen.
Märkische Forschungen. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. XX. Band. Berlin 1887.
Von Ph. E. Raufseysen
Der Töchter Thüßkons mächtige Königin!
Berlin! du großen donnerbewehrten Thors
und der süß-lächelnd holden Frya
heiliger Tempel! sei mir gegrüßt!
Weit glänzt dein Zepter über die Auen hin –
einst Sand und Wüste; izt ein Arkadien! –
Aus hoher Hayne Labyrinthen
winkt ein Arkadien mir entgegen.
Aus ihrem jungen Schilfe erhebt der Spree
Najade ihr mit Lotus bekränztes Haupt,
und staunt sich an, der Thems und Seine
Nymphen durch sich beschämt zu sehen.
Mit Ehrfurcht tret' ich in deinen Portikus,
wo mir dein Schimmer dämmernd entgegenwallt,
ich seh' in dir Athen und Sparta,
durch der Corinthier Pracht verschönert.
Hier herrschet Friedrich! Er seines Volks Odin!
Hier streuet seine segnende Hand die Saat,
die einst ein künftiges Jahrhundert
Glücklich, und dankbar ihn segnend, erntet.
Raufseysens Gedichte, herausgegeben von G. Danowius. Berlin 1872.
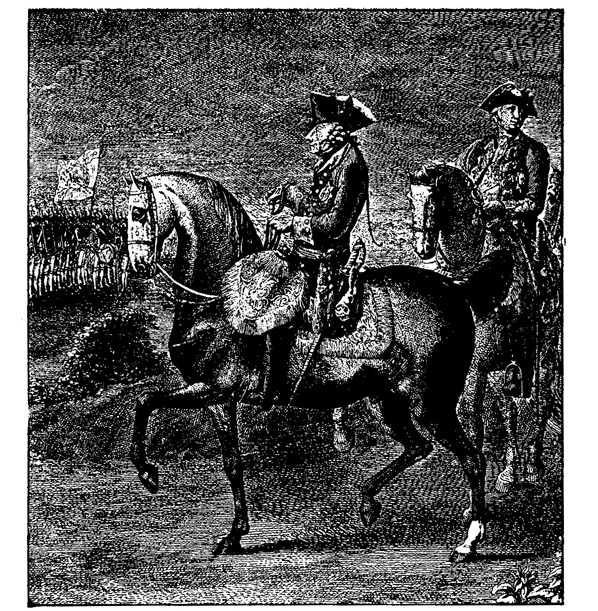
Nach einer Radierung von Daniel Chodowiecki (Ausschnitt).
Es war in Berlin, wo ich den König das drittemal sah, am 21. Mai 1785, als er von einer Revue zurückkehrte. Da man wußte, daß er an einem solchen Tage die Prinzessin Amalie jedesmal besuchte, so hatte mein Hauslehrer mich an das Hallesche Tor geführt. Der König ritt auf einem großen weißen Pferde. Er trug eine einfache blaue Montierung mit roten Aufschlägen und goldenem Achselband, alt und bestaubt, eine gelbe Weste voll Tabak; dazu hatte er schwarze Sammethosen an und einen alten dreieckigen Hut mit der Spitze nach vorn. Hinter ihm ritten eine Menge Generale, dann die Adjutanten, endlich die Reitknechte. Das ganze Rondell (Belle-Alliance-Platz) und die Wilhelmstraße waren gedrückt voll Menschen, alle Fenster voll, alle Häupter entblößt, überall das tiefste Schweigen und auf allen Gesichtern ein Ausdruck voll Ehrfurcht und Vertrauen, wie zu dem geweihten Lenker aller Schicksale. Der König ritt ganz allein voran und grüßte, indem er fortwährend den Hut abnahm. Er beobachtete dabei eine sehr merkwürdige Stufenfolge, je nachdem die aus den Fenstern sich verneigenden Personen es zu verdienen schienen. Durch das ehrfurchtsvolle Schweigen tönte nur der Hufschlag der Pferde und das Geschrei der Berliner Straßenjungen, die vor ihm hertanzten, jauchzten, die Hüte in die Luft warfen oder neben ihm hersprangen und ihm den Staub von den Stiefeln abwischten. Bei dem Palais der Prinzessin Amalie war die Menge noch dichter, der Vorhof gedrängt voll, doch in der Mitte, ohne Anwesenheit irgendeiner Polizei, geräumiger Platz für ihn und seine Begleiter. Er lenkte in den Hof hinein, die Flügeltüren gingen auf; die alte lahme Prinzessin, auf zwei Damen gestützt, die Oberhofmeisterin hinter ihr, wandelte die flache Stiege herab, ihm entgegen. Sowie er sie gewahr wurde, setzte er sich in Galopp, sprang rasch vom Pferde, zog den Hut, umarmte sie, bot ihr den Arm und führte sie zur Treppe hinauf. Die Flügeltüren gingen zu; alles war verschwunden, und noch stand die Menge entblößten Hauptes, schweigend, aller Augen auf den Fleck gerichtet, wo er verschwunden war, und es dauerte eine Weile, bis ein jeder sich sammelte und ruhig seines Weges ging. Und doch war nichts geschehen, keine Pracht, kein Feuerwerk, keine Kanonenschüsse, keine Trommeln und Pfeifen, keine Musik, kein vorhergegangenes Ereignis, nein, nur ein dreiundsiebenzigjähriger Mann, schlecht gekleidet, staubbedeckt, kehrte von seinem mühsamen Tagewerk zurück, aber jedermann wußte, daß dieser Alte auch für ihn arbeitete, daß er sein ganzes Leben an diese Arbeit gesetzt und sie seit fünfundvierzig Jahren noch nicht einen einzigen Tag versäumt hatte. Jedermann sah auch die Früchte seiner Arbeiten nah und fern, rund um sich her, und wenn man auf ihn blickte, so regten sich Ehrfurcht, Bewunderung, Stolz, Vertrauen, kurz alle edleren Gefühle der Menschen.
Aus dem Nachlaß des Generals v. d. Marwitz auf Friedersdorf. (1. Band.)
Eines setzte den französischen Kaiser während seines Berliner Aufenthaltes doch wirklich in Schrecken. In Charlottenburg stand in dem Zimmer, wo der König gewöhnlich speiste, eine mechanische Uhr, die Trompeterstücke im vollen Chor geblasen aufs täuschendste nachahmte. Dieses Zimmer war jetzt auch in der Reihe derjenigen, die Napoleon bewohnte. Irgendein Spaßvogel aus der preußischen Dienerschaft mußte sich wohl daran ergötzt haben, das Spielwerk am Abend aufzuziehen: genug, um Mitternacht geht der Spektakel los, Trompeten ertönen durch das Schloß, die Adjutanten, die Dienerschaft, Napoleon selbst fahren aus den Betten heraus, und alle glauben an einen Überfall. Aber bald ist alles wieder still, und niemand kann begreifen, wo alle die Trompeter geblieben sind. – Es werden Posten ausgestellt, ein Teil der Adjutanten und der Diener bleibt auf den Beinen – und siehe! um ein Uhr erschallt wieder derselbe Lärm, und zwar in einem der Zimmer. Man stürzt hin, und so wurde denn die unschuldige Uhr überrascht, ehe noch der Schabernack zu Ende war.
Aus dem Nachlaß des Generals v. d. Marwitz auf Friedersdorf.
Von Heinrich von Kleist.
Erwäg' ich, wie in jenen Schreckenstagen
still deine Brust verschlossen, was sie litt;
wie du das Unglück mit der Grazie Tritt
auf jungen Schultern herrlich hast getragen;
wie von des Kriegs zerriss'nem Schlachtenwagen
selbst oft die Schar der Männer zu dir schritt;
wie trotz der Wunde, die dein Herz durchschnitt,
du stets der Hoffnung Fahn' uns vorgetragen:
O Herrscherin, die Zeit dann möcht' ich segnen!
Wir sahn dich Anmut endlos niederregnen,
wie groß du warst, das ahneten wir nicht.
Dein Haupt scheint wie von Strahlen mir umschimmert,
du bist der Stern, der voller Pracht erst flimmert,
wenn er durch finstre Wetterwolken bricht.
Von Max von Schenkendorf.
Rose, schöne Königsrose,
hat auch dich der Sturm getroffen?
Gilt kein Beten mehr, kein Hoffen
bei dem schreckenvollen Lose?
Seid ihr, hochgeweihte Glieder,
schon dem düstern Reich verfallen?
Haupt, um das die Locken wallen,
sinkest du zum Schlummer nieder?
Sink' in Schlummer! Aufgefunden
ist das Ziel, nach dem du schrittest,
ist der Kranz, um den du littest,
Ruhe labt am Quell den Wunden.
Auf, Gesang, vom Klagetale
schweb' empor zu lichten Hallen,
wo die Siegeshymnen schallen,
singe Tröstung dem Gemahle!
Sink' in deiner Völker Herzen,
du im tiefsten Leid Verlorner,
du zum Martyrium Erkorner,
Auszubluten deine Schmerzen.
Herr und König, schau nach oben,
wo sie leuchtet gleich den Sternen,
wo in Himmels weiten Fernen
alle Heiligen sie loben!
Von Otto Tschirch.
Man hat Willibald Alexis den märkischen Walter Scott genannt, und man wiederholt heute bisweilen das Wort mit einem Anfluge von mitleidigem Lächeln, indem man denkt, beider Zeit sei dahin. Unser Dichter gab zu diesem Vergleiche selbst den Anlaß, indem er durch eine spöttische und eine ernsthaft gemeinte Nachahmung des schottischen Dichters seine Laufbahn begann. Aber so gewiß Scott dem jüngeren Dichter die Rennbahn des historischen Romans gezeigt hat, so wenig ist die Bedeutung Härings mit dem Worte eines Nachahmers des Schotten erschöpft. Auf steilerem Wege hat, wie wir meinen, Alexis eine größere Höhe künstlerischer Charakteristik erklommen. Wieviel leichter wurde es dem schottischen Edelmann, den Weg zu seinem Schaffensgebiet zu finden, als dem hugenottisch-schlesischen Beamtensohn, der in die Mark verpflanzt wurde! Einem uralten schottischen Clan entsprossen, nach dessen verfallener Stammburg Scott als Knabe alljährlich wallfahrtete, dessen Glieder seit Jahrhunderten mit der Sage und Geschichte der schottischen Marken aufs innigste verwachsen waren, dessen Familienzusammenhang noch lebendig fortbestand, begann Scott damit, die Ruhmestaten seines Geschlechts zu verherrlichen und umfaßte allmählich das größere Vaterland. Stolz, in dem Felsboden, der ihn erzeugt hatte, festzuwurzeln, verjüngte er seine Dichterkraft immer wieder durch die Berührung mit der mütterlichen Erde. Glücklich, einem großen Volke anzugehören, das in ungebrochener Entwicklung durch romantische Kämpfe mit Achtung des Alten zu einem modernen Einheitsstaate erwachsen ist, durfte er sich nur unbefangen in die Überlieferung seines Geschlechts vertiefen, um allen Volksgenossen zum Herzen zu sprechen.
Wie anders bei Häring! Er mußte mit unsäglicher Mühe die Trümmer aufgraben, unter denen die verschütteten Quellen der vaterländischen Geschichte verborgen waren. Eine natürliche Vorliebe führte ihn schon früh zu vaterländischen Stoffen. Aber den rechten Weg, diese Gegenstände künstlerisch zu beleben, entdeckte er erst ganz allmählich. Die Beobachtung alter Soldatenoriginale des friderizianischen Heeres, wie er deren eins im Korporal Lungenbrand in der »Schlacht von Torgau« schildert, die Überlieferungen der hugenottischen Kolonie, der er entstammte, öffneten ihm erst das Auge für packendes Zeitkolorit, und der Erfolg zeigte ihm, was er vermochte. Indem er mit tiefem Naturgefühl dem märkischen Sandboden, seiner dürren Heide, seinen einsamen Seenspiegeln poetisches Leben verlieh, hörte er, unter der Zaubereiche der Heimatliebe träumend, in der Äolsharfe ihrer Zweige die Stimmen von Jahrhunderten wieder. Und wie er uns die einfachen Reize der märkischen Natur, das äußere Leben der Vergangenheit nahe bringt, so ist ihm weiter die köstliche Gabe verliehen, das rätselhafte Weben der Volksseele vergangener Tage zu belauschen.
Mit der Feinheit kulturhistorischer Seelenmalerei hängt die Kunst kraftvoller Charakteristik eng zusammen. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens hat Willibald Alexis darin Großes geleistet. Am besten gelingen ihm derbe, männliche Gestalten aus dem Volke oder dem Volksempfinden nahestehende Charaktere wie die Junker des 16. Jahrhunderts, im Roland von Berlin Bartz Kuhlemey, der Ratsherr Niklas Perwenitz und andere, im Cabanis der verlorene Sohn Gottlieb. Freilich stellt er sich öfter verwickelte Seelenprobleme, und dann gelingt ihm nicht immer die reine Ausgestaltung seiner Ideen. Eine merkwürdige Vorliebe hat er, wohl aus der Zeit seiner romantisch-ironischen Periode, aber auch von Natur, für Charaktere, die ein zwiespältiges Doppelleben führen, die etwas anderes sind, als sie scheinen, und mit einer großen Lüge durch die Welt gehen. Die Ironie spielt schon eine große Rolle bei den harmlosen Schelmen, die er mit vieler Liebe schildert, wie dem in mutwilligen Streichen unerschöpflichen Raschmacher Henning Molner und dem Barbier Hans Ferbitz. Ins Dämonische spielt dann der wilde Hake von Stülpe, ein prachtvoller märkischer Mephisto. Am tiefsten – bis zur ergreifenden Tragik – ist das Problem eines solchen Doppellebens in der Gestalt des falschen Woldemars gefaßt; aber es scheint, als ob der Dichter selbst ein Vergnügen daran fände, den Leser geschickt zu äffen und ihn absichtlich in Unklarheit über die Echtheit des Mannes zu lassen. Ein höchst interessantes Gegenstück zum falschen Woldemar ist die Gestalt des tief verschlagenen Karl IV., das beste historische Charakterbild, das Alexis je gelungen ist. Auch sonst finden sich in des Dichters Werken überall derartige zweideutig schillernde Gestalten: von der düstern Novelle Acerbi an, die der Dichter für sein bestes Jugendwerk hielt, bis zu der Geheimrätin Lupinus und dem Legationsrat Wandel in »Ruhe ist die erste Bürgerpflicht« und der Kurfürstin Dorothea im Roman. Die seltsamste Schelmenfigur in dieser Reihe ist der französische Oberst Espignac im Isegrim, der, einstmals Konditorssohn, Kellner, Komödiant und Kunstreiter in buntem Wechsel, jetzt als Kavallerieoffizier den krankhaften Drang hat, sich in eine altadelige Existenz hineinzulügen und den ehrenfesten, märkischen Edelmann zu täuschen versteht. Derartigen Schemen stehen aber die derben Kerngestalten aus märkischem Holze, an denen des Dichters Romane so reich sind, nur um so wirksamer gegenüber.
Schließlich kann man die Werke des märkischen Dichters nicht anders als mit dem liebenden Auge des Patrioten betrachten. Seine preußische Vaterlandsliebe, sein nationaler Stolz hat ihn in der Tat erst herausgehoben über die Novellisten gewöhnlichen Schlages. Indem es ihn drängte, in den trüben, tatenarmen Jahrzehnten des Vaterlandes das Heimatgefühl der Zeitgenossen zu beleben und zu erwärmen, gelang es ihm, die ungesunden Einflüsse seiner Jugendbildung zu überwinden und die romantischen Spukgestalten, die ihn bisher begleiteten, zu verjagen. So gesundete seine Muse, indem sie national wurde und sich mit dem festen Glauben an die hohe Bestimmung der Hohenzollern und ihres Staats erfüllte. Sein Patriotismus ist voll der Sehnsucht und des Kampfes, und darum soll das Andenken an diesen Dichterkämpfer in den Annalen unserer nationalen Geschichte unter uns nicht erlöschen, die die Erfüllung seines Sehnens, den Sieg nach dem Kampf erlebt haben.
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. 12. Band. 2. Hälfte. Leipzig, Duncker & Humblot.
Von Gottfried Keller.
Welch lustiger Wald um das hohe Schloß
hat sich zusammengefunden,
ein grünes bewegliches Nadelgehölz,
von keiner Wurzel gebunden!
Anstatt der warmen Sonne scheint
das Rauschgold durch die Wipfel;
hier backt man Kuchen, dort brät man Wurst,
das Räuchlein zieht um die Gipfel.
Es ist ein fröhliches Leben im Wald,
das Volk erfüllet die Räume;
die nie mit Tränen ein Reis gepflanzt,
die füllen am frohsten die Räume.
Der eine kauft ein bescheidnes Gewächs
zu überreichen Geschenken,
der andere einen gewaltigen Strauch,
drei Nüsse daran zu henken.
Dort feilscht um ein winziges Kieferlein
ein Weib mit scharfen Waffen;
der dumme Silberling soll zugleich
den Baum und die Früchte verschaffen.
Mit rosiger Nase schleppt der Lakai
die schwere Tanne von hinnen;
das Zöfchen trägt ein Leiterchen nach,
Zu ersteigen die grünen Zinnen,
Und kommt die Nacht, so singt der Wald
und wiegt sich im Gaslichtscheine;
bang führt die ärmste Mutter ihr Kind
vorüber dem Zauberhaine.
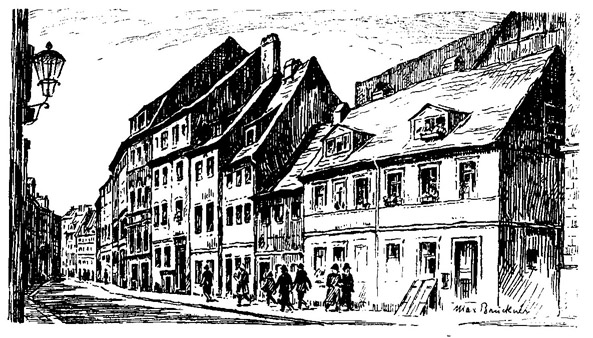
Alt-Berlin: Petristraße.
Von Konrad Burdach.
Wir kennen diesen Spaziergänger mit dem spähenden Auge und dem lauschenden Ohr des Poeten und des Geschichtsfreundes, der erst auf Schottlands und Englands von Ballade und Sage umwobenem Boden aus den tiefen Eindrücken der großen see- und flußreichen Landschaft und des in alter ruhmvoller Geschichte wurzelnden flutenden Menschenlebens, dann aus allen Teilen der heimatlichen Mark und endlich von den Werkstätten unsers nationalen Schicksals, Von den drei Kriegsschauplätzen der Jahre 1864, 1866, 1870/71 greifbare, lebenatmende Bilder der Landschaft, der geschichtlichen Vergangenheit, der gegenwärtigen Kultur und ihres bewegten Werdens in Frieden und Krieg, prächtig sprechende Anekdoten, prägnante Genrebilder und runde Menschenexistenzen in unerschöpflicher Fülle erlauscht und geschaut hat und uns mit ihm schauen und vernehmen läßt.
Dem Fußgänger allein gehört die Welt im Sinne jener Überzeugung Fontanes: »Die Dinge an sich sind gleichgültig, alles Erlebte wird erst was durch den, der es erlebt.« Und der Fußgänger allein gehört sich selbst. Dies aber ist nach Fontanes Meinung »der einzig begehrenswerte Lebensluxus, dem freilich die moderne Menschheit ein Plüsch-Ameublement vorzieht«. Der Spaziergänger bleibt Herr in jedem Augenblick, da er Eindrücke mit empfänglichem Gemüt einsaugt. Weg und Zeitmaß seines Ganges hängen ab von der eignen augenblicklichen Laune und Stimmung. Er besitzt in Wahrheit »Frieden und Freiheit, was – nach Fontanes Wort – allein echtes Glück verleiht«.
Fontanes Leben und Kunst hat in der Tat etwas Spaziergängerisches. Er ist, im wesentlichen Autodidakt, zu seiner Bildung und zu seinem Wissen, die auf allen Gebieten höchst achtungswert waren, so sehr er es liebte, mit geringschätziger Miene davon zu reden, auf zufälligen Wegen gelangt, ohne abschließenden Besuch einer höheren Schule, ohne Staatsexamina, ohne akademisches Studium. Sein ganzes Leben verlief ohne vorgefaßten, festgehaltenen Plan, in Bahnen, wie sie Gelegenheit und Neigung ihm wiesen. Er hatte und suchte keinen Rang oder Titel. Er hatte kein Amt. Als er, um seine äußre Existenz sorgenfrei zu gestalten, sich hatte bestimmen lassen, das Sekretariat der Akademie der Künste anzunehmen, da fühlte er sich von dem bureaukratischen Zwang und dem Joch der geschäftlichen Schreiberei erdrosselt, fürchtete tiefsinnig zu werden und zerriß nach wenigen Monaten die Fesseln, in einem wahrhaft ergreifenden Konflikt mit seiner Frau, die zunächst den Standpunkt der Hausmutter nicht zu verlassen fähig war. Fontane aber atmete auf wie ein Geretteter und zog neu gestärkt, ob auch voller Angst und Sorge, auf ungewissen Pfaden weiter.
Der Lebenssaft seiner Begabung stammt aus diesem ungebundnen Spaziergängertum seines Wesens. Sein köstliches Fabulieren, dem tausend Beobachtungen und Einfälle, Schnurren und Schwänke jeden Augenblick bereitstehen, scheint ihm zuzuströmen wie dem im Freien Ausschreitenden die frische Luft. Seine Erzählung wandelt dahin, leicht, beweglich, rhythmisch elastischen Gangs, ohne rhetorisches, sentimentales, gelehrtes Gepäck. Meister im anmutigen Plaudern, wird er zum Klassiker des modernen deutschen Briefs, der völlig zwanglos sich gehen läßt, um sich mitzuteilen, und dabei spielend sachliche Aufschlüsse, Belehrung, Anregung, lustige Prägungen des natürlichen Mutterwitzes und tausend Sprühteufelchen seines ironischen Temperaments wie von ungefähr mitspazieren läßt.
Wie der rechte Spaziergänger gern nach Kleinigkeiten sich bückt, nach Blumen, Kräutern und Steinen am Wege, so ziehen den Romandichter Fontane besonders an das kleine Glück und die kleinen Schicksale, die unscheinbaren, anspruchslosen Existenzen, die unbedeutenden Charaktere, und überall das Aparte, Absonderliche, Wunderliche, selbst das Groteske, wo es aus der Sonderart echter Natur hervortritt. Und die Darstellung dieser Romane geht still und ruhig dahin, ohne Hinausschreien des Gefühls: nicht auf Stelzen, nicht in der Prachtkarosse des falschen Idealismus, der verlogenen Romantik, nicht auf dem Kothurn der Phrase halbwahrer Gefühle, nicht im »Weitsprung«, sondern schreitend auf guten festen Füßen und in bequemen Schuhen. Daher kommt es aber auch, daß die Technik seiner Romans stets lässig blieb, daß ihrer Komposition Einheit, Geschlossenheit, harmonische Gliederung der Teile fehlt. Es überwuchern darin die Episode, das Genrebild, Gespräch und Briefeinlagen, epigrammatische Sentenzen, Aperçus und Klassifikationen eines unersättlichen Menschenstudiums. Gerade wie der sein Behagen auskostende und als Spaziergänger Wandernde nach Belieben in gemütlichem Quartier Station macht oder in anregendem Gespräch sich festschwatzt – gegen den Reiseplan.
Aber in diesem launischen, Einfall und Stimmung folgenden Spaziergänger Fontane steckt auch ein ganz entgegengesetztes Element.
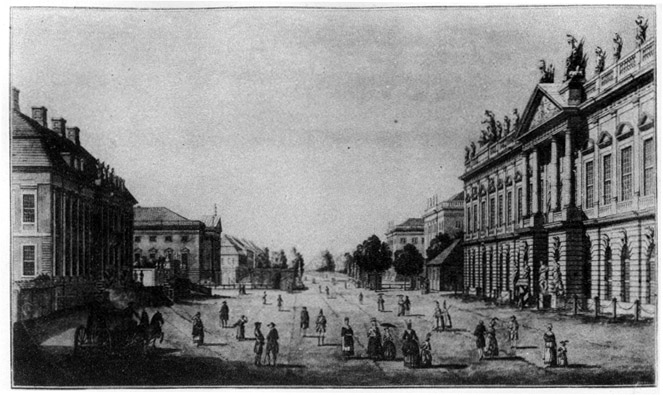
Unter den Linden
nach einer Zeichnung von Joh. Rosenberg (1780)
Der scheinbare, durchs Leben und Dichten schlendernde Bohémien besaß ein seltenes Maß von Energie und Selbstzucht, einen unermüdlichen, ja ich muß sagen: einen geradezu heroischen Trieb zur Arbeit, zur soliden Pflichterfüllung, zum opferbereiten Erwerb für Frau und Kinder, einen geheimen, tief innerlichen Drang zur Ordnung und Gesetzlichkeit.
In dem glücklichen Ausgleich der beiden gegensätzlichen Anlagen von Fontanes Natur liegt – wie es scheint, nach einem fast allgemeinen Gesetz menschlicher Größe – das Geheimnis seiner Persönlichkeit wie der Wirkung und Dauer seiner Kunst.
An dem unglücklichsten und zugleich doch herrlichen Wendepunkt seines Lebens, wo er sein Amt niederlegt und dadurch seinem geliebten alten Kaiser, seiner Frau, seinen Kollegen und Freunden als frivoler, pflichtvergessener Narr erscheinen muß – aus Pflichtgefühl gegen sich selbst, offenbart sich das Geheimnis seines menschlichen Wesens. Und in der Art, wie er, den man den ersten konsequenten Realisten der deutschen Literatur genannt hat, er, der von Grund aus subjektive Schriftsteller, weder dem Realismus noch dem Subjektivismus sich gefangen gibt, sondern beide miteinander durchdringt und über beide gebietet kraft eines geheimen Vermögens, das ihm angeboren war, offenbart sich das Geheimnis seiner Kunst. Sie, die gegen herkömmliche Stilisierung, gegen den »großen Stil« Front macht, wirkt und dauert, weil sie selber Stil hat. Den echten lebendigen Stil, der aus der Sache und der Persönlichkeit kommt.
Schon die straffe Zügelung in den Jugendballaden, dann die formvolle Formlosigkeit seiner schottisch-englischen und märkischen Wanderungen, endlich die reifende Kunst der im Herbst des Lebens entstandenen Romane und die meisterhafte Gestaltung seiner späten anekdotisch-historischen Genrebilddichtung wachsen aus einer unerhörten Konzentration der inneren Anschauung der Dinge und Menschen. Eine ungeheure Fülle persönlicher, zufälliger, augenblicklicher Eindrücke und Entwürfe gebändigt und mit dem Stempel des Bleibenden geprägt durch eine gewaltige Kraft des Sichzusammenraffens: daher stammt Fontanes Meistertum.
Der Sohn der französischen Kolonie fühlte sich zuzeiten als verwunschenen Prinzen: aus dem Sonnenland der Gascogne versetzt in die Bezirke der Kiefer, des Nebels und der kalten Winde, aus dem Genieland der großen Entwürfe und phantasievollen Träume in das nüchterne Berlin, in die Dürftigkeit und Formlosigkeit einer kleinbürgerlichen Existenz. Aber solche Stimmungen bezwang stets sein unerstickbarer Drang, in der von Gott ihm gewiesenen Zeit und Umgebung auszuharren und dort seine Kräfte zu entfalten. Jenseits des Tweed weckte ihm auf der Höhe seines Mannesalters ein schottisches Seeschloß die Sehnsucht nach den landschaftlich verwandten Seen und Wäldern der märkischen Heimat und erregte den Wunsch, ihre Ebenbürtigkeit zu zeigen. Aller italienischen Herrlichkeit gegenüber empfand er auf dem Abstieg des Lebens, daß seine »bescheidene Lebensaufgabe nicht am Golf von Neapel, sondern an Spree und Havel, nicht am Vesuv, sondern an den Müggelbergen liegt«, und so zog es ihn »an die schlichte Stelle zurück, wo seine Arbeit und in ihr seine Befriedigung« lag. Er erkannte sich für seine Person als »ausgesprochen nicht-südlich« und fand, ein Wort A. W. Schlegels über Fouqué auf sich anwendend, daß die Magnetnadel seiner Natur nach Norden zeige.
Er war ein diesseitiger Mensch, und ihm war die Freiheit das Köstlichste. Aber der Mann von heute, der Dichter der zukunftshungrigen Großstadt kannte und ehrte, rückwärts gewandt, das Gestern. Der Verfechter persönlicher Autonomie achtete und schützte die menschliche Gebundenheit in den Ordnungen von Staat und Heer. Seine Schriftstellerei predigt Liebe und Ehrfurcht für den Boden, darauf wir wandeln. Für die Mutter Erde, aus der wir stammen, und die uns am Ende unsrer Tage zurückfordert, die uns erquickt und erbaut durch herbe Schönheit der uns umgebenden Natur. Ehrfurcht und Liebe für die großen geschichtlichen Taten und Personen, die unsers Volkes und unseres Staates Gegenwart und Zukunft bestimmen. Ehrfurcht und Liebe aber auch für die Lebensfülle und gärende Entwicklung unserer Zeit. Ehrfurcht und Liebe vor allem für die Mächte unsers inneren Lebens.
Die Nachkommen der französischen Emigranten haben ihrem neuen Vaterland redlich gelohnt durch Bürgertugend, Gewerbfleiß, Geschicklichkeit im Technischen, durch äußere Kultur. Theodor Fontane vergalt, was seine Ahnen dem preußischen Staat dankten, mit mehr als Zinseszins. Seine Schriftstellerei säte bei uns das, was dem jungen Kaiserreich und seiner auf kulturarmem Kolonialboden gelegenen Hauptstadt am meisten not tat: »Freiheit, Liebenswürdigkeit und die rechte Liebe überhaupt«, die innere Lebenskunst, die geistige Kultur. Er schuf dem wirren Volksgemengsel dieses großen Emporkömmlings Berlin ein Gegengewicht: die Heimatkunst. Er hat in seinen Reisebildern, in seinen Briefen unsre Armut mit mütterlicher Fürsorge an dem gediegenen Reichtum der alten, seit mehr als drei Jahrhunderten ungestört fortgebildeten Kulturen Englands und Frankreichs gemessen und dadurch das Verlangen geweckt und gestärkt nach einer eigenen Form des modernen deutschen Lebens, deren Grundlage das von ihm eingeschärfte Gebot ist: Lerne kennen und halte fest, was du an Edlem, Schönem in Natur und Kultur besitzest und baue darauf weiter! Er hat dieses Gebot nicht bloß durch Worte, er hat es auch durch die Tat ins Leben übertragen wollen: als einer der Ersten, schon im Jahre 1868, hat er für das heranwachsende Deutschland ein großartiges Museum seiner nationalen Kultur erhofft und in sich den Mut gefühlt, der Organisator und Leiter einer solchen Sammlung des angestammten Bildungsschatzes zu werden.
Der Wandel Fontanischer Kunst, durch den der Bewunderer Platens, Lenaus, Herweghs, der Schüler von Scotts Balladen und historischen Romanen, von Percys echten Reliques alter englischer Volksdichtung, der mit Strachwitz, Geibel und Storm Wetteifernde, der Dichter des »Archibald Douglas« und der Zieten- und Seydlitz-Lieder zum Schöpfer des realistischen Zeitromans »Stechlin« wurde, spiegelt ein halbes Jahrhundert deutscher Entwicklung wider. Die zweite Hälfte jenes Jahrhunderts, das wir nicht »das nie genug zu verdammende« schelten, sondern mit Fontane lieben und ehren als das Zeitalter, da Deutschland ein Mann, ein Mann der Tat ward, der sich seinen Platz in der Welt sicherte und daheim auf eigenen Füßen stehen lernte.
Unter den Führern der geistigen Entwicklung dieser Epoche gebührt Theodor Fontane ein Platz in einer Reihe mit Bismarck und Adolf Menzel: nicht als einem Ebenbürtigen, aber als einem innerlich Verwandten.
Von Theodor Fontane.
7. Dezember 1864.
Wer kommt? wer? –
Fünf Regimenter von Düppel her.
Fünf Regimenter vom dritten Korps
rücken durchs Brandenburger Tor.
Prinz Friedrich Karl, Wrangel, Manstein,
General Roeder, General Canstein,
fünf Regimenter, vom Sundewitt
rücken sie an in Schritt und Tritt.
Wer kommt? wer? –
Zuerst die Achter.
A la bonne heure!
Die Achter: Hut ab, sapperment,
vor dem Yorkschen Leibregiment!
Schanze neun und Schanze drei
waren keine Spielerei.
Hut ab und Hurra ohn' End',
allemal hoch das Leibregiment.
Wer kommt? wer? –
Hurra, die Vierundzwanziger.
Guten Tag, guten Tag und gehorsamster Diener!
Ei, das sind ja meine Ruppiner,
flinke Kerle ohne Flattusen,
grüß Gott dich, Görschen und Brockhusen!
Möchte manchen von euch umhalsen;
Düppel war gut, besser war Alsen.
's war keine Kunst, euch half ja die Fee,
die Wasserfee vom Ruppiner See.
Wer kommt? wer? –
Hurra, die Vierundsechziger,
Hurra, die sind wieder breiter und stärker,
das macht, es sind richtige Uckermärker.
Die sind schon mehr für Kolben und Knüppel,
conferatur Wester- und Oster-Düppel.
Verstehen sich übrigens auch auf Gewehre,
siehe Fohlenkoppel und Arnkiel-Oere.
Fünfzig dänische Feuerschlünde
können nichts gegen Prenzlau und Angermünde.
Wer kommt? wer? –
Füsiliere, Fünfunddreißiger.
Hurra, das wirbelt und schreitet geschwinder,
Hurra, das sind Berliner Kinder!
Jeder, als ob er ein Gärtner wäre,
trägt drei Sträußchen auf seinem Gewehre.
Gärtner freilich, gegraben, geschanzt,
dann sich selber eingepflanzt,
eingepflanzt auf Schanze zwei. –
Die flinken Berliner sind vorbei.
Wer kommt? wer? –
Hurra, unsre Sechziger.
Oberst von Hartmann fest im Sitze.
grüßt mit seiner Säbelspitze.
Hut ab und heraus die Tücher!
Das sind unsre Oderbrücher,
keine Knattrer und bloße Verschluser,
lauter Barnimer und Lebuser.
Fest ist ihr Tritt, frank und frei.
Major von Jena ist nicht mehr dabei.
Wer kommt? wer? –
Artillerie und Ingenieur,
elfte Ulanen, Zietenhusaren,
Paukenwirbel und Fanfaren.
halt, der ganze Waffenblitz
präsentiert vor König Fritz.
Alles still, kein Pferdegeschnauf;
zehntausend blicken zu ihm hinauf.
Der neigt sich leise und lüpft den Hut:
»Konzediere, es war gut!«
*
20. September 1866.
Viktoria hat heute Dienst am Tor.
»Landwehr, zeig' deine Karte vor,
Paßkart' oder Steuerschein,
eins von beiden muß es sein.«
»Alles in Ordnung. Jedenfalls
zahlten wir Steuer bei Langensalz';
wir zahlten die Steuer mit Blut und Schweiß.«
»Landwehr, passier', ich weiß, ich weiß.«
Viktoria hat heute Dienst am Tor.
»Linie, zeig' deine Karte vor,
Paßkart' oder Steuerschein,
ein Paß, das wird das beste sein.«
»Wir haben Pässe die Hände voll,
zuerst den Brückenpaß bei Podoll,
dann Felsenpässe aus West und Ost,
Nachod, Skalitz und Podkost.
Und wenn die Felsenpüsse nicht ziehn,
so nimm noch den Doppelpaß von Gitschin,
sind allesamt geschrieben mit Blut!« –
»Linie, Passier', is gut, is gut.«
Viktoria hat heute Dienst am Tor.
»Garde, zeig' deine Karte vor;
preußische Garde, willkommen am Ort,
aber erst das Losungswort.«
»Wir bringen gute Losung heim
und als Parole 'nen neuen Reim,
einen neuen preußischen Reim auf Ruhm.«
»Nenn' ihn, Garde!«
»Die Höhen von Chlum.«
»Ein guter Reim, ich salutier';
preußische Garde, passier', passier'!«
Glocken läuten, Fahnen Wehn,
die Sieger drinnen am Tore stehn.
Eine Siegesgasse ist aufgemacht:
östreich'sche Kanonen, zweihundertundacht.
Und durch die Gasse die Sieger ziehn. –
Das war der Einzug in Berlin.
*
1871.
Und siehe da, zum drittenmal
ziehen sie ein durch das große Portal.
Der Kaiser vorauf; die Sonne scheint,
und alles lacht, und alles weint.
Erst die Garde-Brigaden vier;
Garde und Garde-Grenadier':
Elisabether, Alexandriner,
Franziskaner, Augustiner,
sie nahmen, noch nicht zufrieden mit Chlum,
bei Privat ein Privatissimum.
Mit ihnen kommen, geschlossen, gekoppelt,
die Säbel in Händen, den Ruhm gedoppelt,
die hellblauen Reiter von Mars-la-Tour,
aber an Zahl die Hälfte nur.
Garde vorüber. – Garde tritt an,
Regiment des Kaisers, Mann an Mann,
die Siebner, Phalanx jedes Gefechts.
»Kein Schuß; Gewehr zur Attacke rechts!«
Die Sieben ist eine besondre Zahl,
dem einen zur Lust, dem andern zur Qual.
Was von den Turkos noch übrig geblieben,
spricht wohl von einer bösen Sieben.
Blumen fliegen aus jedem Haus;
der Himmel strömt lachende Lichter aus,
und der Lichtball selber lächelt in Wonne:
»Es gibt doch noch Neues unter der Sonne!«
Gewiß. Eben jetzt einschwenkt in das Tor,
keine Linie zurück, keine Linie vor,
en bataillon, frisch wie der Lenz,
die ganze Armee in Double-Essenz.
Ein Korps bedeutet jeder Zug.
Das ist kein Schreiten, das ist wie Flug.
Das macht, weil ihnen ungesehn
dreihundert Fahnen zu Häupten wehn.
Bunt gewürfelt Preußen, Hessen,
Bayern und Baden nicht zu vergessen,
Sachsen, Schwaben, Jäger, Schützen,
Pickelhauben und Helme und Mützen,
das Eiserne Kreuz ihre einzige Zier.
Alles zerschossen; ihr ganzes Prahlen
nur ein Wettstreit in den Zahlen,
in den Zahlen derer, die nicht hier.
Zum drittenmal
ziehen sie ein durch das große Portal.
Die Linden hinauf erdröhnt ihr Schritt,
Preußen-Deutschland fühlt ihn mit.
Hunderttausende auf den Zehenspitzen!
Vorüber, wo Einarm und Stelzfuß sitzen.
Jedem Stelzfuß bis in sein Bein von Holz
führt der alte Schlachtenstolz.
Halt!
vor des großen Königs ernster Gestalt.
Bei dem Fritzen-Denkmal stehen sie wieder.
Sie blicken auf, der Alte blickt nieder;
er neigt sich leise über den Bug:
»Bon soir, messieurs, nun ist es genug.«
Th. Fontane, Gedichte. (Stuttgart, J. G. Cottasche Buchh. Nachf.)
Eine Stunde vor der Weltstadt beginnt die Landschaft ganz plötzlich sehr sandig zu werden. Rechts und links vom Schienenstrange leuchten weiße Dünen, die jeden Streusand-Industriellen entzücken müssen, und aus dem armselig-unfruchtbaren Boden heben sich mühsam lange, langweilige Reihen spilleriger Kiefern. Berlin versteht es, sich gut in Szene zu setzen: wer diese gottverlassene Wüste durchfährt, der erwartet dahinter alles andere als ein Sesam schimmernden Reichtums, und auf den wirkt das gigantische, goldschaffende Ungeheuer mit der Kraft einer doppelten Überraschung. Dem Fremdling zeigt sich die Mark Brandenburg von ihrer herbsten Seite. Alle Bahnwege laufen im Bett der alten Gletscherströme, die sich vorzeiten durchs Land ergossen und bei dieser Gelegenheit die rieselnden Sandmassen ablagerten. Der Kiefernwald verschwindet, Schornsteine recken sich auf, jagen sich, drängen sich, ein unentwirrbares Gewühl von Fabriken, Warenstapeln, Geleisen, von verschmutzten Flächen, auf denen neue Schornsteine, Fabriken, Warenstapel, Geleise wachsen. Die ganze trostlose, schreckliche Zerrüttung, die unsere aufs Technische gestellte Hochkultur hervorruft; grauenvoll verwüstetes Feld, das der Riese bis in den Grund aussaugt, um neue Nahrung, immer neues Gold zu finden. Fahr im Dämmerlichte des Abends durch dies Industrierevier, das die Stadt umgürtet, und du hast nicht nur das getreue, eigentliche Bild ihres Wesens, du hast auch eine geisterhafte Vision der Zukunft, die sie dem ganzen Lande bereitet.
Man mag nachher die schimmernden Straßen der Residenz, ihre glühenden und funkelnden Schaufenster, ihre Tempel frohen Genusses, ihre Kunststätten und Kunstdenkmäler bewundern, mag köstliche Schlendertage in ihr verleben und dabei erkennen, daß sie's den übrigen Großstädten schon beinahe gleich zu tun versteht – und doch wird der erste Eindruck bleibend sein. Ein ungeheures Arbeitshaus, dies Berlin, dem alles andere nur zum Ornament dienen muß. Deshalb auch keine Stadt im rechten Sinne des Wortes, kein organisch gewordenes Kulturzentrum von einheitlichem, sozusagen künstlerischem Charakter, sondern mehr eine von Millionen benutzte günstige Gelegenheit, emporzukommen und Wohlstand zu erwerben.
Wenn es in Paris und Wien, in London und gewissermaßen sogar in New York einen klar erkennbaren Mittelpunkt des städtischen Lebens gibt, ein gewaltiges Sammelbecken des Verkehrs wie der Interessen, so kann in Berlin nur der oberflächliche Blick dergleichen finden. Zwischen dem Potsdamer Platz und dem Bahnhof Friedrichstraße strömen für den Uneingeweihten Kraft und Geist der Stadt zusammen, schlägt ihr Herz – und er wird sich ungern dahin belehren lassen, daß dieser lebensvolle Bezirk nur eine von den fünf oder sechs großen Städten darstellt, aus denen sich Berlin zusammensetzt. Diese fünf oder sechs Städte wissen wenig voneinander, haben noch weniger miteinander gemeinsam. Was verbindet innerlich die in der Öffentlichkeit den Ton angebenden Bewohner von Berlin W mit dem starken Industrievolke des Nordens, der selbstbewußten Arbeiterschaft in den Ostrevieren, dem ehrbaren erbeingesessenen Kleinbürgertum im Süden oder im alten Spreeviertel, dem südwestlichen Mittelstande und den Leuten von Moabit? Man liest ungefähr dieselben Zeitungen und erzielt dadurch eine scheinbare Übereinstimmung der Gesinnungsäußerlichkeiten – das ist aber auch alles.
In einem so aufgebauten Gemeinwesen kann es keine Gesellschaft im europäischen Sinne des Wortes geben, zumal neben der geographischen Trennung eine tiefgehende, nirgends überbrückte soziale herläuft. Die nimmermüde Sehnsucht nach dem Berliner Salon ist unerfüllbar, und nur ahnungslose Nichtberliner oder Zugezogene, die die Eigenart unserer Stadt nicht kennen, werden solchem Traum nachhängen. Jede Schicht lebt hier für sich. Die Gelehrten, das Beamtentum, die Künstler, die Kaufherren, die Industrie. Es fehlt ein verbindendes Glied, zu dem sie alle aufsehen und in dem sie widerspruchslos ihren Führer anerkennen; es fehlt die heimische Aristokratie. Warum haben alle anderen Hauptstädte ihre Gesellschaft, auf die auch der kleine Mann stolz ist, und an deren großen Tagen er in seiner Art freudig teilnimmt? Weil der alte Adel des Landes an der Spitze steht. Unsere märkischen und preußischen Junker sind aber nicht reich genug, um in Berlin haushalten, um einen Wintersitz in der Residenz bezahlen zu können. Sie erscheinen hier dann und wann, gewiß, sie schlürfen auch einige Wochen lang mit Lust die Annehmlichkeiten der Hauptstadt, aber sie wohnen derweil im Gasthofe und sind ungemein zurückhaltend. Ihnen gilt jeder Standesgenosse als deklassiert, der sich mit dem neuen Geldadel einläßt, und weil sie dem Kuponsreichtum seinen Luxus doch nicht nachmachen können, so verachten sie ihn. Vom nationalen Gesichtspunkte aus ist das rühmenswert; das Berliner Gesellschaftsleben jedoch krankt unheilbar daran, denn die übrigen Stände ahmen das Vorbild des Adels nach. Jeder beschränkt sich auf den Umgang mit seinesgleichen.
Glücklicherweise grämt sich außer den Theoretikern und denen, die Berlins weltstädtisches Heil in der lückenlosen Übernahme fremder Einrichtungen sehen, niemand allzusehr über diesen Mangel. Je mehr man auf sich selber und seinen Nächsten angewiesen ist, desto schöner blüht das Familienleben. Nichts fesselt einen ja zu innig an die Stadt, die in der Hauptsache Kontor und Werkstube ist; ihre Vergnügungen gelten als zierliche Überflüssigkeiten, und dadurch hat sich im allgemeinen die kerngesunde, urmärkische Auffassung erhalten, die jeden Lustwandler als Taugenichts betrachtet. Es ist immer noch gewagt, in Berlin bei Tage spazieren zu bummeln; man schämt sich wirklich, wenn Bekannte einen dabei ertappen.
Die allzu rasch, allzu amerikanisch in die Breite gegangene Metropole hat sich nicht immer einer weitsichtigen Verwaltung zu erfreuen gehabt, und von den schweren Sünden der Vergangenheit sind nur wenige wieder gutzumachen. Berlins Schönheit ist seine Spree gewesen – und den hübschen Fluß, der für die deutsche Hauptstadt das hätte werden können, was die durchaus nicht stattlichere Seine für Paris ist, hat man zu einem schmutzigen Kanal herabgewürdigt. Wo es reizvolle Aus- und Durchblicke gab, so zum Exempel von der Mühlendammbrücke auf die Berliner Akropolis, den Lustgarten, hat man sie mit grundhäßlichen Häuserkästen verbaut. Die kargen Reize der Lage Berlins ganz fortzuwischen, ist das von Erfolg gekrönte Mühen sogenannter Stadtbaumeister gewesen. Jetzt steht ein neues Geschlecht auf dem Plane. Aus dem Berlin an der Spree soll das Berlin an der Havel werden. Stolze Möglichkeiten tun sich auf, und die licht- und lufthungrige Bevölkerung schaut hoffnungsfroh durch das grüne Tor.
Soviel unbändige Kraft steckt in der Stadt, soviel Schaffensfreudigkeit in ihren Bewohnern, und so ruhelos drängt einer den anderen vorwärts, daß man diesem Gemeinwesen die Erreichung aller seiner materiellen Ziele getrost prophezeien darf. Die große Arbeitsstätte im deutschen Norden wirkt anspannend auf das ganze Reich. Wie sich schierer Sand unter den Händen zäher Fleißiger in Gold verwandelt, das kann man nirgendwo besser studieren als hier. Wenn auf der anderen Seite Berlin seines besonderen Werdeganges und seines vielleicht allzu jugendlichen Charakters wegen geistig kaum je die beherrschende Stellung einnehmen wird, die wirklichen Hauptstädten eignet, so ist das kein Verlust für die Stadt und ein Gewinn für die alten deutschen Kulturzentren. Sie können freundschaftlich und in Ehren neben ihr bestehen, trotz ihrer körperlichen Überlegenheit den Wettkampf mit ihr aufnehmen. Haben die, denen der üppig gedeihende Spreekoloß bisher immer noch eine finstere Drohung scheint, das erst klar erkannt, dann werden Berlin und die Berliner im Reiche alle verdienten Sympathien erwecken. Sie sind besser als ihr Ruf. Allzu häufig versündigen sich unartige Neulinge, die kaum in der Liste des Einwohnermeldeamtes stehen, durch Anmaßlichkeit und Mundfertigkeit am Berliner Wesen. Man macht den Reichshauptstädter für diese Schädlinge verantwortlich, obgleich er sie ebenso herzlich verabscheut wie irgendeiner von denen, die unter ihnen leiden. Der Berliner ist ein Kind des märkischen Himmels, nicht ohne Rauheit und Schärfe, haushälterisch mit Gefühlsausbrüchen und sarkastischem Witze hold, aber verläßlich und ehrlich und gerne bereit, die Tüchtigkeit des Nebenmenschen anzuerkennen.