
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Gau Dsï
Gau Dsï ist einer der zeitgenössischen Sophisten, mit denen Mong Dsï gelegentliche Zusammenstöße hatte. Er ist erwähnt II, A, 2, wo von ihm gesagt ist, daß er die Seelenruhe erlangt habe dadurch, daß er, was er nicht in Worte fassen konnte, auch nicht im Gemüt erstrebte, daß, was er nicht im Gemüt zu erfassen vermochte, er auch nicht unter Aufwand von psychischer Kraft erstrebte. Der zweite Grundsatz wird von Mong Dsï gebilligt, der erste verurteilt. Hier haben wir ein Beispiel, wie Gau Dsï mit Hilfe des ersten Grundsatzes seine Seelenruhe wahrt. In den sechs Abschnitten, in denen er direkt oder indirekt mit Mong Dsï disputiert, hält er keine konsequente eigene Theorie über die menschliche Natur fest. Vielmehr ist es ihm nur darum zu tun, Mong Dsï in Verlegenheit zu bringen. So oft einer seiner Angriffe abgewiesen ist, läßt er den Gedanken fallen und wendet sich einem anderen zu, entsprechend dem Grundsatz: »Was sich nicht mit Worten durchbehaupten läßt, soll man auch nicht innerlich festzuhalten streben.« Ganz entsprechend der Art dieses Gegners gibt sich Mong Dsï gar nicht die Mühe, ihm gegenüber seine eigene Lehre von der menschlichen Natur zu entwickeln. Er bekämpft Gau Dsï, den Sophisten, mit dessen eigenen Waffen: er führt der Reihe nach die verschiedenen Theorien, die jener gegen ihn ins Feld führt, ad absurdum, ohne sich dann weiter um ihn zu kümmern. Die eigenen Theorien des Mong Dsï über die Güte der menschlichen Natur finden sich später angeführt. Der Kampf mit Gau Dsï zerfällt in sechs Abschnitte:
1. Gau Dsï behauptet, daß Liebe und Pflicht etwas der menschlichen Natur Wesensfremdes seien, das erst künstlich ausgebildet werde. (Der Unterschied dieser sophistisch ausgesprochenen Schulmeinung von der ernsten, an Kants radikales Böse erinnernden Theorie von der Schlechtigkeit menschlicher Natur bei Sün King ist evident, obwohl sich die hier vorgebrachten Beispiele bei Sün King fast wörtlich finden.)
2. Gau Dsï behauptet, die menschliche Natur sei gegenüber Gut und Böse indifferent.
3. Gau Dsï identifiziert, wohl durch die etymologische Verwandtschaft der chinesischen Zeichen veranlaßt, »Schong« = Leben und »Sing« = Natur.
4. Gau Dsï nimmt den Hunger und die Liebe als Inbegriff der menschlichen Natur an, darum erklärt er sich bereit, auch die höhere Liebe als dem menschlichen Wesen naturgemäß anzuerkennen, während ihm die Pflicht artfremd bleibt.
5. Gespräch zweier Schüler des Mong Dsï über die letztgenannte Theorie Gau Dsïs mit gelegentlicher Einmischung des Mong Dsï.
6. Verschiedene Theorien werden dem Mong Dsï von einem Schüler zur Entscheidung vorgelegt:
a) Gau Dsïs Theorie der moralischen Indifferenz der Natur.
b) Veränderlichkeit der Natur je nach dem Milieu.
c) Wesentliche Verschiedenheit der Natur verschiedener Menschen: die Guten sind gut von Natur, die Bösen sind böse von Natur ohne Änderungsmöglichkeit.
Mong Dsï entscheidet die Fragen von seinem Standpunkt aus. Daran knüpfen sich die weiteren positiven Ausführungen über das Wesen der menschlichen Natur. sprach: »Man mag die menschliche Natur mit einer Weide vergleichen und die Pflicht mit Bechern und Schalen. Man formt die menschliche Natur zu Liebe und Pflicht, wie man die Weide zu Bechern und Schalen formt.«
Mong Dsï sprach: »Könnt Ihr der Natur des Weidenbaums folgen, wenn Ihr Becher und Schalen daraus macht, oder müßt Ihr der Natur des Weidenbaums Gewalt antun, ehe Ihr Becher und Schalen daraus formen könnt? Und wenn Ihr der Natur des Weidenbaums Gewalt antun müßt, um Becher und Schalen daraus formen zu können: dann müßt Ihr also auch der Natur des Menschen Gewalt antun, um Liebe und Pflicht daraus zu bilden. Wahrlich, Eure Worte müssen die Wirkung haben, daß die Menschheit in Liebe und Pflicht ein Unheil sieht.«
Gau Dsï sprach: »Die Natur gleicht einem Wasserwirbel Während im ersten Abschnitt Anklänge an Sün King sich finden, so in diesem solche an Yang Dschu, der wie hier Gau Dsï die menschliche Natur jenseits von Gut und Böse fand. Mong Dsï behauptet demgegenüber, daß die menschliche Natur nicht indifferent sei, sondern eine natürliche Neigung zum Guten besitze, so daß das Böse einen künstlich herbeigeführten Abfall von der Natur darstelle. Die Argumente Gau Dsïs und Mong Dsïs wiederholt später Wang Tschung im Lun Hong im Ben Sing Piän (vgl. Forke, Lun Häng, Bd. I, S. 386), wobei er sich jedoch im wesentlichen der Meinung des Philosophen Schï Dsï anschließt, nach der die menschliche Natur aus einer Mischung von Gut und Böse besteht.: läßt man im Osten einen Ausweg, so fließt das Wasser nach Osten; öffnet man nach Westen einen Ausweg, so fließt es nach Westen. Die Natur kennt keinen Unterschied zwischen Gut und Nichtgut, ebenso wie das Wasser keinen Unterschied zwischen Ost und West kennt.«
Mong Dsï sprach: »Sicherlich kennt das Wasser keinen Unterschied zwischen Ost und West; ist aber auch kein Unterschied zwischen oben und unten? Die menschliche Natur neigt zum Guten, wie das Wasser nach unten fließt. Unter den Menschen gibt es keinen, der nicht gut wäre, ebenso wie es kein Wasser gibt, das nicht abwärts fließt. Man kann das Wasser, wenn man hineinschlägt, aufspritzen machen, daß es einem über die Stirn geht; man kann es durch eine Wasserleitung treiben, daß es auf einen Berg hinaufsteigt; aber ist das etwa die Natur des Wassers? Es ist nur die Folge äußerer Bedingungen. Ebenso ist die menschliche Natur so beschaffen, daß man sie dazu bringen kann, nicht gut zu sein.«
Gau Dsï sprach: »Das Leben Hier kommt der Naturalismus des Gau Dsï zum Vorschein. Infolge seiner Konsequenz kann ihn Mong Dsï leicht ad absurdum führen, wobei freilich nicht zu übersehen ist, daß die von Mong Dsï und Gau Dsï gleichermaßen als Absurdität empfundene These von der qualitativen Naturgleichheit zwischen Mensch und Tier von den modernen europäischen Naturalisten mit Freudigkeit akzeptiert würde, ebenso wie in China etwa von einem Yang Dschu. Ein Kommentar bemerkt zu der Diskussion: »Gau Dsï hätte auf die Frage, ob das Weiß der weißen Feder dem Weiß des weißen Schnees gleich sei, antworten sollen: ›Was die Eigenschaft der Farbe anlangt, sind weiße Federn, Schnee, Steine gleich, doch sind sie ihrem Wesen (Natur) nach verschieden; die Feder ist ihrem Wesen nach leicht, der Schnee weich, der Stein hart.‹ Daß Gau Dsï alles bejaht, das bringt ihn nachher in die schwierige Konsequenz der Gleichheit der Natur von Hund, Ochse und Mensch.« Eine sehr gute Beurteilung der Sache gibt Dschu Hi, freilich auf Grund eines im Laufe der Zeit feiner ausgebildeten Gedankenapparates. Er sagt: »Die Natur (Wesen ›Sing‹) Ist die Vernunft, die die Menschen vom Himmel mitbekommen, das Leben (›Schong‹) ist die animalische Kraft, die die Menschen vom Himmel mitbekommen. Die Wesensnatur des Menschen ist jenseits der Erscheinung (Noumenon), die animalische Lebenskraft ist diesseits der Erscheinung (Phainomenon). Alle menschlichen Wesen haben diese Wesensnatur und diese animalische Lebenskraft. Was die animalische Lebenskraft anlangt, so äußert sie sich in Empfindung und Bewegung. Hierin sind Mensch und Tier nicht verschieden. Was die Vernunft anlangt, so ist sie die Fähigkeit zu Moral, Ästhetik und Wissenschaft, die den Tieren in ihrer Vollkommenheit abgeht. Dieses menschliche Wesen ist schlechthin gut und die Krone der Schöpfung. Gau Dsï kennt nicht die vernünftige Natur des Menschen, sondern verwechselt sie mit der animalischen Natur. Aus diesem Irrtum entspringen alle die In den übrigen Abschnitten erwähnten Theorien ... Gau Dsï kennt nur das Äußerliche der Empfindungen und Bewegungen, in dem Menschen und Tiere übereinstimmen, er kennt nicht das Geistige von Moral, Ästhetik und Wissenschaft, wodurch sich der Mensch vom Tier unterscheidet.« ist es, das man als Natur bezeichnet.«
Mong Dsï sprach: »Bezeichnet man das Leben als Natur, wie man weiß als weiß bezeichnet?«
Gau Dsï bejahte.
Mong Dsï sprach: »Ist das Weiß einer weißen Feder gleich dem Weiß des weißen Schnees, und ist das Weiß des weißen Schnees gleich dem Weiß des Marmors?«
Gau Dsï bejahte.
Mong Dsï sprach: »Dann ist also die Natur des Hundes gleich der Natur des Ochsen und die Natur des Ochsen gleich der Natur des Menschen?«
Gau Dsï sprach: »Das Verlangen nach Nahrung und Schönheit ist Natur. Darum ist die Liebe etwas Innerliches, das nicht erst von außen hinzukommen muß. Die Pflicht aber ist etwas Äußerliches, nichts Innerliches Der Unterschied, auf den Gau Dsï zur Stützung seiner Theorie, daß die Pflicht ein heteronomes Kulturprodukt sei und nicht der Natur autonom entsprungen, ist in diesem Abschnitt derjenige zwischen subjektiv und objektiv begründeten Gefühlen. Darum ist er bereit, wenigstens die Sympathie als ebenfalls im Subjekt begründet anzuerkennen, insofern sie ein spontanes Gefühl ist wie Hunger und Frauenliebe, wogegen die Ächtung – die er als Beispiel für Pflicht anführt – einfach die Anerkennung eines objektiven Tatbestandes in der Art eines synthetischen Urteils a posteriori bedeute. Mong Dsï hat es von hier aus leicht, ihn ad absurdum zu führen, erstens indem er auf den Unterschied zwischen logischer These und Wertsetzung hinweist, und zweitens einer genaueren Präzisierung gegenüber, indem er den Hunger unter Gau Dsïs Definition mit subsumiert. Daß in der Bekämpfung von Gau Dsïs Sophismen ein geschickt verborgener Sophismus auch bei Mong Dsï unterläuft, darauf hat schon Mau Si Ho gelegentlich hingewiesen. Gau Dsï hatte behauptet: »Wo immer das Verhältnis des Jüngeren zum Älteren in Betracht kommt, tritt die Pflicht der Achtungsbezeugung in Kraft, ganz unabhängig von persönlicher Zu- oder Abneigung.« Die entsprechende Formulierung müßte auf dem Gebiet der Nahrungsaufnahme heißen: »Wo immer Nahrung in Betracht kommt, tritt Appetit ein, ganz unabhängig von persönlichem Geschmack.« Statt dessen begeht Mong Dsï, indem er statt Speise »Braten« setzt, eine Subreption. Wie gesagt, handelt es sich bei diesen Plänkeleien, ähnlich wie bei den Wortgefechten des Dschuang Dsï und Hui Dsï, nicht um wirkliche Auseinandersetzungen, sondern nur um »Abfuhr« des Gegners. Daß Mong Dsï übrigens im höheren Sinn recht hat, da die Pflicht nicht etwas Heteronomes (wie Gau Dsï sagt), sondern etwas Autonomes ist, dürfte seit Kant keinem Zweifel mehr unterliegen..«
Mong Dsï sprach: »Was heißt das: die Liebe ist innerlich, die Pflicht äußerlich?«
Gau Dsï sprach: »Wenn der andere älter ist, behandle ich ihn als älteren; diese Achtung vor dem Älter entspringt nicht in mir. Es ist gerade so, wie ich ein Ding, das weiß ist, als weiß bezeichne, indem ich mich nach der äußerlichen Tatsache seines Weißseins richte. Darum nenne ich die Pflicht äußerlich.«
Mong Dsï sprach: »Ob ich ein weißes Pferd als weiß bezeichne, oder ob ich einen weißen Menschen als weiß bezeichne, das macht keinen Unterschied. Ich weiß nun nicht: Ist auch kein Unterschied, ob ich ein altes Pferd als alt behandle, oder ob ich einen alten Mann als alt behandle? Ferner: Ist das Alter Pflicht oder ist die achtungsvolle Behandlung des Alters Pflicht?«
Gau Dsï sprach: »Meinen eignen Bruder, den liebe ich; den Bruder eines Mannes von Tsin, den liebe ich nicht. Es liegt also an mir, daß ich diese Art Zuneigung empfinde. Darum nenne ich sie innerlich. Dagegen ehre ich den älteren Angehörigen eines Mannes aus Tschu, ebenso wie ich auch meine eigenen älteren Angehörigen ehre. Es liegt also in dem Älter des anderen, daß ich diese Art von Zuneigung empfinde. Darum nenne ich sie äußerlich.«
Mong Dsï sprach: »Ich esse den Braten eines Mannes von Tsi ganz ebenso gern wie ich meinen eigenen Braten esse. Mit derlei Dingen verhält es sich also ganz ebenso. Ist also etwa auch der Geschmack am Braten etwas Äußerliches?«
Mong Gi Dsï Der Abschnitt ist ein Nachspiel der Disputationen zwischen Mong Dsï und Gau Dsï. Gung-Du Dsï ist der unter No. 4 genannte Jünger, Mong Gi Dsï der als No. 20 genannte Schüler, der Bruder von No. 16, aus der weiteren Umgebung des Mong Dsï. Erst wird Gung-Du Dsï von Mong Gi Dsï in die Enge getrieben. Mong Dsï eröffnet ihm dann eine neue Parade, indem er den Unterschied zwischen persönlicher und amtlicher Ehrung einführt. Als Mong Gi Dsï sich damit noch nicht zufrieden gibt, versteht es Gung-Du Dsï, ihn durch geschicktes Konsequenzziehen ad absurdum zu führen; denn daß Essen und Trinken etwas »Innerliches« sei, war ja auch von Gau Dsï zugegeben. Die ganze Beweisführung leidet darunter, daß der Begriff der Pflicht hier ungebührlich verengert wird. Es handelt sich bei der vorliegenden Frage gar nicht um I »Pflicht«, sondern um Li »Sitte, Ritus«. Daß die Sitte als äußerliche Handlung durch äußerliche Verhältnisse mitbestimmt wird, ist ohne weiteres klar, wenn auch der Imperativ, der Sitte gemäß zu handeln, ein innerer, autonomer ist. Es handelt sich um den Unterschied von prinzipieller Willensrichtung, die »innerlich« ist, und empirischer Anwendung, die »äußerlich« ist. Zu den erwähnten Bräuchen ist folgendes zu bemerken: Nach den Gemeindeopfern pflegte ein gemeinsames Festmahl der Opfergenossen abgehalten zu werden, bei dem die Reihenfolge der Bewirtung streng an den dem Alter entsprechenden Rang sich hielt. Das von Mong Dsï angezogene Beispiel eines jüngeren Gliedes der Familie als Stellvertreter der Ahnen geht auf einen aus der totemistischen Clanverfassung stammenden Brauch bei den Ahnenopfern zurück. Das Hausheiligtum befand sich hinter der Halle. Die dunkle Südwestecke (zur Heiligkeit der Südwestecke vgl. auch Lun Yü III, 13) war der Sitz des Lars, des ältesten Ahnen der Familie. Daran schlossen sich in wechselnder Generationenfolge die übrigen Ahnen an, geschieden in dunkle (mu, vom Eingang, durch den das Licht kam, abgekehrte) und helle (dschau, der Tür zugekehrte). Die Ahnen wurden beim Opfermahl durch einen Knaben aus der Familie, den sogenannten Leichenknaben, vertreten. Da je zwei aufeinander folgende Generationen zwei verschiedenen Clanreihen angehörten, mußte der Ahn jeweils von einem Glied zweitnächster Generation vertreten werden. fragte den Gung-Du Dsï und sprach: »Inwiefern kann man die Pflicht als etwas Innerliches bezeichnen?«
Gung-Du Dsï sprach: »Sie ist ein Ausdruck meines Gefühls der Achtung; darum nenne ich sie etwas Innerliches.«
Jener sprach: »Wenn ein Dorfgenosse um ein Jahr älter ist als mein älterer Bruder, wen achte ich mehr?«
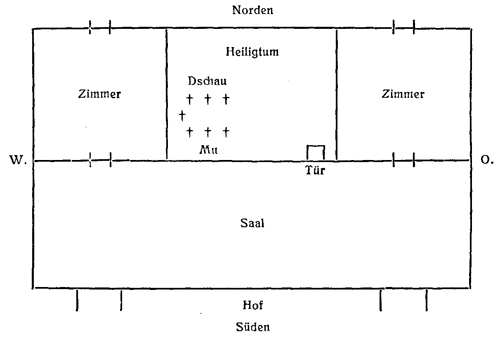
Gung-Du Dsï sagte: »Meinen Bruder.«
Jener fuhr fort: »Wem aber gieße ich beim Festmahl zuerst Wein ein?«
Gung-Du Dsï sprach: »Dem Dorfgenossen.«
Jener sprach: »Auf der einen Seite ist die Achtung, auf der andern Seite das höhere Alter. Demnach wird der Unterschied in der Ehrenbezeigung tatsächlich durch etwas Äußeres bestimmt und richtet sich nicht nach dem inneren Gefühl.«
Gung-Du Dsï konnte darauf nicht antworten und erzählte es dem Mong Dsï.
Mong Dsï sprach: »Auf die Frage: Wen ehrst du mehr, deinen Oheim oder deinen jüngeren Bruder? wird jener antworten: ›Meinen Oheim ehre ich mehr.‹ Wenn du dann fragst: ›Wenn aber dein jüngerer Bruder beim Ahnenopfer den verstorbenen Großvater darstellt, wen ehrst du dann mehr?‹ dann wird jener antworten: ›Ich ehre meinen jüngeren Bruder mehr.‹ Dann magst du fragen: ›Wo bleibt da die Achtung für den Oheim?‹ Jener wird antworten: ›Es kommt in diesem Falle auf die Stellung an.‹ Dann magst du auch sagen: ›Es kommt in jenem Falle auf die Stellung an. In der Regel ist die größere Achtung auf Seiten meines Bruders, ausnahmsweise bezeuge ich vorübergehend dem Dorfgenossen die höhere Achtung.‹«
Mong Gi Dsï hörte es und sprach: »Das eine Mal ehre ich meinen Oheim, weil ihm die Ehre gebührt; das andere Mal ehre ich meinen jüngeren Bruder, weil ihm die Ehre gebührt. Der Grund dafür ist aber doch tatsächlich ein äußerer, er richtet sich nicht nach dem inneren Gefühl.«
Gung-Du Dsï sprach: »Im Winter trinkt man heiße Suppe, im Sommer trinkt man kaltes Wasser; somit wäre auch Essen und Trinken etwas Äußerliches.«
Gung-Du Dsï sprach: »Gau Dsï behauptet, die Natur sei weder gut noch böse. Andere behaupten, die Natur lasse sich gut machen oder böse machen; darum als die guten Könige Wen und Wu herrschten, sei das Volk dem Guten zugetan gewesen, als die schlechten Könige Yü und Li herrschten, sei das Volk zu Gewalttätigkeiten geneigt gewesen. Wieder andere behaupten, es gäbe teils solche, die von Natur gut, und teils solche, die von Natur böse seien. So habe es unter einem Yau als Fürsten Menschen wie Siang gegeben. Umgekehrt habe ein Vater wie Gu Sou einen Schun zum Sohne gehabt. Mit einem Dschou Sin Nach der gewöhnlichen Überlieferung ist nur Bi Gan der Oheim des Dschou-Sin. We Dsï Ki ist sein älterer Bruder. Vgl. Schï Gi. als Neffen und gleichzeitig als Herrscher habe es einen We Dsï Ki und einen Königsohn Bi Gan gegeben. Wenn man nun sagt, die Natur sei gut, so haben jene alle Unrecht.«
Mong Dsï sprach: »Die natürlichen Triebe tragen den Keim zum Guten in sich; das ist damit gemeint, wenn die Natur gut genannt wird. Wenn einer Böses tut, so liegt der Fehler nicht in seiner Veranlagung. Das Gefühl des Mitleids Vgl. II, A, 4. ist allen Menschen eigen, das Gefühl der Scham und Abneigung ist allen Menschen eigen, das Gefühl der Ächtung und Ehrerbietung ist allen Menschen eigen, das Gefühl der Billigung und Mißbilligung ist allen Menschen eigen. Das Gefühl des Mitleids führt zur Liebe, das Gefühl der Scham und Abneigung zur Pflicht, das Gefühl der Achtung und Ehrerbietung zur Schicklichkeit, das Gefühl der Billigung und Mißbilligung zur Weisheit. Liebe, Pflicht, Schicklichkeit und Weisheit sind nicht von außen her uns eingetrichtert, sie sind unser ursprünglicher Besitz, die Menschen denken nur nicht daran Die Worte »(die Menschen) denken nur nicht daran« werden von einem alten Zitat nach unten gerückt: »Daß die Naturen der Menschen um das Doppelte, Fünffache, ja Unendliche voneinander verschieden sind, kommt davon her, daß manche ihre Anlagen nicht erschöpfend zur Darstellung zu bringen vermögen. Daß sie ihre Anlagen nicht erschöpfend zur Darstellung zu bringen vermögen, kommt nur davon her, daß sie nicht darüber nachdenken.«. Darum heißt es: ›Wer sucht, bekommt sie; wer sie liegen läßt, verliert sie.‹ Daß so große Unterschiede vorhanden sind, daß manche doppelt, fünffach, ja unendlich mehr besitzen als andere, kommt nur davon her, daß diese ihre Anlagen nicht erschöpfend zur Darstellung bringen.
Im Buch der Lieder Vgl. Schï Ging III, III, Ode 6. heißt es:
›Gott schuf die Menschen in der Welt,
Und jedes Ding hat sein Gesetz,
Das jeder fest im Herzen trägt,
Der hehren Tugend zugetan.‹
Meister Kung sprach: ›Der dies Lied gemacht hat, der kannte die Wahrheit. Wo immer eine Fähigkeit im Menschen ist, hat sie ihr festes Gesetz. Und weil den Menschen allen dieses Gesetz ins Herz geschrieben ist, darum lieben sie jene hehre Tugend.‹«
Mong Dsï sprach: »In fetten Jahren sind die jungen Leute meistens gutartig, in mageren Jahren sind die jungen Leute meistens roh. Nicht als ob der Himmel ihnen verschiedene Anlagen gegeben hätte; die Verhältnisse sind schuld daran, durch die ihr Herz verstrickt wird.
Es ist gleichwie mit der Gerste. Sie wird gesät und geeggt. Der Boden sei derselbe. Die Zeit des Pflanzens sei dieselbe. So wächst sie üppig heran, und wenn die Zeit zur Ernte da ist, so ist sie alle reif. Es mögen wohl Unterschiede da sein, wie sie vom fruchtbaren oder unfruchtbaren Boden, vom lebenspendenden Regen und Tau, von der Verschiedenheit der Arbeit der Menschen herkommen. Alle Dinge, die zur selben Art gehören, sind einander ähnlich, warum sollte man das allein beim Menschen bezweifeln? Die Heiligen sind von derselben Art wie wir In diesem Abschnitt entwirft Mong Dsï ein Bild vom Wesen des Menschen, durch das die grundlegende Übereinstimmung trotz gelegentlicher Abweichungen in der Empirie ans Licht tritt. In Analogie zur Gleichheit der sinnlichen Konstitution wird eine ebensolche Gleichheit des Geistigen vorausgesetzt: Die Menschheit als sinnlich-geistiges Wesen, das in den Einzelmenschen sich denselben gleichartigen Ausdruck verschafft wie die Gerste oder irgendeine andere biologische Einheit..
So sprach Lung Dsï Lung Dsï, nach Dschau Ki unbekannter Weiser aus der alten Zeit. Vgl. III, A, 3.: ›Wenn einer, auch ohne den Fuß eines Menschen zu kennen, eine Strohsandale für ihn macht, so weiß ich, er wird keinen Korb machen. Die Strohsandalen sind einander ähnlich, weil alle Füße auf Erden übereinstimmen.‹
So ist es auch mit dem Geschmack. Alle Menschen stimmen in ihrer Vorliebe für gewisse Wohlgeschmäcke überein. Der berühmte Koch I Ya I Ya, berühmter Koch des Fürsten Huan von Tsi (684-642). Vgl. Liä Dsï VIII, 11. hat nur zuerst unseren Geschmack erraten. Wenn der Geschmack der Menschen gegenüber den Speisen von Natur so verschieden wäre, wie der der Pferde und Hunde von dem unsrigen abweicht, wie würden da alle Menschen auf Erden in Geschmackssachen dem I Ya folgen? Daß in Geschmackssachen alle Welt sich nach dem I Ya richtet, ist ein Beweis, daß alle Welt in Beziehung auf den Geschmack an Speisen übereinstimmt.
Mit dem Gehör ist es genau dasselbe. Alle Welt richtet sich in Fragen des Wohlklangs nach dem Musikmeister Kuang
Über den Musikmeister Kuang vgl. IV, A, 1 und die dort zitierten Stellen., somit stimmt das Gehör auf der ganzen Welt überein. Mit dem Gesicht ist es ebenfalls dasselbe. Es gibt niemand auf der Welt, der einen Dsï Du
Dsï Du, der chinesische »Adonis«. Im Schï Ging 1, 7, Ode 10, steht der Vers:
»Ich seh nicht einen Dsï Du,
Ich seh nur einen wilden Kerl.«
Er soll identisch sein mit Gung-Sun O, einem Minister in Dschong aus der Zeit ca. 700 v. Chr., der wegen seiner Schönheit berühmt war. nicht schön finden würde. Wer einen Dsï Du nicht schön fände, müßte keine Äugen haben.
So sehen wir also: Der Geschmack ist so beschaffen, daß alle übereinstimmen in Beziehung auf den Wohlgeschmack der Speisen. Das Gehör stimmt überein in Beziehung auf den Wohlklang der Töne. Das Gesicht stimmt überein in Beziehung auf die Schönheit der Erscheinungen.
Und was das Herz anlangt: nur hier allein sollte es keine solche Übereinstimmung geben? Was ist es nun, worin die Herzen übereinstimmen? Es ist die Vernunft Li = Vernunft bezeichnet ursprünglich die Maserung des Nephrits, dann Streifen, endlich die innere Achtung vor dem Pflichtgesetz. In der Sungzeit ist der Ausdruck im Sinne von Vernunft dann sehr häufig. I = Gerechtigkeit ist das äußere pflichtmäßige Handeln., es ist die Gerechtigkeit. Die Heiligen haben zuerst gefunden, worin unsere Herzen übereinstimmen, darum erfreut Vernunft und Gerechtigkeit ganz ebenso unser Herz, wie Mastfleisch Im chinesischen Text sind zwei Arten von Masttieren angegeben: »Tschu« = Rinder und Schafe, die mit Gras gemästet werden, und »Huan« = Hunde und Schweine, die mit Korn gemästet werden. unsern Gaumen erfreut.«
Mong Dsï sprach: ›Die Wälder auf dem Kuhberg Der Kuhberg liegt im Süden der alten Hauptstadt von Tsi, dem heutigen Lin Dschï Hiän in Schantung. Vgl. Liä Dsï VI, 12. waren einstens schön. Aber weil er in der Nähe der Markung einer Großstadt lag, wurden sie mit Axt und Beil gefällt. Konnten sie da schön bleiben? Doch wirkte Tag und Nacht die Lebenskraft, Regen und Tau feuchteten den Boden; so fehlte es denn nicht, daß neue Triebe und Sprossen wuchsen. Da kamen die Rinder und Schafe dahinter und weideten sie ab. Nun steht er kahl da. Und wenn die Menschen ihn in seiner Kahlheit sehen, so meinen sie, er sei niemals mit Bäumen bestanden gewesen. Aber wie will man behaupten, das sei die Natur des Berges?
Und ganz ebenso verhält es sich mit den Menschen. Wie kann man sagen, daß sie nicht Liebe und Pflicht in ihrem Herzen haben? Aber wenn einer sein echtes Herz verloren gehen läßt, so ist das gerade, wie wenn Beil und Axt in den Wald kommen. Wenn er Morgen für Morgen es verwüstet, kann es da gut bleiben? Doch das Leben wächst weiter Tag und Nacht; in der Kraft der Morgenstunden werden seine Neigungen und Abneigungen denen der anderen Menschen wieder ähnlich. Aber wie lange dauert's Der Text liegt hier in verschiedenen Lesarten vor., dann schlagen seine Tageshandlungen sie wieder in Fesseln und zerstören sie. Wenn so seine besseren Regungen immer wieder gefesselt werden, so ist schließlich die Kraft der Nacht nicht mehr stark genug, sie zu erhalten, und er sinkt herunter auf eine Stufe, da er vom Tier nicht mehr weit entfernt ist. Wenn nun die Menschen sein tierisches Wesen sehen, so meinen sie, er habe niemals gute Anlagen gehabt. Aber wie will man behaupten, das seien die wirklichen Triebe des Menschen?
Darum: es gibt nichts, das nicht wachsen würde, wenn ihm seine rechte Pflege zuteil wird, und es gibt nichts, das nicht in Verfall geriete, wenn es der rechten Pflege entbehren muß.
Meister Kung sprach Das hier zitierte Wort Kungs wird sonst nirgends erwähnt.: ›Halt es fest, und du behältst es; laß es los, und du verlierst es. Es kommt und geht; kein Mensch weiß, wo und wann.‹ Das sagt er vom Herzen.«
Mong Dsï sprach: »Kein Wunder, daß der König nicht verständig wird Es ist unbestimmt, wer der König ist, von dem hier die Rede ist. Vermutlich König Süan von Tsi.. Selbst eine Pflanze, die von allen Pflanzen auf Erden am leichtesten wächst, kann nicht gedeihen, wenn man sie einen Tag in die Sonne stellt und dann wieder zehn Tage der Kälte aussetzt. Ich sehe ihn nur selten. Wenn ich gehe, so kommen die andern herbei und machen ihn wieder kalt. Wenn ich dann auch einen Keim in ihm entwickelt habe, was hilft's!
Das Schachspiel ist als Kunst nur eine kleine Kunst. Aber wer nicht mit ganzem Herzen und festem Willen dabei ist, lernt es nicht. Der Schachspieler Tsiu ist der beste Schachspieler im ganzen Land Das genannte Schachspiel ist dasselbe wie das in Liä Dsï VIII, 19 genannte. Es wird mit zwölf Steinen gespielt, ein Mittelding zwischen Schach- und Würfelspiel. Über den Schachspieler Tsiu ist sonst nichts bekannt. Wörtlich heißt er der Schach-Tsiu.. Angenommen, der Schachspieler Tsiu unterrichtet zwei Leute im Schachspiel. Der eine ist mit ganzem Herzen und festem Willen dabei und hört nur auf die Worte des Schachspielers Tsiu. Der andere hört wohl auch hin, aber in seinem Herzen denkt er nur daran, daß jetzt ein Schwan käme; er stellt sich vor, wie er den Bogen spannt, den Pfeil auflegt und nach ihm schießt. Obwohl er mit dem andern zugleich lernt, kommt er ihm doch nicht gleich. Ist es etwa, daß sein Verstand geringer wäre? Ich sage: Nein!«
Mong Dsï sprach: »Ich liebe Fische, und ich liebe auch Bärentatzen. Wenn ich nicht beides vereinigen kann, so lasse ich die Fische und halte mich an die Bärentatzen.
Ich liebe das Leben, und ich liebe auch die Pflicht. Wenn ich nicht beides vereinigen kann, so lasse ich das Leben und halte mich an die Pflicht. Ich liebe wohl auch das Leben, aber es gibt etwas, das ich mehr liebe als das Leben; darum suche ich es nicht mit allen Mitteln zu erhalten. Ich hasse wohl auch den Tod, aber es gibt etwas, das ich noch mehr hasse als den Tod; darum gibt es Nöte, denen ich nicht ausweiche.
Wenn es nichts gäbe, das der Mensch mehr liebte als das Leben, warum sollte ihm dann nicht jedes Mittel recht sein, um sein Leben zu behalten? Wenn es nichts gäbe, das der Mensch mehr haßte als den Tod, warum sollte er nicht alles tun, um der Not zu entgehen? Darum daß er etwas, das ihm das Leben erhalten könnte, doch nicht benützt und etwas, das ihn der Not entgehen ließe, doch nicht tut, muß es etwas geben, das man mehr liebt als das Leben und etwas, das man mehr haßt als den Tod. Nicht nur die Weisen haben diese Gesinnung; sie ist allen Menschen gemeinsam. Die Weisen verstehen es nur, sie nicht zu verlieren. Angenommen, es handle sich um einen Korb Reis oder eine Schüssel Suppe. Leben oder Tod hängen davon ab, ob man sie bekomme oder nicht bekomme. Wenn sie unter Scheltworten angeboten werden, so wird selbst ein Landstreicher sie nicht annehmen; wenn sie mit einem Fußtritt hingeworfen werden, so wird selbst ein Bettler sich nicht herablassen, sie anzunehmen. Aber wenn es sich um Millionen Wörtlich 10 000 Dschung. Ein Dschung ist gleich 30 Pfund. Vgl. II, B, 10. handelt, dann nimmt man sie an, ohne allzu genau nach Ordnung und Recht zu fragen. Aber wie könnten die Millionen mein Ich bereichern! Ja, ich kann mir schöne Häuser und Paläste bauen, kann mir von Frauen und Mägden dienen lassen, und meine notleidenden Bekannten haben an mir einen Halt.
Was ich vorhin nicht angenommen hätte, da es um's Leben ging, das tue ich jetzt den schönen Häusern und Palästen zuliebe. Was ich vorhin nicht angenommen hätte, da es um's Leben ging, das tue ich jetzt dem Dienst von Frauen und Mägden zuliebe. Was ich vorhin nicht angenommen hätte, da es um's Leben ging, das tue ich jetzt der Retterrolle zuliebe gegenüber den notleidenden Bekannten. Aber einem solchen Manne ist nicht mehr zu helfen, denn sein eigenes Herz ist verloren gegangen.«
Mong Dsï sprach: »Menschenliebe Menschenliebe, Jen, ist die innerliche Gesinnung, Sympathie; Ai ist die auf ein bestimmtes äußeres Objekt gerichtete Äußerung dieser Gesinnung. ist die natürliche Gesinnung des Menschen. Pflicht ist der natürliche Weg Der Weg ist im Laufe des Gleichnisses nicht mehr genannt. Denn wenn erst das Herz wiedergefunden ist, so folgt es von selbst dem Weg. des Menschen. Wie traurig ist es, wenn einer seinen Weg verläßt und nicht darauf wandelt, wenn einer sein Herz verloren gehen läßt und nicht weiß, wie er es wieder finden kann!
Wenn einem Menschen ein Huhn oder ein Hund verloren geht, so weiß er, wie er sie wieder finden kann; aber sein Herz geht ihm verloren, und er weiß nicht, wie suchen. Die Bildung dient uns zu nichts anderem als nur dazu, unser verloren gegangenes Herz zu suchen Über das Ziel der Bildung herrscht große Meinungsverschiedenheit zwischen der Schule Dschu His und der Schule Wang Yang Mings. Während Dschu Hi lehrt: das Ziel der Bildung ist nichts anderes, als die ursprüngliche Güte des Herzens wieder zu erlangen (dazu bedarf es aber als Mittel der Aneignung von Kenntnissen), lehrt Wang Yang Ming: die Bildung besteht in gar nichts anderem, als die ursprüngliche Güte des Herzens in sich wieder zu entdecken. Erkennen und Handeln sind eins. Sie dulden zwischen sich keinerlei Vermittlung. Letzten Endes dreht es sich in diesem Kampf um das Problem der Kulturübertragung. Man wird sagen müssen, das was ist Natur, das wie jedoch ist Kultur..«
Mong Dsï sprach: »Angenommen, mein Goldfinger Wörtlich: der namenlose Finger, so genannt, weil er keinem besonderen Zweck dient. sei gekrümmt und lasse sich nicht strecken. Es tut nicht weh, und es stört nicht bei der Arbeit. Aber wenn es einen gibt, der ihn strecken kann, so scheut man nicht den Weg von Tsin nach Tschu Wörtlich: man hält den Weg zwischen Tsin (im äußersten Nordwesten) und Tschu (im äußersten Süden) nicht für weit., weil der Finger nicht ist wie die der andern Leute. Wenn ein Finger nicht ist wie die eines normalen Menschen, so ist man ungehalten darüber. Wenn aber das Herz nicht ist wie das eines normalen Menschen, so ist man nicht ungehalten darüber: das heißt nicht wissen, worauf es ankommt Wörtlich: das heißt, die Klassen nicht kennen..«
Mong Dsï sprach: »Wenn den Leuten wirklich daran liegt, Paulownia- oder Katalpenbäume Der Tung-Baum ist identifiziert mit der Paulownia imperialis. Das Holz wird zu Lauten verwandt. Der Dsï-Baum ist heutzutage Lindera tsimu. Doch wird das klassische Dsï mit Katalpa Kaempferi identifiziert. Das Holz dient zu Holzplatten für den Druck. Interessant ist der Vergleich des Abschnittes mit Dschuang Dsï IV, 6. Dort ist gesagt, daß die Leute solche Bäume als Stäbe für Affenkäfige benutzen wollen., die ein oder zwei Spannen im Umfang haben, zu ziehen, so wissen alle, wie man sie pflegen muß. Das eigne Leben aber, das wissen sie nicht zu pflegen. Lieben sie etwa das eigene Leben weniger als jene Bäume? Nein, es ist nur Gedankenlosigkeit.«
Mong Dsï sprach: »Der Mensch liebt alle Teile seines Leibes. Weil er alle seine Körperteile liebt, darum pflegt er sie alle. Wenn er keinen Fußbreit oder Zollbreit Haut hat, den er nicht liebt, dann vernachlässigt er in seiner Pflege auch nicht das kleinste Stückchen Haut.
Wenn man erkennen will, ob einer tüchtig ist oder untüchtig, so braucht man auf nichts anderes zu sehen als darauf, welchen Teil er besonders wichtig nimmt. Der Leib hat edle Teile und unedle, hat wichtige Teile und geringe. Man darf nicht um des Geringen willen das Wichtige schädigen und nicht um des Unedlen willen das Edle schädigen. Wer seine geringen Teile pflegt, ist ein geringer Mensch, wer seine edlen Teile pflegt, ist ein edler Mensch Die Pflege des Herzens als des wichtigsten Teiles der Persönlichkeit wird an zwei Gleichnissen vom Gärtner und vom Arzt erläutert. Das chinesische Sehen kann sowohl die Bedeutung ›Leib‹ als ›Persönlichkeit‹ haben, so daß das Herz, wenn auch als edelster Teil, doch ein Teil davon ist. Die Bäume werden von vielen mit den im letzten Abschnitte genannten identifiziert. Genauere Definition ergibt, daß es sich um ähnliche, doch nicht gleiche handelt. Wu ist Sterkulia platanifolia, Gia ist Katalpa boyeana, die kleinere Blätter hat als die andere. Die Dornbüsche sind wohl auch zwei: Dauerdorn und Schlehe (Zizyphus). Das mit Quacksalber wiedergegebene Wort scheint im Chinesischen ein Schreibfehler zu sein. Wörtlich heißt es Wolf-kranker Mensch oder Wolfs-eiliger Mensch. Das Wort »dsï« muß nach Mong Dsï Dschong I so korrigiert werden, daß es den im Text gegebenen Sinn bekommt..
Wenn ein Gärtner seine Sterkulien und Katalpen vernachlässigte und pflegte seine Dornen und Schlehen, so wäre das ein unnützer Gärtner. Wenn ein Arzt nur an dem einen Finger herumkuriert und dabei den ganzen Arm zugrunde gehen läßt, ohne es zu merken, so ist das ein Quacksalber. Einen Fresser und Säufer verachten die Menschen, weil er das Geringe auf Kosten des Wichtigen pflegt. Wenn ein Fresser und Säufer richtig handelte, da wäre ja Mund und Magen mehr wert als sonst ein Stück Haut, das einen Fuß oder Zoll breit ist.«
Gung-Du Dsï Gung-Du Dsï ist der unter No. 2 genannte Jünger. fragte den Mong Dsï und sprach: »Es sind doch alle in gleicher Weise Menschen. Wie kommt's, daß manche große Menschen sind und manche kleine?«
Mong Dsï sprach: »Wer dem Großen in sich folgt, wird groß; wer dem Kleinen in sich folgt, wird klein.«
Jener sprach: »Es sind doch alle in gleicher Weise Menschen. Wie kommt es, daß manche dem Großen in sich folgen und manche dem Kleinen?«
Mong Dsï sprach: »Die Sinne des Gehörs und Gesichts werden ohne das Denken von dem Sinnlichen umnachtet. Wenn Sinnliches außer ihm auf Sinnliches in ihm trifft, so wird der Mensch einfach mitgerissen. Das Gemüt ist der Sitz des Denkens. Wenn es denkt, so erfüllt es seine Aufgabe, wenn es nicht denkt, so erfüllt es sie nicht.
Beides zusammen ist uns von Gott verliehen. Wenn wir zuerst das Höhere in uns festigen, so kann es uns durch das Niedrigere nicht geraubt werden. Die das tun, das eben sind die großen Menschen.«
Mong Dsï sprach: »Es gibt einen göttlichen Adel und einen menschlichen Adel. Gütigkeit, Gerechtigkeit, Gewissenhaftigkeit, Zuverlässigkeit, unermüdliche Liebe zum Guten: das ist der göttliche Adel. Fürst sein oder Hoher Rat oder Minister: das ist der menschliche Adel. Die Alten pflegten ihren göttlichen Adel Zur Zeit der streitenden Reiche war zwar der Geist der Moral entwichen, doch hielt man immer noch einigermaßen den Schein aufrecht; daher lohnte es sich noch, moralisch zu sein. Später hörte auch das auf, und es hat noch lange Zeit gedauert, bis die öffentliche Moral wieder einigermaßen sich hob., und der menschliche Adel kam danach von selber. Heutzutage pflegt man seinen göttlichen Adel, um den menschlichen zu erlangen. Wenn man den menschlichen Adel erreicht, so wirft man den göttlichen Adel weg. Das aber ist die schlimmste Verblendung. Und schließlich führt es doch zum sicheren Untergang.«
Mong Dsï sprach: »Der Wunsch nach Ehre liegt allen Menschen am Herzen. Alle Menschen haben Ehre in sich selbst, ohne daß sie daran denken. Die Ehre bei den Menschen ist nicht die echte Ehre. Wen ein Herrscher Wörtlich: Dschau-Mong = Dschau, der Älteste. Dschau war der Titel von mehreren Geschlechtshäuptern aus der Familie Dschau im Staate Dsin. Dschau Giän Dsï, der auch in Liä Dsï und Dschuang Dsï erwähnt ist, war der berühmteste unter ihnen. Die Familie war sprichwörtlich wegen ihrer Macht. ehren kann, den kann ein Herrscher auch erniedrigen.
Im Buch der Lieder Vg. Schï Ging III, 2, Ode 3. heißt es:
›Er gibt uns süßen Weins genug
Und sättigt uns durch seine Güte.‹
Damit ist gesagt, daß, wer sich sättigt an Güte und Gerechtigkeit, nicht mehr nach anderer Leute Fett und feinem Reis begehrt. Wer so lebt, daß weit und breit sein Name einen guten Klang hat, der begehrt nicht nach anderer Leute Schmuck und Stickerei.«
Mong Dsï sprach: »Güte siegt über Ungüte wie Wasser über Feuer siegt. Aber heutzutage übt man die Güte so, als wollte man mit einem Becher Wasser einen brennenden Wagen voll Reisig löschen, und wenn die Flammen nicht erlöschen, dann sagen, daß Wasser Feuer nicht löschen könne. Dadurch wird gerade die Ungüte aufs äußerste gefördert, und das Ende ist, daß die Güte zugrunde geht Das Übel entsteht daraus, daß man die Schuld an seinem mangelnden Erfolg nicht bei sich selber sucht, sondern an der Möglichkeit des Erfolgs schlechthin verzweifelt..«
Mong Dsï sprach: »Das Korn Das Korn, wörtlich die fünf Getreidearten, nämlich Reis, Hirse, klebrige Hirse, Weizen und Bohnen. ist am wertvollsten unter allen Samen. Wenn es aber nicht reif ist, so ist es nicht einmal so viel wert wie Samen von Gras und Quecken Die beiden Unkräuter Di und Bai sind Panicum crusgalli und eine verwandte Art.. Auch bei der Güte kommt alles auf die Reife an.«
Mong Dsï sprach: »Der Schütze I Der Schütze I ist der in IV, B, 24 erwähnte. verlangte, als er die Leute im Bogenschießen unterrichtete, daß sie den Bogen voll anspannten. Der Lernende muß auch seinen Willen voll anspannen. Ein rechter Maurer lehrt seine Schüler Zirkel und Winkelmaß gebrauchen. Der Lernende muß auch Zirkel und Winkelmaß gebrauchen Interessant ist die in der chinesischen Literatur übrigens sehr häufige Anspielung auf die Freimaurerembleme Zirkel und Winkelmaß als Symbole des Lernens..«