
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Listenreicher als jedes Raubtier ist der Mensch, wenn er auf Raub ausgeht. Das hat auch das Fischlein am kühlen Grunde erfahren müssen. Es ist erstaunlich, auf wieviel Arten er dem Fischlein nachzustellen vermag. Vom einfachen Erhaschen mit der Hand, wie es die Wilden verstehen und wie die Jugend in den Bergen die Forelle fängt, über Stechen und Schießen hinweg bis zu der modernen Fallenstellerei, die mit Treib-, Schlepp- und Stellnetzen, mit der Ringwade und mit der Reuse betrieben wird – ganz zu schweigen von der Angelfischerei und ihrer auf Massenfang berechneten Spielart, der Leinenfischerei. Mit Fackeln lockt er den Fisch listig herbei und ins Verderben, und chemischer Mittel bedient er sich (verbotenerweise), indem er dem Fischwasser ungebrannten Kalk beimischt und den Fisch betäubt oder – brutal und einfach – eine Dynamitpatrone oder Handgranate unter Wasser zur Explosion bringt. Um den wandernden Hering zu finden, hat man gar ein Heringslot erdacht, einen dünnen Draht, der ins Wasser hinabgelassen wird, an den der wandernde Hering anstößt und so seine Gegenwart verrät – und geübte Benutzer dieses Heringslotes sollen gar aus der Stärke, in der der Draht erzittert, erkennen können, ob der gelotete Heringsschwarm klein oder mächtig ist. Auch ein Unterwasserfernrohr kennt man (in Norwegen), mit dem man den in etwa 30 m Tiefe wandernden Hering direkt sieht.
Auf unserer Fischdampferreise haben wir es mit dem Schleppnetz zu tun. Wie sein Name sagt, schleppt es am Meeresgrunde. Es in seinen Grundzügen zu beschreiben ist nicht schwer. Der Leser denke sich ein mächtiges fischartiges Ungeheuer, vorn mit einem riesigen breiten Maule, hinter dem ein nach hinten eng und enger werdender Rumpf nachschleppt. Das Ganze ist aus Netzwerk gearbeitet, Maschenwerk aus Manilahanf. Vorn am Maul sind die Maschen verhältnismäßig groß (um kleinen, nicht verwendbaren Fisch entschlüpfen zu lassen), nach hinten zu werden die Maschen enger. Das Ungetüm erhascht seine Beute mit dem geöffneten Maule. Ist dieses passiert, so gerät sie in den Rumpf, und zwar durch ein trichterförmiges inneres Netz, das eine Art Falltür darstellt, indem es dem gefangenen Fisch unmöglich macht, etwa umzukehren und durch das geöffnete Maul wieder in die Freiheit zu entschlüpfen. Aus dem Rumpf wird der gefangene Fisch in das Hinterteil des Ungeheuers getrieben und ist hier vom engmaschigen Netze fest umschlossen, so daß er warten muß, bis fremde Kraft, nämlich der Fischer, ihn wieder »befreit«. Zwar besitzt das Ungeheuer – auch in diesem Punkte einem lebenden Wesen vergleichbar – dort hinten eine Öffnung, aber die ist durch einen besonderen »Schließmuskel« geschlossen; der wird in diesem Falle durch einen haltbaren Strick dargestellt, mit dem der Netzsack hinten zugebunden ist.
Eine besondere Betrachtung verdient das Riesenmaul. Gleich jedem richtigen Maul besteht es aus Ober- und Unterlippe. Es erinnert in einem Punkte an die berühmte Habsburger Physiognomie, nämlich darin, daß die eine Lippe stark vortritt, die andere stark zurück. Doch ist es bei unserem Netzungeheuer nicht die Unterlippe, die vorgeschoben ist, sondern die Oberlippe. Mit der Unterlippe schiebt das Ungeheuer über den Meeresboden und scheucht den Fisch auf, der dort ahnungslos steht oder – wenn Plattfisch – sich meist in den weichen Sand eingebuddelt hat. Der Fisch schreckt auf, will nach oben entfliehen – aber da ist ihm die Oberlippe im Wege, die sich bereits weit vor- und daher über den Fisch geschoben hat. Er muß also seitlich entfliehen. Rechts und links sind ihm die »Mundwinkel« im Wege. Bleibt ihm noch die Wahl zwischen vorn und hinten. Aber ehe er sich noch über die Lage so recht klar geworden ist, befindet er sich schon innerhalb des Maules und gleitet durch den Netztrichter in den Rumpf. Hinten im Netzsack findet er dann seine Leidensgefährten.
Von der Maulöffnung bis zur Schwanzspitze mißt ein solches Netzungeheuer (bei den heute üblichen Größen) etwa 40 m. Ebenso breit ist das Maul.
Damit dieses Fanggerät seinen Zweck erfüllt, ist die erste Voraussetzung begreiflicherweise: das Maul muß nach oben wie vor allem seitlich richtig geöffnet sein. Das Maul oben offen zu halten, also die Oberlippe (die wir von nun an Obernetz nennen) hoch zu halten, dies macht weiter kein Kopfzerbrechen: das bringt der Betrieb von allein mit sich, denn das Netz wird ja an Drahtseilen gezogen, die nach oben zum Schiff führen. Zug nach oben ist also sowieso gegeben. Nicht so einfach ist es, das Maul auch seitlich richtig offen zu halten. Die ursprüngliche Art ist wohl die, daß sich zwei Schiffe in das Schleppen teilen, von denen jedes ein Drahtseil schleppt und somit jedes einen »Maulwinkel«. Die beiden Fahrzeuge brauchen dann nur unter sich entsprechenden Abstand zu halten, und das Maul des Netzes klafft seitlich genügend auseinander. So ist es gehandhabt worden, als die Schleppnetzfischerei noch von Segelschiffen ausgeübt wurde. Man kann sie auch heute noch sehen, von Haffseglern und von ganz kleinen Fischdampfern. Es ist diese Art des Schleppens zu zweit natürlich nicht wirtschaftlich. Die Engländer kamen deshalb auf den Gedanken, die seitliche Öffnung des Netzmaules durch eine eingespannte lange Stange zu erreichen. Dann war natürlich nur noch ein Dampfer zum Schleppen nötig. So ist es auch viele Jahre gehandhabt worden. Man nannte das Netz dann »Baumnetz«. Das Fischen mit dem Baumnetz ist das, was der Engländer unter »Trawlfischerei« versteht. Es bedeutete gegenüber der Zwillingsfischerei einen erheblichen Fortschritt. Durch die Verwendung des Baumes wurden nun aber der Größe des Netzes enge Grenzen gesetzt, denn aus technischen Gründen könnte der Baum nicht länger als 20 m sein, die Öffnung des Maules also nicht breiter. Da kam eine neue Verbesserung auf: die Scherbretter. Man schaltete dort, wo die Drahtseile am Netze ziehen, je ein festes Brett ein, das so befestigt wurde, daß es beim Ziehen schräg zur Zugrichtung stehen muß, – und zwar das eine im entgegengesetzten Sinne des andern. Bei der Befestigung des einzelnen Brettes wurde also dasselbe Prinzip angewendet, das jeder Junge kennt, der sich je einen Papierdrachen selber angefertigt: der Drachen darf nicht lotrecht zur Leine (d. h. zur Zugrichtung) stehen, sonst steigt er nicht, und darf sich erst recht nicht in die Zugrichtung stellen dürfen, sonst fällt er herunter. Die gezwungenermaßen in schräger Stellung stehenden Scherbretter suchen, sobald der Dampfer Zug ausübt, infolge des auf sie wirkenden Wasserdruckes seitlich zu entweichen – das eine rechts, das andere links. Auf diese Weise wird das Netz auseinandergezogen, d. h. das Maul seitlich offen gehalten.
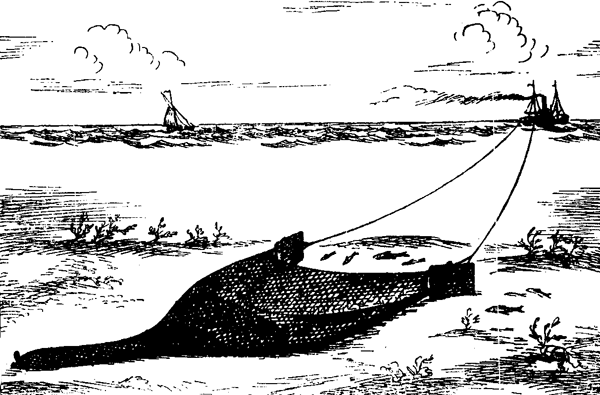
Hochseedampffischerei mit Schleppnetz.
Die schräg zur Zugrichtung stehenden Scherbretter haben das Bestreben, nach außen zu entweichen, und halten so die vordere Öffnung des Netzes offen.
Es ist ein gewisser Streit entbrannt, wer diese Scherbretter eigentlich erfunden hat. Die Engländer nehmen den Ruhm ebenso für sich in Anspruch wie die Holländer und die Deutschen. Aber der Gedanke, sie einzubauen, lag eigentlich so nahe, daß wohl vermutet werden darf: es sind mehrere zu gleicher Zeit und unabhängig voneinander auf ihn gekommen. Anders schon die Frage: wer die Scherbretter verbessern wird oder schon verbessert hat? Die Dinger sind schwer, messen an sechs Geviertmeter, bestehen aus dicken eichenen Bohlen und sind, der starken Abnutzung halber, schwer mit Eisen beschlagen. Trotzdem verbrauchen sie sich schnell, und Widerstand am Meeresboden geben sie auch, hemmen also die Geschwindigkeit des Schiffes. Es ist deshalb mit radförmigen Scherbrettern versucht worden. Die sollen also am Boden nicht mehr schleifen, sondern über ihn hinwegrollen wie die Wagenräder. Dem Vernehmen nach befriedigte das Ergebnis nicht. Was man sich übrigens hätte denken können, denn ein Rad dreht sich nur dann, wenn seine Achse lotrecht oder annähernd lotrecht zur Richtung der Bewegung steht, nicht aber wenn die Achse mit dieser Richtung fast übereinstimmt oder einen ganz spitzen Winkel bildet.

Auf der »Dortmund« beim Hieven. Das Obernetz ist über die Reeling hereingezogen. Nun blickt alles gespannt nach unten, um die Größe des Fanges abzuschätzen. Am interessiertesten ist »Ägir«, der große Fischliebhaber.

Des Grundschleppnetzes hinterstes Ende, wo der gefangene Fisch sich zusammendrängt, ist mit Maschinenkraft über Deck gewunden und die Schleife des unteren Verschlusses gelöst. Nun rauscht der Fang an Deck.
Wie die Scherbretter, leidet auch das Unternetz durch Schleifen am Boden, zumal an der vorderen Kante, dem Rande der »Unterlippe«. Deshalb ist dort ein dickes, kräftiges Tau eingezogen. Selbst dieses hält nicht stand, sofern der Meeresboden steinig, felsig ist. Für solchen Untergrund haben die Fischdampfer ein zweites Netz an Bord, das im übrigen genau so eingerichtet ist wie das erstbeschriebene, nur daß hier das eben erwähnte »Grundtau« noch durch eine Anzahl kurzer Holzrollen von der Größe eines kleinen Wagenrades geschützt ist.
Die Geschwindigkeit, mit der dieses Schleppnetz über den Meeresboden geschleppt wird, beträgt – wir hörten es schon weiter oben – bei deutschen Fischdampfern höchstens knapp drei Seemeilen die Stunde. Mehr ist nicht herauszuholen, weil die Maschinen mit ihren 400 PS nicht mehr hergeben. Die Fischdampfer anderer Völker haben stärkere Maschinen. Die Isländer, die mit ihrer Hochseefischerei recht auf der Höhe sind, haben auf ihren fast durchgehend neuen Dampfern 600 PS. Wir bringen dieses Beispiel, weil gerade die isländische Überlegenheit (bitte: nur in diesem Punkte!) von den Deutschen schmerzlich empfunden wird. Nicht nur fangen die Isländer mehr als unsere Leute, weil sie eben mit ihren stärkeren Maschinen statt drei Seemeilen stündlich deren fünf abfischen können – sie fischen an den deutschen Fischdampfern auch vorbei, überholen diese und haben den Fisch verjagt, wenn der Deutsche dorthin kommt, wo kurz zuvor der Isländer war. Deshalb steht die Sehnsucht jedes deutschen Fischdampferkapitäns nach stärkeren Maschinen, die »besser durchreißen«. Aber woher das Geld nehmen? Deutschland ist arm geworden (das weist auch der Leser), und unserer Hochseefischerei geht es nicht gut, wie der Leser noch erfahren wird.

Das Netz ist wieder außenbords gebracht und alles mit seinem Aussetzen beschäftigt. Inzwischen liegt der Fisch, soweit er noch lebt, in den letzten Zügen. Deutlich erkennbar sind die schlanken Aale (die als einzige noch lange leben), die großen fleischigen Seehechte; auch Rochen und Seeteufel hat der Fang gebracht, sowie Unmengen von Brassen, Langusten, Taschenkrebsen.
Stärkere Maschinen wären auch aus einem anderen Grunde wünschenswert. Es gehört eine Menge Drahtseil dazu, ein Schleppnetz über den Meeresboden zu ziehen! Jedes der beiden Seile muß etwa dreimal länger sein, als die Meerestiefe der betreffenden Gegend beträgt. Schleppt man auf 200 m Tiefe, so muß man zweimal 600 m Drahtseil mitschleppen! Nun liegen die Verhältnisse aber nicht selten so, daß man den Fisch in 300, in 400 m Tiefe suchen muß, wenn man überhaupt welchen fangen will. Dazu gehören zweimal 900 bis 1200 m Drahtseil! Die haben ein ungeheures Gewicht und wollen aufgewunden sein! Um es kurz zu sagen: für Seile dieser Länge reichen weder die Kräfte der Maschinen auf deutschen Fischdampfern noch die Größenmaße der Winden. Den zu kleinen und schwachen deutschen Fischdampfern sind 250 m Tiefe als Grenze gesetzt! Was tiefer steht – und es ist oft der beste Fisch! – holt sich der Engländer oder der Isländer.
Das Netz, das dort unten in der finsteren Tiefe über dem Meeresboden schleppt und mit seinem breiten Maule den Fisch in sich hineinschlingt, wird alle sechs Stunden gehievt; wir hörten es schon. Bei ruhigem Wetter ist das keine Mühe. Dabei wollen wir jetzt ein wenig zuschauen.
Zunächst überzeugen wir uns, wie eigentlich die beiden Drahtseile geführt sind, an denen das Netz geschleppt wird (Kurrleinen heißen sie fachmännisch). Bei der Winde beginnen sie. Die eine Kurrleine führt von dort nach dem vorderen Galgen an Steuerbord, die andere zu dem hinteren Galgen am selben Bord. Von dort gehen sie außenbords nach hinten, wo sie kurz vor dem Heck durch einen eisernen Haken zusammengehalten sind (andernfalls ließe sich das Schiff nicht steuern). Hinter dem Haken verschwinden sie unten im Wasser. Trotzdem man hier von ihnen nur ein kurzes Stück sieht, ist deutlich zu erkennen, wie sie nach unten hin auseinandergehen: das bewirken die Scherbretter, die rechts und links auseinanderstreben. Soll gehievt werden, so wird der Haken losgeschlagen. Die beiden Kurrleinen werden von seiner Umklammerung befreit, und sofort springt die über den vorderen Galgen gehende Leine los; die Divergenz der beiden Kurrleinen ist nun noch größer.
Auf zweierlei ist beim Hieven zu achten: Das Schleppgeschirr darf nicht etwa in die Schraube geraten – und ist das Netz oben, so muß der Dampfer mit Steuerbord gegen den Wind liegen; andernfalls würde der Wind das Schiff auf das Netz treiben. Der ersteren Gefahr begegnet der Kapitän, indem er sein Schiff während des Hievens einen Halbkreis beschreiben läßt; er legt das Schiff also quer zur bisherigen Fahrtrichtung (und läßt dann natürlich stoppen). Nun hat er das Netz weit vor seinem Steuerbord liegen. Man sieht es an den Kurrleinen: die bilden jetzt einen rechten Winkel mit der Schiffsachse. Während der Drehung, die mit langsamer Fahrt ausgeführt wird, zieht die Winde die Kurrleinen mit dem Netz nach oben. Bis es an der Wasseroberfläche erscheint, vergehen volle fünf Minuten.
Was sich zuerst zeigt, sind die Scherbretter. Die Kurrleinen ziehen sie hoch, bis jedes an seinem Galgen hängt, und nun hat das Aufwinden natürlich ein Ende, weil's weiter eben nicht geht. Die Winde hört auf zu arbeiten. Blickt man jetzt über Bord, so ist das ganze vordere Netz in seiner vollen Breite sichtbar. Sein hinteres, schlauchförmiges Ende hängt weiter draußen und noch tiefer im Wasser. Aber es verrät sein Dasein schon: Luftblasen steigen dort hinten auf. Sie kommen aus geplatzten Fischblasen! Der Fisch, den wir gefangen und nach oben gebracht haben, stammt ja aus ansehnlicher Tiefe. Sein Organismus ist auf schwereren Wasserdruck eingestellt. Hier oben ist der Druck geringer, kann der inneren Spannung im Fische nicht mehr das Gleichgewicht halten, die Schwimmblasen platzen. Der Fisch ist regelrecht explodiert; nur war die Explosion nicht stark genug, ihn etwa in Stücke zu zerreißen.
Trotzdem die Mannschaft jetzt alle Hände voll zu tun erhält, werden die aufsteigenden Blasen aufmerksam betrachtet. Aus ihrer Menge läßt sich schon jetzt schließen, ob man viel im Netz hat oder nicht. War der Fang reichlich, so bilden die aufsteigenden Blasen geradezu einen Luftstrom, und scheint gerade die Sonne, so sieht das wunderhübsch aus, wie da im bläulich-grünlichen Wasser eine hellgrüne Strömung nach oben schießt. Auch kleine Fischchen kommen hoch, denen es gelang, aus den Maschen zu entkommen. Meist sind sie tot; zappeln sie noch, so ist doch ihr Schicksal in den nächsten Sekunden besiegelt, denn gierige Möwen (die sich schon auf das bloße Geräusch der arbeitenden Winde um das Schiff sammelten) stürzen sich auf sie und – verschlingen sie? Ach nein, so schnell geht das nicht. Die Möwe muß das Fischlein beim Kopf packen, sonst kann sie es nicht schlucken. Aus Angst vor den Menschen an Bord wie aus Sorge um die Konkurrenz läßt sie sich auf entsprechendes Manövrieren im Fluge nicht ein, sondern nimmt den Fisch auf, wie sie ihn gerade packen kann, und trägt ihn davon, um ihn weiter draußen in Ruhe zu verzehren. Auch dies bleibt freilich nur eine Hoffnung, denn kaum hat sie ihre Beute im Schnabel, so ist sie von der Konkurrenz umringt, die ihr den Bissen abjagen will. Sie nimmt Reißaus, die andern ihr nach. Verfolgt man das futterneidische Volk mit dem Glase, so sieht man, das Fischlein wechselt noch oft den Besitzer, bis es verschlungen ist.
Aus diesen Betrachtungen reißt uns ein schallendes »Hurra!« Die Mannschaft begrüßt mit ihm den beutelförmigen hintersten Teil des Netzes (den »Steert«), der soeben an der Wasseroberfläche erschienen ist. Das tut er nur, wenn er genug Auftrieb hat, und die Ursache des Auftriebes ist immer ein guter Fang. Daher die Freude.
Nun also die Beute an Bord gebracht! Dazu muß zunächst der vordere Teil des Netzes über die Reeling gezogen werden. Mit Menschenkraft. Man holt das Grundtau (also die Unterlippe des Riesenmaules) herauf. Steuerleute und Matrosen, dicht aneinandergedrängt, stehen an der Reeling, fassen mit allen zehn Fingern in die Maschen und ziehen nun das Netz herein. Das Ziehen muß richtig über die Kante der Reeling hinweg geschehen, denn das Netz will infolge seiner Schwere immer wieder zurück ins Wasser, und man kann es nur halten, wenn es auf der Reeling fest aufliegt. Manch Fischlein steckt in den Maschen, auch Krebse und Seesterne. Sie haben hinausgewollt aus dem schrecklichen Gefängnis, sind aber im Garn steckengeblieben. Nun schneidet sich das in ihre Seiten, denn die Maschen strecken sich, da an ihnen gezogen wird. Geht das Ziehen leicht, so bleibt Zeit, die Tiere zu befreien. Aber oft kann die Mannschaft auf sie nicht achten. Dann kommen sie mit hoch, über die Kante der Reeling – und werden dort zerquetscht, brechen zum wenigsten das Rückgrat, daß es knallt und man zusammenschrickt.
Das Ziehen geht weiter, nach dem Kommando des Ersten Steuermanns: »Hol' – up! – Hol' – up!«. Jetzt wird auch das Obernetz heraufgeholt und über das Unternetz geschlagen. Nun wird an beiden mit eingehakten Fingern gezogen. Je mehr von dem Netz man herein hat, um so schwerer wird die Arbeit, denn nun kommt man allmählich an den gewichtigen Steert. Die Bewegung der See muß helfen. Legt sich das Schiff nach Steuerbord, dann wird gezogen. Nun hebt es sich hier, um nach Backbord zu tauchen; jetzt heißt es: festhalten die schwere Last! Oft genug rutscht sie wieder hinab – bei hohem Seegang manchmal mit solchem Ruck, daß über Bord gezogen wird, wer sich zu fest in die Maschen eingekrallt hatte und die Finger nicht schnell genug frei bekommt. Auch der Kapitän hilft jetzt mit, einer der Heizer – und gar Ägir, der brave Schiffshund, den wir in seiner Hilfsbereitschaft dem Leser schon vorstellten. Nun ist auch das Mittelstück des Netzes an Bord; draußen baumelt jetzt nur noch der Steert. Noch einmal: »Hol' – up!«, dann heißt es: »Smitt tosamm!« (schmeiß' zusammen!) Das Netz, das hier bloß noch ein Schlauch ist, wird von rechts und links zusammengelegt und um diese Stelle ein Seil geschlungen. Das Seil läuft über den Vordermast zur Winde, der Steert kann also nunmehr mit Maschinenkraft gehoben und an Deck gebracht werden. Man entleert ihn auf dem Platze zwischen Mannschaftslogis und Winde.
Dieser vorher freie Platz hat sein Aussehen ein wenig verändert, seit das Fischen begonnen hat. Mitten auf ihm hat man dicke Bohlen auf Kante gestellt und so mehrere Bassins (»Fächer«) gebildet. Die werden nachher unter Wasser gesetzt. Zwar sind sie nicht regelrecht abgedichtet; das Wasser rinnt aus Ritzen und Fugen wieder hinaus. Aber das macht nichts. Es fehlt an Wasser ja nicht; die Dampfspritze schafft genügend Ersatz herbei für das wenige, was davonrinnt. Die zu Bassins zusammengesetzten Bohlen haben noch einen anderen Zweck als den, das Wasser zusammenzuhalten: durch sie ist das flache Deck in kleinere Kammern untergeteilt, so daß der Fisch bei heftigen Bewegungen nur kurze Strecken hin und her rutschen kann. Ließe man ihn hemmungslos von einer Bordseite zur andern rutschen, dann ginge er zum großen Teil über Bord.

Der Fang wird sortiert – in Körbe und Fächer, die durch auf Kante gestellte Bohlen gebildet sind. Dem Sortieren folgt gründliches Säubern und Waschen.
Der Steert ist jetzt an Deck geholt und baumelt fast 2 m hoch über dem Platze, an dem sein Inhalt verarbeitet werden wird. Mit ihm haben zunächst nur die beiden Steuerleute zu tun. Die übrigen, einschließlich des Kapitäns, beeilen sich, schadhafte Stellen im Netze zu flicken, denn ohne Löcher geht die Schlepperei selbstverständlich nicht ab. Sie beeilen sich! Das Netz soll so schnell wie möglich wieder hinab, denn jede Zeitvertrödlung schmälert das Endergebnis der Fangreise.
Der Steert – er hängt jetzt wie ein riesiger Tropfen von der Talje am Segelbaum herab – ist unten nur zugebunden. So fest das Verschlußseil auch hält, ist es doch so kunstvoll geknotet, daß es sich mit einem Ruck aufziehen läßt. Das besorgt der Erste Steuermann. Der Steert sperrt unten auseinander und sein Inhalt purzelt auf Deck. Ein Haufen – ein Berg Fisch! Die meisten sind tot. Nicht wenige aber schlagen noch eine Weile mit der Schwanzflosse. Die Aale sind munter, als sei überhaupt nichts geschehen. Sie suchen zu entschlüpfen. Man muß staunen, wie schnell sie die Abflußlöcher für das an Deck kommende Wasser zu finden wissen, trotzdem sie zum ersten Male an Bord eines Fischdampfers sind. Aber die Löcher sind verstopft; es führt kein Weg zurück in die Freiheit. Munter sind auch die Taschenkrebse, die Hummern und die Langusten. Sie krabbeln sich heraus aus dem Haufen, der sie zu ersticken droht.
Was in den Maschen festsitzt, wird herausgeholt und auf den Haufen geworfen. Dann kann der Steert wieder zugebunden werden. Die beiden Steuerleute steigen hinauf auf den schlüpfrigen Haufen, denn anders können sie nicht heran an den Steert. Das Schlingen des kunstvollen Knotens ist Sache des Ersten Steuermanns. Bald ist das Werk getan. Sind die übrigen inzwischen mit dem Netzflicken am Ende, so kann das Gerät wieder zu Wasser; andernfalls beteiligen sich die beiden jetzt am Flicken.
Das Aussetzen des Schleppgeschirrs gleicht dem Hieven, nur in umgekehrter Reihenfolge. Der Steert wird ins Wasser gelassen, dann das übrige Netz. Geduldig wird abgewartet, bis das Ganze seine richtige Lage im Wasser eingenommen hat. Nun läßt die Winde die Kurrleinen ablaufen, die Scherbretter verschwinden im Wasser, das Schiff setzt sich in Bewegung. Nach fünf Minuten ist das Netz am Grunde. Jetzt bleibt bloß noch übrig, die Kurrleinen hinten am Heck durch den Haken wieder zusammenzukoppeln. Der Haken wird beim vorderen Galgen auf die Kurrleine gelegt. An ihm ist eine lange Leine befestigt, die außenbords von vorn nach hinten reicht bis an die Stelle, an der der Haken zuletzt zu wirken hat. Zwei Mann stehen neben diesem Fleck, das Ende der Leine in der Hand. Der Mann, der den Haken am Vordergalgen über die Kurrleine legte, läßt ihn nun los und schreit denen hinten zu: »Hol' ihn achter!« Der Haken rutscht auf der glatten Trosse sofort von allein nach hinten; die beiden Leute mit der Leine laufen schleunigst nach vorn zur Winde. Um deren Kopf schlingen sie die Leine, die Winde fängt zu arbeiten an und der Haken, der schon im Wasser verschwunden war, wird wieder heraufgezogen an den ihm bestimmten Ort; mit ihm die Kurrleine, die nun mit der andern gekoppelt wird. Auch dies ist Aufgabe des Ersten Steuermannes.
Hieven und Wiederaussetzen sind beendet. Im Ruderhäuschen steht der Kapitän selber und allein am Ruder. Von hier kann er gleichzeitig überblicken, wie nun der gefangene Fisch behandelt wird. Mit dem ist jetzt die gesamte Mannschaft beschäftigt, abgesehen vom Koch und dem technischen Personal. Der Fisch wird zunächst sortiert, dann gewaschen. Beim Sortieren kommen die größeren und wertvolleren Arten in die beiden Bassins. Die übrigen werden in Körbe verteilt – richtige große Henkelkörbe, Marktkörbe. Ihre Größe ist so gewählt, daß jeder Korb ungefähr einen Zentner Fisch faßt. Das Ergebnis eines Fanges wird daher nicht nach Gewicht gebucht, sondern nach »Korb«. Das Sortieren geht erstaunlich schnell, freilich sind auch Leute genug damit beschäftigt. Die stehen alle in dem inzwischen ausgebreiteten Fischhaufen, durchsuchen ihn, indem sie den Fisch mit ihren Füßen bald hierhin, bald dorthin schieben, heben auf, was brauchbar ist, und werfen es in den entsprechenden Korb oder in das betreffende Bassin. Was in die Körbe fliegt, ist alles leichte Ware; was jedoch in die Bassins gehört, hat meist anständiges Gewicht – oder lebt noch und schlägt um sich wie der Aal. Auch das wird geworfen und geschleudert und klatscht in das Wasser, das man inzwischen hineinlaufen ließ. In dem einen Bassin steht der Schiffsjunge (der »Bootsmann«), denn ihm kommt zu, jeden einzelnen der wertvollen Fische aufs sauberste zu waschen. Nun, auf den Bootsmann nimmt da keiner weiter Rücksicht. Ob um den das Wasser herumspritzt oder ob ihm ein großer Bengel von Aal oder Seehecht an den Kopf oder an sonstige edle und weniger edle Körperteile fliegt: das spielt keine Rolle. Der Bootsmann kennt keine Empfindlichkeit, und gegen die Nässe ist er geschützt: unten durch hohe Wasserstiefeln, oben durch Öljacke und Südwester. Unbekümmert um das Bombardement wäscht er und wäscht er; am sorgfältigsten muß er die Kiemen mit dem Schlauch ausspritzen. Bleibt hier Schmutz sitzen, dann kommt der Fisch beim Käufer in Verdacht, »gammel« zu sein, wie der Fischhandel sagt, angegangen, verdorben (gammel ist norwegisch und bedeutet »alt«). Und man muß wirklich staunen, wieviel Schmutz zu beseitigen ist, trotzdem der Fisch doch »aus dem Wasser kam«, also eigentlich blitzblank sein müßte. Der Schmutz ist in der Hauptsache Sand vom Meeresboden, den das Schleppnetz aufgewirbelt hat.
Mit dem Waschen der kleineren Sorten macht die Mannschaft weniger Umstände. Der im Korbe liegende Fisch wird unter Schütteln abgespritzt. Ist der Korb für genügende Durchführung dieser Prozedur zu voll, so wird sein Inhalt eben auf zwei Körbe verteilt.

Ländlich – sittlich! In Portugal kommt Seefisch unausgenommen auf den Markt. Je voller und runder er aussieht, um so besser wird er bezahlt (als vermeintlich besonders fett). Die Fischweiber verbessern die Preise, indem sie die Fische zuvor – aufpusten! Wie? – das zeigt unser Bild.
Sortieren und Waschen waren auf der »Dortmund« auch bei guten Fängen in einer kleinen Stunde erledigt. Der Portugiese ist ja, wie erzählt, so freundlich, auf Schlachten und Ausnehmen zu verzichten, Auch waren die Fänge der »Dortmund« nicht gerade groß (wenngleich befriedigend wegen der Güte des Fisches). Mehr als fünfundzwanzig Korb in je sechs Stunden hatten wir wohl nie. Ganz anders sieht sich die Sache aber vor Island an, wo die doppelte Menge als schlechter Fang gilt; und auch an anderen Fangplätzen sind die Mengen größer als vor Marokko (wenngleich weniger dankbar im Preise). Während vor Marokko das Fischen fast ein Sport genannt werden kann, sind Mühe und Arbeit auf den anderen Fangplätzen unendlich größer: die größere Menge zu verarbeiten und außerdem jeder Fisch vor dem Sortieren auszunehmen! Ein Schnitt in den Hals, dann ist der Fisch geschlachtet. Nun der Bauch geöffnet und die Eingeweide herausgenommen. Die Leber (fettreich bei allen Fischen) kommt in Fässer, um zu Tran verarbeitet zu werden; das übrige fliegt über Bord. Dann Sortieren und Waschen. Dies alles dauert nicht eine Stunde, sondern drei, auch vier! Und in dieser ganzen Zeit mit den Händen im kalten Wasser manschen, dazu Winterkälte, Sturm, Sturzseen – nein, leicht oder behaglich ist der Beruf des Hochseefischers nicht!
Nach dem Waschen marschiert der Fisch in den Eisraum. Der liegt, wie früher erwähnt, unmittelbar unter dem Platz, wo Sortieren und Waschen vor sich gingen. Der Raum ist durch senkrechte Querwände in eine Anzahl Kammern geteilt, Nischen oder Boxen in Pferdeställen ähnlich. In der Mitte führt ein schmaler Gang von vorn nach hinten. Von diesem Gange aus wird der Fisch in die Kammern auf Eis gepackt. Diese Arbeit erfordert Sorgfalt, Auch sie gehört daher zu den heiligsten Pflichten des Ersten Steuermanns. Die Kammern lassen sich nach dem Gange zu durch Querbrettchen abschließen, und zwar immer so hoch, wie die Kammer gefüllt ist.
Ist der Fisch verpackt, so meldet der Steuermann dem Kapitän die Menge; das Ergebnis wird in ein besonderes Buch eingetragen. Hiermit ist dieser Abschnitt der Fangreise erledigt. Die Mannschaft hat unterdessen das Deck gesäubert, nämlich alles, was nicht brauchbar war, über Bord geschaufelt und die Reste mit der Dampfspritze zum Schiffe hinausgejagt – sehr zum Entzücken der zahllosen Möwen. Nun herrscht wieder Ruhe. Das Schiff zieht weiter gemächlich seine Bahn. Man träumt hinauf zur Sonne oder zu den funkelnden Sternen und denkt an den Fisch, der Jetzt dort unten in der schwarzen Tiefe aus ähnlichen Träumen aufgeschreckt wird und voller Entsetzen in das offene Maul des Netzes schießt, um sechs Stunden später sein bißchen Leben für das Raubtier Mensch auszuhauchen.