
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
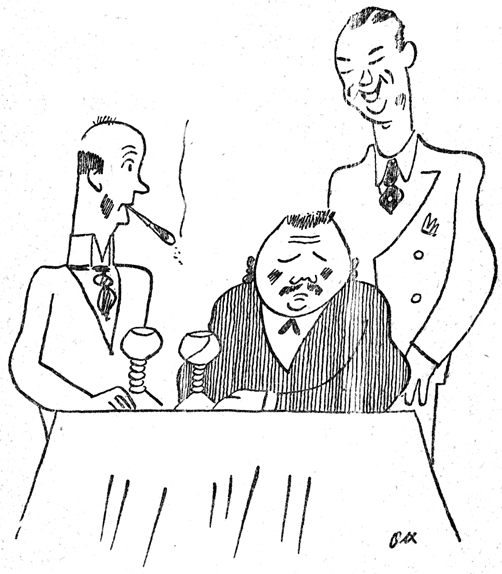
Zwei friedliche und freundliche Herren sitzen im kühlduftenden Ratskeller bei einer Flasche Niersteiner Heiligenbaum, Spätlese. Ein dritter kommt am Tisch vorüber und versetzt dem einen von ihnen einen krachenden Freundschaftshieb auf die Schulter.
»Sieh, Tach, Herr Schröder.«
»Ihrer Frau gehts doch gut, nich?«
»Och, danke, dja, soweit.«
»No, und Ihr Sohn, der kömmt dja wohl in Trinidad gut voran, nich?«
»Och, danke, dja, soweit.«
»Und Ihre Tochter heiratet dja wohl bald, nich?«
»Dja, das soll se dja wohl.«
»No, denn will ich mal. Wiedersehen, Herr Schröder.«
»Wiedersehen.«
Der Dritte entfernte sich. Pause. Dann sagte der bisher schweigende Zweite erstaunt:
»Du heißt dja gar nich Schröder.«
»Nee.«
»Un denn bist du dja auch gar nich verheiratet.«
»Ich kann mich woll wahren.«
»– – denn hast du dja auch keine Kinner.«
»Nich daß ich wüßte.«
Pause.
»Dja, Mensch, warum sagst du ihm das denn nich?«
Ärgerlich abwehrende Handbewegung:
» Ich mag keinen Streit haben.«
Mit meinen Sohn, der dscha noch inner Lehre is, da is mir ne ganz dolle Geschichte mit passiert,« sagte der alte Sengstake. »Gestern kömmt er zu mir rein un sagt: ›Vadder,‹ sagt er, ›voriges Djahr, als dir fuffzig Mark inner Kasse fehlten, die hatt ich dir weggenommen. Un da hab ich inner Lotterie mit gespielt, un nu hab ich da fuffzigtausend Mark auf gewonnen. Hier sind se.' Und denn legt er mir das Geld da hin.«
»Tja,« sagte der mit dieser in mehrfacher Hinsicht unmoralischen Geschichte beschenkte Zuhörer. »Dazu läßt sich ja schwer was sagen.«
»Da läßt sich schwer was zu sagen? Denn verstehen Sie nichts von Erziehung ab,« sagte der alte Sengstake. »Eers mal hab ich das Geld nachgezählt. Da fehlte nix an. Denn hab ich da die fuffzig Mark wieder vongenommen un inne Kasse reingetan, mit Zinsen. Un denn hab ich meinen Sohn den Hintern orntlich vollgehauen. ›Zo,‹ hab ich gesagt, ›un nu leg ich das Geld für dich mündelsicher an. Un daß mir nu son abasiger Kram nich wieder vorkömmt. Da is meist kein Segen bei, un du hast es nu dscha auch nich mehr nötig.‹«
Auf der Börsentreppe wurde der alte Konsul A. gefragt, wie es seinem Sohn ergehe.
»Och, der is dscha nach Philadelphia hin.«
»Ich weiß. Na, und was macht er da?«
»Och, danke, ganz gut. Viel verdienen tut er dscha noch nich; aber das soll denn dscha woll noch werden. Geheiratet hat er da dscha auch. Will ich nix gegen sagen; is'n anständiges Mädchen. Ganz gute Familie. Geld is d'r nich; sind Puritaner. Kinner haben se nich. Er schreibt, sie beten da dscheden Abend um, daß se welche kriegen. Liegt mir nix an; kost' mich dscha man mein Geld. Ich bet'r dscheden Abend gegen an.«
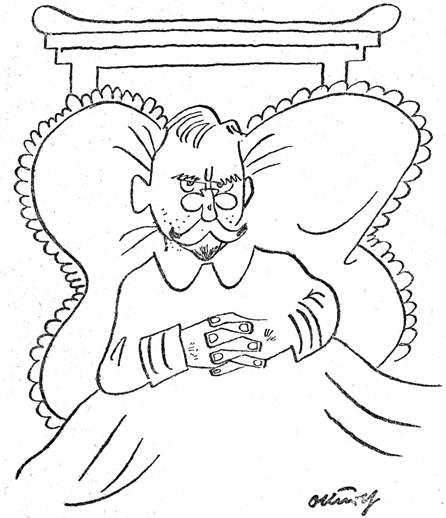
Wenn der Bremer sich vor der ernsten Aufgabe sieht, für einen »Hausbesuch« die passenden Vergnügungen zu beschaffen, geht er vor allem mit ihm in den »Bleikeller« – jene unheimliche Kammer unter dem Dom, die den sonst gebräuchlichen Verfall des Irdischen nach dem Tode in ein langsames mumienhaftes und ungemein malerisches Austrocknen verwandelt. Dieser Besuch im Hades ist besonders an Sonntagvormittagen beliebt, als ernster Auftakt zum mittäglichen Braten und den durch Kaffee und Musik gewürzten Belustigungen des Nachmittags.
Es habe, berichtet man, Frau Aline Tietjen nebst Gatten und hausbesuchendem Vetter im Bleikeller gestanden und, in die entsprechenden Gedanken versunken, die Särge betrachtet; worauf sie, durch eine reizvolle Gedankenverbindung vom Unheimlichen über das Tatsächliche auf das Nutzbare gelenkt, sich folgendermaßen geäußert habe:
»Vadder, der Hase, den ich auf'n Balkon gehangen habe, der is nu woll bald so weit.«
Das Oberhaupt einer bremischen Tabaksfirma, ein Mann, der sich durch die imponierenden Ausmaße seiner Geschäfte ein bleibendes Andenken gesichert hat, und der nebenbei durch einen leichten, ganz leichten Sprachfehler gekennzeichnet war, hatte sich einen seiner Vertreter zu einer Besprechung bestellt; und zwar hatte er, der Neigung des Vertreters wie auch seiner eigenen Neigung folgend, den Ratskeller – oder man muß wohl schreiben: Rathskeller als Treffpunkt bestimmt. Der Besuch eines Geschäftsfreundes nahm ihn unerwartet in Anspruch; und als er in Begleitung des Besuchers zwei Stunden nach der verabredeten Zeit den »Keller« betrat, war an den deftigen Holztischen des weingeheiligten Raumes der »Vertreter« nicht zu entdecken.

Wohl aber stand in einem dämmrigen Winkel, im Schatten eines mächtigen Fasses, ein unbesetzter Tisch, den mehrere leere Flaschen Niersteiner Heiligenbaum, Spätlese, zierten.
Der Tabakskönig wies auf diesen Tisch und sagte mit seherischer Sicherheit:
»D–da liegt er unter.« Es stimmte. Da lag er unter.
Als man in Bremen den Teichmannsbrunnen enthüllt hatte, der an oft umstrittener Stelle den Domshof ziert und bei guter Laune sogar durch einen ansehnlichen und kostspieligen Wasserstrahl belebt, kam eine Frau Konsul Sowieso sittlich erhitzt zum alten Bürgermeister Schultz. Dieser Brunnen sei in seiner jetzigen Form eine Bedrohung der Moral, sagte sie, und sie müsse beantragen, daß der den Brunnen krönende unbekleidete nervige Jüngling mit einem Feigenblatt versehen werde. Andernfalls seien betrübende Folgen großen Ausmaßes mit Sicherheit zu erwarten.
Der alte Bürgermeister Schultz nahm den Antrag mit patrizischem Ernst zur Kenntnis.
»Das seh' ich wohl ein, Frau Konsul,« sagte er. »Das Feigenblatt soll er haben. Das kriegen wir bewilligt. Aber denn setz ich da 'ne Inschrift drauf.«
»'ne Inschrift, Herr Bürgermeister?« fragte Frau Konsul Sowieso. »Was denn für 'ne Inschrift?«
»Denn laß ich da draufschreiben: ›Dies Blatt gehört der Hausfrau.‹«
Als der alte Sengstake sich genötigt sah, vom aktiven Genuß der Daseinsfreuden allmählich zum passiven und betrachtenden überzugehen, ergab es sich, daß auch auf seinen Jagdausflügen – er war ein von allen Pächtern und Treibern gefürchteter Jäger – sein Interesse an der Bevölkerung des flachen (gänzlich flachen) Landes sozusagen den Schwerpunkt verlagerte: Es wandte sich von der erwachsenen weiblichen Jugend ab und wandelte sich in großväterliche Leutseligkeit gegen die unerwachsene Jugend beider Geschlechter.
Darauf gründete ein Jagdpächter, der den alten Sengstake zuweilen einzuladen pflegte, einen häßlichen Streich. Er sorgte dafür, daß der abendliche Heimweg zum Bahnhof in regelmäßigen Abständen von einzelnen Exemplaren der Dorfjugend besetzt war, die durch Bestechung – aber das kommt gleich.
»No, mein Dschung?« fragte der alte Sengstake das erste Exemplar der Gattung. »Wie heißt du denn?«
»Dschohann Sengstake,« antwortete das Exemplar.

»Zo,« sagte der alte Sengstake. »No, das kann dscha vorkommen.« Und er fragte hundert Schritte weiter das nächste Exemplar:
»No, mein Deern? Wie heißt du denn?«
»Antjen Sengstake,« versetzte das kleine Mädchen.
»Zo,« sagte der alte Sengstake leicht erstaunt und stapfte weiter.
Als ihm aber kurz vorm Bahnhof der Name Sengstake zum siebenten Male entgegendröhnte, blieb er stehen, warf einen scheuen Blick auf das vorliegende Exemplar, versank in Grübeln, zählte eine stumme Rechnung an den Fingern ab und sagte kopfschüttelnd:
»Das is dscha sonnerbar. So oft hab ich hier dscha gar nich gedschagd –?«
Die gute alte Sitte, in den Familien das Wohlbefinden unter die freundschaftliche Obhut eines Hausarztes zu stellen, war in Bremen früher von dem Brauch begleitet, die Dienste dieses ärztlichen Schutzengels mit einer festen Jahressumme abzugelten. Sie verpflichtete ihn zu Besuchen in regelmäßigen Zeitabständen. War es ein gesundes Jahr, so hatte er Glück, wurde das Haus von Krankheit heimgesucht, so hatte er Pech. Es war sozusagen eine Wette.
Der alte Doktor Th., lebendiger Mittelpunkt zahlloser und sehr bremischer Anekdoten, wurde bei einer »Visite« von der Dame des Hauses mit einem besonderen Wunsch empfangen.
»Och, Herr Doktor, uns geht das dscha soweit ganz gut. Da fehlt dscha Gott sei Dank nix an. Aber wenn Ihnen das nichts ausmacht, und Sie würden mal nach meinem Dienstmädchen sehn? Die liegt nämlich im Bett, un nu muß ich den ganzen Haushalt allein zugange kleen.«
Als der alte Herr pustend die drei Treppen bewältigt hatte, fand er für Stethoskop, Teelöffel (zum Auf-die-Zunge-Legen beim Aaah-Sagen) und oleum ricini nichts zu tun: denn Anna saß im rotgewürfelten Bett und lachte ihm mit blanken Zähnen ins Gesicht. Doktor Th. ärgerte sich:
»Du vermuxte Deern – was fällt dir denn ein? Lettst mi olen Mann hier de Treppen rupkladdern? Dir fehlt dscha nix!«
»Och nee, Herr Doktor,« sagte Anna. »Fehlen tut mir dscha nix, un das tut mir dscha nu auch leid, daß Sie da um raufklabastert sind. Ich bin dscha auch gar keinen Doktor an 'n Verlangen gewesen. Aber das is nämlich so is das: Ich kann nämlich mein Geld nich kriegen, un denn leg ich mir denn dscha ümmer im Bett.«
Der alte Herr griff sich nachdenklich mit hagerer Hand in den weißen Bart: »Kuck mal an. Sag mal, mein Deern: Hilft das denn? Ich mein: Krist du dein Geld denn nu auch?«
»Dscha, Herr Doktor. Das hilft ümmer.«
»Zo.« Die Überlegung des alten Herrn führte zu raschem Entschluß, und er versetzte Anna einen aufmunternden »Schubbs«: »Denn is das richtig. Denn mach mir da man mal 'n büschen Platz – ich hab mein Geld dscha auch noch nich.«
In einer bremischen Reitbahn erschien vor vielen Jahren ein Mann und bekundete den ernsten Willen, ein Roß für einen mehrstündigen Spazierritt zu chartern. Der Stallmeister betrachtete den Mann mit dem erbarmungslosen Blick gereifter Sachkenntnis und fand, daß er mit Ausnahme sanft geschweifter Beine kaum irgendwelche Vorbedingungen für die Meisterung eines Pferdes mitbrachte. Infolgedessen ließ der Stallmeister Diana vorführen. Sie besah sich den Reiter mit sanften und müden Augen voll abgeklärter Resignation. In diesem treuherzigen Blick war kein Falsch.
Man hob den Mann in den Sattel, und der Stallmeister gab ihm eine Klingel in die Hand.
»Was soll ich denn mit die Pingel?« wunderte sich der Mann.
»Och,« sagte der Stallmeister, »unsere Diana, die war dscha früher bei 'er Ferdebahn, nich? Un wenn Sie denn nach Horn zu reiten, denn bleibt sie denn dscha ümmer bei die Haltestellen stehn. Das hat sie noch so in 'n Kopf zu sitzen, weil daß sie so klug is. Aber wenn Sie denn zweimal abklingeln, denn geht sie denn dscha auch weiter.«
Unter den »Lohndienern«, die in den verklungenen großen Jahrzehnten den festlichen Begebenheiten in den Kreisen der oberen Fünfhundert die rechte Haltung gaben, war der maßgeblichste und am meisten anspruchsvolle der dicke Schier. Generationen half er beim Heiraten, Taufen, Festefeiern und Begrabenwerden; und mit unerbittlicher Strenge wachte er über die Innehaltung der Standesgrenzen und der patrizischen Heiratspolitik.
Als daher einer der größten Handelsherren »unter Stande« geheiratet hatte, betrachtete Schier die solchermaßen eingedrungene Dame mit Kummer, Mißtrauen und Abneigung. Und er mußte es beim »Servieren« auf einer Festlichkeit im »Künstlerverein« erleben, daß sie sich in einen peinlichen und aussichtslosen Kampf mit den Hummerscheren verwickelte.
Da neigte sich der dicke Schier, der schon heimliche Zwiesprache mit einer Flasche Château d'Yquem gehalten hatte, über die Schulter des unglücklichen Gatten und sagte leise und kummervoll:
»Tscha, tscha, Herr Konsul, ich sag's dscha ümmer: das Feine, das will und will er denn nich rein!«
Frau Meybohm hatte bei irgendeinem Festessen einen Tischherrn, dem die Aufgabe zufiel, sie nicht nur zu speisen und zu tränken (was an sich schon nicht ganz leicht war), sondern auch zu unterhalten. In seiner Verzweiflung lenkte er das Gespräch – oder vielmehr: den Vortrag auf das ergiebige Gebiet geschichtlicher Bildung und geriet dabei von Amenhotep über Julius Cäsar auf August den Starken: welch letzterer, sagte er, weit über hundert, nach anderen Quellen sogar über zweihundert springlebendige Kinder gehabt habe.
»Ochottochott, nee,« sagte Frau Meybohm, » die arme Frau!«
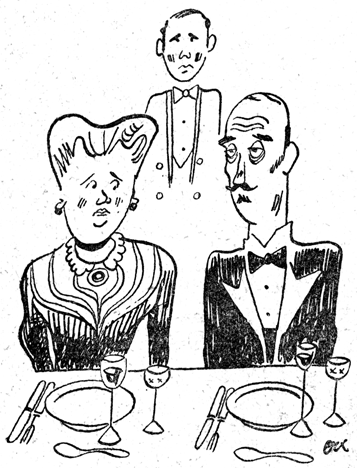
Man redet vom Theater, von Konzerten und ähnlichen Belustigungen.
»Sonnerbar kann einem das dscha gehn,« sagt der alte Sengstake. »Wissen Se, was mir mal passiert is? Nämlich da geh ich mit meiner Frau ins Philharmonische. Wir kommen en büschen spät, und das hatte denn dscha auch schon beinah angefangen. No, wie wir da denn nu so an unsern Platz wollen, da müssen die Leute denn dscha alle aufstehn, un meine Frau, die dungelt denn dscha ümmer so'n büschen achteran. Ich sag: ›Antjen,‹ sag ich, ›mach'n büschen fix zu. Du störst ja die Leute.‹ No, sie macht denn dscha auch'n büschen zu, un denn kömmt sie denn dscha auch an'n Platz. Gott sei Dank, denk ich, daß sie sitzt. Und wissen Se, was sie tut? Sie stirbt.«
An einem Stammtisch würdiger bremischer Herren in einer traditionsgebräunten Weinkneipe wurde der Beschluß gefaßt, einen zur Tafelrunde gehörenden »großen« Weinhändler, der sich an jenem Tage verspätet hatte, bei seiner Ankunft ein bißchen zu ärgern. Als er, schnaufend und erhitzt, eintrat, rief einer der Herren ihm entgegen:
»August, was hört'n denn von dir für Geschichten? Du sollst dscha wohl hunnert Faß Bickbeeren bezogen haben, wo du deinen Wein mit färbst?!«
Dem also Angeredeten schoß die rasche Zornröte zu Kopfe.
»Hunnert –?!« schrie er entrüstet. »Dascha gelogen! Das waren dscha man bloß fuffzig!«
Ein liebenswerter, weißbärtiger, allgemein geschätzter Architekt, dem die gute Stadt vielerlei treffliche Bauwerke und Anekdoten verdankt, hatte zwei hübsche Schwächen, zwischen denen vielleicht irgendeine Ursachen- oder Wirkungsverflechtung bestand: Er brachte seine mündlichen Äußerungen infolge eines fehlerhaften Zungenschlages manchmal erst nach mehrfachen Anläufen zustande; und auch seine baulichen Werke gelangen ihm zuweilen erst nach mehrfachem Start zu seiner Zufriedenheit. Was ihm nicht gefiel, pflegte er ohne sonderliche Rücksicht auf Zeit und Geld einfach wieder umzulegen.
Als daher ein ihm seit langen Jahren verbundener alter Freund ihm den Auftrag gegeben hatte, einen neuen Eingang für sein Haus zu schaffen, fand er bei seiner Rückkehr von einer Reise an Stelle des Tores einen frischen Schutthaufen vor. Er ärgerte sich ein wenig, vereinbarte mit dem Baumeister Fertigstellung bis Pfingsten und verreiste mit seiner Frau. Pfingsten fand er einen frischen Schutthaufen vor. Er wurde ernstlich böse, stellte Frist bis Juli und verreiste mit seiner Frau. Bei der Heimkehr fand er einen frischen Schutthaufen vor. Worauf er dreierlei tat: Er wurde regelrecht wütend; er zog mit seiner Frau ins Hotel; und er schrieb dem alten Freunde einen sackgroben Brief, der mit den Worten schloß: »Von heute ab kenne ich Sie nicht mehr.«
Am anderen Morgen, als die Herrschaften im Hotel beim Frühstück saßen, erschien der weißbärtige Architekt, ging auf die alte Dame zu, reichte ihr die Hand und sagte:
»Och, Frau K–Konsul, w–würden Sie mich wohl mal eben mit Ihrem M–Mann bekannt, machen? Er k–kennt mich nich mehr.«
Worauf die diplomatischen Beziehungen wieder hergestellt waren.
Richter Smidt, der Weltweise, der sehr Bremische, der seit mehr als einem Säkulum Lebendige und in der bremischen Anekdote Unsterbliche, wandelte einmal durch die damals noch stillen Straßen zum Gerichtsgebäude, als ihm eine Schar jener schlichtbehosten Männer auffiel, die mit Ernst und Sachkenntnis die seit der Erschaffung Bremens unerläßliche lenzliche Straßenbuddelei veranstalteten.
»Was macht ihr da?« fragte Richter Smidt.
Der Vorarbeiter nahm Haltung an.
»Wir machen en Kanal,« sagte er.
Am Mittag, als Smidt nach seiner salomonischen Arbeit heimwärts ging, fand er die schlichtbehosten Männer damit beschäftigt, das verursachte große Loch wieder zuzuwerfen.
»Was macht ihr denn nu?« fragte er. »Ich denke, ihr macht en Kanal?«
Der Vorarbeiter nahm Haltung an.
»Da war all einer,« sagte er.
Da Frau Aline Tietjen sich von ihrem Gatten scheiden lassen wollte (und er von Aline), gab es einen darauf abzielenden Prozeß. Die »gegenseitige unüberwindliche Abneigung« kam in den Schriftsätzen der Rechtsvertreter unbezweifelbar zum Ausdruck; aber wirtschaftliche Forderungen und Gegenvorschläge zogen das Verfahren in die Länge, und schließlich stellte sich im Termin heraus, daß die Sache durch das inzwischen erfolgte Eintreffen (Gottlob gesunder) Zwillinge nicht gerade vereinfacht worden war.
Der Richter putzte verlegen seinen Klemmer. »Frau Tietjen,« sagte er, »Sie werden doch zugeben, daß die Sache mit der Abneigung – ich meine: wenn man – so ein freudiges Ereignis – und dann gleich Zwillinge – nicht wahr?«
»Herr Richter,« sagte Aline Tietjen leidenschaftlich, »das war man bloß aus schier Wut.«
Frau Cordes suchte einen Anwalt auf und sagte: »Von meinen Mann, da will ich von ab.«
»Liebe Frau Cordes,« sagte der Anwalt, »für eine so ernsthafte Sache wie eine Scheidung braucht man einen stichhaltigen Grund. Trinkt Ihr Mann etwa?«
» Der Mann und trinken?!« sagte Frau Cordes entrüstet. »Der Mann trinkt keinen Tropfen trinkt der nich.«
»So. Hm. Arbeitet er denn nicht?«
» Der Mann un nich abbeiten?! Der abbeit' sich noch rein zu Schanden abbeit' der sich noch mal.«
»Ja, aber hören Sie mal – Sie müssen doch einen Grund –? Wie ist es denn mit der ehelichen Treue?«
»Sehnse,« sagte Frau Cordes befriedigt, » da können wir ihn mit kriegen. Das letzte Kind, das is nich von ihm.«
Als Käpt'n Bruns eines Tages in urbehaglicher Betrachtung durch den Bremer Freihafen schlenderte und genußreich die mit dem Hafenbetrieb verbundenen Gerüche einsog, sprach ein wißbegieriger Fremder ihn an und wollte etliches wissen. Käpt'n Bruns gab leutselig Auskunft.
»Sie haben auf Ihren Fahrten doch gewiß Vielerlei erlebt?« fragte der Fremde.
Käpt'n Bruns lächelte versonnen und spuckte mit mörderischer Treffsicherheit auf ein Stück Apfelsinenschale, das im Wasser schwamm.
»Da können Sie auf ab,« sagte er.
»Auch mal einen Schiffbruch?« forschte der Fremde weiter.

Käpt'n Bruns nickte. »Auf 'ner einsamen Insel hat es mir verschlagen, wo weiter nich viel auf war.«
»Das war doch gewiß schrecklich?«
»Schrecklich war das gar nich,« sagte Käpt'n Bruns. »Das war das größte Glück, das mir dsche ins Fahrwasser gekommen is.«
»Nämlich,« erklärte Käpt'n Bruns, »da waren noch zwei mit bei: Der Steuermann un en Faß Rum. Un was der Steuermann war, der war abstinent.«
Was unsereins so in seinem Kopf zu sitzen hat, das isser auch nich von selbens isser das auch nich reingekommen. Das isser durch Strebsamkeit isser das reingekommen,« erzählte Käpt'n Bruns. »In meine allerersten Wasserdjahre, als ich noch Djunge auf'n Weserdampfer war, bloß damit meine Mutter mir nich zu Hause rumzusitzen hatte, da bin ich nachts immer heimlich bin ich von Bord und auf'r Seefahrtsschule gegangen.«
»Aber Käpt'n!« wandte ein Meckerer ein. »Nachts ist die Schule doch gar nicht in Betrieb!«
»Weiß ich dscha!« versetzte Käpt'n Bruns. »Ich binner dja auch nich hingegangen. Ich wollte dja man bloß sagen, wie strebsam daß ich war.«
Daß die Passagierkabinen auf dem Frachter »Odin« zuweilen mit Leuten besetzt waren, die besondere Beziehungen zur Reederei hatten, war eine Tatsache, die Käpt'n Bruns mit Fassung als unabänderlich hinnahm, und deren gesellschaftliche Folgen er dem weltmännischen »Ersten« zu überlassen pflegte. Nicht ohne Hochachtung aber sah er es mit an, daß bei einem haushohen Wetter im Kanal eines Tages der Zeitungsmensch aus Kabine fünf mit Händen und Füßen und Zähnen zur Brücke emporklomm. Obwohl das nicht ohne weiteres gestattet war. Aber darüber verlor Käpt'n Bruns kein Wort. Er nahm an, daß Worte gegenüber Zeitungsmenschen zwecklos sind. Und außerdem waren ihm Worte verhaßt.
»Deibel noch mal,« sagte der Zeitungsmensch, »wie machen Sie das?« Käpt'n Bruns nämlich stand, die Hände in den wohnlichen Hosentaschen, und machte alle Schwankungen des »Odin« durch umsichtige Körperbewegungen mit, ohne je aus dem Gleichgewicht zu kommen. Der Laie, der so etwas versuchen wollte, würde sich freiwillig zum Fischfutter machen.
Käpt'n Bruns wies mit dem Daumen zur Rechten, wo gerade der Himmel, und zur Linken, wo gerade das Wasser war.
»Das kömmt,« sagte er, »mir hat der liebe Gott cardanisch aufgehangen.«
Ein Herr Lehmkuhl, der in der Humboldtstraße zu Bremen unter Käpt'n Bruns wohnte und im allgemeinen mit dieser Unterbringung durchaus zufrieden war, sah sich dennoch veranlaßt, nach der Ursache einer seltsamen Erscheinung zu forschen. In den Zeiten nämlich, wo Käpt'n Bruns daheim ein paar Tage von seinen Fahrten (und Landbesuchen) ausruhte, wurde Herr Lehmkuhl allnächtlich durch einen schweren und dumpfen Plumps geweckt, der sich droben im Brunsschen Schlafzimmer ereignete. Dem Plumps folgte ein dumpfes Germurmel, das als die gedämpfte akustische Auswirkung mannhafter internationaler Seemannsflüche anzusprechen war. Danach trat oben Ruhe ein; Herr Lehmkuhl aber, drunten, suchte schwitzend und vergeblich die Rückkehr in den Schlaf.
Infolgedessen heischte er eines Tages Aufklärung.
»Tjä,« sagte Käpt'n Bruns verschämt, »dascha übel, das geb ich dscha zu. Das müssen Sie mir vielmals nich für ungut nehmen; da kann ich nix an tun. Wenn ich an Bord bün un in meine Koje verstaut liege, denn liege ich fest, un wenn der Kasten bei Windstärke 12 Kopf steht. Wenn ich aber an Land bün un in mein Bett liege, un da rührt sich nix, denn fall ich dschede Nacht über die Reling.«
Vor vielen, vielen Jahren, als Käpt'n Bruns noch im Vollbesitz seiner sündigen Jugend war, hatte er einmal mit etlichen Freunden eine lange Sitzung im Bremer Ratskeller. Als er nun hinterher, voll Heiterkeit und durchaus bereit, Bäume jeden Umfanges auszureißen, über den damals noch mangelhaft beleuchteten Domshof schlingerte, kam er zu der Erkenntnis, daß sein Heimweg sich nicht ohne Unterbrechung bewältigen lasse. Somit blieb er, der immer ein Mann von raschen Entschlüssen gewesen war, stehen, wo er eben stand.
In diesem verhängnisvollen Stadium der Geschichte kam aus der dunklen Seemannstraße – man kann, wenn man will, den Namen sinnbildlich nehmen – einer der umgänglichen Männer, denen damals die Pflege der öffentlichen Ordnung oblag, ließ seine ausgedehnte Hand auf die Brunssche Schulter niederfallen und sagte ernst:
»Herr, wat fallt Se in? Das will der Staat nich haben!«
»T–tjä, siehste,« versetzte Käpt'n Bruns fröhlich, »ich dscha auch nich. D–deswegen steh ich hier dscha!«
Zu der Erscheinung des lachenden Dritten, die als Verstoß gegen die sittliche Weltordnung seit langem bekannt ist, gesellt sich die nicht minder bedauerliche Erscheinung des weinenden Vierten in Gestalt des Bäckers Tölke Niebuhr aus Grasdorf. Er hat zwei tiefblaue Augen; das Blau des rechten Auges aber hatte sich, als wir ihn besuchten, bis hoch in die Stirn hinauf und tief an der Nase herunter erweitert, auf eine Weise, die nur als Folge eines gewaltsamen äußeren Eingriffs zu erklären war.
»Das gibt keine Gerechtigkeit inner Welt gibt das nich,« sagte Tölke Niebuhr. »Ich binner nämlich gar nich mit beigewesen, als se bei Kämena auf'r Kegelbahn an'n Tageln waren. Da bin ich nie mit bei; ich mag so was nich. Steh ich da gestern abend ganz friedlich vor meine Tür un kuck nach'n Himmel. Sieh, denk ich, das klärt sich dscha woll reineweg auf; denn mit das Wetter, das war dscha übel inne letzten Tage. Mit'n mal, da kömmt Harm Tietjen daher, un er ging man schief, un ich merkte dscha gleich, daß er einen zu viel an Bord genommen hatte. ›Tölke,‹ sagt er un grifflacht ganz gräsig, ›das is ewig schade is das, daß du da nich mit bei gewesen bist, bei Kämena. Da hättest du deine Freude an gehabt hättest du da. Klaus Sägelken un Lüer Kämena, die haben das mit'n Streiten gekriegt, un mit'n mal geht Klaus auf Lüer zu un holt so richtig von Herzen aus … sieh, so …‹ Un damit harmoniert er mir ümmer so mit'r knutten Faust unterer Nase rum, un mit'n mal, da verliert er denn dscha die Blansierung un fällt mir im Gesicht un pflanzt mich da son Vergißmeinnicht im Auge. Wo ich da doch gar nich mit bei gewesen bin. Un nu frag ich Ihnen: Is das nu wohl gerecht?«