
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
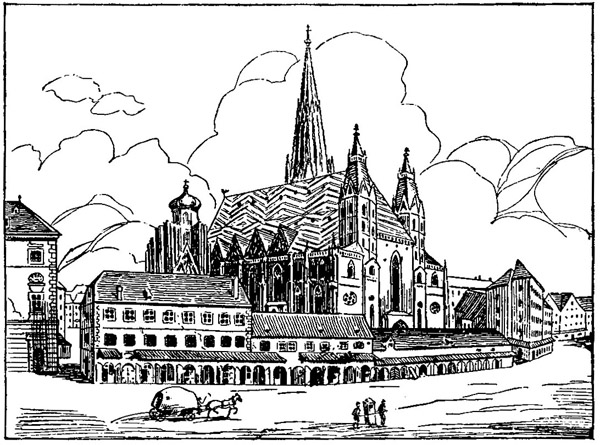
Der Auwinkel lag jahrhundertelang an der Grenze Wiens, und Wiens Grenze war damals eine feste, steinerne Wehrmauer, in der feste, steinerne Türme aufragten; eine machtvolle, trotzige Grenze aus behauenen Felsen, ein Schild, hinter dem eisenharte, geharnischte Bürger standen. Heute liegt der Auwinkel gewissermaßen »mitten in Wien«, und Wiens sichtbare Grenze sind punktierte Linien auf papierenen Stadtplänen. Sprechen wir heute von der »Peripherie der Großstadt« – eine anrüchige Bezeichnung – so denken wir an Küchengärten mit staubigen, verrußten Salat- und Krauthäupteln neben hohen Fabriksschloten, die über flache Werkstattdächer aufragen; denken an endlos lange, fade Straßen, die aus der Gegend der Vorstadtkaffeehäuser mit Spiegelscheiben und geflicktem Billardtuch in die Zone der »Tschecherln« führen und dorthin, wo »Kappeln« und Kopftücher zu Hause sind und wo es unheimlich ist, abends allein zu wandeln.
Auch in alten Zeiten hatten die Grenzgegenden der Städte besonderen Charakter. Auch damals waren dort die »Armenleuthäuser«, die, schmal, und nieder, mit ihren hohen Rauchfängen kaum über die Stadtmauer ragten und die, sich aneinander drängend, aus kleinen, vergitterten Fenstern scheu und ängstlich auf den hölzernen Mordgang an der Stadtmauer blickten. Wie winklig und düster mag eine Häusergruppe gewesen sein, die von der biederen Staatsobrigkeit speziell als »Winkel« bezeichnet wurde? Hören wir heute von einem alten Stadtwinkel, so denken wir an Halbverborgenes, Trauliches, an Erker, an spitze Giebeldächer und verblaßte Heiligenbilder über tiefen Tornischen. Und heißt ein solcher Winkel »Auwinkel«, dann wird die Poesie der Erker und der Giebeldächer von kühlem Waldeshauch umweht.
Der Auwinkel hieß aber früher nach dem Schweinemarkt in seiner Nähe Sauwinkel, und erst um die Mitte des 18. Jahrhunderts, nachdem der Viehmarkt an eine andre Stelle verlegt wurde, strich der ästhetisch fühlende Magistrat das S vom »Sauwinkel« weg und erzielte so schnell und einfach eine liebliche Bezeichnung für eine schmutzige Gegend.
Eine ähnliche radikale und einfache Behandlung wurde Mitte des vorigen Jahrhunderts der Spiegelgasse auf der Landstraße zuteil, als durch die Einbeziehung der Vororte viele gleichlautende Straßennamen zu eliminieren waren. In dem alten Spiegelmacherhause im dritten Bezirk übte zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts der im In- und Auslande angesehene Spiegelmacher Christian Wilkenhausen sein Geschäft aus, dem zu Ehren die Gasse den Namen Spiegelgasse erhalten hatte. Bei der Neubenennung der vielen nun zur Stadt Wien gehörigen Straßenzüge wurde auch die Spiegelgasse im dritten Bezirk geopfert, man strich ihr einfach das »p«, und seither heißt sie Siegelgasse.
Daß das Wort Au aus Sau entstanden war, merkte man den dortigen Häusern nur wenig an. Der riesige Viehmarkt vor der Stadtmauer, dessen pußtahaftes Areale sich vom heutigen Auwinkel bis zum Wienflusse und flußaufwärts bis zum heutigen Beethovenplatz erstreckte, bot Raum für gigantische Schweineauftriebe, würdig, daß eine ganze Stadt nach den Speckträgern benannt werde.

Der Auwinkel bildete gewissermaßen eine Ecke der Stadt dort, wo die Rotenturmbastei und die Dominikanerbastei im rechten Winkel zusammentrafen. Es lag nur ein schmaler Weg zwischen den Häusern des Auwinkels und der dunkelbraunen Ziegelwand der Bastei.
An der Ecke des Auwinkels und des Laurenzerberges stand das Haus »Zum roten Apfel«, in dem ein altberühmtes Gasthaus desselben Namens war. An dessen Stelle befindet sich jetzt der Garten des Café Siller.
Die Wiener, die auf der beliebtesten Promenade der Stadt, auf der Bastei, lustwandelten und über die hellgestrichene Holzbarriere – dem Geländer auf der Rotenturmbastei – stadtwärts sahen, konnten mit den Gästen im »Roten Apfel« plaudern, denn das Gasthaus hatte über einer verglasten Veranda im Parterre eine ebensolche im ersten Stockwerk, und die servierten Flaschen »Grinzinger« oder ein »Pfiff Marker«, standen auf den Tischen in gleicher Höhe mit der Basteipromenade. Die Veranda zog sich über die ganze Breite des Hauses hin. Über dem sechsten Fenster des zweiten Stockwerkes prangte protzig das damals größte Firmenschild der Stadt und zeigte in weißen Buchstaben von Grenadiergröße vier Wörter »Kleider-Magazin Anton Rauch«. Das Haus »Zum roten Apfel« gehörte Anno 1684 zum benachbarten Stadtbrauhause. Der Eingang zur unteren Veranda lag im Zuge des Laurenzerbergels, wenige Schritte weit vom kleinen Rotenturmtor, dem schmalen Durchlaß durch die Bastei, der von der Schlagbrücke – der späteren Ferdinandsbrücke – jetzt heißt sie Schwedenbrücke – zum Laurenzerbergel führte.
Das Plätzchen vor der Bastei bot in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Bild biedermeierischen Stadtcharakters. Knapp an der Brücke standen zwei runde steinerne Schildwachhäuser, deren unerbittliche Polizeiposten ehemals – in den dreißiger Jahren – dafür zu sorgen hatten, daß keiner, der die Brücke betrat, Tabak rauche. Mehr als 30 große steinerne Barrierestöcke – Straßenrequisiten, die schon lange verschwunden find – flankierten den Fahrweg, der im Bogen zum Rotenturmtor führte, und die ganze Gegend wurde von zwei Laternen »erhellt«.
Die Häuser, die sich an den »Roten Apfel« reihten, waren bedeutungslos. Ein Haus unter diesen war eine Art Hotel Garni, in der letzten Zeit seines Bestandes ein Hospitium schnell verflackernder Liebe.
Gute Biedermeier-Bauart zeigte das Haus, das eine Ecke der Stadt bildete, ein Häuschen auf einem Hause. Über seinen Fenstern im ersten Stockwerke waren banddurchschlungene Kränze in Halbkreisfeldern angebracht.
Das Nachbarhaus (Nr. 3) verdiente ob seines liebenswürdigen Äußern nicht in einem Winkel, sondern auf einem Platze zu stehen. Über seinen beiden Stockwerken erhob sich zwischen zwei Bodenfenstern ein geräumiger Mansardenaufbau, auf dem weit vorragenden Torbau ruhte ein vorspringender verglaster Raum, gewissermaßen als Erker des Mittelzimmers, und zwei auf der grasbewachsenen Böschung stehende Bäume schenkten dem Bilde freundliche Farbe, Farbe, an der es dem Auwinkel am meisten gebrach.
Ibn Firdusi, der greise Dichter, hat vor 900 Jahren vom »alten Iran staubbedeckt« gesungen. Ein phantastisches Bild! Ein ganzes Land staubbedeckt! Wer an dem Auwinkel vorüberging, mochte an Firdusi denken und an Iran. Die fahlbraunen Häuser waren staubbedeckt. Dicht lag Staub auf allen Vorsprüngen, auf den Gesimsen und Dächern, Staub hing an den Wänden, und die Grundfarbe des Auwinkels war grau. Die breite Straße vor der Franz Josefs-Kaserne war ungepflastert.
Der Auwinkel war eine verlorene Stadtgegend, vielen Wienern kaum bekannt, eine Insel Encoberta, im Häusermeer, ein Häuserblock ohne Geschäftsleben. Wo einstens die Stadtmauer nahe der Donau lag, unweit der Stelle, wo sich die nordwestliche Ecke der späteren Kaserne befand, war das Donauufer niedrig und moorig. Die Wasser einer Mühle – der Krätzmühle – machten oft das Moor zum Sumpfe, und wo es am sumpfigsten war, stand ein Wehrturm in der Mauer, der »Krotenturm«. Die Menge der Kröten, die im Morast bei seinem Fuße wohnten, hatten ihm zu diesem Namen verholfen, und ein Chronist berichtet, »daß ob der Einsamkeit, so um den Krotenthurm war, allwo nächtens Irrwische hupfeten und insonderheit ob des Klagens und Geschrei der Kroten die Wanderer von bemeldetem Orte wichen.« Wahrlich, der dunkle Turm, die finsteren Winkel zwischen dunkeln Mauern, der dumpfe Unkenruf aus schwarzen Tümpeln und die Irrlichter mögen den Sauwinkel zu einer unheimlichen Stätte gemacht haben.
Im Jahre 1732 wurde der Krotenturm abgebrochen, auf seine Grundfesten ein Haus gebaut und das Terrain trockengelegt. Das Haus gehörte Anno 1775 dem Anton Hundhagen, und wo früher die Unken gerufen, wurde der »gemeinen Stadt Wien Häring-Niederlage« eingerichtet und ihr ein kleiner Markt, gebildet aus Bretterbuden, angegliedert. Unter Leinwandplachen wurden getrocknete und geräucherte Heringe feilgeboten.
Im Auwinkel stand auch eines der ältesten und wichtigsten Gebäude Wiens, nämlich »gemeiner Stadt Wien Getreidekasten«. In diesem, auch »gemeiner Stadt Kasten« genannten Hause wurden Wiens Getreidevorräte aufbewahrt. Im Jahre 1700 verlor dieses Haus seine Benennung, wurde nunmehr als Gefällshaus benützt und kommt später in Wiener Akten als »kleines Hauptmautgebäude« vor. Es stand an der Stelle eines Teiles des heutigen Postgebäudes. Neben der Hauptmaut stand die »Schlesische Burse«, die schon im Jahre 1420 von dem Breslauer Kanonikus Nikolaus Gleiwitz gegründet worden war.
Um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts fiel ein Haus im Auwinkel, das sogenannt« »Biberhaus«, einer Erweiterung des Postgebäudes zum Opfer. Das Haus war schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts alt, sah unfreundlich aus und war in architektonischer Hinsicht ganz unbedeutend. Hier aber wohnte ein Mann, der den Nachbarn unheimlich war, ein Mann, der Unmögliches erstrebte, Seltsames erreichte – und vergessen wurde. Er hatte – das beobachteten die Anrainer – viel Geld. Warum bezog er das ärmliche Haus in der düsteren Gegend? Warum ließ der schweigsame Mann in seiner Wohnung bauliche Veränderungen vornehmen, deren Zweck er niemand verriet? Die Leute im Auwinkel beobachteten scharf das Tun des bleichen Mannes mit dem schwarzen Bart und wunderten sich, daß manchmal grünliche Dünste oder rosenroter Rauch dem von ihm erbauten hohen Kamin entschwebten. Ihre Verwunderung wurde zum Grauen, wenn sie in Vollmondnächten oder wenn der Mond in Opposition stand, rotes Licht durch die dichten Vorhänge eines Fensters dringen sahen und wenn sie, lauschend, hörten, daß der Unheimliche unverständliche Worte in beschwörendem Tone ausrief und seine Rede zum bittenden Murmeln wurde; wußten sie doch, daß er allein war! Oder sprach er zu Unsichtbaren?
Die Leute im Auwinkel mieden den geheimnisvollen Mann, und die einen meinten, er suche den »Stein der Weisen« oder er sei ein Nekromant; die anderen raunten, daß er Gold oder einen Homunkulus machen wolle, und das »Biberhaus« wurde von ihnen »Goldmacherhaus« genannt.
Der Gemiedene saß und grübelte und koagulierte und tingierte. Er war Alchimist. Er suchte den »roten Löwen« und das »große Magisterium«. Vergeblich suchte er die » Tabula smaragdina«. Vergeblich, aber nicht umsonst. Seine Arbeitsmittel waren teuer, sie kosteten alles, was er besaß, und je hartnäckiger er forschte, desto dunkler breitete die Armut ihre Schatten über ihn.
Alt geworden und grau und hager, saß der Alchimist – er hieß Khünnel – vor leerer Gelblade und leeren Retorten, sein Herz aber war voll Bitterkeit. Er hatte einem leuchtenden Phantom nachgejagt. Seine dürren Finger griffen nach dem Entschwindenden, und – er sah den Schatten seiner Hand, einen bewegten, ausdrucksvollen Schatten, einen Schatten an der Wand, der ein Greifen, ein Haschen nachahmte. Der Schatten dünkte Khünnel realer als das Irrlicht der Alchimie: Sollte er mit ihm nichts machen können?
In langen Nächten versuchte Khünnel dem Schatten, den seine Hände machten, durch Bewegungen und Verschlingungen der Finger und Hände mancherlei Formen zu geben, und der Phantast wurde – Schattenspieler. Er stellte an der Wand Schattenengel und Schattenteufel dar. Es gelang ihm, Bilder von mancherlei Tieren, wie Schwänen, Tauben, heraldischen Adlern und Löwen, zu erzeugen, und als er Pilger und Heilige darstellen konnte, begann er zu den Schattenfiguren lehrhafte Verse zu verfassen.
Khünnel gab nunmehr Vorstellungen. Er wurde in die Häuser der Reichen gerufen, Adelige öffneten ihm ihre Salons, und im Jahre 1728 spielte er bei Hofe vor Kaiser Karl dem Sechsten.
Was die Alchimie trügerisch versprochen hatte, gewährten die Schatten, sie brachten ihm Gold und Anerkennung.
Zweiundachtzigjährig starb Khünnel Anno 1755 im »Biberhaus«. Seine Kunst starb mit ihm, und nur wenige Bruchstücke von ihr gingen später in beliebte Zeitschriften, wie zum Beispiel in den »Bazar«, über oder sind in Spielbüchern für Kinder erhalten geblieben. Lange noch, nachdem Khünnel zu den Schatten gegangen, erzählten an stillen Abenden im Scheine des Kerzenlichtes weißhaarige Matronen, die als Kinder den Mann vom »Biberhaus« noch gesehen hatten, ihren Enkeln von dem Schattenmann im Auwinkel.