
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
War der Zorn des Herzogs bei seiner Nachhausekunft groß gewesen, so war der des Barons, als er den Streich Vallombreuses bei Isabella erfuhr, nicht geringer. Der Tyrann und Blasius mußten ihm lange und eindringliche Vorstellungen machen, um ihn abzuhalten, zu dem Herzog zu eilen, und ihn abermals zu einem Kampfe herauszufordern, den er sicherlich abgelehnt hätte. Da Sigognac weder der Bruder, noch der Gatte, noch der erklärte Liebhaber der Schauspielerin war, hatte er auch kein Recht, Genugtuung für einen Schritt zu verlangen, der sich übrigens von selbst rechtfertigte. In Frankreich hat man immer die Freiheit gehabt, schönen Frauen den Hof zu machen.
Es gab daher keine Möglichkeit, sich offen an den Herzog zu halten, und Sigognac mußte notgedrungen den Vorstellungen des Direktors und des Pedanten nachgeben, die ihm rieten, sich ganz ruhig zu verhalten, aber deswegen immer das Auge offen und das Ohr wach zu halten, weil dieser Herzog, der schön war wie ein Engel, und boshaft wie ein Teufel, sicherlich sein Vorhaben noch nicht aufgeben würde, obschon es ihm bis jetzt in jeder Beziehung fehlgeschlagen war. Ein sanfter Blick von Isabella, die Sigognacs vor Wut zitternde Hände in ihre zarten, weißen faßte und ihn inständig bat, aus Liebe zu ihr seine Wut zu zügeln, besänftigte den Baron vollständig, und die Dinge gingen wieder ihren gewöhnlichen Gang.
Die Vorstellungen der Truppe hatten viel Beifall gefunden. Die züchtige Anmut Isabellas, das sprühende, mutwillige Feuer der Soubrette, die elegante Koketterie Serafinas, die köstliche Übertreibung des Kapitäns Fracasse, das majestätische Pathos des Tyrannen, die weißen Zähne und das rosige Zahnfleisch Leanders, die groteske Gutmütigkeit des Pedanten, der trockene Witz des Scapin und die vollkommene Komik der Alten brachten in Paris dieselbe Wirkung hervor wie in der Provinz. Es fehlte ihnen, da sie den Beifall der Stadt hatten, nur noch der des Hofes. Es war sogar die Rede davon, daß sie nach Saint-Germain berufen werden sollten, denn der König, der von ihnen sprechen gehört, wünschte sie zu sehen, worüber Herodes, der Direktor und Kassierer der Gesellschaft, sich nicht wenig freute. Oft wurde die Truppe zu vornehmen Standespersonen gerufen, um in ihren Palästen bei einem Feste eine Vorstellung vor den Damen zu geben. Diese waren neugierig, die Schauspieler zu sehen, deren Leistungen denen des Hotel de Bourgogne und der Truppe des Marais gleichkamen.
Herodes, der schon an solche Aufforderungen gewöhnt war, wunderte sich daher nicht, als eines schönen Morgens in dem Gasthaus der Rue Dauphine eine Art Intendant oder Haushofmeister von ehrwürdigem Äußern wie die in großen Häusern grau gewordenen Diener erschien und im Namen seines Herrn, des Grafen von Pommereuil, in Theaterangelegenheiten mit ihm zu sprechen wünschte. Dieser vom Kopf bis zum Fuße in schwarzen Samt gekleidete Haushofmeister trug eine Kette von Dukatengold um den Hals, Seidenstrümpfe und vorn viereckige, etwas weite Schuhe, wie sie ein alter, zuweilen von der Gicht geplagter Mann zu tragen pflegt. Das weiße lange Haar fiel bis auf die Schultern herab und lieh der ganzen Erscheinung des Mannes ein überaus patriarchalisches, ehrwürdiges Aussehen. Herodes konnte nicht müde werden, das gutmütige, ansprechende Gesicht dieses Intendanten zu bewundern, der, nachdem er ihn begrüßt hatte, in höflichen Worten zu ihm sagte:
»Sie sind doch jener Sieur Herodes, der mit ebenso fester Hand als Apollo die Musen die ausgezeichnete Gesellschaft leitet, deren Ruf sich in Paris verbreitet und schon über den Umkreis dieser Stadt hinausgedrungen ist? Denn er hat bereits das Landgut erreicht, das mein Herr bewohnt.«
»Ja, ich habe die Ehre«, antwortete Herodes, indem er sich auf die anmutigste Weise verneigte, soweit es sein tragisches Aussehen ihm gestattete.
»Der Graf von Pommereuil«, hob der Greis wieder an, »wünscht, um seine vornehmen Gäste zu unterhalten, ihnen in seinem Schlosse eine Theatervorstellung zu geben. Er glaubt, daß keine Truppe diese Leistung besser ausführen würde als die Ihrige, und er schickt mich zu Ihnen, um Sie zu fragen, ob es Ihnen möglich wäre, eine solche Vorstellung auf seinem Gute zu geben, das nur wenige Meilen von hier entfernt ist. Der Graf, mein Gebieter, ist ein freigebiger Herr, dem es auf einige Hände voll Gold nicht ankommt und der keine Kosten scheuen wird, um Ihre berühmte Gesellschaft zu gewinnen!«
»Ich werde alles tun, um einen so vornehmen Cavalier zufriedenzustellen,« antwortete der Tyrann, »obwohl es schwierig sein wird, Paris im Augenblick, wo wir uns gerade des lebhaftesten Beifalls erfreuen, wenn auch nur auf einige Tage, zu verlassen.«

»Drei Tage werden genügen,« sagte der Haushofmeister, »einer für die Hinreise, einer für die Vorstellung und einer für die Rückreise. Wir haben in unserem Schlosse ein vollständig eingerichtetes Theater, in dem Sie nur für die Stellung der Dekorationen zu sorgen haben werden. Überdies sind hier hundert Pistolen, die der Graf von Pommereuil mich beauftragt hat, Ihnen zur vorläufigen Bestreitung der Kosten zuzustellen. Nach der Vorstellung werden Sie eine gleiche Summe erhalten, und die Damen bekommen jedenfalls ein Geschenk: Ringe, Nadeln oder Armbänder, oder wofür die weibliche Koketterie stets empfänglich ist.«
Die Tat folgte auf das Wort. Der Intendant des Grafen von Pommereuil zog eine lange, schwere Börse aus der Tasche und schüttete aus ihr hundert neue schöne, verlockend blanke Taler auf den Tisch.
Der Tyrann betrachtete diese Münzen mit zufriedener Miene und strich sich seinen langen schwarzen Bart. Nachdem er sie lange genug betrachtet, warf er sie mit der Gebärde der Zustimmung in seine Geldtasche.
»Also,« sagte der Intendant, »Sie nehmen die Einladung an, und ich kann meinem Herrn sagen, daß Sie seinem Rufe Folge leisten?«
»Ich stehe Ihrem Herrn mit meiner ganzen Gesellschaft zur Verfügung«, antwortete Herodes. »Jetzt bezeichnen Sie mir noch den Tag, an dem die Vorstellung stattfinden soll, und das Stück, das der Herr Graf wünscht, damit wir die notwendigen Kostüme und was sonst noch dazu gehört, mitnehmen.«
»Es wäre gut,« antwortete der Intendant, »wenn die Vorstellung nächsten Donnerstag statthaben könnte, denn die Ungeduld meines Herrn ist groß. Die Wahl des Stückes stellt er ganz Ihrem Belieben und Ihrer Bequemlichkeit anheim.«
»›Die komische Täuschung‹,« sagte Herodes, »das Werk eines vielversprechenden jungen Dichters, ist das Neueste und Beliebteste.«
»Nun gut, dann geben Sie die ›Komische Täuschung‹, sagte der Intendant.
»Die Verse dieses Stückes«, setzte Herodes hinzu, »sind sehr gut und die Rolle des Matamor ist ganz ausgezeichnet. Nun hätten Sie uns bloß noch die Lage und Richtung des Schlosses und den Weg zu bezeichnen, den wir einschlagen müssen, um dahin zu gelangen.«
Der Intendant des Grafen von Pommereuil gab in dieser Beziehung so genaue und ins einzelne eingehende Weisungen, daß sie einem Blinden, der sich mit seinem Stocke auf dem Boden forttastet, genügt haben würden. Da er aber ohne Zweifel fürchtete, daß der Schauspieldirektor, wenn er einmal unterwegs wäre, sich aller dieser: »Geradeaus! dann rechts, dann links!« nicht mehr genau erinnern würde, so setzte er hinzu:
»Beschweren Sie übrigens Ihr Gedächtnis, das nur zur Aufnahme der schönsten Verse unserer besten Dichter bestimmt ist, nicht mit solchen gemeinen und prosaischen Dingen. Ich werde einen Lakaien schicken, der Ihnen als Führer dienen wird.«
Nachdem das Geschäft auf diese Weise abgeschlossen war, entfernte sich der Intendant unter höflichen Begrüßungen, die Herodes ihm mit Wucherzinsen zurückgab. Da der Tyrann sich in diesem Wettkampfe der Höflichkeit nicht besiegen lassen wollte, so ging er die Treppe hinunter, durchschritt den Hof und blieb erst auf der Schwelle stehen, von wo er dem Intendanten noch einen letzten Abschiedsgruß nachrief.
Wäre Herodes mit seinem Blicke dem Intendanten des Grafen von Pommereuil bis zum Ende der Straße gefolgt, so hätte er vielleicht bemerkt, daß ganz im Gegensatze zu den Regeln der Perspektive der Körper des Intendanten, je weiter er sich entfernte, immer größer wurde. Sein gewölbter Rücken hatte sich emporgerichtet, das altersschwache Zittern seiner Hände war verschwunden, und die Raschheit seines Ganges schien durchaus keine Gicht zu verraten. Herodes war aber schon wieder in das Haus zurückgekehrt und sah von all dem nichts.
Mittwoch früh, als eben die Hausknechte die Dekorationen und Pakete auf einen von dem Tyrannen zum Transport der Truppe gemieteten, mit zwei starken Pferden bespannten Wagen luden, kam ein langer Kerl von Lakai in sehr sauberer Livree auf einem stattlichen, obschon etwas schwerfälligen Pferde vorgeritten und knallte an der Tür des Gasthauses mit seiner Peitsche, um den Aufbruch der Schauspieler zu beschleunigen und ihnen als Kurier zu dienen. Die Damen kamen endlich herunter und richteten sich so bequem wie möglich auf den mit Stroh gepolsterten, an den Seitenwänden des Wagens befestigten Brettern ein. Eben schlug es auf der Samaritaine acht Uhr, als die schwerfällige Maschine sich in Bewegung setzte. Nach weniger als einer halben Stunde hatte man die Porte St. Antoine und die Bastille passiert. Dann kam man durch die Vorstadt und die mit kleinen Häusern besäten Anpflanzungen, und es ging nun weiter durch die Felder in der Richtung von Vincennes, das von weitem schon seinen runden Turm durch einen leichten Schleier bläulichen Dunstes hindurch zeigte.

Da die Straße wenig belebt war, so wunderten sich zuweilen die aus dem Dickicht hervorlugenden und sich mit der Pfote den Bart streichenden Kaninchen über die Ankunft des Wagens, den sie nicht gehört hatten, denn er rollte ziemlich leise, weil der Boden weich und oft mit Gras bewachsen war. Zuweilen sah man auch ein Reh, das scheu quer über die Fahrstraße hinwegrannte und dem man einige Zeit lang mit den Augen durch die von Laub entblößten Bäume folgen konnte. Sigognac interessierte sich ganz besonders für diese Dinge, weil er auf dem Lande geboren und erzogen war. Er freute sich, Felder, Büsche, Wald und Tiere in Freiheit wiederzusehen – ein Anblick, dessen er beraubt gewesen, seitdem er die Stadt bewohnte, wo man weiter nichts sah als Häuser, schmutzige Gassen, rauchende Schornsteine, Menschenwerk, nicht Gotteswerk. Er würde sich auch in Paris sehr gelangweilt haben, wenn er nicht die Gesellschaft jenes sanften Wesens gehabt hätte, dessen Augen genug Blau enthielten, um ihm den Himmel zu ersetzen.
Beim Austritt aus dem Walde sah man eine kleine Anhöhe, über die die Straße führte. Sigognac sagte zu Isabella:
»Geliebte Seele, wollen Sie nicht absteigen und, während der Wagen langsam diese Anhöhe erklettert, Ihren Arm auf den meinen legen, um einige Schritte zu gehen? Das wird Ihnen die Füße erwärmen. Der Weg ist gut, und wir haben heute einen frischen, hellen, aber nicht zu kalten Wintertag.«
Die junge Schauspielerin nahm Sigognacs Anerbieten an, legte die Spitzen ihrer Finger auf die Hand, die er ihr bot, und sprang leichtfüßig vom Wagen herab. Es war dies eine Gelegenheit, ihrem Geliebten ein unschuldiges tête-à-tête zu gewähren. Bald gingen sie wie von ihrer Liebe getragen und streiften den Boden wie Vögel, bald standen sie bei jedem Schritt still, um sich anzublicken, die Arme eingehängt, den Blick des einen in die Augen des anderen gesenkt, das Beisammensein zu genießen.
Plötzlich ließ Isabella seinen Arm los und lief jubelnd wie ein Kind und mit der Leichtigkeit eines Rehes nach dem Rand der Straße. Sie hatte am Fuße einer Eiche unter den von dem Winter aufgehäuften welken Blättern ein Veilchen bemerkt, sicherlich das erste des Jahres, denn man war erst im Monat Februar. Sie kniete nieder, schob behutsam die welken Blätter und Grashalme auf die Seite, durchschnitt mit dem Nagel ihres Fingers den schwachen Stengel und kam mit dem Blümchen mehr erfreut zurück, als wenn sie eine von einer Prinzessin im Moose vergessene Agraffe von Edelsteinen gefunden hätte.
»Sehen Sie, wie lieblich dieses Blümchen ist«, sagte sie, indem sie es Sigognac zeigte. »Sehen Sie nur diese im ersten Sonnenstrahl kaum entfalteten Blättchen.«
»Nicht die Sonne, sondern der Blick Ihres Auges, Isabella, hat es erschlossen«, antwortete Sigognac. »Es hat auch ganz die Farbe Ihrer Augen.«
»Von seinem Wohlgeruch ist nichts zu bemerken, weil es friert«, hob Isabella wieder an, indem sie das zarte Blümchen an ihren Busen steckte. Nach Verlauf von einigen Minuten nahm sie es wieder hinweg, roch lange daran und reichte es Sigognac, nachdem sie verstohlen einen Kuß darauf gedrückt.
»Wie gut es jetzt riecht!« sagte sie. »Die Wärme meiner Brust läßt seine schüchterne und bescheidene Blumenseele ausströmen.«
»Sie haben ihm diesen Wohlgeruch erst gegeben«, antwortete Sigognac, indem er das Veilchen an seine Lippen hielt, um den von Isabella daraufgedrückten Kuß abzunehmen. »Dieser zarte, milde Duft hat nichts Irdisches.«
Isabella ergriff wieder seinen Arm und stützte sich vielleicht sogar ein wenig mehr darauf, als ihr gewöhnlich so leichter Gang und der Weg, der an dieser Stelle so glatt war wie eine Gartenallee, es verlangten. Der Wagen erkletterte langsam die ziemlich steile Anhöhe, an deren Fuß einige armselige Hütten beisammenstanden, als ob sie die Mühe scheuten, den Hügel zu ersteigen. Die Bauern, die in diesen Hütten wohnten, waren auf ihren Feldern bei der Arbeit, und man sah auf dem Wege weiter niemanden als einen von einem Knaben begleiteten blinden Bettler, der ohne Zweifel zurückgeblieben war, um die Mildtätigkeit der Reisenden anzurufen. Dieser Blinde, der vom Alter tief niedergebeugt schien, sang mit näselnder Stimme ein Klagelied, worin er seine Blindheit beweinte und die Güte der Reisenden anflehte, indem er für sie zu beten versprach und ihnen für ihr Almosen das himmlische Paradies in sichere Aussicht stellte. Schon seit längerer Zeit klang seine klägliche Stimme zu Isabellas und Sigognacs Ohr wie ein lästiges, störendes Summen durch das Liebesgeplauder, und selbst der Baron wurde darüber ungeduldig. Denn wenn neben uns die Nachtigall singt, ist es sehr störend, von weitem den Raben krächzen zu hören.
Als sie in die Nähe des alten Bettlers kamen, verdoppelte dieser, durch seinen Führer aufmerksam gemacht, sein Winseln und Bitten. Um das Mitleid zur Tätigkeit anzuspornen, schüttelte er mit ruckweiser Bewegung eine hölzerne Schale, in der einige kleine Silber- und Kupfermünzen klimperten. Durchlöcherte Lumpen umhüllten seinen Kopf, und auf seinem, einem Brückenbogen gleichenden Rücken, lag eine große, grobe, sehr schwere wollene Decke, die eher für ein Lasttier gefertigt zu sein schien als für einen Christen und die er ohne Zweifel von einem krepierten Maultier geerbt hatte. Seine in die Höhe gewendeten Augen ließen nur das Weiße sehen und brachten auf seinem braunen, runzeligen Gesicht eine abstoßende Wirkung hervor. Der untere Teil des Gesichtes verschwand in einem langen grauen Bart, der ihm bis auf den Nabel herabfiel. Von seinem ganzen Körper sah man weiter nichts als die Hände, die zitternd durch die Öffnung des Mantels hervorragten, um die hölzerne Schale zu schütteln. Das Mitleid mußte von diesem Anblick angewidert schaudern und warf ihm, das Gesicht abwendend, sein Scherflein zu.
Der neben dem Blinden stehende Knabe hatte ein abgezehrtes, verwildertes Ansehen. Sein Gesicht war halb von langen schwarzen Haarlocken bedeckt, die ihm über die Wangen herabfielen. Ein alter zerlöcherter Hut, der viel zu groß für ihn war, beschattete den obern Teil des Gesichtes und ließ nur das Kinn und den Mund sehen, dessen weiße Zähne unheimlich funkelten. Ein Kittel von grober, zusammengeflickter Leinwand war seine ganze Kleidung und zeichnete die Umrisse seines magern, obschon kräftigen Körpers, dem es trotz all dieser bittern Armut nicht an einer gewissen Zierlichkeit fehlte. Die kleinen, vom Frost geröteten Füße standen ohne Strümpfe oder Schuhe auf dem kalten Erdboden.

Isabella fühlte sich gerührt beim Anblick dieser erbärmlichen Gruppe, in der sich das Unglück des Alters und der Kindheit vereinigte. Sie blieb vor dem Blinden, der seine Paternoster, begleitet von der hellen, durchdringenden Stimme seines Führers, mit immer steigender Zungenfertigkeit herplapperte, stehen und suchte in ihrer Tasche nach einer kleinen Silbermünze, um sie dem Bettler zu geben. Sie fand aber ihre Börse nicht, und drehte sich nach Sigognac herum, um ihn um einige Scheidemünzen zu bitten, die er auch sofort hervorsuchte, obwohl dieser Blinde mit seinen Jeremiaden ihm nicht recht gefallen wollte. Um Isabella die Mühe, sich diesem alten Scheusal zu nähern, zu ersparen, trat er selbst einige Schritte näher und warf das Geld in die hölzerne Schale.
Anstatt aber Sigognac für dieses Almosen zu danken, richtete der soeben noch so tief gekrümmt dasitzende Bettler zu Isabellas Schrecken und Entsetzen sich auf, öffnete die Arme wie ein Geier, der, um sich aufzuschwingen, mit den Flügeln schlägt, entfaltete den großen braunen Mantel, dessen Wucht ihn vorher zu Boden zu drücken schien, raffte ihn zusammen und schleuderte ihn dann mit einer Bewegung gleich der der Fischer, die das Netz in einem Teich oder Fluß auswerfen. Wie eine Wolke breitete der schwere Stoff sich über Sigognacs Kopfe, bedeckte diesen und fiel schwer längs des Körpers herab, denn die Ränder waren wie die eines Netzes mit Bleikugeln beschwert, so daß er sich mit einem Schlage der Fähigkeit des Sehens und Atmens, sowie des Gebrauches seiner Hände und Füße beraubt sah.

Isabella wollte schreien, fliehen und Hilfe herbeirufen, aber ehe sie einen Ton hervorbringen konnte, fühlte sie sich mit außerordentlicher Schnelligkeit vom Boden emporgehoben. Der blinde Greis, der wie durch ein mehr höllisches als himmlisches Wunder in einer Minute sehend und jung geworden war, hatte sie in seine Arme gefaßt, während der Knabe sie an den Füßen hielt. Beide beobachteten das strengste Schweigen, und trugen ihre Beute von der Landstraße hinweg. Hinter einer der Hütten, wo ein auf einem kräftigen Pferde sitzender maskierter Mann wartete, machten sie Halt. Zwei andere Vermummte hielten, ebenfalls zu Pferde und bis an die Zähne bewaffnet, hinter einer Mauer so, daß man sie von der Straße aus nicht sehen konnte.
Isabella, vor Schrecken mehr als halbtot, wurde quer über den Sattel gelegt, der mit einem mehrmals zusammengefalteten Mantel bedeckt war, so daß er eine Art Kissen bildete. Der Reiter schnallte sie mit einem Lederriemen an sich selbst fest und gab, nachdem dies alles mit einer Gewandtheit und Schnelligkeit geschehen, die einen hohen Grad von Übung in solchen gewagten Entführungen verriet, seinem Pferde die Sporen, das sofort mit großer Schnelligkeit fortgaloppierte.
Sigognac schüttelte sich unter dem schweren Mantel wie ein von dem Netze seines Gegners umstrickter altrömischer Netzfechter. Er dachte sofort an einen Anschlag von Vallombreuse auf Isabella, und erschöpfte sich in Bemühungen, sich freizumachen. Zum Glück kam er auf den Gedanken, den Dolch zu ziehen und den dichten Stoff zu zerschneiden, der auf ihm lastete wie jene bleiernen Mäntel, die nach Dante die Verdammten tragen. Mit zwei, drei Dolchstößen durchbrach er sein Gefängnis und ließ wie ein von seiner Kappe befreiter Falke seinen scharfen, raschen Blick über das Gefilde schweifen. Er sah Isabellas Räuber querfeldein sprengen und ein nicht weit entferntes Gehölz zu erreichen suchen. Der Blinde und der Knabe waren verschwunden. Auf dieses elende Gesindel hatte Sigognac es auch nicht abgesehen. Seinen Mantel, der ihn gehindert hätte, abwerfend, rannte er sofort mit verzweifelter Wut hinter den Räubern drein. Er war flink, zum Schnelläufer wie geschaffen, und hatte es in seiner Jugend in dieser Leibesübung oft den leichtfüßigsten Dorfkindern zuvorgetan. Die Räuber sahen, als sie sich im Sattel herumdrehten, daß die Entfernung, die sie von dem Baron trennte, sich verminderte, und einer von ihnen feuerte einen Pistolenschuß ab, um dem Verfolger anzuhalten. Die Kugel fehlte aber, denn Sigognac sprang während des Laufes rechts und links, so daß man nicht mit Sicherheit auf ihn zielen konnte. Der Reiter, der Isabella trug, suchte den beiden andern vorzukommen, und diesen die Aufgabe zu überlassen, sich mit Sigognac herumzuschlagen, die hinter ihm sitzende Isabella erlaubte ihm aber nicht sein Pferd so zu lenken, wie er wollte, denn sie wehrte und sträubte sich fortwährend, und suchte sich dem sie fesselnden Riemen zu entwinden.
Sigognac kam immer näher, denn das Terrain war jetzt den Pferden nicht mehr günstig. Er hatte, ohne deswegen langsamer zu laufen, seinen Degen gezogen und schwang ihn hoch in der Faust. Aber er war zu Fuße, allein gegen drei gut berittene Feinde, und der Atem begann ihm auszugehen. Er machte eine ungeheure Anstrengung, und mit zwei, drei Sprüngen war er bei den Reitern, die die Flucht des Räubers deckten. Um nicht durch einen Kampf Zeit zu verlieren, stach er mehrmals die Spitze seines Degens in die Kruppe ihrer Pferde und hoffte, daß sie, auf diese Weise angestachelt, durchgehen würden. In der Tat bäumten sich die Pferde, durch den Schmerz wild gemacht, sie schlugen aus, nahmen trotz aller Bemühungen ihrer Reiter den Zaum zwischen die Zähne und begannen zu galoppieren, wie vom Teufel gejagt, über Gräben und andere Hindernisse toll hinweg, so daß sie in einem Augenblicke nicht mehr zu sehen waren.

Sigognac keuchte, von Schweiß triefend, mit ausgedörrtem Munde und glaubte jeden Augenblick, das Herz müsse ihm in der Brust zerspringen. So erreichte er endlich den Vermummten, der Isabella auf dem Sattel festhielt.
»Zu Hilfe, Sigognac, zu Hilfe!« rief sie.
»Ich komme!« röchelte der Baron mit heiserer Stimme und hing sich mit der Linken an den Riemen, der lsabella an den Räuber fesselte. Er bemühte sich diesen herunterzuziehen, indem er neben dem Pferde herrannte. Aber der Räuber schloß die Knie fest an, und es wäre ebenso leicht gewesen, den Rumpf eines Zentauren auseinanderzureißen, als den Räuber aus dem Sattel. Gleichzeitig preßte er mit den Fersen den Bauch seines Tieres, um es vorwärts zu jagen, und suchte Sigognac abzuschütteln. Angreifen konnte er ihn nicht, weil seine Hände beschäftigt waren, den Zügel zu führen und lsabella festzuhalten. Der Lauf des so hin und her gezerrten und gehemmten Pferdes verlor an Schnelligkeit, was Sigognac erlaubte, wieder ein wenig zu Atem zu kommen. Er benutzte sogar diesen kleinen Aufenthalt, um seinen Gegner durchbohren zu können; aber die Furcht, bei diesen unsicheren Bewegungen Isabella zu verwunden, war der Grund, daß sein Stoß fehlging. Der Reiter ließ einen Augenblick lang den Zügel los, nahm aus seiner Tasche ein Messer, durchschnitt damit den Riemen, an dem Sigognac sich verzweifelt anklammerte, und stieß dann die Räder seiner Sporen tief in die Flanken des armen Tieres, das mit unwiderstehlichem Ungestüm weiterraste.
Der Lederriemen blieb in Sigognacs Faust, der, da er nun keinen Stützpunkt mehr hatte und auf diese List nicht gefaßt war, hart auf den Rücken niederstürzte. Wie behend er sich auch erhob und seinen, einige Schritte weit von ihm gefallenen Degen aufraffte, so reichte doch diese kurze Zwischenzeit hin, um den Reiter einen Vorsprung gewinnen zu lassen, den der Baron, ermüdet, wie er durch diesen ungleichen Kampf und wütenden Lauf war, nicht hoffen konnte wieder einzubringen. Dennoch rannte er auf den immer schwächer werdenden Hilferuf Isabellas dem Räuber von neuem nach, aber es war ein erfolgloses Streben eines edlen Herzens, das sich des Teuersten, was es auf der Welt besessen, beraubt sah. Er blieb immer weiter zurück, und schon hatte der Reiter den Wald erreicht, der, obschon entlaubt, durch die Verzweigung der Stämme und Äste hinreichte, die Richtung, welche der Bandit genommen, zu verbergen.
Außer sich vor Wut und Schmerz, mußte Sigognac Halt machen und seine teure Isabella in den Krallen dieses Dämons lassen. Er konnte ihr nicht ferner beistehen, selbst nicht mit Hilfe des Tyrannen und Scapins, die, als sie die Pistolenschüsse hörten, sogleich vom Wagen herabsprangen, obwohl der als Führer dienende Lakai sie zurückzuhalten suchte. Mit wenigen, kurzen, abgebrochenen Worten unterrichtete Sigognac sie von der Entführung Isabellas und allem, was dabei geschehen war.
»Da steckt Vallombreuse dahinter«, sagte Herodes. »Hat er vielleicht von unserer Reise nach dem Schlosse Pommereuil Wind bekommen und diesen Hinterhalt gelegt? Oder war vielleicht die ganze Einladung nur eine List, um uns aus der Stadt zu locken, in der solche Unternehmungen sehr schwierig und gefährlich wären? Dann ist der Schuft, der den ehrwürdigen Haushofmeister spielte, der größte Schauspieler, den ich jemals gesehen. Ich hätte darauf geschworen, dieser Kerl sei wirklich ein aus lauter Tugenden und Vorzügen gekneteter Intendant eines großen Hauses. Jetzt aber, wo wir unser drei sind, wollen wir dieses Gehölz nach allen Richtungen durchsuchen, um wenigstens eine Spur von dieser guten, uns allen so teuren Isabella zu finden. Ach, ich fürchte sehr, daß diese unschuldige Biene in das Netz einer ungeheuerlichen Spinne gefallen ist, die ihr den Garaus macht, ehe es uns gelungen ist, das nur zu fest verschlungene Gewebe zu zerreißen.«

»Ich werde sie zertreten«, sagte Sigognac, indem er mit dem Absatze auf die Erde stampfte, als ob er die Spinne unter seinem Stiefel hätte. »Ich werde es zermalmen, das giftige Ungeziefer!«
Der schreckliche Ausdruck seines sonst so ruhigen und sanften Gesichtes verriet, daß diese Worte keine eitle Prahlerei waren.
»Wohlan,« sagte Herodes, »dringen wir, ohne die Zeit mit Worten zu verlieren, in den Wald und durchstreifen wir ihn. Das Wild kann noch nicht weit sein.«
In der Tat rollte auf der anderen Seite des Dickichts, das Sigognac und seine Begleiter durchdrangen, eine Kutsche mit zugezogenen Vorhängen in der ganzen Schnelligkeit dahin, die eine Salve von Peitschenhieben vier Postpferden verleihen konnte. Den beiden Reitern, deren Pferde Sigognac gestochen hatte, war es gelungen, sie zu bändigen. Sie galoppierten zu beiden Seiten des Wagens her, und einer davon führte noch das Pferd des Vermummten, denn dieser war selbst mit in den Wagen gestiegen, ohne Zweifel um Isabella zu verhindern, um Hilfe zu rufen oder mit Gefahr ihres Lebens aus dem Wagen zu springen. Von jedem, der nicht die Siebenmeilenstiefel besessen, die der kleine Däumling dem Menschenfresser so geschickt zu rauben wußte, wäre es wahnsinnig gewesen, einem Wagen nachzulaufen, der mit dieser Schnelligkeit fuhr und so gut begleitet war.
Der kleine Trupp kehrte daher niedergeschlagen und betrübt nach dem Wagen zurück, wo die übrigen Schauspieler in großer Unruhe und Angst die Aufklärung dieses ganzen rätselhaften Vorfalles erwarteten.
Gleich von Anfang an hatte der als Führer dienende Lakai die Fahrt des Wagens beschleunigt, um Sigognac den Beistand seiner Kollegen zu entziehen, obwohl ihm diese zuriefen, er solle haltmachen. Als der Tyrann und Scapin beim Knall der Pistolenschüsse abgestiegen waren, hatte der seinem Pferde die Sporen gegeben und war, über den Graben setzend, querfeldein gesprengt, um sich seinen Spießgesellen anzuschließen, ohne sich fortan weiter darum zu kümmern, ob die Truppe das Schloß Pommereuil erreiche oder nicht, wenn nämlich dieses Schloß wirklich existierte, was nach dem soeben Geschehenen wenigstens zu bezweifeln war.
Herodes erkundigte sich bei einer alten Frau, die mit einem Bündel dürren Holzes auf dem Rücken vorüberkam, ob man noch weit von Pommereuil wäre. Die Alte entgegnete hierauf, sie kenne mehrere Meilen in der Runde kein Gut, Dorf oder Schloß dieses Namens, obschon sie seit siebzig Jahren die ganze Umgegend aufs Genaueste kenne. Es lag sonach auf der Hand, daß die ganze Geschichte mit der Theatervorstellung ein Streich war, der von schlauen Schurken zugunsten eines Großen ersonnen worden, der kein anderer sein konnte als der in Isabella verliebte Herzog von Vallombreuse. Denn es hatte einen großen Aufwand an Leuten und Geld bedurft, um dieses komplizierte Manöver in Szene zu setzen. Der Wagen kehrte nach Paris zurück. Sigognac aber, Herodes und Scapin blieben an Ort und Stelle, denn sie hatten die Absicht, in einem der nächsten Dörfer Pferde zu mieten, die es ihnen möglich machten, die Räuber auf wirksamere Weise zu verfolgen.
Isabella war nach dem Sturze des Barons auf einen freien Platz des Waldes geschleppt, vom Pferde herabgerissen, und obwohl sie sich aus Leibeskräften wehrte, binnen drei, vier Minuten in eine Kutsche gesetzt worden, die sofort mit größter Schnelligkeit davonrollte. lsabella gegenüber saß respektvoll der Vermummte, der sie auf seinem Sattel fortgetragen hatte. Bei einer Bewegung, die sie machte, um den Kopf zum Schlage hinauszustecken, streckte der Mann den Arm aus, und hielt sie zurück. Gegen diese eiserne Faust anzukämpfen, war unmöglich. Isabella setzte sich wieder und fing an zu schreien, in der Hoffnung, von einem Vorüberkommenden gehört zu werden.
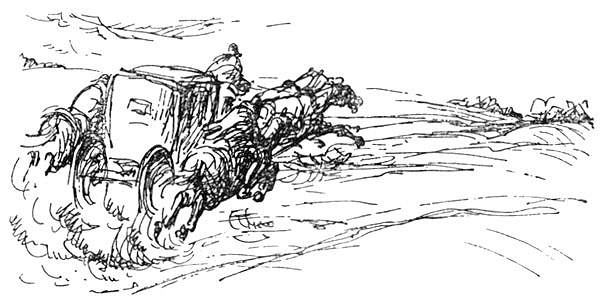
»Mademoiselle, ich bitte Sie, sich zu beruhigen«, sagte der geheimnisvolle Räuber im Tone und mit der Gebärde der ausgesuchtesten Höflichkeit. »Nötigen Sie mich nicht, gegen eine so reizende und liebenswürdige Person Gewalt anzuwenden. Man will Ihnen nichts Böses tun, vielleicht sogar viel Gutes. Beharren Sie daher nicht bei diesem ganz fruchtlosen Sträuben. Wenn Sie fügsam sind, so werde ich die zarteste Rücksicht gegen Sie beobachten, und eine gefangene Königin würde nicht ehrfurchtsvoller behandelt werden. Zeigen Sie sich dagegen widerspenstig und rufen Sie um Hilfe, die doch nicht kommen wird, so bin ich mit den nötigen Werkzeugen versehen, Sie zu bändigen. Diese werden Sie zwingen, sich ganz stumm und ruhig zu verhalten.«
Mit diesen Worten zog der Mann einen sehr künstlich gefertigten Knebel und eine lange zusammengewickelte seidene Schnur aus der Tasche.
»Es wäre,« fuhr er fort, »Barbarei, diese Art Beißkorb an einen so frischen, rosigen und honigsüßen Mund zu legen, und Sie werden selbst gestehen, daß diese Schnur sich nicht sonderlich hübsch um Handgelenke geschnürt ausnehmen würde, die nur geschaffen sind, Armbänder von Gold und Diamanten zu tragen.«
Wie aufgebracht und verzweifelt Isabella auch war, so ergab sie sich doch diesen Vernunftgründen, die in der Tat gut waren. Physischer Widerstand konnte zu nichts nützen. Isabella drückte sich daher so tief als möglich in die Ecke des Wagens, und verhielt sich schweigend. Schwere Seufzer aber hoben ihre Brust, und aus ihren schönen Augen rollten Tränen über ihre bleichen Wangen wie Regentropfen auf eine weiße Rose. Sie dachte an die Gefahr, in der ihre Tugend schwebte, und an die Verzweiflung Sigognacs.
Von Zeit zu Zeit warf Isabella einen ängstlichen Blick auf ihren Hüter, der dies bemerkte und mit einer Stimme, die er sanft zu machen bemüht war, obwohl sie von Natur rauh klang, zu ihr sagte:
»Sie haben von mir nichts zu fürchten, Mademoiselle. Ich bin ein anständiger Mann und werde nichts unternehmen, was Ihnen mißfallen könnte. Wenn das Glück mich mit mehr Gütern gesegnet hätte, so würde ich Sie allerdings nicht zum Vorteil eines andern entführt haben. Aber die Härte des Schicksals nötigt zuweilen das Zartgefühl zu seltsamen Schritten.«
»Sie gestehen also,« sagte Isabella, »daß man Sie gedungen hat, mich zu rauben. Welche Schändlichkeit!«
»Nach dem, was ich getan,« antwortete der Vermummte im ruhigsten Tone, »wäre es völlig überflüssig und zwecklos, es leugnen zu wollen. Aber, um der Unterhaltung Abwechslung zu geben: wie reizend waren Sie in der letzten Vorstellung. In der Geständnisszene entwickelten Sie eine Anmut, die noch nie eine Schauspielerin erreicht hat. Ich applaudierte aber auch, daß meine Nachbarn hätten taub werden können. Die beiden Hände, die Töne gaben wie Wäscheklopfer, das waren meine.«
»Verschonen Sie mich mit diesen jetzt sehr unzeitigen Komplimenten. Wo führen Sie mich so gegen meinen Willen und allein Gesetz und Anstand zum Trotz hin?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, und übrigens wäre Ihnen dies auch vollkommen nutzlos. Unsere Pflicht verlangt von uns, verschwiegen zu sein wie Beichtväter und Ärzte. In solchen Angelegenheiten ist die unbedingteste Diskretion unumgänglich notwendig.«
Da Isabella sah, daß sie nichts weiter herauslocken würde, so richtete sie weiter keine Frage an ihren Wächter. Übrigens bezweifelte sie ohnehin nicht, daß Vallombreuse der Urheber dieses Streiches sei. Sie hoffte, daß Sigognacs Mut ihr zu Hilfe kommen würde; aber würde es wohl diesem treuen und tapferen Freund gelingen, noch rechtzeitig den abgelegenen Schlupfwinkel zu entdecken, wohin ihre Räuber sie führten? »Im schlimmsten Falle«, sagte sie bei sich selbst, »habe ich Chiquitas Messer in meinem Mieder und kann mein Leben meiner Ehre opfern.« Dieser Entschluß gab ihr ein wenig Ruhe wieder.
Der Wagen rollte seit zwei Stunden immer mit derselben Geschwindigkeit entlang, und hielt bloß einmal einige Minuten lang, die für den Ersatz bereitgehaltenen Pferde einzuspannen. Da die herabgelassenen Vorhänge der Gefangenen nicht gestatteten, hinauszusehen, konnte sie auch nicht erraten, in welcher Richtung man sie fortführte.
Das Rollen der Räder über die eisenbeschlagenen Balken einer Zugbrücke verkündete Isabella, daß man am Ziele der Fahrt angekommen sei. In der Tat machte der Wagen halt, der Schlag öffnete sich, und der Vermummte bot der jungen Komödiantin die Hand, um ihr aussteigen zu helfen.
Sie warf einen Blick um sich und sah einen großen Hof, der durch vier von Ziegelsteinen erbaute Flügel gebildet wurde, deren rote Farbe im Laufe der Zeit in eine ziemlich düstere übergegangen war. Enge, lange Fenster durchbrachen die inneren Fassaden, und hinter den grünlichen Glasscheiben gewahrte man geschlossene Läden. Obschon das unbekannte Schloß jenen Anflug von Verödung hatte, die die Abwesenheit des Herrn derartigen Gebäuden gibt, sah es doch noch sehr gut und nobel aus. Es war öde, aber nicht verlassen, und kein Anzeichen des Verfalls war daran zu bemerken. Der Körper war unversehrt, nur die Seele fehlte. Der Vermummte übergab Isabella den Händen eines Lakaien in grauer Livree. Dieser führte sie über eine breite Treppe mit schönem eisernen Geländer nach einer Wohnung, die früher als das Nonplusultra des Luxus erscheinen mußte, und deren jetzt verblichener Reichtum die moderne Eleganz immer noch aufhob. Schönes Getäfel von Eichenholz bedeckte die Wände des ersten Zimmers. In dem zweiten vertraten Malerei und Vergoldung die Stelle der Tapeten. Das Bett stand in einem tiefen Alkoven und war mit einem Stoffe bedeckt, durch dessen Seide sich Gold- und Silberfäden hindurchzogen. Eine wunderschön gearbeitete Toilette trug einen venetianischen Spiegel, der Isabella die Blässe und Verstörtheit ihrer Züge zeigte.
Ein großes Feuer brannte in dem ungeheuren, reich mit Bildhauerarbeit verzierten Kamin, über dem ein Porträt hing, dessen Ausdruck Isabella sehr betroffen machte. Dieses Gesicht war ihr nicht unbekannt. Es schien sie wie beim Erwachen an eine jener im Traum gesehenen Gestalten zu erinnern, die nicht mit dem Traum zugleich entschwinden, sondern dem Träumen dennoch lange im Leben folgen. Es war das bleiche Antlitz eines Mannes mit schwarzen Augen, roten Lippen und braunem Haar, der etwa vierzig Jahre zu zählen schien, und dessen Züge den Ausdruck eines edlen Stolzes trugen. Ein Panzer von gebräuntem Stahl mit goldenen Streifen und einer weißen Schärpe darüber bedeckte die Brust. Trotz des Schreckens, den ihr ihre Lage bereitete, konnte sie doch nicht umhin, dieses Porträt zu betrachten und wie verzaubert ihre Augen immer wieder darauf zu heften. Es lag in diesem Gesichte eine Ähnlichkeit mit dem des Herzogs von Vallombreuse, der Ausdruck aber war ein so verschiedener, daß die Ähnlichkeit bald wieder in den Hintergrund trat.

Sie war noch in diese Betrachtungen versunken, als der Lakai in grauer Livree, der sich einige Augenblicke entfernt hatte, mit zwei Dienern, die einen kleinen Tisch mit einem Gedeck trugen, zurückkam und zu der Gefangenen sagte:
»Mademoiselle, es ist serviert.«
Einer der Diener schob schweigend einen Sessel herbei, und der andere hob den Deckel von einer massiven silbernen Terrine, aus der ein duftiger Rauchwirbel aufstieg. Trotz des Kummers, den ihr Abenteuer ihr bereitete, empfand Isabella doch einen Hunger, über den sie sich fast Vorwürfe machte, als ob die Natur jemals auf ihre Rechte verzichtete. Aber der Gedanke, die Speisen könnten vielleicht ein Schlafmittel enthalten, das sie wehrlos beabsichtigten Anschlägen ausliefern könnte, gebot ihr halt, und sie stieß den Teller wieder zurück, in den sie bereits den Löffel eingetaucht hatte.
Der Lakai in grauer Livree schien ihre Befürchtungen zu erraten, und genoß vor Isabellas Augen ein wenig von dem Wein, von dem Wasser und allen auf dem Tische stehenden Gerichten.
Die Gefangene, dadurch wieder ein wenig beruhigt, trank einen Schluck Fleischbrühe, aß einen Bissen Brot, sog den Flügel eines Huhns und nachdem sie mit diesem kurzen Mahle fertig war, rückte sie ihren Lehnstuhl an das Feuer und blieb so einige Zeit, den Ellbogen auf die Armlehne ihres Stuhles und das Kinn auf die Hand gestützt, während sich ihr Geist in unklares, schmerzliches Hinbrüten verlor.
Nach einer Weile erhob sie sich, und näherte sich dem Fenster, um zu sehen, welche Aussicht sich von hier aus darböte. Als sie sich hinausbog, sah sie am Fuße der Mauer das stehende grünliche Wasser eines tiefen Grabens, der das Schloß umgab. Die Zugbrücke, über die der Wagen gefahren, war wieder aufgezogen, und wenn man nicht den Wassergraben durchschwimmen wollte, so war jeder Verkehr mit der Außenwelt unmöglich. Selbst dann wäre es noch sehr schwierig gewesen, die steile steinerne Einfassung des Grabens am jenseitigen Ufer zu erklettern. Die Aussicht ward durch einen Wall, der durch die um das Schloß herum gepflanzten hundertjährigen Bäume gebildet wurde, vollständig abgeschnitten. Der Hoffnung auf Flucht oder Befreiung mußte Isabella gänzlich entsagen und die kommenden Ereignisse mit jener bangen Ungewißheit abwarten, die vielleicht schlimmer ist als die furchtbarste Katastrophe.
Das arme Mädchen zitterte daher auch bei dem leisesten Geräusche. Das Murmeln des Wassers, ein Seufzer des Windes, ein Knacken des Wandgetäfels, das Knistern des Feuers trieb ihr kalte Schweißperlen auf den Rücken. Jeden Augenblick erwartete sie, eine Tür könnte sich öffnen, ein Teil des Wandgetäfels sich verschieben, dahinter ein geheimer Gang sichtbar werden und aus diesem schwarzen Rahmen etwas, ein Mensch oder ein Gespenst heraustreten. Mit der Dämmerung, die sich immer dunkler herabsenkte, stiegen ihre Befürchtungen immer höher. Ein Diener trat ein und brachte einen Armleuchter, in dem mehrere Kerzen brannten.
Während Isabella in ihrem einsamen Zimmer vor Furcht zitterte, saßen ihre Räuber in einem Zimmer des Erdgeschosses schwelgend und zechend beisammen, denn sie sollten für den Fall eines Angriffs Sigognacs als Besatzung im Schlosse bleiben. Sie tranken alle wie die Schwämme, einer von ihnen aber entwickelte auf diesem Felde eine ganz besondere Virtuosität. Es war der Mensch, der Isabella auf seinem Pferde entführt hatte. Da er jetzt ohne Maske war, konnte jeder sein käseweißes Gesicht, in dem eine rotglühende Nase leuchtete, betrachten. An dieser kirschroten Nase war sofort Malartic, der Freund Lampourdes, zu erkennen.
