
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
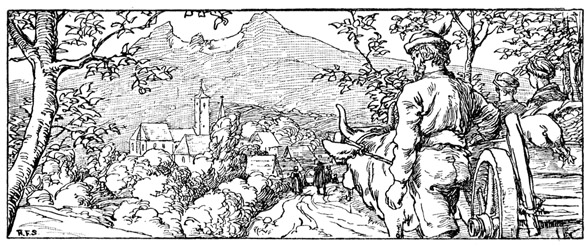
In den Morgenlüften ein leises Frösteln – wie kühler Sorgenschauer, der alles müdgewordene Leben der Natur durchrieselte, da sie den Winter kommen fühlte. Und dennoch ein Tag, wie ihn der junge Sommer leuchtender in allen Farben nicht hätte schenken können. Ein Tag wie Frühling, den in der Morgensonne die Seele des Herbstes träumte; doch nicht wie grüner Lenz war dieses Träumen – es war wie Mai in Flammen und Glut, wie letzte, brennende Leidenschaft aller überreif gewordenen Kräfte der Natur.
Im gelben Flammengezack der Ulmen und Ahornbäume, im roten Laub der Buchen und unter dem schimmernden Sonnengold des Morgens, schwammen die welkenden Wälder wie lodernde Feuerwogen über das weite Thal hinaus, allen Saum der Berge mit Glanz umspülend. Wo sie gedrängt hineinquollen in die seitwärts gesprengten Schluchten des Gebirges – wo sie die Sonne verloren und in den Schatten tauchten, da wurden sie dunkel und waren anzusehen wie erstarrte Bäche von Blut, das aus dem Herzen des Gesteins geflossen. Doch immer wieder – als könnte der Laubwald auch jetzt noch, da er sterben sollte, die Sonne nicht entbehren – immer wieder griff er aus den schattigen Tiefen hinauf in die Höhen des Lichtes, fand seine brennende Freude wieder und brandete mit zerrissenen Leuchtflocken bis hoch empor zu den steilen Gehängen, auf denen der dunkle Fichtenwald sein immergrünes Leben still hinüberträumte in den nahenden Winter. Ihm hellte der Sonnenschein das Dunkel kaum erkenntlich auf – und schöner fast, als im Glanz des Lichtes, sah er sich an im Schatten, wo ihn der blaue Duft des Morgens noch umdämmerte.
Und über ihm, schon weiß behaucht von einem frühen Schneefall, stiegen aus dem ruhigen Meer der dunklen Wipfel die kahlen Felsen in die Lüfte, hart und starr und unveränderlich, mit dem ruhigen Wechsel zweier Farben: wie mattes Silber in der Sonne und wie blauer Stahl im Schatten.
Dort oben die kalte Ruhe, das ewige Dauern – und in der Tiefe des Thales, von warmer Sonne umglänzt, das Welken und Sterben. Doch ein Sterben, leuchtend und schön – ein Sterben, das wie wundersame Blüte war, wie gesteigerte Lebenslust. Jedes fallende Blatt noch eine tanzende Freude, noch einer gaukelnden Flamme gleich.
Blau – eine stille Riesenglocke – wölbte sich der Himmel über alles hin, über das Dunkle und über das Leuchtende, über das Kalte und über alle Glut. Nicht blendend – wie ein mild und wohlig strahlendes Feuer goß die Sonne ihren Glanz über all die steinerne Weite aus und nieder in alle Thäler des Lebens.
Vom leisen Morgenwinde getrieben, schwammen kleine schimmernde Sternchen zahllos in der Luft: der fliegende Distelsamen – Unkraut, das sich ausstreute über allen fruchtbaren Grund – doch der leuchtende Flug dieser Sterne war anzuschauen, als hätte die Sonne von ihren Feuerfunken die tausend schönsten auf die Reise ausgeschickt, um die Erde zu suchen. Und als hätte sie von ihren Strahlen die feinsten in tausend Splitter gebrochen und ausgeschüttet über die Welt, so ging immer wieder ein fliegendes Blitzen durch die blauen Lüfte, schimmernd glomm es auf, erlosch, und leuchtete wieder im Flug. Wie Märchenzauber war es, wie ein gaukelndes Silberrätsel im Blau – und so überreichlich flogen die zarten Fäden, die der Herbst gesponnen, daß die Wipfelspitzen all der brennenden Bäume von ihnen behangen waren wie mit flimmernden Wimpeln. Und wo aus dem weiten Thal, vom Ufer der rauschenden Ache weg, die weißglänzende Straße emporführte zum hochgelegenen Kloster und zu der langen Häusergasse des Marktes, da trieb der Morgenwind, bergaufwärts ziehend in der Sonne, den Flug der glitzernden Fäden von überall zusammen. Wie ein wallendes Netz von Glanz und Schimmer hing es über den hundert stillen Dächern in der Luft. An den Zinnen des offenen Klosterthores, an den Brustwehren der um das Stift gezogenen Mauern, an den Zieraten seiner hohen Dächer, an den Thürmen des Münsters und der Pfarrkirche, an den Giebeln und Schornsteinen der eng aneinander gereihten Bürgerhäuser – überall hatte das Geglitzer sich festgeklammert und leuchtete wie ein Elmsfeuer, das am Tage brennt.
Unter dem wundersamen Blau des Himmels und umwoben vom Glanz der Sonne, im roten Brand des Laubes und umsponnen von all dem silbernen Geschimmer, glich der häuserreiche Markt einer verzauberten Stätte des Lebens, die aus geheimnisvollen Tiefen an den Tag gestiegen. Der kleine Marktplatz und die engen Seitengassen lagen öd und leer, wie ausgestorben; nirgends war ein Mensch zu sehen, nirgends ein lebender Laut zu hören. Denn Sonntag war's, und um die Stunde der Kirchenzeit. Nur das Wasser schwatzte, das am Marktbrunnen aus vier bleiernen Röhren in einen großen Trog aus rotem Marmor plätscherte. Und aus dem Thal herauf klang manchmal das Rauschen der Ache, wenn der Wind ein wenig stärker zog. Der blies über die leere Straße her und machte die bunten Bänder der grünen Firstbäumchen flattern, die auf dem Dache eines neuerbauten, noch vom Holzgerüst umschränkten Hauses aufgerichtet waren.
Gegenüber dem Thor des Klosters, vor dessen Mauern ein Theil des alten Wehrgrabens mit Bauschutt zugeworfen war, um den Marktplatz zu vergrößern, stand das neue Haus an einer freien Ecke des Platzes, all die anderen, niederen Dächer stolz überragend, so recht als sollten seine klobig gefügten Steine jedem Vorübergehenden sagen: »Der mich erbaute, der hat Geld im Kasten!« Sein Nachbar, ein armseliges Häuschen, über dessen niederer Thüre das Werkzeichen eines Drechslers baumelte, schien mit seinem windschiefen Gebälk vor dem stolzen Neubau scheu zurückzuweichen, zwinkerte mit seinen kleinen, von Staub erblindeten Fensteraugen an dem neuen Hause hinauf und schien zu murmeln: »Freilich, der hat Geld, der kann sein Dach mit steinernen Ziegeln decken! Und unter meinen mürben, faulenden Schindeln hausen die Mühseligen, die ihm sein Geld verdienen halfen!«
Über der hohen Thüre des neuen Hauses, die mit dem roten Marmor des Untersberges gesimst und geziert war, stand mit frischer, noch kaum getrockneter Farbe an die Mauer geschrieben:
»Mit Gottes Hilfe hat dieses Haus erbauet:
Dominikus Weitenschwaiger,
Meistersinger, Bürger und Holzverleger zu
Berchtesgaden,
anno domini 1524.«
In der Sonne glitzerte die frische Schrift, als wäre Goldstaub in die Farbe gemischt.
Dieses neue, noch unbewohnte Haus war auch das einzige, an welchem Thür und Fenster offen standen. An allen übrigen Häusern waren die Thüren verschlossen, die Gewölbe der Kaufleute waren gesperrt, mit schweren Vorhängschlössern und eisernen Stangen; an den Fenstern waren die hölzernen Läden zugezogen, oder die kleinen, in dickes Blei gefaßten Scheiben waren von innen dicht verhängt. Das gab dem Anblick der Häuser etwas ängstlich Beklommenes, etwas Scheues und Furchtsames. In all diesen Häusern – auf deren Dächern nur ab und zu ein Schornstein verriet, daß Feuer auf dem Herde brannte – schien das versteckte Leben vor einer Gefahr zu zittern, welche kommen konnte mit jeder nächsten Stunde.
Und um all diese furchtsamen Häuser her die lachende Sonne, das strahlende Blau des Himmels, der brennende Glanz und der fliegende Schimmer des schönen Herbstes.
Da klang der schwebende Hall einer großen Glocke in den stillen, leuchtenden Morgen. Auf dem Thurm des Münsters läutete man zur Wandlung. Und als die große Glocke verstummte, begann eine kleinere zu läuten – die Glocke der Pfarrkirche. Denn die Glocke der Bürger mußte bescheiden warten, bis auf dem Münsterthurm des adeligen Stiftes die erzene Herrenstimme ihr letztes Wort gesprochen hatte – und auf dem Gottestisch, vor dem die Bürger und Bauern beteten, durfte das Brod nicht in den Leib des Herrn verwandelt werden, bevor das heilige Wunder sich nicht vollzogen hatte auf dem goldgezierten Altar, vor dessen Stufen die adeligen Chorherren ihre Kniee beugten.
Der letzte Glockenlaut verzitterte in den Lüften – und wieder die träumende Sonnenstille.
Da kreischte an einem der Bürgerhäuser die Thür, ganz leise. Aus dem Thürspalt, der sich langsam öffnete, schob sich ein zerzauster Mädchenkopf hervor, und zwei scheue Augen spähten auf die Gasse. Mit langen Sprüngen huschte die Magd auf den Brunnen zu. Sie nahm sich die Zeit nicht, unter der Röhre den frischen Quell in den hölzernen Zuber rinnen zu lassen, sondern schöpfte von dem Wasser, das den marmornen Trog erfüllte. Dabei spähte sie immer ängstlich nach allen Seiten. Und als sie aus einer nahen Gasse plötzlich zwei laute Männerstimmen hörte und das jammernde Geschrei eines Weibes, rannte sie, vom Wasser die Hälfte verschüttend, erschrocken in das Haus zurück und schlug hinter sich die Thüre zu.
Die beiden Männerstimmen kamen näher, und ihr Schelten verwandelte sich in grobes Gelächter. Dazu die jammernden Laute eines Weibes – ein Jammer, der nur in der Stimme lag, denn die kreischenden Worte waren fast drollig anzuhören: »Schauet, es ist doch ein Kitzbraten! Auf Ehr und Seligkeit, es ist nur ein Kitzbraten! Um Christi Barmherzigkeit, so lasset mir doch das Bröckl Fleisch!«
Aus enger Gasse, die vom Marktplatz gegen das Gehänge des Untersberges führte, kamen zwei Kirchenwächter des Klosters, in bunt gewürfelter Tracht, die es dem schmucken Kleid der Landsknechte gleichthun wollte. Der eine ließ unter dem Arm hervor den langen Schaft der Hellebarde schleifen, und lachend trug er in beiden Händen am Eisenstiel eine Pfanne mit rauchendem Braten. Der andere wehrte mit dem Hellebardenschaft das jammernde Weib zurück, das immer die Hände nach der Pfanne streckte und nur das eine Wort hatte: »Ein Kitzbraten, ihr guten Herren! Ein Kitzbraten!« Aus dem angstverzerrten Gesicht des ärmlich gekleideten Weibes redete ein Jammer, als hätte man ihr nicht die Bratenschüssel, sondern den kostbarsten Schatz der Welt aus dem Hause geholt. Sie war noch jung, aber ein Leben in Gram und Entbehrung hatte ihre Züge schon zerstört; nur noch das schimmernde Blondhaar war ein Zeichen ihrer jungen Jahre. Ganz heiser war sie vom Schreien schon geworden. »So lasset mir doch das Bröckl Fleisch! Ein Kitzbraten, ihr guten Herren ... es ist nur ein Kitzbraten!« Sie wollte nach der Pfanne greifen.

Aber der Wächter drängte sie mit dem Hellebardenschaft gegen den Brunnen. »Lüg nicht! Wildpret ist's!«
»Auf Ehr und Seligkeit, ein Kitzbraten! Fraget nur den Metzger ...«
»Wildpret ist's! Mein Zinken versteht sich drauf, wie Wildpret schmeckt! Und wer's gestohlen hat ... da soll dich einer fragen, der mit eisernem Züngl redet! Gieb acht, du! Und halt dein Maul! Und schau, daß du weiter kommst!«
»Ein Kitzbraten«, lallte das Weib, »ein Kitzbraten ...«
»So? Und wär's einer ...« der Wächter lachte, »so müßt man erst noch fragen, ob's allweil einer gewesen ist! Es wär nicht das erstmal, daß Eine mit Teufelshilf einen Kitzbraten aus dem Wildpret macht!«
Das Weib tastete mit zitternden Händen nach dem Stein des Brunnens, als wäre ihr eine Schwäche in die Kniee gefahren. Ihr verzerrtes Gesicht war kreidebleich geworden. Sie sagte kein Wort mehr – und die beiden Wächter verschwanden mit der Pfanne im Klosterthor. Man hörte die Stimme des Thorwärtels, eine lachende Frage, eine lachende Antwort. Das Weib streckte sich und griff mit der Hand an den Hals. Und da sah sie plötzlich, daß neben ihr einer stand. Der schien ihr keine Sorge zu machen – es war ein Bauer. Und er mußte an diesem Morgen schon einen weiten Weg gewandert sein – die Schuhe waren grau, bis über die Hüften hing ihm der Staub an den Kleidern. Und ein Fremder mußte er sein; denn er trug nicht die Tracht der Berchtesgadener Klosterbauern, nicht die nackten Kniee, sondern blaue Strümpfe, eine weiße Bundhose aus Bockleder und ein kurzes Wams aus blauem Zwilch, verbraucht und halb schon entfärbt. Ein grauer Mantel hing ihm lose über die Schulter. Unter dem Hut, dessen breite Krempe zu einem Dreispitz aufgebunden war, lag das Gesicht im Schatten, umrahmt von langsträhnigem Haar, durch dessen Braun sich reichlich schon die weißen Fäden zogen. Das Gesicht war ohne Bart, von hundert Krähenfüßen durchrissen – ein Mund fast ohne Lippen, hart und dennoch spöttisch – eine schmale, scharf gekrümmte Nase und zwei kleine, graue, blitzende Augen. Die Hände über den Knauf des Wandersteckens gelegt, so stand er schweigend und betrachtete das Weib, dem die Zähren über die hageren Wangen kollerten.
Die Weinende schien zu fühlen: der meint es gut mit mir! Sie atmete auf und wischte die Thränen vom Gesicht. Doch weiter bekümmerte sich das Weib nicht um den Fremden, sondern starrte wieder mit nassen Augen nach dem Klosterthor, aus dem noch immer die lachenden Stimmen klangen.
Da sagte der Bauer leis, im Dialekt des Schwaben: »Bischt au von Koinrats Schwestern oine, gell!«
Das Weib sah ihn an, als hätte sie nicht verstanden. Doch aus dem Klang seiner Stimme hatte sie das Mitleid gehört und begann zu murmeln: »Mein Mann, der kranket ... schon seit dem Frühjahr ... seit er fronen hat müssen beim Bärentreiben. Die großen Beißer, weißt, die haben ihn überworfen, und da hat er einen schiechen Fall gethan, übers grobe Gesteinet. Ganz käsig im Gesicht, so ist er heim gekommen ... und seit der Zeit thut er siechen, wird minder mit jedem Tag und verschmilzt wie ein Lichtl im Wind. Und die Nachbarsleut, die sagen allweil: Fleisch müßt er haben, daß er sich kräften könnt. Und vierzehn Tag lang hab ich mir's abgespart am Maul ... und gestern hab ich dem Metzger das Stückl Kitzfleisch abgehandelt ... und hab den Rauchfang zugestopft, daß keine Klosternas was schmecken sollt ... aber die haben Nasen aufs Fleisch, wie der Teufel auf arme Seelen ... und von der Glut weg haben sie mir die Pfann davon ...« In dicken Tropfen rannen ihr wieder die Zähren über das Gesicht. »Und Wildpret wär's! Und der's gestohlen hätt, müßt bluten! Und thät sich's weisen, daß es Kitzfleisch ist ...« sie würgte an jedem Wort, »so muß ich ... muß ich das Wildpret halt verscharrt haben, daß es Kitzfleisch wird ... und ich komm vors rote Malefiz!« Die Stimme erlosch ihr fast. »So haben sie's der Steffelsdirn gemacht ... und in Salzburg ist sie verbronnen worden am Tag nach Ostern ...« Verstummend streckte sich das Weib und ballte die Fäuste. Der zornfunkelnde Blick ihrer Augen war auf das kleine, dicht vergitterte Fenster der Thorstube gerichtet. Hatte sie von dem Lachen und Schwatzen, das aus der Stube des Wärtels klang, ein Wort verstanden? In heiseren Lauten, mit ganz entstelltem Gesicht, wie eine Irrsinnige, keuchte sie vor sich hin: »Thät sich doch jeder den Tod in die Gurgel fressen! ... Und wenn ich ein Stückel verstünd, ein schwarzes ... heut thät ich's ... heut!«
Da legte ihr der Fremde die Hand auf den Arm. Ein flinker Blitz seiner Augen huschte über das Klosterthor. Dann hob er langsam das Gesicht, blickte wie lauschend in die sonnigen Lüfte hinauf und flüsterte: »Lus, Weible, was isch das für ein nuies Wesen?«
Verwundert, ihres Kummers halb vergessend, sah ihm das Weib in die Augen. Dann starrte sie in die Lüfte und schüttelte den Kopf. »Ich hör nichts!«
»So?« Der Fremde lächelte. »Bischt von Koinrats Schwestern eine, die doret taub. isch?« Da wurde sein Blick wieder ernst. »Geh hoim und koch deinem kranke Mann ein Müesle, gell? Und denk dir, alleweil und überall giebt's Leut, die noch ein härters Binkele tragen wie du! Hascht bloß ein Häppele Fleisch verlore! Aber mich lueg an! Mein Weib hat tanze müssen am Herrestrickle ... zehn Schuh hoch üb ernt Bode! Drei liebe Bueben hab ich gehabt, und koiner mehr ischt übrig ... sind all verbronnen in der guten Herrefaust! Und an die tauset brave Koinratsbrüder hab ich liege sehen im Blut! ... Geh hoim und koch deinem Mann ein Müesle, du!«
Mit hartem Lachen wandte sich der Bauer ab und wollte gehen. Aber da klammerte das Weib die Hand um seinen Stecken – in den Augen einen erschrockenen Blick, doch auch eine Frage.
Noch leiser wurde die Stimme des Fremden. »Hascht verstanden ein bissele? So? ... Laß aus!« Er zog den Stecken an sich. »Und thut dich oiner fragen um mich, so hascht mich nie gesehen und kennst mich nimmer, gell? Und wann den Weckauf hörst, du dorets Weible ...« die Augen des Bauern funkelten und ein Zug von grausamer Wildheit schnitt sich um den harten Mund, »so koch kein Müesle nimmer, gell? Schlag zu und beiß und brenn und stich! Hilf zum Koinrat, und der Koinrat hilft zu dir!«
Bleich und wortlos wich das Weib vor dem Fremden zurück. Einen Augenblick schien es, als wollte sie noch eine Frage stellen. Aber sie spähte scheu zum Thor des Klosters hinüber und rannte davon, als wüßte sie in der Nähe dieses Bauern ihr Leben nicht mehr sicher.
Mit steinernem Lächeln sah ihr der Fremde nach und murmelte: »Hab Ängsten soviel, wie du magst ... mein Körndle isch drin in dir ... und aufgehn thut's dir au noch, wart!« Er beugte sich über den Brunnen und schöpfte mit der Hand einen Trunk. Als er sich wieder aufrichtete, war sein Gesicht ein anderes. Wie ein Neugieriger, dem alles wohlgefällt, betrachtete er die Häuser, den blauen Himmel, die fernen Berge und das schöne Thal im Feuerglanz des sterbenden Laubes. Langsam, immer schauend, ging er auf das Thor des Klosters zu und nahm mit höflicher Scheu den Hut schon ab, bevor er noch den Guckaus der Wärtelstube erreichte. Deutlich konnte er aus der Thorstube das Schwatzen hören – die drei da drinnen saßen bei der Pfanne. Und eine Stimme klang: »Das Weibl hat recht gehabt ... das ist Kitzbraten.«
Ein Lachen. »Wenn ich Hunger hab, muß alles nach Wildpret schmecken. Greif zu!«
»Meintwegen! Geht halt der Braten für den Kirchversaum! ... Was war's denn für eine?«
»Die Ruefin.«
»Die von dem Löffelschneider, den bei der Bärenhatz ein Rüd über den Haufen geschmissen hat?«
»Die, ja!«
Jetzt hatte der Wärtel den Fremden gewahrt. Schmatzend, mit dem Ärmel den Mund wischend, kam er zum Guckaus und schob das Eisengitter in die Höhe. Mißtrauisch betrachtete er den Bauern eine Weile, bevor er fragte: »Wer bist denn du?«
Da fing der Fremde ein flinkes Reden an, machte Bückling um Bückling, nannte den Wärtel ein ›gutes Herrle‹ und spickte seinen Redefluß mit so drolligen Spässen, daß auch die beiden Kirchenwächter zum Guckaus kamen und einstimmten in das Gelächter des Wärtels, welcher meinte: »Dem hängt der Schwab am Maulwerk, wie der Schwanz am Teufel!« Immer schwatzend, hatte der Fremde ein Päcklein aus der Tasche gezogen und wickelte aus einem mürb gewordenen Lederlappen zwei beschriebene Blätter heraus, die er dem Wächter reichte. Das eine Blatt, das war ein Heimbrief der freien Reichsstadt Augsburg, lautend auf den Namen Sebastian Häfele.
Der Wärtel lachte und versuchte spottend den Dialekt des Schwaben nachzuahmen: »Häfele! Hascht au dein Deckele bei dir?«
»Ei freilich, guts Herrle!« Schmunzelnd lüftete der Schwabe den Hut und streckte den Scheitel in den Guckaus. »Lueget hinein in's Häfele, was drin ischt!«
»Bauernstroh und Kuhmist halt!« erklärte einer von den beiden Kirchenwächtern. »Deck ihn wieder zu, deinen Lausboden!«
Noch lustiger, als die beiden andern in der Thorstube, lachte der Fremde selbst. Und wieder begann er seine Schnurren auszukramen, während der Wärtel die Schrift des zweiten Blattes zu enträtseln suchte. Das war ein Wegzettel, auf dem der Salzmeister von Reichenhall beglaubigte, daß der Sebastian Häfele ein halb Jahr lang dem bayerischen Salzamt als Säumer gedient und ohne Steuerschuld seinen Laufpaß genommen hätte. Ganz zu unterst in der Ecke trug der Zettel einen kaum sichtbaren Merk: ein Kreuzlein, von einem Ring umzogen. Das war ein Geheimzeichen, mit dem der Reichenhaller dem Kloster zu Berchtesgaden anvertraute, daß der Sebastian Häfele ein guter Christ wäre, dem die Wittenberger Nachtigall in den festgeschlossenen Ring seines Glaubens noch kein Loch gepfiffen hätte. Und solches Zeugnis war nötig bei einem, der ein Augsburger Kind sein wollte.
Aber der Wärtel hatte noch andere Neugier. »Warum bist du fort von Reichenhall?«
So harmlos diese Frage klang – sie versetzte den Schwaben in seltsam heißen Zorn. Wie ein Rohrspatz begann er zu schimpfen, schlug mit der Faust auf das Zahlbrett vor dem Guckaus und schnurrte über das bayerische Salzamt und über die ›notleidigen Brüder‹ vom heiligen Zeno zu Reichenhall eine schier endlose Reihe der übelsten Kosenamen herunter – bis er erschrocken verstummte und scheu die drei Gesichter im Guckaus anblinzelte, als ging' es ihm jetzt an seinen schwäbischen Hals. Die drei aber lachten. Denn im Kloster zu Berchtesgaden hörten sie nichts lieber als üble Reden über den Bayernherzog, der mit begehrlichen Augen nach den ergiebigen Salzquellen des reichsfreien Stiftes blickte, und über die guten Brüder von St. Zeno, die jeden Hader der Berchtesgadener mit dem Erzbischof von Salzburg nützten, um ihnen einen Happen Land aus der Grenze zu reißen.
Der Wärtel, als treuer Diener seiner Herren, wischte sich ein Thränlein seiner lachenden Freude aus den Augen und fragte den Schwaben mit sichtlichem Wohlwollen: »Und was willst denn jetzt bei uns?«
Der Fremde schmunzelte. »Gute Arbeit mache!« Seine Augen blitzten. »Und schaffe, was zum Rechten hilft.«
»Mußt dich halt melden beim Salzmeister.« Der Wärtel gab dem Schwaben die beiden Blätter zurück. »Meintwegen, zahl die Fremdmannssteuer, den Wegzoll, die Klostermauth, den Bleibverlaub und den Kirchversaum ... und alles ist gut!«
»Wie viel thät's ausmachen! Alles miteinand?«
Der Wärtel nannte eine Summe, für die ein Säumer einen Monat schaffen mußte, um sie zu verdienen.
»Nit mehr?« Ganz erstaunte Augen machte der Schwabe. »Wenn die Reichenhaller nehme, was ein Säule wert isch, könne die Berchtesgadener verlange, was ein Öchsle zahlt.« Dabei begann er schon die Schillinge und Heller auf das Brett zu zählen.
»Jetzt fallt der Ofen ein und das Wasser lauft bergauf!« Der Wärtel lachte. »Ein Bauer, der nicht flucht, wenn er zahlen muß!«
»Zahle macht Fried! Ischt ein gutes Sprüchle!« Der Schwabe zwinkerte mit lustigen Augen, schob noch einen überzähligen Schilling auf das Brett, zog höflich den Hut, befestigte hinter der Schnur den ›Bleibverlaub‹ – einen gestanzten Blechschild, den er bekommen hatte – und trat in den Laienhof des Klosters.
Da sagte einer der Kirchenwächter zum Thorwart: »Der hat mir ein bissel gar zu flink gezahlt! Den hättst dir besser anschauen sollen!«
Aber der Wärtel sackte den Schilling ein und schüttelte den Kopf. »Schon gut!«
»Thu's und greif ihm ein bissel tiefer in die Kutteln! Schwäbisch Land ist der Unruhkessel, in dem der Luther fischt.«
»Ich weiß, wie ich dran bin. Laß gut sein! Ist wieder einer mehr im Land, der schafft und zahlt. Sein Schnabel ist guter Ausweis! Wem Gott ein lustigs Maul hat geben, von dem wirst nie was Schlechts erleben!«
Der andere Wächter lachte, als wäre ihm plötzlich ein lustiger Einfall gekommen. »Ruf den Rammel noch einmal her, ich muß was reden mit ihm.« Sein Kamerad steckte den Kopf durch den Guckaus und rief: »He, Schwab, komm her da!«
Lächelnd kam der Fremde zurück und zog den Hut. »Was isch, ihr Herre?« Doch als er am Guckaus die Arme über das Zahlbrett legte, fuhr ihm die leergewordene Pfanne mit der rußigen Unterseite über das Gesicht – »Häfele, schleck am Pfännele!« – und die drei in der Thorstube schlugen ein schallendes Gelächter auf.
Was man von dem Gesicht des Fremden unter dem schwarzen Ruß noch sehen konnte, war weiß wie Kreide. Aber als er mit dem Zipfel seines Zwilchkittels den Ruß von den Wangen wischte, lachte er schon wieder. »Luschtige Herre! Luschtige Herre! Alleweil ein Späßle ... so lang wie's geht!« In diesem letzten Worte zitterte ein seltsamer Klang.

Immer noch lachend, durchschritt der gefärbte Schwabe den Laienhof des Klosters. Da konnte er durch die vergitterten Fensterluken eines dämmerigen Raumes allerlei Jagdgeräte sehen, Wildnetze in großen Ballen, bunte Lappen an Schnüren, eiserne Bären- und Wolfsfallen, Jagdspeere und Armbrusten, Treiberklappern und Hundekoppeln.
Auf der anderen Seite des Hofes, in der großen Leutstube, in der nach der Kirchenzeit das Dünnbier des Klosters an die von der langen Predigt durstig gewordenen Bauern verzapft wurde, stellten zwei Klosterbrüder, mit blauen Latzschürzen über den Kutten, schon die Holzbitschen und die thönernen Krüge zurecht.
Vor der Thüre der Leutstube, etwas aus der Mitte des Hofes gerückt, stand der Schandpfahl mit rostigen Ketten, mit Eisenbändern für Hals und Beine – und der Pfahl hatte dunkle braune Flecken, als wäre auch das Holz gerostet.
Der Schritt des Fremden wurde rascher. Er kam durch ein offenes Thor in den großen, dreiwinkligen Innenhof des Stiftes. Gleich neben dem Thor, im Schatten einer Säulenhalle, plätscherte ein Brunnen. Hier wusch sich der Schwabe den Ruß vom Gesicht. Ohne sich zu trocknen, die Faust noch im Wasser des Troges, richtete er sich auf und blickte langsam über die Wände des Stiftes hin.
Alle Fenster waren geschlossen; nur eines, zu ebener Erde, stand mit offenen Flügeln: das Fenster des Kellerstübchens, in dem man weißgedeckte Tische mit blinkenden Zinnkrügen sah. Und daneben gähnte das offene Münsterthor, vor dem in dichtgedrängtem Hauf die klösterlichen Dienstleute standen, die in den Laienbänken des Münsters nicht mehr Platz gefunden hatten: Jägerburschen, Armbruster und Eisenreiter, Handrohrschützen und Hackeniere, alle mit dem Gesicht gegen die Kirche, mit den Hüten und Kappen vor der Brust. Die Sonne machte all die grellen Farben der buntgezwickelten Wämser und Pluderhosen leuchten und spann ihre Goldstrahlen durch die blauen Weihrauchwolken, die aus dem Münsterthor herausdampften über die entblößten Köpfe. Undeutlich hörte man eine singende Priesterstimme, dann schrillende Klingeln. Mit flink atmenden Tönen begann eine Orgel zu tremolieren, Geigen, Posaunen, Pfeifen und Pauken fielen ein, und das gab zusammen eine Musik, so lustig, als wären diese Klänge nicht das Geleit einer heiligen Handlung, sondern eines ausgelassenen Tanzes. So wirkten sie auch auf die vor der Kirche Stehenden. Ein Köpfedrehen, ein Kichern und Gezischel begann, und ein Jägerbursche schlug einem Armbruster den Hut aus der Hand, daß der mit bunten Federn reich besteckte Deckel wie ein Hahn mit zappelnden Flügeln in die Luft wirbelte.
Der Fremde am Brunnen zog die triefende Faust aus dem Wasser, schleuderte die glitzernden Tropfen gegen das Münsterthor und murmelte in die lustig schmetternde Kirchenmusik: »Wasser ischt oft schon Fuier worde! Gebet acht!«
Und wieder war sein Gesicht ein anderes, als er durch die Sonne hinüberschritt zum Münster und scheu den Kopf entblößte.
Der Armbruster, der seinen rollenden Hut vom Boden haschte, machte verdutzte Augen, als er den Bauern sah. Und wurde grob. »Du Rammel, was willst?«
»Suchen, wo Gott ischt.«
»Such, wo der deinig haust! In der Leutkirch! Die steht da draußen!« Der Armbruster wies dem Schwaben mit einem derben Puff den Weg zum anderen Thor des Klosterhofes und staubte auf dem Rücken des Bauern den Hut aus, der vom Rollen im Sande grau geworden. Die buntscheckigen Kameraden vor dem Thor des Münsters lachten. Und als der Armbruster wieder zu ihnen trat, sagte er: »So ein Jauchbruder! Hätt seine Stinkseel misten mögen in der Herrenkirch!«
Im Schatten des Thorbogens drehte der Fremde das Gesicht. Und lächelte. Dann schritt er auf den sonnigen Platz hinaus. Hier stand zur Rechten die Pfarrkirche, daneben das Rentamt mit schwer vergitterten Fenstern, und zur Linken das langgestreckte Zehenthaus mit dicken Mauern und hochgegiebeltem Dach. Man sah durch ein Thor hinaus – und zwischen armseligen Häuschen zog sich eine enge Straße hinunter gegen das Thal der Ache.
Entlang der Mauer des Zehenthauses glich der Platz einem kleinen Jahrmarkt ohne Menschen. Da standen plumpgezimmerte Wagen, vor denen die trägen Ochsen und die ausgehungerten Saumthiere schläfrig die Köpfe hängen ließen – in langer Reihe standen die zweirädrigen Handkarren, und eng aneinander gerückt die beladenen Kraxen, auf denen die Bergbauern ihren Zins und Zehent von den hochgelegenen Höfen heruntergetragen hatten, als sie zur Kirche gingen. Denn so heilig war der Sonntag nicht, daß der Bauer, der unter der Woche schaffen mußte, nicht hätte zinsen und steuern dürfen, wenn das » Ite missa est« gesungen war. Und diese Wagen, Karren und Kraxen standen mit allem beladen, was die Erde des Landes gab und was der schwielige Fleiß der Männer- und Weiberhände zustande brachte. Da waren Hafersäcke und Bündel von Wildheu, Kufen mit eingesalzenem Kraut, Speck und Rauchfleisch, Drechslerwaren und geschnitzter Hausrat, Körbe mit Käslaiben und Eiern, Käfige mit Hühnern und Tauben, Rollen von Hausloden und Leinwand, Schmalztöpfe und Butterballen, die man zum Schutz gegen die Sonne in nasse, halbverwelkte Lattichblätter gehüllt hatte. An die Wagen waren junge Kälber angebunden, die traurig und heiser blökten, und auf den Karren lagen gesprenkelte Ferkeln, welche quiksend mit den gefesselten Beinchen zappelten und die Köpfe aus dem Stroh zu erheben suchten.
So war es auf dem Kirchplatz jeden Sonntag, jahraus, jahrein. Michelstag und Lichtmeß waren wohl die großen Steuertage. Doch bis der Bauer alles herbeischleppte, was er seinen hundert Herren schuldete: den Leibzins und den Todfall, die Liebsteuer und das Freudengeld, die Hals- und Haupt- und Leib- und Weidhühner, den großen und kleinen Zehent, den Bubenzins und die Blutsteuer, den gemeinen Pfennig und alle die anderen Beden Beden = außergewöhnliche Abgaben. – da hatte er zahlende Arbeit das ganze Jahr. Und hatte er heute gezahlt, so wußte er nicht, was morgen sein Herr von ihm begehren würde. Denn bei jeder unnützen Fehde, die das Kloster mit seinen Nachbarn führte, bei jedem Besuch von Höfen oder Fürstentagen, bei jeder Heirat, für die der Propst eine Schwester, eine Muhme oder eine verblühte Freundin auszustatten hatte, bei der Erhebung der Domizelli zu Kapitularen, bei des Propsten Tod und bei des Propsten Wiederwahl – immer mußte der Bauer steuern, zahlen und fronen. Theuer war das Geborenwerden, theuer das Leben, und am theuersten der Tod.
Mit einem funkelnden Blick des Hasses glitten die Augen des Schwaben über alle die Wagen und Karren hin: »Zahl, Bäuerle, zahl! Und wenn dein Säckle leer ischt, so verreck!«
Wo die Wagen zu Ende waren, standen Bretter- und Leinwandbuden aufgeschlagen, die Waren mit Tüchern überdeckt. Nur eine dieser Buden, die dem Thor des Klosterhofes am nächsten stand, schien eines solchen Schutzes nicht zu bedürfen; sie war geschützt durch die Heiligkeit ihres Krames: geweihte Amulette und Reliquienkapseln, wächserne und holzgeschnitzte Heiligenfiguren, Votivtäfelchen und Weihgeschenke, Ablaßbriefe, fromme Wegzettelein und Himmelsleitern. An Schnüren, welche durch die Bude gespannt waren, hingen bedruckte und mit Holzschnitten geschmückte Blätter, die sich im leisen Morgenwinde sacht bewegten: Flugschriften wider die bösen Prädikanten, so das gute Volk verführen, und wider den verfluchten Wittenberger.
Neben der Bude, an einem in die Mauer des Zehenthauses eingebleiten Eisenring, war ein wohlgenährtes braunes Maulthier angebunden, das auf roter Schabrake einen Frauensattel trug. Die beweglichen Blätter in der Bude mochten die Neugier des Thieres gereizt haben – denn es streckte schnuppernd die Nase nach dem raschelnden Papier.
»Lueget! Ischt nur ein unvernünftig Vieh ... und windet die nuie Zeit!«
Das murmelte der Fremde gegen die Kirche hin, als möchte er's den Menschen sagen, die in gebeugter Andacht das offene Thor umstanden: Bauern und Burschen in grauen, starrfaltigen Wämsern und Kniehosen; Bäuerinnen im grauen Faltenrock, das Haupt ganz eingewunden in das blaue Kopftuch, und junge Dirnen in grünen oder braunen Zwilchröcken, mit roten oder gelben Spensern, barhäuptig, nur im Schmuck der Flechten. Die einen beteten stumm, die anderen sangen halblaut die Worte des Liedes mit, das in hundertstimmigem, nicht sonderlich harmonischem Chor aus der Kirche tönte.
Als der Fremde zu ihnen trat, wandte wohl der eine und andere das Gesicht; doch sonderliche Neugier sprach nicht aus ihren Augen. Die Berchtesgadener hatten schon ein Kamel gesehen, das die Stadt Venedig dem Salzburger Bischof geschenkt, und einen Mohren, den man im Türkenkrieg gefangen hatte, und einen Affen, der aus der neuentdeckten Welt des Kolumbus gekommen – wie hätten sie sich noch wundern mögen über einen Schwaben mit verstaubten Schuhen? Auch mochten sie wohl noch andere Ursach haben, daß ihnen die Neugier nicht allzugroß in die Augen wuchs.
Wie jeder den Hut oder die Kappe an die Brust drückte, mit jener Scheu, die zur Gewohnheit geworden – wie sie alle standen, das Haupt gebeugt und den Rücken gekrümmt, war's ihnen anzumerken, daß das Leben auf ihren Schultern lag wie ein schwerer, im Drucke festgewachsener Stein. Und wer hart zu tragen hat, der hält die Augen auf den eigenen Weg gesenkt und kümmert sich nicht um den Weg eines andern.
Seitwärts von den Betenden hatte sich der Schwabe an die Kirchenmauer gestellt, so daß er den Leuten in die Gesichter sehen konnte. Und prüfend blickte er von Gesicht zu Gesicht, wie auf der Suche nach solchen, die ihm gefallen möchten. Und immer wieder nickte er und lächelte – als gefielen sie ihm alle: diese müden und unfrohen Gesichter, aus deren langsam blickenden Augen eine stumpfe Schwermut sprach. Nur manchmal eine junge Dirn – die guckte mit flinkeren Augen umher, sehnsüchtigen Glanz im Blick; und von den jungen Burschen trug der eine und der andere den Kopf ein wenig höher, als die grauen Männer. Besonders einer! Sein Blondkopf ragte auf schlankem Körper über all die anderen hinaus. Und ganz in der Sonne stand er, so daß ihm das dichte Haargeringel schimmerte, als trüge er eine silberne Sturmkappe um Stirn und Schläfen. Ein schmuckes, sonnverbranntes Gesicht – doch trotz der paar Jahre, die er schon über die zwanzig zählen mochte, hatten die Züge noch etwas knabenhaftes, etwas suchendes und still verträumtes. Die blauen glänzenden Augen blickten gegen die sonnige Kirchenmauer, als stünde sie nicht da. Und um den Mund, den ein kleines, silbrig schimmerndes Bärtchen überschattete, spielte ein halbes Lachen – wie Kinder lächeln, wenn sie denken und nicht wissen, an was. Dieses Kinderlachen, dieser träumende Knabenblick – und dazu zwei Schultern wie aus Eisen gerundet, ein tannenschlanker Körper, in dem die ruhende Kraft zu warnen schien: Wecke mich nicht!
Den jungen Burschen kleidete die schmucklose Landtracht, daß keinem Junker die Seide besser zu Gesicht stand! Der weiße Leinenkragen, der sich über die Schultern legte, zeigte noch einen sonnverbrannten Streif der Brust; das braune Lodenwams umspannte straff den schlanken Körper, ein Kalbfellgürtel mit zwei großen Kupferhaken schloß sich um die Hüften, und die Säume der kurzen Berghose starrten wie gebuckelte Dächlein über die gebräunten Kniee hinaus.
Dem Schwaben war der schimmernde Blondkopf lange schon aufgefallen; immer wieder spähte er zu ihm hinüber.
Und die beiden, die neben dem Burschen standen? Sie mußten zu einander gehören, diese drei – weil sie, ein wenig gesondert von den übrigen, sich so dicht zusammen hielten. Vielleicht waren sie Geschwister? Ein etwas schmächtig aufgeschossener Bursch im schwarzen Leinengewand der Salzknappen, das Fahrleder um den Leib gegürtet, vor der Brust das schwarze Knappenbarett mit dem weißen Federschopf – ein stilles und ernstes Gesicht mit braunen Augen von warmer Tiefe, doch die Züge bei aller Jugend schon ein wenig gealtert, von jener Blässe überzogen, die man aus den Schächten der Bergwerke heraufträgt ans Licht – nein, das war kein Bruder des anderen – wie Schatten und Helle nicht Geschwister sind, so treu sie auch zueinander halten. Aber das Mädchen, das neben dem Knappen stand, dicht an ihn angeschmiegt, das mußte eine Schwester des Blonden sein, obwohl sie braunes Haar hatte, das in der Sonne wie rotes Kupfer flimmerte. Die Züge der beiden glichen einander, so verschieden sie auch waren. Ein paar Jahre mochte die Schwester älter sein. Sie hatte auch den kräftigen Wuchs des Bruders – fast zu kräftig für ein Mädchen – ein Wuchs, wie ihn die Arbeit bildet. Und nicht nur schmuck, ihr Gesicht wäre schön gewesen, hätt' es vom Bruder auch dieses frohe, sorglose Lachen gehabt. Doch ihre Augen hatten etwas vom Blick eines verschüchterten Vogels, und in Unruh redete aus ihren Zügen jene scheue Ängstlichkeit, die immer Gefahren kommen sieht und die Nacht auch noch in der Sonne fürchtet.
»Weible«, fragte der Schwabe eine alte Bäuerin, »wer sind die drei?«
»Das ist die Maralen Maria Magdalena. Der Name wird mit dem Ton auf der ersten Silbe gesprochen: Máralen. und der Juliander Julius Andreas., die Kinder vom alten Witting. Und der Salzknapp ist der Stöckl-Josef, der zu Schellenberg dem Salzburger Pfannhaus dienet. Das ist der Maralen ihr Liebster. Die zwei, die thäten schon lang gern heuern, wenn sie die Beden aufbrächten.«
Als hätte Maralen gefühlt, daß von ihr gesprochen wurde, so blickte sie ängstlich um sich und suchte die Hand des Geliebten. Ihr Auge begegnete dem forschenden Blick des Schwaben. Dunkle Röte schoß ihr über die Wangen. Sie schmiegte sich dicht an den Arm des Verlobten und flüsterte: »Du, da schaut uns ein Fremder allweil an.«
»Laß ihn halt schauen,« sagte Josef leis und blickte lächelnd auf das Mädchen nieder. »Du Angsthäslein!«
Im gleichen Augenblick begann die Glocke des Münsters zu läuten ...
