
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Sie kommen gerade zurecht!« sagte der Chef des deutschen Kaufhauses, an das ich eine Empfehlung hatte. »Zu dem einzigen Tage im Jahre, an welchem es sich verlohnt, in diesem gottverlassenen Loche zu sein!«
»Was gibt es denn?« fragte ich.
»Wir haben eine Tigerjagd morgen!« antwortete der Graubart, sich vergnügt die Hände reibend. »Zwei starke Tiere und noch ein kleineres!«
Ich erfuhr dann, dass nur selten sich ein solch grosses Raubtier in jener Gegend blicken lässt, ein-, höchstens zweimal im Jahre. Dann warten die Honoratioren, Deutsche und Amerikaner, regelmässig mit der Jagdpartie, bis irgendein grosses Schiff im Hafen liegt, um den Kapitän und seine Offiziere einzuladen, denn die Jagd ist hier, so gut wie bei uns, längst zum Sport geworden.
Freilich ist das Tier, welches man drüben Tiger nennt, nicht der eigentliche Tiger. Es ist vielmehr die dritte der grossen Katzen, der Jaguar, welcher aber dem asiatischen Tiger an Kraft und Grösse nicht viel nachsteht; er misst von der Schnauze bis zur Schwanzspitze volle sieben Fuss, doch gibt es auch einzelne alte Exemplare, welche dem Königstiger fast an Grösse gleichstehen, also bis acht Fuss lang werden.
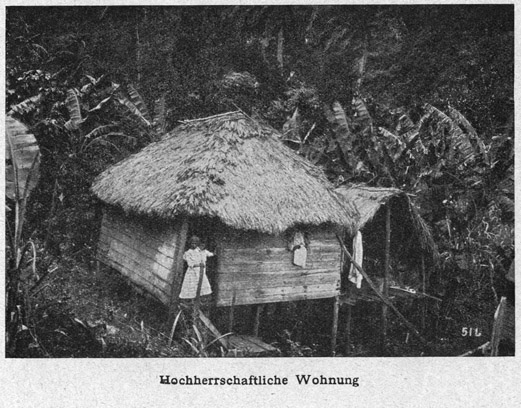
Unsere Jagdgesellschaft bestand aus vierzehn Herren und einer Dame, alle mit guten Büchsen bewaffnet; dazu gesellten sich einige hundert indianische Treiber. Wir brachen schon vor Tagesanbruch auf, nachdem ein paar Indianer am Abend vorher die Nachricht gebracht hatten, dass sich wenigstens zwei der Tiere, welche sich schon seit Wochen um den Küstenplatz herumtrieben, in einem Rohr- und Mangrovendickicht in der Nähe der Küste aufhielten. Die Jäger nahmen bei Sonnenaufgang in weiter Kette längs des Meeres Aufstellung, während die Indianer in langem Bogen herumzogen, um die mächtigen Katzen uns zuzutreiben. Nachdem ich den mir zugewiesenen Platz eingenommen hatte, stand ich aufmerksam mit der Büchse in der Hand und lugte in das Gestrüpp. Aber es rührte und regte sich nichts. Kolibris umflogen mich und handgrosse, tiefschwarze oder auch rote und hellblau gestreifte Schmetterlinge spielten um mich her. Ein paarmal flogen schöne weisse Reiher vorbei, auch mächtige Pelikane, aber ich wagte keinen Schuss abzugeben, um nicht das Raubtier, welches ich erwartete, wegzuscheuchen. Nach ein paar Stunden war ich das Stehen satt; ich setzte mich auf einen Baumstumpf, die Büchse über die Knie. Plötzlich hörte ich ein Rascheln und Knacken in den Dornen, ich sprang rasch hoch und riss die Büchse in die Höhe; das Geräusch kam bald näher, gerade auf mich zu. Jeden Augenblick glaubte ich, ein paar wildfunkelnde, grausame Augen aus den Büschen heraus auf mich starren zu sehen. Aber – leider! – es war nicht der Tiger, es war nur eine tellergrosse, hässliche Landkrabbe, welche, mit einer toten Maus in den Scheren, ihrem Loch zustrebte. Ich setzte mich wieder nieder, verzehrte mein Frühstück und betrachtete derweil den Boden, auf welchem das Leben nicht weniger rege war als in der Luft. Viele Hunderte von Krabben krochen da herum, mächtige, fusslange Burschen und kleine Kerlchen, die nicht grösser waren als mein Daumennagel. Hässliche Gattungen waren darunter, deren eine Schere ganz verkümmert, während die andere dafür um so mächtiger ausgebildet und manchmal dreimal so gross war als das Tier selber. Ueberall im Boden hatten sie Löcher gegraben, kleine und grosse, jedes Tier hatte sein eigenes Heim, welches es mit aller Kraft gegen jeden Angriff verteidigte.
Rings in dem Dschungel eine tiefe Stille. Nur dicht um mich herum ein geschäftiges Leben: ein Laufen und Rennen, ein Rauben und Morden auf dem Boden, ein Flattern und Schweben, ein Gaukeln und Spielen in den Lüften. Ich hatte längst meine Büchse gegen einen Stamm gelehnt und gab mich ganz dem Mittagszauber des Urwaldes hin. Durch die Mangrovenstämme zog vom Meer her ein erquickend, kühler Wind, hinten sah ich die blauen Fluten, welche die dicht mit Austern bedeckten Wurzeln der Bäume umspülten.
Ein paarmal wurde ich aufgescheucht aus meiner Ruhe, sprang auf und griff nach der Büchse. Aber stets war es ein blinder Lärm irgendeiner Lazerte oder ein Leguan lief durch die Zweige, oder eine Schildkröte kroch durch das Schilf. Hier in dieser fast heiligen Stille schien jedes kleinste Geräusch zehnmal so stark zu tönen.
Die Sonne stand schon recht hoch, als ich in weiter Ferne einen Lärm vernahm, der näher zu kommen schien. Ich stand wieder auf und nahm die Flinte in die Hände. Langsam, ganz allmählich unterschied ich die Laute: ein Schreien und Heulen vieler Stimmen in rhythmischem Tonfall, ein Lärmen von Klappern und Rasseln, ein Schlagen und Stampfen durch das Ried. Kein Zweifel, es waren die Treiber, welche langsam, aber beständig auf meinen Standort zukamen.
Und dann vernahm ich, näher als den Lärm der Treiber, ein Brechen und Schieben im Rohr; manchmal war es, als ob eine schwere Masse plötzlich niederfiele. Eine ausserordentliche Aufregung bemächtigte sich meiner; jede Minute erwartete ich, den Tiger vor mir auftauchen zu sehen. Und doch verging noch eine gute halbe Stunde. Ich hob die Büchse an die Schulter und liess sie wieder fallen, ich lauschte aufmerksam auf jedes Geräusch und schaute so angestrengt durch meinen scharfen Zwicker, dass mich die Augen schmerzten. Und dann, plötzlich, von einer ganz anderen Seite, als ich sie erwartet, stand die Bestie vor mir; gerade am Rand der kleinen Lichtung, nicht zehn Schritte von mir entfernt. Wir sahen uns ins Auge – ich weiss nicht, ob es dem Tiger ebenso erging – aber mich wenigstens überlief eine Gänsehaut. Ich wollte die Büchse hochnehmen – es ging nicht. Ich überlegte mir: schiesst du nicht, so geht das Raubtier ruhig an dir vorbei. Schiesst du aber und fehlst oder triffst es nicht tödlich, so greift es dich mit Gewissheit an, und es ist sehr ungewiss, ob du mit dem Leben davonkommst. Dann schalt ich mich einen Feigling, biss die Zähne auf die Lippen und versuchte mit Gewalt die Flinte hochzuziehen, um den entscheidenden Schuss abzugeben. Aber die Arme versagten mir den Dienst, sie hingen Schwer herab wie Blei; ich war völlig ausserstande, sie auch nur einen Zoll zu heben. So blickten wir uns an, ich und der Tiger; es kam mir vor, als hätten wir stundenlang so gestanden, obwohl es kaum eine Minute gedauert haben mag.
Dann ein neuer Lärm in der Ferne – – der Tiger drehte ruhig um und sprang mit mächtigem Satze wieder in das Schilf zurück. Ich hörte ihn schwer durch das Rohr brechen.
»Gott sei Dank!« brummte ich unwillkürlich.
Mein Gesicht war in Schweiss gebadet; ich kann wohl sagen, dass es Angstschweiss war. Ich trocknete mich ab und fing von neuem an, mich fürchterlich über mich zu ärgern! So ein Dummkopf, so ein Feigling! Eine solche Gelegenheit mir entgehen zu lassen, die sich vielleicht nie wieder im Leben bot. Mit Recht würde jeder meiner Jagdgefährten mich gründlich auslachen!
Aber die Gelegenheit sollte sehr schnell wiederkommen. Der Lärm der Treiber kam immer näher auf mich zu, und bald hörte ich wieder das Brechen und Streifen durch das Ried, welches aus derselben Richtung wie vorhin gerade auf mich zukam. Blitzartig verstand ich den Zusammenhang: der Jaguar, welcher mich eben besucht hatte, hatte sich den ganzen Morgen ruhig in meiner Nähe aufgehalten, während der, welcher auf mich zugetrieben wurde, ein anderer war.
Dasselbe gespannte Lauschen und Schauen, dieselbe Aufregung. Bald schienen die Geräusche sich wieder zu entfernen, bald kamen sie näher, ich fühlte, dass ich in weitem Halbkreise von den Treibern umgeben war. Und dann endlich stand das zweite Tier vor mir. Ich hatte mir geschworen, dass es nicht so gehen solle wie das erstemal; im Augenblick riss ich die Büchse hoch und zog den Hahn ab. Leider ohne zu zielen; die Kugel zerfetzte eine Mangrovenwurzel, einen Meter weit von dem Tier entfernt. Aber es war, als ob der Knall mir plötzlich alle Ruhe zurückgegeben hätte. Ich beobachtete ganz kaltblütig, wie sich das Tier zum Sprung anschickte, zielte genau zwischen die Lichter und drückte ab. Und ich war meines Treffers so gewiss, dass ich sogleich die Büchse herabnahm und auf das verendete Tier zuschritt. Ich betrachtete das prachtvolle Raubzeug, als lärmend und schreiend ein paar der Indianer heransprangen. Sie sahen mich und die mächtige Katze und kamen jubelnd und kreischend näher. Plötzlich fassten mich zwei bei den Armen und rissen mich mit Geschrei von dem Jaguar fort.
»Um Gottes willen, Herr!« schrien sie, »das Tier lebt ja noch!«
»Es lebt noch?« rief ich. »Aber keine Spur!«
»Doch, doch!« schrien die Indianer. Und plötzlich sprang einer mit den nackten Füssen auf den Leib des Tieres. Da gab die Bestie ein solch grässliches, langanhaltendes, tiefes Brüllen von sich, dass es mir heiss und kalt über den Rücken lief und ich vor Schreck meine Büchse fallen liess – zur grossen Freude der Indianer, welche mich herzlich auslachten und über ihren gelungenen Jagdwitz fast ausser sich vor Vergnügen waren. Tritt man nämlich einem toten Jaguar auf den Leib – beim Löwen und Tiger ist es ebenso –, so entweicht die Luft aus den Lungen mit einem merkwürdig dumpfen Geräusch durch das Maul, worauf natürlich jeder Neuling hereinfällt.
Bei dem Jagdmahl, das uns unser liebenswürdiger Wirt gab, wurde mir übrigens eine besondere Genugtuung. Er selbst hatte den zweiten Jaguar geschossen, ein deutscher Uhrmacher des Ortes den dritten. Als ich dann mein Abenteuer mit dem ersten Jaguar ehrlich erzählte, lachten die Herren und versicherten mir, dass es fast jedem so gehe, wenn es auch nicht leicht einer zugäbe. In 17 Jahren, erzählte mein Wirt, habe er 48 Tigerjagden veranstaltet, stets mit etwa 8 bis 20 Teilnehmern; 86 Tiger seien dabei geschossen worden. Er selbst habe davon 24 erlegt, nicht weniger wie 54 habe sein Freund, der Uhrmacher, zur Strecke gebracht; der Rest, ganze 8 Stück, käme auf die anderen Teilnehmer zusammen!
In unseren Schulen wird uns stets ein völlig falscher Begriff von dem Wesen der spanisch-amerikanischen Staaten beigebracht, ein Begriff, der den Erwachsenen durch die beliebten Taschenatlanten noch mehr in Fleisch und Blut übergeht. Alles was in diesen sonst recht guten Büchern steht, ist theoretisch durchaus richtig, in der Tat aber völlig verkehrt. So finden wir z. B. bei irgendeiner Republik die Angabe: Dollarwährung. Das stimmt, nur erhält man für einen amerikanischen Dollar nicht weniger wie 378 Papierdollars des Landes. Oder man findet die Angabe: Heeresstärke 50 000 Mann. Die sind auch da, aber nur auf dem Papier, in der »Sollstärke«, in Wirklichkeit ist die Regierung froh, wenn sie 1000 Mann uniformieren und bewaffnen kann. Wenn man alle statistischen Angaben, die unsere geographischen Bücher über diese Staaten bringen, durch zehn dividiert, wird man ein annähernd richtiges Bild erhalten. Das Lügen und masslose Ueberheben ist den spanisch-indianischen Mischvölkern so zur zweiten Natur geworden, dass die Wahrheit kaum zu ermitteln ist. Aus folgender authentischen Anekdote mag man auf die kindische Einbildung und auf die unerhörte Unbildung selbst der sogenannten ersten Kreise in dem berühmten Staat Venezuela schliessen.
Der Präsident Castro, selbst ein völlig ungebildeter Vollblutindianer aus den Anden, hatte gerade seinen bekannten Konflikt mit der französischen Regierung. Er belästigte dabei die französische Kabelgesellschaft in unerhörter Weise und liess ihr schliesslich die Drähte abschneiden. Wenn trotzdem Frankreich von einer bewaffneten Aktion absah und sich darauf beschränkte, auf diplomatischem Wege seinen Schadenersatz einzutreiben, so geschah das nur in der durchaus richtigen Erkenntnis, dass der ganze venezolanische Staat nicht die Kosten der Expedition, geschweige denn das Blut auch nur eines französischen Soldaten wert sei. Trotzdem fürchtete man in Venezuela nach der Abreise des französischen Gesandten eine Zeitlang eine Invasion. Bei dieser Gelegenheit fragte Castro einen seiner Minister, ob nicht Frankreich einmal von einem anderen Staate besiegt worden sei. Man antwortete ihm, dass in der Tat Frankreich 1870 von Deutschland besiegt wurde.
»Von Deutschland?« rief der Präsident lachend. »Na, da werden wir ja mit Frankreich im Handumdrehen fertig! Denn ich habe ja vor einigen Jahren Deutschland, England und Italien zusammen besiegt, während ich nebenher noch die Revolution des Generals Meta niedergeworfen habe.«
Und das ist nicht nur die Ansicht des Präsidenten, das ist die Ansicht fast jeden Venezolaners. Zwar haben die drei europäischen Mächte damals die Blokade der venezolanischen Küste wirksam durchgeführt, haben die venezolanische Marine in den Grund geschossen oder genommen, haben die jämmerlichen Küstenbefestigungen zusammenbombardiert, aber sie haben doch am Ende dank der Intervention der Yankees sehr nachgegeben und ihre Ansprüche – den Schadenersatz für ihre Untertanen im Lande – nur zum kleinen Teile durchgedrückt. Und die venezolanischen Blätter erzählten schon während der Blokade, dass »vom Fort San Carlo aus das englische Geschwader in die Luft gesprengt worden sei«, dass »die deutschen Schiffe ›Panther‹ und ›Vineta‹ von ihren Kriegsschiffen in den Grund gebohrt seien« usw. Heute sind aus diesen Lügengeschichten längst glorreiche venezolanische Siege geworden, die den Kindern in der Schule gelehrt werden – – wenn sie eine besuchen. Castro lässt sich in seinen Blättern tagtäglich als »Restaurador«, als »Cid Campeador«, als den »Heros der Anden« und den »Befreier des Vaterlandes« feiern und mit Alexander und Napoleon dem Grossen vergleichen.
Die Bevölkerung in diesem glücklichen Lande lebt ausschliesslich von Bananen, von Sonne und von Politik. Wozu arbeiten? Was man erwirbt, wird einem ja doch von der Regierung abgenommen; auch ist Arbeit eines »Kavaliers« unwürdig und »Kavalier« ist natürlich jeder echte Venezolaner. Seitdem Venezuela als Staat existiert, hat es nicht fünf ruhige Jahre gesehen; ist die eine Revolution beendet, so beginnt die andere. Die Parteien nennen sich zwar, wie bei uns, liberal, konservativ usw., in Wahrheit gibt es aber diese Unterschiede nicht. Irgendein General – jeder vierte Mensch ist hier General – ist mit der Regierung unzufrieden, weil sie ihm nicht einen Posten gibt, auf dem er genügend Gelegenheit zum Stehlen hat. Entrüstet sammelt er eine Anzahl verhungerter und verzweifelter Subjekte, die es in allen Dörfern und Städten genügend gibt, und macht eine Revolution. Gelingt sie, so ist er solange am Ruder, bis ihn auf dieselbe Weise ein anderer ablöst. So war des Räuberhauptmanns Castro berühmter Zug von den Anden aus, so zog später der General Paredes, der »Mocho« (der Hinkende) von Maracaibo aus, um ihn zu stürzen. Häufig werden solche Revolutionen von Geldleuten finanziert, die natürlich ein glänzendes Geschäft machen, wenn die Sache reüssiert. Dass sich der Präsident Castro – seit vielen Jahrzehnten unter allen diebischen Machthabern in Venezuela der allerräuberischste und frechste – so lange gehalten hat, hat er nur dem Umstande zu verdanken, dass er jeden hervorragenderen Menschen, von dem er nur annahm, dass er vielleicht einmal gegen ihn intriguieren könnte, sofort aufheben und in irgendein unterirdisches Gefängnis sperren oder auch der Bequemlichkeit halber gleich erschiessen liess. Die feuchten Zellen von San Carlo sind voll von »Verbrechern«, die an Ketten an die Mauern angeschmiedet, ohne Licht und Luft, hier seit Jahren bei Wasser und verschimmeltem Brot schmachten, bloss, weil sie reiche Leute waren, die Herr Castro für einflussreich genug hielt, um ihm schaden zu können.
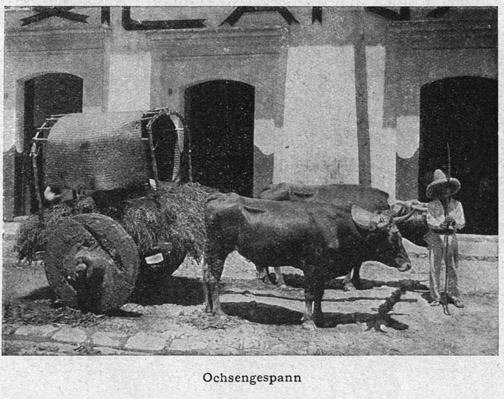
Regieren heisst hier – – das Volk aussaugen. In welch unerhörter Weise das geschieht, davon kann man sich bei uns kaum eine Vorstellung machen. Die Regierung hat alles monopolisiert, Zigaretten, Tabak, Zigarren, Alkohol in jeder Form, Zündhölzer, Mehl, Salz usw., ja seit kurzem ist sogar das Schuhwerk Monopol geworden. Dabei sind die Einfuhr- und Ausfuhrzölle unerschwinglich, so dass man zum Schmuggel ordentlich gezwungen ist, der denn auch recht öffentlich betrieben wird, am meisten von den Zollbeamten selbst. Der Druck auf die niederen Volksschichten ist ein unerhörter; das Ventil, durch das sich die zum Kochen gebrachte Wut und Verzweiflung des ausgesaugten Volkes Luft macht, ist dann immer wieder die Revolution. Aber es werden stets nur die Personen gewechselt, nie wird das System geändert.
Ein alter Trick, den alle schlechten, beim Volke verhassten Regierungen von altersher ausspielen, ist die Ablenkung des Zornes der Massen auf ein anderes Objekt: auf die Fremden. So ist denn heute der Fremdenhass in Venezuela ein sehr grosser; die »Mussius« (Messieurs, so werden alle Ausländer genannt von der Zeit her, als der französische Einfluss noch allein massgebend war) sind zu gleicher Zeit Gegenstand der Furcht und des Neides, wie auch der Verachtung und des Spottes. Dabei liegt der ganze Handel des Landes in deutschen, zum Teil auch französischen Händen; Amerikaner und Engländer kommen nur wenig in Betracht. Eigentlichen Respekt hat der Venezolaner trotzdem nur vor dem Amerikaner, der durch seine stets vorzügliche Vertretung bei allen Schwierigkeiten geschützt ist, während unsere deutschen Kaufleute fast regelmässig von ihren Konsuln und Gesandten im Stich gelassen und desavouiert werden. Die Folge ist, dass die deutschen Kaufleute sich geradezu weigern, deutsche Konsuln zu werden, während sie alles daransetzen, um amerikanische Konsuln zu werden. Das ist ausserordentlich zu bedauern, da Deutschland mit einem sehr grossen Kapital in Venezuela interessiert ist, darunter mit einigen Unternehmungen grossen Stils, die dank der Zustände im Lande durchaus nicht prosperieren. Am besten geht es noch der deutschen »Grossen Venezuela-Eisenbahn«, die, wenn sie nichts einbringt, doch wenigstens nicht noch kostet. Dagegen ist die »Deutsche Asphaltkompagnie«, die mit zweieinhalb Millionen Taler Kapital bei Pedermanos an der Orinokomündung gegründet wurde, in Konkurs geraten, ebenso die »Deutsch-Venezolanische Schwefelgruben-Aktiengesellschaft« bei Carupano, in die die Mülheimer Industriellen Felten und Guilleaume dieselbe grosse Summe steckten. Auch die »Deutsche Plantagengesellschaft« bei Caracas, in die Bremer Handelshäuser ein Kapital von über zwei Millionen steckten, und die fast ein Dutzend grosse Plantagen ihr eigen nannte, ist jetzt in Konkurs. Rechnet man den Bankerott einer ganzen Reihe seit vielen Jahren im Lande bestehender grosser deutscher Handelshäuser hinzu, und beachtet man, dass die Schuld an diesem geschäftlichen Niedergang fast in keinem Fall die betreffende Firma trifft, sondern fast stets auf das Konto der Regierung dieses Raubstaates zu setzen ist, so kann man sich denken, wie zufrieden der Deutsche hier mit dem Schutze ist, den er von dem offiziellen Vertreter des Deutschen Reiches gemessen sollte. – Kein Wunder, dass so viele Deutsche das amerikanische Bürgerrecht erwerben!
»Das Land, das Sie da sehen, war einmal deutsch,« sagte mir der Kapitän der »Patagonia«, »schade, dass es nicht deutsch geblieben ist, es wäre etwas anderes daraus geworden!«
»Deutsch?« rief ich erstaunt. »Wann war das denn?«
»Kolumbus entdeckte die venezolanische Küste 1498 und gründete dort eine kleine Kolonie. Aber schon achtundzwanzig Jahre später trat Kaiser Karl der Fünfte das Land an den reichen Kaufmann Welser aus Augsburg als Lehen ab.«
»Vermutlich als Entschädigung für einen grossen Pump?« sagte ich.
»Natürlich!« lachte der Kapitän. »Die Welser und Fugger verschafften dem Kaiser bares Geld, da musste er sich doch erkenntlich zeigen, besonders, da er es mit der Zinszahlung nicht so genau hielt. Leider gaben die Welser schon nach zwanzig Jahren ihre Kolonie wieder auf, wie auch die Fugger wenig Freude von ihren westindischen Besitzungen hatten. Die Deutschen verstanden eben im sechzehnten Jahrhundert noch nicht, überseeische Kolonien zu Wohlstand zu bringen; hoffentlich werden sie es jetzt im zwanzigsten Jahrhundert endlich lernen! Es gibt noch manches zu erben auf dieser Erde; wir müssen sehen, dass wir nicht zu kurz kommen!«
Gewaltige Gebirgsketten stiegen dicht am Ufer auf, voll von der glühenden Tropensonne beschienen. Unten – lang ausgestreckt, eng eingekeilt zwischen dem Meer und dem Felsen, hie und da sich auf Vorsprüngen, in Täler und Schluchten höher hinaufziehend lag La Guaira. Eine lange Kette von niedrigen Lehmhäusern und Hütten, dazwischen einige grössere Gebäude und Anlagen.
»Ein trostloses Fiebernest,« seufzte der Kapitän, »trostlos wie der ganze venezolanische Staat!«
»Aber ich bitte Sie,« wandte ich ein, »da sind doch einige hervorragende Anlagen. Hier der prachtvolle Pier zum Beispiel, an dem unser Schiff liegt!«
»Gehört den Amerikanern!«
»Aber dort das famose Telegraphengebäude?«
»Ist Eigentum der französischen Kabelgesellschaft. Uebrigens ist es ausser Betrieb, der biedere Präsident Castro hat neulich die Drähte abschneiden lassen.«
»Und das grosse Gebäude dort hinten?«
»Ist eine englische Bank! Und da und dort – alle die grossen Häuser, die Sie sehen, gehören deutschen Kaufleuten! Nur rechts dort hinten, dicht am Meer das weisse, grosse Gebäude, das nahezu vollendet ist, ist venezolanisches Eigentum!«
»Nun, so haben die Venezolaner doch wenigstens einen Anfang gemacht!«
»Einen netten Anfang! Das Gebäude steht schon fünf Jahre so und wird nie vollendet werden. Braucht es ja auch nicht, es erfüllt seinen Zweck vollkommen!«
»Welchen Zweck?«
»Seinen Zweck als offizielle Schmuggelstation! Der tüchtige Castro hat, ›um die Landwirtschaft zu heben‹, jede Einfuhr von Mehl verboten. Das ist ein grotesker Witz von dem Räuberhauptmann, denn es wird im ganzen Lande fast gar kein Korn gebaut. Die Einfuhr von Korn ist dagegen – gegen hohen Zoll – gestattet. Nun hat sich ein guter Freund und Vetter von Castro die grosse Mühle da hingebaut, natürlich auf Kosten der Regierung. Freilich führt er kein Korn ein, mahlt auch nicht – – er importiert nur Mehl und lässt es in seiner »Mühle« speichern; Zoll zahlt er überhaupt nicht! Kein Wunder, dass er längst vielfacher Millionär ist, da er ja ein Monopol hat, mit dem kein Kaufmann konkurrieren kann!«
Wir fuhren mit der englischen Eisenbahn von La Guaira aus steil den Berg hinauf, auf eine Höhe von 3105 Fuss. Es war eine prächtige, äusserst malerische Fahrt an der Seite eines mächtig herabbrechenden Giessbaches, der bald nur wenige Fuss, bald, bei der Station Boqueron, nicht weniger als 500 Meter tief ist. Nach zwei Stunden waren wir in Caracas, der Hauptstadt Castros, angelangt.
Caracas ist eine recht langweilige Stadt; neu erbaut nach dem grossen Erdbeben von 1812, ist sie ganz rechtwinklig angelegt, wie Mannheim. Sie hat eine Reihe bemerkenswerter Kirchen und öffentlicher Gebäude, auch hübsche Plätze und Promenaden, doch nichts, das wert wäre, sich dem Gedächtnis einzuprägen. Der ganze Handel liegt hier, wie in allen Plätzen Venezuelas, fast ausnahmslos in den Händen von Deutschen. Eine deutsche Bahn ist es auch, die die Hauptstadt mit der Stadt Valencia verbindet, eine Bahn, die ein Ruhmesblatt für Leistungsfähigkeit deutscher Industrie bildet, aber leider auch, wie alles in diesem korrumpierten Staate angelegte Kapital, ein Schmerzenskind für ihre deutschen Besitzer ist. 1887 erhielt Krupp in Essen die Konzession für den Bahnbau, die er aber schon im nächsten Jahre der »Grossen Venezuela-Eisenbahn-Gesellschaft« übertrug. Diese Gesellschaft besteht allein aus der Berliner Diskontogesellschaft und der Norddeutschen Bank in Hamburg. Nach einer sechsjährigen Arbeit wurde 1894 die Bahn eröffnet, die bei einer Länge von nur 179 Kilometern nicht weniger wie 212 Viadukte und Brücken zählt und 86 Tunnels durchläuft, die zusammen fünf und einen halben Kilometer lang sind. Der längste Viadukt bei Aqua Amarilla ist 100 Meter lang und 47 Meter hoch, der grösste Tunnel bei Calvario einen Kilometer lang. Ueber drei und eine halbe Million Kubikmeter Stein und Erde musste für diese Bahn weggeräumt werden; über 300 000 Kubikmeter Mauerwerk wurden errichtet. Eine gewaltige Leistung der deutschen Industrie, die ihr – im besten Falle – ein ganzes Prozent Zinsen trägt!
Die Fahrt durch das wild zerrissene Land ist eine der schönsten und interessantesten der Erde. Freilich sind die gewaltigen Wälder längst verschwunden, nur die höchsten Gipfel der Berge tragen noch Bäume. Aber obwohl der Wald in den Tropen für das Gedeihen des Landes eine geradezu zwingende Notwendigkeit ist, denken die Herren Venezolaner nicht daran, neuen aufzuforsten: Raubsystem in allem und jedem! – Je näher wir Valencia kommen, um so fruchtbarer wird das Land; grosse Kaffeeplantagen dehnen sich weithin aus, viele davon befinden sich in deutschen Händen. Vor Valencia fahren wir an dem grossen See von Valencia vorbei, der sich in der Höhe von 415 Metern über dem Meeresspiegel 440 Quadratkilometer weit erstreckt. Sechsundzwanzig kleine Inseln erheben sich aus dem blauen Wasser, bedeckt mit einem üppigen, tropischen Pflanzenwuchs. Fürwahr, es ist paradiesisch schön hier, kein Wunder, dass der Präsident Castro den Wunsch hegt, auf seiner eigenen Lustjacht hier spazieren zu fahren!
Zu dem Zweck liess er sich für den See von Valencia ein – – Kriegsschiff von seiner getreuen Kammer votieren. Man denke: ein Kanonenboot mitten im Lande! Natürlich bestellte der Präsident eine Jacht bei einer deutschen Firma und unser Schiff, die »Patagonia« hatte die hohe Ehre, die Dampfjacht, in Teile zerlegt, nach Venezuela zu bringen. Wir schifften diese Teile in La Guaira aus – und da werden sie voraussichtlich noch unsere Urenkel am Hafen liegen sehen! Denn es stellte sich heraus, dass die Tunnels der Bahn nach Caracas hinauf viel zu niedrig waren, als dass man den Dampfkessel hätte hindurchtransportieren können.
Von Valencia aus geht eine dritte Bahnlinie, die, obwohl englisch, ebenfalls unter deutscher Leitung steht, nach dem zweiten grösseren Hafenplatz des Landes, nach Puerto Cabello; sie wurde bereits im Jahre 1888 eröffnet.
Der Handel in dieser Hafenstadt liegt natürlich auch in deutschen Händen. Der natürliche Hafen gilt als sehr sicher und gut, so gut, dass man die Schiffe an einem »Haare« (Cabello), statt an einem Seile vertäuen könnte. Hier lagen ein paar schmutzige venezolanische Torpedoboote, daneben das berühmte Kanonenboot »Restaurador«, das früher als Vanderbiltsche Jacht einmal bessere Tage gesehen hat. Für uns Deutsche ist der »Restaurador«, der einmal die schwarz-weiss-rote Flagge führen durfte, eine wenig angenehme Erinnerung, erzählt er uns doch ein neues Beispiel von der Unfähigkeit deutscher Diplomatie. Bei der berühmten Blokade von 1902 nahm unser guter »Panther« den »Restaurador«; die deutsche Regierung bezahlte 20 000 Mark für die Wiederinstandsetzung des Kanonenbootes. Dann freilich gab sie das Schiff, der Himmel mag wissen aus welchen Gründen, der venezolanischen Räuberbande wieder zurück und liess sich noch nicht einmal die Reparaturkosten bezahlen – – dafür waren ja die deutschen Steuerzahler da! Der Dank dafür ist der, dass noch heute die Herren Venezolaner jedem, der es hören will, erzählen, dass »die deutschen Seeoffiziere ihnen ihr Silberzeug aus dem Schiff gestohlen hätten«!
Und diese wahnsinnstarke Sonne glüht.
Zwei schreiten wortlos zwischen Häusermassen
Und trinken heissen Tod aus leeren Gassen,
Wo keines Lebens leiser Atem blüht.
Da wacht der Tod, dass man ihm keines raube.
– – Glutkrämpfe schütteln einen Hungerhund,
Die Rippen fliegen, Schaum entquillt dem Mund –
Den trinkt die Sonne gierig aus dem Staube.
Zwei schreiten wortlos auf verkohltem Grase.
Die Würmer pochen tief im Ahornbaum
Und schläfrig hockt der Geier auf dem Aase.
– – Das alles, weiss ich, ist ein schwerer Traum,
Den andere von uns träumen. – Eine Phrase,
So leer, wie dieses Hundes Geiferschaum.
Santa Marguerita ist eine kleine Insel, die der venezolanischen Küste vorgelagert ist, sie wird an ihrem Hauptplatz, Pampaton, von der Hapag nur deshalb zuweilen angelaufen, weil hier Perlen gefischt werden und der Transport auch eines kleinsten Kistchens von Perlen ein sehr lohnender ist. Wir lagen kaum vor Anker, als das übliche Wettrudern einer Reihe von Booten auf unser Schiff begann; diesmal kam zuerst ein Boot längsseit, in dem ein struppiger Kerl mit einer roten Mütze einen Höllenlärm aufführte. Der Mann kletterte wie ein Affe an Bord, umarmte alle Menschen, die an der Reeling standen und führte einen Freudentanz nach dem anderen auf. Es war der Gouverneur der Insel und ein kommandierender General; der Kapitän, der wohl wusste, dass man die Machthaber in diesen Raubstaaten immer möglichst gut behandeln muss, lud ihn ein, ins Rauchzimmer zu treten. Die erste Frage, die er hier an Offiziere und Passagiere richtete, war die, ob er uns nicht mit Weibern versorgen solle; als sein Anerbieten dankend abgelehnt wurde, versicherte er, dass er durchaus keine Provision haben wolle, er handele nur aus Menschenliebe. Er war überhaupt ein menschenfreundlicher Herr. Zunächst erklärte er den Sanitäts- und Zollbehörden, die mit den nächsten Booten ankamen, dass sie den Kapitän, seinen alten Freund – er kannte ihn gerade zwei Minuten – nicht belästigen sollten, sonst würde er sie einsperren lassen. Die Beamten verzichteten also auf alle Formalitäten, was sie sonst wohl auch getan hätten, und wurden dafür gnädigst von dem Herrn Gouverneur zu einer grossen Menge Bier eingeladen, das natürlich der Kapitän bezahlen musste. Als dann der Hapagagent von Land an Bord kam, bestellte der Herr Gouverneur sofort zu Ehren dieses, seines »allerintimsten« Freundes, Champagner, wozu er ebenfalls die ganze Gesellschaft einlud – diesmal musste der Agent bezahlen.
»Sagen Sie mal,« fragte ich den Herrn, »das wird ein teurer Spass für Sie! Ist das immer so?«
»Freilich,« lachte er vergnügt, »das sind halt die Spesen, die der Kaufmann hier aufs Geschäft aufschlagen muss! Dieser Affengeneral ist eben, so lange seine Partei an der Regierung ist, hier absoluter Herr, viel unbeschränkter als der Zar von Russland. Füge ich mich seinen Launen, so schafft er mir manche Vorteile, stelle ich mich ihm entgegen, so macht er mir so viel Schwierigkeiten, dass an irgendein Vorankommen nicht zu denken ist; ja, ich würde meines Lebens nicht sicher sein!«
Sternhagelbetrunken wurden der Herr General und seine Beamten um Mitternacht in die Boote geschafft; der deutsche Agent liess sie von seiner Curaçaomannschaft an Land rudern und nach Hause bringen. Das hinderte nicht, dass der Held am anderen Morgen schon um sechs Uhr wieder an Bord war, um uns einzuladen, seine Festung zu besichtigen. Der Kapitän war wütend und wollte mit dem Kerl nichts zu tun haben; erst die inständigen Vorstellungen des Agenten, der seinen Mann kannte, vermochten ihn, seine eigenen Wünsche zurückzudrängen und nur nach den Interessen der Kompagnie zu handeln.
Der Herr Gouverneur war wie alle Venezolaner – nur ein Prozent der Bevölkerung ist weiss – ein Mischling mit sehr wenig weissem Blut. Er stammte aus den Anden, der Heimat Castros, und diese Empfehlung allein hatte genügt, ihm zu seinem hohen Posten zu verhelfen. Es war ein struppiger kleiner Kerl mit affenartigen Bewegungen; er trug einen Sakkoanzug, nur die reich mit Gold gestickte rote Mütze erzählte von seinem Generalsrang. Er brachte uns in sein Haus, wo uns seine hübsche kleine Frau mit Rum bewirtete, das Dienstmädchen, ein altes Negerweib, schickte er derweil aus, seine Offiziere heranzuholen. Die Einrichtung war eine äusserst primitive; überall schlechte Wiener Rohrmöbel, auf den Tischen und Kommoden grässliche Nippes aus einem amerikanischen Zehncentbasar. In den vier Ecken standen aus Pappe in Dreiviertellebensgrösse vier Figuren des Präsidenten Castro, die dieser zu vielen Tausenden einmal in Neuyork hat anfertigen lassen, um sie in Schulen, Kirchen und Museen auszustellen und seinen guten Freunden und Anhängern zu schenken. Eine echt südamerikanische Reklame!
Die Herren Offiziere kamen an. Grosse und kleine, in blauen, gelben und grünen Uniformen. Die Schuhe waren bald hoch, bald niedrig, bei dem einen gelb, beim anderen schwarz. In zwei Punkten aber waren sie alle gleich, sie hatten alle eine sehr elegante Fasson und hatten alle – Löcher. Nicht, als ob sie etwa alt gewesen wären – o nein! Aber der vornehme Venezolaner stellt an die Fussbekleidung ganz sonderbare Ansprüche. Er kauft nur sehr elegantes, sehr spitzes und langes Pariser Schuhwerk, das ihn natürlich drücken muss. Deshalb nimmt er sofort eine Schere und schneidet an den Stellen, wo ihn der Schuh drückt, sich grosse Löcher heraus – nasse Füsse braucht er ja doch nicht zu befürchten in diesem Lande der Sonne.
Die Herren Offiziere mussten ihre Reverenz machen; dann erhielten sie den Auftrag, uns durch die Festung zu führen. Nun habe ich schon manche Festung gesehen, aber so eine lustige gewiss noch nicht: sie sah genau so aus, wie aus Anker-Steinbaukasten aufgebaut! Vier lange Mauern, an den Ecken je ein rundes Türmchen, rund herum ein Graben. Dazu ein paar Schiessscharten, ein paar planierte Gänge – – das war alles. Furchtbar dräuten nach allen Seiten die Kanonen – – aber es waren nur alte verrostete Rohre aus der Spanierzeit, die auf Fässern standen. Das Ganze war aus schlechtem Zement gebaut, und ein Schuss eines guten Panzerschiffes würde die ganze Geschichte mit Glanz in die Luft sprengen. Fünf Millionen hatte die Regierung für das Fort zum Schutze der Insel bewilligt, zwei Millionen hatte der Herr Gouverneur zum Bau davon bekommen und mindestens den fünften Teil davon wirklich dafür ausgegeben. Freilich hatte der Bauunternehmer seinerseits auch noch die Hälfte eingesteckt.
Trotzdem waren die Offiziere nicht wenig stolz auf ihre Festung. Sie hielten uns sichtlich für Spione und waren ausserordentlich besorgt, als wir die uneinnehmbare Stellung in unsere Kodaks nahmen.
»Ich lehne jede Verantwortung ab! Der General hat allein die Schuld zu tragen,« seufzte der Artillerieoberst, dem die alten verrosteten Kanonenrohre unterstanden, als ich ihn auf eine Fasslafette setzte und so photographierte. Trotzdem bat er mich, die Platte doch bald zu entwickeln und ihm ein paar Abzüge zu übersenden.
Das versprach ich ihm; zum Dank führte er mich dann in das unterirdische Pulverdepot. Da standen nicht weniger wie siebzig grosse Fässer, manche noch heil, die meisten aber zersprungen, so dass das Pulver nach allen Seiten herausgefallen war. Ein Soldat war gerade damit beschäftigt, vermittels eines grossen Reiserbesens alles auf einen grossen Haufen zu fegen. Der Oberst zeigte mir die verschiedenen Fässer und erklärte: das da sei deutsches, jenes belgisches, das dort in der Ecke englisches Fabrikat. Dabei drehte er sich eine Zigarette und bat mich um Feuer.
»Aber nehmen Sie sich in acht!« sagte ich, indem ich ihm die Streichholzschachtel reichte.
»Weshalb?« fragte er und strich ein Zündhölzchen an.
»Nun wegen des Pulvers, zum Kuckuck!« rief ich. »Ich habe absolut keine Lust, mit Ihrer prächtigen Festung in die Luft zu fliegen!«
»Ach so!« lachte der Herr Artillerieoberst. »Haben Sie nur keine Angst.«
Damit warf er das brennende Holz in ein offenstehendes Pulverfass. Ich überlegte, ob ich dem Kerl noch schnell eine Ohrfeige geben sollte, ehe wir gemeinschaftlich in die Luft flogen. Aber wir flogen nicht in die Luft, das Zündholz brannte ruhig aus auf dem losen Pulver und verlosch dann.
»Es ist alles durch und durch nass!« sagte der Herr Oberst. »Wir stellen es absichtlich hier in den feuchten Keller, damit kein Unglück entsteht!«