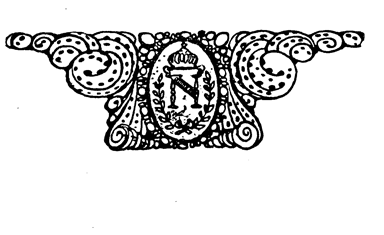|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++


Diese Blätter bilden einen Teil der Memoiren, welche die Gesellschaftsdame der Admiralin Madame Reinezabelle de Vermillon hinterlassen hat. Es geht aus diesen Blättern hervor, daß Madame de Vermillon eine Freundin brauchte, die den Ruf guter Moral mit christlicher Duldung vereinigte und das Französische nicht weitgehend genug verstand, um allerfeinste Anspielungen, verdeckte Bitten, Zusagen und Versprechungen zu durchschauen. Demoiselle Babette Strüntzel aus Straßburg scheint all diesen Anforderungen entsprochen zu haben. Sie schreibt:
»Meine liebe Frau Admiralin war beständig Strohwitwe. Warum nur? Admiral Graf Vermillon, der in Marseille Hafenkommandant war, hätte sich Urlaub genug verschaffen können, um nach dem allgemein begehrten Paris zu kommen. Jedoch er kam nur selten. War er bei Hofe übel angeschrieben? Weiß Gott! Er muß ein prächtiger Mann von großer Keuschheit gewesen sein, denn man hörte keineswegs von ihm jene Geschichten, durch welche die Herren des ancien régime in den Verdacht der Frivolität geraten sind. Im Gegenteil. Er fühlte sich nur wohl in der übermütigen Gesellschaft seiner jüngsten Kameraden und wurde von den Kadetten zur See geradezu angebetet.
Ich wünschte sehr, von Madame Reinezabelle de Vermillon erzählen zu können, wie auch sie nur in Gesellschaft junger Mädchen ihr Glück gesucht hätte. Aber nein. Madame vermied weiblichen Umgang – bis auf den meinen – nach Möglichkeit, und lud ihre hübschen Freundinnen nur ein, wenn sie, wie ich erst jetzt einsehe, sich von einer allzulange währenden Freundschaft eines ihrer liebenswürdigen Herren Gäste zu befreien wünschte.
Wenn man undankbar aus treuen Diensten entlassen wird, so ist das, wie wenn man sich fortab einer schärferen Brillennummer bediente. Man sieht trotz der Milde eines guten Christen bedeutend mehr. Interessant.
Ach, wie ich in Madames Salon eintrat? Wären doch die Zeiten noch da! Wahrlich, es war lasterhaft, aber man benahm sich gut. Herr Phébus de Lagival las ein Novellchen aus dem Nachlaß von Crébillon fils in einem Manuskript vor, dessen Abdruck der tugendhafte König verboten hatte. Wir schämten uns sehr, Madame und ich. Das heißt, Madame benützte ihren Fächer, um dahinter vergnügt zu sein, und ich den meinen, um zu verdecken, daß ich nicht zu erröten vermochte, weil ich die zarte Sprache noch nicht gänzlich beherrschte.
Jedoch lernte ich dabei die Feinheit mehrdeutigen Ausdruckes ein wenig kennen und fürchten.
Am Schlusse jener Erzählung stand Madame in reizender Empörung auf. Sie liebte es, ihr lichtblondes Haar nur leise zu pudern, so daß Gold und Silber im Scheine des Kronleuchters übereinander rieselten, als sie das helle Antlitz weit, weit weg nach seitwärts und nach hinten bog: sehr ablehnend, aber lächelnd.
»Es ist gänzlich unmöglich, die Verlegenheit einer Dame, die einer Erzählung zuhört, ärger zu steigern,« rief sie aus. »Und es ist ebenso unmöglich, ihre gerechte Entrüstung darüber besser in Lachreiz zu verwandeln. Herr Crébillon fils hatte wenig Moral. Das vergäbe ich ihm ja, gestattete jedoch nicht, daß man solche Dinge vor mir lesen dürfte. Aber daß er uns dabei noch zum Lachen bringt, ist unverzeihlich, ist empörend, ist … Er war eben einzig, dieser jüngere Crébillon. Keiner macht ihm das nach!«
»O, doch, Madame,« lächelte Herr Phébus de Lavigal.
»Und wer, wenn ich Sie um das Recht der Anfrage bitten darf?«
»Ich.«
»Schämen Sie sich. Nicht wegen des Stils. Wegen Ihrer Vermessenheit, so reizend sein zu wollen!«
»Und wenn ich wette?«
»Dann hielte ich diese Wette.«
»Was wollten Sie opfern?« fragte Herr Phébus in jener leisen Art von Liebe, die damals bei der guten Gesellschaft gangbar war und von der man nie recht wußte, ob es nicht bloß leise Freundschaft war.
Madame neigte in tiefem Nachdenken die hohe Frisur über das hellblühende Antlitz und prüfte ihn unter den halbverdeckenden Augenlidern. Ich fürchte heute zu erraten, was sie Herrn Phébus antworten wollte. Aber Herr Obolon, der Hausarzt, rief dazwischen:
»Ein Diner!«
»Und ich will nach dem Herrn Chevalier ein Souper verdienen,« rief der Marquis Armand Blancheron, ein Freigeist von größter Ruchlosigkeit der Gedanken, der es nur seiner großen Delikatesse und Liebenswürdigkeit gegen mich verdankte, daß ich ihn nicht haßte.
»Ah, auch Sie wollen mit Crébillon fils in Rivalität treten?«
»Für ein Souper, gern.«
»Gut. Meldet sich noch jemand?«
Wirklich! Es meldete sich ein geistlicher Herr. Der Abbé Lecocq-Choisel. Er verkaufte allerdings seine geistliche Würde nur gegen ein Diner und ein Souper.
»Das wird reizend,« lächelte meine schöne Herrin. »Wann wollen Sie mir Ihren mißlungenen Versuch bringen, Herr von Lavigal?«
»Wenn es eine Novelle sein darf, in drei Tagen.«
»Ah! Ei! In drei Tagen! Sie müssen mit dem Geiste solcher Dinge sehr stark gesegnet sein, Herr von Lavigal. Auf Wiedersehen also in drei Tagen, meine Herren! Bringen Sie Ihre Freunde mit.«
Es war eine liebenswürdige, intime Gesellschaft, die sich verabschiedete; alle freuten sich sehr.
Selbst ich freute mich halb und halb. Zur anderen Hälfte war mir bange. Bange, wie ich mich benehmen sollte. Und bange um das Heil meiner Seele; wirklich.
Es war reizend anzusehen, wie meine Gräfin ihre Wette verlor, und sie verlor sie an alle drei Herren. Denn jeder brachte es zustande, nichtsnutziger zu schreiben, als das von Herrn von Crébillon fils in die Schreibtischlade gelegte und nachher vom König unterdrückte Werk war. Die Vorlesung des Herrn von Lagival verlief derart, daß die Frau Admiralin ehrlich rot wurde und dennoch vor innerlichem Lachen zitterte, wie ein Bäumchen, an dem die Säge frißt. Sie schenkte dem Sieger des Abends für kurze Zeit ihre Freundschaft. Aber Herr von Lagival war zu sehr geistreicher Plauderer, als daß meine hübsche, ränkevolle Dame längere Zeit an den einsamen Stunden Gefallen gefunden hätte, zu denen sie seinen Besuch erlaubte. »Er schwätzt auch da,« sagte sie zu mir; »denken Sie, liebe Freundin, er ist auch da geistreich. Es heißt doch sonst stets: Vor das Publikum gehört die Theorie, vor die Tatsachen aber – – – Kurz und gut, Herr von Lagival weiß seine Verdienste nicht zu placieren.«
Ich verstehe heute noch nicht genau, was sie damit meinte.
Zur Vorlesung des Freigeistes Armand Marquis Blancheron ward Madame des Eucareilles geladen, die von einer süßen, ich möchte sagen, zum Himmel singenden, jedoch tief und schüchtern zur Erde geneigten Schönheit war.
Madame des Eucareilles war mutig genug, mit ihrem Gebetbüchlein zu erscheinen. Sie hatte mir gesagt: »Wird's zu arg, so lese ich hier drinnen weiter und das Lachen einer Hölle soll mich nicht stören, ewige Harmonien zu hören, während die anderen sich am Tand eines leichtverwesbaren Frühlings ergötzen.«
Mein Gott, es wurde so arg, daß Madame des Eucareilles ihr Gebetbuch vergaß, das ich ihr am nächsten Tage bringen mußte; es wurde so arg, daß Herr von Lagival sie nach Hause begleitete, und daß mir am nächsten Tage die Demütigung widerfuhr, das Brevier ihrer Zofe einhändigen zu müssen, weil die des Eucareilles noch nicht in der Lage war, mir ihre Stirn zu zeigen – und mir in die Augen zu sehen.
Wenn ich nicht behaupte, daß Madame Reinezabelle an Blancheron mehr verlor als ein Souper, so hat dies seinen Grund in der einzigen Tugend dieses entsetzlichen Freigeistes: er scheute sich zwar nicht, mit dem, was wir alle glauben und hoffen, der Religion, zu verfahren, wie mit dem Tabak, den ein Pächter in seine Pfeife stopft, um Rauchringel damit zu blasen, aber – Herrn von Blancheron meine ich – er schonte in jeder Weise die Unantastbarkeit einer Tugend (ich habe es an mir selbst erlebt) und begnügte sich bloß damit, in seiner heiteren Weise der Gegenstand des beständigen Entsetzens aller Damen zu werden. So wenigstens kannte ich ihn. Oder sollte ich hier verblendet gewesen sein?
Schade um ihn. Er wurde guillotiniert, noch ehe er daran dachte, sich zu bekehren, während Herr Phébus emigrierte und selbst in Deutschland bei lebendigem Leibe als nichtsnutzig verharrte – bis in sein hohes Alter.
Madame sprach seit jener Vorlesung lange Zeit nicht mehr über Herrn von Blancheron. Er schien für sie ausgetilgt zu sein; hoffentlich! Erst an dem Abende, als der Herr Abbé Pierre Lecocq-Choisel den dritten Preis für leichtsinnige Lektüre gewann, erst dann sagte sie: »Finden Sie nicht, daß dieser Blancheron bloß ein helles Blech hinter dem Lichte ist? Einer, der schlimmer aussehen möchte, als er zu sein vermag? Sehen Sie: dieser Geistliche Lecocq, der ist das Gegenstück. Er sieht aus wie eine feierliche Wachskerze. Er ist es sicherlich, und er ruft dennoch beständig: Ich bin Unschlitt; nicht mehr als Unschlitt, glauben Sie mir, meine Damen! Es ist doch der Gipfelpunkt der Duckmäuserei, den Duckmäuser so vollkommen zu verstecken! Dahinter müßte man kommen.«
Seine Würden Lecocq hatte sich wahrhaftiglich ein wenig anders benommen, als es seinem Stande zukam. Mit gespreizten Beinen saß er an jenem Abende nach seiner Vorlesung da und kanzelte die Herren Phébus und Armand ab, den Kopf ziemlich kahl, die Perücke in der Hand um den Zeigefinger kreiselnd.
Er bewies ihnen, daß man derlei Dinge in zwei verschiedenen Zeitläuften schriebe; vor und nach der schönsten Lebenszeit. Seine beiden Vorgänger hätten die platonische Liebe zur Zweideutigkeit schon wieder, wie die Veilchen im Herbste abermals blühen. Das Gelöbnis der Enthaltsamkeit aber sichere ewigen Frühling.
Es wurde stark widersprochen, und an diesem Abend benützte die für Herrn von Blancheron geladene Dame, die kleine Caçolles, den Fächer sehr eifrig. Aber nur weil sie allzu heftig lachen mußte und ihr ein Backenzähnchen fehlte.
Immerhin erreichte der Abbé, daß Madame Reinezabelle sich für ihn eine Zeitlang interessierte.
Aber es war damals die Soutane keineswegs modern. Die Bemühungen der Herren Rousseau, Voltaire und Diderot hatten bewirkt, daß man in jenen Jahren die Philosophie über alles andere stellte, was sonst in den Salons Geltung genoß, und wahrlich, es muß eine vorzügliche Philosophie gewesen sein, die sich ihren Weg über die dicksten Teppiche und in die ersten Salons der damaligen Zeit zu erobern vermochte! Kein deutscher Philosoph erreichte je Salonfähigkeit. Man bedenke!
Die Herren Rousseau, Voltaire und Diderot waren nun aber schon gestorben und vergessen, und zu unserer Zeit galt in Paris und mehr noch in Versailles Herr Jacques Lagratte für den erfolgreichsten Philosophen auf sämtlichen, in Betracht kommenden Teppichen von Frankreich.
Madame Reinezabelle hatte sich's unendliche Mühe kosten lassen, den vor Berühmtheit leuchtenden Herrn an sich zu bringen. Endlich aber vermochte sie ihn zu sich einzuladen, und ich sehe heute noch den kostbar abgewogenen Hofknix, mit dem Madame ihn ehrte, als er eintrat. Sie war wegen dieser Art, sich zu verneigen, berühmt: als die einzige nach ihrer Lehrerin, der Marschallin von Luxembourg, in Betracht kommende Dame, und sie hatte diesen Knix dem Zeitgeiste angepaßt, erneuert und verfeinert. Ich hatte leider nicht Gelegenheit, ein solches Kunstwerk bei Hofe mitanzusehen, aber man versicherte mir von allen Seiten, daß Herr Jacques Lagratte sich des vollendetsten Komplimentes rühmen dürfte, das Madame je knixte – die erlauchte Familie von Frankreich mit eingerechnet.
Und ich gehe an die Schilderung dieses Ereignisses.
Es brannten hiezu sechshundert Wachskerzen in dem Empfangszimmer Madames, und über dreißig Herren waren versammelt, nebst einem kleinen Dutzend Damen, die Madame diesmal als Freundinnen eingeladen hatte, um Zeugen zu sein, daß Herr Lagratte in Fleisch und Blut ihren Salon beträte.
Herr Lagratte kam von allen Gästen zuletzt, aber er kam genau zu jener Zeit, da sich die Spannung der Gesellschaft so hoch gesteigert hatte, daß in den Herzen der Damen die erste, kleine schadenfrohe Hoffnung aufzischelte, er würde überhaupt nicht kommen. Diese richtige Erwägung der Minute seines Auftrittes allein würde hinreichen, die Größe seiner Philosophie zu beweisen.
Als die Türen aufflogen und die Diener schrien: »Jacques Lagratte« – denn er hatte sich überall streng das Monsieur verboten – da zwang es uns allen die Herzen zur Kehle empor. Nur Madames schöne Augen strahlten in sanftester Heiterkeit gegen die Türe, durch die ein mittelgroßer, vorgeneigter, sehr magerer und etwas an sich gehaltener Herr eintrat, dessen Haar eine leichte Unordnung bewies und ein wenig an den Schläfen flatterte; es war nur schwach gepudert. Das Antlitz war unsagbar schmal und bestand eigentlich, außer einer großen Nase und den prächtig grauen, groß und festblickenden Augen, nur aus zwei senkrechten Falten, die zu beiden Seiten von Nase und Mund bis unter das Kinn spannten.
Es lief ein Schauer durch die Gesellschaft. »Er ist ganz, wie Friedrich der Große aussah« hieß es.
Da trat ihm Madame entgegen. Auf eine Entfernung von ihm, daß sie sich kaum die Fingerspitzen zu reichen vermocht hätten, blieb sie stehen, die Augen demütig und anmutreich gesenkt. Sie bog die Knie, so daß sie fast um die Höhe ihrer golden und silbrig schimmernden Frisur kleiner wurde, und hielt leise ihren Reifrock mit den Handspitzen berührt. Im Augenblick danach griff sie mit dem rechten Füßchen langsam nach hinten aus und zog so ihre ganze junge Pracht leise rücklings mit sich fort, indem sie jetzt dem Gelehrten unendlich bescheiden und schmachtend in die Augen blickte, während sie sich wieder aufrichtete.
Herr Lagratte war ein ganzer Philosoph. Er wußte so viel Grazie, guten Ton und Feinheit nicht anders zu schätzen, als indem er Fassungslosigkeit spielte. Ich glaube, er verliebte sich in diesem Augenblick in sie, als sie sich vor ihm mit solch olympischem Kompliment verneigte.
Madame stellte ihn sofort der Gesellschaft vor. »Ah, meine Freunde,« sagte sie, »was werden Sie von mir denken! In meiner Freude vergaß ich den Namen, den der kleinste Küchenjunge von Paris kennt. Wie soll ich ihn nennen? Unser Philosoph, unsere Girandole, mein Kronleuchter? Nein. Die Sonne dieses Erdballs, heute eingefangen, um unserem Salon allein zu leuchten.«
Nun muß ich weiter berichten. Herr Lagratte war sicherlich ein großer Philosoph, da sich ihm sonst die Salons nicht geöffnet hätten – aber er war selbst für die damalige Zeit etwas stark modern … sagen wir einfach atheistisch.
Schon als das Eis, von Künstlerhand zur Gestalt des Liebesgottes formiert, kam, war er dabei, niemand Geringeren als den lieben Gott auf die niedlichste Art aus der Welt fort zu beweisen, und am Zerfließen der vergänglichen Creme demonstrierte er die Unsterblichkeit der Seele.
»Hier, meine Verehrtesten,« rief er aus und deutete auf seine Eisschale, »hier sehen Sie das Bild des Lebens ins Negative übersetzt. Ja, übrigens, was ist negativ? Was positiv? Dem Eisbären ist die Kälte das Positive.«
»Dieses Eis war noch vor kurzem Formung; es stellte Amor dar. Es war Leben, so lange es Eis war. Ja, was ist Eis? Was ist Leben? Ein beliebig angepaßter Temperaturgrad der Natur, energisch genug, um einen Körper, das heißt, eine Körperschaft zusammenzuhalten. Laßt einen Zephyr wehen – der notwendige Grad entflieht, und die Teile sagen sich auseinanderfließend genau so Adieu, wie hier bei diesem weiland reizenden, zu Eiscreme verkrusteten Amor, den mir unsere liebliche Wirtin zugedacht hatte und über dessen Kälte mich nur seine Vergänglichkeit zu trösten vermag.
»Zu rechter Zeit genießen, das ist alles; – die Temperatur wahrzunehmen, das ist die Aufgabe.«
So bewies der berühmte Herr Lagratte seine Philosophie, die lächelnden, großen, klar grauen Augen auf Madame gerichtet, die Stimme von hoch herab, als käme sie von Gottes Thron, und die Eisschale in der Hand. Man sagte allgemein, daß der Grad seiner Neigung zu Frau Reinezabelle von Vermillon ein hoher gewesen sein müßte, da er schon seit langem nicht mehr so hinreißende und reizvolle Beweise auf den Teppich gebracht hätte.
Immerhin: die Ewigkeit siegt stets; auch über ihre geistvollsten Leugner. Das Verhältnis Madames zu dem Philosophen war nicht von langer Dauer. »Ähnlich wie es das Verhältnis der Völker zu den Philosophien zu sein pflegt,« sagte sein Nachfolger, ein exakter Chemiker.
Ich entsinne mich nicht mehr genau der Jahreszahlen, aber mir ist, als sei jener unwiderlegbare Chemiker zur Zeit aufgetaucht, als der Graf von Cagliostro hier seine Wunder wirkte: kurz vor der Halsbandgeschichte der Königin. Auch wir hatten solch eine kleine Halsbandgeschichte mit ihm, mit Herrn Theophil Bouffler nämlich.
Man wußte damals nicht, ob der Diamant schmelzbar sei. Nun war es Madames Lieblingswunsch, die vierundzwanzig mittelgroßen Rauten ihres Halsschmucks zu einem großen Stein ineinander zu schmelzen und einen Brillanten daraus zu schleifen, der dann, wie Herr Bouffler versicherte, das Vierundzwanzigfache des Halsbandpreises zum Quadrat erhoben, wert sein würde.
Nun weiß ich nicht: mißlang das Experiment wirklich oder hatten später die bösen Zungen recht, die behaupteten, Herr Theophil Bouffler hätte die Diamanten in Wechsel auf die Bank von London umgeschmolzen – kurz, Herr Bouffler stürzte eines Tages in größter Aufregung zu Madame und schrie sie an: »Das Halsband verflüchtigte sich!«
»Wer! Wo! Wie?«
»Das Halsband! Zu Feuer! Zu magnetischer Luft!«
»Mein Halsband! Mein schönes Halsband?«
»Denken Sie sich, Madame: Was die Wissenschaft bisher noch gar nicht ahnte: daß der Diamant nicht schmelzbar wäre, das habe ich, ich entdeckt. Flüchtig ist er! Flüchtig! Haben Sie einen Brillantbouton? Geben Sie her. Begeben wir uns in unser Laboratorium.«
In dem kleinen Zimmer, das Madame dem Chemiker eingerichtet hatte, bewies Bouffler der unglücklichen Reinezabelle, daß der Diamant unter dem Brennspiegel vollständig verlodere. Herr Bouffler wollte in seinem Experimenteifer auch noch Madames andern Ohrknopf verbrennen, aber sie weinte sehr und gab ihn nicht mehr her.
»Trösten Sie sich, Verehrte,« sagte ihr der Chemiker. »Ihr Halsband ist ebensogut dem Äther zugeschwebt, wie es etwa der Seele Ihres Herrn Gemahls oder der meinen in jedem Augenblick ähnlich widerfahren kann. Das sind Erscheinungen dieser armseligen Zeitlichkeit …«
»Armselig?« rief die schwergeprüfte Reinezabelle. »Es kostete zehntausend Franks!«
»… aber Sie haben sich die Ewigkeit damit erkauft – Madame,« fuhr Bouffler unbeirrt fort. »Ich werde der Akademie der Wissenschaften berichten, daß ich durch Ihre Munifizenz die weltbewegende Entdeckung machen und den Beweis erbringen konnte, daß der Diamant verbrennlich ist, und ich werde vorschlagen, daß man diese seltene und kostbare Art der Verflüchtigung für ewige Zeiten ›vermillionisieren‹ nennen solle.«
Meine gütige, junge Herrin lächelte schon wieder ein wenig.
»Sie haben recht,« sagte sie. »›Reinezabellisieren‹ klänge lange nicht so gut.«
Freilich fiel uns nachher ein, daß Herr Bouffler wiederholt die Taktlosigkeit begangen hatte, unsere Herrin um ein Darlehen zu bitten, um dessen Rückerstattung er sich niemals bekümmert hatte. Nun, wer Geld braucht, kann auch Diamanten brauchen, schlossen wir. Aber es war zu spät. Herr Bouffler und vielleicht auch das Halsband waren schon in England.
Dennoch versuchte Madame es noch einmal mit der Wissenschaft. Denn, Gott hat es angesehen: Als die Lebenskundigen und die Herren von Esprit und die Freigeister ihre Walze in den Salons abgespielt hatten, als selbst der Zynismus nicht mehr verfing und die Philosophie all ihre Prismen verspiegelt hatte, da hielt sich die Wissenschaft merkwürdig lange Zeit fest in den Gemütern, und wer modern sein wollte, mußte wenigstens in den Volkswirtschaften irgendwie werkgeübt sein. Sogar der König feilte und schlosserte. Es war zwar keine Wissenschaft, aber was ähnliches.
Nun kam Madame mit Maitre Pierre Savonnard zusammen, und endlich fand es sich, daß sie mit einem Manne etwas Besseres gemeinsam hatte als den Geschlechtsunterschied. Denn die Freude am Experimentieren, die meine schöne Gräfin zum Chemiker gedrängt hatte, verriet damals schon die Neugierde eines Kindes. Und dieselbe kindliche Begierde zur Forschung, ja ich möchte sagen, dieselbe Kinderei des ganzen Wesens, trieb unseren guten Doktor an. Es war rührend zu sehen, wie diese beiden Leute, meine Herrin, klar und schön wie eine Lilie, und der lebhafte Doktor, stark, ansehnlich und frisch, diese Leute, die so leicht Geliebter und Geliebte sein hätten können, sich nur als Kinder fanden.
Ach und wie glücklich waren sie dabei! Alles, was sie als große Leute tun gelernt hatten, vergaßen sie aneinander und lebten wie Kameraden von neun Jahren, denen vom Leben noch nichts anderes gehört – als die ganze Welt, mit Ausnahme ihrer Unruhe. Wie steckten sie die Köpfe über ihrem Mikroskop – nein: über ihrem Spielzeug, zusammen und riefen mich zu sich hin! Die, die dachten nicht daran, sich zu küssen! Aber sie liebten sich viel längere Zeit, als Madame mit den fünf anderen Herren verloren hatte, die ich seit meinem Dienstantritte kommen und gehen zu sehen die Ehre gehabt hatte. Pierre war ein Kind wie sie; das war es.
Wer weiß, wie lange und wohin sich dieses wahrhaft paradiesische Verhältnis fortgespielt hätte, wenn nicht so ein Idealist vom Beginn der Neunzigerjahre hinzugetreten wäre.
Robert Ducrac kam und griff erst Madames vorvergangenen, aber noch immer berühmten Freund Lagratte an. Es waren gewaltige Lufthiebe, die er tat, aber sie freuten uns sehr, weil er auf einen Abgetanen eifersüchtig war; also auf einen Unbesieglichen.
»Darf es für einen Philosophen, der das Leid der Welt durchschaut, das Ereignis seiner Tage bilden, im Kreise von Modeleuten zu regieren und jeden Abend anderswo zum Speisen eingeladen zu sein? Herr Lagratte wird mir antworten, er erzöge Menschen. Was für Menschen, wenn ich bitten darf? Sie sind auf alles neugierig und zu nichts herangebildet. Sie kümmern sich gar nicht um unsere Gedanken: Sie leben in den Tag hinein und reden nicht der Philosophie zuliebe, sondern philosophieren, um zu plaudern«
»Aber man lebt doch, um zu plaudern; nicht?« fragte ihn Reinezabelle.
»Sie verdienen nicht, um besserer Dinge willen zu leben,« schrie sie Ducrac mit seinem dicken Gesichte an. Er war ein großer Idealist, aber kurz, fest, rot, fett und heftig. Er war böse wie ein Luchs, war gefährlich und stets zum Zuschlagen gespannt, wie ein Tellereisen, liebte niemand als sich selber, und das nicht einmal genügend, daß er seine Hände und Haare in Ordnung gehalten hätte. Er ging seit der Erstürmung der Bastille in langen Hosen, nannte Madame und mich Bürgerin und war entsetzlich grob.
Aber was tun? Vor einem Jahre noch mußte jeder Salon von Geltung seinen Hausphilosophen haben, nun waren die Republikaner Sensation, und wer nicht lächerlich oder gar gefährdet sein wollte, hielt große Stücke auf einen Hausrevolutionär. Der unsere war sehr unangenehm zu ertragen, denn es hatte ihn, wie alle unsere Gäste, die Neigung zu Frau Reinezabelle ergriffen. Was aber bei den anderen infolge bester Erziehung oder großer Kühle der Gemütsart ein leichtes Spielchen war, wurde bei ihm gleich zur Sache der Republik, und als Madame nicht augenblicklich der Stimme der Natur folgen wollte, wie er ihr zumutete, ward er auf Herrn Savonnard wolfsböse.
Zu allem Unglück ertappte er den armen Pierre mit Reinezabelle in dem Augenblick, als er ihren schönen Amazonenpapagei, der eingegangen war, mit ihr sezierte, nachdem er dessen Ende auf das innigste mit ihr betrauert hatte. Madame glaubte, er sei an gebrochenem Herzen gestorben, weil seit einigen Monaten der allgemeine Umgangston lauter und kreischender geworden sei, als seine eigenen Stimmittel ihm nachzuahmen gestatteten.
Pierre legte mit dem Skalpell das kleine Herz des Vogels bloß und löste es heraus. Er zeigte ihr, daß dieses leidenschaftliche Geschöpf nur drei Herzkammern gehabt habe, während der Mensch deren vier besäße
Als nun meine schöne Herrin bei der Erwähnung dieses kleinen, unvollkommenen Herzens zu weinen begann, weil es sie an ihr eigenes erinnerte, und Savonnard ihr wie ein guter Kamerad tröstend den Arm über den Rücken legte, trat Ducrac unangemeldet ein. Er hatte mich im Nebenzimmer einfach an die Wand gerannt, sah die beiden zornerfüllt an und schrie: »Bürger Savonnard, Sie konspirieren mit dem Adel!«
Dann drehte er sich um und fuhr polternd ab wie ein Schotterkarren.
Madame lachte sehr und Savonnard auch. »Nun sind wir kompromittiert« rief sie fröhlich, und er schmunzelte: »Ja, wirklich, das hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen!«
So harmlos nahmen sie es; aber mir bangte, denn ich hatte vom Blutdurste Ducracs schon üble Dinge gehört.
Um diese Zeit, als die französische Tagesliteratur sich in unglaublicher Weise verschlechtert hatte, brachte ich Reinezabelle endlich dazu, auch einmal einen der deutschen Dichter zu lesen, von denen sie eine sehr geringe Meinung hatte. Ich hatte schon vor über einem Jahrzehnt den »Werther« in der Sprache meiner Straßburger Heimat gelesen, und er lag mindestens ebenso lange in einer vortrefflichen Übersetzung vor. Ich hatte diesen Band wiederholt meiner schönen jungen Frau Admiral auf das Taburett neben das Sofa gelegt, aber sie hatte ihn gar nicht aufgeschlagen.
Damals nun sollte Madame einen Ball besuchen, der um 10 Uhr abends begann. Durch die einfachere Tracht jener Saison wurde sie um eine halbe Stunde früher fertig und langweilte sich nun, während ihr Wagen unten erst aus der Remise gezogen und hergerichtet wurde.
Da entdeckte sie den »Werther«, setzte sich zum Licht und begann zu lesen.
Der Kutscher ließ melden, es sei angeschirrt. Sie sagte: »Gleich, gleich!« und las weiter.
Die Pferde standen und scharrten, der Portier brummte, der Kutscher schlief auf dem Sitze ein, sie oben hatte alles vergessen. Ball und Wagen, Bediente und mich, die ich mit meiner Stickerei hinter ihr saß und nichts hörte als ihren jähen, schnellen Atem, das hastige Herumreißen der gelesenen Blätter und immer wieder das leichte Aufschlagen einer Träne auf das Papier. Es klang, wie wenn der Föhnwind mit einzelnen verirrten Regentropfen gegen ein Fenster tippt.
Und zwei- oder dreimal hörte ich sie ganz leise und innerlich schluchzen, wobei die liebe Stimme so hoch und rein dahinzog wie der Ton einer Geige.
Gegen Mitternacht ließ sie den Wagen abschirren. Sie las weiter bis 2 oder 3 Uhr; bis zur letzten Seite und war dann so erregt, blaß und unglücklich, und doch so beseligt und schön, daß ich mich wunderte, warum noch kein Mann um dieser Frau willen gestorben sei.
»Ach,« sagte sie mir unter Tränen. »Ich habe ja bis heute niemals gewußt, was Liebe ist! O könnte ich leiden um der Liebe willen! O gebenedeiter Monsieur Werther, o beneidenswerte Lotte! Seliges Unheil! Wie geheiligt ich bin! Sagen Sie doch: Wie sieht dieser Monsieur Goethe aus? Was erzählt man sich von ihm?«
Seit jener Nacht wünschte Madame dringlichst, einmal in ihrem Leben eine wirkliche Liebe zu erleiden.
Und es kam, wie sie wünschte.
Unter ihre Gäste hatten sich in jener Zeit viele jüngere Leute gefunden, die ihre Augen sicherlich nicht zu der schönen Herrin des Salons zu erheben wagten. Es waren beflissene und ehrgeizige Menschen, die bei dem einflußreichen Bekanntenkreise Madames Gelegenheit zu einer erfolgreichen Karriere zu finden gedachten. Zu diesen Leuten gehörte auch ein junger Artillerieleutnant, der eine recht armselige Uniform trug; ein Mensch mit gelbem, magerem Gesicht, wirren Haaren und wirren Reden, die er, stets aufgeregt, in einem nicht sehr gewählten Französisch von stark italienischer Aussprache hervorstieß.
Da sein Taufname ungemein fremdartig war und durch die korsische Aussprache noch viel lächerlicher klang, so nannte ihn die stets lachlustige Reinezabelle nie anders als mit diesem Namen: Leutnant Naboulione.
Der arme Teufel war wegen eigenmächtiger Entfernung aus der Armeeliste gestrichen worden, besaß nicht mehr als seine Uniform und lebte von den Soupers, zu denen man ihn einlud und die er eifrig besuchte. Er war erst seit kurzem in Paris und wünschte sehr, ein wenig in die Höhe zu kommen.
Ducrac, um dessen Freundschaft er sich neben jener des jüngeren Robespierre eifrig bewarb, versicherte mir: »Glauben Sie nur nicht, daß Leutnant Naboulione, für dessen Armut und Originalität sich die sentimentale Reinezabelle so sehr interessiert, um ihretwillen diesen Salon besucht. Ihr Mann, der Admiral, ist Hafenkommandant von Marseille, und der verabschiedete Leutnant benötigt dort dringend eine Stelle. Verweigert sie ihm, und er wirft euch seinen Hut ins Gesicht und geht anderswohin. Sagen Sie das der Bürgerin.«
Ich tat es; Reinezabelle lachte sehr und sagte:
»Nun ist Ducrac auch auf Naboulione eifersüchtig. Ich muß mir den doch genauer ansehen.« Und sie begann den gelben, ungeschliffenen Knirps mit dem zerrauften Haar zu bevorzugen, was diesem nur selbstverständlich schien. Er wurde nicht sehr viel wärmer, außer wenn er Madame von dem Glück erzählte, das ein Oberst der Artillerie in Marseille genösse.
Sie aber lachte und sagte: »Nein, wir wollen Sie in Paris haben.«
»Madame wüßten eine Stelle für mich?«
»Die beste. Alle Abend hier in meinem Salon.«
Naboulione lächelte sauer, bemühte sich aber sehr, es in verbindlicher Weise zu tun. Damals fragte ich mich empört: »Wo hat der Kerl nur seine Augen?«
Heute weiß ich freilich, wo er sie hatte.
Eines Abends war man ungemein aufgeregt. Der König war hingerichtet worden, und Ducrac gab im Salon, Frau v. Vermillon zuliebe, die Generalprobe zu einer fürchterlichen Rede, die er kommenden Tages im Parlament zugunsten weiterer Adelsguillotinierungen halten wollte. Es war schaurig schön; alles applaudierte und prophezeite seiner Rede den besten Erfolg.
Naboulione stand tiefbefriedigt nebenbei. In manchen Dingen erwies er sich schon damals als der geniale Mensch, der später auch den praktischen Erfindungen seiner Zeit weit vorauseilte. Damals hatte er, im stürmischen Drang, seinen Hunger zu stillen und dennoch den Gaumen mit all den reizvollen Genüssen zu bedienen, die man hier als Erfrischungen umherbot, auf einem Brötchen folgende Dinge zusammengestopft: ein Stückchen Käse, ein Stück Salmen vom Schwanzteil, einen Essigpilz, etwas Räucherfleisch, eine Olive und ein wenig Butter Er war also auch der Erfinder der Sandwiches. Anm. d. Herausgebers..
Daran fraß er, beständig abbeißend. Nur die Revolution machte solche Unsitten salonmöglich.
Als nun Herr Ducrac seine Rede beendet hatte, versicherte Madame mit großer Lebhaftigkeit, es sei die höchste Zeit, daß die Adeligen ihre Stellen räumten, um sie den unverbrauchten Kräften der Republik abzutreten. Sie selbst habe, teils aus Überzeugung, teils aus Sorge um den Kopf ihres Mannes, den Admiral de Vermillon bewogen, seine Stelle niederzulegen und sich ins Privatleben zurückzuziehen.
»Unmöglich!« schrie entsetzt Leutnant Naboulione dazwischen.
Reinezabelle fragte ihn, warum er so böse sei?
»Weil ein Mann auf seinen Posten gehört. Weil es von einem Kommandanten schändlich ist, aus Sorge um seinen Kopf sich den Pflichten zu entziehen, die er noch nicht einmal erfüllt hat! Marseille ist schlecht armiert. Es mangelt dort an Artillerieoffizieren. In Marseille ist Admiral Vermillon notwendig, in Paris als Privatier höchst überflüssig!«
»Aber mir ist er nicht überflüssig,« sagte Madame, der es Freude machte, ihn mit ihrem Manne zu necken, in schuldlosem Ton. »Ich habe ihm selbst geschrieben, zu mir zu eilen in einer Zeit, wo Liebe, Treue und zartes Gefühl teuer zu werden beginnen. Ich habe ihm heute bei der Nationalversammlung sein Entlassungsdekret erwirkt. Aber, Herr Leutnant! Sehen Sie mich nicht so böse an. Sie werden mein täglicher Freund bleiben, auch wenn der Admiral zu Hause ist.«
»Sie zerreißen das Entlassungsdekret! Nicht wahr, Ducrac, es ist doch zu annullieren?« bat der tolle, kleine Mensch.
»Aber im Gegenteil« rief Reinezabelle. »Ich habe es heute mit der Eilpost abgeschickt und …«
Naboulione schnitt ihr das Wort auf eine Weise ab, wie sie unmöglich in Korsika, ja nicht einmal auf den Südseeinseln üblich sein konnte! Er warf ihr die noch unverzehrte Hälfte seines belegten Brötchens an den Kopf.
Reinezabelle schrie laut auf vor Schreck, und wir waren alle zerdonnert, ja geradezu in Salzsäulen verflucht.
Dieses war die ungeheuerlichste Tat der Republik. Der Kopf des Königs wog nicht so schwer als diese brutale Mißhandlung einer schönen Frau.
Naboulione entfernte sich in großer Bewegung, und mit einem Ausdruck voll Schreck, Sorge und ausbrechender Liebe sah ihm Reinezabelle nach. Im blonden Haar steckte ihr das Schweifstück des Salmen, am Ohrgehänge hatte sich ein Bissen Räucherfleisch verfangen, und die Butter befleckte ihr sonst stets lächelndes Grübchenkinn. Aber sie machte keine Bewegung, sich zu reinigen.
Es war ein entsetztes Stillschweigen hinter dem wilden kleinen Artilleristen. Erst als Ducrac die Roheit hatte, Bravo zu sagen, ging das Gezeter über Naboulione los. Man fand, das Maß der Schrecken habe seinen Höhepunkt erreicht, und während ich Madame abputzte, sagte ein Orientalist, daß solches bei den Türken unmöglich wäre, und zitierte einen arabischen Spruch hierzu:
Mit einer Blume nur zu schlagen
Ein Frauenbild sollst du nicht wagen.
Reinezabelle aber sagte, während ich sie abwischte, nur immer verklärt: »Welche Leidenschaft! Welche Leidenschaft! Und bloß, weil mein Mann zu mir kommen soll. Nein, diese Leidenschaft! Das ist korsisch, meine Liebe!«
Ich glaube, sie hätte den kleinen, schlimmen Leutnant in allen Gassen von Paris suchen lassen, wenn sich nicht am nächsten Tage Ducrac ebenso abscheulich benommen hätte. Er hatte seine Rede gehalten. Ein brüllender Aufruhr fegte durch die Gassen; aus dem wimmelnden Volkstrott ragten auf Stangen gespießte Köpfe. Eben zog sich Reinezabelle, die neugierig ans Fenster geeilt war, mit den Worten zurück: »Kommen Sie, liebe Babette, ich sehe dergleichen immer noch nicht gerne,« da flog ein abgeschlagenes Menschenhaupt auf den Balkon herauf, kollerte in das Zimmer und eine Stimme rief: »Besuch von Herrn Savonnard! Souvenir der Revolution!«
Madame war leichenblaß geworden. »Nein,« sagte sie dann, »das wird zu arg! Diese Leute beginnen geschmacklos zu werden mit ihren Köpfen. Räumen Sie das hinaus und lassen Sie sofort meine Koffer packen.
Wir wandern aus. Die Sitten sind hier zu frei. Nicht wegen dem belegten Brötchen, o nein. Aber an die Art dieses Ducrac werde ich mich niemals gewöhnen. Er hat mir alle Freude an Paris verdorben.«
Im Exil zu Köln verbrachte sie sehnsuchtsvolle Jahre. Sie konnte den kleinen, rohen Naboulione seit seiner Schandtat nicht mehr vergessen. Als dann der kleine Leutnant bei Lodi und Novi, bei den Pyramiden und bei Marengo zum großen General wurde und die Welt auch am Konsul Bonaparte noch immer nicht genug erlebt hatte, als er, der Kaiser, seinen drolligen Taufnamen wieder hervorsuchte, nur daß er ihn jetzt in besserem Französisch zu nennen wußte, da weinte die unglückliche, einsame Frau vor leidenschaftlicher Liebe nach ihm, dem sie nie mehr wieder nahetreten sollte.
»Ach« klagte sie. »Ich hatte die ganze Geschichte des Rokoko und der Revolution in Gestalt von Freunden durchgeliebt und sie gaben sich in allen Nuancen dieser wechselreichen Zeit; aber mißhandelt hat mich keiner.
Er aber, er hat Völker, Könige, Ideen, Religionen, Philosophien und Gelehrte geschlagen. Alle mit anderen Mitteln, mich aber, allein von allen, durch den Schwung seiner zornigen Hand. Mir betätigte er seine Eigenart am persönlichsten.
Und nun ist er Kaiser; er heiratet diese Marie Louise und ich hätte ihn so gut verstanden.
Schade! O schade!«