
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
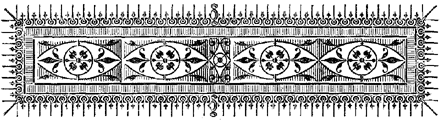
Drei Monate später, an einem jener trüben, regnerischen Frühlingstage, welche in Paris eine Wiederkehr des Winters zu bedeuten scheinen, stieg Aristide Saccard an der Place du Chateau-d'Eau aus dem Wagen und betrat, von vier anderen Herren gefolgt, den durch Demolirungsarbeiten freigelegten Raum, welcher sich damals an Stelle des zukünftigen Boulevard du Prince Eugene erstreckte. Die kleine Gesellschaft war als Untersuchungskommission von der Jury der Entschädigungen an Ort und Stelle entsendet worden, um gewisse Liegenschaften abzuschätzen, deren Eigenthümer sich mit der Stadt nicht gütlich zu verständigen vermocht.
Saccard wiederholte dasselbe Vorgehen, welches er in der Rue de la Pepinière befolgt hatte. Damit der Name seiner Frau vollständig aus der Angelegenheit verschwinde, wurde in erster Linie ein Scheinverkauf des Grundstückes sammt den sich darauf befindlichen Baulichkeiten bewerkstelligt. Larsonneau trat das Ganze einem angeblichen Gläubiger ab. Der Verkaufsvertrag wies die kolossale Summe von drei Millionen auf. Diese Ziffer war eine derart übertriebene, daß als der Expropriationsagent im Namen des imaginären Eigenthümers den Ankaufspreis als Entschädigung forderte, die Entschädigungs-Kommission trotz der unermüdlichen Wühlarbeit des Herrn Michelin und der Fürsprache des Herrn Toutin-Laroche und des Barons Gouraud unter keinen Umständen mehr als zwei Millionen fünfhunderttausend Francs bewilligen wollte. Saccard war hierauf vorbereitet gewesen; er lehnte das Angebot ab und ließ die Sache vor die Jury kommen, deren Mitglied sowohl er als auch Herr von Mareuil war. Und so traf es sich, daß er mit vier Kollegen beauftragt wurde, auf seinem eigenen Grund und Boden eine Schätzung vorzunehmen.
Herr von Mareuil begleitete ihn. Die drei anderen Jurymitglieder waren ein Arzt, der eine Zigarre rauchend, sich nicht im Mindesten um die ihn umgebenden Dinge kümmerte, und zwei Industrielle, deren Einer, Fabrikant chirurgischer Instrumente, ehedem mit dem Schleifstein durch die Straßen gefahren war.
Der Weg, den die Herren betraten, war entsetzlich. Während der ganzen Nacht hatte es geregnet. Der durchweichte Boden bildete ein Kothmeer, in welchem die Fuhrwerke, welche den Schutt fortschafften, bis zur Radnabe versanken. Zu beiden Seiten erhoben sich geborstene Mauern, an welchen bereits die Spitzhacke gearbeitet hatte; hohe, zerstörte Gebäude, die ihr ausgeweidetes Inneres sehen ließen, reckten ihre leeren Treppenhäuser, ihre gähnenden Zimmerreihen in die Luft empor, den zertrümmerten Schubfächern eines großen, häßlichen Möbelstückes vergleichbar. Nichts konnte einen kläglicheren Anblick bieten, als die farbigen Tapeten dieser Zimmer, die gelben oder blauen Papierfetzen, die bis zu einer Höhe von fünf oder sechs Stockwerken hinaufreichend, kleine, armselige Kabinete, enge Löcher kennzeichneten, in denen sich vielleicht ein ganzes Menschenleben abgespielt. An den nackten Wänden stiegen die trübselig schwarzen Schornsteine hinan. Eine vergessene Wetterfahne kreischte am Rande eines Daches, während die halb losgelösten Dachrinnen gleich alten Lumpen herunterhingen. Und der Durchschlag setzte sich inmitten dieser Ruinen schier endlos fort, gleich einer Bresche, durch Kanonenkugeln gerissen; die noch kaum angedeutete Straße dehnte sich von Schutt und Trümmern bedeckt, zwischen Erdaufschüttungen und Wassertümpeln unter dem grauen Himmel hin und über ihr schwebte die düstere Wolke der aufgewirbelten Staub- und Mörtelmassen, deren natürliche Grenzen die schwarzen Linien der Schornsteine zu sein schienen.
Mit ihren blanken Schuhen, fleckenlosen Ueberröcken und hohen Hüten nahmen sich die Herren recht sonderbar aus inmitten dieses schmutziggelben Kothreiches, in welchem außer ihnen nur noch bleiche Arbeiter, bis zu den Ohren beschmutzte Pferde und Karren sichtbar waren, deren Holzgerüste von einer dichten Staubschichte gänzlich bedeckt waren. Sie schritten im Gänsemarsch hinter einander einher, sprangen von einem Stein zum andern, wichen den Tümpeln dünnflüssigen Kothes aus und versanken dennoch zuweilen bis zu den Knöcheln in demselben, worauf sie die Füße fluchend schüttelten. Saccard hatte den Vorschlag gemacht, durch die Rue de Charonne zu gehen, wodurch ihnen diese Wanderung durch dieses Trümmerreich erspart geblieben wäre; unglücklicherweise aber hatten sie mehrere Liegenschaften auf der langen Boulevardlinie zu besichtigen und da die Neugierde sie ebenfalls drängte, hatten sie beschlossen, die Arbeiten in der Nähe zu betrachten, zumal dieselben sie in hohem Grade interessirten. Zuweilen blieben sie schwankend auf einem Stück Mauerwerk stehen, steckten die Nase in die Luft und zeigten sich gegenseitig einen frei überhängenden Balken, ein Schornsteinrohr, welches in die Höhe ragte, eine Dachtraufe, die auf ein benachbartes Dach gefallen war. Dieser verwüstete Stadttheil am Ausgange der Rue du Temple däuchte ihnen sehr drollig.
»Das ist höchst merkwürdig,« sagte Herr von Mareuil. »Sehen Sie doch, Saccard, dort oben ist eine Küche, und über dem Kochherde hängt noch ein alter Ofen ... Ich sehe denselben ganz deutlich.«
Der Arzt aber war mit der Zigarre zwischen den Zähnen vor einem demolirten Hause stehen geblieben, von welchem nur noch das Erdgeschoß erhalten war, dessen Räume mit den Trümmern der übrigen Stockwerke angefüllt waren. Eine einzelne Mauer überragte den Trümmerhaufen und um dieselbe zu Falle zu bringen, hatte man ein Seil darum gewunden, an welchem etwa dreißig Arbeiter zogen.
»Sie werden sie nicht umkriegen,« brummte der Arzt; »sie ziehen zu viel links.«
Die vier Anderen waren zurückgekehrt, um die Mauer fallen zu sehen. Und starren Blickes, mit verhaltenem Athem erwarteten sie in freudiger Erregung den Fall der Mauer. Die Arbeiter ließen nach und zogen dann mit einem plötzlichen Ruck wieder an, wobei sie mit taktmäßigen Zurufen: Auf! Dran! sich selbst antrieben.
»Sie werden sie nicht umkriegen!« wiederholte der Arzt.
Doch nach einigen Minuten angstvoller Erwartung rief einer der Industriellen erfreut:
»Sie bewegt sich! sie bewegt sich!«
Und als die Mauer endlich nachgab und unter fürchterlichem Getöse eine ungeheure Staubwolke aufwirbelnd zusammenbrach, blickten die Herren einander lächelnd an. Sie waren entzückt. Ihre Ueberröcke bedeckten sich mit einem feinen Staube, der ihnen Arme und Schultern weiß färbte.
Als sie jetzt ihren Gang zwischen den Trümmern fortsetzten, sprachen sie von den Arbeitern. Sie ließen nicht viel Gutes an denselben. Ihrer Ansicht nach waren das lauter Tagediebe, Vielfraße und derlei Dickköpfe, die nur dahin strebten, ihre Brodherren zu Grunde zu richten. Herr von Mareuil, der seit einigen Minuten mit einem geheimen Schauer zwei arme Teufel beobachtete, die an einer Dachecke hängend, eine gegenüberliegende Wand mit ihren Spitzhacken angriffen, wagte die Bemerkung, daß diese Leute doch einen bewunderungswürdigen Muth besäßen. Nun blieben auch die Uebrigen stehen und beobachteten die gleichsam in der Luft hängenden Arbeiter, die vornüber gebeugt, ihre Geräthe mit voller Wucht niedersausen ließen. Die losgelösten Steine stießen sie mit den Füßen hinunter und sahen dieselben in aller Gemüthsruhe in der Tiefe zerschellen. Wenn die Spitzhacke fehlgegangen wäre, so hätte der bloße Schwung ihrer Arme hingereicht, um sie in die Tiefe zu reißen.
»Bah! das macht die Gewohnheit aus,« sagte der Arzt, seine Zigarre wieder zu den Lippen führend. »Das sind eher Thiere als Menschen.«
Mittlerweile waren sie bei einem der Gebäude angelangt, die sie zu besichtigen hatten. Sie machten ihre Arbeit in einer Viertelstunde ab und setzten darauf ihre Wanderung fort. Allmälig verloren sie ihre Scheu vor dem Koth, schritten mitten durch die Pfützen und gaben die Hoffnung auf, ihre Stiefel rein zu erhalten. Als sie über die Rue Ménilmontant hinausgekommen waren, wurde der eine der Industriellen, der ehemalige Scherenschleifer, unruhig. Er betrachtete prüfend die ihn umgebenden Ruinen und schien die Gegend nicht zu erkennen. Er sagte, er habe vor dreißig Jahren etwa, als er nach Paris kam, hier gewohnt und es thue ihm ordentlich wohl, daß er den Ort wiederfinde. Immer noch ließ er den Blick suchend umherschweifen, als ihn der Anblick eines Hauses, welches die Axt der Zerstörung bereits in zwei Theile gerissen, ihn mit einem Male stillstehen ließ. Er betrachtete das Thor, dann die Fenster und indem er mit dem Finger auf eine Stelle des dem Untergange geweihten Hauses deutete, sprach er ganz laut:
»Das ist es! das! das! ich erkenne es!« »Was denn?« fragte der Arzt.
»Mein Zimmer, alle Wetter! das ist es ja!«
Ein kleines, im fünften Stock gelegenes Zimmer war es, welches ehemals auf den Hof gegangen sein mochte. Eine niedergerissene Wand ließ es ganz deutlich sehen mit seinen mit gelben Zweigen bemalten Tapeten, von welchen ein losgerissenes Stück im Winde flatterte. Zur Linken sah man die Nische eines Spindes, welche mit blauem Papier beklebt gewesen sein mochte und rechts davon ein Ofenloch, mit einem zurückgebliebenen Stück Rohr.
Die Rührung übermannte den ehemaligen Arbeiter.
»Fünf Jahre habe ich daselbst verbracht,« sprach er halblaut, »Die Dinge gingen damals nicht nach Wunsch; aber jung war ich ... Sehen Sie den Schrank dort? In jenem sparte ich mir dreihundert Francs zusammen, Sou um Sou. Und bei dem Ofenloch erinnere ich mich noch des Tages, an welchem ich dasselbe herstellte. Das Zimmer hatte keinen Kamin, es herrschte eine bittere Kälte darin, zumal wir nicht immer zu Zweien waren.«
»Wir sind nicht neugierig nach Ihren Geständnissen,« fiel ihm der Arzt halb scherzend ins Wort. »Sie waren sicherlich um kein Haar besser als die Anderen.«
»Ja, das ist wahr,« bestätigte der würdige Mann gutmüthig, »Ich erinnere mich noch an eine kleine Plätterin aus dem gegenüberliegenden Hause... Sehen Sie, das Bett stand Zur Rechten, nahe zum Fenster... Ach, mein armes Zimmerchen, wie haben sie dir mitgespielt!«
Er war ganz traurig geworden.
»Hören Sie 'mal,« sagte Saccard, »das ist doch wahrhaftig nicht zu bedauern, daß diese alten Baracken abgetragen werden, an deren Stelle schöne, große, lichte Häuser kommen. ... Möchten Sie denn gar wieder in einem solchen Loch wohnen? Auf dem neuen Boulevard dagegen können Sie leicht eine elegante Unterkunft finden.«
»Ja, das ist wahr,« erwiderte der Fabrikant, der völlig getröstet zu sein schien.
Die Kommission hielt abermals bei zwei Häusern an, während der Arzt mit der Zigarre im Munde vor dem Thore stehen blieb und gen Himmel blickte. Bei der Rue des Amandiers wurden die Häuser immer seltener und man wanderte an großen Lücken vorüber, neben leeren Baugründen dahin, auf welchen zuweilen irgend ein zerfallenes Gemäuer zu sehen war. Saccard schien ganz entzückt über diese Wanderung durch Ruinen; er erinnerte sich des Diners, welches er ehemals mit seiner ersten Frau auf dem Montmartre eingenommen und erinnerte sich ganz genau, daß er mit einer Handbewegung die Linie bezeichnet hatte, welche Paris von der Place du Chateau-d'Eau bis zur Barriere du Trône durchschneiden würde. Die Verwirklichung seiner Vorhersagung erfüllte ihn mit Freude. Er betrachtete den projektirten Straßenzug mit der geheimen Genugthuung des Urhebers, als hätte er selbst mit seinen eisernen Fingern die ersten Axthiebe geführt. Und er setzte frohgemuth über die Pfützen hinweg, indem er sich sagte, daß unter diesen Trümmern, am Ende dieses Kothmeeres drei Millionen seiner harren.
Die Herren glaubten sich auf's Land versetzt. Der Weg zog sich mitten durch Gärten hin, deren Umfriedungsmauern er mit sich genommen. Große Büsche knospenden Flieders waren zu sehen; das Laub der Bäume zeigte ein zartes Grün. Jeder dieser Gärten bildete ein lauschiges Ganzes für sich allein und in jedem derselben konnte man kleine, halbverborgene Häuser sehen, die bald an einen italienischen Pavillon, bald an einen griechischen Tempel erinnerten. Moos bedeckte die Gipssäulen, während Unkraut den Kalk von den Giebeln löste. »Dies sind kleine Häuschen,« bemerkte der Arzt und zwinkerte mit den Augen.
Und als er sah, daß ihn die Herren nicht verstanden, erklärte er ihnen, daß die Marquis und Herzoge unter Ludwig XV. für ihre Liebesabenteuer sich lauschige Schlupfwinkel erbaut hatten. Das war damals Mode. Dann fuhr er fort:
»Man nannte das » kleine Häuschen« und in diesem Viertel gab es eine Menge derselben ... Es trugen sich daselbst mitunter ganz merkwürdige Dinge zu!«
Die Herren von der Kommission waren sehr aufmerksam geworden. Die Augen der beiden Industriellen glänzten und lächelnd, mit lebhaftem Interesse betrachteten sie die Gärten, diese Pavillons, für die sie vor den Erklärungen ihres Kollegen keinen Blick gehabt. Eine Grotte, die sie in einem Garten entdeckten, hielt ihre Aufmerksamkeit besonders lange gefesselt. Als der Arzt aber beim Anblick eines Gebäudes, an dessen Abtragung bereits gearbeitet wurde, behauptete, er erkenne das kleine Häuschen des von seinen Orgien her wohlbekannten Grafen von Savigny, verließ die ganze Kommission den Boulevard, um die Ruine zu besichtigen. Sie erkletterten die Schutthaufen, drangen durch die Fenster in die Räume des Erdgeschosses und da die Arbeiter eben bei ihrem Frühstück waren, so konnten die Herren nach Belieben daselbst verweilen. Sie blieben da eine volle halbe Stunde, betrachteten die Rosetten des Plafonds, die Malereien an den Wänden, die Schnitzereien an den Thüren, während der Arzt das Ganze zu rekonstruiren suchte.
»Sehen Sie,« sprach er; »dies mochte der Saal gewesen sein, in welchem die Gastmahle abgehalten wurden. Hier, in dieser Mauervertiefung stand zweifellos ein mächtiger Divan. Und über demselben befand sich meiner Ueberzeugung nach ein großer Spiegel; ... sehen Sie hier die Spuren der Klammern, welche das Glas festhielten ... Oh, die Spitzbuben verstanden es, sich des Lebens zu freuen!«
Sie hätten diese alten Räume, die ihre Phantasie angenehm beschäftigten, nicht so schnell verlassen, wenn Aristide Saccard, von Ungeduld erfaßt, nicht lachend gesagt hätte:
»Sie suchen vergebens, meine Herren ... Die Damen sind doch nicht mehr hier ... Gehen wir an unsere Arbeit.«
Doch bevor man sich entfernte, stieg der Arzt auf einen Kamin und löste mittelst eines Stemmeisens glücklich einen kleinen, bemalten Amorkopf von der Wand, den er in seiner Tasche verwahrte.
Endlich waren sie am Ziele ihrer Wanderung angelangt. Die ehemaligen Besitzungen der Frau Aubertot waren sehr ausgedehnt; das Caféconcert und der Garten nahmen kaum die Hälfte derselben ein und der Rest war mit einigen unbedeutenden Häuschen bebaut. Der neue Boulevard schnitt dieses Parallelogramm in der Diagonale durch, was Saccard's Befürchtungen ein wenig beruhigt hatte, da er lange gemeint, daß das Caféconcert allein genommen werden würde. Larsonneau war dementsprechend auch angewiesen worden, sehr selbstbewußt zu sprechen; die werthvolleren Randgebiete allein hätten die beanspruchte Ersatzsumme verfünffachen müssen und er drohte der Stadt bereits, von einer kürzlich erlassenen Ermächtigung Gebrauch zu machen, wonach es den Eigenthümern anheimgestellt wurde, für die öffentlichen Arbeiten gerade nur das unumgänglich nothwendige Terrain zu überlassen.
Der Expropriationsagent empfing die Herren. Er führte sie durch den Garten, ließ sie das Caféconcert besichtigen und zeigte ihnen ein mächtiges Aktenbündel. Die beiden Industriellen aber waren in Begleitung des Arztes wieder hinausgegangen und bestürmten diesen noch immer mit Fragen in Bezug auf das kleine Häuschen des Grafen von Savigny, welches ihre Phantasie beschäftigte. Vor einem Tonnenspiel stehend, hörten sie ihm mit offenem Munde zu, während er ihnen von der Pompadour sprach und über die Liebschaften Ludwigs XV. berichtete. Und inzwischen fuhren Herr von Mareuil und Saccard allein in der Untersuchung fort.
»Das wäre also auch besorgt,« sprach Saccard in den Garten zurückkehrend, »Wenn Sie gestatten, meine Herren, werde ich den Bericht verfassen.«
Der Fabrikant von chirurgischen Instrumenten hörte nicht einmal zu; er befand sich im Geiste unter der Regierung Ludwigs XV.
»Welch' drollige Zeiten waren das!« murmelte er.
In der Rue de Charonne fanden sie einen Fiaker und sie bestiegen denselben, bis zu den Knieen von Koth bespritzt und wohlgemuth, als hätten sie eine Landpartie gemacht. Im Wagen nahm die Unterhaltung eine andere Wendung; man sprach über Politik und bemerkte, daß der Kaiser große Dinge vollbringe. Noch nie hatte man einen Anblick gehabt, wie er ihnen heute geboten worden. Diese große, schnurgerade Straße wird nach ihrem Ausbau ein großartiges Werk sein.
Saccard brachte seinen Bericht zu Papier und die Jury bewilligte die drei Millionen. Der Spekulant war am Ende seiner Mittel angelangt; er hätte nicht einen Monat länger aushalten können. Dieses Geld bewahrte ihn vor dem Ruin und einigermaßen auch vor dem Kriminalgericht. Er zahlte fünfhunderttausend Francs seinem Möbelhändler und Baumeister, denen er für das Hôtel des Monceau-Parkes eine Million schuldig war, befriedigte anderweitige drängende Gläubiger und stürzte sich in neue Unternehmungen, indem er Paris mit dem Geräusche seiner Thaler erfüllte, die er in seiner eisernen Kasse aufgehäuft hatte. Der goldene Strom hatte endlich seine Quellen. Noch war das aber kein solides Vermögen, welches vor künftigen Stürmen gesichert war. Nachdem Saccard aus seiner Krise mit heiler Haut davongekommen, vermochte er sich mit den Ueberresten seiner drei Millionen gar nicht zu behelfen und er behauptete naiv, daß er noch zu arm sei, als daß er sich zur Ruhe setzen könnte. Und es währte nicht lange, so begann der Boden unter seinen Füßen neuerdings zu wanken.
Larsonneau hatte sich in der Charonner Angelegenheit so tadellos benommen, daß Saccard nach einigem Zögern die Rechtschaffenheit so weit trieb, ihm zehn Prozent und ein Trinkgeld von 30 000 Francs zu bezahlen. Mit diesem Gelde eröffnete der Expropriationsagent ein Bankhaus. Und als ihn sein Genosse mürrischen Tones beschuldigte, er sei reicher als er – Saccard – selbst, erwiderte der Geck lachend:
»Sehen Sie, theurer Meister, Sie verstehen es vortrefflich, einen Regen von Hundertsousstücken herbeizuführen, wissen aber nicht, wie man dieselben zusammenzuhalten hat.«
Frau Sidonie machte sich die reiche Ernte ihres Bruders zu Nutze, um sich von ihm zehntausend Francs zu borgen, mit welchen sie sich auf zwei Monate nach London begab. Als sie zurückkehrte, besaß sie keinen Sou mehr und man konnte niemals erfahren, wo die zehntausend Francs hingerathen.
»Solche Dinge kosten Geld,« gab sie zur Antwort, wenn man sie befragte. »Ich habe sämmtliche Bibliotheken durchstöbert und hatte drei Sekretäre bei meinen Nachforschungen.«
Und wenn man sie fragte, ob sie bezüglich ihrer drei Milliarden endlich sichere Anhaltspunkte gefunden, lächelte sie vorerst geheimnißvoll, um dann hinzuzufügen:
»Ihr seid lauter Ungläubige ... Ich habe nichts gefunden, doch das thut nichts ... Ihr werdet noch eines Tages Augen machen.«
Dessenungeachtet hatte sie ihre Zeit in England nicht verloren. Ihr Bruder, der Minister, machte sich ihre Reise zu Nutze, um ihr einen schwierigen Auftrag anzuvertrauen. Als sie zurückkehrte, erhielt sie bedeutende Bestellungen vom Ministerium. Sie schloß Verträge mit der Regierung und übernahm alle möglichen Lieferungen. Sie lieferte ihr Lebensmittel und Waffen für das Heer, die Einrichtungen für die öffentlichen Aemter und Gerichtsstellen, Heizmaterial für die Museen und Lehranstalten. Das Geld, welches sie erwarb, vermochte sie nicht zu bestimmen, ihre ewigen schwarzen Kleider abzulegen und sie behielt ihr gelbes, trauriges Gesicht bei. Saccard sagte sich, daß sie es doch gewesen sei, die er einst flüchtig aus dem Hause seines Bruders Eugen kommen gesehen. Sie hatte wohl während der ganzen Zeit in geheimer Verbindung mit ihm gestanden, – doch wußte Niemand, zu welchem Behufe.
Inmitten all' dieser Umtriebe, all' dieses unbefriedigten Haschens und Jagens nach Geld, führte Renée ein jammervolles Dasein. Tante Elisabeth war gestorben und ihre Schwester hatte nach ihrer Verheirathung das Hôtel Beraud verlassen, in welchem ihr Vater allein zurückblieb. In drei Monaten hatte sie das Erbtheil ihrer Tante vergeudet. Sie huldigte nunmehr dem Spiele. Sie hatte einen Salon gefunden, in welchem Damen bis drei Uhr Morgens am grünen Tische saßen und in einer Nacht hunderttausends Francs verloren. Sie versuchte zu trinken; dies brachte sie indessen nicht zu Stande, da sie einen unüberwindlichen Abscheu vor geistigen Getränken hatte. Seitdem sie allein und der Hochfluth der gesellschaftlichen Zerstreuungen preisgegeben war, überließ sie sich rückhaltslos den tollsten Einfällen, da sie nicht wußte, womit sie die Zeit tödten solle. Schließlich kostete sie von Allem und nichts vermochte sie zu fesseln, inmitten der entsetzlichen Langeweile, welche auf ihr lastete. Sie alterte vor der Zeit, blaue Ringe legten sich um ihre Augen und tiefe Falten um ihren Mund. Sie versinnbildlichte das Ende einer Frau.
Als Maxime Luise geheirathet hatte und die jungen Leute nach Italien gegangen waren, kümmerte Renée sich nicht mehr um ihren Geliebten, ja sie schien ihn sogar gänzlich vergessen zu haben. Und als Maxime sechs Monate später allein, ohne »die Buckelige« zurückkehrte, die er in dem Friedhofe eines kleinen, lombardischen Städtchens zurückgelassen, legte sie ihm gegenüber deutlichen Haß an den Tag. Sie erinnerte sich an »Phädra« und gedachte zweifellos jener vergifteten Liebe, welche die Ristori zur Darstellung gebracht. Und um den jungen Mann nicht mehr in ihrem Hause zu sehen, um für alle Zeiten einen Abgrund der Schmach und der Schande zwischen Vater und Sohn zu schaffen, zwang sie ihren Gatten von der Blutschande zu erfahren, erzählte sie ihm, daß Maxime ihr seit langer Zeit nachgestellt und an dem Tage, da Saccard sie mit ihm überraschte, ihr Gewalt habe anthun wollen. Saccard war im höchsten Grade aufgebracht über die Hartnäckigkeit, mit welcher sie ihm die Augen öffnete. Er war gezwungen, mit seinem Sohne zu brechen, jeden Verkehr mit ihm einzustellen. Nun bezog der junge Wittwer, den die Mitgift seiner Frau zu einem reichen Mann gemacht, ein kleines Hôtel in der Avenue de l'Impèratrice. Er hatte auf sein Amt im Staatsrath verzichtet und hielt einen Rennstall. Dies bildete den letzten Triumph Renée's. Sie hatte sich gerächt und den beiden Männern die eigene Infamie ins Gesicht geschleudert; sie sagte sich, daß dieselben nicht mehr über sie spotten werden, während sie wie zwei Kameraden mit einander verkehren würden.
Als Renée von allen Personen, denen ihre Zärtlichkeit gegolten, verlassen war, trat ein Zeitpunkt ein, in welchem sie nur mehr ihre Kammerdienerin liebte. Allmälig faßte sie eine mütterliche Zuneigung für Céleste. Vielleicht rief ihr die Gegenwart dieses Mädchens, das allein von der Liebe Maxime's in ihrer Nähe zurückgeblieben, die für immer entschwundenen Stunden des Glückes ins Gedächtniß zurück. Vielleicht auch war sie nur gerührt durch die Treue dieser Dienerin, dieses wackeren Herzens, dessen ruhige Anhänglichkeit nichts zu erschüttern vermochte. Von Gewissensbissen gequält, dankte sie ihr dafür, daß sie trotz aller Schmach bei ihr ausharrte und sich nicht von Abscheu erfüllt, von ihr wendete; sie bildete sich ein, es bedürfe eines ganzen entsagungsvollen Lebens, um die Ruhe der Kammerdienerin angesichts der Blutschande, ihre eisigen Hände, ihre stille, achtungsvolle Dienstfertigkeit richtig würdigen zu können. Und die Ergebenheit ihrer Magd machte sie umso glücklicher, als sie wußte, daß dieselbe rechtschaffen und sparsam sei, weder ein Laster noch einen Liebhaber besitze.
Zuweilen, wenn die Traurigkeit sie übermannte, sagte sie:
»Du wirst mir die Augen zudrücken, meine Tochter.«
Céleste gab keine Antwort, sondern lächelte nur so eigenthümlich. Und eines Morgens theilte sie ihrer Herrin ruhig mit, daß sie den Dienst verlassen und in ihre Heimath zurückkehren werde. Renée war wie niedergeschmettert, als wäre ihr ein großes Unglück zugestoßen. Sie versprach und bestürmte die Dienerin mit Fragen. Weshalb ging sie von ihr, nachdem sie so gut mit einander auskamen? Sie wollte ihren Lohn verdoppeln.
Die Zofe aber hatte auf alle guten, freundlichen Worte nur ein Kopfschütteln zur Antwort.
»Und wenn Sie mir alle Schätze der Welt anböten, gnädige Frau,« erwiderte sie schließlich, »so bliebe ich keine Woche länger. Sie kennen mich eben nicht. Seit acht Jahren bin ich in Ihren Diensten, nicht wahr? Am ersten Tage sagte ich mir bereits, daß ich an dem Tage in meine Heimath zurückkehren werde, da ich mir fünftausend Francs erspart haben werde; ich würde ein Haus in Lagache ankaufen und dort ruhig und glücklich leben ... Dieses Gelübde, welches ich mir selbst gethan, will ich nun erfüllen. Und seit gestern habe ich mit meinem Lohne, den Sie mir ausbezahlten, die fünftausend Francs beisammen.«
Ein kalter Schauer beschlich Renée's Herz. Sie sah Céleste hinter sich und Maxime, während sie einander umschlungen hielten; sie sah sie mit ihrer Gleichgiltigkeit, ihrer unerschütterlichen Ruhe, während sie an ihre fünftausend Francs dachte. Dessenungeachtet versuchte sie sie zurückzuhalten, entsetzt bei dem Gedanken an die Leere, in welcher sie fortan leben sollte und trotz Allem bemüht, diese halsstarrige Person, die sie für ergeben gehalten und die nur eigennützig gewesen, an sich zu fesseln. Die aber schüttelte lächelnd den Kopf und erwiderte:
»Nein, nein, das ist nicht möglich ... Ich würde damit meine Mutter von mir weisen. Ich werde zwei Kühe kaufen und vielleicht sogar einen kleinen Kramhandel beginnen ... Bei uns ist's sehr hübsch und darum möchte ich, daß Sie einmal zu uns kämen. Wir wohnen in der Nähe von Caën und ich werde Ihnen die Adresse sagen.«
Nun drang Renée nicht weiter in sie. Allein geblieben weinte sie heiße Thränen und am nächsten Tage wollte sie aus krankhafter Laune Céleste in ihrem eigenen Wagen nach dem West-Bahnhofe bringen. Sie überließ ihr eine ihrer Reisedecken, machte ihr ein Geldgeschenk und war um sie bemüht wie eine Mutter, deren Tochter eine gefährliche und langwierige Reise unternimmt. Im Wagen hielt sie die feuchten Augen fortwährend auf sie gerichtet und Céleste plauderte, berichtete, wie sehr sie sich darüber freue, daß sie nunmehr nach Hause gehen könne. Kühner werdend, sprach sie mit weniger Zurückhaltung; ja, sie ertheilte ihrer Gebieterin sogar Ratschläge.
»Ich, gnädige Frau, hätte das Leben nicht so aufgefaßt wie Sie. Gar oft fragte ich mich im Stillen, wenn ich Sie mit Herrn Maxime sah: Mein Gott, wie kann man nur der Männer wegen so dumm sein ... Das hat immer ein schlimmes Ende... Ja, ich war immer so mißtrauisch!...«
Sie lachte und lehnte sich in die Kissen zurück.
»Meine blanken Thaler hätten es zu bereuen gehabt!« fuhr sie fort; »und heute könnte ich mir die Augen aus dem Kopfe weinen. Darum auch ballte ich stets beide Fäuste, wenn sich mir ein Mann näherte ... Ich getraute mich niemals es Ihnen zu sagen; außerdem ging mich die Sache ja nichts an. Sie waren vollkommen frei und ich hatte mich blos darum zu kümmern, mein Geld auf rechtschaffene Weise zu erwerben.«
Auf dem Bahnhofe angelangt wollte Renée für sie zahlen und löste eine Karte erster Klasse. Da sie etwas zu früh gekommen waren, nahm sie Céleste beiseite, drückte ihre Hände und wiederholte immer wieder:
»Geben Sie Acht auf sich, pflegen Sie sich, meine gute Céleste.«
Diese duldete schweigend die Liebkosungen und angesichts der thränenüberströmten Augen ihrer Gebieterin schien sie glücklich und heiter. Renée sprach von der Vergangenheit, als die Andere mit einem Male sagte:
»Ich habe ganz vergessen; ich erzählte Ihnen nicht die Geschichte von Baptiste, dem Kammerdiener des Herrn, wie? ... Man wollte Ihnen gewiß nichts sagen ...«
Die junge Frau gestand, daß sie wirklich nichts wisse.
»Sie erinnern sich doch seiner würdevollen Miene, seiner verächtlichen Blicke, von denen Sie selbst einmal sprachen. ... Nun, das Ganze war nichts als Komödie ... Er liebte die Frauen nicht, kam niemals ins Gesindezimmer, wenn wir dort waren und er behauptete sogar, – heute kann ich es Ihnen schon sagen – es sei zu ekelhaft im Salon mit den vielen ausgeschnittenen Kleidern der Damen. Ich will's gerne glauben, daß er die Frauen nicht leiden mochte!«
Damit neigte sie sich an das Ohr Renée's und während diese bei den Worten, die sie ihr zuflüsterte, tief erröthete, behielt sie selbst ihre rechtschaffene, ruhige Miene bei.
»Als der neue Stallknecht,« fuhr sie darauf fort, »dem Herrn Alles mitgetheilt hatte, zog es der Herr vor, Baptiste zu entlassen, statt ihn der Behörde zu übergeben. Es scheint, daß diese gräßlichen Dinge schon seit Jahren in den Ställen getrieben wurden ... Und dabei gab sich der Bengel den Anschein, als liebte er die Pferde! Ja, Possen! Die Stallburschen liebte er, nicht die Pferde.«
Das Läuten der Glocke unterbrach sie. Schnell raffte sie die verschiedenen Bündel zusammen, von denen sie sich nicht trennen wollte, ließ sich küssen und schritt davon, ohne sich umzuwenden.
Renée blieb im Bahnhofe, bis der Pfiff der Lokomotive ertönte. Und als der Zug davonrollte, wußte sie in ihrer Verzweiflung nicht, was sie thun sollte; die nun folgenden Tage dehnten sich vor ihr aus, endlos und leer wie dieser große Saal, in welchem sie allein zurückgeblieben. Sie stieg wieder in ihren Wagen und befahl dem Kutscher, nach Hause zu fahren. Doch unterwegs besann sie sich; sie fürchtete sich vor ihrem Zimmer, vor der Langeweile, die ihrer harrte und sie fühlte nicht einmal den Muth in sich, nach Hause zu gehen und die Toilette zu ihrer gewohnten Fahrt ins Bois zu wechseln. Sie empfand das Bedürfniß nach Menschen und Sonnenschein.
Sie befahl dem Kutscher, ins Bois zu fahren.
Es war vier Uhr und das Bois erwachte aus seiner dumpfen Nachmittagsruhe. Längs der Avenue de l'Impératrice stiegen Staubwolken auf und man sah von Weitem die grünen Flächen, welche die Abhänge von Saint-Cloud und Suresnes bezeichneten, darüber hinaus die grauen Umrisse des Mont-Valerien. Die Sonne stand hoch am Himmel und erfüllte die Luft mit einem goldenen Staubschleier, verwandelte dieses Meer von grünem Laubwerk in ein Meer von Licht. Doch in der zum Teich führenden Allee war gespritzt worden; die Wagenräder rollten über den gebräunten Boden wie über weiches Moos, während der Geruch der feuchten Erde zu beiden Seiten emporstieg. Rechts und links reckten die Bäume und Sträucher ihre frischen Triebe empor, die in ein grünliches Licht getaucht waren, welches stellenweise von goldgelben Flecken unterbrochen ward. In dem Maße, als man dem Teiche näher kam, vermehrten sich die Stühle des Trottoirs und die Familien, welche dieselben besetzt hielten, betrachteten mit ruhiger, stiller Miene die endlose Reihe der Wagen. An der Wegkreuzung vor dem Teiche angelangt wurde man völlig geblendet; die schräge stehende Sonne hatte die große Wasserfläche in einen einzigen silbernen Spiegel verwandelt, welcher das flimmernde Abbild des strahlenden Gestirns zurückwarf. Die Augenlider blinzelten und man nahm links vom Ufer nichts weiter aus als den dunkeln Fleck der Barke. Die Sonnenschirme neigten sich in sanfter, gleichmäßiger Bewegung gegen diesen Glanz und wurden erst in der Allee wieder in die Höhe gehoben. Zur Rechten erstreckten sich die Reihen der Nadelhölzer, welche die Sonnenstrahlen leicht violett färbten; links breiteten sich die Rasenflächen, die in Licht gebadet, Smaragdfeldern glichen, bis zur Porte de la Muette aus. Und wenn man dem Springbrunnen nahe kam, sah man auf der einen Seite das Halbdunkel der Gebüsche neu beginnen, während sich auf der anderen, jenseits des Teiches, die Inseln in der blauen Luft badeten und die dunkeln Schatten ihrer Tannen sich scharf abhoben. Das in diesen Schatten ruhende kleine Schlößchen glich einem Spielzeug, welches ein Kind am Saume eines Waldes verloren hat. Das ganze Gehölz lachte und erschauerte in den warmen Sonnenstrahlen.
Renée schämte sich an diesem herrlichen Tage ihres Wagens, ihres flohfarbenen Seidenkleides. Sie lehnte sich in die Kissen zurück und betrachtete durch die herabgelassenen Fenster das Spiel des Lichtes auf der Wasserfläche und dem grünen Laub. Wo die Allee eine Biegung machte, erblickte sie eine lange Räderreihe, die sich gleich glitzerndem Golde in dem blendenden Lichte drehte. Die glänzenden Wagen, das Schimmern der Stahl- und Messinggeräthschaften, die hellen Farben der Toiletten wechselten bei dem regelmäßigen Gange der Pferde unablässig, während sich das Ganze in den vom Himmel fallenden Lichtstrahlen wie eine lebende, dunkle Masse von dem Hintergrunde des Bois abhob. Und in diesem blendenden Schimmer unterschied die junge Frau mit halb geschlossenen Augen zeitweilig den blonden Chignon eines Frauenkopfes, den schwarzen Rücken eines Lakaien, das weiße Geschirr eines Pferdes. Die gewässerten Stoffe der Sonnenschirme funkelten dabei gleich Monden aus Metall.
Angesichts dieses hellen Tages, dieser blendenden Sonnenstrahlen gedachte sie der grauen Dämmerung, welche sie eines Abends über das vergilbte Laub hatte sich herabsenken gesehen. Maxime begleitete sie damals. Es war zu jener Zeit, da das Verlangen, dieses Kind zu besitzen, in ihr wach zu werden begonnen. Und sie sah die vom Abendthau durchfeuchteten Rasenplätze, die dunklen Hecken, die verlassenen Baumgänge wieder vor sich. Mit einem traurigen Geräusch rollten die Wagen an den leeren Stühlen vorüber, während das Rollen der Räder, das Getrabe der Pferdehufe heute wie Triumphfanfaren klang. Und sie erinnerte sich an jede ihrer Fahrten ins Bois. Sie hatte daselbst gelebt, Maxime war hier, neben ihr, auf den Kissen des Wagens aufgewachsen. Dies war ihr Garten gewesen. Hier überraschte sie der Regen, hierher lockte sie die Sonne zurück und nicht einmal die Nacht vermochte sie immer daraus zu verscheuchen. Hier lustwandelten sie bei jedem Wetter, hier genossen sie die Freuden und auch die Unannehmlichkeiten ihres Lebens. In der Leere ihres Wesens, in der Melancholie, in die sie die Abreise Céleste's versetzt, bereiteten diese Erinnerungen ihr eine herbe Freude. Ihr Herz sprach: Niemals wieder! niemals wieder! Und sie selbst erstarrte förmlich zu Eis, als sie das Bild dieser Winterlandschaft, dieses spiegelglatten, gefrorenen Teiches vor sich auftauchen sah, auf welchem sie mit ihm Schlittschuhe gelaufen; der Himmel war schwarz wie Ruß, der Schnee hing weißen Spitzen gleichend an den Zweigen und die scharfe Lüfte wehte ihnen feinen Sand in Mund und Augen.
Zur Linken, auf dem für die Reiter reservirten Wege, hatte sie indessen den Herzog von Rozan, Herrn von Mussy und Herrn von Saffré erkannt. Larsonneau hatte die Mutter des Herzogs getödtet, als er ihr am Verfallstage die von ihrem Sohne unterfertigten Wechsel über hundertfünfzigtausend Francs vorlegte und nun vergeudete der Herzog seine zweite halbe Million mit Blanche Müller, nachdem er die ersten fünfhunderttausend Francs in den Händen der Aurigny zurückgelassen. Herr von Mussy, der die englische Gesandtschaft verlassen hatte, um bei der italienischen Dienste zu nehmen, war wieder der galante Kavalier von ehedem geworden, der einen Kotillon mit vollendeter Anmuth anzuführen verstand. Und was Herrn von Saffré betraf, so blieb er der skeptische und liebenswürdigste Lebemann von der Welt. Renée sah gerade, wie er sein Pferd nach dem Wagen der Gräfin Vanska lenkte, in die er, wie man behauptete, rasend verliebt war seit dem Tage, da er sie als Koralle bei den Saccards gesehen.
Auch die Damen waren wieder vollzählig da: die Herzogin von Sternich in ihrem ewigen Landauer; Frau von Lauwerens mit der Baronin von Meinhold und der kleinen Frau Daste in einem Wagen, Frau Teissiére und Frau von Guende in einer leichten Viktoria. Inmitten dieser Damen lagen Sylvia und Laura d'Aurigny in den Kissen einer herrlichen Equipage. Auch Frau Michelin fuhr in einem Coupé; die niedliche kleine Frau hatte Herrn Hupel de la Noue in dem Hauptorte seines Departements aufgesucht und bei ihrer Rückkehr war sie im Bois in diesem Coupé erschienen, welchem sie binnen kurzer Zeit einen offenen Wagen hinzufügen zu können hoffte. Renée entdeckte auch die beiden Unzertrennlichen: die Marquise d'Espanet und Frau Haffner, die unter ihren Sonnenschirmen verborgen, neben einander lehnten und sich zärtlich lächelnd in die Augen blickten.
Darauf kamen die Herren vorüber: Herr von Chibray in eleganter Kalesche, Herr Simpson im Dog-Car, darauf die Herren Mignon und Charrier, die trotz ihrer Behauptung, sich zur Ruhe setzen zu wollen, ihren Geschäften eifriger denn je nachgingen und ihren Wagen am Beginn der Allee zurückgelassen hatten, um zu Fuße ein Stück Weges zurückzulegen; Herr von Mareuil, der noch Trauer um seine Tochter trug und sorgfältig die ihm von allen Seiten werdenden und seinem ersten Zwischenruf in der Kammer geltenden Grüße erwiderte, im Wagen des Herrn Toutin-Laroche, der den Crédit Viticole wieder einmal gerettet hatte, nachdem er ihn hart an den Rand des Verderbens gebracht, und der im Senat immer magerer und ehrwürdiger wurde.
Und gleichsam als Abschluß des Ganzen, als größte Zierde der langen Reihe erschien der Baron Gouraud, der in den doppelten Kissen seines Wagens ruhend, sich an den warmen Sonnenstrahlen erfreute. Zu ihrer Verwunderung, in die sich ein Gefühl des Ekels mengte, erkannte Renée neben dem Kutscher das weiße Gesicht, die feierliche Miene Baptiste's. Der würdige Mann war in die Dienste des Barons getreten.
Immer noch glitten die Dickichte vorüber, das Wasser des Teiches glitzerte in den immer schiefer werdenden Sonnenstrahlen, die lange Reihe der Wagen warf hüpfende Schatten auf den Boden. Die junge Frau, die sich dem Zauber des herrlichen Tages nicht zu entziehen vermochte, war sich all' der Begierden bewußt, die sich da im Sonnenschein ergingen. Sie empfand keine Entrüstung gegen diese Leute, die den Genüssen des Lebens nachjagten. Doch haßte sie dieselben der Genugthuung, des Triumphes wegen, welchen ihre Mienen im goldenen Lichte des Himmels zur Schau trugen. Sie Alle sahen so schön, so lächelnd aus: weiß und wohlgenährt boten sich die Frauen den Blicken dar und die Männer blickten lebhaft, bewegten sich mit den anmuthigen Geberden glücklicher Liebhaber. Sie aber empfand in der Tiefe ihres leeren Herzens nichts mehr als eine Mattigkeit, ein dumpfes Verlangen. War sie denn besser als die Anderen, daß sie unter der Wucht der Vergnügungen derart zusammenbrach? oder verdienten die Anderen Lob, weil ihr Leib widerstandsfähiger war als der ihrige? Sie vermochte es nicht zu sagen, sie wünschte neue Begierden zu empfinden, um das Leben neu zu beginnen, als ihr bei einer Wendung des Kopfes auf dem sich längs der Hecke hinziehenden Fußwege ein Anblick zutheil wurde, der ihr den letzten niederschmetternden Schlag versetzte.
Arm in Arm schritten Saccard und Maxime langsam dahin. Der Vater hatte dem Sohne offenbar einen Besuch gemacht und darauf waren Beide über die Avenue de l'Impératrice plaudernd bis zum Teich gegangen.
»Du bist ein Narr«, sagte Saccard; »verstehe mich doch recht. Wenn man Geld hat wie Du, so läßt man es nicht todt liegen. In dem Unternehmen, von welchem ich mit Dir gesprochen, sind hundert Perzent zu verdienen. Das ist eine ganz sichere Anlage und Du weißt sehr gut, daß ich Dich um keinen Preis zu Schaden bringen möchte.«
Den jungen Mann aber schien dieses Drängen zu langweilen. Er lächelte mit seiner hübschen Larve und betrachtete die Wagen.
»Sieh' doch die kleine Frau dort unten, die in violetter Toilette«, sagte er mit einem Male. »Es ist eine Wäscherin, welche dieser blöde Mussy in die Mode gebracht hat.«
Sie betrachteten die Frau in violetter Toilette, worauf Saccard eine Zigarre aus der Tasche zog und sich mit den Worten zu Maxime wandte, dessen Zigarre bereits brannte:
»Gib mir Feuer.«
Nun blieben sie Gesicht zu Gesicht geneigt einen Augenblick stehen. Und als die Zigarre angezündet worden, ergriff der Vater neuerdings den Arm des Sohnes und fuhr fort:
»Du wärest nicht recht gescheidt, wenn Du nicht auf mich hören wolltest. Also abgemacht? Du bringst mir morgen die hunderttausend Francs?«
»Du weißt doch, daß ich Dein Haus nicht mehr betrete,« erwiderte Maxime und preßte die Lippen zusammen.
»Ach, was, Unsinn! Das muß doch einmal ein Ende nehmen!«
Sie schritten einige Minuten schweigend dahin und während Renée, die sich einer Ohnmacht nahe fühlte, den Kopf in die Kissen des Coupe's lehnte, um nicht gesehen zu werden, entstand eine Bewegung, welche sich der ganzen Wagenlinie mittheilte. Auf den Trottoirs blieben die Fußgänger stehen, wandten sich um und betrachteten offenen Mundes etwas, was allmälig näher kam. Rascher rollten die Räder, die Equipagen fuhren ehrfurchtsvoll zur Seite und zwei grün gekleidete Vorreiter erschienen, von deren runden Mützen goldene Eicheln herunterhingen. Sie saßen etwas vornüber gebeugt auf ihren rasch trabenden Füchsen. Hinter ihnen kam der Wagen des Kaisers.
Dieser nahm den Rückensitz seines Landauers allein ein. Er war ganz in Schwarz gekleidet, sein Leibrock bis ans Kinn zugeknöpft und sein hoher, etwas seitwärts sitzender Seidenhut glänzte im Sonnenlicht. Ihm gegenüber saßen zwei Herren in der tadellosen Eleganz, die in den Tuilerien gebräuchlich war, die Hände auf den Knieen, mit der ernsten, würdevollen Miene zweier Hochzeitsgäste, die inmitten der neugierigen Menge ihre Rundfahrt machen.
Renée fand den Kaiser sehr gealtert. Unter dem dichten, aufgewirbelten Schnurrbart schien der Mund noch weicher geworden und die Lider schienen so schwer, daß sie das halb erloschene Auge, dessen graugelbe Pupille immer trüber ward, fast ganz verdeckte. Nur die Nase ragte noch immer scharf und entschieden aus dem verschwommenen Gesicht hervor.
Während die in den Wagen sitzenden Damen leise lächelten, deuteten die Fußgänger mit den Fingern auf den Monarchen. Ein dicker Mann versicherte, der links mit dem Rücken zum Kutscher sitzende Herr sei der Kaiser. Einige Hände hoben sich zum Gruße. Saccard aber, der seinen Hut abgenommen hatte, bevor noch die Vorreiter passirt waren, wartete, bis sich der kaiserliche Wagen gerade ihm gegenüber befand, worauf er mit seiner derben, weithallenden Stimme rief:
»Es lebe der Kaiser!«
Erstaunt wandte sich der Monarch zurück und erkannte zweifellos den Enthusiasten, denn er erwiderte lächelnd den Gruß. Und damit verschwand Alles im glänzenden Sonnenschein, die Reihen der Equipagen flossen wieder zusammen und Renée erblickte über den Köpfen der Pferde, zwischen den Rücken der Lakaien nur mehr die grünen Kappen der Vorreiter, deren goldene Eicheln auf- und niederhüpften.
Einen Moment verharrte sie mit weit geöffneten Augen, ganz erfüllt von dieser Erscheinung, die ihr eine andere Stunde ihres Lebens in Erinnerung brachte. Es schien ihr, als hätte der Kaiser, indem er sich unter die übrigen Wagen mengte, der langen Reihe den letzten nothwendigen Glanz und dem Siegesdefilé einigen Sinn verliehen. Dies war jetzt ein förmlicher Triumph. Alle diese Räder, diese dekorirten Männer, diese schmachtend hingegossenen Frauen folgten dem Glanz und den Räderspuren des kaiserlichen Wagens. Dieses Gefühl trat so scharf und schmerzlich auf, daß die junge Frau das gebieterische Bedürfniß empfand, diesem Triumph den Rücken zu wenden, diesen Ruf Saccard's, der ihr noch in den Ohren tönte, zu vergessen, diesen Anblick des Vaters und Sohnes, die Arm in Arm langsam dahinschritten, zu fliehen. Die Hände auf die Brust gedrückt, als empfände sie dort ein innerliches Brennen, dachte sie nach und mit einer plötzlich erwachenden Hoffnung, Erleichterung und Beruhigung zu finden, neigte sie sich vor und rief dem Kutscher zu:
»Nach dem Hotel Béraud!«
Der Hof hatte sein düsteres Klosteraussehen bewahrt. Renée schritt durch die Arkaden, ganz glücklich über die Feuchtigkeit, die sich auf ihre Schultern senkte. Sie näherte sich dem moosbedeckten Trog, dessen Ränder durch den Gebrauch abgenützt waren, betrachtete den halb verwitterten Löwenkopf mit dem halb geöffneten Rachen, aus welchem durch ein eisernes Rohr ein Wasserstrahl rann. Wie oft hatten Christine und sie die dünnen Arme um diesen Kopf geschlungen, um den dünnen Wasserstrahl aufzufangen, dessen eisiges Geriesel sie so gerne auf ihren kleinen Händen verspürten! Darauf stieg sie die große, stille Treppe empor. Sie sah ihren Vater in der Tiefe der weiten Räume; er richtete seine hohe Gestalt empor und verschwand langsam in dem Schatten dieses alten Hauses, in dieser feierlichen Einsamkeit, welche er seit dem Tode seiner Schwester nicht mehr verließ und sie dachte an die Männer, die sie im Bois gesehen, an diesen anderen Greis, den Baron Gouraud, der seinen zwischen zwei Kissen gebetteten morschen Leib von den Sonnenstrahlen erwärmen ließ. Sie stieg noch höher, über die Dienertreppe, schritt die hallenden Korridore entlang, dem Kinderzimmer zu. Oben angelangt fand sie den Schlüssel am gewohnten Nagel, einen großen, verrosteten Schlüssel, in dessen Griff sich Spinnen häuslich niedergelassen. Das Schloß gab einen klagenden Laut von sich. Wie traurig war dieses Kinderzimmer! Das Herz krampfte sich ihr zusammen, als sie dasselbe so leer, so grau, so still wiedersah. Sie verschloß die offen gebliebene Thür des Vogelkäfigs von der unbestimmten Empfindung geleitet, daß die Freuden ihrer Kindheit durch diese Thür entflattert sein mochten. Vor den noch mit verhärteter, geborstener Erde gefüllten Blumentöpfen blieb sie stehen; ihre Finger zerbröckelten unbewußt einen vertrockneten Rhododendronzweig, – dieses Skelett von einer Pflanze, verdorrt und von Staub bedeckt, war Alles, was von den blühenden Blumenkörben zurückgeblieben. Und auch die Matte, die ihre Farbe verloren und von den Ratten zernagt worden, bedeckte noch den Boden, melancholisch wie ein Leichentuch, das seit Jahren des versprochenen Leichnams harrt. In einer Ecke fand sie inmitten dieser stummen Verzweiflung, dieser grenzenlosen Verlassenheit, eine ihrer alten Puppen wieder; die ganze Kleie war durch ein Loch ausgeronnen und der Porzellankopf lächelte dessenungeachtet noch immer mit seinen Emaillippen auf diesem zusammengeschrumpften Leib, welchen Puppen-Thorheiten erschöpft zu haben schienen. Renée erstickte fast in dieser verdorbenen Atmosphäre ihrer ersten Jugend, Sie öffnete das Fenster und blickte in die endlose Landschaft hinaus. Hier war nichts beschmutzt worden; sie fand die ewigen Freuden, die ewige Jugend der freien Luft wie ehedem vor. Hinter ihr sank die Sonne allmälig tiefer und sie sah nur die Strahlen des schwindenden Gestirns mit unendlicher Zartheit diesen Theil der Stadt vergolden, welchen sie so gut kannte. Es war wie ein letzter Gesang des Tages, ein Refrain der Heiterkeit, der sich schlummernd über das ganze All herniedersenkte. Unten lag der Kohlenabladeplatz in flimmerndem Lichte, während bei der Constantine-Brücke das schwarze Spitzenwerk der eisernen Bögen und Balken sich scharf von den weißen Pfeilern abhob. Zur Linken breiteten sich die Schatten der Weinhalle und des Jardin des Plantes gleich einem regungslosen Meere aus, dessen grüne Oberfläche sich in dem beginnenden Dunkel zu versenken anschickte. Links waren der Quai Henri Quatre und der Quai de la Rapée mit denselben Häusern sichtbar, welche die beiden Schwestern schon vor zwanzig Jahren gesehen, mit denselben braunen Wagenremisen und röthlich schimmernden Schornsteinen. Und die Bäume überragend erschien ihr das schieferbedeckte, im Glanze der scheidenden Sonne bläulich schimmernde Dach der Salpêtrière mit einem Male wie ein alter Freund. Was sie aber gewissermaßen beruhigte, ihre Brust mit einiger Frische erfüllte, das waren die langgedehnten, grauen, steilen Ufer, das war in erster Linie die Seine, die Riesin, die sie vom Rande des Horizonts gerade auf sich zueilen sah, ganz wie zu jener glücklichen Zeit, da sie gefürchtet, der Fluß könnte immer größer werden und bis zu ihrem Fenster emporsteigen. Sie erinnerte sich, wie sehr Christine und sie diesen Fluß geliebt, wie sie von einem Schauer vor diesem grollenden Wasser erfaßt worden, welches sich zu ihren Füßen ausbreitete und sich hinter ihnen in zwei Arme theilte, welche sie nicht mehr sahen, deren große, reine Liebkosung sie jedoch deutlich empfanden. Sie waren schon damals kokett und sagten, die Seine habe ihr schönes Kleid aus grüner, weißgeflammter Seide angelegt, welches bei den Strömungen, wo sich das Wasser kräuselte, mit Rüchen besetzt schien, während über den Gürtel der Brücke hinaus das helle Tageslicht sonnenfarbenes Zeug über den glatten Spiegel breitete.
Und indem Renée die Augen emporhob, betrachtete sie den unendlichen Himmel, welcher sich blau und rein über ihr wölbte, in der herannahenden Dämmerung aber schon ein wenig dunkler anzusehen war. Sie gedachte der mitschuldigen Stadt, der hell beleuchteten Boulevards, der heißen Nachmittage im Bois, – und als sie den Kopf sinken ließ, sah sie mit einem Schlag das friedliche Bild ihrer Kindheit, diesen Winkel arbeitsamer Thätigkeit vor sich, in welchem sie von einem friedlichen, ruhigen Leben geträumt. Maßlos quoll die Bitterkeit in ihrem Herzen empor und die Hände faltend schluchzte sie in die sinkende Nacht hinaus.
Als Renée im darauffolgenden Winter an vorgeschrittener Hirnhautentzündung starb, wurden ihre Schulden von ihrem Vater bezahlt. Die Rechnung bei Worms allein belief sich auf zweihundertsiebenundfünfzigtausend Francs.