
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
(Essay)
Ich bin mir immer bewußt gewesen, daß es am Gesang etwas gab, was mir mißfiel, und ich hasse Druck und Papier von Natur aus; jetzt aber weiß ich endlich warum, denn ich habe etwas Besseres gefunden. Ich habe soeben ein Gedicht rezitieren hören, mit einem so feinen Gefühl für seinen Rhythmus und einer so vollkommenen Würdigung seines Sinnes, daß ich, wäre ich weise und könnte ich einige Leute überreden, diese Kunst zu erlernen, niemals wieder ein Buch mit Versen öffnen würde. Eine Freundin, die mich vor einigen Minuten verlassen war dagesessen, ein herrliches Saiteninstrument auf ihren Knien, ihre Finger glitten über die Saiten, und dazu rezitierte sie mir Verse aus Shelleys »Skylark«, Sir Ectors Klage über den toten Lancelot aus »Morte d'Arthur«, und einige meiner eigenen Dichtungen. Wo immer der Rhythmus am feinsten war oder die Erregung am meisten ekstatisch, da war auch die Schönheit ihrer Kunst am größten, und dennoch, obgleich sie manchmal ihre Stimme zu einer schwachen Melodie erhob, war es niemals Gesang, wie wir heutzutage singen, nie war es mehr als ein einfaches Sprechen. Eine einzige gesungene Note, ein Wort, gesungen wie in den Kirchen gesungen wird, würde alles verdorben haben. Es war auch nicht Deklamation, denn sie sprach zu einer Art Noten, die so bestimmt waren wie Gesangsnoten, und dabei gebrauchte sie das Instrument, das mit schwachem und süßem Ton zu den gesprochenen Lauten murmelte und ihr so die wechselnden Noten angab. Andere würden möglicherweise alle diese Wirkungen auch hervorgebracht haben, nur jene nicht, die von ihrer eigenen wundervollen Stimme ausgingen, die sie berühmt gemacht hätte, wenn die einzige Kunst, durch die der Sprechstimme Gelegenheit zu ihren vollkommenen Wirkungen geboten wird, unter uns so wohlbekannt wäre, wie es einst in einer fernen Vergangenheit der Fall gewesen.
Seit meiner Knabenzeit habe ich mich immer darnach gesehnt, Gedichte zur Harfe sprechen zu hören, so wie ich mir dachte, daß Homer die seinigen gesprochen, denn es ist nicht das Natürliche, daß man sich an einer Kunst erfreut, nur wenn man allein ist. Immer hat, wer einen schönen Vers gefunden, das Bedürfnis, ihn jemandem vorzulesen, und es würde viel weniger Mühe machen und viel genußreicher sein, könnten wir alle lauschen, der Freund dem Freund, Geliebtes dem Geliebten. Bilder pflegten vor mir aufzusteigen, wie sie sicherlich jedem für die Dichtkunst Begeisterten erschienen sind, Bilder von Menschen mit wilden Augen, die in Harmonie zu murmelnden Saiten sprachen, während die Zuhörerschaft in vielfarbigen Kleidern lauschte, stille hielt und entzückt war. Wann immer ich jemand von meiner Sehnsucht sprach, wurde mir gesagt, ich solle für Musik schreiben, aber wenn ich dann irgend etwas gesungen hörte, waren es nicht die Worte, die ich hörte, oder wenn ich sie hörte, war ihre natürliche Aussprache und ihre natürliche Musik geändert oder untergegangen in einer anderen Musik, die ich nicht verstand. Was für einen Sinn hatte es, ein Liebeslied zu schreiben, wenn der Sänger Liebe »Li–i–i–i–i–ie–be« aussprach, oder selbst wenn er »Liebe« aussprach, aber dem Worte nicht seine genau richtige Stellung und sein Gewicht im Rhythmus gab? Wie jeder andere Dichter, sprach ich Verse, als ich sie erfand, in einer Art von Kirchengesang, und manchmal, wenn ich allein auf einer Landstraße dahinging, sprach ich sie mit lauter psalmodierender Stimme; und ich habe das Gefühl, ich würde sie auf diese Art auch anderen Leuten vorsprechen, wenn ich den Mut dazu fände. Eines Tages ging ich durch eine Straße von Dublin mit jenem Seher, über den ich in meinem Buche »Im keltischen Dämmerlicht« berichtet habe, und dieser begann nun seine Verse laut herauszusprechen, ganz in dem sicheren Vertrauen jener, die das innere Licht haben. Es war ihm ganz gleichgültig, daß die Leute stehenblieben und ihn sogar von jenseits der Straße her ansahen, er ließ ein Gedicht auf das andere folgen. Gleich mir verstand er nichts von Musik, aber er war sicher, daß er seine Verse zu einer Art von Musik erfunden, und er hatte einst jemanden, der ein eigenartiges Blasinstrument spielte, und später auch einen Geiger gebeten, diese Musik aufzuschreiben und zu spielen. Der Geiger hatte sie gespielt, aber nicht niedergeschrieben, der Bläser hingegen erklärte, sie könne unmöglich gespielt werden, weil sie Vierteltöne enthalte und er diese Töne nicht hervorbringen könne. Von alldem konnten wir nicht überzeugt werden, und eines Tages, als wir mit einem Freund aus Galway, einem geschulten Musiker, zusammen waren, bat ich diesen, er möge unsere Verse und die Art, wie sie gesprochen werden, anhören. Zu seiner Überraschung erfuhr nun der Seher, er habe nicht jedes Gedicht auf einen eigenen Ton gedichtet, und zum Erstaunen des Musikers stellte sich heraus, daß er sie alle zu zwei ganz bestimmten Weisen gemacht hatte, die, wie es scheint, einer sehr einfachen arabischen Musik nahekamen. Vielleicht, so dachte ich mir, war es eine ähnlich geartete Musik, zu der Blake seine »Songs of Innocence« im Salon der Mrs. Williams gesungen, und vielleicht hat auch er eher gesprochen als gesungen. Ich hingegen habe nicht oft, wenn auch manchmal vielleicht zu einer Melodie gedichtet, immer aber zu Noten, die man niederschreiben und auf der Orgel meines Freundes spielen oder aber in eine Art von Gregorianischen Choral formen konnte, wenn man sie in der gewöhnlichen Art sang. Ich variierte mehr als der Seher, der niemals seine beiden Melodien vergaß, eine für die langen, die andere für die kurzen Zeilen, auch war ich nicht imstande, ein Gedicht immer wieder auf die gleiche Art vorzutragen, sondern hatte immer das Gefühl, es gebe besondere Arten, die richtig waren, und daß ich eine jede von ihnen wiederum erkennen würde, wenn ich mich nur der Art und Weise erinnerte, wie ich das Gedicht das erstemal gesprochen hatte. Als ich nach London kam, gab ich die Notierung, wie sie auf der Orgel gespielt worden war, der Freundin, die mich gerade jetzt verlassen; sie hat mir das Gedicht vorgesprochen und durch die Schönheit ihrer Stimme meinen Worten einen neuen Wert verliehen.
Nun begannen wir durch einen Wald von Irrtümern zu wandern. Vermöge des ungünstigen Einflusses, von ich weiß nicht wem, versuchten wir auf die gewöhnliche Art und Weise durch die Musik zu reden, bis wir schließlich anfingen die beiden miteinander wetteifernden Melodien und Rhythmen zu hassen, die so oft unter sich im Streit lagen, die Melodie und der Rhythmus der Verse und die der Musik. Dann versuchten wir auf Veranlassung von jemand, der dachte, Vierteltöne und noch kleinere Intervalle seien das charakteristische Merkmal der Sprache im Gegensatz zum Gesang, einiges in Wellenlinien niederzuschreiben. Als wir etwas Ähnliches wie diese Linien in der tibetanischen Musik entdeckt hatten, wurden wir unserer Sache so sicher, daß wir ein großes Stück Pappe, jetzt dazu bestimmt, mein Kaminfeuer in der Frühe anzufachen, mit einer Notenschrift in Wellenlinien bedeckten, damit es uns zur Demonstration in einer Vorlesung dienlich sei. Schließlich aber führte uns Herr Dolmetsch auf unseren ersten Gedanken zurück. Er fertigte für uns ein schönes Instrument, halb Psalter, halb Lyra, welches, soviel mir bekannt ist, alle chromatischen Intervalle innerhalb des Umfanges der Sprechstimme enthält, und er lehrte uns, unsere Stimmen mit Hilfe der gewöhnlichen Noten zu führen. Einige von diesen Notationen, die er uns gelehrt –jene, in denen keine trällernde Weise vorkommt, kein sich wiederholendes Tongebilde, sind ähnlich geschrieben wie die Notierung eines Liedes aus dem I. Akt von »The Countess Cathleen«. Es ist in dem alten C-Schlüssel notiert, der, wie man mir sagt, dafür am besten geeignet ist, denn es würde unterhalb des Liniensystems fallen, wenn es im Diskant-Schlüssel, und oberhalb, wenn es im Baß-Schlüssel notiert würde. Die Mittellinie des Liniensystems entspricht dem mittleren C des Klavieres, die erste Note des Gedichtes ist also D. Die Zeichen für lang und kurz über den Silben sind nicht Zeichen zum Skandieren, sondern sie bezeichnen die Silben, bei denen man die Stimme beschleunigt oder verweilen läßt.
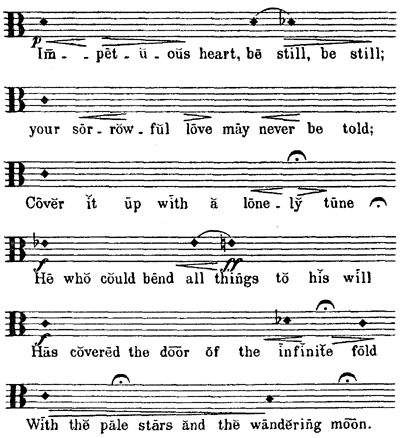
Natürlicherweise braucht man hier eine viel weniger komplizierte Art der Notierung wie für Gesang, und wenn der dramatische Ausdruck es fordert und das Instrument nicht mittönt, sind sogar geringfügige Abänderungen der festgesetzten Noten zulässig. Die Notierung schreibt nur die allgemeine Tonbildung vor und läßt es jedem unbenommen, aus ihrem eigenartigen und nicht mitteilbaren Geist heraus eine Fülle von dramatischem Ausdruck hinzuzufügen, der den Verehrer der Sprache für den Mangel an kompliziertem musikalischen Ausdruck entschädigt. Die gewöhnliche Sprache ist formlos und ihre Mannigfaltigkeit gleicht jener, die schlechte Prosa von der geregelten Sprache Miltons unterscheidet, oder irgend etwas Formloses und Leeres von Formvollendetem und Schönem. Der Redner, der Sprecher, der ein wenig von der großen Tradition seines Handwerks besitzt, unterscheidet sich vom Versammlungsredner sehr wesentlich, weil er es versteht, jene subtile Monotonie der Rede anzunehmen, die wie Feuer durch die Nerven rinnt. Sogar wenn man bloß zu einer einzigen, schwach auf dem Psalter angeschlagenen Note spricht, vorausgesetzt, daß man hinreichend geübt ist, darauf zu sprechen, ohne nachzudenken, kann man eine endlose Mannigfaltigkeit des Ausdrucks herausbringen. Tatsächlich ist alle Kunst eine Monotonie nach außenhin zugunsten einer inneren Fülle, ein Aufopfern grobsinnlicher Effekte zugunsten von subtilen, eine Art Askese der Einbildungskraft. Aber diese neue Kunst, ich meine neu im modernen Leben, wird ihre Zuhörer ebenso wie die Ausübenden erst zu erzielen haben, denn es nimmt Zeit in Anspruch, die groben Effekte, an die man gewohnt ist, glücklich loszuwerden, und es mag wohl sein, daß man im Anfang dort einfache Monotonie findet, wo bald eine Fülle erkennbar wird, so unberechenbar wie die in den Gesichtszügen oder im Ausdruck der Augen. Die moderne Schauspiel- und Deklamationskunst hat uns gelehrt, unsere Aufmerksamkeit den groben Effekten zuzuwenden, bis wir so weit gekommen sind, daß wir Geste und Intonation, die Nachbildung der zufälligen Oberfläche des Lebens, für wichtiger ansehen, als den Rhythmus. Und trotzdem ist uns theoretisch klar, wie es gerade dieser Rhythmus ist, durch den sich Gutgeschriebenes von Schlechtem unterscheidet, und daß er der Glanz, der Duft, der Geist von allem machtvollen Schrifttum ist. Ich sage nicht, wir sollten unsere Schauspiele zu Musiknoten sprechen, denn dramatische Verse werden ihre eigene Methode verlangen, und ich habe bisher allein mit kurzen lyrischen Gedichten Versuche angestellt, aber ich bin ganz sicher: könnten die Leute erst einige Zeit hindurch lyrische Verse zu Noten gesprochen hören, dann fänden sie es bald unmöglich, ohne Entrüstung Verse anzuhören, wie sie jetzt auf unsern führenden Bühnen gesprochen werden. Sie könnten eine Subtilität des Gehörs erwerben, die von den Schauspielern und sogar auch von den öffentlichen Rednern neue Wirkungen forderte, und möglicherweise sogar anfangen, auf ihre eigenen Stimmen zu achten, so daß dadurch die Dichtkunst und der Rhythmus näher an das gewöhnliche Leben herangebracht würden. Ich kann unmöglich sagen, was für Wandlungen diese neue Kunst durchzumachen haben oder wie großen oder geringen Erfolg sie erringen wird, aber ich kann mir ganz wohl kleine Geschichten in Prosa denken, die mit ihren metrischen Dialogen vorzüglich zu dem Saitenklang passen. Ich bin gar nicht sicher, ob sich nicht noch einmal ein Orden nach dem goldenen Veilchen der Troubadours oder ähnlich benennen und unter seinen Mitgliedern nur wohlausgebildete und gut erzogene Sprecher haben wird, die diese edle Kunst vor der Verachtung bewahren. Diese werden wohl wissen, wie sie sich von Gesangstönen und von prosaischer, lebloser Intonation gleichermaßen fernhalten können; sie werden, wie weit sie ihre Versuche auch treiben mögen, sich stets vor Augen halten, daß ihr Ziel die Dichtkunst ist und nicht die Musik; und sie werden, wie die irische »Rotte«, genug Gedichte und Notationen auswendig wissen, um es nicht nötig zu haben, sich über Bücher hinwegzubeugen, zum Schaden des dramatischen Ausdrucks und auf Kosten jenes wilden Gebarens, wie es ein Barde in meinen Knabenphantasien stets haben mußte. Sie werden hier und dort auftauchen, um ihre Verse und ihre kleinen Erzählungen vorzutragen, wo immer sie ein oder zwei Dutzend poetisch fühlender Menschen in einem großen Raum beisammen finden oder ein paar dichterisch veranlagte Freunde am Kamin; und Dichter werden Gedichte für sie schreiben und kleine Geschichten. Ich zum wenigsten beabsichtige darum, alle meine längeren Dichtungen für die Bühne zu schreiben und alle kürzeren für den Psalter, so lange wenigstens, als ein starker Schutzengel mich anhält, meinen Vorsätzen treu zu bleiben.