
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
In der Morgenfrühe kommt der Zug in München an. Die Stadt schläft noch, die Straßen sind fast leer, die Läden geschlossen, nur ab und an fährt schnarchend eine Rollgardine in die Höhe. Ich schlendere die Kaufinger Straße hinunter, am Stachus vorbei. »Zu Hause«, denke ich, »wieder zu Hause!« Aber Heimatgefühl, die warme Vertrautheit mit den Dingen um mich her will sich nicht einstellen. Eine Stadt im Morgendämmern ist so fremd und fern wie ein Mensch im Schlaf.
Ich trete in einen Zigarrenladen und rufe meinen Vater im Büro an. Er ist schon da, trotz der frühen Stunde, er hält darauf, immer der erste zu sein.
»Erni«, sagt er, und ich höre, wie er ein paarmal tief Luft holt, »Erni, du hier?«
Und dann verabreden wir, daß wir Mutter nichts sagen wollen und daß ich ihn aus der Fabrik abholen soll, kurz vor der Mittagspause. Vorher will ich noch zum Arzt gehen.
Es ist unser alter Hausarzt, und er empfängt mich mit dem geräuschvollen Hallo einer ganzen Stammtischrunde. Bei vielen mag das Geschäftskniff sein, ihm kommt dieses Gedröhn aus den Tiefen seines weiten Säuferherzens. Dann untersucht er mich und wird ernst.
»Aus mit der Fliegerei, junger Mann«, sagt er, »das Trommelfell ist hin und das Mittelohr vereitert.«
»Das ist doch nicht möglich« – trotz aller Anstrengung kann ich nicht verhindern, daß meine Stimme vibriert.
»Na«, er klopft mir begütigend auf die Schulter, »vielleicht kann Onkel Doktor das wieder zusammenflicken. Aber besser wär's schon, wir blieben auf dem Lande und nährten uns redlich.«
Der Besuch hat mich niedergedrückt. Auf dem ganzen Weg zu meinem Vater muß ich daran denken. Nicht mehr fliegen – das kann doch nicht sein. Das wäre ebenso, als wenn man mir eine schwarze Brille aufsetzen wollte und mich zeitlebens damit herumlaufen lassen. Dann lieber noch ein paar Jahre die Sonne sehen und danach für immer blind sein. Ich beschließe, die Ratschläge des Medizinmannes nur so lange zu befolgen, wie ich es selbst für gut halte.
Und dann bin ich bei meinem Vater. Sobald ich ins Kontor trete, steht er von seinem Schreibtisch auf und kommt mit großen Schritten auf mich zu.
»Junge, mein lieber Junge!« sagt er und streckt mir beide Hände entgegen.
Einen Augenblick stehen wir uns gegenüber und sehen uns an, dann beginnt er, ein bißchen atemlos, zu sprechen.
Also die erbeutete Winchesterbüchse vom Sergeanten Barlet, die ich ihm geschickt habe, ist ganz tadellos, zweimal ist er damit schon auf den Bock gegangen.
Wie einfach haben es doch die Männer in Frankreich. Sie kennen keine Scheu, und bei einer Begrüßung und beim Abschied umarmen sie sich und bohren sich küssend ihre Bärte in die Gesichter, ganz einerlei, wo sie gehen und stehen. Ich habe das oft auf Bahnhöfen beobachtet.
Wir sitzen uns gegenüber, durch die Breite der Schreibtischplatte getrennt.
»übrigens«, sagte Vater, »ist mir neulich nachts eine Sache eingefallen. Du schriebst davon, daß du den Caudron nicht abschießen konntest, obwohl du bestimmt getroffen hast. Vielleicht war der Apparat gepanzert?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Doch, doch«, fährt er eifriger fort, »du kannst das ja nicht wissen. Und ich habe mir gedacht, daß wir unsere Flugzeuge auch panzern sollten, wenigstens den Führersitz und den Motor. Damit wäre die größte Gefahr für den Piloten beseitigt.«
Ich widerspreche. Für die Artilleriehasen mag das allenfalls möglich sein, für uns Jagdflieger ausgeschlossen. Mit einer so gepanzerten Kiste würde man bestimmt nicht über tausend Meter steigen.
»Das ist doch gleichgültig, die Hauptsache ist ja schließlich das Leben des Fliegers.«
»Aber Papa«, erkläre ich ein bißchen von oben herab, »was für eine Vorstellung hast du von der Fliegerei!«
Der frohe Eifer in seinem Gesicht erlischt. »Ja, ja, du magst schon recht haben«, sagt er müde, und im gleichen Augenblick fühle ich, wie eine Welle von Scham und Reue in mir aufwallt. Wie wenig habe ich ihn verstanden! Die Panzerplatten waren, in seinem Herzen geschmiedet, um mich zu schützen, und ich habe sie unbesehen zum Gerümpel geworfen.
»Bei Krupp sollen sie jetzt allerdings ein neues Leichtmetall ausprobieren, das kugelfest ist«, suche ich den Faden wieder anzuspinnen, aber er winkt ab:
»Na, laß schon, Junge, wir wollen an Mutter telefonieren, daß ich einen Gast mitbringe und sie ein Gedeck mehr auflegen soll.«
Und dann sind wir zu Hause. Vater geht zuerst ins Wohnzimmer. Mutter deckt auf. Ich höre das Klirren der Messer und Gabeln, dann ihre Stimme: »Du, hast du schon den Heeresbericht gelesen? Unser Erni hat seinen Vierundzwanzigsten abgeschossen!«
Da kann ich mich nicht mehr halten, ich laufe ins Zimmer. Sie wirft die Messer und Gabeln auf den Tisch, und wir liegen uns in den Armen. Dann nimmt sie meinen Kopf und hält ihn mit beiden Armen weit von sich ab: »Krank, Junge?«
»Ach, nur ein bißchen an den Ohren.«
Sie beruhigt sich sofort. Das ist das Eigenartige an ihr: sie hat ein felsenfestes Vertrauen, daß mir in diesem Krieg nichts Schlimmes passieren kann, und sie behauptet das mit einer Bestimmtheit, als hätte es ihr der liebe Gott persönlich in die Hand versprochen. Manchmal muß ich darüber lächeln, manchmal rührt mich die Kindlichkeit ihres Glaubens, aber allmählich strömt ihr Vertrauen auf mich über, und oft glaube ich selber schon, daß diesmal keine Kugel für mich gegossen ist.
Wir essen. Zwischendurch fragen sie mich, und ich erzähle, was ich für gut halte. Über den letzten Kampf mit Maasdorp spreche ich nicht. Ich will Vater nicht beunruhigen, und außerdem hält mich eine eigentümliche Scheu zurück. Ich kann nicht bei Sauerbraten und Klößen über einen Mann reden, der ein Kerl war mit dem Herzen eines Helden und der durch mich gefallen ist.
Ja, nun bin ich zu Hause. Man taucht in dieses Gefühl ein wie in ein warmes Bad, alles entspannt sich, man schläft lange, ißt viel und läßt sich verwöhnen. In die Stadt gehe ich selten in den ersten Tagen. Was soll ich da? Meine Kameraden stehen im Felde, viele sind schon tot, und so unter Fremden herumflanieren mag ich nicht. Nur zum alten Bergen müßte ich eigentlich gehen, aber vor diesem Besuch graut mir. Der alte Mann soll über die Nachricht von Ottos Absturz schwermütig geworden sein. Was kann ich ihm zum Trost sagen? Wahrhaftig, es ist leichter, zu kämpfen, als untätig dazustehen und auf die Wunden zu schauen, die dieser Krieg geschlagen hat.
Zum Arzt muß ich jeden Tag. Er ist nicht sehr zufrieden mit dem Heilverlauf. Ich lasse ihn reden, jetzt berührt mich das nicht mehr so wie das erstemal. Eines Morgens, als ich gerade von einer Konsultation zurückkomme, treffe ich Lo im Hofgarten. Wir kennen uns von früher, so wie sich junge Leute eben kennen. Wir haben ein paarmal zusammen getanzt, mit anderen gemeinsam Ausflüge gemacht.
Wir gehen nebeneinander her. In ihrem zart gemusterten, waschseidenen Kleid sieht sie aus, als sei sie heute morgen frisch aufgeblüht. Wenn man sie ansieht, glaubt man nicht, daß es überhaupt so etwas wie Krieg geben kann. Aber dann erzählt sie, daß sie als Hilfsschwester in einem Lazarett tätig ist. Auf ihrer Station liegt ein Mann mit einem Schuß im Rückenmark, der seit Monaten stirbt. Alle paar Wochen kommen die Verwandten angereist, nehmen Abschied von ihm, und dann lebt er weiter. Aber sterben muß er, sagen die Ärzte.
Sie sieht mich erstaunt an, als ich sie schroff unterbreche: »Wollen wir nicht lieber von etwas anderem reden?«
Eine Weile ist sie beleidigt. Sie schiebt dabei die Unterlippe vor und sieht aus wie ein Kind, dem man ein Stück Schokolade weggenommen hat. Vor ihrem Hause versöhnen wir uns wieder und verabreden, daß wir uns am Abend im »Ratskeller« treffen wollen.
Nachmittags gehe ich zu Bergens. Länger kann ich den Besuch nicht mehr aufschieben. Das Mädchen führt mich gleich ins Wohnzimmer, wo der alte Bergen hinter einer Zeitung sitzt. Er ist ganz allein, Hans und Claus stehen im Felde, und seine Frau ist längst tot. Er läßt das Blatt sinken und sieht mich über seine Kneifergläser hinweg an. Sein Gesicht ist erschreckend alt geworden, ganz tot, der weiße Spitzbart hängt wie ein verschneiter Eiszapfen herunter.
Wie arm ist man vor dem Schmerz eines anderen! »Ich wollte ...« sage ich ... »wegen Otto ...« stammele ich.
Er winkt ab.
»Laß gut sein, Ernst, du wolltest Otto noch mal besuchen.« Er steht auf und schüttelt mir die Hand. »Komm!«
Er öffnet die Tür und steigt vor mir die Treppe hinauf. Wir stehen in Ottos Zimmer, dem Mansardenstübchen, das er als Schüler bewohnt hat.
»So«, sagt der alte Bergen und deutet mit einer flattrigen Handbewegung ringsum. »Du kannst dir das alles ansehen.«
Dann dreht er sich um und geht hinaus, seine Schritte klopfen immer matter die Treppe hinunter. Ich bin allein mit Otto.
In der kleinen Stube ist alles noch wie damals. Auf dem Vertiko und auf dem Bücherbrett stehen die Flugzeugmodelle, die Otto selbst gebaut hat. Sie sehen wunderbar aus, diese Modelle, alle bekannten Typen von damals sind vertreten, bis ins kleinste genau nachgebildet, aber wenn sie fliegen sollten, sackten sie nach unten weg wie Steine. Vor zehn Jahren war das.
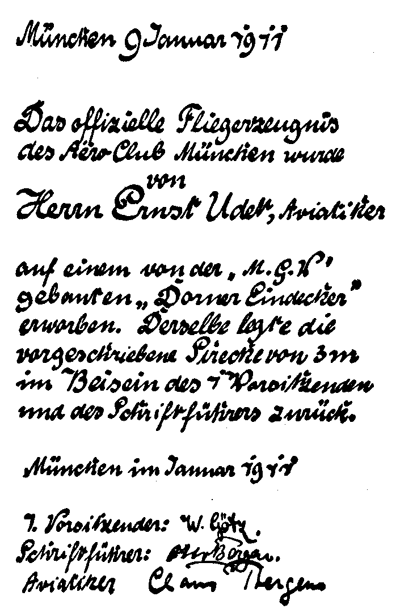
Ich trete an das Kinderpult mit der grünen, tintenbefleckten Bespannung und schlage den Deckel hoch. Ja, da liegen sie noch, die blauen Schulhefte, die Tagebücher des »Aero-Club München 1909«. Zwischen zehn und dreizehn Jahre waren die Mitglieder alt. Jeden Mittwoch war gemeinsamer Modellbau auf unserem Speicher, jeden Sonnabend großes Flugmeeting am Stadtbach oder an der Isar. Ottos Apparate sahen immer am schönsten aus, aber meine, häßlich wie nasse Spatzen, flogen am weitesten. Irgendwie hatte ich den Kniff weg. Und alles hatte er, der Schriftführer des Klubs, in seiner sauberen, schönen Kinderhandschrift aufgezeichnet. »Der Aviatiker Herr Ernst Udet erhielt den ersten Preis für die gelungene Kanalüberquerung seines Modells » U II« steht da, denn meine Type war ohne Havarie über die Isar hinweggeflogen.
Es liegt alles so ordentlich nebeneinander, als hätte er aufgeräumt, bevor er für immer wegging.
Da sind die Briefe, alle Briefe, die ich ihm geschrieben habe, in kleine Bündel gepackt und mit Jahreszahlen versehen. Ganz obendrauf liegt der letzte. Der Umschlag ist noch zu. Es steht darin, daß es mir endlich gelungen ist, ihn für meine Staffel freizubekommen. »Hurra, Otto!« schließt der Brief.
Da liegen die Zeichnungen, die rechte Hälfte hat immer er gemacht, die linke ich, dort die Photographien ... Alle Bilder sind beisammen, von den ersten dummen Kinderbildern an. Sogar den »Flugtag von Niederaschau« hat er aufgehoben. Ich sprang mit dem ersten, selbstkonstruierten Gleitflugzeug des Aero-Clubs in die Luft, stürzte zur Erde, der Vogel brach sich den Schnabel, und Willi Götz, unser Vorsitzender, erklärte den Niederaschauern, der Erdmagnetismus in ihrer Gegend sei zum Fliegen zu stark. Dann Gruppenbilder aus der Zeit der ersten Tanzstundenliebe, und dann der Krieg, und wieder ich als Motorradfahrer, im ersten Fliegerdreß, nach dem ersten Abschuß. Unter jedem Bild das Datum und in Rundschrift mit weißer Tinte die Inhaltsangabe. Er hat mein Leben mitgelebt.
Es ist etwas Seltsames um eine Jungensfreundschaft. Wir hätten uns eher die Zungen abgebissen, als auch nur mit einem Wort angedeutet, daß wir uns gernhaben. Erst jetzt sehe ich alles vor mir. Ich klappe den Pultdeckel zu und steige die Treppe hinunter. Der alte Bergen sitzt schon wieder hinter seiner Zeitung. Er steht auf und gibt mir die Hand, eine Hand ohne Druck und Wärme.
»Wenn du etwas von Ottos Sachen haben willst, Erni«, sagt er, »du kannst dir nehmen, was du magst. Er hat dich ja am liebsten von seinen Freunden gehabt.«
Er wendet sich ab und beginnt, an seinem Klemmer zu putzen. Ich habe keinen Klemmer, mir laufen ein paar Tränen übers Gesicht. Eine Weile stehe ich noch allein im Treppenhaus, ehe ich auf die Straße hinaustrete.
Ich war einundzwanzig Jahre alt damals, und Otto Bergen war mein bester Freund.
Am Abend treffe ich mich mit Lo im »Ratskeller«. Ich habe Zivil angezogen, für einen Abend möchte ich vergessen, daß Krieg ist. Aber Lo ist gekränkt. Ich sehe nicht heldenhaft genug aus.
Wir essen zähes, sehniges Kalbfleisch und große, blauschimmernde Kartoffeln, die aussehen, als wenn sie blutarm wären und zu lange im Wasser gelegen hätten. Nur der Wein ist voll reifer Süße, ihm merkt man nichts vom Kriege an.
Eine alte Frau mit Rosen kommt vorbei. Lo schielt nach den Blumen. »Laß doch«, sage ich leise, »die sind ja doch alle gedrahtet.« Aber die Alte hat's gehört, setzt ihren Korb hin und baut sich vor uns auf:
»Dös hob i fei gern«, kreischt sie und bohrt die Arme in die Hüften, »so an fans Herrl, sitzt do herum, geschniegelt, und will an alten Weiberl dös Brot bespein, In dene Schitzengrabn gehörns, junger Herr, dös sag i Eahne!«
An den Nachbartischen ist man aufmerksam geworden und guckt zu uns herüber. Wenn ich ein Drückeberger wäre, wäre die Sache verdammt peinlich. So macht's mir Spaß. Aber Lo ist rot geworden bis unter die Stirnhaare.
»Na«, sage ich zu der Alten, »dann geben Sie mal zwei Sträuße her!«
Die Veränderung ist wunderbar. Der Zorn verrauscht wie ein Theatergewitter, das Gesicht ist in süße Freundlichkeit getaucht. Eilig kramt sie in ihren Sträußen.
»No, nix für ungut, junger Herr«, brabbelt sie, »dös siacht ja a Blinder, daß Sie vui z' jung san für draußt. Dös redt ma halt so in san Zorn daher. Do haßt's bloß herschaun«, wendet sie sich an die Umsitzenden, »dös muß ja an Kind segn, daß dös Buberl grad gefirmt is ...«
Ich winke ab. Lo hat eine böse kleine Falte zwischen den Augenbrauen. »Wie ein Konfirmand!« stößt sie hervor.
Ich ergreife ihre Hand, die schmal und braun auf der weißen Tischdecke liegt.
»Weißt du«, sage ich, »ich möchte einmal mit dir allein sein, ganz weit weg von allem.« Es ist ein Angriff aus der Sonne heraus. Sie ist überrascht, ich kann fast die Gedanken hinter ihrer runden Kinderstirn arbeiten sehen.
»Wir müßten wegfahren«, erkläre ich, »irgendwohin, ins Freie. Vielleicht an den Starnberger See. Gustav Otto hat mich eingeladen. Oder weiter hinauf in die Berge.« Und ich setze ihr auseinander, wie ich mir das denke: »Ganz frei sein von allen Bindungen, in der Natur leben, so als ob man auf einem anderen Stern wäre.«
Zuerst lächelt sie, dann zieht sie die Lippen schmal zusammen.
»Aber das geht doch nicht... was sollen meine Eltern dazu sagen?«
»Verzeih, bitte«, sage ich, »ich habe draußen Tanz und Anstand vergessen.«
Wir gehen. Es ist eine feuchtwarme Nacht. Der Wind rauscht in den Baumkronen. Unter einer Laterne bleibt sie stehen, streicht mir über den Arm:
»Du mußt nicht böse sein ...«
Ich zucke die Achseln: »Böse? Nein!«
Doch ich habe das Gefühl, daß irgend etwas nicht stimmt. Unter uns da draußen ist alles anders geworden. Das, was einmal wichtig war, gilt fast nichts mehr. Andere Dinge machen unser Leben aus. Hier aber sind sie stehengeblieben. Ich kann das nicht so in Worte fassen, aber ich habe plötzlich Sehnsucht nach meinen Kameraden.
Los Eltern wohnen bei den Propyläen. Am Gatter des Vorgartens bleibt sie stehen, aber ich verabschiede mich schnell mit einem korrekten Handkuß.
Die Tage darauf gehe ich allein aus. Ich bin in einer scheußlichen Stimmung. Raus kann ich noch nicht, der alte Arzt ist mir saugrob gekommen, als ich davon anfing. Und hier fühle ich mich so verdammt überflüssig.
Wenn ich abends heimkomme, schlafen die Eltern schon.
Eines Abends aber sind noch alle Fenster bei uns hell. Ich laufe die Treppe hinauf, die Korridortür öffnet sich von selbst, und im Türrahmen erscheint Mutter. Ihr Gesicht ist rot und glänzend vor Freude, in der Hand schwenkt sie ein Stück Papier. Ein Telegramm ist eingetroffen, ein Telegramm vom Geschwader. Sie haben's aufgemacht. Ich habe den Pour le mérite bekommen.
Ich freue mich, ich freue mich wirklich, obwohl es mir nicht ganz so überraschend kommt. Denn mit einer bestimmten Zahl von Abschüssen fällt auch der Pour le mérite. Schon beinah automatisch. Aber die richtige, tiefinnerliche Herzensfreude entzündet sich am Glück meiner Mutter. Sie ist ganz außer Rand und Band, sie hat alle gezwungen, aufzubleiben und auf mich zu warten. Sogar meine kleine Schwester. Die hat den Pour le mérite aus Papier geschnitten, einen Zwirnsfaden durchgezogen und hängt mir jetzt ihren Orden um den Hals. Ganz kleine Augen hat sie vor Schlaftrunkenheit.
Mein Vater gibt mir die Hand. »Gratuliere, Junge!« sagt er, sonst nichts. Aber er hat eine Flasche Steinberger Kabinett aufgemacht, 1884, ein Heiligtum der Familie. Das sagt mehr als Worte. Der Wein ist goldgelb und dickflüssig wie Öl, das ganze Zimmer duftet danach. Wir stoßen an.
»Auf den Frieden, auf einen guten Frieden!« sagt mein Vater.
Am nächsten Morgen, im Bett, denke ich an Lo. Wenn ich jetzt den Pour le mérite dahätte, würde ich ihn umtun und mich mit ihr verabreden, ganz so, als wenn nichts geschehen wäre. Ich springe aus dem Bett, ziehe mich schnell an und gehe in die Stadt.
Auf der Theatinerstraße weiß ich ein Ordensgeschäft. Der Verkäufer zuckt die Achseln: » Pour le mérite? – Nein! Zu wenig gefragt.« Es ist schade, sehr schade. Ich hatte mir die Überraschung für Lo so nett gedacht. Aber bis der Orden von der Truppe ankommt, dauert's wenigstens vierzehn Tage.
Langsam schlendere ich durch die Straßen nach Hause zurück. Grüße mechanisch Soldaten und Offiziere, die vorbeigehen. Ein Marineoffizier, der U-Boot-Kommandant Wenninger. An seinem Hals, in der Sonne funkelnd, der Pour le mérite.
Es ist der Einfall eines Augenblicks. Ich trete auf ihn zu, grüße: »Verzeihung, haben Sie vielleicht noch einen zweiten Pour le mérite?«
Er sieht mich an wie einen Gestörten. Ich kläre ihn auf. Er lacht furchtbar, beschämend laut und lange. Nein, einen zweiten hat er nicht vorrätig. Aber er gibt mir die Anschrift eines Berliner Geschäfts, wo man ihn sicher bekommt. Sogar telegrafisch kann man ihn dort bestellen. Ich danke verlegen und grüße förmlich.
Zwei Tage später kommt der Orden aus Berlin an. Er liegt in einem rotsamtnen Kästchen wie ein Stern. Ich rufe Lo an. Wir wollen uns wiedersehen. Sie lacht, ist gleich bereit.
Im Stechschritt marschiere ich vor dem Zaun ihres Hauses auf und nieder. Da kommt sie. Sie sieht den Stern an meinem Halse sofort, »Erni« ruft sie, hüpft wie ein Vogel, der anfliegen will, und läuft auf mich zu. Mitten auf der Straße, vor allen Leuten, fällt sie mir um den Hals und gibt mir einen Kuß.
Es ist ein heller, sonniger Frühlingsmorgen. Nebeneinander gehen wir langsam mit schlenkernden Gliedern auf die Innenstadt zu. Wenn uns Soldaten begegnen, grüßen sie besonders stramm. Die meisten drehen sich um. Lo zählt: von dreiundvierzig haben sich siebenundzwanzig umgedreht.
Wir bummeln die Theatinerstraße entlang. Sie ist die Aorta der Stadt, von ihr scheint alles Leben auszugehen und durch sie zurückzuströmen. Vor der Residenz steht ein Posten, ein kleiner Landsturmmann mit Seehundsbart und Knopfnase. Plötzlich schreit er mit einer Stimme, die man in seinem winzigen Brustkasten nie vermuten würde:
»Wache rrraus!«
Wie die Waldteufel flitzen die Leute raus. »Angetreten!« kommandiert der Offizier. »Stillgestanden!... Das Gewehr über!... Achtung! Präsentiert das Gewehr!«
Ich sehe mich um. Niemand ist in der Nähe. Da fällt mir der Pour le mérite ein. Und schon im Abgehen danke ich. Der Gruß fällt sehr kümmerlich aus, allzu überhastet und ohne jede Würde.
»Was war denn das?« Lo sieht mich mit großen Augen an.
»Gott«, sage ich möglichst obenhin, »vor dem Pour le mérite hat eben die Wache ins Gewehr zu treten.«
»Is nit wahr!«
»Is doch wahr!«
»Gut, dann probier's doch noch mal!«
Erst sträube ich mich ein bißchen, aber dann willige ich ein. Schließlich bin ich mir selbst meiner Sache nicht ganz sicher.
Diesmal sind wir auf alles vorbereitet und gehen in guter Haltung den Ereignissen entgegen. »Wache rraus!« schreit der Posten. Im gleichen Augenblick angelt Lo meinen Arm. Und huldvoll nickend schreitet sie an meiner Seite die kleine Front ab.
Frauen sind unersättlich in ihrer Eitelkeit. Wenn es nach ihr ginge, würden wir den Rest des Vormittags damit zubringen, die Wache raus und reintreten zu lassen. Aber da streike ich. Die Wachtruppe ist kein Spielzeug für kleine Mädchen. Lo schmollt.
Es sind Tage wie aus blauer Seide, nie wieder habe ich einen solchen Frühling erlebt.
Wir treffen uns jeden Tag. Spazieren durch den Englischen Garten trinken Kaffee oder gehen ins Theater.
Der Krieg ist jetzt sehr, sehr weit entfernt. Einmal sehen wir am Theater eine Menschenmenge vor einem Maueranschlag stehen. »Sicher wieder eine Siegesnachricht«, sage ich, und wir treten herzu.
In diesem Augenblick trifft mich ein Schlag vor die Brust, mitten aufs Herz.
»Rittmeister Freiherr von Richthofen vermißt!« steht da. Die Buchstaben werden unsicher vor meinen Augen. Ich sehe niemanden mehr, ich achte auf keinen Menschen, ich arbeite mich mit Ellenbogenstößen rücksichtslos durch die Menge in die erste Reihe vor. Fünfzig Zentimeter vor mir klebt das gelbweiße Papier an der grauen Mauer. »Vom Feindflug nicht zurückgekehrt«, lese ich ... »Nachforschungen bisher ergebnislos.«
Und da weiß ich, weiß mit untrüglicher Sicherheit, daß der Rittmeister tot ist.
Welch ein Mann war das! Gewiß, auch die anderen kämpften. Aber sie hatten Frauen zu Hause, Kinder, eine Mutter oder einen Beruf. Nur in seltenen Augenblicken konnten sie das vergessen. Er aber lebte beständig jenseits der Grenze, die wir nur in unseren großen Augenblicken überschritten. Sein Leben war ausgelöscht, wenn er kämpfte. Und er kämpfte immer, wenn er an der Front war. Essen, trinken, schlafen, das war alles, was er dem Leben freigab. Das, was notwendig war, um diese Maschine aus Fleisch und Bein in Gang zu halten. Er war der einfachste Mensch, den ich kannte. Ganz preußisch. Und der größte Soldat.
Eine Hand schiebt sich behutsam in meine. Für Sekunden hatte ich Lo ganz vergessen.
»Wenn du noch rausfahren magst, will ich gern mitkommen«, sagt sie. Dabei sieht sie mich an, als ob ich morgen sterben müßte. Schon am nächsten Tag fahren wir an den Starnberger See. Das Laub ist früh heraus dieses Jahr, alle Büsche und Bäume sind von hellem Grün überschäumt. Wir wohnen bei Gustav Otto und seiner Frau. Es sind natürliche Leute von offener Herzlichkeit. Sie kennen und respektieren das oberste Gebot der Gastfreundschaft. Sie zwängen uns nicht in ihren Haushalt, sie lassen uns ganz nach unserem Geschmack leben.
Morgens reiten wir oder rudern auf dem See, und den Tag über strolchen wir durch die Wälder. Wir waten durch das welke Laub vom vorigen Herbst, und oben an den Zweigen flammt schon wieder das neue Grün. Es ist wirklich so, als ob es keinen Krieg gäbe. Wenn wir alle tot sind und vergessen, werden diese Bäume weitergrünen, Früchte tragen und welken.
Und doch, und doch... Manchmal, wenn wir so nebeneinander im Gras liegen und in den Himmel starren, ertappe ich mich dabei, wie ich mit Blicken die dicken Bäuche der Kumuluswolken abtaste. Ob da nicht im Sturzflug einer rausstößt? Und morgens beim Aufwachen gehen meine Augen zuerst nach dem Himmel. Was für ein Flugwetter wohl sein mag?

Oberleutnant Löwenhardt, Führer der Jagdstaffel 10
Die ersten fünf Tage habe ich keine Zeitung gelesen, aber jetzt gehe ich dem Briefträger immer schon ein Stück entgegen. Es muß toll zugehen draußen. Und das Geschwader ist mitten im dicksten Schlamassel drin. Löwenhardt holt fast jeden Tag einen, er ist jetzt bei Siebenunddreißig. Und als ich abfuhr, hatten wir gerade gleichgezogen. Sicherlich werden wir auch große Verluste haben.
Es ist Mittag, und Lo und ich sind im Boot. Mitten auf dem See.
»Weißt du«, sage ich nachdenklich, »manchmal wünsche ich, ich wär erst wieder draußen.« Es ist das erstemal, daß ich darüber spreche.
Lo läßt die Steuerleine los und starrt mich an. Ihre Lippen zittern.
»Also so wenig lieb?« sagt sie.
Nein, sie hat mich nicht verstanden. Ich stehe auf, tappe nach hinten. Das Boot schaukelt mächtig. Ich gebe ihr einen Kuß. Mir ist ein bißchen traurig zumute ... Meine Mutter hätte mich sofort verstanden.
Das Wetter ist unwahrscheinlich schön, ein Tag leuchtender als der andere. In der dritten Woche fahre ich nach München zum Arzt. Er ist zufriedener. Die Entzündung läßt nach. »Aber Schonzeit, junger Mann, Schonzeit!« meint er behäbig.
Abends sitzen wir auf der Terrasse von Gustav Ottos Haus. Es ist Vollmond. Lo ist müde und geht früher in ihr Zimmer. Ich sitze neben Gustav Otto im Liegestuhl. Wir rauchen.
»Würdest du sehr böse sein«, frage ich, »wenn ich eines Morgens plötzlich verschwunden wäre?«
An der Feuerscheibe seiner Zigarre sehe ich, wie er den Kopf langsam nach mir hinwendet.
»Was sagt denn der Arzt?
»So weit zufrieden.«
Er schweigt eine Weile: »Ich glaube, ich würde es ebenso machen«, sagt er dann.
»Es ist gut!« Wir haben uns verstanden.
Um fünf am Morgen weckt mich Gustav Otto. Auf Zehenspitzen schleichen wir die Treppe hinab. Lo schläft noch. Unten wartet das Auto.
Der Bahnhof ist fast leer zu dieser frühen Stunde. Nur ein paar Marktfrauen warten mit mir auf den Zug. Es sieht nach Regen aus, der erste trübe Tag seit Wochen. Der Morgen kommt nur mühsam über die Berge.

Von nun an hieß mein Flugzeug »Lo«