
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
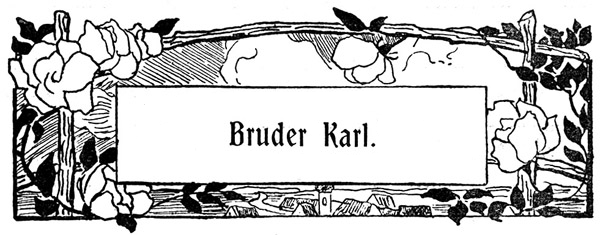
Das ganze kleine Haus wurde auf den Kopf gestellt. Frau Jöhrs, das dürre, langleibige Scheuerweibchen in hochgerolltem Kleide und Rapperschürze kam auf drei Tage und überflutete alles, vom Boden bis zum Keller, mit Seifenwasser. Minna, die peinlich saubere, die immer so hell und zierlich ihres Amtes waltete, war nicht mehr zu erkennen in ihrem alten Gewande aus bäuerlichen Jugendtagen. Aermel kurz, Taille zu eng, Rock in die Höhe gewurstelt, gleichfalls unter grauleinenem Schurz. Die ungebrannte Ponyfranse, die sonst zwei bauschige Polsterchen vor dem netten Häubchenstriche bildete, schlaff bis beinahe auf die Nase, und in der respektgedämpften Stimme ein gewisser, schreiender Keifton vorherrschend.
Minna »konnte nicht« mit Frau Jöhrs. Frau Jöhrs wollte alles besser wissen als Minna; verstellte und verkramte ihr die Sachen und spekulierte auf jeden Bissen übriggebliebenes Essen, Fettreste, Kaffeesatz und Suppenknochen. So waren es gewöhnlich Kreuz- und Schelttage, wenn das dürre Weibchen sich im Haushalt tummeln mußte, nachdem der Schornsteinfeger sein Vorläufer gewesen war, schwarz wie eine finstere Unheilsahnung, ob zwar sonst ein scherzhafter junger Mensch nach Aussage aller Dienstmädchen des Bezirks, in dem er seine Kunst ausübte.
Ja, Minna vergaß sogar, daß man mit seiner Herrin in der dritten Person sprechen mußte: »Wollen Frau Ringhardt so gut sein und mir noch etwas Scheuerseife geben?« – Während des Jöhrs-Regiments ward einfach von der Bodentreppe ins Souterrain hinuntergeschrieen: »Frau Ring–hardts! Soll ich mal eben noch 'n bischen grüne Seife nach oben haben!«
Es fehlte nicht viel, so hätte »Fräulein Mariechen« sich von der Küchenfee die Anrede »mien' Deern« gefallen lassen müssen.
»Fräulein Mariechen« mußte auf die Windfangklingel acht geben und wenigstens einen Raum standesgemäß geordnet halten für etwaigen Besuch. Natürlich kam alles, was Beine und Anliegen hatte, am zweiten Reinmachetage und stieg über Eimer, Schrupper und Besen weg, und die Mutter kochte unten am kleinen Gasherd irgend ein einfaches und schmackhaftes Kraftgericht für die ganze fleißige Sippschaft des Hauses.
Gott sei Lob und Dank, es ging durch Nacht zum Licht. Das Möbelschleppen und das schreckliche Gedienere und Gerede des höflichen Tapeziergesellen beim Gardinenaufstecken – alles erreichte sein Ende. Frau Jöhrs verschwand wieder für ein Vierteljahr, unter Mitnahme von drei Pfund gespendetem Reis, abgelegter Garderobe für sich und Familie und dem klingenden Lohne ihrer Säuberungstaten. Minnas Haar bauschte sich von neuem hinter dem getollten Mullstriche des Häubchens und äußere Tadellosigkeit nebst Ehrerbietung wurden verdoppelt. Die Mutter lobte Minna sowohl wie »Fräulein Mariechen«. Dafür brachte Minna am nächsten Sonntage aus dem elterlichen Landgarten einen ganzen Armvoll Sonnenblumen und Malven mit, zur Verschönerung der frisch erstrahlenden Salons, und »Fräulein Mariechen« verfertigte mit Hilfe des Davidisschen Kochbuches eine großartige Mandeltorte aus Privatmitteln. Sie hatte das Rezept nach eigener Weisheit umgemodelt, und daß die Torte dennoch wohlgeriet, war entschieden mehr Glückssache als Verdienst. – Marilis Gesicht strahlte, als die Mutter ihr Machwerk für würdig erklärte, übermorgen, zur Feier von Karls Ankunft, verspeist zu werden.
Ueberhaupt: es ist merkwürdig, wie entzückend und begehrenswert selbst gestrenge, ältere Brüder jüngeren Schwestern gegenüber werden, wenn sie, nach langer Abwesenheit, einmal wieder in naher Sicht sind.
»Bin ich wohl gewachsen, Mutter? Wird Karl mich wohl noch immer als Kind behandeln?«
Es war kaum zu zählen, wie oft Marili, binnen zweimal vierundzwanzig Stunden, diese nämliche Frage mit geringen Abweichungen an die Mutter stellte, und die Mutter, trotzdem sie nickte oder verneinte, je nachdem es ihrem Marili erfreulich war, mußte sich das zarte, junge Ding immer noch einmal heimlich von der Seite betrachten.
Ach nein – verdenken würde sie's Karl schwerlich, wenn er sein jüngstes Schwesterchen auch jetzt noch nicht für voll ansah. Kaum Fünfzehn hätte man von Rechts wegen der Siebzehnjährigen gegeben; das blasse, kleine Gesicht glich nach wie vor dem unbeschriebenen Blatte eines Buches, und zuweilen lag ein Ausdruck unbestimmten Leidens darauf, trotz aller Versicherungen auf ganz direkte Fragen: »Mir fehlt nichts, Mutter.«
Zwar hatte die Herzuntersuchung, gleich am Tage nach der Mutter Besuch im Doktorsgarten, eine leise Unregelmäßigkeit ergeben, die aber verwuchs schon wieder oder glich sich völlig aus, und bei etwas weiser Vorsicht konnte man steinalt dabei werden. Jedenfalls wäre es töricht gewesen, sich darüber schwere Gedanken zu machen.
* * *
Endlich, endlich war der große Tag da, der Mutters »besten Jungen« (sehr leicht, weil er ihr Einziger war!) heimbringen sollte.
Zwei Jahre hatte er seine Lieben nicht gesehen, sondern in Berlin und München und Straßburg seinen Studien obgelegen, sogar die Universitätsferien treulich »verochst«, wie er seinen ungeheuren Strebefleiß bezeichnete. Schließlich die Uebung und die Manöver in Elsaß-Lothringen. Von diesen kam er nun. Das Gartenstraßenhäuschen war ihm noch nicht recht vertraut und er liebte die norddeutsche Stadt, der Mutter Geburtsort und Jugendheimat, eigentlich nur in der Erinnerung von Kindertagen her.
Marili hatte sich, Karl zuliebe, von der Mutter trennen und hinauf in Kittys verödetes Stübchen ziehen müssen, weil der »Kronensohn« das große, geräumige Schlafgemach nach der Straße hinaus zum Arbeitszimmer haben sollte. – »Er ist wie sein Vater; er muß auf und ab gehen können beim Nachdenken,« sagte die Mutter von jeher. – Sie selbst behalf sich mit einem Kabinettchen neben des Sohnes kleiner Schlafstube; winzig wie eine Schiffskabine war's, man konnte sich kaum darin umdrehen, aber es lag so schön still und hatte den Blick ins Grüne, und die Mutter behauptete, daß sie's besonders reizend und bequem fände. Karls neues Reich fand Marili wundervoll; das Urbild von Behaglichkeit mit Schaukelstuhl und stilvollem Ruhebette aus Bambusgeflecht, mit gelehrtem Bücherregal und spartanischem Stehpult und hundert Millionen Kinkerlitzchen, wo man sie nur stellen und legen konnte. Keinen alten Aschenbecher und keine abgedankte Zigarrenspitze durfte man dem Jungen wegwerfen! Auch darin war er ganz wie sein Vater geworden, während die Mutter alle Vierteljahr eine Generalrevision vornahm, zur Wonne von Minna, Frau Jöhrs und der getreuen Nähkaroline. – Unten stand der Eßtisch gedeckt. Bis Vier mußte heute gewartet werden, und Marili behauptete: sie hungere dermaßen, daß sie nicht mit zum Bahnhof könne. Der Hauptgrund, weshalb sie nicht mit zum Bahnhof gehen wollte, lag indessen in etwas anderm: »Du hast Karl doch erst gern für dich allein, Mutter!«
* * *
Jetzt aber erschien er wirklich und zwar zu Fuß. Tüchtig schellte er an, und als nicht sofort geöffnet wurde, sagte er seine Meinung mit kräftiger Stimme. Aber Marili war schon da! Sie zitterte vor Aufregung, als er zum Willkomm ihre beiden Hände ergriff. Es war ihr genau so, als müsse der Bruder nun sofort streng auf sie hineinfahren: »Wie abscheulich ist deine Handschrift; warum hast du dir nicht noch viel mehr Mühe gegeben?«
Glücklicherweise durfte sich das Herzklopfen beruhigen. Der Geliebte und Gefürchtete war gar zu froh und herzlich, nahm die kleine Schwester in seine männlichen Arme, drückte sie an sich, daß es beinahe weh tat und doch so angenehm, und küßte sie mehr als einmal: »Also das bist du? Du kleiner Kerl! Wir müssen sie irgendwohin auf die Fettweide schicken, daß sie Kitty und mir nachkommt, Mutter. Es geht ihr doch gut?«
»O herrlich, herrlich!« versicherte Marili, hängte seinen schweren Mantel an den Garderobenständer, den Hut darüber, und schob sich darauf dicht neben ihm durch die enge Eßstubentür zu Tische. »Ich bin selig, daß du wieder da bist! Früher habe ich mich längst nicht so sehr darauf gefreut, wie diese letzten Tage. Nun bin ich auch erwachsen wie Kitty! Du sollst sehen: so hübsch ist es oben bei dir, und, nicht wahr, du spielst auch öfters mit mir vierhändig?«

Jetzt erschien Karl wirklich und Marili zitterte, als er ihre beiden Hände ergriff.
»Hoho, hoho, immer sinnig mit den Wünschen! Jetzt gibt's ganz andre Flötentöne für mich als piano und pianissimo. Sei du froh, daß du keinen Doctor phil. zu deichseln brauchst, Kind. Na, nur kein trauriges Gesicht, Marili. Ist es damit noch alleweil dasselbe? Schad't nichts; das ändern wir schon, was? Wirklich, Mutterchen, mollig ist's bei dir, urmollig; nur, daß unsre Kitty dabei fehlt – Mutter: das paßt mir nicht!«
»Uns auch nicht, liebster Junge; aber besser so für sie, als daß sie hier müßig sitzt und die Daumen dreht. Liebe hat gottlob nichts mit Trennung zu schaffen. So, nun laßt uns essen, Kinder. Marili hat tüchtig kochen helfen.«
»Bitte, erzähl mir von Kitty,« bat Marili, als sie glücklich saßen, »wie war Kitty?«
»Eine herzige Schwester Katharine – viel zu schade für solch ein Büßergewand.« Karls frisches Gesicht blickte ganz wehmütig. »Gerade Kitty, so jung und lustig! Wenn ich daran denke, wie wir vor zwei Jahren in Berlin auf Onkel Bodos silberner Hochzeit zusammen tanzten; wie ihr da der Himmel voller Geigen hing! – Na – was hilft die Nachklage? Vorbei ist vorbei! Sie sagt ja, daß sie hochbefriedigt zwischen all ihren armen Lazarussen ist. Aber, wahrhaftig, Mutter, die Unscheinbaren sollten sich von der Lebensbühne zurückziehen, aber nicht solche wie Kitty.«
»Mein guter Junge, ich sage gerade wie Kitty: Kranke Menschen sehen auch gerne heitere Gesichter, und wer mündig ist, der hat freie Berufswahl,« antwortete die Mutter, allein Karl konnte sich anscheinend gar nicht darüber beruhigen. Immer weiter spann er den Gesprächsgegenstand aus, und erst beim Nachtisch machte er einen großen Sprung zurück in die Interessen des kleinen Hauses, unter dessen Dache er jetzt wohlgeborgen saß.
Marili war ganz stumm geworden, und sie genoß das wenige, was sie aß, so langsam, daß ein Beobachter leicht gesehen haben würde, wie tief sie in ihre Gedanken versunken war. – – – – – – – – – – Die Unscheinbaren – so wie sie selber eine war! Die sollten der Weltfreude absterben, sich ganz für andre aufopfern. Die besaßen nur halbe Rechte ans Leben und mußten sich diese halben Rechte auch noch durch Entsagung verdienen. Ja, wenn man nur immer könnte, wie man wollte. Sie fühlte den besten Willen, ebensogut wie Kitty, allen Mitmenschen Liebes zu erweisen, aber mitten im Vollbringen wurde sie schlaff und müde und mußte ihr Vorhaben stecken lassen. – Vielleicht besserte sich das, wenn im März ihre Aenne wiederkam und die lustigen andern drei aus der Pension, oder Kitty auf Urlaub im Sommer. – Ach! an der Liebe fehlte es ja nicht.
»Marili, Kind, woran denkst du?«
»An – a–n – gar nichts Besonderes, Karl.«
»Hältst du das für die lautere Wahrheit, Mutterchen? Komm, gib mir noch einen Schnitt von deinem gut geratenen Mandelpapp, kleine tragische Muse du, und dann sitz nicht gleich an meinem ersten Daheimtage und grolle und grüble! Dein ›Garnichts‹ ist nämlich der Floh, den ich dir wegen Kitty ins Ohr gesetzt habe. Du bist meine Schwester so gut wie sie, und ich will mit dir ebenso reinen Kram haben. Eifersüchtig auf Kitty mußt du nicht sein, hörst du, Kindchen?«
Sie schnitt ihm auch ein großes Stück Torte auf den Teller und ging damit um den Tisch herum zu ihm.
»Ach Junge, es ist auch wahr! – Wenn ich doch so wie Kitty wäre und mich reell nützlich machen könnte,« sagte sie bekümmert und rieb ihre Wange an seinen kurzgeschorenen Haaren, dicht und knapp wie eine Sammetbürste. »Am liebsten möchte ich ganz das Gegenteil von mir selber sein.«
Er lachte und führte sich den »Mandelpapp« mit bestem Appetit zu Gemüte. »Du bist schlau! Das ist eine rechte Kateridee, mein gutes Mädchen. Leider gibt's weder Häutung noch Seelenwanderung beim Menschen hienieden. (Das wäre eigentlich ein brillanter Romanstoff für dich, Mutterchen, eigenartig, was?) Sieh mal, Marili, ich habe einen guten Freund in Berlin, der hat nur zum Ulk drei Semester studiert, besitzt zwei Rittergüter in der Mark und seine Braut bringt ihm das dritte mit und so ungefähr eine halbe Million bar auf den Tisch des Hauses. Der wäre doch wenigstens ein würdiger Gegenstand zur Neidhammelei. Aber unsre Kitty? Schäm dich doch, Marili! – Mahlzeit, Mutter; Mahlzeit, Marili, und darum ›keine Feindschaft nicht‹ am ersten Tage.«
Sein guter Humor war selbst für die kleine tragische Muse unwiderstehlich. Sie taute auf, setzte sich dicht neben ihn, plauderte ungewöhnlich lebhaft und fand den Dampf seiner Zigarre, der in bläulichen Ringeln durchs sonnige Wohnzimmer schwebte, ideal. Ja, sie zeigte ihm sogar freiwillig ihre vollgemalten Schreibhefte und guckte ihm, während er seinen Mokka aus der großen Tasse schlürfte, so gespannt nach dem Munde, als habe sie noch niemals einen jungen Herrn Kaffee trinken sehen. Sein keckes Schnurrbärtchen gefiel ihr, und der Kneifer und die kräftigen, gutgepflegten Hände und sein Lachen, so lustig, daß es gewiß die Traurigsten froh machen müßte. In ihrer Seele keimte schon so eine verschämte Backfischschwärmerei für den Herrn Bruder. Der einzige Kummer dabei war, daß er sich entschieden weigerte, neben der Zigarre auch noch Mandeltorte zum Kaffee zu genießen.
»Morgen zum Nachtisch, falls Mutter mich nicht gleich auf das gewöhnte Pülleken Bier zurücksetzt, sondern mir noch einmal ein Glas Wein spendiert.«
Mutter sagte »ja«; sie saß behaglich zwischen ihren beiden und machte heute Arbeitsferien. Ihr Schreibpapier für das neue Werk lag schon in Marilis abgedankter Ordnungsmappe geschichtet; ein tüchtiger Stapel, und auf dem Schreibtische vor Meyers Konversationslexikon stand das ganze Arbeitsmaterial: eine lange Reihe ehrwürdiger Stadtbibliotheksbände: »Diesmal heißt's tüchtig studieren und Auszüge machen, liebster Junge. Es soll etwas Gelehrtes werden: Weltgeschichte und Volksseele.«
»Famos, Mutterchen! Wenn ich über den Berg bin, will's Gott, teile ich das alles mit dir. Stören dürfen wir einander ja nicht, und du mußt dir nur ordentlich Ruhe schaffen. Bei dir ist zum Glück nicht, wie bei mir, das zwingende ›Muß‹ vorhanden.«
»Und ich sorge für dich – für euch alle beide. Bitte, bitte, übertragt es mir!« rief Marili.
»Geschieht hiermit feierlichst, Marili. – Apropos: wo soll ich mir denn bei euch mein Nest bauen und meinen Doktor ausbrüten? Komm, zeig mir ein bißchen Hausgeographie, ehe es stockdunkel ist, Marili.«
Die Mutter ließ Bruder und Schwester allein gehen. Sie freute sich, als die beiden sich wieder Arm in Arm durch die enge Schiebetür hinausdrängten und saß ganz still in ihrer Fensterecke, damit sie die tiefe, fragende Stimme und die weiche, antwortende noch recht lange verfolgen konnte. Die festen Tritte im Zimmerchen über ihr, das rasche Türengehen und gedämpfte Sprechen beglückten sie. Wieder Leben im stillen Häuschen, wieder eine starke Hand, die sie nehmen und drücken durfte als ihr Recht und Eigentum, in die sie alle ihre geheimen Sorgen legen konnte. Um Kitty sorgte sie nicht; solch eine frische, energische Natur kam schon gut durchs Leben – Marili würde viel mehr auf die Bruderliebe angewiesen sein.
»Gott gebe, daß ihre Charaktere sich gut ineinanderschachteln,« dachte sie; »vielleicht hilft der stille Arbeitswinter dazu.«
Leicht und licht lag die Zukunft noch nicht vor dem mütterlichen Herzen, und die mütterliche Hand hätte wohl gern einmal den Schleier gelüftet, den die weise Allmacht vor das zieht, was jenseits der Gegenwart liegt. Das aber wäre ein frommes Wünschen geblieben, und ganz gewiß ist es besser für die Menschen, daß sie nicht wissen, was kommen wird.
* * *
Nun wurde es Winter und für dieses Jahr ein rechter, echter. Das trauliche Gartenstraßenhäuschen kapselte sich ein. Die weinroten Tuchgardinen vor den mattgeblümten aus englischem Musselin und die Fenstermäntel machten schon warm; das Feuer in den runden Amerikaneröfen brannte Tag und Nacht, und die gelbbeschirmten Petroleumlampen wurden jeden Abend ein paar Minuten früher angezündet. Leuchtgas, Glühlicht, oder nun gar elektrisches, dazu war die Mutter noch nicht neumodisch genug geworden, und vielleicht hatte auch der Geldbeutel nicht die rechte Größe dazu.
Draußen stäubte und wirbelte der Schnee wochenlang fast alle Tage ein paar Stunden, und über Nacht fror es meistens, – nicht Stein und Bein; die armen Spatzen und Buchfinken blieben doch sehr munter und zirpten und piepten lustig bei den Brotbrocken, die Marili ihnen morgens auf die Veranda hinausstreute, und die Blaumeisen zankten sich lebhaft um das baumelnde Speckstückchen herum. Weiß wie ein Feenmärchen standen die baumreichen Gärten; es leuchtete ordentlich ins Wohnzimmer hinein; entzückend war's draußen unter blauem Winterhimmel im Sonnenglanz oder in der frühen Glut des Abendrots, und dann, eine Stunde später, im silbernen Vollmondschein. Ueber den grünen Turmdächern von St. Paul stand ein zarter, kalter Duft und in den Steinrosetten des Matthäiturmes lag der Schnee wie hingezaubert von Künstlerhand. Die Schlitten klingelten durch die Straßen und die ländliche Chaussee hinunter, sie fuhren um die Wette mit dem Bahnzuge, und fast allabendlich machten sich die Ballkutschen auf zu dieser großen Festlichkeit und zu jener.
Marili hatte, vom Fenster aus, manch eine vorüberjagende Vision von weißen Gewändern und von rosa oder blaßgelben – wie Traumbilder so flüchtig gaukelte es vorüber. Spät, spät in den Nächten hörte sie dann die Kutschen in schnellem Trabe zum zweitenmal rollen, heimwärts mit den müden Ballblümchen. Oft meinte sie, es müsse doch schon Aufstehenszeit sein.
So viel lag sie in diesem Winter wach mit ihren Gedanken und mußte ihr eigenes Herz belauschen, sie mochte wollen oder nicht. Es war letzterzeit viel unruhiger als sonst, und daß nur die Mutter nichts davon bemerkte! Sehr angestrengt hatte sie zu arbeiten, bis tief in die Nacht hinein, und es war ihr deshalb gar nicht unlieb, daß Marili ganz ungestört droben in Kittys Stübchen schlief. – Ja, wenn sie nur gewußt hätte! Aber Marili war froh, daß sie nicht wußte.
Stetig und pünktlich besorgte der kleine, fleißige Hausgeist alle seine Pflichten, und niemand ahnte, wie oft er dann mit mattgeschlossenen Augen auf der Chaiselongue in der Eßstube lag, wenn es einmal gar zu viel Treppenlaufen gegeben hatte. Die Schiebetür in das Wohnzimmer hinein wurde immer vor solcher Ruheviertelstunde ganz sacht zugerollt, und rief etwa die Mutter vom Schreibtisch aus: »Marili, Kind, hast du gefrühstückt? was tust du?« so kam immer in gleicher Freundlichkeit die Antwort: »Ja, Mutter, ich will jetzt ›dies‹ tun oder ›jenes‹,« so daß man meinen konnte, es gäbe großen Fleiß am Mädchennähtisch und am Stopfkorbe. – An Tanzen dachte sie vorläufig nicht mit ihren jungen siebzehn Jahren; die Ballfreuden und das lustige Schlittschuhlaufen, alles sollte erst nächsten Winter mit den Freundinnen gemeinsam begonnen werden. Auch ohne das liefen die stillen Tage pfeilgeschwind. Es gab Weihnachtsarbeiten, die Briefe an Kitty und an die Freundinnen und manchmal auch ein paar heimliche Seufzer ins Tagebuch: »Warum bin ich nicht wie andre? Warum muß ich mich so oft unfähig und niedergedrückt finden?«
Wirklich, das gute Kind saß wie Schneewittchen hinter den sieben Bergen und freute sich schon morgens auf den Nachmittag, wenn die Mutter ihr erstes Tagespensum fertig hatte und es vor dem späten, zweiten, zuerst einen Spaziergang und dann eine Vorlese- oder Plauderstunde gab.
Von Bruder Karl sah man fast nichts. Den halben Tag brütete er, der Sage nach, über gelehrten Büchern in der ehrwürdigen Stadtbibliothek und eigentlich kam er nur zu den Mahlzeiten zum Vorschein. Immer ein bißchen versträubt, die Augen starr und müde, das ganze Wesen stumm und zerstreut. »Verochstheit« nannte er diesen lieblichen Zustand und behauptete, er könne bald keine Bücher und Kupferstiche mehr sehen. – »Ich werde alle Tage dümmer – ich gehe zurück! Sprecht lieber gar nicht mit mir.«
Marili traute sich, wenn er Sonntags daheim war, kaum mit dem Kaffee hinauf in seine verqualmte Höhle. Eigentlich saß nur die Mutter ab und zu, kurz vor Abendbrot, ein Weilchen bei ihm und wiegte sich langsam in des Vaters altem, geräumigem Schaukelstuhle. Sie sahen beide recht ruhebedürftig aus, die verarbeiteten Leute, und Marili sagte sich selber vor: »Ich darf nicht wackelig werden – das dumme Herz, das dumme Kopfweh! Ach was, das geht vorüber.«
* * *
»Weswegen machst du denn niemals Musik, Marili?« fragte Karl eines Tages, kurz vor Weihnachten, wie aus der Pistole geschossen. »Ich denke, du bist eine wütende Mendelssohnschwärmerin?«
»Das bin ich ja auch, aber wie kann ich dich stören?«
»Mich? Wieso? – Wenn du hübsch spielst, ist mir das keineswegs eine Störung, falls Mutter nicht – –«
»O, Mutter hat nie etwas dagegen!« Marilis Augen leuchteten auf bei der Aussicht auf ihre schmerzlich entbehrte Hausmusik. »Mutter schreibt ganz gern dabei, besonders beim Frühlingslied, und denke dir, wenn ich einmal › F‹ greife und es müßte › Fis‹ sein, so ruft Mutter mitten aus ihrem schönsten Kapitel heraus: › Fis, Marili, Fis‹!«
»Ja, vorbeihauen gilt allerdings nicht, das kann ich in den Tod nicht ausstehen,« sagte Karl. »Takt genau und Akkorde dementsprechend, das ist mein Fall. Außerdem tu', bitte, deinen Gefühlen keinen Zwang mehr an, mein Mädchen. Ich arbeite von morgen an ständig zu Hause, Mutterchen; der Stoff ist geordnet, aber es fehlte bloß noch, daß ich es euch hier in euren vier Wänden ungemütlich machte.«
»Spricht er nicht, als wäre er ›Besuch‹, der rührende Junge?« rief Marili. »Danke millionenmal, du Süßer!« Sie wollte ihm sofort um den Hals fallen, er jedoch wehrte die Liebkosung ab, halb war's Ernst, halb Scherz.
»Meine Nerven, Kind! – Hand von der Butter!«
* * *
Also Karl arbeitete jetzt daheim und Marili machte wirklich Gebrauch von seiner Erlaubnis, gleich an einem der ersten Nachmittage danach. Die Mutter hatte erklärt, daß sie notwendig eine kleine Schreibpause machen müsse, und nun saß sie zu ungewöhnlich früher Stunde rechts vom Klavier an der verstellten Verandatür und nähte eine sehr prosaische Stoßlitze um Marilis Kleiderrock. Vor ihr auf dem Bauerntischchen mit der roten gestickten Decke stand ein hoher Busch frischen Tannengrüns im Glase; Marili hatte ein paar goldglitzernde Lamettafäden darüber hingeworfen zum Weihnachtsvorschmack. Die rote Sonne, die wie eine strahlenlose Feuerkugel tief im Westen stand, spielte mit dem flimmernden Gespinst auf den dunkelgrauen Nadeln und färbte draußen alle Baumwipfel rosig. Auch das kleinste Aestchen hatte der Rauhfrost mit Zucker bepudert, und aus den Schornsteinröhren der Hausdächer stieg der Rauch kerzengerade; klar klang der Stundenschlag der Turmuhren durch die stille Luft. Es war eine gar zu schöne, festliche Landschaftsstimmung. Die Welt lag unter der Hand des Winters und regte sich nicht, sie harrte der Erlösung: Advent!
Draußen so schön und drinnen so gemütlich. Vorhin hatte die Mutter beim Wachslichtchen gesiegelt und dann die kleine Flamme ausgeblasen. Es duftete noch immer nach Weihnachten.
Marili war's auch ganz andächtig zu Mut, als sie das geliebte rotgebundene Notenbuch aufs Klavierpult legte: »Was möchtest du, daß ich spiele, Mutter?«
»Was du am liebsten magst, Liebchen.«
Sie zauderte noch ein paar Sekunden. Das jubelnde Frühlingslied paßte nicht in ihre Stimmung, die weich und traurig wurde, gerade weil die Welt so still und schön war. Endlich schlug sie den ersten Ton an – fremd und sonderbar kam ihr's vor nach der langen Pause – und dann verlor sie sich ins eigene Spiel. – Ihre Finger waren ungelenkig geworden; sie fühlte selbst, daß sie viel verlernt hatte. Mit zaghaftem Anschlage und zarter Auffassung ging sie von einer der reizenden Melodien zur andern über, herzbeweglich und traumhaft berührte dies unvollkommene Suchen und Tasten der schwachen Mädchenhände.
Zuerst eins der beiden venetianischen Gondellieder, dann das Volkslied.
Die Spielerin merkte es ebensowenig wie die Zuhörerin, daß nebenan, über der offenstehenden Eßstube ein Fuß den Takt zu Marilis Musik trat. Zwar anfänglich nur vorsichtig tippend, allein das Tippen verstärkte sich nach und nach. Ein- oder zweimal stampfte dann ein unsichtbares Stuhlbein energisch auf und die Mutter hob verwundert den Kopf.
Nun machte sich Marili an den Trauermarsch: »Tum–tum te tum –!« und da klappte oben die Tür. Gleich darauf kam's treppunter gepoltert wie das Ungewitter; Karl in der Hausjoppe, die Haare zu Berge, den Kneifer auf der Nase und die Feder hinter dem Ohr: »Donnerwetter! Dabei soll ein Mensch seinen Doktor bauen! Hör zu, steh mal 'nen Moment auf und laß mich.«
Marili stand bereits, und da saß der nervöse junge Mann schon vor dem Klavier, nachdem er das Pack Noten, das Marilis Sitz erhöhte, vom Stuhl zu Boden geworfen, trat das Pedal und begann mit Macht und Wucht: »Tu–um!! – tu–um, te tumm!«
Ja, das war allerdings ein andrer Trauermarsch; ein mächtiger Klageruf in vollen und großen Akkorden und das Zeitmaß schritt schwer und wuchtig. Karl war durchaus kein Liszt, sondern meistenteils sein eigener Musiklehrer, aber den Geist der Sache, den hatte er erfaßt.

Der nervöse junge Mann saß schon vor dem Klavier, trat das Pedal und begann: »Tu–um! –
»So!« sagte er, noch während der Schlußakkorde, » so mußt du's machen, nicht wahr, Mutter? Das andre ist gräßlich – verzeih, liebes Mädel; das macht mich glattweg verrückt. Nur nicht immer ›smorzando‹ auch manchmal ›fortissimo‹ und ›maestoso‹. Verstanden? Für heute mach Schluß, bitte, wenn du mich lieb hast, und nicht böse sein; komm Kind! versuch, ob du ein bißchen flotter trommeln kannst!«
Er drückte ihre zarte Gestalt im Fluge gegen seine breite Brust, kniff sie in die Wangen und sprang geräuschvoll wieder treppauf an seine Arbeit.
Das gemaßregelte Marili legte sein rotes Notenbuch beiseite ohne eine Silbe zu sprechen, schloß den Klavierdeckel unhörbar über den Tasten und holte aus der Bibliothek, in der Mutter Schreibtischerker, ein »Handbuch der Kunstgeschichte«, aus dem sie Mutter oft vorlas.
»Dürfte ich dir denn jetzt den Abschnitt über Velasquez zu Ende lesen, Mutter?«
»Sehr gern, Marili. Ich habe noch Zeit bis nach dem Tee. Setz dich da auf den Sessel, Kind, und sei nicht so betrübt. Männer müssen zuweilen poltern.«
Marili gab keine Antwort. Sie nahm das Gesicht der Mutter zwischen ihre kleinen Hände und drückte ihr Kinn gegen den gesenkten Scheitel. – Sie hatte in sich ein Gefühl, als wollte es ihr die Brust auseinanderreißen. Aber sie sagte sich immer vor: »Nicht weinen, nicht weinen – ruhig sein!«
Dann las sie wohl eine halbe Stunde lang ohne abzusetzen, bis das Buch zu Ende war, und sie selber wußte kaum, was sie gelesen. – »Ich muß es mit Karl ausfechten – Karl kann mich nicht leiden – Karl liebt nur Kitty – –« dachte sie unablässig.
Auch die Mutter hatte nicht übermäßig viel Gedanken für die Infanten und Infantinnen von Spanien übrig, die Velasquez so herrlich in Reifröcken, Baretts und Federhüten gemalt hatte, sondern weit mehr für ihr Marili. Das Kind war ihr oft rätselhaft: so verschlossen wurde es, so ernst und anders. Immer gleich dies still ergebene Gesicht; jedes Lächeln, jede kleine Freudenäußerung schwach und flüchtig wie ein Wintersonnenstrahl. Körperlich entwickelte sie sich; die schmächtige Figur wurde doch geformter, mädchenhafter, aber die Seele, die sich auch wohl formte, schien zu leiden. – War's nur ein unbestimmtes Sehnen ins Blaue hinein? – war's Heimweh nach den fernen Freundinnen? Sie schloß sich so schwer an, die junge Mimose in Menschengestalt.
Gerade als Marili das Buch schloß, weil Velasquez mit Prunk und Ehren zu Grabe getragen war, kam Minna mit dem Teewasser und meldete: »Fräulein Leutwein.«
»Mutter – laß mich gehen – darf ich, Mutter?« fragte Marili mit einer ganz heiseren Stimme, während Tante Klärchen sich draußen im Flur von Mantel und Pelzstiefeln befreite, und hob die Hände zu ihrer Bitte auf wie eine Tragödin. »Bitte, Mutter!«
»Kind, willst du uns keinen Tee machen?« Verwundert sah die Mutter in Marilis Gesicht. »Wie kannst du deinem Bruder, der so angestrengt arbeiten muß, etwas übelnehmen?«
»Nein, nein – nein! Mutter, vergib –«
Sie war schon am Teekessel und setzte daneben auf der Servante die Tassen zurecht und die chinesische Zuckerschale, den niedlichen Rahmguß für zwei Personen, und füllte Zwieback ins Blechtrömmchen. – Tante Klärchen war schon tief im Gespräch mit der Mutter! »Gutes Jettchen« und »liebes Klärchen« ging es lebhaft hin und her, als Marili eintrat und das Bauerntischchen für die beiden deckte.
Sie wurde auch diesmal nur ganz flüchtig begrüßt und bekam ein Liebesbriefchen von Aenne, über und über mit Markenrändern verklebt, in die Hand gesteckt: »Geht's gut, liebes Kind?« – dann war die Unterhaltung der beiden gleich wieder bei dem interessanten Thema: irgend ein Bankrott oder Todesfall, oder ein Verbrechen.
Marili hatte keine Ohren für das Gespräch. Nur hinaus – fort, – zu Karl hinauf. Wie jemand, der zu viel Wein getrunken hat, so unsicher wankte sie treppan.
Karl wollte eben ausgehen. Mit der Zigarre zwischen den Lippen trat er aus seiner Stubentür – es war seine gewöhnliche Spaziergangstunde. Da warf sich ihm, völlig unvermutet, die Gestalt seines Schwesterchens an die Brust und umklammerte ihn mit beiden Armen!
»O Karl –! Karl –! – Bruder – o, hör mich an – – ich muß – mich aussprechen!«
»Kind – Mädchen, was ist passiert, um Gottes willen, sage doch, sag!«
»Ich muß mich aussprechen. Laß mich, Karl – bitte, Karl – hör mich –!«
Wildes Schluchzen aus tiefster Brust: er wußte wahrhaftig nicht, wie rasch und leise er mit der sich anklammernden kleinen Gestalt in sein stilles Reich zurückkommen konnte. Endlich saß er glücklich wieder im Schaukelstuhl, hatte den Mantel abgeworfen, die Zigarre beiseite gelegt, hielt sein Schwesterchen umfaßt, das tränenvolle Gesicht an seiner Brust und streichelte und beschwichtigte.
»Sprich dich aus, Marili, sag alles, was du willst. Ich bin, bei Gott, kein Barbar! – hab' ich dich denn so tödlich gekränkt?«
»Nein – nein – sage doch nichts von Kränkung – daran ist ja kein Gedanke – niemals – glaub' es – glaub' es.«
»So, bleibe bei mir, liebstes Kind!«