
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Ich war in einer sehr bösen Laune. Es steckte mir etwas in allen Gliedern, entweder eine kleine Krankheit oder eine große Dummheit, und ich wußte nicht, sollte ich zum Arzt oder zum Schreibtisch gehen. Woher die böse Laune kam? Das muß man eine schöne Frau, einen reichen Mann und einen armen Redakteur nie fragen. Diese drei Naturreiche in dem Menschenreiche – wozu sogar der Naturarme: der Redakteur, gehört – sind so eigentlich dazu gemacht, stets böse Laune zu haben. Die schönen Frauen, weil ein schöner Himmel nie schöner ist, als wenn er ein bißchen blitzt und donnert, und weil bunte Tauben nie schöner sind, als wenn sie zürnend das bunte Gefieder auffächern. Reiche Leute überhaupt, weil sie an der goldnen Ader leiden. Arme Redakteurs endlich sind die wahren Essigmütter, Schwabennester und Rattenkönige der üblen Laune. Erstens schon darum, weil jeder Redakteur auch ein sie, ein Femininum in sich einschließt: die Redaktion nämlich, und also schon an und für sich Launen, diese Bandwürmer des schönen Geschlechtes, in sich beherbergen muß. Drittens endlich – eben aus übler Laune sag' ich nicht, wie ich sollte: zweitens – drittens endlich, ja, drittens endlich bin ich jetzt in böser Laune, daß ich mich selbst genötigt habe, unerklärliche Dinge – böse Launen nämlich, erklären zu wollen.
Genug – ich war in böser Laune und hatte fest beschlossen, mit ihr heute abend allein und zu Hause zu bleiben, denn mit bösen Launen und mit bösen Frauen muß man nicht unter Menschen gehen, wenn man nicht zu diesen Bösen noch ausgelacht sein will.
Ich sagte also zu meinem Joseph: »Heute Abend bleib' ich zu Hause; du wirst Thee, Erdäpfel mit Butter und Hering bereiten, mir einen ›Wegweiser durch Wien‹, eine ›Karte vom Rhein‹ und den ›Katalog der Düsseldorfer Galerie‹ auf den Tisch legen und einen Strick zum etwaigen Aufhängen an die Mauer hängen!« Ich wollte nämlich dem Spleen ein englisches Fest geben, er sollte glauben, ich bin ein reisender Engländer, und ich wollte mich eigentlich in diese dicksichtige, trägblutige, zähgeistige, dichtnebelige Gemütsverfassung eindachsen und einbibern.
Es war schon alles so schön eingeleitet, da kam ein Brief. Wenn ich sage: ein Brief, so verstehe ich darunter ein papiernes Sechseck, in sich zusammengekrümmt, geknittert, gefaltet und ineinander geschoben wie ein gordischer Knoten, und auf dem Goldblättchen, welches diese Blattzwiebel zusammengesiegelt hielt, sprang ein Pferd über eine Barriere mit der Umschrift: »Hindernisse muß man überwinden.«
Die Sendung kam von der Alservorstadt, von der »Frau Randhoferin, verwitwete Partikuliererin«.
Der Brief enthielt nichts als eine dringende Einladung zu einer Partie Whist.
Frau Randhoferin war successive Witwe zweier Männer geworden, und hatte aus diesem Successivkrieg nichts gerettet als das, was jeder Sieger aus jedem Kriege rettet: die Lust zu fernem Kriegen und Siegen. Siegerin aber blieb sie in beiden Kriegen, das heißt, sie blieb auf dem Platze, während die zwei Männer das Feld und das Leben räumten!
Ihr erster Mann war ein zurückgelegter »Zwetschkenfabrikant«, wie sie ihn gerne und mit Selbstgefälligkeit nannte, weil sie es war, die ihn vermochte, zuerst seinen aufblühenden Zwetschkenhandel und dann sich selbst an den Nagel zu hängen, das heißt, an sie, die ein Nagel zu seinem Sarge wurde. Sie hatte von diesem, den sie abwechselnd: »mein seliger Erster« und »mein seliger Zurückgelegter« nannte, zwei hinterlassene Zwetschken: Binchen (Sabine) und Röschen, zwei Zwetschken, auf denen noch der frische Jugendreif lag, und deren Kern aus seligen zurückgelegten zehntausend Gulden Heiratsgut per Zwetschke bestand.
Der zweite Mann der Frau Randhoferin war einer jener Glücklichen, die das beste Geschäft haben: gar keines, und den unantastbarsten Charakter: keinen; wenn man zu diesen beiden Eigenschaften ein sicheres Kapital von zehntausend Gulden Konventionsmünze mischt und alles bei einer gelinden Faulheit und einer mäßigen Selbstliebe aufkochen läßt, so hat man in kurzer Zeit einen substanzlosen »Privatier«. Ein solcher Privatier hat nichts zu thun, als zu liegen und zu essen, er liegt nämlich auf seinem Kapital und ißt seine Interessen. Ein solcher Glücklicher war ihr zweiter Mann, den sie stets nur: »mein seliger Zweiter«, oder: »mein seliger Privatmann«, oder auch brevi manu: »mein Privatseliger« nannte. Auch dieser Zweite machte sich zeitig von hinnen, segnete dieses und alles Zeitliche und ging ein zu seinen Vätern, wovon der eine noch lebte und Großhändler war. Auch dieser »selige Zweite« hinterließ der Frau Randhoserin zwei Töchter als Koupons seines Privatlebens, Johanna und Dore, mit der Testamentsklausel, daß die Nutznießung des Kapitals ihr bleibe, bis die beiden Töchter geholt werden, und zwar von sittsamen, gewerbetreibenden Männern.
Es lag also im Interesse der Frau Randhoferin, um diese zwei hinterlassenen Schatzkästlein von ihrem seligen Zweiten lauter Männer zu versammeln, die kein Gewerbe treiben, zum Beispiel Musikanten, Dichter, Schauspieler, Redakteure und anderes zweideutiges Volk.
Für die Kontumaz- und Heiratsabsperrung der beiden Töchter sorgte Frau Randhoferin; allein sie selbst war noch sehr geneigt, ihre eigenen körperlichen Reste und die ihres »ersten Seligen« und »zweiten Seligen« dazu an einen »dritten Unseligen« an Hymens Altare hinzugeben. Sie meinte erstens: »Aller guten Dinge sind drei.« Ob sie nun unter diesen »guten Dingen« die Männer selbst oder den Tod dieser Männer verstand, steht mir und uns nicht zu, zu beurteilen; denn auch ein Humorist darf wie ein Zivilrichter keinen animus injuriandi supponieren. Zweitens dachte sie: »Einmal ist keinmal« sagt das Sprichwort, folglich ist »zweimal einmal« und noch folglicher auch »zweimal keinmal«, und einmal muß man doch heiraten! Drittens und, wie mir scheint, der triftigste Anlaß und die ratio sufficiens ihres Entschlusses war ein juridischer Skrupel über das jenseitige Gericht, eine antizipierte Gewissenhaftigkeit und Fürsorge für ihre einstigen Richter dorten.
Denn gesetzt, wenn ihre beiden Seligen dorten befragt würden: »Wie war Frau Randhoferin als Gattin im Leben?« so könnte es doch sein, daß eine Geteiltheit der Stimmen eintreten könnte, und wie sollte da entschieden werden? Also tres faciunt Collegium; sie müßte also auch einen dritten Seligen bei Gericht sitzen haben, um dem schwankenden Pol den Ausschlag zu geben.
Frau Randhoferin war noch in den besten Jahren, denn die Witwen nennen stets die Jahre, die zwischen den beiden Ehen liegen, die besten, so wie sie es für beide Männer, für den vergangenen als auch für den futur conditionel, wirklich auch sind.
Was die persönliche Schönheit und Gestalt der Frau Randhoferin betraf, so ersetzte die Quantität die Qualität auf jeden Fall. Wenn sie zuweilen das Grab eines ihrer Seligen besuchte, und das geschah immer bei jenem, dessen Töchter sie eben mißhandelte, so glaubte man von ferne, es wäre die Pyramide des Grabmales. Sie war in Hinsicht ihrer irdischen Konstitution eine Konservative mit zeitweiligen Neuerungen!
Es ist anzunehmen, daß – wenn sie den Gram um zwei gestorbene Gatten nicht gehabt hätte – sie ganz mager geblieben wäre. Allein da sie selbst ganz und gar ein Gram war, da sie diesen Gram stets nährte, und alles, was man nährt, dick wird, so ist es kein Wunder, daß diese Witwe in specie, so wie die Witwen in genere, eine Anlage zum Dickwerden hatte.
Bei alledem konnte man nicht sagen, daß sie das Haupt hoch trägt, denn es liegt vielmehr so tief zwischen den beiden Speckschultern wie eine halbe Mandel in der Fleischpastete.
Übrigens ist es eine bekannte Sache, daß jedes und auch das häßlichste Frauenzimmer alle Gaben und Zuthaten und sozusagen dasselbe ganze Spezereigewölbe an Schönheitsmitteln besitzt wie das allerschönste, nur sind sie nicht am rechten Orte placiert. Zum Beispiel schwarze Haare, blaue Augen, rote Lippen, weiße Zähne, lange Wimpern, eine gebogene Nase, rundes Kinn, spitze Finger, breite Schultern, schmale Füße u. s. w, sind so die einzelnen Medikamente zu der Hausapotheke Schönheit. Nun aber finden sich bei den Häßlichsten alle diese Formen, Farben und Größen, nur sind sie nicht am rechten Orte, und die Natur hat in aller Eile eine kleine Verwirrung angerichtet; daraus entstanden nun: schwarze Zähne, blaue Lippen, rote Augen, weiße Haare, runde Nase, spitzes Kinn, schmale Schultern, breite Füße u. s. w.
Es wäre also unrecht, eine Person häßlich zu nennen, die alle Zeichen der Schönheit besitzt, wenn diese auch nicht geographisch und topographisch richtig angesiedelt sind.
Die hinterlassenen Werke des »seligen Zweiten«, Johanna und Dore, waren sich sehr unähnlich, und nie sind zwei an Inhalt und Einband so entgegengesetzte Exemplare aus einer Verlagshandlung in die Welt getreten, als diese zwei Schwestern. Johanna war schön, sanft, klug und hatte echt humoristische Augen, das heißt Augen, in denen himmelblaue Gemütlichkeit und zuweilen eine ganze Herzensweltgeschichte aufleuchtete; und Dore war weder schön, noch sanft, noch klug, sie hatte nicht nur keine humoristischen Augen, sondern der oberflächliche Beschauer hätte sogar an der Existenz ihrer Augen ganz und gar gezweifelt, so in sich versunken, zogen sie sich aus den Wirren und Irren dieses Lebens in ihre Höhlen zurück.
Ich war ein alter Bekannter und Hausfreund des »seligen Zweiten«, kannte die beiden Mädchen noch in ihrem Flügelkleide, und nie ist einem eine lange Bekanntschaft nachteiliger als die, welche man bei Mädchen aus so früher Zeit datiert.
Indessen besuchte ich in meiner frommen Gemütlichkeit, die befugt, Witwen und Waisen zu lieben, die Frau Randhoferin und ihre zwei Tochter von Zeit zu Zeit.
Die Frau Randhoferin besaß eine einzige Schönheit: eine schöne Hand; diese Hand und die des Schicksals lagen zwar lange und schwer auf den zwei vorausgeschickten Relaismännern, allein sie hatte doch noch wenig von ihrer angeborenen Schönheit eingebüßt, und sie spielte also eine Hauptrolle bei der Frau Randhoferin.
Wenn ich kam, küßte ich stets ihr und Johannen die Hände, Hände von zwei ganz verschiedenen Jahrgängen.
Sie, die Mutter, ließ ihre Hand, das einzige Vermächtnis ihrer gütigen Mutter Natur, lange in oder auf der Hand des Küssenden ruhen, und überhaupt war es immer die Hand, welche sich stets mit in die Konversation mischte, entweder mit Lichtputzen oder mit Tischabstäuben oder mit Lockenzurechtschiebung oder am liebsten mit und beim Kartenspiel.
Beim Whistspiel, da hat die Hand freie Hand, sich zu produzieren, beim Abheben, Mischen, Taillieren, Stichedecken, Karten zusammennehmen u. s. w.
Außer Karten geben wußte aber auch diese Hand vom Geben gar nichts, am wenigsten vom Tafel geben oder vom Souper geben.
Wenn also eine Einladung zu Frau Randhoferin zu einer Whistpartie kam, so stand in meiner Phantasie ein vierhändiger Abend da, mit zwei alten und zwei jungen Händen, aber die nichts mitbringen und nichts in die unseren legen, als sich selbst, und eine Whistpartie mit noch zwei Sibyllen aus der Alservorstadt und sonst nichts, nichts, gar nichts für Hunger und Durst und für sonstige unerläßliche Leidenschaften des menschlichen Lebens.
Bloß Johanna stand mit ihren blauen Augen in dem Hintergrunde dieses Bildes und sprach:
»Zwei Blumen blühen für den weisen Finder; sie heißen Hoffnung und Genuß. Genießen mußt du nichts, aber hoffe, hoffe!«
Das Gesellschaftszimmer der Frau Randhoferin war beleuchtet, das heißt, aus zwei Leuchtern, die zwischen Pakfong und Messing ein gelblichtes juste milieu hielten, brannten zwei Lichter, wovon das eine schon gestern sein Licht hatte leuchten lassen müssen und sozusagen schon etwas abgestumpft war, und das andere eben erst aus der Lichter-Erziehungsanstalt in die Welt trat und zum erstenmal an der atmosphärischen Luft sich entzündete. Da in jeder Gesellschaft sich große und kleine Lichter befinden müssen, so liebe ich es vorzüglich, wenn eine lange Kerze und ein kurzes Stümpfchen nebeneinander auf dem Tische stehen.
Die lange Kerze kommt mir dann immer wie eine lange französische Gouvernante vor, die ihr kleines Püppchen bewacht und dabei sich selbst im eigenen Feuer verzehrt und zerrinnend herabschmilzt.
Ich küßte die Randhoferische Hand, welche weiter unten, wo die Hand an den Vorderarm anschließt, schon einige kleine Randzeichnungen des großen Faltenwurfzeichners: »Vierzigstes Jahr!« an sich trug, und dachte dabei an die Hand Johannas, die mir eben einen Sessel zwischen sich und die Mutter hinschob, den ich auch sogleich einnahm.
»Wir haben schon auf Sie gewartet!« sprach Madame Randhoferin; »hier Herr Gröbel und Madame Ritzinger.« Ich machte mein Antrittskompliment, und die Partie Whist begann.
Herr Gröbel war einer jener auserlesenen Menschen, die davon leben, daß sie einem die Haut abziehen und den andern damit bekleiden, das heißt, er war ein Kürschner. Er hatte manchem Affen einen Bären auf den Kragen gesetzt und manchen Hasen in Fuchspelz gehüllt. Er war ein sehr dicker Mann mit ganz kleinen, stumpfen, fetten Fingerchen und mit dem Sprichworte: »Ei du mein Zobelchen!«
Madame Ritzinger war eine Quartiervermieterin und hatte weiter keine Kennzeichen, als daß sie etwas hart hörte und sehr laut schrie.
Mich selbst kennt der Leser, und so kennt der Leser die ganze Whistpartie mit allen ihren Reizen und Annehmlichkeiten.
Für Leser aber, die mich nicht kennen, füge ich das Nötigste über mich hier bei, nämlich: daß ich die Gewohnheit habe, beim Whistspiel alle Karten laut zu nennen, sowohl die, welche ich spiele, als auch die, welche die andern spielen. Eine Gewohnheit, die eben nicht zu den Annehmlichkeiten des Whistspielens gehött.
Wir saßen so:
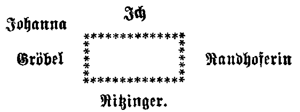
Dieser viereckige Tisch war die Quadratur unseres kleinen Zirkels. Der Tisch war ein rechtwinkliges Viereck. Für mich aber war der Winkel, wo Johanna zwischen mir und Herrn Gröbel – wie Figura zeigt – wie ein Vergißmeinnicht zwischen einer Bohnenstange und einem Wolfspelz saß, der wahre, rechte und allerrechteste Winkel.
An beiden Enden des Tisches standen die zwei Kerzen, an meiner Seite Pipin der Kurze und vis-à-vis Philipp der Lange.
Die Karten wurden gebracht, und Madame Randhoferin bemächtigte sich des Geschäfts, sie zu mischen, um dabei ihre Hand mit im Spiele zu haben. Dieses Geschäft war aber nicht so leicht abgemacht, als man glaubt. Die Karten nämlich, welche nicht von unten hinauf, sondern von oben herab dienten, brachten den Frühling ihrer Tage und sozusagen ihre goldene Jugend in einem Kaffeehause zu. Von da gingen sie, wie ein bereits gekanntes Bonmot, in das populäre Leben eines Weinhauses über, aus diesem Getümmel der Welt gingen auch sie nicht ohne irdische Flecken heraus, als sie von da durch die dritte Hand in die der Randhoferin kamen.
Diese Karten aber hatten in dem Laufe ihres wechselvollen Daseins und eben dadurch eine solche gegenseitige Anhänglichkeit aneinander gefaßt, daß man sie nur mit Mühe trennen konnte, und es dauerte oft eine ganze Weile, bis sich Carreau-Bube von der Herz-Dame losriß. Vom Schicksal mürbe gemacht, verloren sie auch viel von der angebornen Festigkeit ihres Charakters und nahmen eine Gemütsweichheit und Schlaffheit an, welche beim Geben und Mischen bedeutende Hemmungen hervorbrachte.
Mit Zeit, Geduld und mit einer Nachbarin wie Johanna überwindet man manches!
Endlich war das Mischen überstanden, und das Spiel begann. Vorher noch ein Streit.
Madame Ritzinger. Wie hoch spielen wir?
Ich. Wie es gefällig ist.
Madame Ritzinger. Es ist mir alles eins.
Herr Gröbel. Ei du mein Zobelchen! Wie Sie wollen.
Madame Randhoferin. Nein, sagen Sie!
Ich. Ich hab'gar nichts zu sagen.
Madame Ritzinger. Man spielt ja nicht, um zu gewinnen.
Herr Gröbel (lacht bedeutend).
Madame Randhoferin. Nicht gar zu hoch.
Ich. Nein, nicht gar zu hoch.
Madame Ritzinger. So sagen Sie.
Ich. Ich? O, ich überlasse es Ihnen.
Madame Randhoferin. Was meinen Sie, Herr Gröbel?
Herr Gröbel! Ich? Ei du mein Zobelchen! ich meine, was Sie meinen.
Madame Randhoferin. Was meinen Sie, Madame Ritzinger.
Madame Ritzinger. Ich? Ich meine, was der Herr Saphir meint.
Madame Randhoferin. Was meinen Sie, Herr Saphir?
Ich. O, ich meine, was die Damen meinen.
Madame Randhoferin. Nicht zu hoch.
Madame Ritzinger. Nein, nicht zu hoch.
Madame Randhoferin. Ich meine, den Fisch um einen schwarzen Groschen. Was meinen Sie, Herr Saphir?
Ich. O ja, ich meine, das ist ein sehr frugales Auskommen; o ja, ein schwarzer Groschen um den Fisch, will ich sagen, den schwarzen Fisch um einen Groschen, nein, den Fisch um einen schwarzen Groschen, ganz recht, vortrefflich, richtig!
Auch das war also abgemacht, und das Spiel begann.
Inzwischen hatten sich von Herrn Gröbel zwei junge Zobelchens, ein Junge von acht und ein anderer von neun Jahren, und ein Mädchen der Madame Ritzinger, ein Kind von sieben Jahren, eingefunden und hatten an den andern drei Tischecken Posto gefaßt, und in ihrer Begleitung kamen ihre zwei Hausmöpse: »Billi« und »Fidel«, mit, welche sich auf dem Schoße der Madame Ritzinger und des Herrn Gröbel ansiedelten und mit den Vorderfüßen auf den Tisch hinaufsprangen, als wollten sie auf dem Tisch um einen schwarzen Groschen mitspielen.
Es ist noch zu wissen nötig, daß Madame Randhoferin kurzsichtig war und zuerst jedesmal fragte: »Was ist gespielt worden?« dann die gespielte Karte vom Tische nahm, sie vor die Augen führte, sie laut benannte und wieder niederlegte.
Wenn der Leser nun den ganzen Schauplatz, die zwei- und vierfüßigen Helden der Whistpartie, die Kinder und die Kerzen kennen gelernt hat, so bleibt ihm nichts übrig, als auch noch die Lichtschere in Augenschein zu nehmen, welche diesen Kerzen beigegeben wurde. Wenn man behaupten wollte, sie war aus Silber, so würde der Eisenhändler mit Recht auf böswillige Kritik klagen, denn unstreitig waren ihre Bestandteile aus dem eisernen Zeitalter, obwohl sie schon die silberne Hochzeit mit dem einen Leuchter gefeiert hatte. Ich sage: die Hochzeit, denn sie war mit einer eisernen Kette an den Leuchter angekettet, so daß man stets, wenn man das zweite Licht putzen wollte, den Leuchter mitsamt der Lichtschere zu diesem verwickelten Geschäfte hinüberführen mußte.
Durch das lange und undankbare Geschäft, etwas zur Aufklärung beitragen zu wollen, war besagte Lichtschere mit ihrem Gewissen selbst zerfallen, sie fand in sich selbst keinen moralischen Halt mehr und fiel in einen Zwiespalt auseinander, so daß, wenn man das Licht putzte, die Schnuppe entweder auf das Licht oder auf den Tisch fiel und man dann noch immer die Naturlichtschere: die zwei Finger, zu Hilfe nehmen mußte, um diese Schnuppe in ihr eigentliches Gemach wieder einzuführen. Dabei hatte sie in irgend einer Affaire einen Fuß verloren, und der eine Finger des Putzenden fand keinen Anhalt an der einbeinigen Lichtschere. Und nun ist der Leser in vollem Lichte über die ganze Szene!
Das Spiel begann. Ich hatte die Vorhand. Ich spielte Treff-Drei aus und rief nach meiner Gewohnheit laut dabei aus: »Treff-Drei!« Madame Randhoferin fragte zugleich: »Was spielen Sie?« nahm die Karte vor die Augen und rief: »Treff-Drei!« Madame Ritzinger rief: »Was sagt Madame Randhoferin?« Ich schrie: »Sie sagt: Treff-Drei!« – »Treff-Drei?« wiederholle Madame Ritzinger und gab Treff-Neun, worauf ich laut sagte: »Treff-Neun!« Herr Gröbel aber lachte: »O du mein Zobelchen! Treff-Neun?« und gab Treff-Dame, worauf ich fagte: »Treff-Dame!« Madame Randhoferin fragte: »Was ist gespielt worden? Treff-Neun? Wer gab Treff-Neun? Wer hat denn ausgespielt?« Darauf nahm sie alle drei Karten vor die Augen und fragte: »Ist die Dame zu nehmen?« Ich fragte ironisch, indem ich Johanna die Hand drückte: »Welche Dame?« Madame Ritzinger fragte: »Was sagt Madame Randhoferin?« Ich schrie: »Ob die Dame zu nehmen ist?« – »Ob die Dame zu nehmen ist? Freilich ist die Dame zu nehmen!« Darauf warf Madame Randhoferin Treff-König zu und wollte die Karten einziehen, allein auch die kleine Ritzinger wollte die Karten einziehen, wogegen aber seinerseits der Mops Einspruch that, der auch schon seine Pfoten nach der Lever ausstreckte. Endlich zog Madame Ritzinger die Lever an sich, nachdem sie ihrem kleinen Ebenbilde einen starken und dem Mopse einen zarten Klaps angehängt hatte.
So ging die Unterhaltung lebhaft und angenehm vor sich. Jede Lever wurde zuerst einzeln ausgerufen, besprochen, hinund hergezogen, ein Kind oder eine Hand mischte sich darein, und ein Klaps endigte die interessante Debatte.
Von Zeit zu Zeit rief Madame Randhoferin mir zu: »Putzen Sie das Licht, ich bitt' Sie!« Das war leicht gesagt, aber schwer erfüllt; ich mußte dazu meine Karten aus der Hand legen, den Leuchter zum andern führen, die unanfaßbare Lichtschere mit List und Gewalt bei einem Ende erwischen und dann erst mit einem pfiffigen Manöver mich, die Lichtschere und die gefallene Schnuppe aus der Affaire ziehen. Herr Gröbel machte, wenn es ihm zu dunkel wurde, Versuche in der Experimentalphysik der Naturlichtschere, putzte das Licht mit den Fingern, wovon oft ein schwarzer Verdacht sodann auf die von ihm ausgespielte Karte überging.
Ich sah den Moment kommen, wo er mit seinen Stumpffingern das Licht auslöschen wird, und hatte auf diesen Fall eine Haupt- und Staatsaktion vorbereitet.
Richtig! Madame Randhoferin hatte eben den Herz-König mit dem Herz-Buben eingestochen, als Herr Gröbel das Licht putzte und es auslöschte. In diesem Momente hatte ich auch das meinige gelöscht, und die ganze edle und liebenswürdige Partie saß im Stockfinstern.
Mit Vergnügen bemerkte ich durch mein Gehörorgan, daß alle meine Mitspieler zuerst darauf bedacht waren, ihre Kasse in Sicherheit zu bringen und mit der einen Hand sie zu bedecken! Indem ich mich damit beschäftigte, meiner Herz-Dame zur Linken eine süße Levee von den Lippen zu pflücken, riefen alle einstimmig: »Licht! Licht!« Die Kinder fingen zu kichern an, zwickten die Möpse, diese heulten; der Lärm dauerte eine Minute, bis Johanna auf Befehl Licht bringen mußte und Kinder, Möpse, Karten und Kasse wieder in Ordnung gebracht wurden.
Wir hatten von halb sieben bis zehn Uhr richtig ganze zwei Robber gespielt! Die große Zusammenrechnung kam, ich hatte dreizehn schwarze Groschen an Madame Randhoferin und Herr Gröbel neun dito an Madame Ritzinger zu bezahlen; woraus ersichtlich ist, daß Kürschner und Poeten Lebensart haben und galant gegen Frauenzimmer sind.
Indessen hatten die drei Kindlein in meinem Hute gekocht! Sie hatten nämlich mitunter auch Küche gespielt, Brotkrumen, Wasser u. dgl. genommen und meinen Hut zur Küche gemacht. Die Möpse wollten auch an Aufmerksamkeit nicht zurückbleiben und zernagten meine Handschuh, die aus dem Hute auslogiert und auf die Erde geworfen wurden.
Madame Randhoferin tröstete mich über den Verlust von dreizehn schwarzen Groschen und sagte mit bedeutungsvollen, hoffnunggebenden Mienen:
»Unglück im Spiel, Glück in der Liebe!«
»Ach!« sagte ich neu belebt, »glauben Sie, daß ich mir in der Liebe dreizehn schwarze Groschen hereinbringen werde?«
Unterdessen war es spät geworden, ich mußte dreizehn schwarze Groschen, fünf graue Stunden und zwei blaue Augen im Stiche lassen, um Madame Ritzinger nach Hause zu begleiten. Es war ein Katzensprung! von der Alstervorstadt bis nach der St. Marrer Linie!
Ich wollte einen Wagen nehmen; das litt sie durchaus nicht, es käme ihr gerade recht, eine kleine Bewegung zu machen, und sie wüßte, ich bin sehr galant!
Das sind Folgen eines guten Rufes!
Ich brachte sie wohlbehalten in ihre Heimat und versprach ihr, sie recht oft zu besuchen, denn sie meinte: »es sei ein kleiner Spaziergang!«