
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1714. 1715
Das Testament des Königs / Sein Tod / Charakter und Lebensweise / Seine Liebschaften / Frau von Maintenon Schlussbetrachtungen
Der König alterte zusehends, und wenn sich auch in der äußeren Führung seines Lebens keine Änderung zeigte, so mehrte sich doch in jedem, der in persönliche Berührung mit dem Herrscher kam, von Tag zu Tag die Befürchtung, daß er nicht mehr lange leben werde. Es ist hier nicht der Platz, seine bis dahin so feste und unwandelbare Gesundheit des näheren zu beurteilen. Es genüge hier, wenn gesagt wird, daß sie heimlich verfiel. Nachdem er so lange Zeit unbeschränkter Herr seines Glückes gewesen war, drückten ihn nun harte Schicksalsschläge zu Boden. Dazu kam viel häusliches Unglück. Alle seine Nachkommen waren bis auf einen vor ihm dahingegangen, was ihn zu den düstersten Betrachtungen veranlaßte. Beständig sah er sein eigenes Leben bedroht. Statt daß ihm nun seine nächste vertrauteste Umgebung diese Zwangsvorstellung ausredete, verstärkte man sie fortwährend von neuem. Die einzige Ausnahme machte sein Leibwundarzt Maréchal, der alles versuchte, ihn von seinem Argwohn zu befreien. Alle anderen, Frau von Maintenon, der Herzog von Maine, Fagon, Blouin und die anderen vertrauten Kammerdiener, die alle vom Bastard und seiner ehemaligen Erzieherin bestochen waren, bemühten sich, seine mißtrauischen Gedanken noch zu verstärken, was ihnen nur allzu leicht gelang.
Niemand zweifelte, ja niemand konnte ernstlich daran zweifeln, daß der König Gift in sich trug. Auch Maréchal war davon überzeugt. Gleichwohl ließ er das den König nie merken. Im Gegenteil. Er tat alles, ihm die quälenden Gedanken zu vertreiben, die ihm schaden mußten. Andrerseits lag dem Herzog von Maine allzuviel daran, ihn in seiner Angst zu erhalten. Dasselbe erstrebte Frau von Maintenon aus Haß und Eigennutz. Ihrer Verschlagenheit gelang es, den einzigen volljährigen Prinzen des Königshauses, das sie zu vernichten beschlossen hatten, dem Könige zum Schreckgespenst zu machen. Den Herzog Philipp von Orleans. Wenn man hiernach bedenkt, daß der Monarch unaufhörlich in seinen Befürchtungen bestärkt ward, daß er den Prinzen, der als Urheber gewisser Verbrechen galt, täglich vor Augen hatte, bei Tische und stundenlang in seinem Arbeitszimmer, so begreift man, wie düster es in seinem Innern aussehen mußte.
Zudem hatte er außer seinen leiblichen Kindern auch jene unersetzliche Prinzessin Die Herzogin von Burgund. verloren, die nicht allein die Seele und Zierde seines Hofes, sondern auch sein ganzes Glück, seine ganze Freude, sein ganzes Entzücken, die letzte Sonne in seinem Dasein gewesen war. Sie war die einzige in seinem Leben, mit der er völlig vertraut verkehrte. Wie weit das ging, ist schon erwähnt worden. Nichts war imstande, die Leere auszufüllen, die durch ihren Tod entstand. Seitdem gab es für den König keine Erholung mehr, und somit wuchs sein Schmerz über den Verlust. In seiner Zerrissenheit suchte er Trost, wo immer er konnte. Er überließ sich immer mehr Frau von Maintenon und Herrn von Maine. Sie zeigten sich äußerlich stets gleichergeben und zuverlässig, und so war er in dieser Hinsicht beruhigt. Der Herzog von Maine trug ihm Berichte vor, die bis in die kleinsten Einzelheiten gingen, und gerade Einzelheiten liebte der König über alles. Seit langem hatte man es verstanden, ihm einzureden, daß Herr von Maine, trotz seiner großen Klugheit und seiner Befähigung für die Staatsgeschäfte, nicht im geringsten irgendwelche ehrgeizigen Pläne hege. Dazu sei er unfähig. Als guter Familienvater gehe er in der Familie auf. Er liebe den König auf das zärtlichste. Er mache sich nichts aus Größe, höchstens wenn er damit dem Ansehen des Königs diene. Er sei der schlichteste, freimütigste, aufrichtigste und harmloseste Mensch. Wenn des Tages Arbeit getan, die er aus Pflichtgefühl und dem Könige zu Gefallen verrichte, dann widme er sich voll Hingabe seinen Gebets- und Andachtsübungen, und darauf pflege er einsam die Jagd. In seinem häuslichen Leben sei er heiter und sehr gern gesellig. Zudem habe er keine Ahnung vom Hofe und von allem, was dort und in der Welt vorgehe.
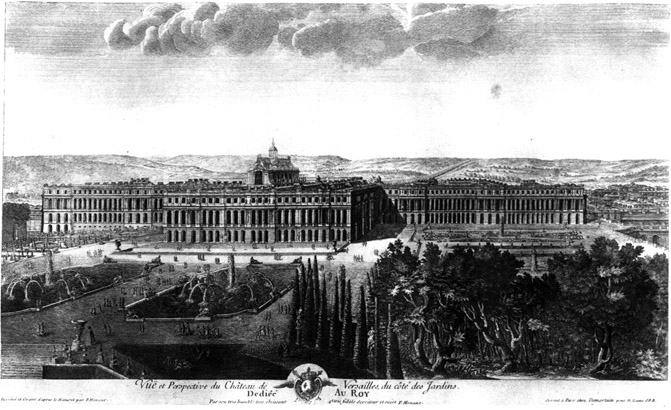
32. Versailles, vom Parke aus gesehen
Menant.
Der König war hocherfreut über diese Beurteilung, die ihn seinem Lieblingssohne gegenüber frei und behaglich stimmte. Der Herzog war fortwährend um ihn und unterhielt ihn mit seinen Geschichten und Späßen. Hierin war er ein großer Künstler, wie ich nie einen andern gesehen habe. Er plauderte leicht und gewandt, als sei das ein Kinderspiel. Dabei verstand er scharf zu sein und alles Lächerliche zu verhöhnen. Er hielt aber Maß und richtete sich nach Zeit, Gelegenheit und Laune des Königs, den er gründlich kannte. Hinter seiner Natürlichkeit und Liebenswürdigkeit vermutete man keine Hintergedanken. Wenn er wollte, war er ein meisterlicher Komödiant. Wenn man dazu seinen Charakter in Betracht zieht, so ersieht man mit Schaudern, was für eine fürchterliche Schlange der König an seinem Busen nährte. Der Herzog von Maine und Frau von Maintenon ließen, wie Saint-Simon weitererzählt, dem König keine Ruhe, bis er sein Testament aufsetzte. Der König war über diese Zudringlichkeit sehr böser Stimmung, und in seinem Groll verhehlte er auch seinem Lieblingssohne nicht, daß er selber, über seinen Tod hinaus keine Macht habe und es dem Herzog überlassen müsse, sich durch seine Persönlichkeit zur Geltung zu bringen. Über das Kodizill zu diesem nicht ganz freiwilligen Testament siehe Seite 428 f. Der König, dessen Mutter das Testament ihres Gemahls in keiner Weise geachtet hatte, mochte ahnen, daß auch sein Letzter Wille nicht erfüllt werden würde. In der Tat, der Regent Philipp von Orleans erhob Einspruch; das Testament wurde vom Parlament für ungültig erklärt, und der Herzog von Maine kam um alle seine Rechte, die dem Regenten übertragen wurden, in dessen Händen auch die Aufsicht über die Erziehung des minderjährigen Ludwig XV. lag. Da aber die Ränke des Herzogs von Maine und der Parlamentsherren nicht aufhörten, kam es in der berühmten Gerichtssitzung (lit de justice) vom 28. August 1718 zu einer Auseinandersetzung der feindlichen Gewalten: die Bastarde kamen um ihre Vorrechte als Prinzen von Geblüt, und die Juristen erfuhren eine Demütigung, die der feudale Saint-Simon mit beispielloser Begeisterung erzählt. Die Schilderung dieser berühmten Gerichtssitzung, bei der Saint-Simon alle Wonnen der Rache bis zur Neige durchkostete, gehört zu den glänzendsten Stellen seiner Denkwürdigkeiten.
Seit länger denn einem Jahre ging die Gesundheit des Königs zurück. Seine Kammerdiener bemerkten dies zuerst. Sie beobachteten alle Anzeichen des Verfalles; doch wagte keiner, etwas davon auszuplaudern. Auch dem Herzog von Maine entging dies nicht. Im Verein mit Frau von Maintenon und dem ihnen ergebenen Kanzler traf er die nötigen Vorkehrungen. Nur Fagon, der Leibarzt, an Körper und Geist bereits recht gebrechlich, war in der nächsten Umgebung des Monarchen der einzige, der gar nichts merkte. Maréchal, der Leibwundarzt, machte ihn mehreremals darauf aufmerksam, aber Fagon wies ihn jedesmal barsch zurück. Aus Pflichtgefühl und Liebe zum König wagte es Maréchal schließlich, sich an Frau von Maintenon zu wenden. Eines Vormittags um Pfingsten [1715] teilte er ihr seine Wahrnehmungen mit und bemerkte, Fagon sei hierüber falscher Meinung. Er versicherte ihr, der König, dessen Puls er häufig untersuche, leide seit langem an einem geringen, kaum merkbaren Fieber. Bei seinem vorzüglichen Körperzustand, bei guter Pflege und geeigneter ärztlicher Behandlung habe das nicht viel auf sich. Vernachlässige man die Sache aber, so könne sie schlimm werden. Frau von Maintenon ward ärgerlich. Maréchals Eifer erregte ihren Zorn. Sie erwiderte dem Arzt, es sei unmöglich, daß sich ein so tüchtiger, erfahrener und aufmerksamer Arzt wie Fagon über den Gesundheitszustand des Königs täusche. Nur die Feinde des Leibarztes seien darüber anderer Ansicht als er. Maréchal mußte sich bescheiden. Er hat mir später selbst gesagt, daß er von da an den Tod seines Herrn beklagt habe. Fagon war in der Tat theoretisch wie praktisch der erste Arzt Europas, aber er war, wie schon gesagt, aus gesundheitlichen Gründen längst nicht mehr imstande, seine Kunst voll zu betätigen. Er war nicht mehr so recht auf der Höhe, auf die ihn Kunst und Gunst gebracht. Er verbat sich jedes Für und Wider und ging mit des Königs Gesundheit nicht anders um denn in den vergangenen unbedenklichen Jahren. Sein Dickkopf mordete den Herrscher.
Der König hatte schon immer an Gichtanfällen gelitten, und da hatte ihn Fagon allabendlich sozusagen in einen Berg von Federbetten einpacken lassen. Dadurch geriet er allnächtlich so sehr in Schweiß, daß man ihn an jedem Morgen abreiben und mit einem andern Hemd versehen mußte, ehe der Großkämmerer und die Kammerherren eintreten durften.
Seit langen Jahren trank er an Stelle des besten Champagnerweins Wir wissen nicht, ob dies der natürliche Wein aus der Champagne oder der moderne Champagner war. Die Bereitung des modernen Schaumweins wurde erst möglich, als man die Flaschen mit Kork schließen konnte. Die Erfindung der Champagnerbereitung wird dem Kellermeister der Abtei Haut-Villiers, Dom Perignon, der sein Amt von 1670-1715 verwaltete, zugeschrieben. Gleichwohl soll die Bereitung des künstlichen Schaumweins schon im vierzehnten Jahrhundert bekannt gewesen sein. Es wird erzählt, Karl VI. habe dem König Wenzel von Böhmen 1397 zu Reims ein Fest gegeben, wobei zum ersten Male Champagner auf die Tafel kam und die beiden Könige so begeisterte, daß sie sich eine Woche lang täglich ein Räuschlein antranken., den er bis dahin einzig genossen, Burgunder, mit Wasser vermischt, der so alt war, daß er gar keinen rechten Geschmack mehr hatte. Er lachte oft über die Enttäuschung ausländischer hoher Herren, die sich auf die Weine seiner Tafel gefreut hatten. Nie in seinem Leben hatte er reinen Wein getrunken, niemals Schnaps, auch Tee, Kaffee und Schokolade nicht. Ehedem genoß er beim Aufstehen frühmorgens etwas Brot und Wasser mit Wein. Das war seit langem schon durch ein Getränk aus Salbei und Ehrenpreis verdrängt worden. Zwischen den Mahlzeiten und regelmäßig beim Zubettgehen trank er Eiswasser mit Orangeblütensaft, übrigens auch zu seinen Mahlzeiten und sogar in Tagen der Krankheit. Zimtkügelchen trug er jederzeit bei sich in der Tasche. Etwas andern bedurfte er von einer Mahlzeit zur andern nicht. Für seine Hunde, die in seinem Arbeitszimmer zu liegen pflegten, füllte er sich die Taschen stets mit Zwiebäcken.
In seinem letzten Lebensjahre litt er mehr und mehr an Verstopfung. Deshalb verordnete ihm Fagon als Vorgericht bei den Mahlzeiten allerhand Früchte auf Eis, wie Maulbeeren, Melonen und ganz weiche Feigen, und zum Nachtisch wiederum Früchte. Dazu vertilgte er Süßigkeiten in erstaunlicher Fülle. Zum Abendessen aß er das ganze Jahr hindurch eine unglaubliche Menge Salat. Morgens und abends aß er verschiedene kräftige Suppen, von jeder sehr reichlich. Man würzte alle seine Gerichte äußerst stark. Seinem Arzte war das gar nicht recht. Auch mit den Süßigkeiten war Fagon nicht einverstanden. Er schnitt zuweilen ein spöttisches Gesicht, wenn er den König so essen sah, wagte aber nichts zu sagen. Wildbret und Wasservögel mochte der König nicht, sonst alles ohne Unterschied. Zur Fastenzeit nahm er seit ungefähr zwanzig Jahren nur Fastenspeisen, ein paar Tage lang. Im letzten Sommer führte er die ihm verordnete Kost in den Früchten und Getränken doppelt streng durch.
Schließlich richtete das viele der Suppe folgende Obst seinen Magen zugrunde, verdarb ihm die Verdauungssäfte und nahm ihm die Eßlust. Die hatte ihm sein Leben lang nicht gefehlt; andrerseits hatte er nie Hunger empfunden und nie das Verlangen zu essen, so sehr ihm auch zuweilen der Zufall das Mittagsessen verspätete. Er hat selbst oft gesagt, daß seine Eßlust stets erst mit dem ersten Löffel Suppe erwacht sei. Er aß so stark und so gewohnheitsmäßig, daß man immer wieder staunen mußte. Aber mit dem Übermaß an Wasser und Obst, dem keine geistigen Getränke die Wagschale hielten, zersetzte er sein Blut, dem übrigens durch jene gewaltsamen Schwitzkuren die Kraft entzogen ward. Das brachte ihm den Tod. Man erkannte es bei der Öffnung seiner Leiche. Seine Eingeweide waren alle noch so gesund und kräftig, daß er damit gut hundert Jahre hätte alt werden können. Der Magen vor allem erregte Verwunderung, ebenso die Gedärme, die die gewöhnliche Länge und Größe um das Doppelte übertrafen. Daher hatte der König ein so starker und gleichmäßiger Esser sein können. An Arzneien dachte man erst, als es bereits zu spät war. Fagon hatte ja niemals an eine ernstliche Krankheit glauben wollen, ebensowenig Frau von Maintenon. Das hatte sie jedoch nicht abgehalten, für Saint-Cyr und Herrn von Maine allerhand Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Der König selbst sah am ersten ein, wie es mit ihm stand, und verlor zuweilen ein Wort darüber an seine Kammerdiener. Fagon beschwichtigte ihn jedesmal, tat aber nicht das geringste. Der König gab sich scheinbar zufrieden mit des Arztes Worten, glaubte ihnen aber nicht. Er wähnte, Fagon sowie Frau von Maintenon verstellten sich, um ihn zu schonen.
Am Mittwoch, dem 21. August 1715, untersuchten ihn vier Ärzte, und alle stimmten sie Fagon zu, der dem Kranken Kassia verordnet. Der König verschob die Besichtigung der Schweren Reiter, die er vom Fenster aus zu halten gedachte, auf den kommenden Freitag, hielt nach der Mittagstafel Staatsrat und arbeitete sodann noch eine Weile mit seinem Kanzler. Darauf besuchte ihn Frau von Maintenon, in Begleitung der nächsten vertrauten Damen. Beim Abendessen saß er im Schlafrock in seinem Lehnstuhle. Seit einigen Tagen ward es ihm schwer, Fleisch zu essen, sogar Brot, wovon er sein Leben lang kein großer Freund gewesen. Seit langem aß er nur noch die Krume, weil er keine Zähne mehr hatte. Dafür bekam er reichlich Suppe, feingehackte Fleischspeisen und Eier. Er aß jedoch sehr mäßig.
Samstag, den 24. August, hatte der König eine außergewöhnlich schlechte Nacht gehabt. Sein Bein sah beträchtlich schlimmer aus und bereitete ihm auch mehr Schmerzen denn sonst. Die Messe fand wie immer statt; die Mittagsmahlzeit nahm er im Bett ein, wozu die angesehensten Personen der Hofgesellschaft ohne weiteres Zutritt hatten. Darnach war Finanzrat. Hinterher arbeitete er mit dem Kanzler allein. Darauf kamen Frau von Maintenon und die Damen des engsten Kreises. Das Abendessen nahm der König im Schlafrock, in einem Lehnstuhl sitzend, ein, zum letzten Male in Gegenwart von Hofleuten. Ich beobachtete dabei, daß er nur Flüssigkeiten zu sich nehmen konnte und daß es ihm peinlich war, Zuschauer zu haben. Er hielt es nicht bis zum Ende der Tafel aus und bat schließlich die anwesenden Herren, zu gehen. Man brachte ihn wieder zu Bett. Das Bein ward untersucht. Es zeigte schwarze Flecke.
Der König ließ den Pater Tellier holen und beichtete. Die Ärzte waren bestürzt. Man hatte es mit Milch und Chinin versucht. Jetzt ließ man davon ab und wußte keinen Rat.
Sonntag, den 25. August, am Heiligen-Ludwigs-Tage, war die Nacht noch schlimmer. Man machte kein Geheimnis mehr aus der Gefahr, die in der Tat bereits sehr groß war. Trotzdem wünschte der König, daß an der Einteilung des Tages nichts geändert werde. So spielten die Musikkapelle wie gewöhnlich frühmorgens vor den Fenstern und auch die vierundzwanzig Geiger während der Mittagstafel im Vorzimmer. Hiernach war er allein mit Frau von Maintenon, dem Kanzler, und eine Weile auch mit dem Herzog von Maine. Vom Tage vorher, wo er mit dem Kanzler unter vier Augen gearbeitet hatte, lagen noch Tinte und Papier da. Frau von Maintenon und der Herzog von Maine, beide durch und durch Selbstlinge, waren der Meinung, der König habe in seinem Letzten Willen zu wenig für den Herzog getan. Dem wollten sie durch einen Nachtrag abhelfen. Diese Urkunde liefert den Beweis, wie ungeheuerlich des Königs Schwäche durch diese beiden Personen mißbraucht worden ist und wie grenzenlos die menschliche Eitelkeit werden kann. Durch diesen Nachtrag wurde der gesamte königliche Zivil- und Militär-Hofstaat dem Herzog von Maine, unter Beisitz des Marschalls von Villeroy, uneingeschränkt unterstellt. Dadurch wurden die beiden Genannten völlig Herr über die Person und über das Haus des Königs. Mit Hilfe der beiden Garderegimenter und der beiden Leibkompagnien bekamen sie ganz Paris in die Hände. Sie verfügten über die Schloß- und Stadtwachen, über Gericht und Kirche, über die gesamte Dienerschaft, über die Stallungen, Kleider, Küchen und Keller. Mit einem Worte, der Regent ward zu einer Strohpuppe und behielt auch nicht die geringste Macht. Er geriet völlig in die Hände der beiden. Sooft es ihn gutdünkte, konnte ihn der Herzog von Maine festnehmen und einsperren lassen.
Bald nachdem Pontchartrain den König verlassen hatte, kam auch Frau von Maintenon, die noch geblieben war, heraus und bat die Damen des engsten Kreises, einzutreten. Sieben Uhr abends traf das Hoforchester ein. Inzwischen war der König unter dem Geplauder der Damen eingeschlummert. Als er wieder erwachte, fehlte ihm die volle Besinnung. Man ward bestürzt und schickte nach den Ärzten. Der Puls ward ganz schwach befunden, und man riet dem König, die letzten Sakramente zu nehmen. Pater Tellier wurde geholt und der Kardinal von Rohan benachrichtigt. Man entließ das Orchester, das bereits seine Noten und Instrumente in Bereitschaft gesetzt hatte. Die Hofdamen verließen das Zimmer.
Eine Viertelstunde, nachdem die Musik und die Damen weggeschickt worden waren, war alles bereit. Pater Tellier nahm die Beichte des Königs entgegen, worauf der Kardinal Rohan die Letzte Ölung vornahm und ihm die Sterbesakramente reichte, was er mit einigen feierlichen Worten einleitete. Zugegen waren zwei Geistliche, die der Kardinal hatte holen lassen, sowie sieben kerzentragende Edelknaben, dazu drei Kammerdiener, ferner Pater Tellier, Frau von Maintenon, ein Dutzend Hofleute, die das Recht des Zutritts hatten, und ein paar Kammerdiener. Der König sah gefaßt aus und von der Bedeutung des Augenblicks durchdrungen. Nach der Feierlichkeit verließen alle Anwesenden das Gemach, um die heiligen Geräte zu geleiten. Nur Frau von Maintenon und der Kanzler blieben zurück. Alsbald – und diese Hast war eigentümlich – legte man dem König eine Schreibunterlage oder dergleichen auf das Bett. Der Kanzler las ihm nochmals den Nachtrag zum Testament vor. Eigenhändig schrieb der König vier oder fünf Zeilen darunter. Sodann reichte er das Schriftstück zurück.
Der König verlangte zu trinken, worauf er den Marschall von Villeroy zu sich befahl, der mit einer kleinen Anzahl hoher Würdenträger an der Tür des anstoßenden Sitzungszimmers bereitstand. Der König redete mit ihm beinahe eine Viertelstunde lang unter vier Augen. Sodann wurde der Herzog von Orleans gerufen, mit dem der König ein klein wenig länger als mit Villeroy ebenfalls allein sprach. Er versicherte ihm eindringlich seine Hochschätzung, seine Freundschaft, sein Vertrauen. Das Sinnbild Christi, das er eben empfangen, noch auf den Lippen, beteuerte der König (wie schrecklich!), er werde in seinem Letzten Willen nichts finden, womit er nicht zufrieden sein könne. Darauf legte er ihm den Staat und die Person des künftigen Königs an das Herz. Zwischen der Letzten Ölung und dieser Unterredung lag kaum eine halbe Stunde. Somit konnte er unmöglich die sonderbaren Verfügungen nicht mehr in seiner Erinnerung haben, die man ihm mit so viel Mühe abgerungen hatte und die noch verschärft worden waren durch den Nachtrag zum Testament, dessen Unterschrift noch frisch war. Dieser Nachtrag setzte dem Herzog von Orleans ein Messer an die Kehle, dessen Heft dem Herzog von Maine in die Hand gegeben ward.
Montag, den 26. August, nahm der König die Mittagsmahlzeit im Bett ein, in Gegenwart der Herren, die das Recht des Zutritts hatten. Hernach ließ er die Anwesenden näher treten und hielt folgende Ansprache:
»Meine Herren! Ich bitte Sie um Verzeihung, daß ich Ihnen ein so schlechtes Beispiel gegeben habe. Ich danke Ihnen verbindlich für die Dienste, die Sie mir geleistet, für die Anhänglichkeit und Treue, die Sie mir jederzeit bewiesen haben. Es tut mir sehr leid, daß ich für Sie nicht das getan habe, was ich gern für Sie getan hätte. Die schlechten Zeiten waren daran schuld. Ich bitte Sie, meinem Enkel Urenkel. Der Herzog von Burgund hatte zwei Söhne, den Herzog von Bretagne, der am 3. März 1712 seinem Vater als fünfjähriges Kind nachstarb, und den Herzog von Anjou, den nachmaligen Ludwig XV., geb. 15. Februar 1710. den gleichen Eifer und die gleiche Ergebenheit entgegenzubringen wie mir. Er ist noch ein Kind, das wahrscheinlich manches Schlimme zu überstehen hat. Sie müssen meinen anderen Untertanen mit gutem Beispiel vorangehen. Gehorchen Sie den Befehlen, die mein Neffe Ihnen als Verwalter des Reiches geben wird. Ich hoffe, er wird seine Sache recht machen. Ich hoffe auch, daß Sie alle an der Einheit festhalten und jeden, der beiseitegehen will, zurückgeleiten ...
Ich fühle, daß ich gerührt werde, und ich sehe, daß es Ihnen ebenso geht. Ich bitte, mir das zu verzeihen. Leben Sie wohl, meine Herren! Ich rechne darauf, daß Sie sich zuweilen meiner erinnern.«
Kurz nachdem sich alle entfernt hatten, ließ der König den Marschall von Villeroy zu sich rufen und sagte zu ihm einige Worte, die sich dieser genau gemerkt und später mitgeteilt hat:
»Herr Marschall, ich gebe Ihnen sterbend einen neuen Beweis meiner Freundschaft und meines Vertrauens. Ich ernenne Sie zum Erzieher des Dauphins. Ein wichtigeres Amt habe ich nicht zu vergeben. Sie werden durch meinen Letzten Willen erfahren, in welchem Verhältnis Sie zum Herzog von Maine zu stehen haben. Ich zweifle nicht, daß Sie mir nach meinem Tode ebenso treu dienen werden, wie Sie es zu meinen Lebzeiten getan haben. Ich hoffe, mein Neffe wird Ihnen mit der Achtung und dem Vertrauen begegnen, die er einem Manne schuldig ist, den ich immer geliebt habe. Leben Sie wohl, Herr Marschall. Ich hoffe, Sie vergessen mich nicht.«
Nach einer Weile ließ der König den Herzog von Condé und den Prinzen Conti, die in ihren Gemächern waren, rufen. Ohne sie nahe an sich herankommen zu lassen, sagte er zu ihnen nur, er empfehle ihnen, Eintracht unter den Prinzen walten zu lassen und sich nicht an schlechte Beispiele zu halten.
Als der König Stimmen von Damen im Nebenzimmer vernahm, begriff er, wer es wohl wäre, und ließ sie der Reihe nach eintreten. Es waren dies die Herzogin von Berry Marie-Louise-Elisabeth, die galante Tochter des Herzogs Philipp von Orleans und der natürlichen Tochter Ludwigs XIV., Mademoiselle de Blois; geb. 20. August 1695, gest. 21. Juli 1719, Madame, die Herzogin von Orleans und die Prinzessinnen von Geblüt. Sie schrien laut, worauf der König sagte, es schicke sich nicht, so zu schreien. Er sprach ein paar kurze freundliche Worte, besonders zu Madame. Schließlich ermahnte er die Herzogin von Orleans und die Herzogin von Condé, sich zu versöhnen. Alles das ging schnell vonstatten. Dann entließ er die Damen. Weinend und laut jammernd zogen sie sich in das Sitzungszimmer zurück, dessen Fenster offen standen, so daß man das laute Schreien draußen vernahm. Man glaubte, der König sei gestorben. Dieses Gerücht drang nach Paris und in alle Provinzen.
Einige Zeit später befahl der König, die Herzogin von Ventadour solle ihm den Dauphin bringen. Er ließ ihn an sein Bett treten und sagte ihm, in Gegenwart einiger weniger Personen seiner nächsten Umgebung folgendes:
»Mein Kind, du wirst ein großer König werden! Ergib dich nicht meiner Leidenschaft für große Bauten und für den Krieg. Trachte vielmehr darnach, mit deinen Nachbarn Frieden zu halten! Gib Gott, was Gottes ist! Erkenne die Pflichten an, die du ihm gegenüber hast! Bewirke, daß ihn deine Untertanen ehren! Folge immer den guten Ratschlägen! Suche es dem Volke zu erleichtern! Ich habe das unglücklicherweise nicht tun können. Vergiß auch nicht, gegen Frau von Ventadour dankbar zu sein!« Indem er ihn küßte, fuhr er fort: »Mein liebes Kind, ich segne dich von ganzem Herzen.«
Als man den kleinen Prinzen wegführen wollte, verlangte der König nochmals nach ihm. Abermals küßte er ihn, hob die Hände und den Blick zum Himmel und segnete ihn zum zweiten Male. Es war überaus rührend anzuschauen. Die Herzogin von Ventadour trug dann den Dauphin schnell hinweg und brachte ihn in seine Gemächer.
Wiederum nach einer kleinen Weile ließ der König den Herzog von Maine und den Grafen von Toulouse rufen. Nachdem alle anderen das Zimmer verlassen hatten und die Türen geschlossen worden waren, hatte er mit den beiden eine ziemlich lange geheime Unterredung.
Sodann ward der Herzog von Orleans, der in seinen Gemächern weilte, befohlen. Er sprach nur sehr kurze Zeit mit ihm. Als er bereits wieder gegangen war, rief ihn der König zurück und sagte ihm rasch noch ein paar Worte. Es war der Befehl, sofort nach seinem Ableben solle der junge König nach Vincennes gebracht werden und dort in der guten Luft so lange verbleiben, bis alle Trauerfeierlichkeit zu Versailles ihr Ende gefunden hätte und das Schloß wieder in Ordnung gebracht wäre. Dann sollte er in Versailles bleiben.
Dienstag, den 27. August, betraten das Zimmer des Königs nur Pater Tellier und Frau von Maintenon. Zur Messe waren nur der Kardinal von Rohan und die beiden diensthabenden Hofgeistlichen zugegen. Gegen zwei Uhr ließ der König den Kanzler holen. In seiner und der Frau von Maintenon Gegenwart ließ er zwei Kästen öffnen und einen großen Teil der darin verwahrten Papiere verbrennen. Gleichzeitig ordnete er an, was mit dem Rest geschehen solle. Gegen fünf Uhr abends bat er nochmals den Kanzler zu sich. Später ließ er den Pater Tellier rufen und unmittelbar nach dessen Weggang zum dritten Male Pontchartrain, dem er befahl, sofort nach seinem Tode zu veranlassen, daß sein Herz nach der Kirche des Ordenshauses der Jesuiten in Paris gebracht werde, wo es gegenüber dem Herzen seines Vaters in der nämlichen Weise wie dieses aufbewahrt werden solle.
Nachdem er dies bestimmt hatte, sagte er zu Frau von Maintenon, er habe immer gehört, es sei schwer, sich zum Sterben zu entschließen. Er stehe jetzt vor diesem den Menschen so fürchterlichen Augenblick; er fände jedoch nicht, daß es schwer sei, sich mit dem Tode abzufinden. Frau von Maintenon antwortete, es sei sehr schwer, wenn einen noch Liebe oder Haß an das Leben feßle oder wenn man noch etwas wieder gutzumachen habe. »Ach,« sagte der König, »wieder gutzumachen habe ich einzelnen Menschen gegenüber nichts, und was das Reich anbetrifft, so rechne ich auf Gottes Barmherzigkeit.«
Die Nacht darauf verlief sehr unruhig. Man sah den König aller Augenblicke die Hände falten. Man hörte ihn die Gebete hersagen, die er in gesunden Tagen gesprochen hatte, und bei dem Confiteor schlug er sich die Brust.
Mittwoch, den 28. August, früh, machte er eine liebe Bemerkung zu Frau von Maintenon, die sie arg verschnupfte und mit keinem Worte erwiderte. Der König sagte ihr nämlich, er tröste sich über die Trennung von ihr in der Hoffnung, daß sie ihm bei ihrem Alter bald nachfolgen werde.
Um sieben Uhr morgens ließ er den Pater Tellier rufen. Während er mit ihm über Gott sprach, erblickte er im Spiegel über dem Kamin zwei Kammerdiener, die zu Füßen seines Bettes knieten und weinten. »Warum weint ihr?« fragte er sie. »Habt ihr geglaubt, ich sei unsterblich? Ich für meine Person habe das nie geglaubt. Da ich alt bin, so mußtet ihr längst darauf vorbereitet sein, daß ihr mich verliert.«
Ein Bauer aus der Provence, ein riesengroßer Kerl, hatte auf dem Wege von Marseille nach Paris erfahren, daß es um den König schlecht stand. An diesem Morgen erschien er in Versailles mit einem Heilmittel, das, wie er behauptete, den Brand zu heilen imstande sei. Dem König ging es schlimm, und die Ärzte standen dermaßen am Ende ihrer Künste, daß sie in Gegenwart der Frau von Maintenon und des Herzogs von Maine einwilligten, das Mittel zu versuchen. Fagon wollte Einrede erheben, da wurde ihm der Bauer, der sich Lebrun nannte, dermaßen grob, daß Fagon, der es gewöhnt war, alle Leute anzufahren, von ihnen aber hündische Ehrfurcht zu verlangen, kreidebleich ward. Nun gab man dem König zehn Tropfen der Flüssigkeit in spanischem Wein ein. Das war um elf Uhr vormittags. Bald darauf fühlte sich der König wohler, aber der Puls war schwach geworden und blieb so. Gegen vier Uhr gab man ihm nochmals davon, indem man ihm sagte, es bringe Leben. Er nahm das Glas mit den Heiltropfen und meinte: »Leben oder Tod! Ganz wie es Gott gefällt!«
Frau von Maintenon verließ dann das Zimmer, ihren Schleier vor dem Gesicht, begleitet vom Marschall von Villeroy. Vor ihren Gemächern blieb sie stehen, zog den Schleier weg und verabschiedete sich von ihm. In kühlstem Tone sagte sie: »Leben Sie wohl, Herr Marschall!«
Ohne ihre Räume zu betreten, stieg sie in die Hofkutsche, deren sie sich tagtäglich bediente und in der bereits Frau von Caylus wartete, und fuhr nach Saint-Cyr. In einem ihrer Wagen folgten ihr ihre Frauen.

13. Charles Le Brun (1619-1690)
Selbstporträt (1684).
Florenz, Uffizien.
Die schmeichelhafte Aufforderung Cosimos III., ihm für die Sammlung der Selbstbildnisse der Uffizien sein Porträt zu senden, beantwortete Le Brun am 8. Februar 1683 mit einem Schreiben, worin es heißt »... Je suis trop convaincu que mon portrait est indigne d'avoir une place dans ce fameux cabinet où l'on voit les plus belles choses d'Europe ... Comment luy pourrois-je reffuser mon portrait, moi qui me frois gloire de me donner en personne à Elle, si le service du plus grand Roy de l'univers ne me retenoit à Paris ...« – Im November 1684 sandte Le Brun das Porträt nach Florenz und bekannte in dem Begleitschreiben vom 20. dieses Monats »... Je ne me suis jamais faict une joye d'estre connu par les traits de mon visage.« Vgl. Gualandi: »Nuova raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architectura etc.« Bologna 1854-1856, III. Bd., S. 199-202.
Das Lebrunsche Mittel ward dem König weiterhin eingegeben. Als man ihm eine Tasse mit Fleischbrühe anbot, bemerkte er, man solle zu ihm nicht wie zu jedem Beliebigen sprechen. Er brauche keine Fleischbrühe, sondern seinen Beichtvater. Dieser wurde geholt.
Als er einmal aus einer vorübergehenden Bewußtlosigkeit erwachte, bat er den Pater Tellier um Erlaß von allen seinen Sünden. Der Geistliche fragte, ob er große Schmerzen habe. »Ach nein,« antwortete der König, »das ist gerade das Schlimme! Ich möchte mehr leiden, um meine Sünden zu sühnen!«
Am Donnerstag, dem 29. August, nachdem der Mittwoch sowie die Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag so schlimm gewesen waren, fühlte sich der König im Laufe des Vormittags merklich wohler. Dieser Schimmer von Besserung verbreitete sich schnell und wurde gewaltig übertrieben. Der König nahm zwei Biskuits in spanischem Wein nicht ohne Eßlust zu sich.
Um zwei Uhr nachmittags machte ich dem Herzog von Orleans einen Besuch in seinen Gemächern, in denen sich seit acht Tagen zu jeglicher Tageszeit eine solche Menge Menschen drängte, daß tatsächlich kein Apfel zur Erde fallen konnte. Diesmal fand ich dort keine Menschenseele. Als mich der Herzog erblickte, lachte er und sagte mir, ich sei heute der einzige Besucher. Majestäts besserer Stuhlgang habe sie alle weggeblasen. Bis zum Abend kam in der Tat niemand weiter. So ist die Welt.
An diesem Tage bezeichnete der König gelegentlich eines Befehles, den er gab, den Dauphin als den jungen König. Als er die Bewegung bemerkte, die dieses Wort unter den Anwesenden hervorrief, fragte er: »Warum? Mir bereitet es keinen Kummer.«
Um acht Uhr nahm er wiederum die Heiltropfen des Mannes aus der Provence ein. Der Kopf war dem König benommen, und er sagte, er fühle sich gar nicht wohl. Gegen elf Uhr abends wurde das Bein untersucht. Der Brand wütete im Unterschenkel und Knie. Der Oberschenkel war stark geschwollen. Während dieser Untersuchung fiel der König in Ohnmacht. Zu seinem Schmerze hatte er bemerkt, daß Frau von Maintenon nicht anwesend war. Sie hatte die Absicht gehabt, nicht wiederzukommen. Da der König mehrfach nach ihr fragte, konnte man ihm ihren Weggang nicht verheimlichen. Nun schickte er nach Saint-Cyr und ließ sie holen. Am Abend kam sie zurück.
Freitag, der 30. August, verging so schlecht wie die Nacht vorher. Der König befand sich in einem Zustande des Halbschlafes. Von Zeit zu Zeit nahm er ein wenig Gelee und etwas Brunnenwasser zu sich. Wein mochte er nicht mehr. Im Zimmer verblieben nur die dringlichst nötigen Kammerdiener und Frau von Maintenon. Pater Tellier ließ sich ab und zu blicken, jedoch selten. Er war nicht einmal immer in seinen Gemächern. Ebensowenig der Herzog von Maine. Ein paarmal hatte der König lichte Augenblicke.
Fünf Uhr abends begab sich Frau von Maintenon in ihre Gemächer, verteilte alles, was darin ihr Eigentum war, an ihre Dienerschaft und fuhr dann nach Saint-Cyr, um es nie wieder zu verlassen.
Die Nacht zum Samstag und Samstag, der 31. August, waren schrecklich. Der König war nur einige wenige flüchtige Augenblicke bei vollem Bewußtsein. Der Brand hatte das Knie und den ganzen Oberschenkel ergriffen. Auf Anraten des Herzogs von Maine gab man dem Könige eine Arznei ein, die der verstorbene Abbé Aignan erfunden hatte, ein ausgezeichnetes Mittel – gegen die Blattern. Die Ärzte ließen alles zu, weil keine Hoffnung mehr war.
Gegen elf Uhr abends ging es so schlecht, daß man anfing, die Sterbegebete zu sprechen. Das Getöse dabei brachte den König wieder zu klarerem Bewußtsein. Mit einer Stimme, die man aus dem Gemurmel der zahlreichen Priester und sonstigen Anwesenden deutlich heraushörte, sprach er die Gebetsworte mit. Als das Beten zu Ende war, erkannte er den Kardinal Rohan und sagte zu ihm: »Das ist die letzte Gnade der Kirche!«
Dies waren die letzten an einen Menschen gerichteten Worte des Königs. Mehrere Male flüsterte er dann noch: »Nunc et in hora mortis«, und schließlich sagte er: »O mein Gott, steh mir bei, komm mir schnell zu Hilfe!« Das waren seine letzten Worte.
Die ganze Nacht brachte er ohne Bewußtsein und in langem Todeskampfe zu. Er starb am Sonntag, den 1. September 1715, morgens 8¼ Uhr, drei Tage bevor er sein 77. Lebensjahr vollendet hätte, im 72. Jahre seiner Herrschaft.
Man kann dem Fürsten viele gute, ja sogar große Eigenschaften nicht absprechen; aber man findet doch noch mehr kleinliche und Schlechte an ihm, ohne daß es möglich wäre, zu entscheiden, was ihm eigentümlich war und was er von anderen angenommen hatte. Und Leute, die zu Schreiben verstehen, die ihn aus eigener Anschauung kennen und fähig und in Selbstzucht genug sind, um ohne Haß und ohne Schmeichelei im Guten wie im Schlimmen die nackte Wahrheit über ihn zu sagen, solche sind äußerst dünn gesät. Die folgenden Blätter werden die erste Forderung sicher erfüllen, und was die zweite betrifft, so will ich versuchen, gewissenhaft jede Leidenschaft auszuschalten, um nach Möglichkeit gerecht zu sein.
Es ist hier nicht der Platz, von den ersten Regierungsjahren Ludwigs XIV. zu sprechen. In frühesten Jahren auf den Thron berufen, wurde er durch die Politik seiner Mutter, die herrschen wollte, unterdrückt; noch mehr aber durch die rege Selbstsucht eines verderblichen Staatsmannes, der des Landes Wohl tausendmal seiner eigenen Größe opferte. Solange Mazarin lebte, blieb er unter dessen Joch gebeugt, und diese Jahre müssen von der Königszeit des Fürsten abgerechnet werden.
Man muß es offen sagen: der König war weniger denn mittelmäßig begabt, aber bildungsfähig. Er liebte den Ruhm und hielt auf Ordnung und Gesetz. Er besaß natürlichen Verstand, war mäßig, verschwiegen, Herr seiner Bewegungen und seiner Sprache und, so sonderbar es klingen mag, im Kern seines Wesens gütig und gerecht. Gott hatte ihn genügend befähigt, ein guter, ja vielleicht ein großer Herrscher zu werden, wenn nicht äußere Einflüsse dazu gekommen wären.
Als Kind wurde er so vernachlässigt, daß sich niemand getraute, sich seinen Gemächern zu nähern. Er hat später oft von dieser Zeit mit Bitterkeit gesprochen. So erzählte er, man habe ihn einmal abends im Garten des Palais-Royal, der damaligen Hofburg, aus dem Weiher fischen müssen, in den er gefallen war. Man brachte ihm nicht einmal ordentlich Lesen und Schreiben bei. So blieb er sein lebelang unwissend und hatte von den Hauptdingen der Weltgeschichte, von den Zeitereignissen, vom Geld- und Verwaltungswesen, von den Sitten und Gebräuchen, von der Geschichte des Adels, von den Gesetzen usw. keine Ahnung. Manchmal beging er sogar vor der Öffentlichkeit die allergrößten Schnitzer.
Es könnte den Anschein haben, als hätte der König den Hochadel begünstigt und dessen Sondertum gefördert. Dies war indessen durchaus nicht der Fall. Er hatte vor Aristokraten der Geburt genau soviel Furcht wie vor Aristokraten des Geistes. War jemand beides in einer Person und verriet dies, so war er erledigt.
Seine Minister, seine Generale, seine Mätressen und Höflinge erkannten bald nach seinem Regierungsantritt seine Fehler, eher als seine Ruhmsucht. Man lobte den Herrscher um die Wette und verdarb ihn damit. Dieses Loben, besser gesagt, diese Lobhudeleien sagten ihm dermaßen zu, daß selbst die gröbste Sorte Erfolg und die niedrigste zum mindesten ein huldvolles Lächeln nach sich zog. Schmeichelei war der einzige Weg, sich den König geneigt zu machen. Seine Günstlinge verdankten ihre Vorteile nicht allein ihrem guten Stern, sondern ebenso ihrer Unermüdlichkeit in jener Hinsicht. Die übergroße Macht seiner Minister hatte die nämliche Quelle, da sie fortwährend Gelegenheit hatten, ihm Weihrauch zu streuen, indem sie so taten, als ginge alles vom Könige aus, was in Wirklichkeit aus ihren Köpfen kam, und als sei er der hohe Herr und Meister, von dem sie dauernd lernten. Geschmeidigkeit, Lakaiengetue, Speichelleckerei und vor allem die Kunst, im Dunstkreise der Majestät im Nichts zu ersterben und so zu tun, als sei man alles lediglich durch die allerhöchste Huld und Gnade, das waren die Hauptmittel, dem Herrscher zu gefallen. Wenn man dies auch nur ein wenig außer acht ließ, fiel man bei ihm auf immerdar in Ungnade, wie es zum Beispiel Louvois erging.
Dieses Übel wuchs beständig und erreichte eine unglaubliche Höhe. Dabei war der König gar kein geistloser Mensch und besaß auch eine gewisse Erfahrung. Obgleich er weder Stimme noch Gehör hatte, sang er im Kreise seiner Getreuen die Opernstellen vor, die ihn verherrlichten. Das war ihm eine Art Wollust. Bei Festmahlen im größeren Kreise, bei denen es zuweilen Tafelmusik gab, trällerte er solche Lobgesänge vor sich hin, sobald das Orchester die Melodie dazu spielte.
Eng verwachsen mit dieser Schwäche war die Ruhmsucht des Königs, die ihn auch zeitweilig den Armen der Liebe entriß. Infolgedessen war es eine Leichtigkeit für Louvois, ihn zu großen Kriegen zu bewegen. Daß der eigentliche Kriegsanlaß manchmal nichts weiter war als das Begehren, Colbert zu stürzen, oder die Angst, selbst gestürzt zu werden, oder der Drang nach noch größerer Macht, das entging dem Fürsten. Louvois wußte ihm einzureden, er selber sei ein größerer Feldherr als seine Heerführer alle miteinander, sowohl auf theoretischen wie praktischen Gebieten. Die Generale machten dem König die Freude und ließen ihn bei seinem Wahn. Männer wie Condé und Turenne taten das. Wie viel mehr ihre Nachfolger! Der König war hierin maßlos leichtgläubig. Voll erstaunlichem Selbstgefallen hielt er das Bild von sich für echt, das man ihm vorspiegelte.
Dadurch erklärt sich auch seine Vorliebe für Truppenschauen, die dermaßen ausartete, daß ihn seine Feinde den Paradekönig nannten, sowie für Belagerungen, bei denen er seine Tapferkeit zeigen konnte, ohne groß in Gefahr zu geraten. Bei solcher Gelegenheit ließ er sich gern mit Gewalt zurückhalten. Er ließ seine Fachkenntnisse leuchten, bewies seine Umsicht, seine Wachsamkeit und seine Felddienstfähigkeit. Mit seinem kräftigen und prächtig gebauten Körper vermochte er Hunger, Durst, Frost, Hitze, Regen und jegliches schlechte Wetter zu ertragen, ohne daß es ihm lästig ward. Dabei hörte er es sehr gern, wenn man seine soldatische Ausdauer, sein kriegerisches Aussehen und seine Feldherrnmiene, seine Reitfertigkeit und sein ganzes Gebaren laut rühmte.
Der Felddienst und sein Heer gaben den Hauptstoff her, wenn er sich mit seinen Mätressen, oft auch, wenn er sich mit seinen Höflingen unterhielt. Er verstand, geschickt in gewählten Ausdrücken und anschaulich zu reden. Er war ein besserer Erzähler als alle um ihn herum. Auch trug er gut vor. Selbst wenn er etwas Alltägliches sagte, offenbarte sich darin eine gewisse natürliche feine Würde.
Sein Geist hatte einen angeborenen Sinn für das Kleine. Infolgedessen gefiel sich der König in allerlei Nebensachen. Allezeit beschäftigten ihn an seinen Soldaten die Einzelheiten der Kleidung, Ausrüstung, Bewaffnung, Ausbildung, des Drills und der Führung. Ebenso war er ein Kleinigkeitskrämer in seinen Bauten, seinem Hofstaat, sogar in den Angelegenheiten seiner Küche. Immer und überall bildete er sich ein, Fachmenschen belehren zu können. Allerdings nahmen diese Leute seine Belehrungen an, als seien sie Neulinge in Dingen, mit denen sie seit Jahren vertraut waren.
Solche Zeitvergeudung, in der sich der König so wichtig vorkam, als leistete er ordentliche andauernde Arbeit, war seinen Staatsmännern höchst willkommen. Es war kein besonderes Kunststück für gewandte Menschen, den König dahin zu bringen, daß er ihre Vorschläge für seine eigenen Erfindungen ansah und darnach handelte. So kam es, daß er große Dinge nach dem Sinne und oft auch zum Vorteile anderer vollzog und vollbrachte. Kein Wunder, daß sie nichts lieber sahen, als wenn er sich an kleine Dinge verlor.
Eitelkeit und Hochmut wurden in ihm großgezogen und täglich frisch genährt, ohne daß er selbst es gewahr ward. Sogar die Priester auf den Kanzeln taten hierzu das Ihre. Und seine Minister erhoben ihn bis zu den Sternen, planmäßig und grundsätzlich. Er sei der Allerhöchste und unerreichbar. So umschmeichelten sie ihn. Je einflußreicher er seine Staatsmänner mache, je angesehener die Werkzeuge seiner Gesetzgebung seien, um so höher steige sein eigenes Ansehen, um so besser werde man ihm gehorchen. Staatsschreiber und Beamte entledigten sich nach und nach des Mantels, der Beffchen, des schwarzen Rockes. Vom Einfarbigen, Einfachen, Unauffälligen gingen sie über zur Kleidung des Adels und zu dessen Sitten. Sie strebten nach Vorteilen und ruhten nicht eher, bis sie zur königlichen Tafel zugezogen wurden. Genau so ihre Frauen. Unter allerlei Vorwänden persönlicher Art drängten diese sich kraft der Stellung ihrer Männer in die Gesellschaft des Hochadels. Wie die Damen der höchsten Kreise hatten sie freien Zutritt bei Hofe.
Einander waren die Würdenträger spinnefeind. Aber das eine Interesse einigte sie mit starken Banden. Die Macht, die sie sich erlistet, währte bis ans Ende der Herrschaft Ludwigs XIV. Alle diese Leute machten ihn immer eitler und schließlich ebenso eifersüchtig, wie sie unter sich waren. Es gab nur eine Hoheit: Er. Jede andre Überlegenheit war ihm ein Dorn im Auge und konnte ihn in schier unverständliche Wut bringen, als ob Titel, Würden und Ämter mit ihrem Drum und Dran nicht alle ebensogut von ihm herrührten wie die Stellen der Minister und Staatssekretäre. Die allein hielt er für den Ausfluß seiner Hoheit und erhöhte sie ungemessen, während er alles andre ihrer Macht unterwarf.
Audienzen in seinem Arbeitszimmer gehörten zu den allergrößten Seltenheiten. Nicht einmal Aufträge und Berichte in seinen persönlichen Angelegenheiten gab oder empfing er unter vier Augen. Niemals hatte Zutritt, wer einen ausländischen Posten antrat oder davon zurückkehrte; niemals ein einfacher Offizier, ein paar gewisse und seltsame Fälle ausgenommen, und ganz vereinzelt einer von den Regimentern, die den König näher angingen. Ausrückenden Generalen ward zuweilen – oft auch nicht – eine kurze Unterredung gewährt. Eine noch kürzere bei ihrer Wiederkehr aus dem Felde. Ihre Briefe gingen durch die Minister an den König, mit Ausnahme von wenigen seltenen Fällen. Allein Turenne, der offenkundig mit Louvois gebrochen hatte, konnte es im Glanze seines Ruhmes und bei der hohen Verehrung, die er genoß, wagen, seine Berichte an den Kardinal von Bouillon zu senden, der sie unmittelbar dem König unterbreitete. Der Kriegsminister bekam sie erst nachher, und neue Befehle und Bescheide wurden mit ihm beratschlagt.
Der König hatte eine übertrieben hohe Ansicht von seiner Größe und Herrscherwürde. Sie grenzte an Größenwahn. Zu seiner Ehre sei es aber gesagt, daß man trotzdem durch Audienz etwas erreichen konnte. Die Hauptsache war nur, daß man überhaupt eine erhielt und daß man ihm dann mit aller Ehrfurcht vor Augen trat, die Krone und Herkommen verlangten. Ich habe mancherlei darüber gehört und kann auch aus eigener Erfahrung reden, denn man hat mir Gehör bewilligt, und manchmal hab ich es mir auch erschlichen. Der König war dann zunächst ungehalten auf mich. Immer versuchte ich, ihn zu besänftigen, und wenn ich hinausging, war er sogar zufrieden mit mir, was er sich gegen mich und andere anmerken ließ.
Bei solchen Audienzen – seine Voreingenommenheit und seine Ungnade mochten in seinen Augen noch so berechtigt sein – hörte er stets geduldig und gütig zu, und er unterbrach einen nur, um die Sache zu verstehen und Fragen zu stellen. Er hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und wollte in allem die Wahrheit hören, selbst wenn sie ihn in Zorn versetzte. So war er bis an sein Lebensende. Man durfte die gewagtesten Dinge sagen, vorausgesetzt, daß man dabei eine achtungsvolle, ergebene, unterwürfige Miene zur Schau trug. Ohne sie war man verloren. Benahm man sich jedoch vorschriftsmäßig, so durfte man dem König sogar ins Wort fallen oder ungehindert Tatsachen anzweifeln, die er anführte, oder lauter reden denn er. Es fiel ihm nicht ein, dergleichen übelzunehmen. Im Gegenteil. Er rechnete sich selbst eine solche Audienz hoch an und war voll Lobes über den, der darum nachgesucht hatte. Er ließ dann seine Vorurteile gegen ihn fallen und vergaß alle Schlechtigkeiten, die man ihm über den Betreffenden hinterbracht hatte. In der Art und Weise, wie er ihn fortan behandelte, brachte er das auch zum Ausdruck. Die Minister gaben sich infolgedessen alle erdenkliche Mühe, ihm in der Zahl der Audienzen Einschränkung einzureden. Es gelang ihnen genau so gut wie alles andere.
Deshalb wurden die Ämter und ihre Vertreter, die unmittelbar mit dem König zusammenkamen, so ungeheuer einflußreich. Die Minister konnten ihm jederzeit vortragen. Es handelte sich bei ihnen nicht um besondere Audienzen. Sie wurden vorgelassen, wann sie es wünschten, und keine Menschenseele erfuhr etwas davon. Aus demselben Grunde war der freie Zutritt der Grandseigneurs mehr eine besondere Gnade denn eine Auszeichnung. Die Marschälle von Bouffiers und von Villars Der König hatte allen Grund, den Marschall de Villars (1653 bis 1734), dessen Gestalt Saint-Simon nicht mit den Augen eines Freundes ansah, mit Würden und Auszeichnungen zu bedenken; dieser Glückssoldat war es, der Frankreich durch den Sieg bei Denain (1712) vor dem Untergang rettete. Saint-Simon behauptet (XXIII, 96), Villars habe das Treffen nicht einmal aus eigenem Antriebe geliefert. wurden damit belohnt und somit den Pairs gleichgestellt, und ihre Ämter wurden in ihrer Familie erblich, in einer Zeit, als der König keine Stellen mehr verschenkte.
Aus allem geht hervor, daß man Grund genug hat, jene greuliche Erziehung bitter zu beklagen, die ihr Ziel einzig darin sah, Geist und Herz des Monarchen zu vergiften, ebenso jene nichtswürdige Götzendienerei vor dem Fürsten und die grausame Politik seiner Minister, die ihn immer unerreichbarer machte. Um ihrer Größe, ihrer Macht und ihres Glückes willen lagen sie ihm beständig in den Ohren mit Schmeicheleien über seine Macht, seine Größe und seinen Ruhm. Sie waren sein Verderb. Wenn sie auch Güte, Gerechtigkeitssinn und Wahrheitsliebe nicht völlig in ihm erstickten, so stumpften sie diese Eigenschaften doch bedenklich ab. Eifersüchtig wachten sie darüber, daß keine seiner Tugenden Früchte trug. Der Fürst und sein Land waren ihre Opfer.
Sie waren der Quell seines grenzenlosen Hochmutes. Hätte Gott in ihm nicht unablässig – auch in Zeiten zügellosester Vermessenheit – die Angst vor dem Teufel wach erhalten, fürwahr, er hätte sich anbeten lassen. Und es hätten sich Anbeter gefunden. Den Beweis liefern seine – gelinde ausgedrückt – übertriebenen Standbilder. Das auf dem Siegesplatze beispielsweise, mit der heidnischen Aufschrift, das ihn so entzückte. Auf der Place des Victoires, 1685 von Mansart angelegt, ward 1686 ein Standbild Ludwigs XIV. errichtet, mit der Inschrift: Viro lmmortali. Während der großen Revolution zerstört, ist es 1822 durch ein Reiterstandbild des Königs ersetzt worden. Dieser unselige Hochmut hat viel Unheil gestiftet, wie wir gesehen haben und noch sehen werden.
Niemals hat ein Fürst in so hohem Maße die Gabe besessen, in die Beweise seiner Huld so viel Gnade zu legen und sie dadurch doppelt wertvoll zu machen, wie Ludwig XIV. Niemand verstand so wie er seine Worte, sein Lächeln, seine Blicke zu verschenken. Es waren Kostbarkeiten, die er hoheitsvoll spendete, selten und knapp. Wendete er sich zu jemandem mit einer Frage oder einer gleichgültigen Bemerkung, so hefteten sich sofort aller Blicke auf den Betreffenden. Es galt dies für eine Auszeichnung, um deretwillen man im Ansehen der anderen stieg. Jedermann sprach davon. So war es mit allen Aufmerksamkeiten und Auszeichnungen und Gunstbeweisen, die er den Verhältnissen entsprechend austeilte. Nie kam es vor, daß er gegen jemanden unhöflich war. Fand er etwas zu rügen oder zu verbieten, was selten geschah, so tat er es stets in mehr oder minder gütiger gelassener Art, nie gereizt oder zornig. Zuweilen lag Strenge in seinem Tadel.
Er war außerordentlich höflich in Wort und Wesen. Dabei verstand er es, seine Höflichkeit je nach Alter, Rang und Verdienst abzumessen und abzustufen. Jede seiner Antworten, die über sein »Wir werden sehen!« hinausging, war ungemein verbindlich. Die nämliche Abstufung legte er in seinen Gruß und in die Art, wie er die Verneigungen der Kommenden und Gehenden aufnahm. Es war wundervoll, ihn zu sehen, wie verschieden er vor der Front des Heeres oder bei der Truppenschau den Gruß seiner Soldaten entgegennahm. Ganz besonders bewundernswert war seine Höflichkeit gegen die Frauen. An keiner ging er vorbei, ohne den Hut zu lüften, selbst nicht an Kammerfrauen, die ihm als solche bekannt waren. Vor Damen zog er den Hut vollständig ab, aus größerer oder geringerer Entfernung. Vor großen und hohen Herren nahm er ihn halb ab und hielt ihn so ein paar Augenblicke über dem Haupte. Herren geringeren Ranges begrüßte er mit der Hand am Hut. Prinzen von Geblüt wurden wie Damen gegrüßt. Wenn er mit Damen sprach, bedeckte er sich erst nachher wieder. So hielt er es außer dem Hause, denn im Zimmer trug er niemals einen Hut. Er verneigte sich stets leicht, wenn auch mit mehr oder minder Unterschied. Seine Verbeugungen waren unvergleichlich vornehm und hoheitsvoll, selbst wenn er sich bei der Abendtafel nur halb erhob, sobald eine Dame eintrat, die das Vorrecht, sich zu setzen, hatte. Bei andern, auch beim Eintritt der Prinzen von Geblüt, blieb er sitzen. Als er älter ward, fiel ihm dies Grüßen bei Tische schwer. Trotzdem stellte er es nicht ein. Aber die Damen vermieden es schließlich von selbst, noch einzutreten, wenn das Mahl bereits begonnen hatte. Mit äußerster Verbindlichkeit nahm er stets die Dienste Monsieurs, des Herzogs von Orleans und der Prinzen von Geblüt entgegen. Die Prinzen grüßte er militärisch, Monseigneur und dessen Söhne ebenfalls, aus Vertraulichkeit; hohe Offiziere gütig und aufmerksam.
Mußte er beim Ankleiden auf irgend etwas warten, so zeigte er sich nie ungeduldig. Pünktlich hielt er alles ein, was er angeordnet hatte. Seine Befehle waren stets knapp und klar. Im Winter bei schlechtem Wetter, wenn er nicht ins Freie konnte, kam es zuweilen vor, daß er eine Viertelstunde vor der angesagten Zeit zu Frau von Maintenon ging. War da der Gardehauptmann vom Dienst noch nicht zur Stelle, so versäumte er niemals, diesem hinterher zu sagen, daß ihn kein Vorwurf träfe, als sei er zu spät gekommen; sondern er, der König, habe die Stunde nicht genau eingehalten. Infolge seiner Regelmäßigkeit in allem ward er stets aufs pünktlichste bedient. Für die Höflinge war das unsagbar bequem.
Seine Dienerschaft, besonders seine Kammerdiener, behandelte er sehr gut. Unter ihnen fühlte er sich am wohlsten, und mit ihnen, besonders mit den obersten, verkehrte er völlig vertraut. Ihre Liebe oder ihre Feindschaft ist oft von großem Einfluß gewesen. Beständig zu guten oder schlimmen Diensten bereit, waren sie mit jenen mächtigen Freigelassenen der römischen Kaiser zu vergleichen, vor denen Senat und Patrizier zitterten und krochen. Sie wurden ganz ebenso hofiert. Selbst die mächtigsten Staatsmänner behandelten sie ungemein säuberlich. Die Prinzen von Geblüt, die Bastarde und erst recht die tiefer stehenden machten es genau so. Das Amt des ersten Kammerherrn ward verdunkelt durch das des ersten Kammerdieners. Infolgedessen waren die Diener und die Unterbeamten zumeist unglaublich dreist. Man mußte ihnen aus dem Wege gehen oder sie langmütig ertragen.
Ludwig XIV. unterließ es nie, seine Herren, die er mit Glückwunsch- oder Beileidsaufträgen zu Angehörigen des Hochadels entsandt hatte, zu fragen, wie sie aufgenommen worden seien. Er hätte es für übel erachtet, wenn man ihnen nicht einen Sitz angeboten und sie beim Weggang ein Stück begleitet hätte.
Bei Truppenbesichtigungen, Festen und überall, wo die Anwesenheit der Damen Liebenswürdigkeit erheischte, war er unvergleichlich. Er war am Hofe der Königin-Mutter und bei der Gräfin von Soissons in die Schule gegangen. Seine Mätressen hatten ihn dann immer mehr daran gewöhnt. Er blieb immer hoheitsvoll, wenn er auch zuweilen sehr fröhlicher Laune war. Vor den Augen der Welt tat er nie etwas Gewagtes oder Unbedachtes. Die geringste Gebärde, sein Gang, seine Haltung, sein ganzes Äußeres, alles war maßvoll, ritterlich, vornehm, hoch und erhaben, dabei immer natürlich. Gewöhnung und der Vorteil einer wie dazu geschaffenen Gestalt trugen das Ihre bei. Bei ernsten Anlässen, bei Botschafterempfängen, bei Feierlichkeiten machte er einen großartigen Eindruck. Wollte man vor ihm reden, ohne dabei stecken zu bleiben, so mußte man ihn vorher lange ansehen, um sich an sein Gesicht zu gewöhnen. Bei solchen Gelegenheiten antwortete er immer, den Nagel auf den Kopf treffend, kurz und bündig. Meistens fand er ein paar verbindliche Worte, zuweilen sogar eine Schmeichelei, wenn die Rede sie verdiente. Seine Gegenwart rief allüberall ehrfürchtiges Schweigen, mitunter eine Art Angst hervor.
Frische Luft und Sport liebte er über alles. Er war ehedem ein guter Tänzer, Mail- und Ballspieler. Im Alter noch saß er gut zu Pferde. Man mußte in allem geschickt und gewandt sein und ward danach von ihm beurteilt. Wer nichts vom Sport verstehe und von sonstigen nicht unbedingt notwendigen Dingen, der solle die Hände davon lassen, pflegte er zu sagen. Niemand war ein so sicherer und gewandter Schütze wie er. Er liebte große Hunde und hatte deren stets sieben bis acht – wundervolle Exemplare – in seinen Gemächern. Er fütterte sie selbst, damit sie ihn gut kennen sollten. Er war ein großer Liebhaber der Reitjagd, an der er allerdings nur noch im Wagen teilnahm, seitdem er einmal, kurz nach dem Tode der Königin, in Fontainebleau zu Pferd den Arm gebrochen hatte. Er fuhr allein in einem Wägelchen, das vier Ponys zogen, die fünf- bis sechsmal gewechselt wurden. Er kutschierte eigenhändig, geschickt und so sicher, wie es sein bester Kutscher nicht konnte. Seine Grooms waren neun- bis fünfzehnjährige Burschen, die er selbst ausbildete.
In allem liebte er Glanz, Verschwendung, Fülle. Es war wohlberechnet, daß er die Sucht, ihm hierin nachzueifern, in jeder Weise begünstigte. Er impfte sie seinem ganzen Hofe ein. Wer alles daraufgehen ließ für Küche, Kleidung, Wagen, Haushalt und Spiel, der gewann sein Wohlwollen. Um solcher Dinge willen redete er die Leute an. Indem er so den Luxus gewissermaßen zur Ehrensache und für manche zur Notwendigkeit machte, richtete er nacheinander alle zugrunde, bis sie schließlich einzig und allein von seiner Gnade abhingen. So befriedigte er seinen Hochmut und seinen Ehrgeiz. Sein Hof war blendend, und die Rangunterschiede verschwanden in einem allgemeinen Wirrwarr. Er hat dem Lande damit eine Wunde geschlagen, die wie ein Krebsschaden an allem frißt. Vom Hofe aus hat die Verschwendungssucht Paris, das Land, das Heer ergriffen. Man schätzt einen jeden, der eine gewisse Stellung einnimmt, nur noch nach seinem Aufwand in Küche und Haus ein. Wer Gelegenheit zum Stehlen hat, stiehlt infolgedessen, um die Ausgaben seines Haushalts bestreiten zu können. Die Not zwingt ihn dazu. Es besteht im Grunde kein Rangunterschied mehr. Alle Stände sind in heillosem Durcheinander. Der Hochmut wächst ins Ungemessene. Die Folgen sind nicht abzusehen. Untergang und Umwälzung sind im Anzuge.
Mit seinen Galawagen und allerlei anderen Kutschen hat er in Pracht und Anzahl alles bis dahin Dagewesene übertroffen. Ungezählt sind seine Bauten, diese Merkmale des Hochmuts, der Laune und der Geschmacklosigkeit. Saint-Germain überließ er seinem Schicksal. Paris erhielt keine Verschönerung außer dem Bau der Königsbrücke, den die Not gebot. Daher steht Paris, trotz seiner beispiellosen Ausdehnung, hinter so vielen europäischen Städten zurück.
Saint-Germain liebte er nicht. Dieser Ort, der so einzigartig gelegen ist, mit seiner wundervollen Aussicht, dem nahen Walde mit seinen prächtigen Bäumen und seinem fruchtbaren Gelände, war wie geschaffen zum Sitz eines Fürsten: Hügel und Terrassen nach allen Seiten, entzückende Gärten, dazu die Seine mit ihren reizenden Ufern und ihrem bequemen Verkehr. Wie leicht hätten sich auf diese Anhöhe die mannigfaltigsten Wasserkünste hinzaubern lassen! Doch nein. Versailles ward erwählt. Der trübseligste, undankbarste aller Orte, aussichts-, wald- und wasserarm, wo der Boden Sand oder Sumpf und die Luft infolgedessen ungesund war.
Es gefiel ihm, auch die Natur gewaltsam zu beherrschen, sie der Kunst und dem Gelde zu unterwerfen. Planlos reihte er ein Gebäude neben das andere, Häßliches und Schönes, Großartiges und Kleinliches, alles bunt durcheinander. Eng und unbequem, finster und ohne Aussicht sind sogar seine und der Königin Räume. Die Gärten verraten erstaunliche Prachtliebe. Aber sie sind geschmacklos und laden nicht zum Aufenthalt ein. Man erreicht den Schatten der Bäume erst, nachdem man ein großes Stück Sandwüste durchquert hat. Dann steht man auf dem Hügel – und hier ist das Ende der Gärten. Die Wege sind mit Kies bedeckt. Man zerschneidet sich beinahe die Sohlen darauf, würde aber ohne ihn bald im Sand, bald im Schlamm versinken. Überall ist die Natur vergewaltigt worden, und man mag wollen oder nicht: man wird davon abgestoßen und angewidert. Das Wasser, das man von allen Seiten herbeigeleitet und angesammelt hat, ist grün, dick, schlammig. Es steigt eine fühlbar ungesunde, feuchte Luft daraus empor. Die spielenden Wasserkünste freilich bieten einen unvergleichlichen Anblick. Es hat alles zwei Seiten. Daher wird man einesteils angezogen, andernteils abgestoßen. Nach dem Hofe zu ist alles erstickend eng und zusammengedrängt. Von der Gartenseite aus hat man von dem Schloß einen Gesamteindruck. Aber es sieht aus wie ein Schloß nach einem Brande, oder wie eins, dem Oberstock und Dach fehlen. Es wird von der Kapelle erdrückt. Mansart baute sie so hoch, um den König zu veranlassen, noch ein Stockwerk auf das Schloß aufsetzen zu lassen. Sie sieht düster aus wie ein Riesensarg. Die Einzelarbeit daran ist erlesen, während das Ganze nichts taugt. Am besten ist der Chor, denn ins Schiff hinunter ging der König kaum. Wozu noch weiter von den ungeheuerlichen Fehlern des Riesenpalastes reden, der Unsummen verschlungen hat, mit allem, was dazu gehört: Gewächshäusern, Obstgärten, Hunde- und Pferdeställen, den zahllosen Gesindehäusern? Das ist eine ganze Stadt, wo ehedem nur ein elendes Wirtshaus stand, eine Windmühle und jenes Gartenschlößchen, das Ludwig XIII. hatte bauen lassen. Mein Vater hat manch liebes Mal darin übernachtet.
Mit einem Wort: das Versailles Ludwigs des Vierzehnten ist ein geschmackloses Machwerk, dazu unvollendet. Trotz der großen Menge der Säle gibt es nicht einen einzigen wirklich großen Theater-, Bankett- oder Ballsaal. Überall bleibt noch sehr viel zu tun. Park und Alleen stehen so dichtgedrängt voller Bäume und Sträucher, daß sie keine Luft haben. Beständig muß neues Wild ausgesetzt werden. Wassergräben, vier bis fünf Meilen lang, gibt es im Überfluß, ebenso dicke Mauern, die das Ganze wie ein Eiland der Trübsal und Häßlichkeit umschließen.
Im Park liegt Trianon. Früher gab es dort nur Geschirr, und man konnte daselbst höchstens einen Imbiß einnehmen. Später ward angebaut, damit man auch über Nacht bleiben könnte. Zuletzt ward es ein Palast aus Marmor, Jaspis und Porphyr mit den köstlichsten Gartenkulturen rundherum. Gegenüber, auf dem andern Ufer des Kanals, liegt die Menagerie mit den seltensten Vögeln und Vierfüßlern.
Ein Übel beherrschte das Ganze. Es fehlte an Wasser, so daß die Brunnenwunderwerke alle Augenblicke versiegten, wie das auch heutigentags noch geschieht, trotz des Riesenwasserbehälters, dessen Bau auf Sand und Schlamm Millionen gekostet hatte. So unglaublich es klingt, diese Bauten haben das Heer zugrunde gerichtet. Frau von Maintenon herrschte. Sie stand damals noch im Einklange mit Herrn von Louvois. Es war Friede. Da kam er auf den Einfall, die Eure zwischen Chartres und Eure aufzuhalten und in einem neuen Bett nach Versailles zu leiten. Jahrelang kostete dies Unternehmen viel Geld und viele Menschenleben. Man hatte am Arbeitsort ein Lager aufgeschlagen, in dem sich Kranke und Tote täglich mehrten. Die schwere Arbeit und die Bodenausdünstungen verdarben sie. Schließlich ward bei hoher Strafe verboten, davon zu reden. Viele brauchten lange Jahre, ehe sie die Folgen der Ansteckung überwanden. Viele erholten sich nicht wieder bis an ihr Lebensende. Nicht einmal die Offiziere, selbst die höchsten nicht, durften sich auch nur eine Viertelstunde entfernen. Gott sei Dank machte 1688 der Krieg dieser grausamen Tollheit ein Ende. Die Arbeiten wurden auch nach dem Feldzuge nicht wieder aufgenommen. Die unförmlichen Anfänge blieben unvollendet.
Schließlich ward der König des Schönen und des Überladenen überdrüssig. Er sehnte sich nach Schlichtheit und Einsamkeit. Er sah sich in der Gegend von Versailles um, was wohl seine neue Laune befriedigen könne. Er reiste hierhin und dahin, durch das wellige Gelände von Saint-Germain und die endlose Ebene unterhalb davon. Die Seine windet sich gleich einer Schlange hindurch und bewässert große und reiche Ortschaften. Man drängte ihn, sich Lucienne zu erwählen, wo Cavoye einen Landsitz mit entzückendem Ausblick besaß. Er erwiderte, diese paradiesische Lage würde ihn auf die kostspieligsten Baupläne bringen. Er wolle etwas ganz Bescheidenes, in einer Gegend, die größere Bauten unmöglich mache.
Er fand das Gesuchte. Hinter Lucienne lag ein schmales, langes, steilwandiges, unzugängliches, sumpfiges, ausblicksloses Tal. Rundherum Höhen. Auf einer ein elendes Dorf: Marly. Das war, was er begehrt hatte, Abgeschlossenheit und Enge. An ein Sichausbreiten war hier nicht zu denken.
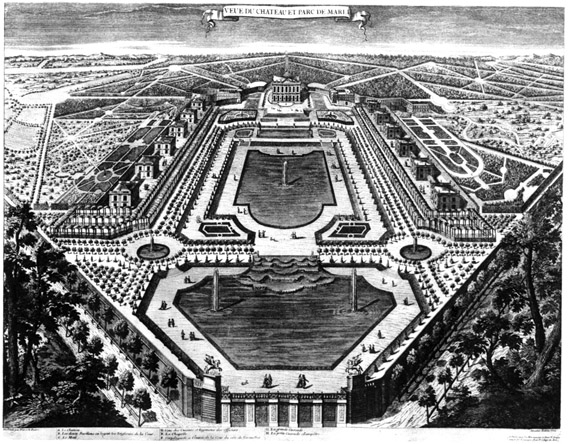
33. Ansicht von Marly
Antoine nach Le Pautre.
Der König entschied sich für diesen Ort. Es kostete viel Arbeit, bis dieses Tal, das der ganzen Umgegend als Schindanger gedient hatte, gesäubert und mit Erde ausgefüllt war. Alsdann errichtete man die Eremitage, die allmählich vergrößert wurde. Man trug die Höhen teilweise ab, um Raum zu neuen Bauten zu bekommen, und, um ein wenig Fernsicht zu erlangen, auch den Hügel am Ausgang des Tales.
So erwuchs Marly, wie man es heute sieht, mit seinen Gebäuden, Wassergräben und Wasserleitungen. Man behauptet wenig, wenn man sagt, Marly sei teurer als Versailles. Marly, im Jahre 1679 begonnen, hat 4½ Millionen Franken zu bauen gekostet, allerdings ohne die Wasserleitung. Über die Baukosten von Versailles vgl. Einleitung S. 65 f.
Es kommen dazu die vielen kostspieligen Reisen nach Marly, wo sich der König bald ebensoviel aufhielt wie in Versailles, zuletzt beinahe alltäglich, mit demselben zahlreichen Hofstaat.
Und diesen Sumpf, in dem Nattern, Kröten und Frösche gehaust, hatte der König erwählt, weil er gewähnt, dort werde er nicht in Versuchung geführt, irgendwelche Ausgaben zu machen! Solch schlechten Geschmack bewies er in allem. Die Sucht, sich die Natur untertänig zu machen, hatte ihm alle Eigenheit genommen. Weder die Kriegslasten noch seine spätere Frömmelei heilten ihn davon.
So artete seine Herrschsucht aus. Auf einem andern mehr im allgemein Menschlichen liegenden Gebiete ward sie ungleich unseliger: in der Galanterie. Seine Liebschaften haben in ganz Europa Aufsehen erregt, Frankreich in Verruf gebracht, den Staat erschüttert, zweifellos die Verwünschungen heraufbeschworen, deren Last ihn an den Rand des Abgrundes drückte, und seine rechtmäßige Nachkommenschaft auf ein einziges Haupt beschränkt. Sie waren Übel, die zum allgemeinen Unsegen wurden und noch lange fühlbar bleiben werden.
Ludwig XIV. war in jungen Jahren für die Liebe geschaffen wie keiner seiner Untertanen. Schließlich ward er es müde, hin und her zu flattern und Früchte des Augenblicks zu pflücken, wo immer sie sich ihm boten.
Zuerst ließ er sich von der La Valliere fesseln. Es ist allbekannt, wie sich dieses Verhältnis entwickelte und was es für Folgen hatte. Dann gewann ihn Frau von Montespan mit ihrer siegreichen Schönheit, und zwar noch zur Zeit, da Fräulein von La Valliere Favoritin war. Das Schauspiel, daß gleichzeitig zwei Mätressen herrschten, erregte bedauerliches Aufsehen und erfüllte alle Völker mit Abscheu. Der König reiste mit beiden im Lande umher und besichtigte mit ihnen das Heer. Sie saßen im Wagen der Königin, und das Volk strömte in Massen herbei, um »die drei Königinnen« zu sehen. Schließlich obsiegte Frau von Montespan. Es gelang ihr, den Fürsten und den ganzen Hof zu beherrschen. Um das öffentliche Ärgernis voll zu machen, wurde Herr von Montespan in die Bastille gesteckt und Frau von Montespan zur Oberhofmeisterin der Königin ernannt. Der Hof der Montespan ward zum Mittelpunkt des höfischen Lebens und aller Vergnügungen. Von ihrer Gunst hing alles im Lande ab. Die Minister und die Generale drängten sich danach.
Frau von Montespan war boshaft, eigensinnig, leicht verstimmbar und von einem maßlosen Hochmut, unter dem jedermann zu leiden hatte, nicht zum mindesten der König. Die Hofleute gingen nicht gern an ihren Fenstern vorüber, zumal wenn der König bei ihr weilte. Man sagte, und dies ward zum geflügelten Wort bei Hofe: das sei Spießrutenlaufen. In der Tat verschonte sie niemanden, und zwar oft nur, um den König zu belustigen. Da sie sehr witzig war, drollig und geistreich, so war es eine höchst gefährliche Sache, von ihr lächerlich gemacht zu werden. Das verstand sie unvergleichlich. Dabei liebte sie ihre Familie und ihre Verwandten; auch leistete sie Personen, denen sie freundschaftlich gesinnt war, gern Dienste.
Die Königin empfand ihren Übermut auf das peinlichste. Frau von Montespan betrug sich so ganz anders als die allezeit rücksichtsvolle und ehrerbietige Frau von La Vallière. Deshalb war die Königin dieser immer gewogen, während sie von der Montespan einmal äußerte: »Diese Hure ist noch mein Tod!« Über die Zeit, da die Ungnade über Frau von Montespan hereingebrochen war, über ihre Reue und Buße, sowie über ihr gottseliges Ende ist bereits berichtet worden. Vgl. S. 333 ff. Während ihrer Herrschaft war sie in einem fort eifersüchtig. Fräulein von Fontanges gefiel dem König so sehr, daß sie seine Maîtresse en titre ward. So merkwürdig diese Doppelliebschaft war, etwas Neues war das nicht. Man hatte das nämliche bereits an Frau Von La Vallière und Frau von Montespan erlebt. Somit wurde dieser nur vergolten, was sie jener angetan hatte. Nur war Frau von Fontanges nicht so glücklich in ihrer Sünde, in ihrem Glanze und in ihrer Reue. Ihre Schönheit hielt sie wohl eine Weile, aber ihr fehlten die geistigen Vorzüge, und so vermochte sie den Herrscher auf die Dauer nicht zu fesseln. Zu gänzlicher Ungnade kam es nicht. Ihr plötzlicher Tod setzte dieser Liebschaft ein rasches Ende. Auch alle anderen Liebeleien des Königs waren nur Zwischenspiele.

10. Marie Angelique Scoraille de Roussille, Herzogin von Fontanges (1661-1681)
Pierre Mignard (etwa 1679)
Madrid, Prado
»... Il [sc. Mignard] avoit fait aussi le portrait de Mme. de Fontanges, et le Roi lui même n'avoit pas trouvé qu le Peintre eût rien diminué des charmes de cette belle personne.« (Monville: »La vie de Pierre Mignard.« Amsterdam 1731, S. 126.)
Vgl. S. 102 ihre Charakteristik durch den Abbé de Choisy und S. 452 durch Saint-Simon.
Eine einzige hielt länger an, die mit der Herzogin von Soubise. Anne de Rohan-Chabot, 1648 bis 1709, die Gemahlin des Marschalls von Soubise, 1631 bis 1712. Diese schöne Frau beherrschte den König bis zu ihrem Tode und beutete ihn derartig aus, daß sie ihren beiden Söhnen eine schmachvolle Millionenerbschaft hinterließ. Ihr Gatte, der sich sozusagen selber zum Hahnrei gemacht hatte, duldete nicht nur den Ehebruch seiner Frau, sondern zog sogar ungeheure Vorteile daraus. Er lebte entweder zurückgezogen in Paris oder war bei der Armee. Bei Hofe zeigte er sich selten. Kupplerin war die Herzogin von Rochefort gewesen, in deren Hause auch die Schäferstunden meist stattzufinden pflegten. Stellten sich ihnen mitunter Hindernisse in den Weg, so war der Marschall sicher nicht daran schuld, der alles wußte und nie etwas sah. Binnen kurzem war er so reich, daß er aus seinem armseligen Hause am Königsplatze in den Palast Guise ziehen konnte, den er kaufte, luxuriös wiederherstellte und erweiterte. Darin hauste er fortan mit seinen Söhnen. Durch sein verschwiegenes Verhalten blieb die Liebschaft Geheimnis. Als es der Herzogin angebracht schien, verstand es die übrigens rothaarige Zauberin, des Königs Liebe in Freundschaft und Gunst zu verwandeln.
Erwähnt sei auch die schöne Ludre, Fräulein von Lothringen, der der König eine Zeitlang vor aller Augen seine Huld bezeigte. Aber diese Liebschaft verlosch schnell wie eine Sternschnuppe, und Frau von Montespan blieb Siegerin.
Ich komme nunmehr auf ein Verhältnis ganz anderer Art zu sprechen, das bei allen Völkern genau so große Verwunderung hervorrief wie die früheren Liebschaften Entrüstung. Es währte bis zum Tode des Königs. Wer sollte den Namen dieser berühmten Geliebten nicht kennen: Francoise d'Aubigné, Marquise von Maintenon. Ihre Herrschaft hat nicht weniger denn zweiunddreißig Jahre gewährt. Sie ist angeblich auf der Insel Martinique geboren In Wahrheit am 27. November 1635 im Gefängnis zu Niort; vgl. Einleitung S. 105., wohin ihre Eltern ausgewandert waren. Ihr Vater war wohl ein Edelmann. Nachdem sie Waise geworden, wurde sie von Frau von Neuillant, der Mutter der Marschallin von Navailles, aus Mitleid aufgenommen und ward ihr eine Stütze in der Wirtschaft auf ihrem Gute. Das junge Mädchen war gewandt, klug und schön. Von Frau von Neuillant mit nach Paris gebracht, fügte es ein glücklicher Zufall, daß der bekannte Dichter Scarron sie kennen lernte. Sie gefiel ihm und seinen Freunden. Und so heiratete er sie.
Sein Haus war ein geselliger Mittelpunkt. Da er Krüppel war, ging er nicht aus, aber die Spitzen der Hof- und Stadtgesellschaft kamen zu ihm. Seine geistreiche Art, sein Wissen und seine Phantasie, seine unvergleichlich heitere Laune bei all seinen Leiden, seine witzigen Werke, die einen feinen Geschmack bekunden, alles das zog immer von neuem Leute an. Frau Scarron machte eine Menge Bekanntschaften aller Art. Nach dem Tode ihres Mannes geriet sie aber trotzdem so in Not, daß sie öffentliche Unterstützungen annehmen mußte. Sie mietete für sich und eine Magd ein Stübchen im Kirchspiel von Saint-Eustache und lebte daselbst sehr armselig.
Allmählich kam die ungewöhnlich schöne Frau wieder in bessere Verhältnisse. Sehr bald verkehrte sie im Hause Albret, im Palast Richelieu und andernorts. Überall machte sie sich nützlich. Es war besonders das Haus Albret, dem sie den Umschwung ihrer Lage verdankte.
Der Marschall Karl von Albret Der Marschall, der Letzte seines Namens, 1614 bis 1676, stammte von den Königen von Navarra ab. Die Mutter Heinrichs IV., Johanna von Albret, war eine navarresische Prinzessin., Graf von Dreux, Vicomte von Tartas, war ein großer Weltmann, in alle Kabalen des Hofes verstrickt. Er war Inhaber einer Gardekompagnie und bekam 1653 den Marschallstab und gegen das Ende des Jahres 1670 die Statthalterei von Guyenne. Ohne jemals wirkliche, zumal selbständige Dienste zu leisten, war er ein kluger, mutiger und geschickter, dabei prunkliebender Mann. Er war nahe verwandt mit Richelieu. Frau von Montespan, eine Base von ihm, ging im Albretschen Hause ein und aus.
Das achtungsvolle Benehmen der Frau Scarron, die Mühe, die sie sich gab, sich beliebt zu machen, ihre witzige und angenehme Art machten den besten Eindruck auf Frau von Montespan. Sie schenkte ihr ihre Freundschaft, und als sie ihre ersten Kinder dem König gebar, den Herzog von Maine und die Herzogin von Conde, schlug sie dem Vater vor, sie der Witwe Scarron anzuvertrauen. Man wollte die Sache geheimhalten. Frau Scarron bekam ein Haus am Marais Stadtviertel in Paris., wo sie mit den beiden Bastarden wohnte und deren Erziehung leitete. Später kamen die Kinder in das Haus der Frau von Montespan. Sie wurden dem Könige vorgestellt. Ihr geheimer Ursprung wurde nach und nach eine allbekannte Tatsache, bis sie schließlich vom Könige als seine Kinder anerkannt wurden. Ihre erste Erzieherin gelangte mit ihnen an den Hof. Sie schmeichelte sich immer mehr bei Frau von Montespan ein, die den König mehrere Male bat, sie zu beschenken. Er konnte sie nicht ausstehen, und wenn er ihr zuweilen seine Gunst bezeigte, indem er ihr ein Geschenk machte, das stets gering ausfiel, so tat er dies lediglich aus übergroßer Artigkeit gegen die Montespan, was er durchaus nicht verhehlte.
Als die Gutsherrschaft Maintenon zum Verkauf kam, hielt die Montespan diesen Besitz wegen der geringen Entfernung von Versailles wie geschaffen für Frau Scarron. Sie plagte den König so lange, bis sie ihm so viel Geld abnötigte, daß die Scarron das Gut erstehen konnte. Bald darauf erhielt diese den Namen von Maintenon. Da der Vorbesitzer, Herr von Danguenne, den Landsitz völlig hatte verwildern lassen, ließ sie Schloß und Park wieder instand setzen. Die hierzu nötige Summe ward wiederum vom Könige erpreßt.
Dies geschah, wie auch das erstemal, bei der Toilette des Monarchen, wo nur der Generaladjutant zugegen war. Das war damals der Marschall von Lorge, der wahrheitsliebendste Mann, den es je gegeben. Mehr als einmal hat er mir den Auftritt geschildert, dessen Augenzeuge er an jenem Tage war.
Anfangs wollte der König von nichts wissen und schlug der Montespan ihre Bitte rundweg ab. Als sie aber nicht nachließ und immer wieder in ihn drang, da wurde er ungeduldig und antwortete ihr, er hätte bereits mehr denn zuviel für diese Frau getan. Er begreife weder ihre sonderbare Vorliebe für diese Person noch ihre eigensinnige Anhänglichkeit an sie. Er habe doch bereits öfters den Wunsch geäußert, daß sie ihr den Laufpaß erteile. Er müsse ihr gestehen, sie sei ihm unausstehlich. Nur wenn Frau von Montespan ihm fest verspreche, daß er die Scarron nicht wieder zu Gesicht bekäme, und wenn er nie wieder von ihr reden höre, wolle er ihr das Geld geben, obgleich er, wie er betone, einer Kreatur ihrer Art bereits viel zu viel geschenkt habe.
Der Marschall von Lorge hat diese Rede nie vergessen können. Er hat sie mir mehr als einmal im Wortlaut und immer wieder in der nämlichen Wortfolge erzählt. Einen solchen Eindruck hatte sie auf ihn gemacht, zumal da sich später so viel zutrug, was dem widersprach. Frau von Montespan erwiderte kein Wort. Sie war sichtlich verlegen, daß sie dem König so stark zugesetzt hatte.
Der Herzog von Maine hinkte bekanntlich. Es hieß, eine Amme habe ihn fallen lassen. Da kein Mittel Erfolg hatte, schickte man ihn schließlich in das Bad Barèges. Die Briefe, die von der Erzieherin des Knaben von dort an Frau von Montespan geschrieben wurden, um über den dortigen Aufenthalt zu berichten, kamen auch in die Hände des Königs. Er fand diese Briefe gut geschrieben. Sie gefielen ihm. Von da an begann seine Abneigung gegen die Maintenon zu schwinden.
Die Gemütsart der Frau von Montespan tat das übrige. Sie hatte tausend Launen und war gewöhnt, sich gar nicht zu beherrschen. Der König war dem mehr ausgesetzt als jeder andere. Noch war er in die schöne Frau verliebt, und deshalb ertrug er ihre Launen, wenn auch mit innerem Widerstreben. Frau von Maintenon machte der Montespan wiederholt darob Vorwürfe, und diese erzählte das offenherzig dem Könige. Diese Versuche bewogen ihn, sich zuweilen mit der Maintenon zu unterhalten und sich ihr gegenüber auszusprechen. Dadurch machte er sie gewissermaßen zur Vermittlerin, zur Schiedsrichterin und zur Ratgeberin. Und so erschlich sich Frau von Maintenon allmählich das Vertrauen des Königs im höchsten Maße. Sie verstand es, sich ihm unentbehrlich zu machen. Sie verdrängte die Montespan, die zu spät merkte, was ihm die Maintenon geworden war.
Nachdem es so weit gekommen war, begann sich Frau von Maintenon ihrerseits beim König zu beschweren, was sie unter seiner Geliebten zu leiden habe, die selbst ihn so rücksichtslos behandle. Indem sich nun beide, der König und seine Ratgeberin, gegenseitig ihr Leid klagten, festigte die letztere immer mehr ihren eigenen Einfluß auf den Monarchen.
Fortuna, um hier nichts zu sagen die Vorsehung, die dem erhabenen Sonnenkönig die tiefste und düsterste Erniedrigung zudachte, ließ ihn immer mehr Geschmack an dieser durchtriebenen Ränkeschmiedin finden, zumal zu Frau von Montespans häufigen schlimmen Launen nunmehr eifersüchtige Anwandlungen traten.
Um diese Zeit [1683] verlor der König durch die Unfähigkeit und den Starrsinn seines Leibarztes Daquin seine Gemahlin. Dies brachte die Entfremdung zwischen dem Herrscher und seiner ihm wegen ihrer Übellaunigkeit unerträglich gewordenen Geliebten auf ihren Höhepunkt. Keiner ihrer Kunstgriffe vermochte dies wieder gutzumachen.
Die herrschsüchtige schöne Frau, gewohnt zu gebieten und angebetet Zu werden, fiel in die tiefste Verzweiflung über den Verfall ihrer Macht. Und was sie vollends um alle Fassung brachte, das war die Erkenntnis, eine verworfene Person zur Nebenbuhlerin zu haben, der sie das tägliche Brot gewährt hatte, die ihr alles zu danken hatte, insbesondere die königliche Gunst, und die sie aus Freundschaft, dem oft ausgesprochenen Willen des Königs zum Trotz, nicht längst zum Teufel gejagt hatte. Diese Intrigantin, die mehrere Jahre älter war als Frau von Montespan und nicht im entferntesten so schön, wurde jetzt ihre Henkerin. Es war ihr eine Marter, zu sehen, daß der König nur noch dieser niedrigen Person wegen zu ihr kam; daß er diese bei ihr suchte und seinen Verdruß nicht verbergen konnte, wenn er sie einmal nicht bei ihr fand; daß er oft ihre Gesellschaft verließ, um mit Frau von Maintenon unter vier Augen zu plaudern, und daß sie obendrein bei Zwistigkeiten aller Augenblicke ihre Zuflucht zu ihr nehmen mußte, um sich mit dem Könige auszusöhnen oder Dinge von ihm zu erlangen, die sie brauchte.
Die ersten Tage nach dem Tode der Königin Maria Therese von Spanien war am 30. Juli 1683 gestorben. brachte Ludwig XIV. in Saint-Cloud zu, bei seinem Bruder. Von dort ging er nach Fontainebleau, wo er den ganzen Herbst verbrachte. Hier in der Einsamkeit wuchs seine Neigung zu Frau von Maintenon ins Unwiderrufliche. Nach seiner Rückkehr ward ihre Bevorzugung offenkundig. Jetzt wagte sie es, ihre Macht auf die Probe zu stellen. Sie verschanzte sich hinter Frömmigkeit und Zimperlichkeit. Aber der König ließ sich nicht zurückweisen. Sie redete ihm ins Gemüt und machte ihm angst vor dem Teufel. So nahm sie sowohl seine Verliebtheit wie sein Gewissen ans Gängelband, und zwar derart meisterhaft, daß sie das erreichte, was unsereiner erlebt hat und was die Nachwelt kaum glauben wird.

24. Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. (1652-1722)
Hyacinthe Rigaud(?).
Braunschweig, Gemäldegalerie
Dieses Porträt gilt als eine vielleicht eigenhändige Wiederholung Rigauds nach jenem Bildnis der Herzogin, worüber diese am 18. Juni 1713 der Raugräfin Louise schreibt: »... man hatt sein leben nichts gleicheres gesehen, alß Rigeaut mich gemahlt hatt.« Ob sie aber nicht ein zweites Mal sich von Rigaud »nach dem Leben« porträtieren ließ? Die Absicht hatte sie jedenfalls, wie aus dem Anfange des Briefes klar hervorgeht: »... Mein contrefait werde ich ma tante schicken, s baldt es möglich wirdt sein können. Ich werde nach mich selber außmalen laßen, damitt es ein original sein mag ...« Andere mit dem Braunschweiger Bilde übereinstimmende Porträts befinden sich in den Museen von Versailles und Budapest, im Musée Rath zu Genf und im Schloß Ferrières des verstorbenen Barons Alphons Rothschild. Keines von all diesen Gemälden hat sich bisher mit Sicherheit als »das Original« Rigauds nachweisen lassen.
»... wer mich Nur Einmahl gesehen hatt, kan gar woll persuadirt sein, daß ich mitt meinem gesicht undt taille Nie keine jalousie geben kan ...« (Aus einem Briefe der Herzogin an die Kurfürstin Sophie von Hannover vom 24. November 1695.) »... Ich bin gewiß, daß E. L. nicht soviel ronsellen haben alß Ich ... aber Ich frage gantz und gar nichts darnach, bin Nie schön geweßen, habe also nicht viel verlohren ...« (Aus einem Briefe der Herzogin an die Kurfürstin Sophie von Hannover vom 29. Dezember 1701.)
(Siehe auch Nr. 21)
Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß sich der König einige Zeit nach seiner Rückkehr aus Fontainebleau, um die Mitte des Winters 1683 Die Vermählung hat im Januar 1684 stattgefunden. Siehe Einleitung S. 108., mit Frau von Maintenon trauen ließ. Es geschah nachts, im Schlosse von Versailles, in einem der Gemächer des Königs. Pater La Chaise, der Beichtvater des Fürsten, las die Messe. Bontemps, der vertrauteste der vier Kammerdiener des Königs, servierte bei dieser Messe. Zugegen war Harlay François de Harlay-Chanvallion, 1625 bis 1695, seit 1670 Erzbischof von Paris, ein ausgezeichneter Redner, aber berüchtigt wegen seines wenig erbaulichen Lebenswandels., der Erzbischof von Paris, ferner Louvois und Montchevreuil. Der Marquis von Montchevreuil, 1622 bis 1706, war Erzieher des Herzogs von Maine. Er war vermählt mit Marguerite Boucher d'Orsay (gest. 1699), die als langjährige Vertraute der Frau von Maintenon großen Einfluß am Hofe genoß. Selbst die Kinder des Königs zitterten vor der beschränkten, aber vielerfahrenen Intrigantin. Saint-Simon erzählt (VI, Appendice XXI), der ganze Hof habe bei ihrem Tode aufgeatmet. Die beiden zuerst Genannten hatten sich vom König das Wort geben lassen, daß die Heirat niemals bekanntgemacht werde.
Fortan hatte sie ihre Gemächer in Versailles im gleichen Stock mit denen des Königs, ihnen gegenüber, an der Freitreppe. Nunmehr verbrachte er in Versailles tatsächlich bis an sein Lebensende täglich viele Stunden bei ihr. Hielt er sich anderswo auf, so wurde sie ihm möglichst nahe im selben Geschosse untergebracht.
Jetzt lag ihr als der nächsten Vertrauten des Herrschers alles zu Füßen: die öffentliche Meinung, die Minister, die Generale, die Königliche Familie. Ohne sie ward nichts gutgeheißen, nichts verworfen. Alles lag in ihren Händen: die Untertanen, Handel und Gewerbe, die Auswahl der Würdenträger, die Gerichtsbarkeit, die Gnadenbeweise, das Kirchenwesen, alles ohne Ausnahme, selbst der König und der Staat. Eine allmächtige Zauberin, herrschte sie ununterbrochen, ohne je Widerstand zu finden, ohne die leiseste Trübung ihres Glanzes, zweiunddreißig Jahre hindurch. Ein unglaubliches, unvergleichliches Schauspiel vor ganz Europa!
Frau von Maintenon war eine durch und durch kluge Frau. Die erlesenste Gesellschaft, die sie zunächst nur geduldet hatte, deren Liebling sie aber sehr bald geworden war, hatte ihre geistigen Fähigkeiten geschliffen und geschärft und sie zu einer Kennerin der Welt und einer Meisterin des höfischen Benehmens erhoben. Die so verschiedenen Lebenslagen, in denen sie sich selbst befunden, hatten sie zur Schmeichlerin und Verführerin gemacht, zu einem Wesen, das allen gefällig war und allen zu gefallen trachtete. Die Notwendigkeit des Ränkespiels und die vielen Umtriebe jedweder Art, die sie mit angesehen und in die sie vielfach selber verstrickt war, sei es aus Eigennutz, sei es zugunsten andrer, hatten sie Geschmack daran finden lassen und ihr die dabei nötige Kaltblütigkeit und Geschicklichkeit verliehen. Bei allem, was sie tat, war sie von unvergleichlicher Anmut. Dazu gesellten sich eine gewisse Ungezwungenheit und vor allem ihre Zurückhaltung und Bescheidenheit, Dinge, die ihren Anlagen in wunderbarer Weise zu Hilfe kamen. Ihre Stimme klang sanft, aber bestimmt; ihre Ausdrücke waren treffend, ihre Beredsamkeit zielbewußt und echt. Die Höhe ihrer Entwicklung – sie war drei Jahre älter denn der König – hatte sie zur Blütezeit der schöngeistigen Plauderkunst und der feinen Galanterie, in der sogenannten Zeit der Alkoven Ruelles. Die berühmte Marquise de Rambouillet empfing die schöngeistige Gesellschaft ihrer Zeit in ihrem berühmten «blauen Gemach«. (Einleitung S. 31.) Ruelle (eigentlich der Gang zwischen dem Bett und der Wand) ist die Bezeichnung für das Schlafgemach, wo die gezierten Damen, auf dem Bette sitzend, ihre Schöngeister empfingen., gehabt, und ihrem Wesen hat immer etwas von den Eigentümlichkeiten und dem Geschmack dieser Zeit angehaftet. Ihre gezierte, kunstgerechte Art und Weise nahm mit dem Glanz ihres Ansehens zu, ganz besonders aber mit ihrer sich steigernden Frömmelei. Letztere ward schließlich ihre Haupteigenschaft, vor der alle übrigen verblaßten. Durch ihre Gottseligkeit war sie emporgekommen, und durch sie mußte sie sich auf ihrer Höhe behaupten. Herrschen können war bei ihr Lebensbedingung. Alles andere opferte sie rücksichtslos dieser einen Leidenschaft. Geradheit und Freimut waren mit solchem Erfolg und solchem Ziel schwerlich zu vereinen, und so besaß sie davon kaum den äußeren Schein. Trotzdem war sie nicht falsch von Natur, aber der Zwang, es immer sein zu müssen, und das ihr angeborene Anpassungsvermögen ließen sie doppelt so unaufrichtig erscheinen, als sie in Wirklichkeit war.
In nichts blieb sie sich gleich, außer wenn sie dazu unbedingt genötigt war. Es bereitete ihr Freude, ihre Freunde und Bekannten fortwährend zu wechseln. Eine Ausnahme machte sie nur mit ein paar treuen Freunden von ehedem und mit etlichen aus der jüngsten Zeit, die ihr unentbehrlich geworden waren. In ihren Vergnügungen hatte sie freilich kaum Abwechselung, seit sie Königin war. Darum richtete sie ihre Lust am Neuen auf ernste Dinge und verursachte damit manch großes Übel. Man konnte sie leicht und maßlos für sich einnehmen; aber ebenso rasch kam es zur Wiederentfremdung, und dies wie jenes oft ohne rechten Anlaß.
Die Niedrigkeit und Armut Letztere übertreibt Saint-Simon. Die Königin Anna hatte ihr nach Scarrons Tod eine nach damaligem Geldwert nicht unbedeutende Jahrespension von 2600 Franken ausgesetzt. Von Not kann keineswegs die Rede sein., in der die Maintenon so lange hatte leben müssen, hatte sie kleinlich, engherzig und empfindungsarm gemacht. Ihre Gefühls- und Gedankenwelt war in jeder Hinsicht beengt, so daß immer und überall die Frau Scarron und manchmal nicht einmal eine solche zum Vorschein kam. Diese Mischung von Spießbürgerei und Machtfülle war sehr häßlich. Geradezu gefährlich jedoch war, wie gesagt, ihre Art, mit Freundschaft und Vertrautheit zu spielen.
Auch in anderer Weise war sie eine trügerische Verführerin. Es war ziemlich leicht, sich bei ihr Gehör zu verschaffen, und wenn irgend etwas ihr Gefallen erregte, so kam sie einem mit einer Hilfsbereitschaft entgegen, die erstaunlich war und zu den besten Hoffnungen zu berechtigen schien. Aber schon beim zweiten Male war sie umgestimmt, unzugänglich und wortkarg. Kaum konnte man dann noch sagen, ob man sich ihrer Gnade oder Ungnade erfreute. So rasch aufeinander folgte der Wechsel. Daran war lediglich ihre Chamäleonsnatur schuld, in die man sich schwer hineindenken konnte. Wohl entgingen manche diesem schlimmen Wankelmut, aber das waren eben nur Ausnahmen von der Regel.
Mit erheucheltem Vertrauen konnte man Frau von Maintenon täuschen, insbesondere durch Selbstbekenntnisse. Die Abgeschlossenheit, mit der sie sich umgab, erleichterte dies. Fernerhin litt sie an der Sucht, zu schulmeistern, wodurch sie die wenige Zeit verlor, über die sie zu verfügen hatte. Es ist beispielsweise unglaublich, wieviel Zeit sie mit Saint-Cyr und zahllosen anderen Klöstern vergeudete. Sie hielt sich für die General-Äbtissin. Dabei mischte sie sich in tausend Kleinigkeiten. Das war ihre Lieblingsbeschäftigung. Sie bildete sich ein, so etwas wie eine Kirchenmutter Mère d'église, Analogon zu Kirchenvater, Père d'église. zu sein. Der König hielt sich auch für einen Apostel und verfolgte in diesem Wahne sein Leben lang den Jansenismus oder vielmehr das Schreckbild, das man ihm unter dieser Bezeichnung vor die Augen gestellt hatte. So glaubte Frau von Maintenon, dem Könige hierin ein rechtes Feld der Tätigkeit zu eröffnen.
Die ungeheuerliche Unwissenheit auf jedwedem Gebiete, in der man den König wohlweislich und sorgfältigst hatte aufwachsen lassen und aus allerlei Eigennutz auch weiterhin verharren ließ, die völlige Abgeschlossenheit, in der man ihn hinter seinen Ministern und seinem Beichtvater gefangen hielt, hatte ihm von Jugend auf die verderbliche Gewohnheit eingeimpft, sich in Fragen des Glaubens auf bloße Worte hin zu entscheiden und in seiner so gefaßten Meinung alsdann sein eigenstes Wohl zu sehen. Die Königin-Mutter und später noch mehr der König selbst, beide im Banne der Jesuiten, hatten sich von ihnen den Unsinn einreden lassen: alles Jesuitenfeindliche sei unbedingt gegen die Königsmacht gerichtet und von umstürzlerischem Geist erfüllt. Der König stand jedweder Lehre wie ein kleines Kind gegenüber, was die Jesuiten sehr wohl wußten. Sie waren die bevorrechteten Beichtväter des Herrschers und die Verteiler der Pfründen. Das Strebertum der Höflinge und die Furcht der Staatswürdenträger vor den Jesuiten erweiterte die Macht dieses Pfaffengesindels ins Grenzenlose.
Die sorglich behütete Weltfremdheit des Monarchen gestattete allein ihnen, ungehindert mit ihm zu sprechen. Sie brachten ihm allerhand Vorurteile bei, unter anderm die Überzeugung, daß jeder, der in Dingen des Glaubens anderer Meinung sei als sie, Jansenist sein müsse, und daß jeder Jansenist an sich ein Feind des Königs und des Königtums wäre.
Der König wurde zum Frömmler. Nun war er Frömmler und Nichtswisser zugleich. Dies beeinflußte seine Staatsführung. Wer ihm gefallen wollte, wandte sich an seine empfindlichsten Stellen: seine Frömmelei und sein Gottesgnadentum. So schilderte man ihm die Hugenotten in den schwärzesten Farben, als einen Staat im Staate. Man sagte ihm, sie hätten ihre große Macht nur durch ihre umstürzlerischen Bestrebungen, durch Aufstände und Bürgerkriege, durch Bündnisse mit dem Auslande, durch offene Empörung gegen seine Vorgänger auf dem Throne erworben. Und so sei er selbst durch Verträge mit ihnen unfrei. Wohlweislich verschwieg man ihm jedoch die Quelle so vielen Unglücks und den wahren Grund ihres Wachstums und ihrer Machterweiterung, auch warum und durch wen die Hugenotten zuerst bewaffnet und dann unterstützt worden waren. Man sagte ihm kein Wort von den Machenschaften, Greueln und Verbrechen der Liga gegen die Krone, gegen das französische Herrscherhaus, gegen seinen Großvater, seinen Vater und alle die Seinen.
Man bestimmte ihn, ihn, der stolz darauf war, Selbstherrscher zu sein, einen politisch-religiösen Meisterzug zu tun, der den einzig wahren Glauben zum Siege führen, jeden andern vernichten und ihm die unumschränkte Alleinherrschaft wiedergewinnen sollte. Er müsse die Kette zerreißen, die ihn an die Hugenotten feßle, und die Rebellen mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die seien allezeit bereit, jedweden Umstand zur Stärkung ihrer Kräfte und zur Knechtung des Königtums zu benutzen.
Die großen Staatsmänner waren damals schon dahingegangen. Le Tellier lag auf dem Sterbebette. Michael Le Tellier (1603 bis 1685), Kanzler von Frankreich. Sein Sohn war Franz Michael Le Tellier, Marquis von Louvois. Sein unheilvoller Sohn stand allein, denn der Marquis Von Seignelay Der Sohn Colberts. begann gerade erst seine Laufbahn. Louvis war gierig nach Krieg. Der Waffenstillstand, der kaum erst auf zwanzig Jahre abgeschlossen worden war, drückte ihn schwer. Er hoffte nun, durch einen großen Schlag gegen die Hugenotten den gesamten Protestantismus von Europa in Aufruhr zu bringen, und freute sich darauf in der Erwartung, daß ihm die Ausführung der Maßregeln übertragen werden mußte, da der König doch nur mit Waffengewalt etwas gegen die Hugenotten ausrichten konnte. Dadurch mußte seine eigene Macht steigen.
Frau von Maintenons politische Fähigkeit ging über ihre Geschicklichkeit im Ränkeschmieden nicht hinaus. Voll Eifer ergriff sie die schöne Gelegenheit, sich und ihre Frömmigkeit in ein günstiges Licht zu setzen. Wußte sie doch, daß ihre Umtriebe Geheimnis zwischen ihr und dem Beichtvater blieben und daß sich kein Mensch dagegen aufzulehnen wagte. Das ist die Art, wodurch Fürsten zu allem gebracht werden, wenn sie sich aus Selbstgefälligkeit, Mißtrauen, Unselbständigkeit oder Trägheit nur mit zwei oder drei Personen beraten und zwischen sich und ihren anderen Untertanen eine unübersteigbare Schranke errichten!
Die Aufhebung des Edikts Von Nantes, die 1685 ohne den geringsten Anlaß und ohne das leiseste Bedürfnis erfolgte, war die Frucht eines abscheulichen Geheimabkommens. Diese Maßnahme beraubte Frankreich eines Viertels seiner Bevölkerung, verdarb seinen Handel und schwächte es in jeder Beziehung, indem man das Land der Plünderung durch zügelloses Kriegsvolk auslieferte und jene Folterungen und Hinrichtungen guthieß, denen zahllose Unschuldige beiderlei Geschlechts zum Opfer fielen. Viele Familienbande wurden zerrissen; Verwandte kämpften gegen Verwandte und vernichteten einander. Die Folge war, daß viele unsrer Werkstätten in das Ausland verlegt wurden, daß fremde Staaten auf unsre Kosten aufblühten und reich wurden, daß man dort neue Städte gründete: alles das, weil ein Teil französischen Volkes, geächtet, nackt und heimatlos, ohne Schuld, in die Fremde sich und sich fern dem Vaterlande Heimstätten suchen mußte. Jenes Abkommen war die Ursache, daß man Edelleute, Reiche, Greise, Gelehrte, angesehene und geachtete Männer, Halbkranke usw. auf die Galeere schickte, lediglich um ihres andern Glaubens willen; daß alle Gebiete des Reiches von Meineidigen und Gotteslästerern wimmelten; daß alle Orte vom Gejammer der Opfer ihrer Überzeugung widerhallten, während tausend andre ihr gutes Gewissen schändeten, um sich Hab und Gut und Frieden zu wahren, und ihre Rettung mit einer erheuchelten Bekehrung erkauften. Zwischen Folter und Abschwörung und dem heiligen Abendmahl lagen oft keine vierundzwanzig Stunden, und die Henker dienten alsbald zu Lehrmeistern und Zeugen.
Fast alle Bischöfe gaben sich zu diesem vom Zaune gebrochenen verruchten Vorgehen her. Viele schürten die Sache noch. Die meisten ermunterten die Henker und erzwangen die Bekehrungen nur der Zahl der Bekehrungen wegen. Denn die Listen wurden an den Königlichen Hof gesandt. Man wollte damit sein Ansehen steigern und sich Belohnungen sichern.
Die Intendanten der Provinzen wetteiferten mit den Bischöfen und den Dragonern an diesem Bekehrungswerke. Die Statthalter, deren es nur noch wenige gab Ludwig XIV. verlieh die hohe Würde und Macht eines Statthalters nur ungern. Er besetzte die freigewordenen Stellen meist mit Vizestatthaltern (Generalleutnants) und ließ die Provinzen durch bürgerliche Intendanten verwalten, als deren Nachfolger man die heutigen Präfekten betrachten kann., sowie die vereinzelten Edelleute, die noch auf ihren Gütern und nicht am Hofe lebten, verfehlten ebensowenig, sich neben den Bischöfen und den Intendanten die allerhöchste Gunst zu erwerben.
Von allen Seiten empfing der König eingehende Berichte über die Verfolgungen und Bekehrungen. Man zählte die Bekehrten nach Taufenden. An manchen Orten waren es bis zu sechstausend, die zu gleicher Zeit ihren Glauben abschworen. Der König war über seine Macht und sein frommes Werk hochbeglückt. Er wähnte sich in die Zeit der Wirksamkeit der Apostel zurückversetzt und schrieb sich das alleinige Verdienst zu. Die Bischöfe sandten ihm Briefe voller Lobhudeleien. Die Jesuiten predigten auf den Kanzeln davon.
Ganz Frankreich war von Schrecken und Verwirrungen erfüllt, und doch hörte man allerorts Sieges- und Freudenrufe und endlose Lobessprüche. Der Herrscher zweifelte nicht im geringsten an der Aufrichtigkeit der Massenbekehrungen. Die Bekehrer hatten ihn ja im voraus davon überzeugt und ihm die ewige Seligkeit dafür verheißen. So schlürfte er ihr Gift mit Behagen. In keinem Abschnitte seines Lebens war er sich selber menschlich so groß vorgekommen, und nie hatte er an die Verzeihung seiner Sünden durch Gott fester geglaubt.
Bald nach der Aufhebung des Edikts von Nantes erfolgte die Gründung der großartigen Anstalt von Saint-Cyr. Frau von Montespan hatte ehedem zu Paris ein schönes Haus für die Töchter des Heiligen Josef erbaut, ein Erziehungsinstitut für junge Mädchen. Als sie genötigt wurde, den Hof zu meiden, zog sie sich dahin zurück. Um mit ihr zu wetteifern, faßte Frau von Maintenon noch größere Pläne. Sie wollte den armen Adel unterstützen und sich dadurch zu einer Schutzherrin und Förderin des Adels überhaupt aufschwingen. Indem sie sich durch ein bleibendes großes Werk hervortat, das dem König wie ihr Anregung bot und ihr als Zufluchtsort dienen konnte, falls sie den König verlor, hoffte sie auch mindestens, sich damit die amtliche Verkündung ihrer heimlichen Ehe zu erleichtern. Sie ließ einen Teil der Einkünfte von Saint-Denis auf Saint-Cyr übertragen und erreichte dadurch, daß die Unterhaltungskosten einer so großen Anstalt geringfügig erschienen. Zudem war der Zweck der Gründung so gut, daß sie mit Recht nur Billigung und Lob fand.
Ihre öffentliche Anerkennung war allezeit ihr sehnlichster Wunsch. Der heldenhafte Widerstand, den ihr Louvois entgegengestellt hatte, war die Ursache seines baldigen Sturzes gewesen. Gleichzeitig mit ihm fiel der Erzbischof von Paris, der ihm zur Seite gestanden hatte, in Ungnade. Frau von Maintenon hatte deshalb nicht auf jede Hoffnung verzichtet und schien gerade jetzt ihrem Ziele nahe. Aber der König erinnerte sich der früheren Vorgänge und fragte den Bischof von Meaux, den berühmten Bossuet, und Fénelon, den Erzbischof von Cambrai, um Rat. Beide widerrieten ihm, und so scheiterte der Plan für immer. Der Erzbischof stand mit Frau von Maintenon bereits seit der Geschichte mit der Frau Guyon auf gespanntem Fuße, aber der König hielt große Stücke auf ihn. Nun jedoch dauerte es nicht lange, daß er auch bei der Majestät in Ungnade fiel. Gegen Bossuet wagte Frau von Maintenon aus vielen Gründen nicht zu arbeiten. Einmal brauchte ihn nämlich der Bischof von Chartres, Godet, der gänzlich im Garne der Maintenon war. Bossuets Feder und großer Name waren seine Waffen gegen Fénelon. Zudem war der König allzusehr an Bossuet gewöhnt und schätzte ihn ungemein hoch. Er war früher der höchste Vertraute des Königs gewesen und in die Geheimnisse seines ehedem so sittenlosen Lebens eingeweiht. Zu guter Letzt hatte er der Maintenon ohne seine Absicht einen außerordentlichen Dienst erwiesen.
Bossuet war ein Ehrenmann. Sein Wissen war nicht minder groß als seine Männlichkeit und Geradheit. Als Erzieher Monseigneurs war er in enge Berührung mit dem König gekommen, der sich mehr denn einmal an ihn gewandt hatte, wenn ihm sein Lebenswandel irgendwelche Bedenken verursachte. Bossuet hatte ihm dann stets mit einer Freiheit ins Gewissen geredet, die einem Kirchenvater zu Zeiten des Urchristentums alle Ehre gemacht hätte, und mehr denn einmal hatte er den König von schlimmen Dingen abgehalten. Ein wichtiges Ergebnis seines guten Einflusses war es, daß Frau von Montespan für immer vom Hofe verdrängt wurde. Die unwiderrufliche Entfernung dieser Favoritin enthob Frau von Maintenon großer Sorge. Wenngleich sie auf dem Höhepunkt ihres Glanzes stand, hatte sie doch keine rechte Ruhe, solange sie ihre ehemalige Herrin noch bei Hofe wußte und mit ansah, wie der König sie noch täglich besuchte. Das war der außerordentliche Dienst, den ihr Bossuet erwiesen hatte, wie ihr wohlbekannt war.

12. Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704)
Hyazinthe Rigaud (1698)
Florenz, Uffizien.
Dieses Porträt bringt das Geistige in Bossuet weit intensiver zum Ausdruck als Rigauds ungleich berühmteres, ganz auf Repräsentation gestelltes Bildnis des Erzbischofs von Meaux, das heute im »Salon Carré« des Louvre hängt. Auf dem Stich, den Edelinck nach diesem Porträt schuf, ist zu lesen: »Aetatis anno 74.« Danach müßte das Porträt im Jahre 1701 entstanden sein. Aber aus Rigauds »Livre de Comptes« (herausgegeben von Eudel, Paris 1910) wissen wir, daß dieses Bildnis (S. 39) bereits Anno 1698 entstand, und zwar im Auftrage Cosimos III. de Medici. Rigaud malte allerdings im Jahre 1700 Porträts von Bossuet, wie aus dem »Journal« seines Eckermann, des Abbé Le Dieu hervorgeht. Dort heißt es (Paris 1856, II, S. 151 f.) unterm 27. September 1700: »Il [Bossuet] a été chez Rigaud faire retoucher ses deux portraits, pour M. le Chantre et pour M. de Moreri, de Meaux«; und am 3. November 1701 endlich (s. ebd. S. 245) begann Rigaud das Porträt im Louvre, das aber erst, nach Bossuets Tode, 1705 vollendet und gestochen wurde.
Ein subtiles literarisches Porträt hat seltsamerweise kein Zeitgenosse von Bossuet entworfen, aber der Abbé de Choisy zeigt uns die Wirkung seiner Persönlichkeit. Er schildert ihn »tantôt majestueux et tranquille comme un grand fleuve, conduisant ses auditeurs d'une manière douce et presqu'insensible à la connoissance de la vérité; tantôt rapide et impétueux comme un torrent, forçant les esprits, entraînant les coeurs, et ne permettant que le silence de l'admiration.«
Als sie ihre Hoffnung auf die Verkündung ihrer Ehe zum zweiten Male getäuscht sah, begriff sie, daß sie nie wieder darauf zurückkommen dürfe. Auch besaß sie Selbstbeherrschung genug, um sich völlig darüber hinwegzusetzen. Der König fühlte sich durch ihren geheimen Verzicht sehr erleichtert und war ihr dafür dankbar. Seine Zuneigung, seine Achtung und sein Vertrauen stiegen. Unter der Bürde der Stellung, die sie erstrebt hatte, wäre sie vielleicht zusammengebrochen. So aber wurde sie unter dem durchsichtigen Schleier des Geheimnisses nur noch mächtiger.
Dennoch darf man nicht glauben, daß es ihr ohne weiteres leicht gewesen wäre, ihre Macht zu behaupten und zu betätigen. Im Gegenteil, ihre Herrschaft war eine endlose Intrige, und die des Königs eine ewige Narrenrolle. Sie empfing keine Besuche und erwiderte auch keinen. Nur selten machte sie eine Ausnahme von dieser Regel. Sie besuchte die Exkönigin von England und empfing sie bei sich oder manchmal auch bei Frau von Montchevreuil, ihrer besten Freundin, die auch häufig zu ihr kam. Nach deren Tode suchte sie zuweilen Herrn von Montchevreuil auf, doch nur selten. Er hatte Zutritt bei ihr, wann es ihm beliebte, aber er kam immer nur flüchtig. Der Herzog von Richelieu genoß dasselbe Vorrecht. Mitunter ging sie auch zu Frau von Caylus, ihrer geliebten Nichte, die öfters zu ihr kam. Frau von Caylus war die Tochter des Generals Vilette, eines Vetters der Marquise von Maintenon. Sie spielte, seit ihre Tante allmächtig geworden war, eine nicht unbedeutende Rolle in den Machenschaften des Hoflebens. Wenn sie sonst ein oder zweimal im Jahre etwa die Herzogin von Lude oder eine andere hochgestellte Dame aufsuchte, so war dies eine Auszeichnung und ein besonderes Ereignis. Bei den Prinzessinnen des Königlichen Hauses erschien sie nie, und es kam auch keine zu ihr, höchstens in Form einer Audienz, was höchst selten der Fall war und jedesmal viel besprochen wurde. Wenn sie ihrerseits aber mit den Töchtern des Königs ein Wörtchen zu reden hatte, was gewöhnlich nur geschah, wenn sie ihnen einmal eine Standrede halten wollte, so ließ sie sie einfach holen. Sie kamen dann zitternd und bebend und entfernten sich heulend. Dem Herzog von Maine stand ihre Türe dauernd offen. Das war ihr Liebling. Ferner hatte der Herzog von Noailles Adrien-Maurice, Graf von Ayen, 1678 bis 1766, heiratete 1698 die Nichte der Frau von Maintenon, Françoise d'Aubigné. Er erhielt 1704 den Titel eines Herzogs von Noailles., seitdem er verheiratet war, Zutritt, sooft er wollte. Godet, den Bischof von Chartres, sah sie nur in Saint-Cyr, ebenso Aubigny, den Erzbischof von Rouen.
Bei ihr Audienz zu erhalten, war zum mindesten ebenso schwer wie beim Könige. Die wenigen, die sie zugestand, fanden fast ausnahmslos in Saint-Cyr statt, wo man sich dann zu bestimmter Stunde einzufinden hatte. Wollte man ihr in Versailles etwas vortragen, so mußte man ihr auflauern, wenn sie ihre Gemächer verließ oder dahin zurückkehrte. Das taten vornehme wie geringe und selbst arme Leute. Der Augenblick war kurz; man mußte ihn erfassen. War sie auf dem Wege zu ihrer Wohnung, so durfte man sie nur bis in das Vorzimmer begleiten. Dort brach sie das Gespräch kurz ab und ließ einen stehen. Eine kleine Anzahl von Damen nahm sie an in den Stunden, wo der König nicht bei ihr verweilte. Selten nahmen welche an ihrem Mittagsmahl teil.
Der Vormittag begann bei ihr früh und verging unter Empfängen gewöhnlicher Art in wohltätigen oder kirchlichen Angelegenheiten. Manchmal fand sich ein Minister, sehr selten der oder jener Marschall, ein. Oft fuhr sie um acht Uhr oder noch früher zu einem der Minister. Nur ausnahmsweise erschien sie bei ihnen zur Mittagstafel, im Kreise der Gemahlinnen und weniger Auserwählter. Das geschah nur, wenn sie einen besonders auszeichnen wollte, und war immer ein Ereignis, das aber keine weiteren Folgen hatte, als daß es dem Betreffenden Ansehen und Neid einbrachte. Der Marschall von Beauvillier war einer der zuerst häufig so Begünstigten, bis dies der Fall Fénelon änderte. Der Kriegs- und besonders der Finanzminister waren es, mit denen Frau von Maintenon am meisten zu tun hatte. Diese bearbeitete sie. Selten, ja mehr als selten, suchte sie die übrigen auf, und nur in Staatsangelegenheiten und immer vormittags. Zur Mittagstafel kam sie zu ihnen niemals.
Gewöhnlich begab sie sich, bald nachdem sie aufgestanden war, nach Saint-Cyr, um daselbst, allein oder mit einer guten Freundin, zu frühstücken. Dort erteilte sie, wie schon erwähnt, Audienzen, möglichst wenige, schulmeisterte in der Anstalt herum, erledigte kirchliche Verwaltungsangelegenheiten und las und beantwortete ihre Briefe. Von dort aus regierte sie alle möglichen Nonnenklöster und Erziehungsanstalten. Dort empfing sie auch die Polizei- und Spionageberichte. Ungefähr zur Stunde, da sie der König zu besuchen pflegte, war sie wieder zu Haus. Als sie älter und schwächer geworden war, legte sie sich nach ihrer Ankunft in Saint-Cyr, was zwischen sieben bis acht Uhr morgens geschah, eine Weile nieder. In Fontainebleau hatte sie ein Haus in der Stadt, wohin sie sich verfügte und dasselbe tat wie in Saint-Cyr. In Marly hatte sie ein kleines Appartement, von dem ein Fenster in die Kapelle ging. Auch hier lebte sie ganz wie in Saint-Cyr, nur daß sie für niemanden außer für die Herzogin von Burgund zugänglich war.
In Marly, Trianon und Fontainebleau kam der König zur Maintenon an den Vormittagen, wo kein Ministerrat abgehalten wurde und sie nicht in Saint-Cyr war. In Fontainebleau verweilte er von der Messe bis zur Mittagstafel, wenn letztere nicht unmittelbar nach der Messe stattfand, was der Fall war, wenn der König auf die Hirschhatz gehen wollte. Seine Besuche dauerten anderthalb Stunden und noch länger. In Trianon und in Marly blieb er nicht so lange bei ihr, weil er dort hinterher einen Spaziergang durch den Garten zu machen pflegte. Bei diesen Besuchen war fast niemals jemand zugegen, während der König bei seinen Nachmittagsbesuchen bei Frau von Maintenon fast nie allein war, denn die Minister erschienen der Reihe nach in ihren Gemächern, um mit dem Könige zu arbeiten. An Feiertagen fiel der Ministervortrag öfters aus. Dann spielte Majestät mit den Damen des engsten Kreises, oder man hörte Musik. Gegen Ende seines Lebens geschah dies mehr und mehr.
Abends gegen neun Uhr kleideten zwei Kammerfrauen die Marquise aus. Gleich darauf setzte ihr der Haushofmeister und ein Kammerdiener eine Suppe vor und irgendein leichtverdauliches Gericht. Nach Beendigung dieser Abendmahlzeit brachten sie die Kammerfrauen zu Bett. Alles das geschah in Gegenwart des Königs und des Ministers, der bei ihm noch Vortrag hatte, ohne daß man sich bei der Arbeit stören ließ oder ohne daß man leiser sprach. So kam zehn Uhr heran. Der König begab sich zu seinem Abendessen, und man zog die Bettvorhänge zu.
Ein königlicher Wagen, der Frau von Maintenon eigens zur Verfügung stand, brachte sie von Versailles nach Saint-Cyr. Epinay, der Stallmeister vom kleinen Stall, hob sie in den Wagen und begleitete sie zu Pferd. Das war sein tagtäglicher Dienst.
Auf Reisen ging es genau ebenso zu. Frau von Maintenon fuhr frühzeitig mit einer ihrer guten Freundinnen ab, mit Frau von Montchevreuil (solange sie lebte, war sie es unbedingt), Frau von Heudicourt, Frau von Dangeau oder Frau von Caylus, in dem ihr zur Verfügung gestellten Wagen. Epinay begleitete diesen zu Pferd. Im Wagen der Maintenon folgten ihre Kammerfrauen. Sie richtete es stets so ein, daß sie bei der Ankunft des Königs bereits völlig in Ordnung war, wenn er sie in ihrem Heim aufsuchte.
Sie war vor sich selbst die Königin, vor der Welt hinsichtlich Anrede, Platz, Rang usw. eine Privatperson. In Gegenwart des Königs, Monseigneurs, Monsieurs, des Exkönigspaares von England usw. hatte sie den letzten Platz. Ich habe sie bei der Königin von England und andernorts gesehen, wo sie ganz zurücktrat, den Damen des hohen und selbst des niederen Adels den Vortritt ließ, tadellos, höflich, gesprächig, liebenswürdig wie eine Dame, die keinen besonderen Rang hat und nichts Besonderes darstellen will. Trotzdem machte sie Eindruck. Sie ging immer sehr vornehm, gut und schick gekleidet, aber stets unauffällig und bescheiden und so, als sei sie älter, als sie wirklich war. Später, als sie sich nicht mehr öffentlich zeigte, trug sie nur noch schwarze Hauben und Bänder.
Zum Könige ging sie nur, wenn er krank war oder wenn er morgens Arznei eingenommen hatte. Ebenso pflegte sie es mit der Herzogin von Burgund zu halten. Kam der König zu ihr, dann saßen beide am Kamin je in einem Lehnstuhl, und jedes hatte einen Tisch vor sich. Am Tische des Königs standen noch zwei Taburette, eins für den Minister, der zum Vortrag erwartet wurde, und eins für dessen Aktentasche. An den Vortragstagen war der König nur kurze Zeit mit Frau von Maintenon allein, bis der Minister eintrat, und hinterher, wenn er fortgegangen, noch weniger. Während des Vortrags las oder stickte Frau von Maintenon. Sie hörte auf alles, was zwischen dem Könige und dem Minister verhandelt wurde, denn die Herren sprachen laut. Selten nur warf sie ein Wort dazwischen, noch seltener ein Wort von Bedeutung. Der König fragte sie häufig um ihre Meinung. Dann antwortete sie kühl und gemessen, und es schien, als hätte sie keinerlei Vorliebe. Noch weniger verriet sie den geringsten Anteil an den Personen, um die es sich handelte. In Wahrheit stand sie mit dem Minister längst im Einverständnis. Keiner der Vortragenden hätte es gewagt, in ihrer Abwesenheit gegen ihren Willen zu handeln, geschweige denn in ihrer Gegenwart. Wenn eine Auszeichnung oder ein Amt in Frage stand, war die Entscheidung bereits zwischen dem Minister und der Maintenon gefallen, ehe die Sache dem König vorgelegt wurde. Aus diesem Grunde verzögerte sich manche Angelegenheit, ohne daß der König noch sonstwer wußte, warum.
Gewöhnlich befahl sie den betreffenden Minister zu sich, mit dem sie zu reden hatte. Keiner wagte, eine Sache allerhöchsten Orts zur Sprache zu bringen, bevor er nicht ihre Weisungen empfangen und sich mit ihr ins Einvernehmen gesetzt hatte. Erst wenn dies geschehen, machte der Minister seinen Bericht und bereitete die Liste vor. Fügte es der Zufall, daß der König selber den Vorgeschlagenen der Frau von Maintenon bezeichnete, so war die Sache erledigt. Nannte der König aber jemand andern, so schlug der Minister vor, er möge erst einmal die ganze Liste durchgehen. Er ließ den König reden und strich dabei einen Namen nach dem andern aus. Selten schlug er ihm seinen Anwärter allein vor, sondern immer in einer Reihe von Mitbewerbern, an deren Verdiensten er hin und her mäkelte. Dadurch erschwerte er dem König die Entscheidung. Dann fragte ihn der König um Rat. Nun ging der Minister nochmals die Gründe für diesen und jenen durch, bis er sich schließlich besonders bei dem aufhielt, den er vom König ausgewählt haben wollte. War der König immer noch unschlüssig und wandte er sich an Frau von Maintenon, so lächelte sie, erklärte sich für unmaßgeblich, sprach zunächst meist von einem andern, kam aber dann auf den vom Minister in Vorschlag Gebrachten und gab so die Entscheidung. Auf diese Weise bewirkte sie drei Viertel aller Auszeichnungen und Ernennungen, und von dem fehlenden Viertel auch meist noch drei Viertel. Hatte sie zuweilen niemanden im Sinne, so setzte der Minister seine eigenen Wünsche durch, ohne daß der König irgendwie Verdacht schöpfte. Er bildete sich aber stets ein, selbständig und persönlich entschieden zu haben, wo er dies doch nur in ganz seltenen Fällen wirklich tat. Auch dann war es meist ein Zufall, ausgenommen, wenn er schon vorher einen ganz Bestimmten im Kopfe hatte oder wenn ihm ein Günstling einen solchen besonders empfohlen hatte.
Wollte Frau von Maintenon eine Sache durchdrücken oder scheitern lassen oder in eine bestimmte Richtung gelenkt haben, was seltener vorkam, als ihre Eingriffe bei den Personalien, so entspann sich genau dasselbe Spiel. Hieraus kann man ersehen, daß die kluge Frau fast alles durchsetzte, was sie wollte, freilich nicht alles, auch nicht immer zur gewünschten Zeit und in der erhofften Art und Weise.
Dieses insgeheime Zusammenarbeiten der Minister mit Frau von Maintenon vermehrte das Ansehen und die Macht der Minister und ihrer Gefolgschaft. Weder der Minister noch die Maintenon vermochten etwas ohne einander. Man war immer gegenseitig auf sich angewiesen. Sobald aber Frau von Maintenon bei einem Minister auf Widerstand stieß und es aufgab, ihn umzustimmen, war sein Untergang sicher. Nur nahm sie sich dazu schlauerweise Zeit und Gelegenheit.
Auch mit den Generalen und dem Kriegsminister arbeitete der König im Beisein der Frau von Maintenon, doch nur selten und meist sehr rasch. Ebenso mußte Pontchartrain, der Kanzler, über die Ergebnisse des Spionagedienstes und über die mannigfachsten Vorfälle bei Hof und in der Stadt Paris berichten. Frau von Maintenon war dadurch imstande, viel Gutes und auch viel Böses zu tun.
Die auswärtigen Angelegenheiten wurden im Staatsrat verhandelt. Eilige Sachen trug Torcy Jean-Baptiste Colbert, Marquis von Torcy, ein Neffe des berühmten Ministers; 1665 bis 1746. Diplomat, Staatssekretär (1696), Minister der Posten, Schatzmeister und Großordenskanzler; er ist einer der Urheber des Spanischen Erbfolgekrieges. dem Könige ohne weiteres allein vor. Frau von Maintenon hegte stark den Wunsch, daß auch diese Dinge bei ihr erledigt würden, um auch hier ihren Einfluß auszuüben, aber Torcy verstand es, sich dieser Gefahr sehr gewandt zu entziehen. Er entschuldigte sich stets damit, und zwar in der bescheidensten Weise, daß zu wenig vorläge, als daß sich derlei Arbeitsweise lohne. Selbstverständlich erzählte der König Frau von Maintenon auch alle auswärtigen Angelegenheiten, aber erst hinterher; und dies war ein großer Vorteil für Torcy.
Der Monarch war mißtrauisch. Mehrere Male ist es geschehen, daß der König dahinterkam, wenn ein Minister oder ein General einen ihrer Verwandten oder einen Schützling der Maintenon fördern wollte, ohne daß man es fein und verschmitzt genug einfädelte. Dann war er steif und starr dagegen und machte eine halb ärgerliche, halb spöttische Bemerkung darüber. Dergleichen gelegentliche Mißerfolge machten die Maintenon sehr vorsichtig und ängstlich. Deshalb war ihre ständige Antwort, wenn sich jemand an sie wendete: »Ich mische mich in nichts!« Höchst selten gab sie einen bestimmten Bescheid. Demungeachtet wandte man sich immer wieder an sie, in der Hoffnung, daß sie sich, trotz der anscheinend abschlägigen Antwort, in der erbetenen Hinsicht bemühen werde. Dies geschah auch zuweilen.
Es waren alles in allem höchstens fünf bis sechs Persönlichkeiten, meistens Freundinnen von früher, denen sie eine offene und ehrliche, wenngleich immerhin unverbindliche und vorsichtige Zusage gab, und deren sie sich dann auch wirklich tatkräftig annahm. Wie schon gesagt, erreichte sie meistens, was sie wollte, aber doch nicht immer.
Le Tellier, lange Zeit Kanzler von Frankreich, kannte den König hierin vorzüglich. Einer seiner besten Freunde bat ihn eines Tages um Fürsprache bei Majestät in irgendeiner Angelegenheit seines Amtsbereiches. Le Tellier gab zur Antwort, er werde sein möglichstes tun. Das genügte dem Freunde nicht; da sagte der Kanzler freimütig: »Sie kennen das Gelände nicht. Gewiß entscheidet Majestät in neunzehn von zwanzig Fällen der ihm vorgetragenen Angelegenheiten so, wie man es will. Aber ebenso gewiß entscheidet er im zwanzigsten Falle anders. Welcher Fall dieser zwanzigste ist, der gegen unsern Wunsch nach seinem Gutdünken entschieden wird, das weiß vorher kein Mensch. Oft ist es gerade die Sache, die einem am meisten am Herzen liegt. Es ist das besondere Vergnügen von Majestät, hin und wieder fühlen zu lassen, daß er doch der Herr und Meister ist. Wenn er dabei zufällig halsstarrig bleibt und die Sache so wichtig ist, daß auch wir beharren, dann gibt es manchmal einen Zornesausbruch. Läßt man diesen über sich ergehen, ist der Vorschlag gefallen, und hat Majestät einem seine Überlegenheit bewiesen, dann tut es ihm leid, daß er verletzend war. Dann wird er nachgiebig, und man kann nun alles durchsetzen, was man will.«
In ähnlicher Weise behandelte der König Frau von Maintenon, gegen die er oft höchst zornig und ausfällig wurde, womit er sich selber groß dünkte. Dann vergoß sie wohl Tränen vor ihm und tat tagelang duckmäuserig. Später, als durch sie Fagon, ein ihr sehr ergebener und kluger Mann, an Daquins Stelle Hofleibarzt geworden war, spielte sie in solchen Fällen die Kranke, wodurch sie meist viel erreichte. Trotz aller Tuerei und in der nackten Wirklichkeit hatte sie jedoch durchaus nicht die Macht, den König zu irgend etwas zu nötigen. Ludwig XIV. war ein unbedingter Selbstling. Seine Mitmenschen hatten nur insofern Bedeutung für ihn, als sie ihm dienten. Sonst berührten sie ihn nicht im leisesten. Zur Zeit, da er für seine Buhlerinnen sehr viel übrig hatte, befreite er sie doch von keiner Pflicht, selbst auf beschwerlichen Reisen nicht; ebensowenig hinsichtlich der Hoftracht. Auch die bevorzugtesten Damen hatten nie anders als so zu erscheinen, sogar im Reisewagen. Ob sie krank oder in andern Umständen waren, war gleichgültig; kaum genesen und sechs Wochen nach ihrem Wochenbett mußten sie in großer Kleidung, geschmückt und geschnürt, mit nach Flandern und noch weiter reisen, tanzen, die Nächte aufbleiben, Feste und Festmahle mitmachen, fröhlich und gesellig sein, immer rüstig und nie mißlaunig, trotz Hitze, Kälte, Staub, Wind und Wetter, und stets auf die Minute pünktlich.
Seine eigenen Töchter behandelte er in keiner Hinsicht anders. Auch gegen die Herzogin von Burgund, die er doch so zärtlich liebte, als er dessen nur fähig war, nahm er nicht mehr Rücksicht denn gegen andere.
Auf Reisen hatte er in seinem Reisewagen immer eine Menge Damen bei sich, seine Geliebten, dann seine unehelichen Kinder, seine Schwiegertöchter, zuweilen Madame, auch andere Damen, soweit Platz da war. Man hatte allerlei Lebensmittel mit, Fleisch, Gebäck, Früchte. Kaum hatte man eine halbe Wegstunde zurückgelegt, so fragte der König bereits, ob man nicht etwas verzehren wolle. Er selbst aß zwischen den Mahlzeiten nie etwas, auch kein Obst. Aber er sah es gern, wenn andre aßen und recht tüchtig aßen. Die Damen mußten Hunger und gute Laune haben, mit Eßlust und Anmut essen, sonst ward er verstimmt und hielt damit nicht hinter dem Berge. Man sei zimperlich, geziert, unnatürlich, murrte er dann. Mochte man aber noch so zulangen, so mußte man abends an der Tafel trotzdem essen, als hätte man den ganzen Tag über keinen Bissen bekommen.
Der König liebte die freie Luft und ließ sämtliche Wagenfenster öffnen. Er hätte es sehr unpassend gefunden, wenn eine der Damen den Fenstervorhang zugezogen hätte, um sich gegen Sonne, Zug oder Staub zu schützen. Unterwegs unwohl zu werden, war ein nie wieder gutzumachendes Majestätsverbrechen.
Auch Frau von Maintenon, die starken Zug und Ähnliches als Unannehmlichkeit empfand, erfreute sich keines Vorrechtes in dieser Hinsicht. Alles, was sie durchsetzen konnte, war, daß sie unter dem Deckmantel der Bescheidenheit allein fahren durfte. Aber mit auf die Reise mußte sie, in welchem Zustande sie auch sein mochte. Sie mußte vorher ankommen und sich schon häuslich niedergelassen haben, wenn der König eintraf. Sehr häufig fuhr sie mit nach Marly in einer Verfassung, in der man keine Dienstmagd über Land geschickt hätte. Einmal war sie so krank, auf der Fahrt nach Fontainebleau, daß man befürchtete, sie stürbe unterwegs. Wie ihr Befinden auch sein mochte, der König besuchte sie zur üblichen Stunde und änderte in seiner Tagesordnung nicht das geringste. Höchstens durfte sie im Bett bleiben, und mehr als einmal lag sie fieberkrank darin. Der König, der die frische Luft liebte, wie schon gesagt, war oft erstaunt, alle Fenster geschlossen zu sehen, und ließ alle aufmachen. Davon ging er nicht ab, auch wenn er sah, daß Frau von Maintenon leidend war. Auch bei kühler Nachtluft blieb es dabei, bis er um zehn Uhr abends wegging. Wenn verabredet war, daß Musik in ihren Gemächern gemacht werden sollte, gab es keine Änderung, auch wenn die Maintenon Kopfschmerzen oder Fieber hatte. Ebenso mußte sie das Flackern von hundert Kerzen vor den Augen ertragen. So lebte der König ganz nach seinem Wohlgefallen, ohne zu fragen, ob es ihr lästig sei.
Erwähnenswert sind die Spaziergänge, die sie in den Gärten von Marly zusammen mit dem König machte. Mit der wirklichen Königin wäre er hundertmal zwangloser und weniger galant gewesen. Obwohl er vom ganzen Hofe und den Bewohnern von Marly beobachtet werden konnte, erwies er ihr doch in der auffälligsten Weise seine Hochachtung. In Marly hielt er sich nämlich für einen freien Mann. Die beiden Vehikel, seins und das der Frau von Maintenon, bewegten sich nebeneinander hin; der König in seinem Wagen, Frau von Maintenon in einer Sänfte. Sie zog eine solche vor Diese Chaisen haben sich aus dem 18. Jahrhundert bis zum Umsturz von 1918 nur in einer einzigen Stadt Europas im öffentlichen Gebrauch erhalten, in Dresden.. Oft ging der König auch zu Fuß neben ihrer Chaise her. Aller Augenblicke lüftete er seinen Hut und beugte sich, um Frau von Maintenon etwas zu sagen oder ihr zu antworten. Sogar beim allerschönsten Wetter ließ sie das Schiebefenster jedesmal nur drei Fingerbreit herab und schloß es immer gleich wieder. Blieb man halten, um irgend etwas zu betrachten, so gab es das nämliche merkwürdig zeremonielle Schauspiel. Zu Ende des Spazierganges begleitete der König die Marquise bis an das Schloß, verabschiedete sich von ihr und setzte seinen Weg allein fort. Derartige Einzelheiten fehlen fast in allen Denkwürdigkeiten, und doch vermögen gerade sie das beste Bild einer Zeit zu geben.
Der König war äußerst fromm. Selten versäumte er Advents- und Fastenpredigten, niemals die in der Karwoche und an den hohen Festen, niemals die beiden Fronleichnamsprozessionen oder die vom Heiligen-Geist-Orden oder zu Mariä-Himmelfahrt. In der Kirche war er sehr andächtig. Wer mit ihm der Messe beiwohnte, mußte vom Sanctus bis nach dem Abendmahl des Priesters knien. Niemand durfte das geringste Geräusch machen oder schwatzen. Er ward gegen den Betreffenden höchst ungnädig. Er fehlte Sonntags beinahe nie beim Salus, hörte es oft Donnerstags mit an und stets in der Fronleichnamsoktave. Fünfmal im Jahre nahm er das Abendmahl in Ordenstracht; am Osterheiligabend in der Pfarrkirche, die andern Male in der Kapelle, nämlich am Pfingstsonnabend, zu Mariä-Himmelfahrt, bei der großen Messe am Heiligenabend vom Allerheiligenfest und am Weihnachtsheiligenabend. Nach dem Abendmahle fand immer eine stille Messe statt; Musik unterblieb. Und jedesmal rührte er Kranke an. An diesen Tagen ging er auch zur Vesper, und danach arbeitete er mit seinem Beichtvater an der Verteilung lediger Pfründen. Selten verlieh er Pfründen zu einer andern Zeit im Jahre. Am Tage nach dem Abendmahle ging er in die große Messe, Vesper und Frühmesse und in die drei Mitternachtsmessen mit Musik. Die Kapelle bot da ein wundervolles Schauspiel. Den nächsten Tag begab er sich wieder in die große Messe, in die Vesper und zum Salus. Am Gründonnerstag bewirtete er die Armen. In der Messe betete er seinen Rosenkranz (mehr wußte er nicht), immer im Knien, ausgenommen beim Evangelium. Bei den großen Messen saß er in seinem Lehnstuhl, aber nur an den Stellen, wo man sich für gewöhnlich setzt. Die Stationen an den Jubeljahresfesten machte er beinahe immer zu Fuße. An den Fasttagen begnügte er sich mit einem Imbiß.
Seine Lieblingsfarbe war braun. Er ging beständig in Braun verschiedenen Tones. Als Schmuck trug er leichte feine Spitzen, zuweilen nichts als einen Goldknopf, manchmal schwarzen Samt. Seine rote, blaue oder grüne Weste aus Atlas oder Seide war reich gestickt. Nie trug er einen Ring am Finger, Edelsteine nur an seinen Schuhschnallen, am Kniegürtel und an der Schnalle am Hut, der mit Goldborte besetzt und mit einem weißen Federstutz geschmückt war. Das große blaue Ordensband mit Brillanten im Werte von acht bis zehn Millionen Franken trug er nur bei Hochzeiten und ähnlichen Festen über dem Rock. Sonst war er in der Königlichen Familie und unter den Prinzen von Geblüt der einzige, der das Ordensband unter dem Rocke trug. Das machten ihm damals sehr wenige Ordensritter nach. Heutigentags trägt es kaum einer mehr über dem Rocke.
Aller vierzehn Tage fuhr der König nach Saint-Germain. Daran änderte auch der Tod Jakobs II. nichts. Jakob II., 1633 bis 1701, war gegen Ende des Jahres 1688, zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung, mit seiner Familie nach Frankreich geflohen, wo ihm Ludwig XIV. die verlassene Residenz Saint-Germain als Wohnort anwies. Er machte von da aus verschiedene vergebliche Versuche zur Wiedererlangung des englischen Thrones. Über seine Hofhaltung vgl. G. du Bosq de Beaumont et M. Bernos: La Cour des Stuarts à Saint-Germain-en-Laye 1689-1718. Paris, Emile-Paul, 1912. Der Hof von Saint-Germain kam zuweilen nach Versailles, öfter zur Abendtafel nach Marly. Der Exkönig ward zu allen Vergnügungen eingeladen und stets ehrenvoll ausgezeichnet. Man war gegenseitig übereingekommen, einander in der Mitte des Zimmers zu empfangen und zu begleiten. In Marly empfing der König diese Gäste an der Tür zum kleinen Saal. Er geleitete sie auch so weit und sah zu, wie sie in ihre Sänften stiegen. In Fontainebleau empfing er sie oben auf der Hufeisentreppe, seitdem sie nicht mehr wollten, daß man ihnen bis in den Park entgegenkam. Der König war unvergleichlich besorgt und rücksichtsvoll und höflich zum englischen Exkönigspaar, dabei ebenso würdevoll wie liebenswürdig. In Marly blieb dieses erst immer eine Viertelstunde inmitten der Hofgesellschaft im kleinen Saal. Darauf ging man zum König und zur Frau von Maintenon.

11. Françoise d'Aubigne, Marquise de Maintenon (1635-1719)
Pierre Mignard (1694)
Paris, Louvre
»Au reste, Madame, j'ai vu la plus belle chose, qu'on puisse imaginer: c'est un portrait de Mme. de Maintenon, fait par Mignard; elle est habillée en sainte Françoise Romaine; Mignard l'a embellie, mais c'est sans fadeur, sans incarnat, sans blanc, sans l'air de la jeunesse; et sans toutes ces perfections, il nous fait voir un visage et une physionomie au dessus de tout ce que l'on peut dire: des yeux animés, une grace parfaite, point d'atours et avec tout cela aucun portrait ne tient devant celui la.« (Madame de Sévigné: »Lettres«, ed. Hachette. X. Bd., S. 208) Die Bibliothèque Nationale zu Paris verwahrt unter ihren Papieren folgende anonyme, im Stile eines Reisepasses gehaltene Schilderung von Madame de Maintenon, die d'Haussonville und Hanotaux in ihren »Souvenirs sur Madame de Maintenon«, Paris 1902, I, S. VI publizierten: »Visage ovale d'un tour admirable, beau teint, grands yeux noirs fort vifs, nez aquilin, bouche grande, belles dents, lèveres vermeilles bien bordées, sourire charmant, mains et bras bien taillés, beau port, physionomie fine ... cachant avec soin une belle gorge ...«
Der König hielt sich niemals im großen Saal auf, außer bei Bällen. Er schritt hindurch, um einen Augenblick dem Spiele des jungen Königs von England oder des Kurfürsten von Bayern zuzusehen.
Die Geburts- oder Namenstage in seiner Familie gingen unbeachtet vorüber, während man sie an den Höfen Europas allüberall feierte. Der König tat ihrer nie Erwähnung.
Seit dem Jahre 1709 mehrten sich die häuslichen Schicksalsschläge von Jahr zu Jahr und ließen von der Königlichen Familie nicht wieder ab. Der Fürst von Conti und Monsieur le Prince waren innerhalb von sechs Wochen dahingegangen. Monsieur le Duc folgte in Jahresfrist, und der älteste der Prinzen von königlichem Geblüt, die nunmehr noch am Leben waren, hatte ein Alter von kaum siebzehn Jahren. Dann starb Monseigneur.
Sehr bald darauf trafen den König noch empfindlichere Schläge. Sein Herz, das er bis dahin selber brach liegen gelassen hatte, wurde durch den Verlust der liebenswürdigen Dauphine gebrochen. Seine Ruhe floh mit dem Tode des unvergleichlichen Dauphins. Mit seiner Sorglosigkeit um die Nachfolge auf dem Thron war es mit dem Hinscheiden des Enkels, acht Tage später, zu Ende. Der nunmehrige Thronerbe war erst fünfundeinhalb Jahre alt.
Doch wer kann die Schrecken schildern, die mit den letztgenannten drei Unglücksfällen auftauchten, ihre Ursachen und die einander widerstreitenden Verdachtsgedanken, die künstlich erzeugt und geschürt worden waren, ferner die gräßliche Wirkung dieser Gerüchte? Die Feder sträubt sich vor so geheimnisvollen Greueln. Man kann das Gelingen dieser Schandtaten nur beklagen, nicht zum mindesten deshalb, weil sie die Ursache des Gelingens von weiteren ebenso abscheulichen Dingen waren. Man muß sie beklagen, weil sie ihren Schatten auf die Zukunft Frankreichs warfen, weil sie das Unglück des Königreichs auf den Gipfel getrieben haben. Es gibt niemanden im Lande, dessen Mund nicht immer wieder Gottes Vergeltung anriefe.
Alle diese nicht endenden grauenvollen Umstände und schmerzlichen Tatsachen umstürmten die zähe Natur des Königs. In diesem vielfachen Ungemach bewies er seine Seelengröße um so mehr, als er in seiner Familie ebenso wie nach außen unumschränkter Herrscher gewesen war. So lange Jahre immer an die höchsten Erfolge gewöhnt, sah er sich schließlich in jeder Richtung vom Glück verlassen. Zu Boden geworfen von erbitterten Feinden, die mit seiner sichtlichen Machtlosigkeit spielten und ihn ob seines verlorenen Glanzes höhnten, sah er sich äußerlich ohne Rückhalt, ohne fähige Minister und Heerführer, und innerlich schwer bedrückt, ohne jedweden Trost, eine Beute seiner Schwächen. Einsam und allein mußte er gegen seelisches Grauen kämpfen, das tausendmal fürchterlicher war, als das schlimmste äußere Ungemach. Er war nicht mehr freier Herr von sich selbst, und obwohl er die volle Last der Fesseln spürte, denen er sich hingegeben hatte, so konnte, ja so wollte er sich nicht freimachen. Sowohl durch eine Neigung, die ihn unbesiegbar beherrschte, als auch durch die Gewohnheit, die ihm zur Natur geworden, war er nicht imstande, sich über das Tun und Treiben seiner Kerkermeister klar zu werden. In den Banden dieser häuslichen Zwangsherrschaft war er gleichwohl in der Seele zäh und fest, nach außen gleichmütig, immerdar darum besorgt, das Steuer noch möglichst fest in den Händen zu behalten, noch voller Hoffnung, wo niemand mehr hoffte, und zwar aus Mut und Weltklugheit, nicht aus Blindheit. Zu alledem wären an gleicher Stelle nur wenige Menschen fähig gewesen, und darum verdient er den Beinamen der Große, den man ihm voreilig zugesprochen hatte. Das ist es auch, was ihm die aufrichtige Bewunderung aller Welt eingetragen hat und die Achtung derjenigen seiner Untertanen, die davon Zeugen waren. Eine Menge Herzen, die ihm im Laufe seiner so langen und so harten Herrschaft entfremdet worden waren, fielen ihm zuletzt wieder zu.
Insgeheim fügte er sich in Gottes Schickung. Er erkannte darin die Vergeltung und unterwarf sich der ewigen Gnade, ohne seine Person und seine königliche Würde vor den Augen der großen Menge zu demütigen. Im Gegenteil, seine Haltung berührte die Menschen wie ein Hauch von Seelengröße.
Der so stolze Fürst ertrug jene Zwangsherrschaft, er, der ehedem ganz Europa in seinen Händen gehalten hatte, er, der seine eigenen Untertanen zugunsten von Ausländern und Verwandten arg bedrückt hatte, er, der jedwede Freiheit niedergehalten und selbst die frömmsten und rechtgläubigsten Gemüter geknechtet hatte.
Seine starke innere Zerknirschung gab sich gewaltsam kund. Man kann sie in seinen Worten an die ehemalige Königin von England und die Mitglieder des Parlaments deutlich erkennen. Er habe sich seinen Frieden erkauft. Als er seinen Letzten Willen aus den Händen gab, bemerkte er, er, der vollendete Herr über sich selbst, er, der niemals etwas aussprach, was er nicht sagen wollte, und alles so faßte, wie er es zu sagen beabsichtigte: man habe ihn damit gequält und ihn veranlaßt, etwas gegen seinen Willen und gegen seine Pflicht zu tun. Es liegt eine sonderbare Heftigkeit, ein sonderbares Weh, ein sonderbares Bekenntnis in diesen Worten, die ihm die schmerzliche Stimmung der Stunde gewaltsam entriß.

34. Ludwig XIV. im Jahre 1688
Unbekannter Künstler.
Miniatur aus den »Heures de Louis le Grand, faites dans l'Hostel royal des Invalides, 1688.«
Paris, Bibl. Nat. – Latin 9476, fol. Av.
Vergl. Anmerkung 1 auf Seite 118.
(Siehe auch Nr. 1, 3, 15, 31)
Ludwig XIV. ward nur von seinen Kammerdienern, sonst sehr wenig, betrauert. Sein Nachfolger war noch zu jung dazu. Madame hatte den König immer nur gefürchtet. Die Herzogin von Berry liebte ihn nicht und rechnete schon auf die Herrschaft. Der Herzog von Orleans hatte keinen Anlaß zu trauern; und wer Grund gehabt hätte, den Toten zu beweinen, tat es nicht.
Paris frohlockte in der Hoffnung auf Freiheit und Unabhängigkeit, nachdem es so lange unter dem Joch gestöhnt, und in der Freude, daß nun die Macht so vieler aufhörte, die sie mißbraucht hatten. Die Vorländer waren verfallen und ausgesogen. Freudig atmete man allerorts auf. Parlament und Gerichte, denen allerlei Erlasse und Verfügungen die Hände gebunden, beglückwünschten sich, nun für frei zu gelten, nun frei zu sein. Das Volk war zugrunde gerichtet, gedrückt, verzweifelt. Jetzt dankte es Gott in lautem Taumel für die Befreiung, die seine heißesten Wünsche nicht mehr zu erhoffen gewagt hatten.
Die vier Veduten 6, 14, 32, 33 stammen aus dem Werke: »Les Plans, Profils et Elevations des Ville, Château de Versailles ... Levez sur les Lieux, Dessinez et Gravez en 1714 et 1715. A Paris, chez Demortain.«
Während der größte Teil der Bilder durch den Verlag nach den Originalen neu aufgenommen worden ist, standen für einige die bei Ad. Braun & Cie., Dornach i. Elf. (2, 8, 11, 16, 19, 20, 22, 26, 28), F. Bruckmann A.-G., München (9, 24, 30), Fratelli Alinari, Florenz (12, 13), A. Giraudon, Paris (21), Lacoste & Co., Madrid (10), Mansell & Co., London (1) vorhandenen Photographien zur Verfügung.