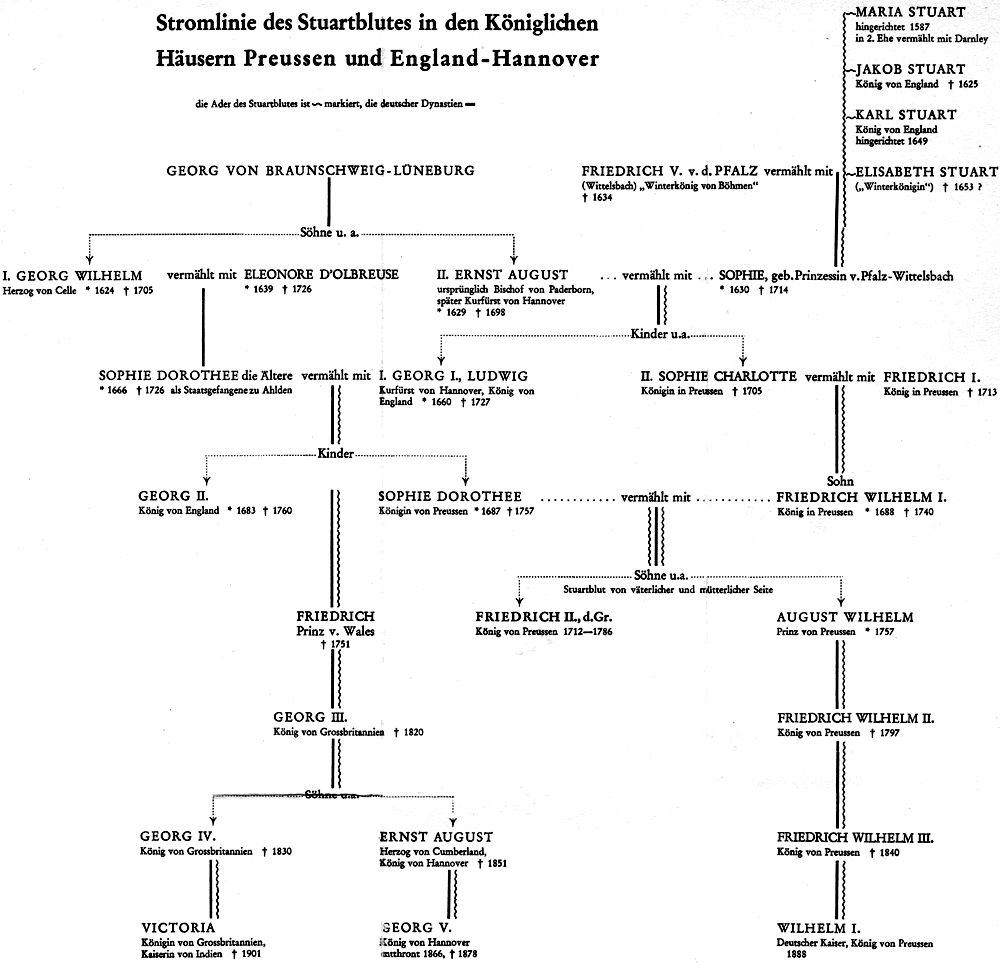|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
›Ich muß gestehn, Majestät, daß Ihr Gesicht, ebenso Ihre Uniform, recht voll Tabak ist.‹
Friedrich: ›Das nenne ich, mein Herr, recht wie ein Schwein. Solange meine Mutter lebte, war ich reinlicher, oder, um mich genauer auszudrücken, weniger unreinlich. Seit dem unersetzlichen Verlust, den ich durch ihren Tod erlitten habe, kümmert niemand sich um mich – aber rühren wir lieber nicht an diese Seite. Guten Abend, mein Lieber, gute Nacht …‹
Friedrich im Gespräch mit seinem Vorleser Henri de Catt.
Wie alle die pyknischen, der Erde verhafteten und an die Erde fest sich klammernden Naturen stirbt Friedrich Wilhelm einen schweren Tod. Da sehen wir in den letzten Monaten den ungefügen, grobschlächtigen Mann (Seckendorf erfährt das alles sozusagen über Nacht durch den diensttuenden Kammermohren) dahinvegetieren zwischen fünf bereitstehenden, frisch aufgedeckten Betten, weil in dem einmal durchwärmten Lager sofort mit doppelter Qual die Atemnot kommt. So wird er von einem Lager zum andern, vom Bett zum Fenster, vom Fenster zum Fahrstuhl und wieder zum Bett geschleppt, und wenn der Anfall der Angina pectoris kommt, schreit der arme und gar nicht geduldige Kranke verzweifelt ›Luft, Luft!‹, zertrümmert in rasender Angst Wasserflaschen, Stühle und Medizinflaschen und macht den Zeugen dieses Sterbens das Leben sauer genug …
›Das Wasser‹, berichtet der Kammermohr an den österreichischen Geschäftsträger, ›hört man im Leibe poltern, wenn Se. Majestät sich bewegt‹, und dieses furchtbare Wasser, die Quittung auf die barbarisch schwere Kost eines eßfrohen Lebens, ist dem reinlichkeitsgewohnten Manne so verhaßt, daß er in den Anordnungen für seine Bestattung eindringlich dessen Entfernung aus dem Körper anbefiehlt, obwohl er im übrigen ›bei Leib und Leben‹ verbietet, ›daß aus seinem Leichnam irgendein Organ entfernt werde‹.
So also sind über den, vor dem durch siebenundzwanzig Jahre seine Gefolgsleute noch in den letzten Winkeln seines kimmerischen Reiches zitterten, Hiobs dunkle Tage gekommen, und man kann, wie gesagt, nicht behaupten, daß er sie geduldig trägt. Vier Pagen werden blutig geschlagen, noch eine Woche vor dem Sterben verprügelt Se. Majestät eigenhändig ein paar des Holzdiebstahls bezichtigte Jäger, die Diener werden so schwer mißhandelt, daß sie schließlich den Dienst versagen. Die Königin wird streng, wie sie Kranken gegenüber immer streng war, wie sie ihre Kinder, wenn sie in Unpäßlichkeiten jammerten, immer aus ihrer Nähe verbannte, wie sie jedes Sichgehenlassen immer mit eisiger Verachtung gestraft hat. So greift sie an diesem Krankenbette ein. ›Wenn er sich nicht mäßige‹, bedeutet sie dem Kranken, ›werde alle Welt von ihm gehn, um ihn verfaulen zu lassen, wie er da liege … oder man werde ihn an die Kette legen müssen wie ein wildes Tier …‹
Sagt die Königin aus dem Blute der Stuarts, und es ist, wie gesagt, die Stunde herangereift, wo sie sich endgültig für die Jahre ihrer Ernte frei macht von dem armen Tyrannen, der nun wehrlos vor ihr liegt. Aehnlich, wenngleich zu schaudervoller Tat, war einst ihre Ahnin Maria hinweggeschritten über Darnleys Leben. Wer aber in ihrem Tun das vermißt, was das Biedermeier ›Gemüt‹ nannte, der erinnere sich daran, daß die Frau, die den Sieger von Leuthen hatte gebären sollen, andere … aber auch wirklich ganz andere Eigenschaften als die des Gemütes in sich zu bergen hatte …
Dieses harte Wort also wurde an Friedrich Wilhelms Krankenbette gesprochen. Der hilflose Tyrann sieht sich kläglich nach den Anwesenden um, als wolle er fragen, ob denn niemand ihm helfen wolle. Dann beginnt er kläglich zu weinen.
Das also ist der schwere Kampf, den alle Erdensöhne durchkämpfen müssen – der schwere Kampf, in dem sie ihre Leiblichkeit besiegen und durch das enge Schlüsselloch zwischen dem Hier und dem Drüben sich zwängen müssen. Er geht auch für diesen gefällten Riesen vorüber, und nun, wo er ihn bestanden hat, empfängt er den Sohn. ›Gott sei Dank‹, schreibt Friedrich an seinen Freund Suhm, ›der König liest nun täglich drei Stunden in Wolfs Philosophie. So sehen wir endlich doch noch die Vernunft siegen.‹
So schreibt Friedrich. Es ist ja nur die heute fadenscheinig gewordene Vernunft des XVIII. Jahrhunderts, jene alleswissende Vernunft der Encyklopädisten, die die Auflösung aller großen Staatsgedanken, aller Formen, aller Farben … ja die Aufhebung der ganzen alten europäischen Kultur gebracht hat und geradeswegs hinübergleitet in Gleichmacherei, Menschenrechte, Liberalismus und in die graue Melangesauce des XIX. Jahrhunderts – es ist nur jene Vernunft, an die Friedrich, Kind einer selbstzerstörerischen Zeit, glaubt: rechten wir über diesen Glauben nicht. Uebrigens hält er insgeheim, was der argwöhnische Vater natürlich merkt, Estafetten bereit, die ihm den Tod des Königs sofort melden sollen, arbeitet auch schon viele Tage zuvor für die Garnison, für die Schloßwachen, für den Hof sehr bestimmte Befehle über das aus, was in dem Augenblick, wo der Vater die Augen schließt, zu geschehen hat. Narren mögen auch dies gemütlos schelten – es ist bei jedem Thronwechsel so gewesen, wo der Thronfolger kein Traumkönig war, es wird auf jedem Bauernhof so sein, wenn der alte Regent stirbt und ein junger regieren will.
Seht also, hier stirbt nach wohlverwaltetem Leben und unter den Augen einer Familie, die er um seiner Arbeit willen durch sein ganzes Leben schund und vergewaltigte, ein großer, edelmütiger, von seinem Tagewerk besessener Fürst – ein Stuartenkel auch er. Zeitgenossen sagen aus, daß der Anblick des Sterbenden in seiner Verunstaltung furchtbar gewesen sein soll – erinnern wir uns also, daß auch hier der Todesengel die milde Gabe der Verklärung in der Hand hielt und daß seine Totenmaske – jenes Lebensdiagramm, das da niemals lügt – nur von unendlicher Gelassenheit, nur vom Ausruhen nach grimmigem Gefechte, nur von einem unsäglich guten Gewissen zeugt. Mit der Umgebung gibts am Sterbelager noch diese und jene harte Auseinandersetzung. So mit dem Seelensorger, der von Buße und Gericht redet und unwirsch abgefertigt wird. ›Arm und nackt werde ich im Grabe liegen‹, betet der geistliche Herr. ›Das‹, brummt der sterbende königliche Rechthaber, ›ist nicht wahr, denn ich werde in meiner Uniform begraben werden.‹
So hat ers nämlich angeordnet. Kein drap d'or, wie der königliche Vater, der Freund der alten Sophie, ihn im Sarge trug. Sondern Montur wie immer. Stundenlang spricht er mit seinem Thronfolger hinter verschlossenen Türen, ›hat ihm dann alles gesagt, was er weiß‹, hat sein Haus bestellt. Wenn's fertig ist, kommt der Tod – so will es der Fluch, der Evas Söhne aus dem Paradiese trieb.
Als es so weit ist, läßt er sich noch einmal hundert Grenadiere von seinem Regiment kommen, läßt sich in den Hof hinaustragen, verschenkt, wie ein sterbender Tatarenkhan, an seine Getreuesten Pferde, Waffen und alles, was ihm lieb war (Hunde nicht zu vergessen!) … zankt zum Schluß sich noch mit dem Leibarzt Ellert herum, der das Aussetzen des Pulses feststellt, und beweist mürrisch dem Doktor, daß er noch immer die Finger bewegen könne. Stirbt und wird begraben unter einer wohlverdienten Leichenpredigt, deren Text er sich selbst bestimmt hat: ›Denn ich habe einen guten Kampf gekämpft.‹ Er war, wie er war, aus einem Stück, und es rechte über die Ziele dieses Kampfes, wer rechten mag: gut und ehrlich war dieser Kampf. Ihre Majestät ist unsichtbar geblieben in den letzten Tagen dieses Sterbens, das unter den Augen der Männer sich vollziehen sollte, wie das Leben den Männern und eigentlich wohl nur ihnen gehört hat.
Sophie Dorothee also ist unsichtbar geblieben nach den kühlen im Rokoko gültigen Gesetzen einer Lebenskunst, die das Leben nicht unnütz belasten wollte mit den Weltgewichten des Sterbens. Wenige Tage vorher ist sie in Monbijou, bespricht mit dem Gärtner Anordnungen, die sofort nach des Königs Tode ausgeführt werden sollen, kehrt heim, prüft in den eleganten Händen, die ihr wie allen Stuartfrauen auch jetzt in den Jahren zunehmender Leibesfülle geblieben sind, allerhand Geschmeide, blättert in alten Papieren, nimmt mit unbewegtem Gesichte die Nachrichten vom Krankenzimmer hin, schreibt tief in die Nacht hinein Briefe an den königlichen Bruder in England. Wer die einschlägigen Spielregeln des Rokokos kennt, wird sich der Tatsache erinnern, daß Konstanze nicht an Mozarts Grabe stand, daß Schiller ohne seine Damen ins Kassengewölbe geleitet wurde, daß noch 1816 Goethe, scheinbar sehr kühl, notiert: ›Heute Nacht wurde meine Frau aus dem Hause getragen …‹
Wobei ja wohl auch zu bemerken ist, daß diese Ehe allzuviel von ihren Kräften verzehrt hatte, daß sie, die Friedrich Wilhelms weithin tönende Gewitter durch so viel Jahrzehnte hatte toben hören, sich nach Ruhe und nach Erfüllung sehnen mochte und die Ernte ihres Lebens vorbereiten wollte. Offiziere, die bei dem aufgebahrten Leichnam wachen, sehen in der Nacht eine dichtverhüllte Frauengestalt erscheinen und mit murmelnd bewegten Lippen am Sarge stehen. Ob die nunmehr verwitwete Königin gebetet oder mit dem Toten allerletzte Zwiesprache gehalten hat, ist nicht zu entscheiden. Als sie beim Leichenbegängnis vor dem königlichen Sohn das Knie beugt und ihn mit ›Ew. Majestät‹ anredet, wird sie von Friedrich gebeten, in ihm nicht den König, sondern den Sohn zu sehen; als sie sich erhebt, weiß sie, daß sie, die Königin Mutter, trotz ihrer Witwenschaft und trotz der Existenz einer ›regierenden‹ und vom Sohne so unerbittlich ignorierten Königin an diesem Hofe die erste Rolle spielen wird. Im übrigen hält sie es mit ihrer Witwentrauer strenger als der übrige Hof und legt die schwarzen Gewänder erst im Januar 1741 ab, während Friedrich schon im August, zur Freude aller Berliner Antimilitaristen, den Grundstein zur neuen Oper legt, und am Vorabend des Schlesischen Krieges ein Maskenfest nach dem anderen feiert. Wobei ›Se. Majestät mit allen Masken ohne Unterschied des Ranges tanzt‹, und auf den Pharotischen wieder die Dukaten klirren, und, ›ohngeachtet der ernsten Zeiten die Konzerte, Komödien, Assemblern ihren Fortgang nehmen‹. Sie ihrerseits verläßt in der Trauerzeit ihre Gemächer kaum. Was sie in diesem Jahr beschäftigt, ist die Verwendung der reichen Mittel, die der Sohn ihr zum glanzvollen Ausbau Monbijous zur Verfügung gestellt hat. Der Sohn wußte, daß es der Mutter Bestimmung war, zu glänzen und zu strahlen, und sie sollte endlich, gehemmt in siebenundzwanzig schweren Ehejahren, nun so blühen, wie es ihr vorgezeichnet war.
Monbijou, das wurde nun, nach dem Ausbau des Schlosses, das Versailles von Berlin, das, was der Bürger dem Gastfreund bei Ausflügen zeigte als Prunkstück einer Stadt, die sozusagen das gleiche können wollte wie Wien und Paris. Zwei Flügel waren nun angebaut, an der Front nach der Oranienburger Straße ein Platz ›so rein, wie manche Stube nicht ist‹ … gewaltig groß nach damaligen Begriffen, groß genug für alle die zahlreichen Gefährte, die die Gäste all der Galaempfänge und Kammermusikabende brachten. Denn jetzt, als die Trauer abgelegt ist, reißen die Feste, die großen Cercles bei all den Siegen des Sohnes nicht ab … Monbijou birgt den repräsentativen Salon, in dem sich die Diplomaten, die durchreisenden Gäste von Rang und Ruhm treffen – den Ort, wo man den König, den die Welt nur als Schlachtenlenker zu kennen glaubt, als eleganten und geistvollen Sohn seiner majestätischen Mutter sehen kann …
Monbijou, heute angeräuchert vom Dunst trostloser Fabrikkamine, ertrinkend in der heillosen Sintflut trübseliger Mietkasernen, es war damals mit all seinen Feuerwerken, Gartenpartien, Wasserfahrten die farbenprächtige Bühne dieses Hofes. ›Auf beyden Seiten des Platzes steht in Lebensgröße ein Mohr‹, und in dem großen Orangensaal hinter dem prunkenden Haupteingang wurde gespielt, getanzt, musiziert und Friedrichs ›Scipio‹ zum Geburtstag der Königin Mutter uraufgeführt. Auf der anderen Seite, der Spree zugewendet, begann mit seiner ›süperben vue‹ jener berühmte Lustgarten, mit den ›raren Gewächsen in ihren porcelain-Topfen, mit den Blastiken der nacketen Personen, als nemlich zwei Mans- und zwei Weibspersonen, und sie sind mit ihren Musculn so natürlich dargestellt, daß man nichts auszusetzen hat. Sonderlich die Weibspersonen, eine hat eine Schlange an ihrer Brust und hat ihre Scham bedeckt, die andere hält zwar ihre Hand vor die Scham weit genug, allein so, daß man alles sehen kann. So sind auch einige nackete Knaben dort zu finden, weil sie aber keine Pfeile und Köcher haben, kann man sie für Cupidines nicht ausgeben‹.
Das hätte Friedrich Wilhelm sehen sollen … Friedrich Wilhelm, der schon im Aspekte seidener Weiberröcke auf der Straße mit dem Stock dreinfuhr! Aber Friedrich Wilhelm war fortgegangen … die Zeit von ›Willke und Fieke‹ war versunken, es lebte nun Sophie Dorothee, Königin Mutter, Mutter der Siege und Bewahrerin des Lorbeers. Eine Fontäne sprang in Monbijou, acht Pferde bewegten die dazu gehörige Wasserkunst, für die Friedrich einen französischen Ingenieur hatte kommen lassen. Zwischen diesen, die liebe Schaulust der Berliner arg in Anspruch nehmenden ›nacketen‹ Figuren gibt es ›kostbare orange Bäume und andere orangerieen, aus den Bäumen säuberlich zugeschnittene Hecken, Türme, Schnecken‹. Es gibt, wie in Schönbrunn, eine kleine Menagerie, es gibt, genau wie in Hellbrunn bei Salzburg, allerlei Grotten mit allerliebsten kleinen Wasserkünsten. Und vor allem: wir haben eine Vogelhecke mit ›Lachetauben‹, mit Sittichen und angeketteten Papageien. Alle Stuarts seit Maria haben diese Leidenschaft gehabt, Großmutter Sophie ist in einem Zimmer gestorben, in dem zwanzig Kanarienpaare ihre Triller und Kadenzen schlugen, Großmutter Sophie hat immer behauptet, daß diese Vogelhecke sie so lange am Leben erhalten habe. Kraft all des jungen Lebens, das so um sie herum sang und liebte und brütete und immer so etwas wie Frühling in die Zimmer der alte Dame trug …

Sophie Dorothee als Königin Mutter
So also ist damals Schloß Monbijou, hier reift dieses Leben, wie es gesäet war – ein großzügiges, stolzes und wahrhaft königliches Frauenleben. Man glaube ja nicht, daß es sich leicht lebte im Schatten dieser großen Frau – nie hatten diensttuende Kammerherren ein schwereres Dasein, nie standen märkische und pommersche Edelfräulein so vor der Aufgabe, ihr bisheriges buccolisches Leben auszustreichen und sich um die letzte, erlesenste Form zu bemühen, die es in dieser schon von leisen unterirdischen Stößen erzitternden Rokokowelt noch gab. Als ihr der junge, im Schicksalsjahr 1730 geborene Prinz Ferdinand (dessen Sohn Louis Ferdinand schon für Beethovens Eroika schwärmen und bei Saalfeld fallend sein Schicksal erfüllen wird) … item, als dieser ihr jüngster Sohn mit dem allzu unbeherrschten Getöse und Jubel des elfjährigen Knaben den Sieg meldet, den der große Bruder eben bei Mollwitz erfochten hat, da blitzt die Mutter ihn zornig an: ›Mon prince, mon prince!! …‹ sie hatte so viel Unbeherrschtheiten in ihrer Ehe gesehen, und nun, in ihrem Wittum, wollte sie Zucht, Maß, Form und königliche Würde. Niemand hat in Berlin, wo das Rokoko ja etwas derber, etwas klobiger, etwas arrivierter geraten war, die Lebensform der Zeit so meisterlich gehandhabt wie sie in diesen ihren letzten Lebensjahren. ›Klatscht sie‹, berichtet einer ihrer Tafelgäste, ›nach beendetem Mahl in die Hände, um den Lakaien das Zeichen zum Abräumen zu geben, so meint man, daß draußen die Sonne stille stehen müßte, und keiner wagt zu atmen, wenn sie also die Gespräche abschneidet und die Tafel aufhebt.‹ ›Olympia‹ hieß sie bei den jüngeren Herren des Hofes. Das Verhältnis zu ihrer Schwiegertochter Elisabeth Christine, die als Friedrichs des Großen Gattin ein wenig schemenhaft dasteht in der Reihe preußischer Königinnen – dieses Verhältnis blieb kühl, weil die Schwiegertochter zu Geschmacklosigkeiten ihres Anzuges und zu einem etwas verstörten, etwas krampfigen Wechsel zwischen übertriebener Bescheidenheit und exaltierter Anmaßung neigte: stets, wenn Sophie Dorothee in Charlottenburg oder Sanssouci den königlichen Sohn besuchte, wurde die Königin Mutter auftragsmäßig durch die jüngeren Prinzen vorsichtig sondiert, ob ihr die gleichzeitige Anwesenheit der regierenden Königin recht sei, und von ihren nach Oranienburg und Rheinsberg gehenden ›Lustreisen‹ hat sie die königliche Schwiegertochter, die auf eine entsprechende Aufforderung jedesmal wartete, stets ausgeschlossen: was sollte denn die elegante alte Dame auch mit der kleinen gekrönten Unbedeutendheit anfangen, die der verstorbene Friedrich Wilhelm kurz und bündig ›nicht schön, nicht häßlich, aber ein gottesfürchtiges Mensch‹ genannt hatte und die in die blitzenden Säle der Schwiegermutter immer etwas von der muffigen Luft ihres armseligen väterlichen Hofes brachte? Ueber Exaltiertheiten, wie sie etwa die Prinzessin Amalie sich leistete, konnte man achselzuckend hinwegsehen – Lächerlichkeiten übersah Sophie Dorothee auch dort nicht, wo sie sich nur andeuteten. Sie hatte ein Recht auf diese Unnahbarkeit und das, was Hochmut scheinen könnte: einfach deswegen, weil sie in ihrem wechselvollen Leben manchem Sterblichen wohl Anlaß zur Kritik und zum Widerspruch, nie aber Anlaß zu einem Lächeln gegeben hatte. Als bei einem ihrer Besuche in Charlottenburg in ihren Gemächern Feuer ausbricht und der Hof voller Geschrei, voller Panik ist und Prinzessinnen sich im Nachthemd flüchten, sieht man die Königin Mutter, wie sie sich, Kammerherr zur Rechten und Kammerherr zur Linken, in ihrer Sänfte mit unbewegtem Gesicht durch das Getümmel des Schloßhofes tragen läßt – ihre eigene grandiose Haltung zwischen den beiden in Unterkleidern und Nachtmützen marschierenden Kavalieren wirkt trotz der grotesken Situation monumental. Wie alle Stuarts, vergaß sie geleistete Dienste und erprobte Treue so wenig, wie sie je einem Sterblichen seine feindselige Haltung vergessen hat. Die Nachkommenschaft Grumbkows hat sie bis ans Ende ihrer Tage mit unverbrüchlichem Haß verfolgt. Als Leopold, der böse Geist ihrer so schweren Ehe, gestorben ist, zuckt sie verächtlich die Achseln: ›Ich fürchtete aufrichtig, er werde ewig leben‹. Pöllnitz hat es sich gefallen lassen müssen, daß sie seine Briefe, wenn sie sich über ihn geärgert hatte, uneröffnet zurückschickte. Im übrigen hat der königliche Sohn der Mutter nicht ganz selten und wahrscheinlich lächelnd Spielschulden bezahlt. Wie sollte auch eine Tochter jenes glanzvollen Geschlechtes vom Spiel lassen, da das Spiel, das am Pharotisch und das auf dem Blachfelde, samt dem steten ›Leben in Gefahr‹ unzertrennlich zu den Stuarts gehört hat?
Ganz bewußt sah sie ihres Lebens Erfüllung, die Abgeltung für alle die Bitternisse ihrer Ehe in dem Adlerflug des großen Sohnes. Sie, der es vergönnt war, nur seine Siege zu erleben, hat jeden von ihnen in ihrer geheimnisvollen Weise gefeiert. Des Sohnes Ruhm widerstrahlend – just so, wie Friedrich, der ewig Gehetzte und früh Gebrochene, wollte, daß seine Mutter ihn feierte. Kraft der fremden Blutsaat, die mit ihr gekommen war, hörten die Hohenzollern auf, ein in Derbheit ungebrochenes Geschlecht zu sein. Aber sie hätten ohne sie den Großen, den Leuchtenden nie hervorgebracht. Was mitternächtig ist an Friedrich, kommt von ihr und den hunderttausend Lastern und Sünden ihrer Ahnen. Aber es kommt von ihr auch das andere: das Bestehen der großen Nervenprobe zwischen der Kapitulation von Breslau und der Leuthener Schlacht, die Kraft, ein schon demoralisiertes Heer zum letzten und gewaltigsten Triumph über die Masse emporzureißen, das Sich-Bewähren in der tiefsten Nacht der absoluten Hoffnungslosigkeit: es kommt von ihr oder doch von dem Zusammenprall ihres wilden und feurigen Blutes mit dem schwerflüssigen des Schwabengeschlechtes der Zollern. Denn just dort, wo zwei so verschieden temperierte Blutströme sich mischen – gerade dort lodern sie gern auf, die Flammengarben des Genius und die düsteren der menschenbeugenden Tragik.
Manche ihrer späten Aeußerungen lassen darauf schließen, daß sie das Zerbrechen des Rokokos, den großen Aufbruch aus den Schlössern aus weiter Ferne geahnt hat – sie hat angedeutet und im übrigen geschwiegen, wie der Schicksalsbewußte über seine Visionen immer schweigt. Was war denn auch das Leben? Das Leben hieß, ahnungsvoll und mit der Hellsichtigkeit des Weibes einem Geschlecht den künftigen Monomachos, den Genius tragen und gebären und behüten. Wer dies kann, ist nicht so töricht, an die Beständigkeit von menschlichen Institutionen zu glauben.
Sie hat nur des Sohnes Siege gesehen – der freundlich strahlende Stern, der über ihren späteren Jahren scheint, hat es ihr erspart, den Hiobsboten von Kolin zu empfangen oder gar die noch furchtbarere Stunde von Kunersdorf zu erleben. Sie ist leicht gestorben, wie Menschen ihres Schlages immer leicht sterben, an ihrem Sarge ist von den siebenzig Jahren die Rede gewesen, die der Mensch erfüllt mit seinem Leben, und daß es köstlich gewesen ist, wenn es voll Mühe war und voll Arbeit. Ich weiß nicht, ob es in der Bibel für die stolze, die Ungebeugte und Unbeugbare nicht noch treffendere Verse gegeben hätte …
Ehe sie stirbt, sehen die Wachen, wie einst zu ihres königlichen Schwiegervaters Zeiten, auf den Gängen des Berliner Schlosses das Phantom einer verhüllten Frauengestalt auf weißem Roß, und das weiße Roß, das bedeutet den Welfentod …
Als man sie in den Dom trägt, begibt es sich, daß Scharen von Amseln hier, wo man eine gekrönte Vogelhegerin zu Grabe trägt, herbeiflattern und mit einem geradezu unbesieglichen Gesang die Zeremonien unterbrechen.
Ich weiß nicht, wieviel das aufgeklärten Besserwissern unserer Tage noch besagt. Ich aber für mein Teil weiß, daß die stumme Kreatur ihre Beschützer kennt und unter den Menschen von den Zwiespältigen immer die Unbrechbaren unterscheidet und immer jubelt, wenn von Adams Brut eines sich ein Stück ahnungsvoller Paradieshaftigkeit hinüberrettete in das ächzende Wissen und Wollen der Menschen.