
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bis in die spätesten Abendstunden pilgerten die Bewohner Münchens in Scharen zur königlichen Residenz an der Ludwigstraße. Alle wollten Neues erfahren. War doch der König, der bayerische König Max II. schwer erkrankt und sollte im Sterben liegen: Maximilian II., der Sohn Ludwigs des Ersten, der zwar abgedankt hatte, aber immer noch unter den Lebenden weilte und seiner sorglosen alten Tage sich freute. Seiner Regierungssorgen war er am 20. März 1848 ledig geworden.
Die zur königlichen Residenz pilgernden Münchner sprachen über ihre Könige, aber nur im Tone hoher Anerkennung und Zuneigung. Man bedauerte den armen Max; man kannte die Ursache seiner letzten schweren Erkrankung, denn diese war ein Verhängnis. Auf einer Ungarnreise, während seiner Kronprinzenzeit 1835 fiel ihn der Typhus an, der eine schwere Störung des Nervensystems zurückließ. Diese wurde dann Ursache eines peinvollen Kopfleidens, gegen das immer nur die reine Alpenluft helfen wollte.
Um in den Bergen wohnen zu können, hatte König Max das alte Schloß Hohenschwangau bei Füssen erworben und ausbauen lassen. Viele Münchner Künstler, auch Moritz von Schwind, der Maler, waren an dem Umbau beteiligt.
Nach dem Friedensschluß von Villafranca zwischen dem neuerstandenen Italien und dem unterlegenen Habsburger Hause, welches (außer Venedig) seinen ganzen oberitalienischen Besitz hatte abtreten müssen, liebte König Max diese Italiener nicht mehr, weil er zu Österreich hielt. Im Jahre 1863 sollte er auf Anraten der Ärzte die milde Luft Italiens aufsuchen und das deutsche Schlechtwetterland meiden. In seiner Abneigung gegen das neue Italien reiste er diesseits der Alpen nach Frankreich und von dort nach Marseille, wo er ein Schiff bestieg, um direkt nach Mittelitalien zu gelangen: nach dem immer noch päpstlichen Rom. Hier, in der Villa Malta, ging König Max langsam seiner Genesung entgegen.
Zu gleicher Zeit wurde die schleswig-holsteinische Frage brennend. Auch in Bayern sorgte man sich um das Schicksal der deutschen Nordmark. Einige Mitglieder des bayerischen Staatsrates reisten nach Rom, um den König zu bitten, mit Rücksicht auf die gefahrenvollen Zeitverhältnisse doch lieber nach Hause zu kommen, nach München. Der König antwortete: »Eingedenk meiner Regentenpflichten kehre ich ungesäumt in meine treue Hauptstadt zurück, obwohl meine Gesundheit das Gegenteil wünschenswert macht.« Am 15. Dezember war König Max wieder in München.
Politisch stand er auf seiten des Augustenburgers, dessen Erbansprüche auf Schleswig-Holstein er als zu Recht bestehend empfand. Gewiß, ein neuer deutscher Kleinstaat würde entstehen. War das aber nicht besser, als daß wieder Tausende bluten mußten, nur, damit die Dichter wieder singen konnten: »Ach, grünen werden die vordem mageren Getreidefelder, getränkt mit dem Blute aus menschlichen Adern –«
Inzwischen hatten aber Preußen und Österreicher sich auf eigene Faust für einen Waffengang mit den habgierigen Dänen entschieden. Mit siegreichem Ungestüm drangen die verbündeten Truppen vor, und König Max fühlte sich machtlos und unglücklich. Vielleicht wußte er sogar, daß es Herr Otto von Bismarck-Schönhausen war, der den Kampf bevorzugte, Deutschland zuliebe.
Bei diesen seelischen Beschwernissen wurde der Gesundheitszustand des Königs nicht besser. Anfang März zeigten sich auf der linken Brustseite Rotlauferscheinungen. Am 7. März machte König Max seinen letzten Spaziergang im Englischen Garten. Schon am Abend hatte der Rotlauf sich über die ganze Brust ausgebreitet. Am 9. März, gegen Abend, gaben ihn die Ärzte verloren. Die Nachricht hiervon erfüllte die Stadt mit Entsetzen und Jammer. Während der ganzen Nacht knieten Hunderte von Münchnern im Schloßhofe der Residenz, in stillem Gebete.
Gegen sechs Uhr morgens machte man den König, der noch nicht viel über fünfzig Jahre alt war, auf sein bevorstehendes Ende aufmerksam. Er empfing die Sterbesakramente und sprach dann lange unter vier Augen mit seinem ältesten Sohne Ludwig, dem Kronprinzen, der noch keine neunzehn Jahre alt war. Otto, der zweite Sohn, war drei Jahre jünger, König Max segnete dann Gattin und Söhne und zeigte die sanft überlegene Würde eines Weisen, der zu entsagen versteht, als sein Auge brach. Kurz vor der Mittagsstunde des 10. März war alles vorüber. Das dröhnende Trauergeläut der klagenden Münchner Sankt Bennoglocke überflutete Häuser und Straßen.
Die Karwoche des Jahres 1864 hatte begonnen.
*
Immer noch zogen Bürger und Bürgerinnen jedes Alters über Straßen und Plätze. Viele hatten ehrlich klagende Augen – man hatte den König geliebt.
Was sollte nun werden? Würde alles so weitergehen, wie bisher? Wie würde der kommende König sein, der noch im Jünglingsalter stehende Ludwig? Ein Neunzehnjähriger übernahm es, über das Wohl eines großen Landes, wie Bayern zu wachen. Gewiß, seine bewährten Kabinettsräte und Minister schafften für ihn, die der hingegangene König Max noch ausgewählt hatte. Das war auch gut so, denn die Mutter des neuen Königs, Marie, war eine stille harmlose Frau, auch keine Bayerin von Geburt. Sie war eine Tochter des Prinzen Wilhelm, des Bruders Friedrich Wilhelms III. von Preußen. Im Jahre 1842 war die Ehe geschlossen worden, drei Jahre später wurde ihr ältester Sohn Ludwig geboren, der Kronprinz.
Man wußte nicht viel von diesem, da die breite Öffentlichkeit ihn nur selten erblickte. Seine Knabenjahre hatte er unter strenger Aufsicht seiner Erzieher verbracht. Einsam und abgeschlossen war er erzogen worden.
Heute hing sein Bild in allen Schaufenstern der Hauptstraßen Münchens. Die Leute blieben neugierig stehen: das also war der junge, der neue König? Sehr schlank und gutgewachsen war er, sein Gesicht war edel geformt, schwärmerisch blickten die großen Augen unter dem vollen Haupthaar.
Auch ein kleinerer Mann in den Fünfzigern stand vor einem der Fenster und studierte das Bild. Trübe Gedanken mochten ihn quälen, er schien eigene Sorgen zu haben: blaß, faltig und hager war sein Gesicht. Das Bild dieses jungen Königs sagte ihm nichts. Im Weiterschreiten ging es ihm durch den Sinn: Auch dir, junger König, wird das Leben nicht nur Freude gewähren. Auch die Könige müssen leiden, nicht nur armselige Künstler und Musiker. Auch ich hatte deine jungen Augen in deinen Jahren; dann kamen die schlimmen anderen und verdarben alles fröhliche Fühlen.
Der langsam weiter Schreitende war der sächsische Kapellmeister Richard Wagner, der in München nur zu kurzer Erholung weilte, denn er befand sich auf der Reise von Wien nach der Schweiz.
Reise? Nein, eine richtige Flucht war es, die ihn aus dem schon grünenden Penzing bei Wien bis nach München getrieben hatte.
Richard Wagner kam sich schon immer vor wie ein vom Zorne der Götter Verfolgter. Diese gönnten ihm keine längere Rast, von Ort zu Ort trieben sie ihn, nie gelangte er zu einem geruhigen Schaffen am eigenen Herde.
»Du selbst trägst die Schuld«, riefen die zürnenden Götter mit höhnischen Mienen, »du weißt dich nirgends zu halten. Immer neue Fehler begehst du und verdirbst es mit Freunden und Mächtigen, die dir die Wege ebneten. Keiner kann dich auf die Dauer ertragen. Das Schicksal ist gegen dich; dir ist gar nicht zu helfen!«
Wagner wollte in seinen Gasthof in der Nähe des Bahnhofs zurück, in dem er wohnte, bescheiden und kümmerlich. Sein Geldvorrat war sehr schmal, und Reisen kostete Geld. Seine Wiener Freunde hatten eine kleine Summe zusammengebracht, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Richtig gesammelt hatte man für ihn, den schon älteren: der Hofarzt Standhartner, der Landgerichtsrat Eduard von Liszt, ein Vetter des weltberühmten Komponisten Franz Liszt, und der ärmliche Musiker Peter Cornelius, die den genialen Richard Wagner bewunderten.
In seinem Gasthofe nahm Wagner irgendwo zwischen den Gästen Platz, um sein bescheidenes Mahl zu verzehren und einen Bierkrug zu leeren. Tabaksqualm erfüllte das schmale lange Gastzimmer im Erdgeschoß; alle Tische waren besetzt, kaum fand er Platz. Handwerker, Geschäftsreisende und andere einfache Bürger saßen um ihn herum und redeten eifrig.
Und immer das gleiche.
Wagner verstand nicht immer, was diese Münchner erzählten, er, der nie in Oberbayern gelebt hatte.
Aber auch andere Norddeutsche saßen an seinem Tische. Auch sie – es schienen junge Künstler zu sein – sprachen von den Dingen des Tages.
»Der junge König?« sagte der eine. »Warten wir ab! Seinem Großvater wird er kaum ähneln. Ob er ein Herz für die Künstler hat, muß sich erst zeigen. Auf Jahre hinaus wird er anderes zu tun haben, als an die Künste zu denken. Heute steht die große Politik obenan.«
»Und Österreich?« meinte ein anderer. »Vor kurzem war Erzherzog Albrecht in München. Man sagt, er wollte Bayern zu einem Bündnis bewegen. Und abwendig machen vom Deutschen Bunde.«
Einer der jungen Leute stutzte: »Ich höre blasen«, rief er, »da draußen scheinen Reiter zu traben. Kommt einer mit?«
Auch die anderen erhoben sich und schritten zur Tür. Draußen auf der Straße marschierte viel Volk. Trompetenfanfaren übertönten den Lärm der Stimmen und Schritte.
Auch Richard Wagner verließ seinen Platz und strebte neugierig den anderen nach. Vom Himmel kam dichtes Schneegestöber herab. Aber da kamen sie schon: ein ganzer Trupp als Herolde kostümierte Männer zu Pferde. Den Zug eröffneten in mittelalterlicher Gewandung Hofpauker und Hoftrompeter. Inmitten der Herolde ritt der Rufer und verkündete mit lauter Stimme aus einer mächtigen Pergamentrolle den Regierungsantritt des neuen Königs.
Trotz Wind und Schneegestöber folgte dem Zuge eine unübersehbare Volksmasse: halb München schien auf den Beinen zu sein.
Einige neben Wagner auf der Straße Plaudernde sprachen von den letzten Stunden des verstorbenen Königs.
»Und der junge Ludwig?« fragte der eine.
»Der Kronprinz soll entsetzt zusammengefahren sein, als nach dem Ableben des Königs einer der Räte ihn zum ersten Male mit ›Majestät‹ anredete. Er wurde fast ohnmächtig und mußte vom Sterbelager hinweggeführt werden.«
»Der Ärmste!« bedauerte ein älterer Herr. »Er wird es schwer haben. Bald wird er sich entscheiden müssen: für Österreich oder für Preußen. Ich glaube kaum, daß er diese schwierige Lage schon überschaut. Er wird seinen Räten glauben müssen, und das ist schlimm für ihn.«
Die Herren sprachen noch weiter. Richard Wagner eilte wieder ins Gastzimmer: der Aufenthalt auf der Straße war ungemütlich. Immer noch sprühte der Schnee, zuweilen blies auch ein kräftiger Ostwind die Straße herunter. Nur aus weiter Ferne erklangen noch Paukenwirbel und Trompetengeschmetter.
Bald wies der große runde Biertisch im Inneren keine Lücke mehr auf. Die jungen Künstler redeten weiter vom jungen König. Wagner wußte nicht viel von diesem, man sprach nicht von ihm. Am öffentlichen Leben hatte er noch nicht teilgenommen. Man wußte nur, daß er viel las und oft ins Theater ging.
»Das ist schön und gut«, sagte einer der jungen Leute, »ist er nicht auch Soldat?«
»Soldat?« lachte ein anderer. »Nicht im geringsten. Er reitet nur gern und ausdauernd, das ist alles. Soll er eine Uniform anlegen, ist er unglücklich. Alles Kriegerische ist ihm zuwider; er wird ein Friedensfürst sein. Wer ihn zu einem kriegerischen Bündnisse überreden will, wird es schwer haben.«
Richard Wagner interessierte das alles nicht sehr. Dieser junge König tat ihm ein wenig leid. Wie hatte der so verrufene, wenn auch selten richtig verstandene Macchiavelli, der kluge Staatsmann der Renaissance, einmal gesagt? »Ein Fürst, der den Krieg verabscheut, ist auf dem besten Wege, seiner Herrschaft verlustig zu gehen?« Bayern würde zwar niemals in die Lage kommen, selbständig Krieg führen zu müssen. Das Kriegführen in oder um Deutschland war wohl Sache der weniger umständlichen Norddeutschen, der Leute also, die Wagner kannte. Krieg führen, das konnten sie, diese Preußen, nur in Sachen der Kunst blieben sie hoffnungslos rückständig und kamen nicht vorwärts. Vor allem in Berlin blieb alles muffig und langweilig. Wagner wußte Bescheid auf Grund eigener Erfahrungen. Auch sein lieber Freund Hans von Bülow klagte darüber, der Gatte der Tochter Franz Liszts, der in Berlin Konzerte veranstaltete, aber auch unterrichtete.
Wagner verließ den Gastraum und suchte sein Zimmer auf. Er wollte noch Briefe schreiben und seinen Wiener Freunden seine glückliche Ankunft in München melden. Heute abend schon wollte er weiterfahren, über Augsburg nach Lindau am Bodensee, um von dort nach der Schweiz zu entkommen, ehe die Häscher ihn packten, um ihn in Schuldhaft zu führen.
Immer wieder dachte Wagner an das bayrische Königshaus und an den verstorbenen König Max, den seine Untertanen geliebt hatten. Aber auch alle Gelehrten und Schriftsteller; weil er ein offenes Herz hatte und eine freigebige Hand für diese schon berufsmäßig Not leidende Kaste von Menschen, die zwar immer neue geistige Werte schufen und die Kultur förderten, aber nicht immer wußten, wovon sie essen und wohnen sollten. König Max hatte auch nicht einseitig nur an seine Landeskinder gedacht. Geisteshelden aus aller Welt berief er nach München, vor allem Norddeutsche. So auch Franz Dingelstedt für das Schauspiel am Hoftheater, dann die Dichter Franz Bodenstedt und Emanuel Geibel.
Sein Vater, Ludwig I., hatte es mehr mit den bildenden Künsten gehalten; er berief Bildhauer und Maler nach München und gab ihnen Arbeit.
Ludwig I. war der Begründer Münchens als Kunststadt gewesen. Bei seinem Regierungsantritt hatte er diesen Plan gefaßt und geäußert:
»Unsere Stadt München muß zu einer Zierde von Deutschland werden. Wer Deutschland kennen will, wird auch in München gewesen sein müssen.«
Freilich: viele hielten das München Ludwigs I. mehr für ein Museum für die verschiedenen Baustile vergangener Jahrhunderte, weil man alles durcheinander gebaut hatte: Nachbildungen griechischer Tempel, römischer Siegesbogen, christliche Basiliken und Renaissancebauten. Denn auch München hatte eine systematische Entwicklung ebensowenig aufzuweisen wie die gesamte deutsche Kunst überhaupt. Alles stand da: vereinzelt, explosiv-unvermittelt, häufig aus fremdländischen Einflüssen abgeleitet, was unausbleiblich war, da eigene Vorbilder fehlten.
Trotzdem trieb Ludwig I. keine Verschwendung; er blieb der sparsame Hausvater und sorgte auch in der Verwaltung dafür, daß die vorherige geldliche Mißwirtschaft nach den Freiheitskriegen wieder beseitigt wurde.
Nur das bayrische Heerwesen kam ein wenig zu kurz. Kriegerische Blutarbeit war auch diesem kunstsinnigen Regenten zuwider. Von seinen Söhnen erhielt nur der eine, Prinz Luitpold, eine gründliche militärische Erziehung. Seit den Freiheitskriegen gab es auch eine Wehrpflicht in Bayern. Kriegstauglichkeit galt aber bei den Menschen der Biedermeierepoche als Unglück. Viele Jünglinge mit sehr guten Augen trugen mit Vorliebe Brillen, um nicht dienen zu müssen.
Auch unter Max II., Ludwigs Sohn, blieb alles wie vorher. Krieg war auch diesem verhaßt, wie auch allen anderen Menschen nach der Napoleonzeit.
König Max liebte die Wissenschaften ebenso wie die Dichtkunst. Er berief außer seinen Dichtern auch berühmte Forscher nach München, wie Justus von Liebig. Er wünschte einmal:
»Möchte es mir doch gelingen, wahre und echte Wissenschaft hier in München so heimisch zu machen, wie die Kunst in Baudenkmälern, die keiner forttragen kann.«
König Max gelang es auch, den Grafen Friedrich von Schack, einen geborenen Mecklenburger, an München zu fesseln, der später die berühmte Galerie in der Briennerstraße gründete. Aus eigenen Mitteln gründete, denn er war reich und unabhängig. Gegen Lebensende des Königs wurde die Heranziehung dieses norddeutschen Grafen immer häufiger. Oft mehrmals wöchentlich verlangte es den König nach Unterhaltung über Kunst, Poesie und Wissenschaft.
Manche Kreise verübelten dem König diese Vorliebe für die Norddeutschen, oder »Nordlichtln«, wie die Münchner sagten. Das Einheimische schien ihm nicht viel zu gelten; eine Behauptung, die aber ungerecht war.
Richard Wagner hatte immer ein größeres Interesse des Königs für die Musik vermißt.
Berühmtere Musiker hatten hier niemals gelebt in den letzten Jahrzehnten, wie etwa in Wien oder Leipzig. Die beiden älteren Opern Wagners, den »Tannhäuser« und den »Lohengrin« gab man hier schlecht und recht im Repertoire. Nur den »Holländer« hatte man abgelehnt, der großen Unkosten wegen, welche dieses »Seestück« verursachen würde – diese Oper sei überhaupt nichts für Deutschland!
Der Münchner Opernbetrieb besaß demnach keinerlei Reize für Richard Wagner, dessen Gedanken dann wieder zu den eigenen Sorgen hinüberglitten.
Der bayrische König, noch jung an Jahren, war tot. Auch ihm selbst, Wagner, würde wohl bald ein ebenfalls vorzeitiges Ende beschieden sein. Eigentlich gab es gar keinen Platz mehr für ihn auf der Welt, nachdem alle herrlichen Blütenträume seiner Jugend verdorrt und vergangen waren.
Und Wagner ergriff die Gänsefeder und entwarf in galgenhumoriger Laune eine Art Grabschrift für sich; sie lautete:
»Hier liegt Wagner, der nichts geworden,
Nicht einmal Ritter vom lumpigsten Orden;
Nicht einen Hund hinterm Ofen entlockt er,
Universitäten nicht mal 'nen Doktor –«
Ob es noch einmal anders wurde mit ihm, nach all den Fehlschlägen in seinem Leben? Oder würde er, völlig zermürbt, die Hände sinken und alles über sich ergehen lassen müssen, vielleicht noch ein paar letzte Wochen von irgendeinem Almosen leben, bis alles zu Ende war. Er, der die Fünfzig überschritten hatte, konnte nichts Neues mehr anfangen, um sein gesichertes Brot zu finden. Kapellmeister war er schon früher gewesen, in Magdeburg, Königsberg, Riga; dann auch in Dresden. Aber bald war alles verschüttet; das böse Jahr 1849 hatte ihn aus Dresden vertrieben, wo seine ersten Opern das Licht der Rampe erblickten: »Rienzi«, »Lohengrin«, »Tannhäuser« und »Fliegender Holländer«, nachdem er in dem großen Paris furchtbare Hungerjahre erlebt hatte.
Er floh nach der Schweiz, nach Zürich, wo er eine herrliche Zeit verlebte, geführt und getröstet von der Zuneigung einer schönen, jungen und geistvollen Frau, seiner Mathilde Wesendonck. Hier in Zürich waren der »Tristan« entstanden und zwei Werke seines mächtigen Nibelungendramas: »Walküre« und »Rheingold«. Der »Siegfried« wurde begonnen.
Aber seine eigene Frau Minna zerstörte in ihrer Eifersucht auf Frau Mathilde Wesendonck ein für allemal seinen holden Wahn, schon in Zürich Frieden für immer gefunden zu haben. Aus Rücksicht für den häuslichen Frieden der Familie Wesendonck räumte Wagner das ihm gewährte Asyl und begab sich nach Venedig, wo er am »Tristan« arbeitete.
Immer wieder schwebte ihm vor, in Paris festen Fuß zu fassen. Dort regierte jetzt der zweite Napoleonkaiser und neues, frisches Leben schien dort zu keimen. Das konnte man ausnützen. Der Kaiser konnte jedoch nicht verhindern, daß seine eigenen und Wagners Gegner – und wo gab es die nicht? – seinen der »Großen Oper« übergebenen »Tannhäuser« durchfallen ließen, mit Krach und Posaunen. Wiederum hieß es zum Wanderstabe greifen.
Diesmal wollte er es mit Wien versuchen, mit der kunstverbundenen ehrwürdigen Kaiserstadt an der Donau. Ein Erfolg in dieser mußte ihm den Weg zu allen Bühnen Europas öffnen. Es wurde aber nichts mit dem Erfolge. Sänger und Sängerinnen erkrankten; ihre Stimmen waren den hohen Anforderungen der Oper »Tristan« nicht im geringsten gewachsen, und der »Tristan« wurde an der Wiener Hofoper vom Spielplan abgesetzt.
Ein wenig Trost brachten eine Reihe Konzerte, die Wagner in Moskau und Petersburg abhalten durfte. Sie brachten auch schönes Geld. Alle deutschen Musiker erlebten im kaiserlichen Rußland immer nur Angenehmes. Auch der junge Johann Strauß erschien jeden Sommer schon seit zehn Jahren in Petersburg und erntete reichlich an Ruhm und Gold.
Dieser plötzliche Geldzufluß machte Wagner ein wenig übermütig. Mit vollen Taschen kam er zurück nach Wien. Er wollte sich seßhaft machen und mietete ein geräumiges villenartiges Landhaus im idyllischen Penzing bei Wien. Diese Villa mußte er erst möblieren. Er kaufte und kaufte, und nicht nur das mitgebrachte russische Geld entschwand seinen Händen. Es entstanden auch hohe Schulden. Die Lieferanten nahmen den armen Wagner ordentlich »hoch«, und bald sollten Wechsel eingelöst werden. Leider gingen sie zu Protest. Bald drohte die Schuldhaft, die es damals – im ganzen deutschen Bundesgebiet – noch gab. Es blieb Wagner nichts anderes übrig, als Flucht, die allerdings strafbar war. Die Wiener konnten Wagner in ganz Deutschland verhaften lassen, sobald sie seinen Aufenthalt kannten.
Wagner mußte also auch aus München bald wieder verschwinden.
Das wollte er auch. Noch heute abend sollte die Flucht fortgesetzt werden: zunächst nach der Schweiz, wo er noch treue Freunde besaß. Nicht nur die Wesendoncks in Zürich, auch andere Menschen, die hilfsbereit waren. So z. B. die Familie Wille in Mariafeld in der Nähe von Zürich. Nur mit diesem nächsten Ziele beschäftigte Wagner sich noch in seinen Gedanken.
Am Abend verließ er München mit dem Augsburger Zuge.
Vorsichtig hatte er Bahnsteig und Reisende gemustert, geprüft. Auch hier konnten schon Häscher erscheinen, um ihn dingfest zu machen wegen gebrochenen Wechselarrests. Außer der Schuldhaft gab es dann noch eine Gefängnisstrafe. Wagner entdeckte aber keinen Verdächtigen, der wie ein Häscher aussah.
*
Die Bestattungsfeier des Königs Max am 14. März währte drei volle Stunden. Gegen 18 000 Mann Militär und Bürgerwehr waren daran beteiligt, auch das gesamte Beamtenpersonal, die Professoren aller hohen und mittleren Schulen und alle Dienerschaften der Familien des königlichen Hauses. An diese vielen schloß die Bevölkerung sich an.
Hinter dem Sarge schritten der Münchner Erzbischof und die beiden Söhne des Toten, Prinz Otto und Kronprinz Ludwig. Der neue, junge, erst neunzehnjährige König war bleich. Sein kummervoller Blick erregte das Mitleid aller und gewann ihm die Herzen. Blassen Gesichts und gebeugten Hauptes schritt Ludwig in der Oberstenuniform seines Leibregiments, aber mit unsicheren, stockenden Schritten, hinter dem Sarge des Vaters her. Er war hoch gewachsen; seine gute Figur sah in der Uniform stattlich aus. Alle jungen Frauen und Mädchen dachten oder sagten:
»Wie hübsch er ist –«
Schon am Tage nach der Beerdigung begannen die Beratungen Ludwigs mit seinen Kabinettsräten und den Ministern. Die Zwangsläufigkeit aller Ereignisse duldete keinen Aufschub der Regierungsentschließungen. Noch mehr: zahllose Neugierige suchten um Audienzen nach, um sich in Erinnerung zu bringen. Zuerst kamen alle diejenigen, die der freigebige verstorbene König beschützt hatte, indem er ihnen gnädige Zuwendungen machte, wobei es ungewiß war, ob der Sohn sie fortsetzen würde.
Diese Zuwendungen erfolgten nicht etwa von Staats wegen, sondern aus der königlichen Privatkasse. Ungezählte Leute lebten aus dieser. Der bayrische König verfügte freilich auch über einige Millionen im Jahre.
Auch der junge Stipendiat und Musiker Julius Hey gehörte dazu, der in Hofkreisen Musikunterricht erteilte. Auch die junge Sophie, die Tochter des Herzogs Maximilian in Bayern, erhielt Gesangsunterricht von ihm, und ihr Bruder Klavierunterricht. Elisabeth, die Schwester beider, hatte den jungen Kaiser Franz Joseph von Österreich geheiratet.
Auch Julius Hey hatte ein Anliegen an König Ludwig: er wollte ihm eine neue Komposition zueignen. Die hierfür erforderliche Audienz besorgte Prinzessin Sophie für ihren erfreuten Lehrer. Dennoch mußte er tagelang warten.
Die hohe Politik ging vor. Fortwährend hatten die königlichen Räte Vortrag bei Ludwig. Oft mit erregten Mienen. Immer wieder drehte es sich um die schleswig-holsteinische Frage.
Und der junge König Ludwig erlebte seine erste große Enttäuschung.
Sein Vater, König Max, hatte beim Frankfurter Bundesrat für den Augustenburger plädiert, was seinem Gesandten, einem Herrn von der Pfordten aber wenig genützt hatte. Dieser fand wenig Gegenliebe; schon überschwemmten Preußen und Österreicher das umstrittene Gebiet zwischen Nordsee und Ostsee, also die deutsche Nordmark, die durchaus nicht willens war, dänisch zu werden.
Der Prinz von Augustenburg hatte Ansprüche auf Schleswig und Holstein, also mußten diese befriedigt werden. So dachte der neunzehnjährige bayerische Ludwig. So aber dachten die Preußen nicht. Bismarck wollte die beiden Ländchen an Preußen angliedern, damit sie ein für allemal Deutschland verbunden blieben. Die Österreicher taten nur mit, um dabei zu sein und Preußen auch da oben nicht die Vorhand zu lassen.
Das Ganze erzeugte in dem jungen bayrischen König einen richtigen Abscheu vor allen politischen Dingen. Er war kein Soldat. Aus dem Studium der Geschichte wußte er, daß noch lange nicht immer das verbriefte und logische Recht zum Siege gelangte. Nur mit den stärkeren Bataillonen hielten die Götter Freundschaft. War das nicht unsittlich, unchristlich, jammervoll?
Also Schluß mit dem Denken an diese unerfreulichen Dinge! Bayern war da oben im Norden nicht im geringsten beteiligt, das war ein Glück! Ludwig hatte wichtigere Pläne, die er verwirklichen wollte, jetzt, wo er zu sagen hatte und über unermeßliche Geldmengen verfügte. Er wollte seinen geliebten Vater nachahmen und als Förderer der Wissenschaften und der Künste sich nützlich machen. Was Vater und Großvater begonnen hatten, wollte er fortsetzen. Nicht nur Anfängern wollte er Stipendien zuweisen. Es drängte ihn vor allem, bewährte Könner, echte, erwiesene Künstler in seine Umgebung zu ziehen, damit der junge Ruf der Kunststadt München nicht wieder vergehe.
Schon wenige Tage nach seinem Regierungsantritt berief Ludwig den Kabinettsrat von Pfistermeister zu einer Besprechung. Er sagte:
»Ich möchte Sie bitten, eine Reise für mich zu machen. Kennen Sie den Musiker, Komponisten und Dichter Richard Wagner? Wissen Sie, wo er jetzt lebt?«
Herr von Pfistermeister war unmusikalisch: von diesem Richard Wagner hatte er gehört oder gelesen: es war nichts Bedeutsames gewesen. Er gestand seine Unkenntnis.
»Ich möchte ihn kennenlernen«, fuhr Ludwig nachdrücklich fort, »er ist ein bedeutender Künstler und ein sehr kluger Kopf. Ich las auch Bücher von ihm, die von Musik handeln, von Oper und Drama, also auch von der Dichtung. In unserer Hofoper sah ich den ›Lohengrin‹ und den ›Tannhäuser‹. Beides sind göttliche Werke. Man kann sie nicht oft genug anhören.«
»Ist Richard Wagner nicht der Mann mit der ›Zukunftsmusik‹?«
Ludwig lächelte: »Wenn die deutsche Musik der Zukunft immer mit den Herrlichkeiten einer Wagnerschen Melodik aufwarten kann, darf man auf diese Zukunft sich freuen.«
Herrn von Pfistermeister interessierte das nicht. Seine Bürokratenseele wanderte über den Horizont seiner Beamtenpflichten nicht gerne hinaus. Er sah nur, daß sein junger Monarch strahlende frohe Augen hatte, seitdem er von Wagner sprach. Also handelte es sich um eine erste königliche Marotte, die man bei diesem jungen Manne entdeckte. Dieser Marotte würde er treu bleiben wie sein Vater den seinigen; man mußte das vormerken. Also war jetzt die Musik an der Reihe. Der Großvater hielt es mit Malern und Bildhauern, der Vater mit Dichtern und mit Gelehrten, der Enkel Ludwig liebte die Musiker. Diese konnten sich also freuen.
»Suchen Sie also, Herr von Pfistermeister«, ordnete Ludwig an, »geben Sie nicht eher Ruhe, bis Sie Herrn Wagner gefunden haben und bringen Sie ihn hierher nach München. Wir wollen alle seine Opern hier aufführen und den guten Ruf Münchens als moderne Musikstadt noch weiter ausbauen. Sollten Sie den verehrungswürdigen Künstler und Meister nicht zur sofortigen Abreise bewegen können, so bringen Sie mir wenigstens einen Bleistift von ihm oder auch nur eine Schreibfeder, die er benützt hat, ich will Ihnen dankbar sein, lieber Pfistermeister.«
Der Kabinettsrat war sehr erstaunt. So groß war die Zuneigung des Königs zu diesem Herrn Wagner, daß ihn schon ein Stück Bleistift oder eine Gänsefeder aus seinem Besitz glücklich machte? Das war völlig unbegreiflich für das künstlerisch nur wenig entwickelte Empfinden dieses königlich bayrischen Kabinettsrates.
»Sie werden ihm auch etwas aushändigen«, fuhr Ludwig fort, »diesen Brief, einen Rubinring von meiner Hand und mein Bildnis. Alles befindet sich in diesem Umschlage. Da nehmen Sie. Was Herr Wagner zu wissen braucht, ist in dem Briefe enthalten. Sie haben also nur wenige Worte zu sagen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen, vielen Erfolg und eine glückliche Reise.«
*
Herr von Pfistermeister reiste nicht gern. Und jetzt sollte er sogar hinter einem windigen Musikus herfahren? Als königlich bayrischer Kabinettsrat? Trotzdem versicherte Herr von Pfistermeister dem Könige, daß er alle Weisungen gut beachten würde, um wenigstens einen Bleistift oder eine Gänsefeder als Beute mit heimzubringen, die diesem Herrn Wagner gehörten.
Zunächst aber begab er sich ins Königliche Hoftheater, um den Herrn Generalmusikdirektor Franz Lachner aufzusuchen, der zweifellos Näheres über diesen Herrn Wagner wußte.
Herr Generalmusikdirektor Lachner wußte eine ganze Menge über den Komponisten Wagner aus Leipzig.
»Unser junger König interessiert sich für diesen Musiker?« fragte er, »dann wird er enttäuscht werden. Richard Wagner ist kein geruhiger Mann, er gehörte 1849 zu den Revolutionären in Dresden; er, der Hofkapellmeister mußte entfliehen. Er lebte dann in der Schweiz, jetzt lebt er in Wien. Seine Oper ›Tristan‹ sollte dort aufgeführt werden, was aber nicht möglich war, weil diese Oper verrückt ist. Alle Sänger erkrankten an ihren Stimmbändern!«
»Verrückt?«
»Verrückt oder irrsinnig! Wagner mutet seinen Sängern schwierigste Dinge zu, die keiner leisten kann. In den allerhöchsten Tonlagen schreien die Sänger einander an, fortissimo, endlos und ohne aufzuhören.«
»Wagneropern gibt man doch auch in München?«
»Leider! Der verstorbene König wollte es so. Es hätte sich auch kaum ausführen lassen, wenn unsere Münchner Kräfte, einschließlich Orchester, nicht so überaus tüchtig waren.«
»Unter Ihrer sublimen Leitung, Herr Generalmusikdirektor. Der junge König hat wohl auch als Kronprinz schon Wagneropern gehört?«
»Das hat er, Herr Kabinettsrat. Häufig sogar. Er versäumte keine Lohengrinaufführung. Ich verstehe seinen Geschmack nicht recht. Diese Lohengrinmusik ist nur ein wirres Durcheinander von Dissonanzen und Schreitönen. Auch ein bißchen ohrfällige Melodik kommt auf, zuweilen. Bald ist es aber wieder zu Ende. Alle unsere Sänger haben die echte italienische Schulung der Stimmen, die einzig schöne des wahren Belcanto. Wissen Sie, daß keine Sängerin im ›Lohengrin‹ auch die Elsa nicht, auch nur eine einzige Koloratur singen darf? Ich habe da eingegriffen. Unsere Primadonnen wollen bewundert werden. Wenn sie nur ihren öden Sprechgesang ableiern, kommt ihre hohe Schulung überhaupt nicht zur Geltung.«
»Was sagt denn das Publikum?«
»Das Publikum?« lächelte Franz Lachner mitleidig. »Das Publikum! Das Publikum versteht nichts von Kunst. Es freut sich über die blankpolierte Rüstung des Lohengrinritters und über den niedlichen Schwan. Es würde sich ebenso freuen, wenn dem Teufel seine Großmutter auftreten würde.«
»Ha, ha! Inwiefern haben Sie eingegriffen, wie Sie sagen?«
»Ich habe mehr echte Kunst in die Oper hineingebracht. Wo es irgend anging, dürfen die Sängerinnen jetzt ihre Kadenzen singen, ihre Triller auf den langen Fermaten, damit das Publikum merkt, wie lange die Damen ihre hohen Töne aushalten können. Auch gestrichen habe ich hier und da. Herr Wagner liebt bei seinen Kompositionen die endlosen Längen im Dialoge. Das ermattet aber Sänger und Zuhörer. Diese lieben es nicht, wenn die Handlung gar nicht vom Fleck kommt. Am ein ganzes Fünftel habe ich ›Lohengrin‹ und ›Tannhäuser‹ kürzer gemacht. Jetzt wirkt alles kräftiger.«
»Dann wird Ihnen dieser Wagner sehr dankbar sein. Da kann er viel lernen von Ihnen. Wo sagten Sie, daß er jetzt lebt?«
»In Wien. Sein Haus steht im Vororte Penzing. Jeder Fiaker fährt Sie da hin.«
»Dann will ich nicht länger stören, Herr Lachner. Haben Sie besten Dank für Ihre freundliche Auskunft. Kennen Sie Herrn Wagner persönlich? Soll ich ihn grüßen?«
Lachner überlegte erst, dann sagte er: »Nein. Tun Sie das lieber nicht. Es gibt eine kleine Mißstimmung zwischen uns. Wagner sandte uns vor ein paar Jahren seinen ›Fliegenden Holländer‹. Ich mußte ihn ablehnen. Diese Oper spielt auf Schiffen und auf dem Meere. Wer soll das aufführen? Was soll die Ausstattung kosten? Man wird auch nicht klug aus dem Text. Eine Schiffertochter liebt das Gespenst des fliegenden Holländers. Sie stürzt sich zuletzt ins Meer. Das gefällt unseren Münchnern nicht, dann schmeckt ihnen ihr Bier nicht mehr und sie träumen schlecht.«
Herr von Pfistermeister lächelte beipflichtend. Er erhob sich, er mußte gehen. Es gab da noch manches zu ordnen für diese weite Reise nach Wien – ins Ausland!
Auf dem Heimwege fiel ihm ein, daß Herr Lachner erwähnt hatte, dieser Richard Wagner sei früher in Dresden Revolutionär gewesen. Also ein Demokrat von der gefährlichen Sorte. In München aber war man kirchlich gesinnt oder sehr streng liberal-monarchistisch. Wollte König Ludwig mit einem Demokraten verkehren? Seit 1849 waren freilich schon sechzehn Jahre verflossen, und auch dieser Herr Wagner mochte inzwischen seine rabiate Einstellung gegenüber dem Staate geändert haben, wie alle anderen getan hatten, als sie älter und klüger wurden. Auch die Könige waren klüger geworden.
Der junge Ludwig ließ die anderen ihre Köpfe sich über Schleswig-Holstein zerbrechen und schickte lieber seinen Kabinettsrat nach einem fremden Musikus aus. Er war eben Vaters Sohn und würde es bleiben.
*
Den ersten Tag seiner Anwesenheit im schönen Wien benützte Herr von Pfistermeister zur Erholung von seinen Reisestrapazen. Er wohnte in einem Hotel auf der Ringstraße, wo es am elegantesten war. Schon vor langen Jahren war er einmal in Wien gewesen, wo er mehrere Monate auf der bayrischen Gesandtschaft arbeitete, weil er eigentlich in die diplomatische Laufbahn hineinwollte. Er kannte also schon manches von Wien.
Freilich: wie hatte diese Stadt sich verändert! Eine so vornehme »Ringstraße« hatte es noch nicht gegeben, das fing erst an. Vergnügt und tatenlustig waren die Wiener aber noch immer. In allen großen Vorstädten gab es überfüllte Gartenlokale mit Musik und Tanz, tagein, tagaus.
Herr von Pfistermeister besuchte einen der größten Säle: hier spielte der junge Johann Strauß mit seiner Kapelle. Das war ein Hallo jedesmal, wenn er einen seiner Walzer beendet hatte. Die Menschen, junge und alte, ließen Stürme von Beifall auf das schwarze Haupt ihres jungen Lieblings herabregnen; so etwas gab es in München nicht. Alle diese Gäste tanzten, aßen und tranken, als ob sie dafür bezahlt bekämen. Nichts deutete darauf hin, daß sehr viele Landessöhne soeben da oben in Schleswig-Holstein im Felde standen und kämpfen sollten. Nicht zur Verteidigung der eigenen Scholle, sondern zu Habsburgs hohen Ehren, also für Dinge, die sie nichts angingen. Wenn das nur gut ging! Herr von Pfistermeister lächelte bei solchen Gedankengängen. Die klugen Bayern und ihr junger König mischten sich in solche Dinge nicht ein, bei denen nur zu riskieren, aber nichts zu gewinnen war.
Sehr getröstet suchte Pfistermeister schon am zeitigen Abende sein Hotel auf, um gut auszuschlafen und für morgen gerüstet zu sein.
Am nächsten Vormittag stand die Uhr schon auf elf, als die gemächliche Schaukelfahrt mit dem Fiaker in einer mit Bäumen bestandenen Straße in Penzing ihr Ende erreichte. Pfistermeister ließ halten und fragte einige vor einer Gartentür schwatzende Frauen, ob hier in der Nähe ein Herr Kapellmeister Wagner wohne.
»Da drüben«, rief eine der Frauen und deutete mit dem Finger irgendwohin.
Der Wagen fuhr weiter und hielt vor einem schönen villenartigen Landhause. Vornehm wohnt dieser Herr Wagner, ging es durch den Kopf des Besuchers.
Vor dem Landhause stand ein Gefährt, welches mit Kisten beladen war. Soeben brachten Träger eine weitere Kiste getragen. Das sah nach Umzug aus.
Ein jüngerer Herr, anscheinend Künstler, trat aus der Haustür und musterte den Besucher.
»Verzeihen Sie«, begann Herr von Pfistermeister, »ist Herr Kapellmeister Richard Wagner zu sprechen?«
»Nein«, sagte der junge Mann, »das ist er nicht. Wollen Sie nicht nähertreten, mein Herr?«
Drinnen im Vorraum begann der Besucher: »Mein Name ist von Pfistermeister. Ich komme aus München, um Herrn Richard Wagner eine Botschaft zu übermitteln.«
»Ich heiße Peter Cornelius und bin Musiker wie Herr Wagner. Ich darf mich wohl seinen Freund nennen. Herr Wagner ist abwesend – auf Reisen. Er fuhr nach der Schweiz, nach Zürich. Darf ich erfahren, um was es sich handelt?«
»Meine Aufgabe ist eine geheime, es handelt sich um eine Vertrauenssache.«
»Dann rufe ich Herrn Landgerichtsrat von Liszt, der ebenfalls anwesend ist. Er sitzt im Arbeitszimmer Wagners und schreibt. Darf ich bitten?«
Pfistermeister betrat einen eleganten, blau drapierten Salon und sah sich neugierig um. Nein, schlecht konnte es diesem Herrn Wagner nicht gehen, wenn er hier hauste. Das war schon Luxus und nicht nur Behaglichkeit. Also mochte er mit seinen Opern viel Geld verdienen?
Ein großer, ernst blickender Herr trat ein, der Herr Landgerichtsrat von Liszt: »Sie dürfen ganz offen sprechen, mein Herr«, sagte er und bat den Gast, Platz zu nehmen, »Herr Wagner mußte ins Ausland reisen. Ich erzähle das offen und ehrlich, weil die Angelegenheit kein Geheimnis mehr ist. Soeben verkaufen wir, seine intimsten Freunde, alles Wertvolle aus seinem Besitz, sogar die Möbel, um die hartnäckigsten Gläubiger zufriedenzustellen, damit Wagner von der fälligen Schuldhaft befreit wird. Was führt Sie nach Wien?«
»Ich bin Kabinettsrat des jungen Königs Ludwig II. von Bayern. Seine Majestät beruft Herrn Wagner zu künstlerischen Leistungen nach München.«
Herr von Liszt rief in freudigem Schreck: »Nach München? Der junge König? Das ist Rettung in letzter Stunde, mein Herr. Wagner bedarf einer kräftigen Hilfe, sonst geht er zugrunde. Ihren liebreichen jungen König wird der Himmel belohnen. Nicht aus eigenem Verschulden geht es Wagner übel zur Zeit. Er hat sich dieses Haus hier einrichten lassen; allerhand Händler haben den Unerfahrenen benachteiligt. Wagner liebt es, in wohleingerichteten Räumen zu leben. Darf man ihn, den Künstler, deswegen tadeln?« Und Herr von Liszt berichtete dem hochaufhorchenden Kabinettsrat das Wichtigste von dem, was sich zugetragen. Herr von Liszt erhob sich und ging zur Tür, die er öffnete; »Peter!« rief er mit lauter Stimme, »kommen Sie, es ist etwas Gutes für Wagner – –«
Schon erschien der Gerufene: »Etwas Gutes? Dem Himmel sei Dank.«
Herr von Liszt erzählte. Auch Herr von Pfistermeister fragte dieses und jenes. Er war sehr erfreut und getröstet, weil man diesem Wagner nicht etwa aus politischen Gründen auf den Fersen war. Nur wegen Geld? Das war bei Künstlern eigentlich völlig normal. Wer München kannte, der wußte das schon. Nur – die Schulden dieses Herrn Wagner schienen ein wenig sehr hoch zu sein, wenn nicht einmal seine angesehenen Freunde ihm helfen konnten. Die fehlenden Gulden mochten wohl in die Tausende gehen – jetzt würde sein junger König in München sie zahlen müssen, falls es ihm Spaß machte.
Teufel noch mal – echte, gute Gemälde hingen noch an den Wänden, die mit schwerer Seide bespannt waren, nach dem Brauche der vornehmen Leute der Zeit. Und draußen standen schon viele gepackte Kisten mit Wertgegenständen, und diese Herren packten immer noch weiter.
Dieser Herr Wagner schien ein wenig viel zu bedürfen, um sich wohl und behaglich zu fühlen.
Herr von Liszt räusperte sich: »Dürfen wir unserem Freunde Wagner brieflich mitteilen, um was es sich handelt? Oder, wollen Sie, Herr Kabinettsrat, hinter ihm herfahren?«
»Das muß ich wohl«, seufzte Pfistermeister, »Seine Majestät, der König, gab mir ein eigenhändiges Anschreiben an ihn mit auf den Weg, das ich nur persönlich in seine Hände zu legen berechtigt bin. Wo erreicht man Herrn Wagner?«
»Er wollte zunächst bei einer Familie Wille in Mariafeld bei Zürich haltmachen, ehe er weiterreist; wohin, ist noch unbestimmt. Nur in der Schweiz wähnt er sich sicher.«
Herr von Pfistermeister nahm Abschied von Wagners Freunden. Noch einmal hatte man über diesen als Künstler gesprochen und von seinen Enttäuschungen. Seit Jugendtagen litt er darunter, daß die ihn umgebende Welt die Dinge um Musik, Kunst und Theater ganz anders sah als er selbst. Für ihn war die Kunst unentbehrlicher Odem für das menschliche Dasein. Für alle anderen war sie ein mit Maßen zu konsumierendes Genußmittel, das man notfalls auch missen konnte. Hieran konnte ein schaffender Künstler trotz allerhöchster Begabung zugrunde gehen.
*
Mit einem der Abendzüge fuhr Herr Pfistermeister nach München zurück. Was würde der enthusiastische junge König zu alledem sagen? In Geldsachen war er sehr unerfahren. Was Schulden waren, wußte er kaum. An seinem siebzehnten Geburtstage hatte man ihm zum erstenmal Taschengeld anvertraut: von jeder im Umlauf befindlichen Münzsorte erhielt er ein einziges Stück. Alles zusammen konnte nicht allzuviel ausgemacht haben.
Was tat der junge Ludwig damit?
Er suchte einen Juwelierladen in München auf, in dessen Schaufenster seine Mutter ein Medaillon entdeckt hatte, das ihr sehr wohlgefiel. Ludwig erstand es für seine Mutter und erklärte dem Juwelier:
»Hier ist meine Börse. Nehmen Sie bitte heraus, was Sie haben müssen – ich habe jetzt eigenes Geld.«
Von Ludwigs Vorrat an eigenem mochte nicht viel übriggeblieben sein!
*
Mariafeld bei Weilen in der Nähe von Zürich war ein idyllisches Örtchen. Wie ein Asyl für Dichter und Denker nahm es sich aus. Überragt vom schneebedeckten Gipfel des Tödi und den im Abendrot erglühenden Glarner Alpen lag das einfache niedrige Herrenhaus inmitten eines nicht großen, aber Ruhe und Kühle spendenden Baumgartens. Umgeben war der Ort von Weingeländen und lag in malerischer Ansicht vom Seeufer aus. Zwei alte Nußbäume und eine stolze Platane schmückten den Hof und überhingen dessen fließenden Brunnen.
Nur eine Wegstunde war es von hier aus nach Zürich, immer am See entlang. Aber nach Zürich wollte der müde Fremdling mit der Reisetasche nicht gehen, der soeben am Haustore pochte, um bei seinen alten Freunden von früher Einlaß und Rast zu finden.
Wagner hatte von Wien aus an Wille geschrieben und sich angemeldet. Er konnte aber nicht ahnen, daß der Hausherr auf Reisen war. Soeben unternahm er eine Osterfahrt nach Konstantinopel, sogar in Begleitung seines Jugendfreundes Fritz Reuter aus Mecklenburg. Wille war ein hochangesehener, wohlhabender Mann; seine Gattin Eliza versuchte sich auch in Romanen.
Frau Eliza Wille war aber auch eine resolute Mutter zweier Söhne im Alter von sechzehn und achtzehn Jahren. Sie war eine kluge und lebenserfahrene Frau, die Wagner schon früher immer gern ein wenig bemuttert hatte.
Seit mehr als zehn Jahren war Wagner hier wohlgelitten. Er hatte die Willes durch die Familie Wesendonck kennengelernt. Er hatte jetzt, in seiner verzweifelten Lage, auch bei den Wesendoncks angeklopft. Aber es stimmte da manches nicht. Karl Wesendonck, der Gatte, wollte es seiner Mathilde ersparen, von neuem an die »Tristan«-Zeit erinnert zu werden, an jene Jahre des gemeinsamen Wohnens auf »dem Grünen Hügel« bei Zürich. Wesendonck hatte es freundlich abgelehnt, Wagner auch jetzt wieder aufzunehmen. Nur einen Geldbetrag hatte er in Aussicht gestellt, den Wagner aber, ein wenig verletzt, abgelehnt hatte.
Als die gute Frau Wille Wagner in seiner neuen schlimmen Verfassung erblickte, erschrak sie heftig. Schon wieder im Elend? Da galt es wieder einmal zu trösten. Wagners Anmeldebrief lag auf dem Schreibtisch des abwesenden Gatten, noch uneröffnet.
Beruhigende, tröstende Worte hatte Wagner schon viele vernommen, auch in Wien von den Freunden. Worte konnten nicht helfen, nur Taten. Tief eingreifendes mutiges Wollen war erforderlich, um das gestrandete Schiff wieder flott zu machen. Das konnten aber weder die Willes noch Wesendoncks leisten.
»Sie bleiben hier, Herr Wagner, das ist selbstverständlich, solange Sie wollen, bis Sie wieder Mut gefaßt haben. Alles Üble geht wieder vorüber.«
»An mir geht überhaupt nur Übles vorüber«, scherzte Wagner mit einem entsagenden Lächeln. »Ich glaube, es geht zu Ende mit mir. Ich kam zu früh auf die Welt oder zu spät. Unsere Gegenwart paßt nicht zu mir, und ich nicht zu ihr. Darf ich Ihnen erzählen?«
Wagner schilderte die Lage so, wie sie war; nichts beschönigte er, ja, er klagte sich an. Wieder einmal hatte er Torheiten begangen, es war nicht das erstemal. Frau Eliza verstand Wagner sehr gut – sie kannte ihn ja, sie wußte um seine Ideen und Pläne. Diese waren immer weitausgreifend. Hemmungen sah er nicht. Alle Leute mit gegenteiliger Ansicht hielt er für böswillige Dummköpfe und Ignoranten.
Als Frau Wille ihm vorschlug, daß er eine Arbeit aufnehmen solle, um auf andere Gedanken zu kommen, wehrte er ab: »Wie kann ich das? Alles Angefangene liegt in meinem Penzing, im Schranke. Alles ließ ich zurück. Ich könnte nur eines, in Schweizer Städten Konzerte geben, um ein wenig Geld zu verdienen. Aber auch hierfür sind wieder Betriebsmittel erforderlich, über die ich nicht verfüge.«
»Sie müssen aber Ablenkung finden«, klagte Frau Eliza, als Wagner zwei Tage später immer noch tatenlos grübelnd umherging. »Können Sie nicht eine ganz neue Dichtung beginnen?«
»Nein – höchstens Bettelbriefe an alle meine Bekannten schreiben, das kann ich noch. Auch das müssen Dichtungen sein, sonst wirken die Briefe nicht.«
Eine Idee kam auf: wie, wenn alle seine zahlreichen Freunde und Gönner in aller Welt ihre Scherflein zusammenlegten, damit die drängendsten Schulden abgedeckt werden konnten? Aber schnell mußte das gehen. Wagner wollte ohne weitere Verzögerung in sein Penzinger Haus zurück. Die gewohnte Umgebung wollte er haben, um weiterschaffen zu können. Auch sein bißchen bescheidener Luxuskram war unentbehrlich für ihn.
Frau Wille hatte schon früher einmal zu bemerken gewagt, daß auch andere große Musikkünstler in bescheidenen kleinen Verhältnissen, ohne jede geringste Spur von Luxus große Werte geschaffen hätten, zum Beispiel Sebastian Bach.
»Das hilft mir nicht weiter, Frau Eliza. Ich kann in keiner kleinen Organistenstelle mein Brot verdienen, wie Ihr Sebastian Bach, den ich übrigens hoch schätze – ich würde verkümmern –«
Auch Frau Eliza war dieser Ansicht. Wer aber sollte dann helfen? Oh, es war schade um diesen Begnadeten. Nur ein Wunder konnte ihn retten. Aber die Wunder waren selten geworden in dieser Zeit.
Stundenlang saß Wagner im Garten oder an einem Fenster des Wohnzimmers und grübelte in halber Verzweiflung, Frau Eliza konnte das nicht mehr mit ansehen. Er solle wenigstens Briefe schreiben, riet sie ihm.
Wagner hatte das auch getan. Auch an seinen Freund Peter Cornelius in Wien hatte er einige verbitterte Zeilen gerichtet: »Ein einziger Stoß, und es hat ein Ende. Ich schwanke auf schmaler Zunge – ein Licht muß sich zeigen, ein Retter muß mir erstehen, der jetzt energisch hilft –, dann habe ich noch die Kraft, diese Hilfe zu vergelten – sonst nicht, das fühle ich.« Weiter schrieb er an Cornelius, daß er schleunigst wieder nach Penzing zurück müsse, in seine alten vier Wände.
Da traf ihn der neue Schlag, den er als den schwersten empfand.
Peter Cornelius antwortete: »Leider kann aus Ihrem Plane einer Rückkehr, lieber Meister, nichts werden. Denn wir haben, um Ihre unerbittlichsten Gläubiger zu besänftigen und nur in Ihrem eigenen Interesse, die Villa in Penzing aufgegeben, den Hausrat bis auf weniges so gut wie möglich verkauft und das Geld verteilt.«
*
Wagner war es, als müsse er rasend werden.
Warum hatten diese Dummköpfe das getan? Seine unentbehrliche Habe und Eigentum verschleudert und nur, um diesen Blutsaugern von Händlern die Taschen zu füllen? Waren das Freunde? Peter Cornelius war ein sehr harmloses Blut, aber die hochmögenden anderen Herren, der Herr Landgerichtsrat von Liszt und der Hofarzt Standhartner hätten dem wehren müssen.
Wenn sie alles Wertvolle versilbert hatten, waren auch die Stücke dabei, die nicht aus Ankäufen stammten, sondern kostbare Geschenke, also Andenken waren. Andenken an seine Konzerte in Rußland, Geschenke von Großfürsten; schwere silberne Prunkstücke.
Das alles war fort?
Wahrscheinlich, ohne daß damit die Gesamtschuldensumme abgelöst war. Denn nur ein Bruchteil des Anschaffungswertes wurde bei solchen Notverkäufen erzielt.
Frau Eliza fand überhaupt keine Trostworte. Was sollte sie sagen?
Wagners Freunde hatten es gut gemeint, sie wollten das Schlimmste, seine Verhaftung wegen Arrestbruches verhüten. Das war richtig gehandelt, auch Frau Eliza hätte dazu geraten.
Wagners dumpfe Verzweiflung kam Frau Wille immer gefährlicher vor. Wenn dieser durch und durch erschütterte Mensch nur keine Hand an sich legte! Frau Wille erinnerte sich an manche Äußerungen ihres Gastes, die mit dem Gedanken an Selbstmord spielten. Wenn die Schwerbesorgte von einer besseren Zukunft sprach, wurde Wagner unwillig:
»Was reden Sie von der Zukunft, wenn meine Manuskripte im Schrank liegenbleiben? Wer soll das Kunstwerk aufführen das nur ich unter Mitwirkung glücklicher Dämonen zur Erscheinung bringen kann, damit alle Welt wisse: so hat der Meister sein Werk geschaut und gewollt?«
Wagner mochte ein wenig zur Selbstüberschätzung neigen, empfand Frau Wille. Glückliche Dämonen sollten sich ihm verschreiben? Ob diese das überhaupt jemals tun würden? Die nüchterne, klarblickende Frau Wille glaubte nicht an Dämonen.
An einem der nächsten Tage kehrte der Hausherr von seiner Reise zurück. Wagner hatte das Empfinden, daß er diesem Ehepaare sehr bald lästig sein würde, und bereitete seine Abreise vor. Aber wohin?
Er wollte nach Stuttgart. Hier wirkte der Kapellmeister Eckert an der Hofoper, den er von früher her kannte. Eckert war ihm freundlich gesinnt. Vielleicht bot sich in Stuttgart ein geeignetes Unterkommen für ihn?
Wagner hatte auch an den ihm von früher her befreundeten jungen Musiker Wendelin Weißheimer geschrieben, dessen Eltern wohlhabende pfälzische Weingutsbesitzer waren. Weißheimer sollte ihn in Stuttgart besuchen, damit man sich aussprechen könne.
Ein wenig zuversichtlicher gelaunt, reiste Wagner nach Stuttgart. Er fuhr über Basel. Dort begann die badensische Eisenbahn. Auch hier konnten schon Häscher warten. Auf der Reise nach Stuttgart wechselte Wagner zweimal das Abteil. Es hatten Leute daringesessen, die ihn allzu scharf musterten.
Unangefochten kam er in Stuttgart an. Im Hotel Marquart, dicht beim Bahnhofe, nahm er Wohnung. Sofort suchte er Eckert auf, den Hofkapellmeister, der hocherfreut war. Wagner erwähnte auch seinen »Tristan.« Eckert zeigte Interesse:
»Warum nicht, Herr Wagner? Wenn Ihr ›Tristan‹ uns nicht zu schwer ist? Dem aber ließe sich durch Gäste abhelfen. Wir sind hier immer auf Suche nach erfreulichem Neuen. Ihr ›Lohengrin‹ liegt uns sehr gut.«
Auch von den »Meistersingern« sprach Wagner und spielte dem Freundlichen vor.
Dann ging er zu »Tristan« über. Eckert lauschte und lauschte: er schien bedenklich zu werden. Die Ideen der »Meistersinger«-Musik sagten ihm besser zu.
Am Abende desselben Tages besuchte Wagner die Stuttgarter Oper. Er war begierig, die Kräfte kennenzulernen, über die man verfügte. Man spielte den »Don Juan«. Wagner lauschte und lauschte.
Da wurde ihm angst.
Was er hörte und sah, war nettes Provinztheater. Kleine, bescheidene Stimmchen hatten diese freundlichen Sängerchen. Diese sollten den Tristan und die Isolde singen? Unmöglich – unmöglich!
Auch dieser Traum war zu Ende. Eckert hatte zwar von Gästen gesprochen. Aber, wo kamen diese Gäste her? Wieder von kleinen Provinztheatern.
Am nächsten Tage kam Wendelin Weißheimer von Mainz herüber.
»Sie blicken verstört, Meister«, rief er erschrocken, »ist Ihnen nicht gut?«
»Ich bin am Ende, ich kann nicht weiter – ich muß irgendwie von der Welt verschwinden.«
»Will es mit den ›Meistersingern‹ nicht weiter?«
Weißheimer schien Wagners Elend nicht ernst zu nehmen. Also mußte man ihm erläutern, wie alles lag. Weißheimer erschrak. Er wollte helfen, so gut er konnte. Er verehrte Wagner wie einen Genius, wie ein leuchtendes, bestrickendes Vorbild, dem man nachstreben mußte. Aber ohne Hoffnung, ihn je zu erreichen.
»Auch in Stuttgart, Herr Wagner, ist Ihres Bleibens nicht lange«, warnte Weißheimer sorgenvoll. »Auch die hiesige Behörde müßte Sie ausliefern, wenn das Wiener Gericht es verlangt.«
Man sprach noch lange. Weißheimer riet zu einem versteckten Wohnsitze, oben in der »Schwäbischen Alb«, wo es nur stille Dörfer gab, wo keiner den Komponisten des »Lohengrin« suchen würde. Und Wagner machte sich mit diesem Gedanken langsam vertraut.
*
Das Ehepaar Wille in Mariafeld saß eben beim Kaffee, als neuer Besuch gemeldet wurde: ein Herr von Pfistermeister aus München wünsche, Herrn Wille zu sprechen. Herr Wille ließ bitten. Als er den Zweck des Besuchers erfahren hatte, bedauerte er lebhaft, nicht dienen zu können: »Herr Richard Wagner genoß bei uns nur einige Tage Erholung. In Stuttgart erfahren Sie seinen Aufenthalt beim Opernkapellmeister Eckert.«
Herr von Pfistermeister lächelte traurig: immer noch weiter sollte er wandern? Jetzt von Zürich nach Stuttgart fahren und von Stuttgart wahrscheinlich weiter nach Leipzig oder Dresden, oder Berlin, London oder Stockholm. Lohnte das wirklich der Mühe? Das war noch nicht dagewesen, daß man einen Königlich bayrischen Kabinettsrat hinter einem entflohenen Musikus herjagte, nur damit ein enthusiastischer junger König die Schulden dieses windigen Musikanten bezahlen konnte.
Ja, wenn König Ludwig noch selbst ein großer Musiker wäre; so aber war er nicht einmal sehr musikalisch, wie sein bisheriger Klavierlehrer, der alte Hofrat Wanner, immer behauptete: Ludwigs musikalisches Gehör sei recht mangelhaft.
Schon wenige Stunden später bestieg der geplagte Kabinettsrat von neuem den Eisenbahnzug: er reiste nach Stuttgart.
*
Wagner redete mit seinem jungen Freunde Weißheimer immer noch über die Möglichkeiten, irgendwohin zu verschwinden, wo kein Häscher ihn fand. Weißheimer wußte von einigen verborgenen Plätzchen der Schwäbischen Alb. Auch nicht auf dem Stuttgarter Bahnhof sollte Wagner den Zug besteigen, sondern erst einige Stationen weiter. Bis dahin sollte ein Fuhrwerk ihn bringen.
Diesen Wagen hatte Weißheimer bereits besorgt, morgen in der Frühe sollte die Abreise stattfinden. Man sprach aber auch über Musik. Wagner erläuterte eben zum wiederholten Male, welche erhöhten Anforderungen er an Orchester und Sänger für eine Aufführung seiner noch toten Werke stellte, als es klopfte.
Weißheimer öffnete, es war ein Hoteldiener, der eine Karte brachte, eine Besuchskarte: »Der Herr bittet, Herrn Wagner sprechen zu dürfen.«
Weißheimer warf einen neugierigen Blick auf die Karte. Er las mit staunenden Augen: »Von Pfistermeister, Secrétaire aulique de Sa Majesté le Roi de Bavière«?
Wagner war bleich geworden. Er hatte an Schergen geglaubt, die ihn holen kämen. Der bayrische König, Sa Majesté le Roi de Bavière, konnte ihn aber nicht gut verhaften lassen. Was mochte das sein? Trotzdem: auch eine Falle konnte das sein. Auf alle erdenklichen Schliche kamen diese Gerichtsmenschen, wenn sie jemanden packen wollten.
»Weißheimer«, flüsterte Wagner in seiner Angst, »wir nehmen nicht an – mir graut vor neuen Geschichten – lehnen Sie ab.«
»Herr Wagner läßt bestens danken«, sagte Weißheimer zu dem wartenden Kellner, »er ist sehr beschäftigt.«
»Vielleicht war es die Einladung zu einem Konzert«, mutmaßte Weißheimer, als der Kellner gegangen war, »das konnten Sie annehmen.«
»Woher weiß dieser bayerische König, daß ich in Stuttgart bin?« rief der mißtrauische Wagner »das ist verdächtig.«
Das war es auch.
Nach wenigen Minuten kam der Kellner zurück: der fremde Herr müsse Herrn Wagner ganz unbedingt sprechen, und zwar sofort; er überbringe eine Botschaft vom bayerischen König.
Da ermannte sich Wagner. Vielleicht sah er in seinem gesteigerten Angstempfinden Gespenster, wo gar keine waren? »Ich lasse bitten!«
Der Kellner verschwand. Bald klopfte es wieder, Weißheimer öffnete. Im Türrahmen erschien ein älterer, schwarz gekleideter Herr mit steifen Mienen. Er verbeugte sich grüßend und sagte:
»Es ist nicht leicht, Sie zu finden, Herr Wagner. Schon seit vielen Tagen reise ich hinter Ihnen her; aber vergeblich.«
»Hinter mir her? Wie ist das möglich?«
Der fremde Herr nahm einen Stuhl, da man ihm keinen anbot, und setzte sich aufatmend. Er fuhr in der Rede fort: »Zuerst war ich in Wien, wo Ihre dortigen Freunde mich nach der Schweiz sandten, nach Mariafeld bei Zürich. Dort waren Sie nicht. Herr Wille gab mir Ihre Adresse bei Herrn Opernkapellmeister Eckert an. Auch bei diesem waren Sie nicht. Herr Eckert sandte mich hierher ins Hotel. Jetzt habe ich Sie – endlich!« Alles, was Herr von Pfistermeister sagte, klang ein wenig nach Vorwurf.
Er kramte dann in seinem Portefeuille, das er seiner Rocktasche entnommen hatte, und nahm ein weißes Kuvert heraus. Dann ein flaches Päckchen und noch ein Kuvert. Er sagte feierlich: »Im Auftrage Seiner Majestät, des bayerischen Königs Ludwig des Zweiten, lege ich diese drei Objekte in Ihre Hände, Herr Wagner. Nehmen Sie bitte Kenntnis davon.«
Richard Wagner nahm erst den Brief und erbrach ihn; er ging zum Fenster und setzte sich auf einen Stuhl, ehe er las. Es bebte etwas in ihm, eine Erwartung hatte ihn erfaßt, die aber jetzt frei von Befürchtungen war. Nein, dieser junge König, dessen Bild er neulich in München in den Läden erblickt hatte, würde ihm sicherlich keinen Schaden zufügen wollen.
Als er den Brief zweimal gelesen hatte, ging es wie eine erlösende Entspannung durch seinen Körper – gerettet!! Gerettet aus allerschlimmster, gefährlicher Notlage durch einen jungen, von Idealen erfüllten, freundlichen, echt königlichen Menschen, der auch die Macht besaß, um helfen zu können.
Weißheimer hatte Herrn von Pfistermeister gewinkt, und beide hatten das Zimmer verlassen. Beide begriffen, daß Wagner jetzt allein bleiben mußte.
Wagner aber sann und sann. Konnte es möglich und Wirklichkeit sein, dieses Große, Betörende? Wie – dieser junge König, dieser prachtvolle Jüngling, berief ihn nach München? Nein, noch viel mehr: er berief ihn an seine Seite – auf Lebenszeit?
Der junge König schrieb: »Seien Sie überzeugt, ich will alles tun, was in meinen Kräften steht, um Sie für vergangene Leiden zu entschädigen. Die niederen Sorgen des Alltagslebens will ich für immer von Ihrem Haupte verscheuchen, die ersehnte Ruhe will ich Ihnen bereiten. Damit Sie im reinen Äther Ihrer wonnevollen Kunst die mächtigen Schwingen Ihres Genius ungestört entfalten können.«
Noch lange blieb Wagner am Fenster sitzen und blickte träumerisch hinüber nach dem Parke der königlichen Residenz, ganz andächtig. Immer wieder stieg ein hohes Glücksgefühl in ihm auf. Denn er hoffte: man wollte ihm nicht nur ein Almosen geben, man würde auch Taten verlangen und seine Arbeit achten. Woher wußte dieser junge König von ihm, der vor zwei Monaten erst den Thron bestiegen und als erste monarchische Tat einen beinahe halbverkommenen alten Musiker an seine Seite berief?
Das mußte vergolten werden.
Eine Enttäuschung durfte der junge König nie und nimmer an ihm erleben.
Das ganze Elend, der Schrecken jahrzehntelanger Mißerfolge und Enttäuschungen waren also für immer verjagt? Was würden sie dazu sagen, die lieben Freunde in aller Welt? Die Gegner, die Neider und Besserwisser?
Oder war der junge König nur ein phantastischer Idealist, der vom Leben bisher nur die buntere Seite kannte? Um so weniger durfte man zögern, ihm zu helfen, seine Glücksträume, die er hegen mochte, auch zu verwirklichen.
Zunächst wollte Wagner seinem neuen Beschützer danken. Wie schrieb man an einen König? Wenn er nur die richtigen Worte fand, um auszudrücken, was ihm am Herzen lag.
»Diese Tränen himmlischer Rührung sende ich Ihnen«, schrieb Wagner, »um Ihnen zu sagen, daß die Wunder der Poesie wie eine göttliche Wirklichkeit in mein armes, liebeleeres Leben getreten sind. Und dieses Leben, mein letztes Dichten und Tönen gehört Ihnen, mein gnadenreicher junger König: verfügen Sie darüber als über Ihr Eigentum!«
*
Das Herrlichste aber war, daß Wagner den jungen König nicht um Hilfe angefleht hatte; daß Ludwig von selber kam und ihn rief, ihm also nicht aus Gnade und Barmherzigkeit Brot und Lohn versprach, sondern, weil er seine Dichtung und seine Musik liebte, soweit er sie kannte. Wie würde er erst beglückt sein von dem, was noch kam?
Auch in München wurden seine älteren Opern gespielt, schlecht und recht. In München, wo Franz Lachner bei der Oper das Zepter führte, der Bruder des alten Vinzenz Lachner in Mannheim.
Aber auch in München mochte es manches zu reformieren geben, was dieser aufstrebenden Kunststadt nottat. Das war eben nicht anders bei dem herrschenden Opern-Schlendrian, in München ebenso wie in Stuttgart, Karlsruhe, Paris, Wien und Berlin.
Eine der schönsten Zukunftshoffnungen, die er hegen durfte, war, daß sein »Tristan« endlich ein Unterkommen fand, nach langen Irrfahrten. Dann kamen die »Meistersinger« und die Dramen des »Ringes des Nibelungen«. Arbeit kam, Arbeit in endlosen Strömen – immer mehr, immer mehr. Das war das Herrlichste!
Und wie tatkräftig mußte dieser junge König erst sein, der einen Musiker zu sich berief, keinen berühmten, vergötterten und gesättigten, sondern einen hart umstrittenen, verpönten, verlästerten, dem tiefstes Elend am Herzen saß, aus dem er allein kaum noch herausfand. Der König schrieb:
»Wie der Ihnen gesandte Rubin glüht, so brenne ich vor Verlangen, den Genius von Angesicht zu sehen, dem ich, wie ich bekenne, meine ganze bisherige Entwicklung verdanke!«
Schon am nächsten Tage reiste Wagner, nicht als Flüchtling in ein Versteck in der Schwäbischen Alb, sondern mit Herrn von Pfistermeister nach München.
*
Den 4. Mai schrieb man, als König und Künstler zum ersten Male einander sahen. Dieses immerhin folgenreiche Geschehen vollzog sich im Schlosse Nymphenburg, dicht bei München. Herr von Pfistermeister stellte Wagner nur vor, dann entfernte er sich, froh darüber, daß er seinen Auftrag erfolgreich erledigen konnte.
Ach, dieser Richard Wagner, das war aber einer! Keine drei Worte hatte er auf der langen Reise von Stuttgart nach München geredet. An diesen wenigen Worten hatte man aber deutlich gemerkt, daß Herr Wagner ein Sachse war, eine Sachse aus Dresden. Ein echter Norddeutscher, wahrscheinlich auch Protestant, wie man sie in München schon kannte, ohne sie freilich zu lieben. Alles, was nördlich der Donau wohnte, gehörte für die Münchner begriffsmäßig zu Preußen. Na, und die Preußen –
Den Wortlaut des denkwürdigen ersten Gespräches zwischen König und Künstler an jenem 4. Mai 1864 kennen wir nicht. Wir wissen nur, was beide darüber zu Freunden, Bekannten äußerten. Danach sprach man sehr sachlich über das Nächstliegende. Von der augenblicklichen Notlage Wagners schien Ludwig Kenntnis zu haben.
»Nennen Sie mir die Summe, Meister, die Sie benötigen, um reinen Tisch zu machen. Sie müssen sorgenfrei sein, wenn Sie schaffen wollen.«
Das war eine schwer zu beantwortende Frage für Wagner. Er hatte nur die ungefähre Summe im Gedächtnis, die seine Wiener Gläubiger nach ihrer Ansicht zu fordern hatten: also die Summe der Beträge aller laufenden oder schon verfallenen Wechsel. Aber das war noch nicht alles. Es gab wohl überhaupt keinen Platz in Europa, an dem Wagner längere Zeit sich betätigt hatte, wo nicht noch Schulden liefen, kleine und große; die Gesamtsumme aller dieser Beträge war Wagner nicht gegenwärtig. Um den König nicht zu erschrecken und nicht als wüster Schuldenmacher zu erscheinen, gab Wagner einen Betrag an, der viel zu niedrig war. Der König schrieb eine Anweisung an seine Kabinettskasse aus.
Ludwig nannte dann den Betrag, den Wagner als Jahresgehalt haben sollte bis an sein Lebensende: es waren viertausend Gulden, also ein ausreichender, wenn auch nicht allzu hoher Betrag. Ludwig hatte wohl an das Einkommen vieler höherer Beamter aus der Umgebung des Königshofes gedacht, die schon mit zwei bis dreitausend Gulden zufrieden sein mußten, in jener sparsamen Zeit.
Für Wagner waren viertausend Gulden aber eine gute Grundlage für ein gesichertes Dasein unter behaglichen Umständen. Der König besprach dann die Wohnungsfrage. Er hatte bereits ein Wohnhaus für Wagner gemietet, das freilich erst instand gesetzt werden mußte. Es lag in der Briennerstraße – Nummer 21 – also in vornehmer Wohngegend, nicht zu weit entfernt von der königlichen Residenz und dem Opernhause. Ludwig setzte hinzu: »Der ganze Sommer wird mit der Renovierung vergehen. Bis zur Fertigstellung beziehen Sie eine ländliche Wohnung am Starnberger See, in der Nähe meines Schlosses Berg am östlichen Ufer. Das Landhaus wird Villa Pellet genannt. Das Haus ist schon vorbereitet, morgen können Sie übersiedeln.«
Wagner war richtig erschüttert von so viel Güte. Keiner hatte ihn im Leben bisher verwöhnt. Eisige Ablehnung hatten die Hochmögenden immer nur für ihn übriggehabt, wenn er mit Bitten und Vorschlägen kam. Nicht einmal ihn zu verstehen, bemühte man sich. Und jetzt diese reiche Fülle auf einmal.
Dann war von der Kunst die Rede. König Ludwig schlug vor: »Sie studieren am besten zuerst einmal unser Musik- und Theaterleben in München, lieber Meister, nicht wahr? Finden Sie etwas Verbesserungsbedürftiges, so wollen wir Hand anlegen. Brauchen Sie neue Hilfskräfte, so sagen Sie es.«
Das war Wasser auf Wagners Mühle. Es war ihm schon beigefallen: er würde nicht nur Hilfskräfte nötig haben, sondern auch treue Freunde für alle Fälle auf diesem ihm fremden Boden, München genannt. Er wußte schon, wen er sich holen wollte: es waren seine Treuesten und Besten aus der vergangenen Zeit, Leute, denen das Durchringen ebenfalls schwerfiel oder mißlungen war, trotz wahrer, eigener Kunst.
Wagner nannte dem jungen freundlichen König zuerst seinen Freund Hans von Bülow, Schüler und Schwiegersohn des berühmten Franz Liszt. Auch Bülow war Klaviervirtuose und gab viele Konzerte; augenblicklich unterrichtete er in Berlin.
Auf Hans von Bülow freute sich König Ludwig. Er wollte einen neuen Posten für diesen schaffen, einen »Klavierspieler des Königs«. Einen solchen Posten gab es noch nicht am bayerischen Hof.
Wagner empfahl auch Peter Cornelius, den getreuen.
»Man bringt ihn am besten an einer guten Musikschule unter, als Lehrer«, erläuterte Wagner dem Könige, »denn Cornelius will auch arbeiten. Er schrieb bereits eine Oper, den ›Barbier von Bagdad‹. Jetzt schreibt er an einer neuen: dem ›Cid‹. Auch sehr schöne Lieder gelingen ihm. Er könnte mir im Musikalischen des Opernbetriebes behilflich sein.«
»Dann gewähren wir ihm, außer seinem Lehrergehalt, noch einen königlichen Ehrensold von 1000 Gulden im Jahre«, entschied Ludwig unbedenklich. »Ist das genug?«
Wagner verneigte sich dankend. Der gute Cornelius konnte sich freuen. Augenblicklich führte er ein klägliches Dasein in Wien. Er erteilte Klavierunterricht, wußte aber nicht immer, wie er seine bescheidene Miete aufbringen sollte. Er begleitete, gegen Bezahlung, auch hier und da Sängerinnen auf dem Flügel bei deren Darbietungen bei Gesellschaften oder Vereinsfestlichkeiten. Ein Hungerleben!
»Es ist mir sehr lieb, lieber Meister«, bemerkte Ludwig, »daß Sie Ihre tüchtigen Freunde nach München berufen. Sie sind hier fremd und gar nicht bodenständig. Wenn Sie nur auf Ihre Münchner Umgebung angewiesen wären, würden Sie bald kümmerlich einsam werden. Das Zusammenleben mit meinen lieben Münchnern ist nicht immer ganz leicht. Mein Vater und Großvater haben das am eigenen Leibe erfahren. Gerade Fremden, also Norddeutschen gegenüber, sind diese Münchner recht mißtrauisch. Nun aber zu Ihnen selbst, lieber Meister, zu Ihrer wonnigen Kunst!«
Wagner war Aug' und Ohr: jetzt kam das Wichtigste.
»Ich sah Ihre Opern«, fuhr Ludwig fort, »den ›Lohengrin‹ und den ›Tannhäuser‹ schon vor drei Jahren zum ersten Male und war ergriffen von so viel Schönheit. Ich sah sie auch immer wieder seitdem. Ich möchte, daß Sie diese beiden Werke einmal nach eigenen Intentionen neu einstudieren!«
»Darf es nicht auch der ›Fliegende Holländer‹ sein, Majestät? Diesen hat man in München noch nie gespielt. Die Ausstattung für dieses ›Seestück‹ sei allzu kostspielig schrieb man mir damals.«
Der König lächelte. »Auch das wird sich ermöglichen lassen, Meister. Wenn Sie den Münchnern eine Neuheit darbieten können, ist es noch besser.«
»Neu sind auch ›Tristan‹ und ›Meistersinger‹, sind ›Walküre‹ und ›Rheingold‹, die beiden ersten Dramen meines ›Ringes des Nibelungen‹.«
»Das alles wollen wir haben, Herr Wagner, und sobald wie möglich.«
»Erst müssen wir aber auch Sänger haben, Majestät, die richtigen Sänger. Es handelt sich um den neuen Gesangsstil, wie ich ihn schuf, der erst erlernt werden muß. Darsteller italienischer Spielopern können meinen Tristan und meine Isolde nicht singen, erst recht nicht Siegfried und Wotan.«
Der König nickte lebhaft: »Ich weiß es. Ich kenne Ihre im Druck erschienenen Schriften, in denen Sie eine neue deutsche Gesangsschule fordern. Ich will Ihnen helfen, soweit ich vermag. Ich las auch die Dichtung zu Ihrem Bühnenfestspiel, das Sie ›Ring des Nibelungen‹ benannten. Zu dieser Dichtung schrieben Sie auch ein Nachwort. Sie fragten in diesem, ob auch der deutsche Fürst sich finden würde, dessen Macht es erlaube, Ihr Werk auch würdig erstehen zu lassen. Dieser Fürst will ich sein, lieber Meister. Ich verspreche es Ihnen – hier ist meine Hand.«
Ludwig war aufgestanden und stand dicht vor dem beglückten Wagner.
Ludwig schildert das Ende seines ersten Gespräches mit diesem in einem Briefe: »Als ich geendet, bückte Wagner sich lief auf meine Hand und schien sehr gerührt zu sein von dem, was doch so natürlich war. Da neigte ich mich nieder zu ihm und zog ihn an mich. Ich hatte das Gefühl, von da ab für alle Zeit mit ihm verbunden zu sein.«
*
Als Wagner am Abend wieder in seinem Hotel war – er wohnte im angesehenen »Bayerischen Hof« am Promenadenplatz – schrieb er an seine unverzagte alte Gönnerin Eliza Wille in Mariafeld bei Zürich: »Der junge König ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, daß ich fürchte, sein Leben müsse zerrinnen wie ein flüchtiger Göttertraum, in dieser gemeinen Welt –«
Auch an seinen Freund Peter Cornelius schrieb er sofort: »Ich habe Dich im besonderen Auftrage Seiner Majestät aufzufordern, sobald Du kannst, nach München überzusiedeln, hier Deiner Kunst zu leben, und mir, Deinem Freunde, als Freund behilflich zu sein. Du erhältst vom Tage Deiner Ankunft an aus der königlichen Kabinettskasse ein Gehalt von –«
Wagner aber gab sein Hotel auf und fuhr nach Starnberg und von dort mit einem Schiffchen nach dem östlichen Seeufer hinüber. Ohne Schwierigkeit fand er das königliche Schlößchen Berg und die Villa Pellet, wo schon alles zur Aufnahme des angekündigten Sommergastes bereitstand.
Wie schön war es hier! Der Starnberger See – auch Würmsee genannt, da der Würmfluß ihn speist – ist ein friedlicher See. Nur bei starken Stürmen gehen die Wogen höher. Sonst spielen sie nur leise im Winde. Bei klarer Sicht liegen die Bayrischen Alpen im Süden zum Greifen nahe, vor allem die Zugspitze. Das mochte für Wagner einen bescheidenen Ersatz bedeuten für seine geliebte Schweiz und den Züricher See.
Wagner saß bald tief in der Arbeit. Ein neuer Feuereifer hatte ihn erfaßt, der Tag hatte zu wenig Stunden für ihn. Schon am zweiten Tage schrieb er ausführlich an seinen vertrauten Freund Hans von Bülow in Berlin, den Klaviervirtuosen und Dirigenten, der vor wenigen Jahren Cosima geheiratet hatte, die Tochter Franz Liszts. Bülow sehnte sich fort von Berlin, das er als »muffig und unmusikalisch« bezeichnete. Als er einst in einem Konzert Wagners »Tannhäuser«-Ouvertüre dirigierte, hatten diese Berliner gezischt, das Publikum bestand hauptsächlich aus Wagnergegnern, und Bülow wurde vor Ärger krank.
Wagner schilderte dem Freunde seine veränderte Lebenslage. Dieses Glück seines schon allzuoft genarrten Vorbildes Wagner erschien dem mißtrauischen Bülow freilich phantastisch genug, als daß es Bestand haben konnte. Und von den Münchnern versprach er sich auch nicht viel Besseres als von den Berlinern.
Trotzdem erhielt Wagner eine Zusage von seinem Freunde, nach München zu kommen, was Frau Cosima, die kluge Gattin, veranlaßte, die erst siebenundzwanzig Jahre alt war.
*
Zu seiner Freude sah Wagner mehrere fest umrissene Aufgaben vor sich, an die er Hand anlegen durfte, ohne erst warten zu müssen. Das Nächstliegende war die Einstudierung seines »Fliegenden Holländers« an der Hofoper. Es ging Wagner aber weniger darum, den Münchnern durch eine neue Opernuraufführung unterhaltlich zu sein, als vielmehr die zur Verfügung stehenden Sänger zu prüfen und das Orchester. Hierzu mußte er sich in die Sphäre seines alten Gegners Franz Lachner begeben, des Generalmusikdirektors am Hoftheater, der schon seit vielen Jahren dort wirkte.
Wie das ausgehen würde? Nicht ganz ohne Widerstand, fürchtete Wagner. Er kannte diese Hofkapellmeister mit ihren unangreifbaren Paschabefugnissen. Fast immer behielten sie das ausschlaggebende Wort im großen, im kleinen. Auch der leitende Intendant mußte sich ihnen beugen, da er selten genügend sachverständig war, um etwas widerlegen zu können.
Wagner wollte auch nichts verderben; er hegte keinen Groll gegen Lachner, da dieser weder besser noch schlimmer war als alle anderen.
Wagner schrieb also einen freundlichen Brief an Lachner und kündigte seinen Besuch an. Briefeschreiben war überhaupt seine Haupttätigkeit in diesen Tagen endlicher Sorgenfreiheit. Dutzende von Zuschriften richtete er an seine Bekannten in aller Welt. Überall im In- und Auslande gab es Musiker und Schriftsteller, mit denen er schon in Verbindung gestanden hatte in seinem bisherigen bewegten Künstlerdasein. Auch seine Verwandten erhielten Mitteilungen. Wagner war hochgemut und glücklich darüber, daß er ihnen schreiben konnte, wie gut es ihm ging: vom bayerischen König war er auf Lebenszeit nach München berufen worden – oh, das würde auf Windes Flügeln in allen deutschen Gauen sich herumsprechen, auch im Auslande, wo man ihn kannte, und die Zeitungen würden darüber schreiben!
Eines Tages bekam Wagner, der noch an seiner Zimmereinrichtung arbeitete, seinen ersten Besuch. König Ludwig hatte ihm diesen Besuch gemeldet:
»Ich sende Ihnen, lieber Meister, eine brauchbare Hilfe in der Person des jungen Herrn Julius Hey, der Musiklehrer im herzoglichen Hause unserer Familie ist. Prinzessin Sophie und Prinz Max, die Kinder des Herzogs Maximilian in Bayern, erhalten Klavierunterricht und Gesangsstunden bei ihm. Er war ein Stipendiat meines hochseligen Vaters. Wir haben ihn alle sehr gern. Er komponiert auch ein wenig –«
Ich hatte es nicht so gut, dachte Wagner, nicht ohne Galgenhumor, obgleich auch ich schon ein wenig komponierte, als ich noch jung war.
Julius Hey entpuppte sich später als »Wagnerianer«, wie die meisten jungen Menschen der Zeit. Er hatte beim Hofkapellmeister Franz Lachner Musik studiert: Komposition und Gesang, seine Stimme war ansehnlich. Aber er malte auch, er hatte als Akademieschüler bei Kaulbach gelernt. Die Malerei genügte ihm aber nicht: die Musik zog ihn stärker an.
Als Hey jetzt bei Wagner ins Zimmer trat, war dieser mit Bilderaufhängen beschäftigt, in Hemdärmeln. Julius Hey erbot sich sofort, ihm zu helfen, was er auch durfte. Beim Bilderaufhängen plauderten beide.
Hey erzählte von seinem Musiklehrer Franz Lachner, und Wagner erfuhr allerhand Wissenswertes. Hey erzählte dann, daß König Ludwig ihn zur Audienz befohlen habe, um mit ihm über Wagner zu reden. »Wissen Sie, was der König sagte, Meister? Er sagte: ›Haben auch andere Komponisten so süße, überirdisch berauschende Melodien wie Wagner? Nein, das haben sie nicht. Es fällt ihnen nichts ein, sie erarbeiten alles und räubern in fremden Gärten. Die Tristanmusik, nach der Dichtung zu urteilen, denke ich mir unheimlich düster. Ganz ungeduldig sehe ich der ersten Aufführung dieses ›Tristan‹ entgegen –‹«
»Der König wird Geduld haben müssen«, warf Wagner ein, »sehr viel Geduld. Nicht einmal für meine älteren Opern gibt es gut geeignete Sänger an deutschen Bühnen. Für den ›Tristan‹ schon gar nicht. Nur einen einzigen wüßte ich: meinen Freund Schnorr in Dresden. Er wird aber nicht kommen wollen.«
»Aber wenn der König es will? Schnorr stammt doch aus München, aus der Künstlerfamilie Schnorr von Carolsfeld?«
»Schnorr müßte Aussichten in München erhalten und behagliche Verhältnisse vorfinden, da er verheiratet ist. Seine Frau heißt Malwine; auch sie ist Sängerin von hohen Graden. Aber jetzt erzählen Sie mir ein wenig von Ihrem Lachner. Wie spricht er von mir?«
»Er ist keiner Ihrer Anhänger, Meister. Er denkt und fühlt nur in der alten Musik. Beethoven, Schubert, Haydn und Mozart sind seine Lieblinge.«
»Sie sind auch die meinigen, lieber Freund«, lächelte Wagner, »das hindert aber nicht, daß neue Komponisten heranwachsen, die gleichfalls Erfreuliches schaffen.«
»Herr Lachner wird, glaube ich, mit Ihrer endlosen Melodie nicht fertig, Herr Wagner. Sein Ideal bleibt die geschlossene Arie.«
»Bei der der Sänger vorn an der Rampe sich aufbaut und das Publikum anschreit?«
»Auch das. Vor allem in italienischen Opern. Lachner behauptet, daß es das Publikum ermüde, wenn so ein Sänger gar nicht aufhören will. Dann müsse man eben den Rotstift nehmen und wegstreichen, was zuviel ist.«
Wagner hatte Zorn in der Stimme: »Das soll er sich nur nicht einfallen lassen, wenn es um meine Opern geht. Da ist nichts zu streichen. Ein Sänger ermüdet das Publikum nur dann, wenn er nicht singen kann. Singen können die wenigsten Opernsänger von heute, lieber Hey.«
Dieser lächelte amüsiert. Franz Lachner würde sich wundern. Ein bißchen umständlich, voreingenommen und überaltert war er ja schon, das mußte man zugeben. Hey wollte Lachner aber gut zureden, mit Wagner sich gut zu stellen, schon König Ludwigs wegen, damit keine Disharmonie die königliche Laune trübte, welche soeben über der Musik die Sonne hatte aufgehen lassen. Hey wollte Wagner noch etwas Erfreuliches sagen, ehe er ging: »Es ist überraschend, wie eingehend der König in Ihre gedruckten Darlegungen und Bücher eingedrungen ist. Er will Ihr Schüler sein, Meister, Schüler und Mentor zugleich.«
»Das wird nicht ganz leicht sein«, murmelte Wagner in einem Rückfall in sein pessimistisches Denken von früher. »Wie spricht man sonst bei Hofe von mir?«
»Nur Gutes, Meister. Namentlich die jüngeren Herrschaften schwärmen von Ihnen, vor allem die junge Prinzessin Sophie.«
Wagner schien sich zu freuen. Hey verschwieg aber, daß andererseits die älteren Herrschaften ein wenig beunruhigt blickten, sobald von Wagner die Rede war. Hier nahm man Anstoß an Wagners Dresdner politischer Vergangenheit. Es mußte sich schon herumgesprochen haben, daß er 1849 die große Sturmglocke auf der Dresdner Annenkirche geläutet hatte, als der Barrikadenkampf einsetzte.
Damals war soeben erst sein »Rienzi« aufgeführt worden. Der Held hieß eigentlich Cola di Rienzo und war ein Volksverführer, ein unruhiger Geist, der das alte Römerreich wiederherstellen wollte, und den Wagner verherrlichte. Das machte auf die älteren Herrschaften am bayerischen Hofe durchaus keinen vertrauenerweckenden Eindruck; auch auf die Geistlichkeit nicht. Außerdem: Richard Wagner war Protestant im wahrsten Sinne des Wortes und nach allen Seiten und Richtungen hin.
Nur König Ludwig, der junge schönheitssehnsüchtige Mentor des einundfünfzigjährigen Wagner gab nichts auf solche Dinge. So hoch er auch sein Königtum hielt, glaubte er nicht daran, daß Wagner auch heute noch Tyrannenhasser sein könnte. Wagner hatte erfahren, daß es schlimmere Peiniger im Leben gab; Schergengebieter, die noch willkürlicher mit ihren Mitmenschen umgingen, als Könige es jemals getan hatten, namentlich, wenn sie Ludwig II. von Wittelsbach hießen.
Julius Hey mußte gehen, um noch seinen Münchner Zug zu erreichen, und Wagner schüttelte ihm freundlichst die Hand zum Abschiede.
*
Der hohe Betrag zur Schuldentilgung war aus der königlichen Kabinettskasse eingetroffen, und Wagner konnte endgültig reinen Tisch machen. Hierzu war eine Reise nach Wien erforderlich. Wagner wollte auch seinen dortigen Freunden, diesen Angsthasen, gründlich die Meinung sagen, die alle seine Möbel und Kunstgegenstände verschleudert hatten. In seiner jetzigen gesicherten Lebenslage erschien ihm diese Untat ganz besonders grotesk. Wie prachtvoll hätte er sein Münchner Haus in der Briennerstraße jetzt einrichten können! Woher bekam er Ersatz? Er würde wegen dieser Einrichtung von neuem an die Königliche Kabinettskasse herantreten müssen. Was würde der König sagen?
Peter Cornelius erwartete den verehrten Meister in Wien an der Bahn. Wagner benahm sich zurückhaltend, überlegen und ironisch in Rede und Gegenrede, es wurde aber nicht schlimm. Nur die beiden anderen »Freunde«, den Herrn von Liszt und den Hofarzt Standhartner, mochte Wagner nicht sehen. Das waren in seinen Augen schlimme Pedanten und Hasenfüße.
Peter Cornelius mußte auch die Verhandlungen mit den Gläubigern führen. An die achtzehntausend Gulden königliches Geld ließ Wagner in Wien zurück.
Peter Cornelius zeigte sich nicht etwa beglückt von seiner Berufung nach München, um »dort seiner Kunst zu leben«, wie Wagner das nannte. Den Ehrensold des bayerischen Königs in Höhe von tausend Gulden hielt er für eine Verlockung des Teufels. Er mußte auch erst nach Weimar, wo man seinen »Cid« angenommen hatte und einstudierte; Cornelius wollte dabei sein. Er hatte den Eindruck, daß sein eigenes Streben in der Kunst vollkommen aufhören würde, wenn er erst von Wagner als Gefolgsmann eingespannt wurde, »dann komme ich überhaupt nicht mehr los von ihm«, schrieb er einem Bekannten.
Wagner versuchte, den treuen Cornelius umzustimmen, was aber nicht gelang. »Erst muß mein ›Cid‹ aufgeführt werden«, erklärte Cornelius, »dann komme ich, Meister! Den ›Cid‹ bringen wir dann auch in München heraus.«
»Aber erst nach meinen ›Meistersingern‹, mein lieber Peter«, widersprach Wagner; was in Cornelius von neuem den Gedanken aufkommen ließ, daß Wagner ein schlimmer und ganz großer Egoist sei und bleiben würde.
*
Neun Jahre vorher, im Jahre 1855, hatte Hans von Bülow die bis dahin in Paris erzogenen Töchter Franz Liszts kennengelernt. Der junge preußische Edelmann Bülow mit seinem altadligen Namen gefiel der jungen Cosima, die damals erst sechzehn Jahre alt war. Im Laufe der Zeit fühlten beide sich immer mehr zueinander hingezogen, und Bülow bewunderte die jüngste Liszttochter Cosima, die schon damals voller Geist, Talent und Leben war.
Cosima, die Tochter Liszts und der französischen Gräfin d'Agoult, sah in Bülow aber nicht nur den Edelmann, sondern auch den begeisterten Schüler ihres berühmten Vaters, der zu großen Künstlerhoffnungen berechtigte. Der Vater Liszt, der nur zwei Jahre älter als Richard Wagner war, freute sich über die zwischen den beiden jungen Leuten aufkeimende Neigung von Herzen. Das Schicksal seiner geliebten Cosette hatte ihm Sorge bereitet. Er hatte die Töchter der Gräfin d'Agoult zwar adoptiert; trotzdem befand sich diese in einer gesellschaftlich nicht eben vorteilhaften Lage der Außenwelt gegenüber. Wenn seine Cosette Bülow heiratete, kam sie in sichere Hut.
Zur Verlobung kam es aber erst in Berlin, wo Bülow eine Anstellung am Sternschen Konservatorium bekleidete. Er fühlte sich dort nicht wohl. Die Unterrichtsstunden im Klavierspiel, die er erteilen mußte, waren ein Greuel für ihn, der viel lieber Dirigent eines großen Orchesters gewesen wäre. Bülow war ein sehr ungeduldiger Lehrer; er war nicht nur streng zu seinen Schülern, sondern geradezu grob, wo es ihm nötig erschien. Was nicht nur zu Streitereien mit den empörten Schülern führte, sondern auch zu unliebsamen Kontroversen mit dem Inhaber des Konservatoriums, Herrn Julius Stern.
Lieber heute als morgen hätte Bülow diese lästige Beschäftigung aufgegeben, was er aber nicht durfte als junger Ehemann, der jetzt für eine Familie sorgen mußte.
Cosima war die sanftmütigere. Trotzdem mag es nicht selten bei dem lebhaften Temperament und heißen Blut der Gatten zu scharfer Rede zwischen beiden gekommen sein.
Immer neuer Berufsärger verschärfte die Lage noch.
Schon im Herbst 1853 hatte Cosima die Bekanntschaft auch Richard Wagners gemacht. In den Jahren 1857 und 1858 besuchte das junge Ehepaar Wagner in Zürich, der damals noch »auf dem grünen Hügel« lebte, dicht beim Hause der Wesendoncks und am »Tristan« arbeitete. Auch Wagners Gattin, Frau Minna geborene Planer, war damals noch anwesend. Frau Cosima mochte nach beiden Seiten hin beobachten, diese Frau Minna ebenso wie jene Mathilde Wesendonck, die schöne hochgebildete Frau – und Wagner inmitten der beiden.
Cosima verehrte den Freund ihres Vaters über alle Maßen. Von Jugend auf hatte sie diesen von ihrem Vater als ein Genie rühmen hören und später erst recht von dem eigenen Gatten. Auch in seine schriftstellerischen Werke vertiefte sie sich, obwohl das nicht leicht war für sie, die französisch erzogene Tochter einer französischen Mutter. Auch die tägliche Umgangssprache Liszts mit seinen Töchtern war die französische.
Auf jeden Fall hatten Franz Liszt und Hans von Bülow die kluge Cosima zur Verehrung und Anbetung Richard Wagners erst richtig herangebildet.
Als Wagner im Jahre 1863 die Bülows in Berlin aufsuchte, soll eine innige Zuneigung zwischen Wagner und Cosima aufgeblüht sein, obwohl Wagner zunächst noch stumm blieb in der Bezeugung tiefster Sympathie »für diese junge, ganz unerhört seltsam begabte Frau, Liszts wunderbares Ebenbild, intellektuell sogar über ihm stehend«.
*
Als Wagners Aufforderung bei den Bülows eintraf, sofort nach München überzusiedeln, gab es ausgedehnte Debatten über das Neue. Bülow freute sich über Wagners Hilfeleistung und Kameradschaftlichkeit. Wagner wußte, wie stark Bülow sich fortsehnte aus dem Berlin jener Jahre.
»Vorspieler des bayerischen Königs soll ich werden?« rief Bülow mit einem Lächeln. »Wird dieser junge lebenslustige König sehr oft das Bedürfnis haben, mein Klavierspiel zu hören? Ich glaube nicht daran, Cosima. Nur um den Titel wird es sich handeln, um dem Kinde einen Namen zu geben. In der Hauptsache werde ich für Wagner tätig sein müssen.«
»Ganz gleich«, meinte Frau Cosima lebhaft, »wir dürfen uns freuen. Der gewährte Ehrensold von zweitausend Gulden ist kein Geschenk: deine Zeit wird voll ausgenützt werden.«
»Wovon ich fest überzeugt bin. Ich werde aber auch dirigieren dürfen: mein ewiger Wunsch. Hoffentlich auch in der Hofoper, nicht nur in Konzerten. Wagner will zuerst seinen ›Holländer‹ aufführen lassen, wie er schreibt, der König ist einverstanden – alles sehr schön und gut! Ich traue nur den Münchnern nicht, den Banausen um den König herum. Es soll da noch sehr viel Abneigung gegen alles Norddeutsche geben, gegen die ›Preißen‹. Wagner und ich können da manches erleben.«
»Irgendwo mußt du doch sein, Hans. Auch in Berlin gefällt es dir nicht. Überall, wohin du kommst, wirst du Andersdenkende finden. Man muß lernen, sich einzufühlen und den Gegner richtig behandeln.«
Bülows Widerstand wurde bald schwächer. Seine Freude galt der ihn erwartenden Arbeit. Für alles andere würde Wagner schon sorgen.
»In seiner schönen Villa sollen wir vorläufig wohnen«, schwärmte Frau Cosima, »bis wir in München eine gute Wohnung gefunden haben. Darauf freue ich mich. Ich werde mich auch ein wenig um Wagners Häuslichkeit kümmern, er hat nur ein Dienerpaar um sich, den alten Mrazek aus Wien und dessen Frau als Köchin. Das ist zu wenig, wenn er seine volle Behaglichkeit finden soll, die er zum Arbeiten braucht.«
Bülows hatten zwei kleine Töchter, Daniela Senta und Blandine, vier- und zweijährig. Auch für diese freute die junge Mutter sich auf den bevorstehenden gesunden Aufenthalt in der freien Natur. Und für sich selber.
Aber immer neue Bedenken kamen dem ewig mißtrauischen Bülow. Er wußte aus Erfahrung, was die ihn umgebende »Masse Mensch« für einen Künstler bedeuten konnte. Bülow kannte München noch nicht, nur einige Münchner hatte er kennengelernt: sie gefielen ihm nicht.
Und dann dieser merkwürdige junge König, dieser noch viel zu junge König, der als erste Regierungstat diesen sonst nur angefeindeten und verspotteten Richard Wagner an seine Seite berief, weshalb dieser auch nur in Superlativen von ihm redete. Freilich: das wollte sehr wenig besagen. Wagner war schnell begeistert und achtete selten auf die wichtigen Nebendinge. Wo ein junger König war, gab es auch einen königlichen Hof, gab es königliche Verwandte und einen großen Kreis eingesessener Nutznießer um den Thron herum, die immer um ihren Einfluß bangten und um die damit verbundenen Emolumente. Neuankömmlingen brachten sie nicht das geringste Wohlwollen entgegen – im Gegenteil.
»Ein Dichter soll mit dem König gehn«, wandte Frau Cosima ein, wenn Bülow wieder einmal die Dauer von Wagners Wohlbefinden anzweifelte und den Neid der Götter fürchtete.
»Diese Dichter sollen so manches, sie tun es nur nicht, oder nicht lange. Auf solche Zitate gebe ich nichts: es sind Phrasen, die in der Praxis nicht standhalten: sie wurden nur wegen des Wohlklanges der Worte geprägt. Wehe dem Lande, wo ein König und ein Künstler einander beeinflussen. Sie denken und handeln auf ganz verschiedenen Ebenen. Nur in der Unverantwortlichkeit sind beide einander ähnlich.«
»Könige können helfen und fördern.«
»Gewiß. Aber, wie ich Wagner kenne, wird er es sein, der dem jungen Könige helfen will. Beim Negieren nämlich und in der Lebensanschauung. Das sollte er bleiben lassen.«
»Um so schlimmer für beide. Sie werden dann mit ihren Köpfen gegen Mauern anrennen, wobei gewöhnlich die Köpfe entzweigehen, nicht aber die Mauern.«
Ähnliche Unterhaltungen zwischen den Ehegatten gab es sehr häufig. Frau Cosima aber dachte gradlinig nur an das Ziel, das ihr vorschwebte, sie ließ sich nicht einschüchtern und bereitete emsig die Abreise vor.
*
Das Pelletsche Villenhaus war geräumig genug, um auch die Familie Bülow noch aufnehmen zu können. Dieser Aufenthalt am Starnberger See war nur für den Sommer gedacht. Im frühen Herbst sollte die Übersiedlung nach München stattfinden.
König Ludwig war vorübergehend nach Schloß Berg übergesiedelt. Von diesem bis zur Villa Pellet hatte man nur ein paar Minuten zu fahren. Jeden Nachmittag mußte Wagner gewärtig sein, zum Könige befohlen zu werden. Nur die Vormittage konnte er ungestört für seine eigene Arbeit verwenden.
Auch der junge freundliche Musiker und Maler Julius Hey stellte sich wieder ein. Er mußte regelmäßig nach Possenhofen, einem Örtchen weiter südlich am See gelegen, wo die Familie des bayerischen Herzogs Maximilian im Sommer ihr Schlößchen bewohnte. Hier erteilte Hey auch seinen Musikunterricht. Hier mußte er auch von Richard Wagner erzählen, den er schon einmal aufgesucht hatte. Hey hatte das Empfinden, daß die Verwandten des jungen Königs sich ununterbrochen mit der Person des »Lohengrin«-Komponisten beschäftigten. Der alte Herzog Maximilian hatte bereits seine Bedenken geäußert: »Wenn Herr Wagner seinerzeit in Dresden Revolution gemacht hat, so wird er das auch in München fortsetzen, denn die Katze läßt das Mausen nicht. Mindestens wird er allerhand bewährtes Altes umwerfen wollen, um Neues an dessen Stelle zu setzen, das keiner kennt. Damit wird Herr Wagner bei den Münchnern aber kein Glück haben.«
Die Kinder des Herzogs, vor allem die liebenswürdige liebliche Prinzessin Sophie, die jüngere Schwester der österreichischen Kaiserin Elisabeth, die den jungen Franz Joseph geheiratet hatte, war sehr neugierig auf den neuen Schützling ihres Vetters, des Königs. Bei der ersten Begegnung mit Wagner wollte sie diesem Partien der Elsa aus dem »Lohengrin« vorsingen. Julius Hey mußte das einstudieren.
Max, der Bruder Sophies, erzählte von dem Geflunker in München, daß der König seine beste Zeit mit zwecklosen Plaudereien mit Wagner zubringe, was aber nicht auf Wahrheit beruhe, im Gegenteil: Ludwigs Arbeitskraft habe sich seit dem Eintreffen Wagners beinahe verdoppelt. Auch seine Auffassung von den Staatsgeschäften habe an Einsicht und Ernst gewonnen.
Julius Hey freute sich über alles Gute, das er über König und Künstler vernahm.
*
Einige Tage später hatte Wagner ein merkwürdiges Erlebnis. Dieses zeugte davon, daß man in allen Landen von dem Seltsamen sprach, das Wagner begegnet war. Er, der phantastische Weltverbesserer und Idealist, der Umstürzler und Allesbesserwisser nahm jetzt eine einflußreiche Stellung an der Seite des jungen bayerischen Königs ein?
Alle horchten auf: Könige, Staatsmänner, Künstler und Pöstchenjäger. Dieses Novum konnte man bei Gelegenheit ausnützen, sobald man den bayerischen König brauchte.
Eines Tages ließ sich sogar Herr Ferdinand Lassalle melden, der sattsam bekannte marxistische Agitator und Revolutionär. Der Mann, der immer so tat, als ob er auch alles ganz ernst meinte, was er verteidigte. Er stand sogar in Fühlung mit hochintellektuellen Bürger- und Adelskreisen, und nicht nur im Inlande. Auch er hielt Richard Wagner für einen immer noch revolutionär eingestellten Gesinnungsgenossen. Diesmal kam er aber mit einem rein privatpersönlichen Anliegen.
In der Schweiz hatte er die Tochter des bayerischen Gesandten, ein Fräulein Helene von Dönniges, kennengelernt. Lassalle erläuterte Wagner, wie sehr er dieses Fräulein verehre, ja liebe. Leider biete des Fräuleins Vater ein unüberwindliches Hindernis. Herr Wagner möge doch veranlassen, daß König Ludwig ihn in Audienz empfange, damit Lassalle ihn über diesen Liebesfall aufklären könne. König Ludwig, der so romantisch empfindende, würde dann sicher seinen Gesandten veranlassen, jeden Widerstand aufzugeben.
Auch Hans von Bülow war anwesend, als dieser merkwürdige Bittsteller und Liebhaber seine Pläne entwickelte. Wagner aber, dem dieser Lassalle höchlichst mißfiel, lehnte sofort jedes Eingreifen ab: »Es ist mein fester Grundsatz, bei Seiner Majestät nur für sachliche, das heißt in meinem Falle künstlerische Dinge zu wirken, nie für Privatangelegenheiten.«
Lassalle mußte sich damit bescheiden: er hatte sich also in Wagner getäuscht: wahrscheinlich war auch er ein Verräter an der Sache des Volkes geworden. Nicht sehr viele Wochen später, am 28. August 1864, fiel Lassalle im Duell von der Hand des eigentlichen Bräutigams von Fräulein Helene von Dönniges. Auch über dieses Vorkommnis berichtete Wagner an Frau Eliza Wille in Mariafeld: »Ich gelte jetzt eben als allesvermögender Günstling. Neulich haben sich sogar die Hinterlassenen einer verurteilten Giftmischerin an mich gewendet.«
*
Die Bekanntschaft mit dem jungen Musiker Hey, der später bei den Einstudierungen in Bayreuth eine wichtige Rolle spielte, hatte eine neue Berufung nach München zur Folge.
Wagner vernahm mit Erstaunen, daß Hey seine Gesangsstudien bei dem früheren Opernsänger Schmitt in München getrieben hatte.
»Bei Schmitt? Ist das mein alter Freund Schmitt, der in jungen Jahren am Magdeburger Stadttheater Tenorrollen sang? Den Stradella sang er am liebsten. Damals war ich ganz junger Kapellmeister an dieser Bühne.«
Hey bestätigte das, er erzählte: »Schmitt ist heute in Leipzig tätig. Er ist ein tüchtiger Lehrer, konnte sich aber damals in München nicht halten. Er war zu unfreundlich zu seinen Schülern, ja sogar grob, beinahe tätlich. Auch seine Schülerinnen, junge Sängerinnen, bekamen kleine, aber ernst gemeinte richtige Rippenstöße von ihm, wenn sie Fehler beim Singen machten.«
Wagner lachte: »Das sieht ihm ähnlich; dann ist er es auch. Mein alter Schmitt! Wir sagen ›du‹ zueinander. Er sandte mir vor einigen Jahren eine neue Gesangsschule zur Begutachtung. Seine Methode hat unstreitige Vorzüge.«
Hey nickte zustimmend: »Schmitts Methode verlangt, daß gleichzeitig mit der Ton- und Stimmbildung des Schülers auch ein gründliches Studium der Schönheitsgesetze unserer Sprache verbunden werde, damit deren Ausdrucksvermögen besser zum Vorschein kommt.«
»Ganz richtig, mein lieber Herr Hey. Ich habe in dieser Hinsicht bei manchen Bühnen schon die ergötzlichsten und gleichzeitig auch entmutigendsten Dinge erlebt. Vor allem bei meinem ›Lohengrin‹. Dieses rohe Geschrei am Ende des ersten Aktes! Die Hauptabsicht aller Sänger ist eine möglichste Stimmentfaltung, damit der Zuhörer auch erfährt, welchen Tongewaltigen er zu bewundern hat. In der ersten Szene ist die Elsa noch zart und mimosenhaft. Plötzlich, gegen Ende des ersten Aktes, wird eine anspruchsvolle Primadonna aus ihr, die mit herausfordernden Gesten erhobenen Hauptes bis an den Souffleurkasten tritt, nur bemüht, durch Überschreien der anderen Sänger sich einen ausgiebigen Applaus zu verschaffen. Erliegt dann auch Lohengrin dieser Verlockung und König Heinrich, als Dritter im Bunde, der sich unter Aufgebot aller Stimmittel mit gezücktem Schwerte in der Mitte aufbaut, dann läßt der gewaltige Opernlärm nichts mehr zu wünschen übrig. Musikalische Kunst – wie jede Kunst überhaupt – soll aber immer nur schön sein, nie aufdringlich.«
Hey mußte lachen. Er wollte aber wieder von Schmitt reden. Diesem gefiel es auch in Leipzig nicht mehr. Ob Herr Wagner ihn für seine umfassenden künstlerischen Reformpläne nicht brauchen könne?
Wagner zuckte die Achseln und erzählte Stimmungsbilder über Schmitt aus jener dreißig Jahre zurückliegenden Zeit. Schmitt sei wahr und aufrichtig gewesen, aber ein »Allesverbesserer« und »Grobschmied«, sogar gegen die eigenen Kollegen, mit denen er auf der Bühne zu tun hatte. »Ich werde aber versuchen«, versprach Wagner, »den König auch für Schmitt zu begeistern. Vielleicht gelingt es uns, mit Schmitts Beihilfe brauchbarere Sänger heranzubilden. Schmitt kennt vielleicht einige. Wie soll ich auch sonst des drängenden Königs Wunsch befriedigen, der durchaus Neueinstudierungen meiner älteren Opern verlangt?«
Beim Abschiede sagte Wagner: »Schmitt soll die Vorzüglichkeit seiner Lehrmethode durch gute Sänger nachweisen, die bei ihm lernten. Falls er das kann, soll er willkommen sein. Teilen Sie Schmitt das mit.«
Freudiger Stimmung bei der vorhandenen Aussicht, seinem verehrten Lehrer helfen zu können, fuhr Hey nach München zurück.
Wagner aber ging zu Rate mit sich, wie er dem Könige am schnellsten plausibel machte, daß das gesamte Münchner Musikschulwesen einer gründlichen Verbesserung bedürfe. An Beweisen hierfür fehlte es nicht.
*
In Wirklichkeit lag die staatliche Musikschule, das Konservatorium, seit langem in Agonie. Das Kultusministerium wußte das auch. Der augenblickliche Leiter des Ganzen war der Geistliche Rat Nissl, ein älterer Herr, ohne jeden Ehrgeiz zu zeitgemäßen Reformen und ganz bestimmt kein Befürworter neuesten Wagnerschen Opernstils.
König Ludwig ging sofort auf die Vorschläge Wagners ein, dessen Forderungen zur Heranbildung fähigerer Sänger er schon aus Wagners Druckschriften kannte. Ludwig deutete an, daß es ihm am liebsten wäre, wenn Wagner selbst die Zügel ergriffe.
Wagner wehrte sich aber. Er hatte nicht die geringste Neigung, sich in diesen Kessel brodelnder Schwierigkeiten zu verlieren, die ihn von seinen anderen Arbeiten vollständig abziehen würden. Der von ihm, Wagner, vorgeschlagene neue Opernstil würde von den bisherigen Hütern einer streng orthodoxen Musikerziehung sofort als irrsinnig oder verbrecherisch gebrandmarkt werden. Wagner waren die Ansichten dieser Herren Behüter mehr als geläufig, schon aus ihren Kritiken in den Musikzeitschriften, sobald diese Wagnersche Opern besprachen.
Der merkwürdigste Vertreter dieser mumifizierenden Richtung war der Münchner Musikprofessor Riehl von der Universität. Dieser vertrat den erheiternden Standpunkt, daß eigentlich schon Beethoven der erste große musikalische Verderber und Umstürzler gewesen sei. Mit Sebastian Bach sei die Reihe der echten Musiker eigentlich abgeschlossen gewesen.
Sollte Wagner mit solchen Gralshütern sich etwa in Kontroversen und Debatten einlassen? Nein, mein lieber, junger, herrlicher König, das tun wir nicht! »Dagegen werden einige meiner jüngeren Freunde, die ich als Könner sehr hochschätze, meinem Rufe an die Musikschule Folge leisten, Majestät.«
»Wer würde das sein, Meister?«
»Außer Hans von Bülow, den wir schon hier haben, und Peter Cornelius, der noch in Weimar zu tun hat, vielleicht Karl Klindworth, ein Klavierpädagoge, auch Dirigent. Ferner der junge Heinrich Porges aus Prag.«
»Sie nannten noch keinen Gesangspädagogen?«
»Majestät – hierfür wird Friedrich Schmitt der richtige sein, ein alter Kumpan von mir, der schon in München war. Er kennt die hiesigen Menschen. Er hat hier nichts Gutes erlebt, er zankt sich mit allen. Er besitzt ein rauhes Gemüt.«
Ludwig lächelte: »Da wird er bei meinen Münchnern, die selbst über rauhe Gemüter verfügen, sich ein wenig beherrschen müssen.«
Wagner nickte: »Das wird er schon tun, wenn ich ihn instruiere. Die Lehrer für die Musikinstrumente entnehmen wir der königlichen Hofkapelle und dem Opernorchester. Es müssen vorzügliche Praktiker sein: Theoretiker nützen uns nichts.«
Ludwig fühlte sich immer befriedigt von solchen Aussprachen. Man hatte ihm Wagner als Illusionisten geschildert, der unausführbare Lehren verfechte. Ludwig fand alles logisch und zielbewußt, was Wagner an Forderungen aufstellte. Man kam gar nicht in Versuchung, Einwände zu erheben. Ludwig hatte den Meister bereits aufgefordert, eine alle Einzelheiten berührende ausführliche Planung für eine neu zu gründende bayerische Musikschule zu Papier zu bringen, an welcher Wagner zur Zeit auch schon arbeitete.
Am ungeduldigsten war König Ludwig in bezug auf die Neueinstudierungen Wagnerscher Opern, auch des »Holländers«. Wenn hierbei Gutes zustandekam, stand Ludwig selbst allen Warnern gegenüber als der Mann kluger Voraussicht da, der das Rechte tat, als er Wagner an seine Seite berief, damit München auch musikalisch zu einer bewunderten Kunststadt wurde.
*
Was sagten die Münchner zu Richard Wagner?
Das damalige München kann mit dem heutigen in keiner Weise verglichen werden. Das öffentliche und familiäre Leben spielte sich noch in patriarchalischen Formen ab, München war eine Residenzstadt wie jede andere, jede Kaste lebte getrennt von der anderen, und alle Fremden, die man heute zu hegen und zu pflegen gelernt hat, sah man damals mit scheelen Augen an. Man war mit sich selbst zufrieden und brauchte keine neuen Ideen.
Verschiedene Kasten? Da waren der Hof und die Adelskreise, die klerikalen Kreise mit großem Anhang; dann die Künstler: Maler, Bildhauer, Dichter, während die Sänger, Schauspieler und Musiker sich wieder abseits hielten. Man nahm diese weniger wichtig als die bildenden Künstler. » Noli me tangere« rief die eine Kaste der anderen zu.
Der verstorbene König Max hatte bekanntlich viele Künstler und Dichter aus dem Norden berufen, und durchaus nicht zur Freude der Einheimischen. Die Münchner nannten diese Fremden immer die »Nordlichtln«, und staunten sie vorwurfsvoll an. Also waren diese »Nordlichtln« auf sich selbst angewiesen. Die Künstler nannten ihren Kreis »Musenhof«. Außer markanten und anerkannten Künstlern gehörten diesem auch »Unberufene« an, die Anschluß gefunden hatten. Alle waren ein wenig aufeinander eifersüchtig, gemeinsam war ihnen nur die warme Anbetung der strahlenden königlich bayerischen Gnadensonne.
Den eingeborenen Münchnern erschienen diese Norddeutschen, nicht immer mit Unrecht, als aufdringliche Nutznießer, sie fühlten sich selbst übersehen und zurückgesetzt in ihren Belangen. König Max wiederum kamen diese Norddeutschen weltgewandter und ergiebiger vor. Zu diesen »Nordlichtern« gehörten auch die Dichter Franz Bodenstedt, der Verfasser der Mirza-Schaffy-Lieder, Emanuel Geibel und die Maler Moritz von Schwind und Wilhelm Kaulbach.
Namentlich die letzteren waren sehr stolze und unzugängliche Herren, bei deren Zusammenkünften das Durchhecheln der Werke ihrer Kollegen den beliebtesten Gesprächsstoff bildete: da flogen richtig die Späne!
Als man Schwind und Kaulbach und noch einige andere eines Tages durch eine Tür belauschte, hörte man öfter die Worte: Kälber, Ochse und Rindvieh aufklingen. Man fragte Kaulbach: »Ihr spracht heute soviel von der Landwirtschaft? Warum denn?«
»Von der Landwirtschaft?« staunte Kaulbach, »nein, wir haben nur von der Kunst gesprochen!«
Auch Paul Heyse verkehrte in diesem Kreise, als Haupt der Münchner Dichtergilde der »Krokodile«. König Max lud diese norddeutschen Geisteshelden oft zu sich ein. Gespräche über Literatur und Wissenschaft waren die liebste Erholung des Königs, zu dessen Verkehrsgästen auch Graf Friedrich Schack gehörte, der Begründer der berühmten Gemäldegalerie.
*
Hans von Bülow machte Wagner den Vorschlag, Eingang in diese Kreise der anderen Norddeutschen zu suchen, um seiner gesellschaftlichen Stellung eine breitere Basis zu geben, was nur nützlich sein konnte. Wagner sträubte sich nicht und machte seine Besuche.
Diesen Zugeknöpften erschien der ganze Richard Wagner aber nur als eine vorübergehende Marotte des jungen unerfahrenen Königs, sie blieben auf Ironie und Skepsis eingestellt und erzählten überall Anekdoten, deren tragikomischer Held er war. Auch kannten die Literaten unter den Musen-Verbundenen seine Schriften und Dichtungen. Man behauptete, daß Wagner alle überlieferten Sagen der germanischen Mythologie nochmals umdichten wollte, was heiter stimmte. Diese Vielbelesenen, die die Nibelungensage aus Urtexten kannten, hatten schon festgestellt, daß Wagners »Nibelungen«-Dichtung frei erfundene Figuren und Charaktere enthielt, die zu Zweifel und Spott herausforderten ob ihrer Verstiegenheit. Das erweckte keinen Respekt, und mochte der junge König noch soviel von diesem Phantasten halten.
Paul Heyse, Emanuel Geibel und Bodenstedt brachten Wagner sogar offene Ablehnung entgegen. Auch Kaulbach mochte nichts von ihm wissen, obwohl er mit Franz Liszt bekannt und befreundet war. Moritz von Schwind kannte Wagner bereits von Dresden her, auch dort hatte er ihn schon nicht leiden mögen. Alle Bemühungen Gutmeinender, diese Koryphäen der Kunst Wagner geneigter zu machen, blieben auch in der Folge ergebnislos.
Nur der jetzt in München lebende Maler Friedrich Pecht, den Wagner in seiner Pariser Notzeit kennengelernt hatte, blieb ihm befreundet und zugänglich. Pecht malte aber nicht mehr, er hatte den Pinsel mit der Gänsefeder des Kunstrezensenten vertauscht. In Münchner Kunstkreisen war auch er daher nicht besonders beliebt. Im damaligen München mit seiner mehr burschikosen Einstellung gegenüber allen geistigen Dingen betrachtete man alle Kunstkritik eher als eine ganz überflüssige, schädliche Einrichtung.
Auch das Münchner Witzblatt, der vielgelesene »Punsch«, hatte bereits Notiz genommen von Richard Wagner. Er brachte schon am 26. Juni 1864 folgende Parodie im Wagnerstil: »Renk und Lachsfräulein, zukunftsmusikalische romantische Oper von Richard Wagner.«
Renkenjüngling:
Ha! –
(Akkord) Wie? –
(verstärkter Akkord) Oh!
(längere Musik.)
Liebe hat mein Herz bewegt, ja Liebe
Zur Tochter eines Silberlachses.
Und ich versprach der jungen Lächsin
Sie zu besuchen –
(Violinspiel)
Heute noch!
(andauerndes Tongemälde.)
Am Ufer ist das Stelldichein
Im Sandgeröll und Sonnenschein.
Doch wenn's der Vater wüßt', der alte Lachs,
Weh' mir, ich wär' sofort verschlungen.
Und Silberlachs und Renk, welch' eine Mesalliance,
Ein Bastardvolk nur könnte draus entstehen.
Lachsfräulein (schwimmt hin und her):
Laue, liebliche Lüfte, Labsal, Labsalala!
Trag mich, treib mich, trauliche Welle, Tralala!
Lustige Laichzeit lachender Lachse, Lachsalala!
Ob er wohl kommen wird?
(Der Renk schwimmt auf. Beide umflossen sich zärtlich.)
Renkenjüngling: Horch – Siehe! Was ist das?
Lachsfräulein: Ein glänzendes, sich drehendes Fischlein. Ich will's verspeisen.
Renkenjüngling: Um Gottes willen, zurück! Das ist ein Köder. Siehst du den Haken?
Unbesonnene, wenn
ich nicht wäre –!
Lachsfräulein (schwärmerisch): Ja, wenn du nicht wärst! (Sie streichelt ihm die Kiemenflossen.)
NB. Herr Richard Wagner hat während seiner Anwesenheit am Starnberger See bereits ein neues Opernwerk entworfen, aus welchem wir Obiges mitzuteilen in der angenehmen Lage sind.
NB. Renken sind eine Art Fische plebejischer Art, die im Starnberger See vorkommen.«
Am 7. Mai 1864 lief folgende Notiz durch die Münchner Presse: »Seit einigen Tagen weilt Richard Wagner in unserer Stadt.« Diese Notiz war für den weitaus größten Teil der Bevölkerung von keinem Interesse. Erst als bekannt wurde, daß König Ludwig Wagner in Audienz empfangen habe und ihm aus der Kabinettskasse eine jährliche »Sustentation« zahle, murrte ein schlimmer Philister darüber, daß schon wieder »hungerige Preußen nach Bayern berufen würden, damit sie es sich mit bayerischem Gelde gütlich tun und dafür über bayerische Zustände schimpfen könnten, gerade als ob wir in Bayern nicht selber genug gute Musikanten hätten und noch einen bräuchten, der überall Schulden gemacht hat und gar von seiner Frau geschieden ist.«
Dieser unbedeutende kleine »Wagnerschrecken« legte sich aber bald. Die Uninteressierten sahen bald ein, daß es sich nur um die Ausführung eines glücklichen und edlen Gedankens des jungen Königs handeln konnte, wenn er einem bedeutenden Musiker, der eigentlich keinen festen Wohnsitz besaß, einen solchen in München bot.
Anders wurde es, als Wagner Anfang Herbst sein Haus in der Briennerstraße bezog. Leute, die sich in ihrer Stellung oder Bequemlichkeit bedroht fühlten, äußerten ernste Befürchtungen. Der bayerische Adel sah in Wagner nur noch den Demokraten, den ehemaligen Barrikadenkämpfer, der jetzt der böse Dämon des jungen unerfahrenen Königs geworden war und anderen den Weg zum Throne versperrte.
Bei der Geistlichkeit erregte der Heide Wagner Besorgnis, der dem Könige die Schriften Ludwig Feuerbachs empfohlen haben sollte. Von den Münchner Musikern bekämpften die meisten Wagners Zukunftsmusik als grobe, unkünstlerische Verirrung. Auch irritierte es diese kleineren Musiker, daß Wagner sich in Fürstengunst sonnen durfte, während sie selbst unten im Schatten zu vegetieren gezwungen waren.
Viele Musiker aber bekämpften die »Wagnerclique«, wie man Wagner und seine Freunde bald nannte, nicht wegen deren künstlerischen Schaffens, sondern so mancher persönlicher Mängel wegen, die immer wieder vor der Öffentlichkeit erörtert wurden.
Es läßt sich gar nicht leugnen, daß die Unbeliebtheit Wagners und seiner Genossen nicht nur giftigem Neid und schlimmer Bosheit törichter Nörgler entsprang, sondern daß die Angegriffenen auch ein wenig selbst die Schuld trugen. Sie fühlten sich überlegen und unangreifbar, weil der König ihnen die Stange hielt, der selbst von seinen Münchnern nicht immer erbaut war.
Soweit war es aber noch nicht, als Wagner die ersten Wochen und Monate in seinem Münchner Hause zubrachte, das erst eingerichtet sein wollte.
Vorläufig wurde es also noch nichts mit dem Fußfassen Wagners in Münchner Gesellschaftskreisen. Hier mußte die Zeit wirken und vor allem ein allerbestes Gelingen der Wagnerschen Opernkunst. – – –
Nicht immer residierte König Ludwig auf seinem Schlößchen Berg am Ufer des Sees bei Starnberg. Schon seit Knabentagen weilte er noch lieber im Schlosse Hohenschwangau in den Bayrischen Alpen, in der Nähe von Füssen im Allgäu. Das Leben in den Bergen stimmte ihn fröhlich, die königliche Residenz im nebligen München engte ihn ein. Hohenschwangau hatte auch historische Tradition. Hier hatten schon im Mittelalter Wittelsbacher gehaust, es lag nicht weit von der uralten römischen Heerstraße, auf der schon Friedrich Barbarossas Streiter gen Italien zogen oder wieder von dort zurückgekehrt waren.
In den Herbsttagen mußte Wagner König Ludwig auch in Hohenschwangau besuchen. Hier wurden die Münchner Besprechungen über alles neu zu Unternehmende fortgesetzt. Es handelte sich diesmal um allgemeinere Pläne Wagners und des Königs zur Hebung des deutschen Theaters. Nach Wagners ein wenig allzuweit greifender Idealistik sollte dieses Theater dem Geschäftsbetriebe entzogen werden. Erst später, in Bayreuth, wurde Wagner am eigenen Leibe darüber belehrt, daß auch ein ideal gepflegtes Kulturunternehmen ohne vernünftige Geldwirtschaft nicht zu bestehen vermochte.
Wagner tadelte an den bestehenden Theatern auch die Tatsache, daß nirgends die Werke der Dichter den Menschen in der Form dargeboten würden, wie die Dichter sie aufzeichneten, überall herrsche nur geschäftige Willkür und Effekthascherei.
Schon vorher hatte Ludwig an Wagner geschrieben: »Meine Absicht ist, das Münchner Publikum durch Vorführung ernsterer, bedeutenderer Werke wie diejenigen von Shakespeare, Calderon, Mozart, Gluck, Weber in eine gehobene, gesammelte Stimmung zu versetzen, nach und nach dasselbe jener gemein-frivolen Tendenzstücke entwöhnen zu helfen, und es so vorzubereiten auf das Wunder Ihrer eigenen Werke.«
Also hatten zwei ganz echte Idealisten einander gefunden: Ludwig und Wagner, König und Künstler. Man durfte gespannt darauf sein: »was daraus wurde.«
*
Bülow, der kühlere Denker, war immer noch nicht hoffnungsfreudiger geworden, seitdem er in Wagners Nähe weilte und einen tieferen Einblick in die neue Lage gewonnen hatte.
Sofort nach dem Eintreffen Bülows, dem seine Frau Cosima mit den Kindern vorausgeeilt war, führte Wagner ihn beim Könige ein. Seine Besoldung sollte nach der gleichen freien Weise gestaltet werden, wie König Max sie bei seinen eigenen Berufungen gehandhabt hatte. Bülow konnte also beruhigt sein.
Ludwig hatte sehr viel Freude an Bülows Klavierspiel. Er äußerte bald darauf, daß er Bülow schon sehr bald liebgewonnen habe. Besonders gefiel Ludwig die unbestechliche Offenheit Bülows, bei dem es niemals ein verstecktes Gerede über Dinge und Menschen gab, wie bei anderen Geistigen in der Umgebung des Königs.
Seinen Berlinern bewahrte Bülow immer noch ein unrühmliches Gedenken, was manche Münchner mit ihm versöhnte, vielleicht auch König Ludwig gefiel. Bülow sagte einmal: »Nach einem Rosenbette lechze ich durchaus nicht. Nur nach einem möglichen Terrain, einem weniger sterilen und sterilisierenden, als dem Berliner.« Bülow hatte versucht, in Berlin den Lisztschen und Wagnerschen Kompositionen Eingang zu verschaffen, indem er sie immer wieder zu Gehör brachte, in allen Konzerten. Aber Unverstand und Böswilligkeit verhinderten das. Der Geiger Joachim, der am Sternschen Konservatorium maßgebenden Einfluß ausübte, verbot den Schülern den Besuch Bülowscher Konzerte und das Anhören von Wagners Musik. Es gelang also nicht, diese »muffigen, trockenen Berliner zu einem neudeutschen Berlin zu erziehen und von ihren Vorurteilen zu entpöbeln«, wie Bülow sich einmal ausdrückte.
Schon Anfang Oktober gab es im Schloßhofe der königlichen Residenz ein Ständchen, dargebracht von den Münchner Militärkapellen, denen Wagner seinen neu komponierten »Huldigungsmarsch«, aber auch Stücke aus »Lohengrin« und »Tannhäuser« einstudiert hatte.
*
Endlich war Wagner auch mit dem Generalmusikdirektor Franz Lachner in Verbindung getreten. Nach außen hin erfolgte das in größter Freundschaft. Lachner hütete sich, irgendwelche Gegnerschaft Wagner gegenüber sich anmerken zu lassen. Auch Wagner war sehr freundlich, heiter und rücksichtsvoll, was er sehr gut verstand, wenn er entgegenkommend sein wollte; viel besser als Bülow, dem das Herz immer auch auf der Zunge saß.
Franz Lachner war schon seit vielen Jahren in München tätig, und seine Macht schien unangreifbar zu sein. Er verdiente hohes Lob, mit dem auch weder Wagner noch Bülow kargten. Es war ihm gelungen, sein großes Hoforchester zu einem festgefügten Instrument zu erziehen, durchaus nicht ohne Kampf mit den Widerwilligen, welche den Schlendrian liebten. Jetzt war er hochangesehen, besonders in Hofkreisen und bei der alten Adelsgesellschaft.
Auch der noch lebende ehemalige König Ludwig I., der Großvater des jetzigen Königs, besuchte noch die Lachnerschen Konzerte im Odeonssaale, die ein Stelldichein der vornehmsten Kreise waren, obwohl er bei seiner zunehmenden Schwerhörigkeit kaum viel Genuß haben konnte. Alle Besucher aus den Kreisen des eleganten Stammpublikums kannten einander.
Der prachtvolle alte Ludwig war ein Original.
Es war seine Gewohnheit, während der Konzertpause im Odeon im Mittelgange zwischen den Tischreihen auf und ab zu gehen, bald diesen, bald jenen mit einer Ansprache auszeichnend. Einer sehr schönen Dame rief er dann jedesmal zu: »Was macht der Herr Gemahl? Ist er recht eifersüchtig?«
Auf das »Nein, Majestät«, der Dame wehrte er ab: »Glaube ich nicht, glaube ich nicht.«
Als er nach Jahren längeren Aufenthalts in Italien, nach seiner Thronentsagung, wieder einmal in München war, sah er die inzwischen älter gewordene Dame immer noch auf ihrem Eckplatze sitzen. Er erkannte sie und rief sofort: »Nun, was macht der Gemahl? Ist er immer noch eifersüchtig?« Auf die verneinende Antwort der Dame rief er lachend: »Glaube ich gern, hat's auch gar nicht mehr nötig.«
Noch vieles andere erzählte man von dem lebenslustigen alten Herrn. Bei einer Wagenfahrt im Gebirge bemerkte er vor einem Hause die Anstalten zu einer Bauernhochzeit: Kränze und Girlanden bis zum Giebel hinauf. Sofort ließ er den Wagen halten, worauf er ausstieg: »Will die Braut sehen, die Braut!«
Er ging auch ins Haus, kam aber bald wieder zurück, indem er heftig den Kopf schüttelte: »Pfui Teufel, wie garstig, wie garstig!« Der Wagen fuhr schleunigst davon.
*
Franz Lachner hatte mit Wagner bereits alles die Einstudierung des »Holländers« Betreffende ausführlich besprochen. Jetzt wollte er mit den Proben beginnen. Er setzte es als selbstverständlich voraus, daß er nicht nur diese Proben, sondern auch die Aufführung leiten würde. Den ersten Orchester- und Sängerproben wohnte Wagner als Zuhörer bei. Er hatte schon richtig geahnt: Herr Franz Lachner hatte wieder einmal mit dem Rotstift gearbeitet und fortgestrichen, was ihm zu lang erschien. Da erhob sich Wagner eines Tages und legte sein Veto ein. Hier in München durfte er das, glaubte er, weil der König hinter ihm stand.
Er trat zu Lachner heran und sagte: »Seine Majestät hat mir erlaubt, die Proben notfalls selber zu leiten, Herr Lachner. Ich möchte das tun. Der König will meinen ›Holländer‹ ungekürzt, nicht aber mit Lücken aufgeführt haben. Ich danke Ihnen für Ihre bisherige freundliche Beihilfe.«
Lachner wurde rot vor Empörung, aber er mußte gehorchen. Er hatte Anweisung vom Königlichen Kabinett, Wagners Wünsche in jeder Beziehung auch zu berücksichtigen. Trotzdem hatte er nicht erwartet, daß Wagner den Taktstock ihm aus der Hand nehmen würde. Das sollte er büßen! Alle sollten es erfahren, alle Großen vom »Musenhofe«, die bei Hofe immer noch eine gewichtige Stimme hatten. Sofort erbat Lachner Urlaub für die gesamte Zeit der geplanten Wagneraufführungen.
In Freundeskreisen bemitleidete man den Ausgeschalteten, konnte aber nicht verhindern, daß die am 4. Dezember stattfindende Münchner Uraufführung des »Holländers« zu einem großen Erfolg wurde. Das große Publikum war sehr neugierig auf diesen neuesten »Wagner«, dessen Komponist jetzt schon wiederholt in den Zeitungen erwähnt worden war. Der »Holländer« gefiel den Münchnern, schon weil er neu für sie war und schöne sangbare Melodien aufwies.
Die Freude König Ludwigs war grenzenlos: er hatte recht behalten mit seinem Vertrauen zu Richard Wagner!
*
»Nun aber den ›Lohengrin‹ und den ›Tannhäuser‹, Meister«, rief Ludwig begeistert und ungeduldig, »und vor allem den göttlichen ›Tristan‹!«
»Für den ›Tristan‹ brauchen wir Sänger, Majestät, die noch nicht da sind.«
»Ihr Freund Schmitt in Leipzig sollte doch welche verschaffen? Warum kommt er nicht und bringt sie uns mit?«
»So weit scheint es noch nicht zu sein«, sagte Wagner. »Schmitt mag ein paar gut abgerichtete Sängerchen in seiner Schule haben, kaum aber einen Tristan oder eine Isolde. Ich habe eine ganz andere Idee.« Und Wagner erzählte seinem Gönner von einem prachtvollen Sängerpaare Schnorr von Carolsfeld, das an der Hofoper in Dresden auftrete. Schnorr habe den Tristan bereits vor zwei Jahren in Wagners damaligem Heime in Biebrich am Rhein gesungen. Er sei ein phänomenaler Sänger allergrößter Bedeutung mit einer echten Heldenfigur.
»Dann soll er kommen«, rief Ludwig, »zögern wir nicht, Meister. Leiten Sie das sofort in die Wege!«
»Ich will mein möglichstes tun.«
Wagner war nicht ganz zuversichtlich. Die Dresdner Theaterverhältnisse kannte er aus eigener Erfahrung. Hundert Instanzen gab es dort, die alle mitsprechen wollten.
»Sie sollen uns den Schnorr nur borgen, nicht abtreten«, betonte Ludwig.
Man hatte aber viel Glück. Die Dresdner Hofoper sträubte sich kaum. Man wollte dem bayerischen König keinen Wunsch abschlagen, vielleicht aus politischen Gründen. Denn es stand nicht alles sehr gut zwischen den beiden Siegerstaaten Preußen und Österreich nach dem dänischen Kriege. Sachsen neigte zu Österreich, und neben Österreich stand Bayern, die Heimat der österreichischen Kaiserin. Herrn Wagner zuliebe beurlaubte man das Schnorrsche Ehepaar keinesfalls, denn man hatte ihn noch in schlechtem Andenken in Dresden, wo er freundliches Entgegenkommen mit schnödem Undank vergolten hatte, indem er, mit anderen Revolutionären gemeinsam, die sächsische Monarchie stürzen wollte.
Hans von Bülow freute sich schon auf den »Tristan«, bei welchem er zum ersten Male ganz selbständig schaffen durfte. Der König und Wagner sollten sich nicht in ihm getäuscht haben, dafür wollte er sorgen.
Bald darauf besuchte der junge Musiklehrer Julius Hey den Gesangspädagogen Schmitt in Leipzig – im Auftrage Wagners.
Sofort schimpfte Schmitt heftig auf seine Schüler, anstatt sie für Wagners Bedürfnisse zu empfehlen: »Keiner ist zum Anhören, wenn er kommt. Halb fertig dressiert, laufen sie mir davon, an ein Theater, wo der Kapellmeister alles wieder an ihnen kaputt macht, was sie bei mir gelernt haben.«
»Alle Gesangslehrer klagen darüber, Herr Schmitt.«
Schmitt wurde wütend. »Wie können Sie von anderen Gesangslehrern sprechen, Hey? Sie wissen doch, daß es außer mir gar keine gibt? Alle sind Pfuscher und Stimmenverderber.«
Schmitt ließ dann einige seiner Schüler Probe singen. Sie konnten schon einiges, aber keine Partien aus Wagnerschen Opern. Trotzdem nahm Hey seinen früheren Lehrer mit sich nach München zu Wagner. Schmitt ließ sofort einige seiner besten Schüler mitgehen. Als man in München ankam und die jungen Sänger erfuhren, daß sie vor Wagner singen sollten, bekamen sie Angst und reisten sofort wieder ab, die Feiglinge, zu Schmitts größtem Entsetzen. Er wurde sogar krank vor Ärger und mußte das Bett hüten.
Um seine neue Gesangsmethode an einem leibhaften Sänger vorführen zu können, mußte Julius Hey, der frühere Schmittschüler, selbst zu singen beginnen, was ihm sehr unlieb war. Schmitt erläuterte zwischen den einzelnen Vorträgen vor Wagner seine neueste Theorie der Stimmbildung.
»Gut«, sagte Wagner, »du hast mich beinahe überzeugt, ich kann dem König Gutes melden. Du kommst also wieder nach München. Nur – du darfst nicht mehr grob werden.«
Schmitt versprach, sich zu bessern.
Also sollte er in München jetzt Wagnersänger heranbilden, und zwar in einer privaten Opernschule, die mit dem neu zu errichtenden Konservatorium nichts zu tun haben sollte. König Ludwig war einverstanden und wollte bei allem helfen. Auch Hans von Bülow wollte sich an dieser Privatopernschule betätigen.
»Jetzt fängt es erst richtig an«, schrieb Wagner an Frau Eliza Wille, »aber ich fühle mich wohl dabei. Endlich soll mein ›Tristan‹ herauskommen, was in Wien nicht gelingen wollte. Am herrlichsten aber erscheint mir die unendliche Güte und Zuneigung des jungen Königs. Möge der Himmel ihm noch unendlich viel Gutes und Schönes bescheren!«
*
»Bewahre dir frischen Mut, gesunde Lungen und kräftige Fäuste für die Ausführung unserer Pläne«, hatte Wagner noch zu Schmitt, dem Gesangspädagogen, gesagt, »denn die werden wir brauchen. Die gemeinsame Arbeit wird uns beide gesund und jung erhalten.«
Schmitt aber quälte die Sorge: würde Wagner auch durchhalten und bei der Schmittschen Gesangstechnik bleiben? Würde er sich mit diesen Einzeldingen auch genügend beschäftigen können, er, der nur die Einstudierung seiner Opern im Kopfe hatte?
Inzwischen erregte die Berufung schon wieder neuer, fremder Musikmenschen nach München auch neuen Unmut bei den Alteingesessenen. Kapellmeister Franz Lachner hielt bereits seine Stellung für untergraben. Wahrscheinlich würde Wagner sein Nachfolger werden wollen. Hierin täuschte Lachner sich freilich gründlich. Wagner hätte nicht um die Welt einen Kapellmeisterposten in München angenommen, noch dazu unter dem Oberbefehl irgendeines Intendanten aus Hofkreisen. Nur an seinen noch unvollendeten Werken wollte er schaffen, zunächst am »Ring des Nibelungen«, augenblicklich am »Siegfried«.
Aber nicht nur die kostspieligen Berufungen erregten den Unwillen der Bürgerkreise. Man begann an Wagner selbst zu mäkeln, an seinem Privatleben. Man hatte von neuen geldlichen Zuwendungen des Königs an Wagner erfahren.
Das Wagner überwiesene Jochumsche Haus in der Briennerstraße kostete den König dreitausend Gulden im Jahre Miete, das war nicht billig. Herr Wagner hätte auch billiger wohnen können. Außerdem hatte der König Wagner noch eine außerordentliche Zulage von zweitausend Gulden zu den schon gewährten viertausend bewilligt. Wagner bat dann noch um ein sofortiges Geschenk von fünfzehntausend Gulden »teils für eine schöne, meinen Wünschen entsprechende Einrichtung des gemieteten Grundstücks, teils zur Erledigung hinter mir liegender Mietsverbindlichkeiten und anderer alter Verpflichtungen. Ich würde dann keinerlei neue Anforderungen mehr zu stellen haben«.

Ludwig II. als junger König

Franz Liszt und Hans von Bülow
Daß jemand zur Einrichtung einer Privatwohnung fünfzehntausend Gulden benötigte, wollte den Münchnern nicht einleuchten. Diese, selbst in gehobeneren Stellungen, waren damals in ihren Lebensbedürfnissen derart einfach und anspruchslos, daß jeder Luxus als sträfliche Verschwendung oder gar Narrheit erschien. Es war dem Münchner Bürger unverständlich, daß eine farbenprächtige, den Sinnen schmeichelnde Umgebung für einen Künstler von Bedeutung sein könne. Sehr bald nannte man Wagner einen Ausbeuter der königlichen Freigebigkeit.
Bald darauf brachte auch der witzige Münchner »Punsch« eine Beschreibung des Wagnerschen Schlafzimmers: Samttapeten, Seidenvorhänge, Spiegelplafond mit gemalten Fresken. Am Fenster ein kleines Orangewäldchen, wo von Zeit zu Zeit eine reife Frucht abfällt. Der Waschtisch befindet sich in einer Felsengrotte mit wohlriechendem Moos, mit Efeu und Buchsbaum bepflanzt. Aus dem Felsen entspringen zwei Quellen: eine kalte und eine warme. Links und rechts wachsen die feinsten Schwämme.
Rumorhäuser, der große Komponist, erwacht in seinem Bett, streckt sich, aber nicht nach der Decke, sondern in die Breite und reißt an einem Glockenzuge. Man hört das Trompetensignal aus »Lohengrin«.
Kammerdiener erscheint und bringt eine große silberne Platte, auf der zwölf Paar neuer, verschiedenfarbiger Socken liegen.
Rumorhäuser: Man bringe mir den Katalog meiner seidenen Schlafröcke! Rumorhäuser komponiert alsdann zwei neue Arien, die er beim Anziehen singt. Die eine für Tenor: »Oho! Ohe! Ha-Hi-Ha-Ho! Ollaho! Ollahe! Ha, Hu! Heijoh! Hollahihahi!«
Die andere für Sopran: »Eia, popeia! Tralala, walala! Wugala weia!«
Wagner nahm diese ersten Krisenzeichen nicht ernst. Er lachte darüber. Er dachte an die nur allerbesten Früchte, an denen die Wespen nagten.
Ärger beeindruckten ihn die überall sich ihm darbietenden Widerstände und Gegenbemühungen der Leute um den König herum. Ludwig hatte ihm schon berichtet, daß Leute im wagnerfeindlichen Sinne sich bei ihm bemühten. »Aber an unserer Liebe prallt alles ab«, hatte der König hinzugefügt.
Eines Tages verbreitete sich das Gerücht in der Stadt: Richard Wagner sei beim König endgültig in Ungnade gefallen, es sei aus mit ihm. Alle wollten es aus zuverlässiger Quelle wissen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung vom 14. Februar 1865 schrieb: »Wir können Ihnen auf das Bestimmteste versichern, daß Richard Wagner die ihm reichlich zuteil gewordene Gnade unseres Monarchen völlig verscherzt hat.«
Und am 25. Februar schrieb dasselbe Blatt: »Die unleugbaren Tatsachen von Wagners maßloser Verschwendung dünkten uns, wenn in der Folge sich wiederholend und der Öffentlichkeit Ärgernis gebend, das Ansehen unseres erlauchtesten Schutzherrn schädigen zu müssen.« Jetzt war man dort, wo man hinwollte: man hatte den König in die Debatte gezogen.
Als Ludwig erfuhr, daß man von seiner Ungnade Wagner gegenüber sprach, wurde er traurig und schrieb seinem Günstling: »Elende, kurzsichtige Menschen, die von Ungnade sprechen können! Verzeihe ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, daß Sie mir alles sind, waren und sein werden bis in den Tod. Daß ich Sie liebte, ehe ich Sie noch sah. Ich weiß aber: mein Freund kennt mich, sein Glauben an mich wird nie sinken. Ich will auch nicht klagen, denn ich habe ja ihn, den Freund, den Einzigen. Trotzen wir den Launen des tückischen Tages dadurch, daß wir uns nicht beirren lassen, ziehen wir uns zurück von der Außenwelt, sie versteht uns nicht. Wie entzückt es mich, zu hören, daß Sie am ›Siegfried‹ arbeiten. Ich will nun mit Ihnen in Siegfrieds Wald sein, mich geistig an der Vöglein Sang erquicken. Vergessen Sie die rauhe Umgebung, die mit Nacht und Blindheit geschlagen ist – unsere Liebe leuchte hell und lauter!«
Der junge König Ludwig hätte seine Klagen sich sparen können. Nicht lange darauf kam die Mär von des Königs Ungnade auch zu Wendelin Weißheimers Ohren, der sich bei Hans von Bülow erkundigte, was es denn gäbe. Da schrieb Bülow zurück:
»Also auch Sie sind in die Falle gegangen? Jene Gerüchte, die alle in Aufruhr versetzten, sind von uns (den Wagnerfreunden) selbst erfunden und verbreitet worden. Wir wollten uns nur gegenüber dem unverschämten zudringlichen Bettelvolk schützen, das von nah und fern Wagner und mich wanzengleich, sommerfliegenmäßig mit Bitten um Protektion bis zum Exzeß peinigt. Sie würden erschrecken, wenn Sie den Haufen grobes und feines Papier sähen, der allein bei mir sich in den letzten fünf Wochen aufspeicherte. In einer scherzenden Stunde haben Wagner und ich uns auf eine solche ›Königliche Sonnenfinsternis‹ geeinigt. Wir hatten sehr wenig Mühe mit deren Inszenierung. Innerhalb vierundzwanzig Stunden wurde unsere ›vertrauliche Mitteilung‹ wollüstig aufgeschnappt und weitergeklatscht, mit Zunge und Feder. Nicht nur die bayerischen, sondern auch alle übrigen deutschen Zeitungen, sogar belgische und französische fielen auf unsere Ente herein und sind voll von der ›Ungnade‹.«
Die ganze zivilisierte Welt beschäftigte sich also mit König Ludwig und Wagner. Das war nicht verwunderlich. Es gab in der neueren Geschichte kein Beispiel für ein solches Beieinanderleben von König und Künstler. Nur im Altertum fand man Ähnliches und im Florenz der Renaissance am Hofe der Medici.
Bülow erzählte noch mehr: »Jetzt lassen sie uns ungeschoren, die Bittsteller, sogar die königlichen Kammertrio-Geiger kommen nicht mehr zu uns und spielen uns nichts mehr vor, was meine durch ihre elende Geigerei ermatteten Ohren prächtig erholt hat. Inzwischen hat der prachtvolle junge König das von Pecht gemalte Porträt von Wagner neben den Bildern seiner Ahnen aufgehängt, und der Bildhauer Zumbusch muß fortwährend neue Wagnerbüsten für den König anfertigen. Der Maler Echter malt an Illustrationen zu sämtlichen Wagnerschen Opern. Ebenfalls für den König –«
Die Mär von der Ungnade Ludwigs soll übrigens nicht von Wagner und Bülow, sondern von der jungen Frau Cosima erdacht worden sein. –
*
In den Gesprächen zwischen Ludwig und Wagner tauchte immer häufiger der Gedanke auf, daß Bühnen der überkommenen Art, wie auch diejenige des schönen Hof- und Nationaltheaters in München durchaus nicht dazu geeignet seien, Wagnersche Musikdramen genau so wiederzugeben, wie Wagner sie bei der Konzeption mit seinem geistigen Auge sah.
König Ludwig war Feuer und Flamme für diese Idee: »Sie denken an ein richtiges Festspielhaus, lieber Meister? An einen königlichen Prachtbau in Marmor und edlen Metallen?«
»Nein, Majestät. Es darf auch ein einfacher Fachwerkbau sein, der keine unerschwinglichen Summen erfordert. Es geht mir nur um die geeignete bautechnische Einrichtung von Bühne und Zubehör und Zuschauerraum.«
»Der Kostenpunkt darf keine Rolle spielen, Meister«, verteidigte Ludwig seine Idee. »Ein solcher Neubau müßte eine herrliche Zierde für München werden. Ich weiß einen prachtvollen Platz auf den Isarhöhen, im Osten.«
Und Ludwig entwickelte seine Idee. Eine schöne breite Straße, welche jetzt noch über Ödterrain, Wäschetrockenplätze und andere unschöne Dinge von der Residenz aus zur Isar hinführte, sollte verlängert und mit Monumentalbauten besetzt werden. Den Abschluß sollte jenseits einer zu erbauenden Prachtbrücke das neue Festspielhaus bilden.
»Gibt es in München erfahrene Architekten, welche moderne Bühnenhäuser zu bauen verstehen?« fragte Wagner.
»Wir haben den Hofarchitekten Leo von Klenze. Klenzes Tochter ist eine Gräfin Otting; auch sie war Schülerin unseres Julius Hey.«
»Ich kenne die Münchner Bauten des Herrn von Klenze, Majestät, und ich bewundere sie. Herr von Klenze hat aber noch kein Theater erbaut, soviel ich weiß.«
»Kennen Sie einen solchen Theatererbauer?«
»Ich wüßte einen: den Dresdner Architekten Gottfried Semper, ich habe allergrößtes Vertrauen zu ihm.«
»Dann lassen Sie ihn nach München kommen. Er soll einen Plan entwerfen, Meister, nach Ihren Ideen natürlich.«
Wagner hatte Bedenken. »Wird man es in München nicht wieder übel auffassen, wenn Majestät immer neue Norddeutsche hierher berufen? Man ist schon nicht erbaut von der ›Wagnerclique‹, wie sie uns nennen.«
»Wer hat sich erdreistet, Meister?«
»Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern herunter. Unsere Berufungen schädigen das hiesige Erwerbsleben, behaupten die Leute.«
»Das ist töricht' Geschwätz, Meister, nehmen Sie es nicht schwer. Ich kehre mich nicht daran. Ich führe nur fort, was Vater und Großvater taten. Auch mein lieber verstorbener Vater, König Max, hatte Widerstände zu überwinden, als er das geistige und künstlerische Niveau unserer Residenz veredeln und heben wollte. Zuweilen gingen die Wogen der Empörung recht hoch. Warum sollen Norddeutsche nicht nach München berufen werden, wenn sie Ersprießliches leisten? Sind sie nicht Deutsche wie wir? Befinden sich nicht auch tüchtige Münchner in angesehener Stellung in norddeutschen Residenzen?«
Wagner versprach, an seinen Freund Gottfried Semper zu schreiben.
Auch mit diesem seinem Freunde hatte es eine eigene Bewandtnis. Als Wagner vor fünfzehn Jahren, also im Jahre 1849 als Königlich sächsischer Hoftheaterkapellmeister in seinem dunklen Drange nach vorwärts sich zur Teilnahme am Dresdner Revolutionsgetriebe verleiten ließ, war Gottfried Semper bereits ein geachteter Baukünstler. Auch er wurde Revolutionsteilnehmer, aber aus einem mehr sachlichen Grunde. Er war alles andere, nur kein »Tyrannenhasser« und Umstürzler.
Er hatte sich nur fachmännisch darüber geärgert, daß die Dresdner Revolutionäre ihre Barrikaden so liederlich bauten, gegen alle Gesetze der Baukunst und Schwerkraft.
Er erbot sich, eine bessere Barrikade zu bauen, eine ganz große, widerstandsfähige, was man gern annahm.
Nur die sächsische Regierung hatte wenig Verständnis für diese Art Baukunst. Ebenso wie Wagner mußte auch Semper fliehen, um nicht ins Zuchthaus zu wandern, wie Wagners Orchestergenosse, der Kapellmeister August Röckel, der seine zwölf Jahre absitzen mußte. Semper fand, wie Wagner, ein Unterkommen in der freien Schweiz, wo er sogar Bauten ausführen durfte. Später begnadigte man ihn in Dresden.
Heute war er ein angesehener, ja schon berühmter Mann seiner Zeit. Oft genug hatte er mit Wagner über alle wünschenswerten Reformen beim Bau neuer Theater gesprochen. Er wußte also, was Wagner für richtig und nötig hielt.
Ein neues Festspielhaus in »Stein und edlen Metallen«, wie König Ludwig es wünschte, war aber eine kostspielige Sache. Die enormen Kosten würden der bayerische Staat und die Münchner Bürger zu tragen haben, die königliche Privatschatulle mochte für eine solche Belastung zu schwach sein; sie war jetzt schon durch alte Verpflichtungen von früher her genügend belastet.
Nein, mein herrlicher, schönheitsliebender junger König, dachte Wagner, damit wirst du in München kein Glück haben. Aber mein Freund Semper soll trotzdem die Pläne zeichnen. Vielleicht kann er sie einmal anderswo ausführen?
Wagner schrieb also an Gottfried Semper nach Dresden.
*
Sogar außenstehende Leute, denen die Münchner Verhältnisse gleichgültig sein konnten, begannen jetzt schon – wagnerfeindlich – Stellung zu nehmen. Das konnte nur Futterneid sein. Einige englische Blätter brachten »Enthüllungen« über Herrn Richard Wagners »Verschwendungssucht« auf Kosten der Königlich bayerischen Kabinettskasse.
Man hatte König Ludwig diese englischen Blätter in die Hand gespielt. Sofort berief er Wagner zu sich. »Diese Presseangriffe zielen ebensosehr auf mich, wie auf Sie, lieber Meister«, grollte der König, »haben Sie nur keine Sorge. Alle diese Bosheiten und Verunglimpfungen prallen wirkungslos von uns ab. Wir beiden sind unzertrennlich und stehen einander bei. Sie mir und ich Ihnen. So soll es bleiben, und wenn die Welt aus den Fugen geht!«
Wagner dankte dem Könige gerührt für sein hohes Vertrauen. Es war sehr viel für einen König der Zeit, daß dieser eines Künstlers wegen allerlei übler Nachrede ausgesetzt wurde und sich nichts daraus machte.
König und Künstler kamen dann überein, daß man den freundlichen Julius Hey beauftragen wollte, bei dem englischen Gesandten in München, Mister Howard, dessen Tochter ebenfalls seine Schülerin war, vorstellig zu werden. Mister Howard sollte seinen Einfluß dazu verwenden, daß die englischen Zeitungen mit ihrem Geschwätz endlich aufhörten, was der Gesandte mit Rücksicht auf den bayerischen König zu tun versprach.
Die kränkende Behauptung, Wagner nehme die königliche Kabinettskasse zu stark in Anspruch, konnte sich kaum auf sein Jahresgehalt von viertausend Gulden beziehen. Ludwig hatte Wagner aber auch Wagen und Pferde gestiftet, damit er zu seiner Erholung ein wenig ausfahren konnte. Er wollte ihm durch dieses und anderes das äußerliche Leben so erfreulich wie möglich gestalten, aber das alles kostete Geld.
Da tauchte das Gerücht auf, daß König Ludwig beabsichtigte, Richard Wagner mit der Umgestaltung des Münchner Konservatoriums zu betrauen.
Es gab merkwürdige Einrichtungen an diesem ein wenig eingerosteten Konservatorium des Herrn Geistlichen Rates Nissl, der unter anderem angeordnet hatte, daß der Lehrer für das Cellospiel gleichzeitig auch den Gesangsunterricht zu erteilen habe – aus welchen Gründen, war unerfindlich. Der Herr Geistliche Rat zeigte auch mehr Sorge um die moralischen Qualitäten seiner Studierenden, vor allem der weiblichen, als um die künstlerischen. Geeignetes Schülermaterial für einen ernsten Künstlerberuf war von dieser Anstalt kaum zu erwarten. Alle ehrlichen Sachverständigen hofften, daß sehr bald einer kommen möge, der einen eisernen Besen in diesen Augiasstall mitbrachte. Aber ebenso eindringlich baten alle ehrlichen Wagnerfreunde den Meister, seine Hand aus dem Spiele zu lassen, da jedes handfeste Eingreifen zu einem Zwiespalt zwischen König und Ministerium führen müsse. Dieses stand augenblicklich besonders stark unter den Eingebungen einer klerikal-reaktionären Zünftelei. Gerade die bayerischen Reichsräte waren damals so stockklerikal, daß der Papst ihnen gegenüber als ein fanatischer Freigeist zu gelten hatte. Mit dunklen politischen Plänen im Hintergrunde ihrer nachtschwarzen Seele, bezeichneten sie immer Preußen als Erbfeind des bayerischen Volkes, wie sie schon immer taten und nach 1870 erst recht.
In ihren Kreisen behauptete man, daß der Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. seinerzeit die Lola Montez nach München gesandt habe, um durch deren Verschwendung die Größe Bayerns zu ruinieren. Lola Montez, eine spanische Tänzerin, hatte durch ihre Schönheit und Grazie Einfluß auf den alternden König Ludwig I. gewonnen. Ganz München kochte vor moralischer Entrüstung über und nahm 1848 diese Sache ernster als die Lösung der großdeutschen Frage.
Wagner hatte auch unangenehme Auseinandersetzungen mit der königlichen Kabinettskasse wegen der Honorierung des Gesangslehrers Schmitt, der von Leipzig gekommen war. Es bedurfte erst eines neuen Machtwortes des Königs, bis Ordnung in diese Dinge kam.
Hinter diesen Kabinettsräten stand aber der bayerische Adel, mit dem der junge Ludwig nicht viel Aufhebens machte; kaum, daß er notgedrungen von ihm Notiz nahm, weil ihm der Horizont dieser Leute zu enge war. Aus diesem Kreise kamen auch die Minister und Kabinettsräte am Königshofe. Was diese Leute von Richard Wagner hielten, kann man sich vorstellen.
Der Hofzeremonienmeister Graf Pocci galt in Adelskreisen als hervorragender Musiksachverständiger. Er dichtete nebenbei Kasperlkomödien für das heute noch bestehende Schmidtsche Marionettentheater. Für dieses Theaterchen schrieb Graf Pocci sogar satirische Komödien gegen Wagner und dessen Zukunftsmusik, die sehr vielen Beifall fanden.
Wagner nahm das alles nicht schwerer als nötig, er gönnte den Münchnern die Freude. Auch Bülow wurde von den Satirikern schon aufs Korn genommen. Er aber, der norddeutsche Edelmann, war feinfühliger als Wagner und fand es blamabel, als Zielscheibe für Münchner Witzbolde zu dienen.
Man tadelte aber auch seinen eigenen König, den unerfahrenen jungen, den schlechten Bayern, den Geldverschwender zugunsten norddeutscher Schluckspechte.
Es bestand eine hochvornehme Gesellschaft in München, die sich (ein wenig unbayerisch) »Alt-England« nannte. In dieser war auch ein Teil der damaligen geistigen Elite Münchens zusammengeschlossen. Auch der Musikdirektor Franz Lachner gehörte ihr an. Sobald dieser seine Stellung durch Wagner gefährdet sah, nahm man heftig Partei für ihn, heftig, ja leidenschaftlich, und war sehr empört über die neue Richtung.
Freilich, man tröstete sich, der »Tristan« Herrn Wagners, der schon in Wien sich als unaufführbar erwiesen hatte, eben weil er Zukunftsmusik war, würde auch in München niemals zustandekommen. Wagner war dann der Blamierte und der enttäuschte König Ludwig würde seine »Nordlichter« wieder abreisen heißen und alle Gefahr war vorüber. Darauf hofften jetzt alle.
*
Man darf aber nicht behaupten, daß alle Wagnergegner in jener Zeit nur aus stumpfer Böswilligkeit handelten. Mehr als siebzig Jahre vergingen seitdem. Damalige Menschen hörten musikalisch noch ungeübter als heutige. Noch gab es kein sinnebetörendes Großstadttreiben, nicht in München, und nicht in Berlin. Nicht einmal in London oder Paris. Die Hörnerven der Theaterbesucher waren weder lärmgewohnt noch abgestumpft gegen Dissonanzen jeglicher Art. Alle Musikliebenden hingen an Schubert und Haydn. Beethoven war ihnen schon zu schroff und zu steil, das will sagen: »zu hoch«. Mozartsche Symphonien galten als herzerquickend. In der Oper liebte man »Freischütz« und »Oberon«. Die heute verschwundene Weiglsche »Schweizerfamilie« war noch Repertoireoper aller Bühnen. Hierzu gesellten sich die hochbeliebten italienischen und französischen Spielopern: Rossini und Donizetti waren noch Trumpf.
Auf die Textworte legte man wenig Gewicht. Was die Sänger sangen, verstand man kaum, man wollte auch nur die Musik. Über den Gang der Handlung, die an Naivität meist ihresgleichen suchte, belehrte der gesprochene Dialog zwischen den Chören und Arien. Auch enthielten die Gesangsverse nur immer dieselben allgemeinen Auslassungen über Freude und Schmerz, Liebe und Haß und Phrasen heldischer oder komischer Art. Das alles war nebensächlich, es regte nicht an und nicht auf. Nur die Melodien behielt man im Ohre, die behaglich und wohllautend klingen mußten, sonst ließ man die Oper durchfallen. Man wollte diese Melodien nachsingen können, das war der ersehnte Genuß und diese Forderung ist bestehengeblieben bis auf den heutigen Tag. Und mit Recht.
Aus den Wagnerschen Opern »Rienzi«, »Lohengrin«, »Tannhäuser«, auch aus dem »Holländer« hörten damalige Opernbesucher überhaupt keine oder nur sporadisch Melodien heraus. Es gehörten viele Jahrzehnte dazu, um das menschliche Ohr an den Wagnerschen Sang zu gewöhnen. Wenn Wagner jetzt auf einen großen Erfolg bei den Zuhörern auch bei »Tristan und Isolde« rechnete, so gab er sich unerfüllbaren Illusionen hin. Nicht nur einigen besonders hörgeschulten Musikschwärmern sollte seine neue Oper zusagen, sondern dem großen Publikum in den Theatern in aller Welt, welches jede Oper erst zu einer Repertoireoper machte, indem dieses Publikum immer wieder in die Theater strömte, wenn diese Oper gegeben wurde. Nicht, um eine verbesserte neue Kunst zu genießen, eine Opernreformation, gingen die Menschen in die Theater, sondern nur, um etwas zu sehen, zu hören, was ihnen wohlgefiel.
Auch die Stoffe und Vorgänge, welche Wagner in seinen noch kommenden Opernwerken oder Musikdramen bevorzugte und welche das angebliche Denken und Handeln unwirklicher, frei erfundener und nicht einmal der Urvätersage entnommener Götter und Helden, Riesen und Zwerge verherrlichten, konnten niemand erwärmen. Man kannte diese Urvätersagen aus Jugendschriften und war erstaunt darüber, daß aus diesen harmlos durch die Urwälder wandernden Nibelungenmenschen auf einmal schwerfällig grübelnde Philosophen geworden waren.
Damit rechnete Wagner zu wenig, der Illusionist. Er wollte die Menschen sofort zu einem ihm günstigen Mitempfinden fortreißen. Hierzu berührte alles Dargebotene die Menschen seinerzeit viel zu wenig menschlich-verständlich. Halber Philosoph mußte man selber sein, um zu begreifen, worum es diesen Göttern, Riesen, Helden und Zwergen eigentlich ging, oder besser gesagt: Richard Wagner, deren geistigem Vater. Übrig blieb für die Menschen des Alltags nur die Melodik und der Wohllaut Wagnerscher Harmonien, soweit diese nicht in einem wilden Urgetön untertauchten, das die Ohren marterte.
Augenblicklich, im München des Jahres 1865, stand Richard Wagner, der Neutöner, noch im allerersten Anfange der unvermeidbaren Kämpfe um Gunst und Verständnis der Menschen.
Weniger entschuldbar, als die ausgebreitete Ablehnung Wagners aus musikalischen und textlichen Gründen, waren die Mittel und Wege der aus anderen Gründen Übelwollenden, welche von allen Seiten her an die Arbeit gingen, um sein Werk zum Mißlingen zu bringen.
*
Immer, wenn König Ludwig wieder einmal genug hatte von allem üblen Gerede und den boshaften Taten seiner Münchner Umgebung, verließ er die Stadt und zog sich in seine geliebten einsamen Berge zurück. Meist fuhr er nach Hohenschwangau bei Füssen. Hier ließ er nur Leute vor, die ihn kaum ärgern würden. Dann begann er zu grübeln und über dem Grübeln kamen die absurden, fremden Gedanken. Gedanken auch an Richard Wagners zeitfremde Gestalten aus grauer Urzeit.
Waren diese Menschen etwa glücklicher gewesen als heutige? Wohl kaum, denn auch sie wußten nur von Schuld und Gier, von Schicksal, Trauer und Sühne. Eigenwillige düstere Dämonen herrschten damals wie heute. Aber, dann hatte sich gar nichts geändert im Inneren der Menschen, auch alle christlichen Lehren des Heils hatten sie nicht gebessert. Vielleicht war an ihnen gar nichts zu bessern, sie mußten genommen werden, so, wie sie waren.
Dann aber waren auch alle hart zugreifenden Tyrannen im Rechte, die immer nur abschrecken wollten und Furcht erregen.
Solche Autokraten unter den Königen hatte es sehr viele gegeben. Allen gelangen ihre Vorhaben nicht, nur den Klügeren. Manche traf der Stahl der Tyrannenfeinde, manche erlagen heimtückischen Giftbechern. Oder bösartigen Krankheiten, wie Alexander der Große, der so großzügig war, daß er von den tapferen Verteidigern der Stadt Tyrus gleich tausend auf einmal ans Kreuz schlagen ließ. War das etwa ein Vorbild für einen König der Zeit? Manche wurden auch wahnsinnig vor Größenwahn und zu läppischen Kindern.
Diese letzteren wurden am schlimmsten betroffen. Nein, dann noch lieber ein Ende mit Schrecken, ein plötzliches grausiges, als allmählich herankriechender Wahnsinn vor dem Versinken in der ewigen Nacht.
Oder, war es besser, ein milder Herrscher zu sein, der sein Menschengefolge an rosenfarbigen Bändern leitete? O nein; auch diese freundlichen Fürsten zogen sehr häufig den kürzeren und endeten übel, wie Ludwig XVI. von Frankreich. Auch er war kein Vorbild für einen heutigen Ludwig von Wittelsbach.
Viel eher Ludwig XIV., der Autokrat, der kühne Eroberer und Länderdieb. Trotz seiner Laster starb er friedlich in seinem Bette, in einem kleinen und einfachen Nebenzimmerchen in seinem Schlosse Versailles. » Roi soleil« nannte man ihn, er blieb der Sieger. Er war ein Vorbild. Immer wieder mußte man an ihn denken und ihn bewundern.
Er war ein Vorbild. Ob man es je erreichte?
*
Endlich erschien auch der Sänger Ludwig Schnorr von Carolsfeld in München. Schon bei der ersten Klavierprobe zu »Tristan« nahm Wagner wahr, daß Schnorrs begeisterte Empfänglichkeit für diese Rolle nicht etwa geringer geworden war.
Die anderen Probenteilnehmer waren erstaunt, als sie Schnorr zum ersten Male erblickten und dessen mächtige Leibesfülle. Auch seine Gattin Malwine war eine robuste Erscheinung. Vor dem Tristan noch sollte Schnorr den Tannhäuser singen, wie König Ludwig es wünschte. Auch diese Aufführung gelang wider Erwarten gut. Wagner war hochentzückt; er nannte Schnorr einen Ausnahmemenschen. Schnorr sei »ein Sänger mit der Seele eines Kindes und dem Verstande eines gereiften Mannes«. »Er weiß immer, was ich will und kommt mir zuvor – er macht's besser, als ich's ihm zeigen kann«, pflegte Wagner zu sagen.
Schnorrs leichte und überlegene Auffassungsgabe, die Wagner wie ein Wunder an ihm bestaunte, zeigte sich erst recht bei den »Tristan«-Proben, die jetzt begannen.
Bei diesen war der Gesangslehrer Schmitt aber ausgeschaltet, er wohnte den Proben nur als Zuhörer bei, freilich als kritischer. Er hatte an allem viel auszusetzen, an Schnorr sogar, obwohl ihm die mühelose Bewältigung der ungeheuer schwierigen Tristanrolle erstaunlich erschien.
Wagner sagte dann begütigend: »Gewiß! Du meinst es gut, lieber Schmitt, du bist aber ein unheilbarer Nörgler, der immer nach Fehlern sucht, aber des Schönen nicht achtet.«
Für Wagner war es ein hohes Glück, daß sein Schnorr nicht versagte, schon König Ludwigs wegen. Die Arbeit mit Schnorr war der letzte Versuch, dieses Schmerzenskind »Tristan« für die Bühne zu retten.
Auch mit dem »Tristan« selbst war Schmitt nicht ganz einverstanden. Wie er überhaupt nicht zu den extremen Zukunftsmusikern gezählt werden wollte. Er erklärte, für den »Tristan« reiche sein musikalisches Begriffsvermögen nicht aus. Am wenigsten gefiel ihm der König Marke. Um wieviel herrlicher sei Wagner der König Heinrich im »Lohengrin« gelungen, welche Hoheit und ehrfurchtgebietende Haltung spreche aus jeder Note!
Der König Marke dagegen sei eine Jammergestalt.
Wagner empfand diese Kritik eher humorhaft, nicht ernst. Denn auch an Hans von Bülow hatte Schmitt manches zu tadeln. Bülow singe zu wenig auf dem Klavier, sein Spiel sei zu hölzern. Dementsprechend achte er als Dirigent auch zu wenig auf die Schönheit des Sängertones.
Bülow dagegen äußerte: »Wie kann ein Musikbanause, wie Schmitt, Wagnersänger heranbilden wollen? Keinen blauen Dunst hat er von dem, was Wagner will.«
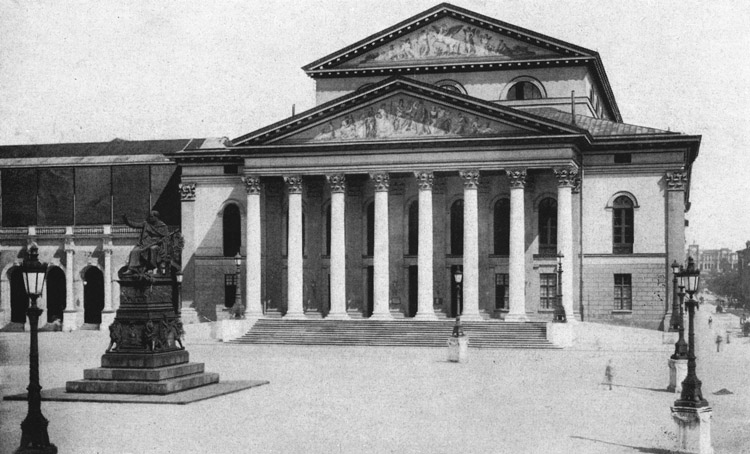
Das Münchner Hoftheater

Schnorr von Carolsfeld, der erste Tristan
Die Herren Wagnerfreunde waren also schon untereinander nicht immer ganz einig über das, was sie tun, loben oder verurteilen sollten. Willig aber anerkannten sie Wagners Autorität und fügten sich gern.
Inzwischen hatte Wagner auch seinen vom König erbetenen Bericht: »Über eine neue in München zu errichtende deutsche Musikschule« fertiggestellt. Dieser Bericht mußte einer Kommission vorgelegt werden, die der Kultusminister ernennen sollte: so war es der Brauch. Das Gutachten dieser Kommission mußte man abwarten.
*
Ganz München war neugierig auf den kommenden Tristanversuch.
An allen Biertischen, in den Kaffeehäusern und in Privatgesellschaften war die Rede davon. Schlimme und gute Gerüchte wechselten miteinander ab. Die Beteiligten schwiegen sich aus; nur der König war freudigster Hoffnung auf ein gutes Gelingen. Nach einundzwanzig anstrengendsten, von Bülow mit vollster Hingebung geleiteten Orchesterproben war es soweit.
Schon vor der Aufführung wollte König Ludwig sich dankbar erweisen.
Als sein Vater, König Max, im Jahre 1863 vom Frankfurter Fürstentage zurückkehrte, empfingen ihn bei seinem Einzuge in München zahlreiche Inschriften, welche Begnadigung für alle forderten, die noch in Haft oder Verbannung lebten, weil sie 1848 nach Deutschlands Freiheit und Einigung strebten. König Max hatte diese Begnadigung abgelehnt.
Am Tage der letzten »Tristan«-Probe hob König Ludwig II., ungeachtet des Widerspruchs seines Justizministers, alle wegen der Ereignisse von 1848 gegen Zivil- und Militärpersonen verhängten Strafen auf. Wahrscheinlich nur Wagner zuliebe, der ebenfalls einer von denen gewesen war, die des deutschen Volkes Bestes gewollt hatten, wenn auch auf einem verkehrten Wege.
Freude an dieser großherzigen Tat hatten aber nur die Enthafteten.
Die Adelskreise und die konservative Gelehrtenwelt waren richtig empört. Sie erblickten in Ludwigs Güte nur schädliche Irrläufigkeiten auf Grund demokratischer Einflüsterungen der »Wagnerclique«. Richard Wagner wurde also von neuem zum Zankapfel der Münchner Bevölkerung. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe türmten sich auf zu immer noch anwachsenden bedrohlichen Ballungen.
*
Am Tage der letzten »Tristan«-Probe geschah noch allerhand anderes.
Eben, als Wagner sein Haus in der Briennerstraße verlassen wollte, um zur Probe zu gehen, ließ sich ein Fremder melden, ein zugeknöpfter, frostig tuender Herr.
»Ich habe einen verfallenen Wechsel zur Einlösung vorzulegen, mein Herr«, sagte der Fremde und entnahm seiner Brieftasche einen länglichen Streifen Papier. »Er stammt aus Paris, wie Sie sehen. Ich habe den Auftrag, den Betrag einzukassieren.«
Der verdutzte Wagner warf nur ein flüchtigen Blick auf das Papier: die Sache stimmte. Der Wechsel stammte noch aus der Zeit der Pariser mißglückten Konzerte von vor vier Jahren. Er hatte den hohen Betrag aber nicht im Hause, auch nicht auf der Bank. Er bat um Aufschub bis morgen. Der fremde Herr lehnte ab. »Ich habe den Auftrag, die sofortige Schuldhaft gegen Sie zu beantragen, wenn der Wechsel nicht eingelöst wird.«
Wagner wußte niemand, den er um Hilfe angehen konnte. Sollte der »Tristan«-Komponist kurz vor der Aufführung seiner neuen Oper in den Schuldturm spazieren? Dann war alles vorbei in München; diese Schande durfte er König Ludwig nicht antun.
König Ludwig –
Nochmals verlegte Wagner sich auf Bitten; der Fremde blieb unerschütterlich. Anscheinend war ihm das von seinem Auftraggeber eingeschärft worden.
Mrazek, der Diener, mußte im Eilschritt hinüber zur Residenz. Der fremde Dränger zeigte starke Anzeichen von Ungeduld. Seinem Auftraggeber war es zweifellos lieber, wenn das Geld nicht gezahlt wurde, wie alles lag.
König Ludwig war edelmütig wie immer. Er sandte durch Mrazek ein Schreiben, welchem die erbetene Summe beilag und ermahnte den Freund: »Oh, ich begreife wohl, daß oft Augenblicke des Unmutes gegen das Menschengeschlecht bei Ihnen eintreten. Stets wollen wir aber bedenken, daß es doch viele edle und gute Menschen gibt, für welche zu leben und zu schaffen es wahre Freude ist.«
Wenn du nur nicht enttäuscht wirst, du Guter, du Edler, dachte Wagner mit dankbarem Herzen. Der fremde Besucher erhielt seine Banknoten und ging seiner Wege.
Wagner begriff sofort, daß er sehr auf der Hut sein mußte. Solche und ähnliche Überfälle aus dem Hinterhalt konnten sich wiederholen: täglich und stündlich. Es war schon so: irgendeiner seiner gehässigsten Gegner in München hatte auf Umwegen dieses verfallene Papier aufkaufen lassen, um ihm zu geeigneter Zeit zu schaden. Was ihm freilich mißlungen war.
Wagners Frohgefühl wurde wieder gedämpft, als er das Theater betrat. Ein Beamter der Intendanz kam ihm entgegen. »Soeben ist der Tag der ›Tristan‹-Aufführung verschoben worden, Herr Wagner, Frau Malwine Schnorr, Ihre Isolde, ist plötzlich erkrankt.«
Wagner erschrak zu Tode. »Was ist ihr begegnet?«
»Nichts Schlimmes: es ist eine Halsaffektion. Der Theaterarzt glaubt an eine Überanstrengung beim Singen, an eine Überreizung der Stimmbänder.«
Nichts Schlimmes? jammerte Wagner, das war schlimmer als schlimm. Neues Wasser war das auf die Mühle der Gegner. Es ereignete sich dasselbe, wie damals in Wien, als der Tenorist Ander während der Proben erkrankte.
Ludwig Schnorr, der Gatte, bestätigte Wagner das Schlimme. Seine Malwine würde sofort nach Bad Reichenhall müssen, um ihre Stimmbänder auszuheilen. Hoffentlich währe das nicht zu lange!
Das war ein schwerer Schlag für Wagner. Jetzt würden sie wieder schreien, daß der »schreckliche Tristan« gar nicht aufführbar sei. Wagner ruiniere die Stimmen!
Und das schrien sie auch, die Münchner.
Um so mehr, als Frau Malwine Schnorr nicht etwa innerhalb weniger Tage wiederhergestellt war, trotz eifriger Kur in Bad Reichenhall unter Obhut des Gatten.
Die Uraufführung hatte am 15. Mai stattfinden sollen. Wagner hatte bereits aus aller Welt Freunde geladen. Schon bei der Generalprobe am 14. Mai waren sechshundert Geladene erschienen. Das Münchner Publikum aber war zu einem »Kunstfeste dreier gänzlich ausnahmsvoller und mustergültiger Aufführungen« geladen worden. Wagner selbst hatte in seiner Einladung geschrieben: »Mein huldreicher Beschützer, der edle Wirker dieser Tat, will, daß diese bedeutungsvollen Aufführungen nicht der gewöhnlichen Neugier, sondern dem ernsteren Interesse an meiner Kunst geboten werden sollen. Somit bin ich ermächtigt, in alle Ferne hin, soweit meine Kunst sich Herzen gewann, die Einladungen zu diesen Aufführungen ergehen zu lassen.«
Schon am 5. April hatten die Proben – zunächst in Wagners Wohnung – begonnen, die dann im Residenztheater fortgesetzt wurden. Es begann für Wagner eine so befriedigende, wunderschöne Zeit, daß er zu träumen glaubte nach all den Enttäuschungen. Er schrieb an seine alte Freundin, Frau Wille:
»Zum ersten Male in meinem Leben bin ich hier mit meiner ganzen vollen Kunst wie auf einem Pfühle der Liebe gebettet. Edel, groß, frei und reich die Anlage der ganzen Kunstwerkstatt: ein wunderbares, vom Himmel mir beschiedenes Künstlerpaar, innig vertraut und liebevollst ergeben, begabt zum Erstaunen. Meinen treuen Schutzengel, den König, immer schön und segnend über mir schwebend, voll kindlichem Jubel über meine Zufriedenheit am wachsenden Gelingen: unsichtbar immer anordnend, was mir diente, entfernend, was hinderlich war. Wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit.«
Friedrich Pecht, der frühere Maler und jetzige Kunstkritiker, der alte Freund Richard Wagners und Helfer in seiner ersten Pariser Notzeit, der den »Tristan«-Proben jetzt beiwohnte, erzählte später: »Nichts Interessanteres konnte es geben, als Wagner bei diesen »Tristan«-Proben zu sehen: da glich der kleine Mann mit dem mächtigen Kopfe, langen Beinen, einem feuerspeienden Vulkan – alle riß er mit sich fort.«
Die Probenzeit verlief aber gar nicht so reibungslos, wie Wagner es darstellte. König Ludwig hatte für die Wagnerschen Werke Hans von Bülow dem Hofopernorchester als Leiter bestellt, zum großen und empörten Erstaunen aller Münchner musikalischen Kreise.
Die Orchestermitglieder, die ihren Franz Lachner ob seiner Strenge eher fürchteten als liebten, hielten jetzt nicht etwa zu Bülow, der ebenfalls Energie anwenden mußte, schon bei der ersten Probe, um sich Achtung und Energie zu verschaffen. Es bildete sich sofort eine Clique, die sich als Anhänger des alten Chefs Lachner aufspielte und durch passiven Widerstand Bülow zu reizen versuchte.
Bülow führte eine neue Methode durch. Bisher hatten die Musiker jeder für sich zu Hause geübt, ehe die gemeinsame Probe begann. Bülow aber hielt Sonderproben für die verschiedenen Instrumentengattungen ab, für Streicher, Bläser und Schlagzeug. Die Arbeitslast für Bülow wurde hierdurch verdreifacht, die gesamte Probenzahl aber vermindert.
Bald klagten auch die Orchesterleute über unüberwindliche Schwierigkeiten der Partitur – alles sei sozusagen unspielbar.
Die Musikgeschichte verzeichnet Ähnliches. Klemens Brentano erzählt gar ergötzlich davon, daß im Jahre 1815 bei der Berliner Hofoper eine entsetzlich schwere Oper einstudiert wurde. Die Choristen fielen bei den Proben um wie die Fliegen. Der Kapellmeister habe vor Ärger die Schwindsucht bekommen, die Geiger hätten den Veitstanz in den Fingern gehabt, die Bläser seien mindestens auf dem einen Lungenflügel erlahmt. Trotzdem gab es eine meisterhaft gelungene Aufführung – der Oper »Fidelio« des Herrn Ludwig van Beethoven. Fünfzig Jahre später ereignete sich jetzt das gleiche in München. Auch diesmal empfanden die zartbesaiteten Münchner heftiges Mitleid mit den geplagten Orchestermitgliedern des Hoftheaters.
Versteckte oder offene beleidigende Äußerungen und Beschuldigungen drangen unaufhörlich an Bülows Ohr. Seine Laune wurde nicht besser; er fühlte sich aufs stärkste gereizt, und Frau Cosima zu Hause hatte es schwer, ihn zu besänftigen.
Und so kam es denn, daß Bülow sich eines Tages zu einer Äußerung hinreißen ließ, die man ihm stark verübeln mußte, und die auch Wagner schadete. Es sollte der Orchesterraum verbreitert werden, was nur durch Entfernung einiger Reihen Parkettplätze durchgeführt werden konnte. Die Intendanz erhob Einspruch. Worauf Bülow privatim sich äußerte: es liege gar nichts daran, wenn einige Dutzend Münchner Schweinehunde weniger Platz fänden.
Die Wirkung war schlimm. Bülow erklärte zwar, er habe nur »böswillige Theaterbesucher« im Auge gehabt, aber das half ihm nichts. Ganz München fühlte sich durch »den Preußen Bülow« an seiner Ehre gekränkt. Während bisher immer nur einzelne Kreise gegen den »Günstling Wagner« geplänkelt hatten, kam die gesamte Volksseele jetzt ins Kochen. Neuer Mißmut entstand, als man – in Befürchtung von Ausschreitungen gegen Wagner – den Zutritt zu den oberen Rängen bei den »Tristan«-Aufführungen erheblich einschränkte.
Als die Erstaufführung jetzt verschoben wurde, nahmen Hohn und Spott gar kein Ende mehr. Die Musikfachleute sahen in dieser Verschiebung einen neuen eklatanten Beweis dafür, daß der »Tristan« überhaupt unausführbar sei. Ein sogar Wohlwollender schrieb: diese neue Aufschiebung mache die ganze Tristansache lächerlich und stumpfe jedes Interesse ab. Der Musikkritiker Speidel, der zur »Tristan«-Aufführung von Wien herübergekommen war, berichtete seiner »Neuen Freien Presse«, daß er die Fopperei satt habe und wieder abreisen wolle.
Bis aus Paris und anderswoher waren Wagneranhänger auf dessen schwungvolle Einladung hin herbeigeeilt und mußten unverrichteterdinge wieder umkehren, da ihnen die Zeit zum Abwarten fehlte; vielleicht auch das Geld. Es war auch kein neuer Termin für die Aufführung festgesetzt worden.
Jetzt wurden auch diese Getreuen zu Zweiflern.
Allen war unbegreiflich, warum Wagner ganz unnötigerweise diese schwer singbaren Noten schrieb. Mit einer kleinen Erleichterung des Tonsatzes konnte er zweifellos musikalisch dasselbe ausdrücken und zu szenischer Wirkung bringen. Höchster Affekt konnte ebensogut drei Töne tiefer, also bescheidener zum Ausdruck kommen, ohne dem Gesamtwerke Schaden zu tun. Wagner verdarb seine Chancen also auch hier wieder aus persönlichem Eigensinn? Das war nichts Neues bei ihm. Dann aber sollte er nicht Gott und die Welt beschuldigen, daß sie ihn peinigten.
*
Bange Tage verlebte Wagner, verlebten Bülow und beide Schnorrs.
Endlich war Frau Malwine soweit geheilt, daß sie heimkehren durfte.
Am 5. Juni kehrte das Ehepaar nach München zurück; an den drei folgenden Tagen war wieder Probe, und am Sonnabend, dem 10. Juni 1865, fand dann die heiß ersehnte öffentliche Aufführung des ebenso heiß umstrittenen Werkes statt, die am 13. und 19. wiederholt wurde. Bülow schrieb gleich nach der letzten Vorstellung an einen Freund:
»Wir sind alle wie im Traume über das merkwürdig vollständige Gelingen. Es ist der größte Erfolg, den je die erste Aufführung eines Wagnerschen Werkes erstritten. Schnorr ganz unglaublich. Alle übrigen recht erträglich, Orchester famos!«
Bülow bewährte sich nach dem Urteil aller als vollendeter Dirigent, dem das vorher so widerwillige Orchester in jeder feinsten Nuance folgte. Bülow war aber ehrlich genug, anzuerkennen, daß bei diesem Orchester eine so wunderbar schöne Leistung beim »Tristan« in so kurzer Zeit gar nicht möglich gewesen wäre, ohne die vorangegangenen Jahre strengster Schulung durch den Generalmusikdirektor Franz Lachner.
Wagner hatte diesen zur Uraufführung durch ein sehr liebenswürdiges Schreiben besonders eingeladen. Nach der Aufführung dankte Wagner den »geehrten Herren und Freunden von der Kapelle« begeistert für die Wärme, das Feuer und Zartgefühl, »mit denen Sie der Welt mein Werk laut und innig zutönten.«
Ebenso glücklich war Schnorr, der Sänger, auch in bezug auf die liebe Gattin, von der er rühmte, sie habe als Isolde »ein ganzes Antikenkabinett« von Plastik an sich gehabt. Schnorr, der erfahrene Sänger, hatte die Gesamtwirkung als »eine vom ersten bis zum letzten Auftritt sich unablässig steigernde« empfunden. Gerade diese Steigerung von Akt zu Akt habe die »Sicherheit des Sieges« gewährleistet.
» Heil dem Schöpfer des Tristan«, rief König Ludwig in tiefer Ergriffenheit und dankte Schnorr und Gattin überschwenglich in Briefen, die von des Königs Eindringen in die »Tristan«-Materie gesanglich und textlich das schönste Zeugnis ablegten. Ludwig ließ auch zur Anerkennung die im Erdgeschosse der Residenz angebrachten Bilder aus der Nibelungensage, die Schnorrs Vater gemalt hatte, für den Sohn künstlerisch photographieren.
Auf Ludwigs Drängen mußte noch eine vierte »Tristan«-Aufführung stattfinden: am 1. Juli, bei aufgehobenem Abonnement. Diesmal waren die Münchner ganz unter sich, da alle Fremden abgereist waren. Das Haus war bis zum letzten Platze gefüllt. Bülow hielt diese vierte Aufführung für die am besten gelungene.
Am 12. Juni, zwei Tage nach der Uraufführung, hatte König Ludwig an Wagner geschrieben:
»Dem Tondichter Richard Wagner in München.
Erhabener, göttlicher Freund!
Kaum kann ich den morgenden Tag erwarten, so sehne ich mich nach der zweiten Vorstellung schon jetzt. Sie schrieben an Pfistermeister, Sie hofften, daß meine Liebe zu Ihrem Werke durch die in der Tat etwas mangelhafte Auffassung der Rolle des Kurwenal von seiten Mitterwurzers nicht nachlassen möge!
Geliebter! Wie konnten Sie nur diesen Gedanken in sich aufkommen lassen? Ich bin begeistert, ergriffen. Entbrenne in Sehnsucht nach wiederholter Aufführung.
Wer dürft' es sehen, dies wunderbare Werk, das uns Dein Geist erschuf! Wer erkennen, ohne sich selig zu preisen? Das so herrlich, so erhaben, mir die Seele mußte laben?
Heil seinem Schöpfer! Anbetung ihm!
Mein Freund, wollen Sie die Güte haben, dem vortrefflichen Künstlerpaare Schnorr zu sagen, daß dessen Leistung mich entzückt und begeistert hat.
Ich bitte, erfreuen Sie mich bald mit einem Briefe!
Nicht wahr, mein teurer Freund, der Mut zu neuem Schaffen wird Sie nie verlassen? Im Namen jener bitte ich Sie, nicht zu versagen, jener, die Sie mit Wonne erfüllen, die sonst nur Gott verleiht.
Sie und Gott.
Bis in den Tod, bis hinüber nach jenem Reiche der Weltennacht bleibe ich
Ihr treuer Ludwig.«
*
Was sollte Wagner nach einem solchen Briefe seines königlichen Beschützers noch fürchten?
»Hast du gelesen?« fragte Bülow erregten Tones, als er, mit einer Zeitung in seiner Hand, Wagners Arbeitszimmer betrat.
»Etwas über den ›Tristan‹? Eine schlechte Kritik?«
»Lies nur erst. Hier hast du die ›Augsburger Allgemeine‹. Professor Riehl von der Universität läßt von sich hören. Es muß bereits etwas bekannt geworden sein von eurer Theaterneugründung jenseits der Isar. Es sollte doch alles geheimbleiben, bis Semper kommt?«
Wagner trat zum Fenster und las laut vor: »Jetzt, nach dem ›Tristan‹, wird auch die Ausführung des idealen Festspieltheaters noch weiter betrieben werden. Wir sind mit vielen Sachverständigen der Ansicht, daß mit dem ersten Steine hierzu der Grundstein zu einer Ruine gelegt würde. Wir sollten den Tag preisen, an welchem Richard Wagner, samt seinen Freunden, wirklich ›gestürzt‹, unserer guten treuen Stadt München und ganz Bayern den Rücken kehren würde.«
Wagner lächelte überlegen: »Jetzt nach unserem großen Erfolge? Dieser Riehl ist ein Narr. Vom Festspielhause habe ich keinem etwas erzählt. Vielleicht hat der König geplaudert?«
»Schon möglich. Wem das junge Herz voll ist, dem läuft der Mund über. Er wird mit seinen Verwandten über seine neuen Pläne gesprochen haben. Einmal mußte das sein.«
Wagner schien andere Sorgen zu haben: »Schlimmer ist die hiesige Zeitungskritik über ›Tristan‹. Diese Leute haben mich gar nicht begriffen. Der brave ›Münchener Volksbote‹ behauptet, ich hätte in ›Tristan und Isolde‹ den gemeinen Ehebruch unter Pauken und Trompeten verherrlicht. Was sagst du dazu?«
»Dasselbe, was Schnorr sagt: ›Noch nie sei über eine theatralische Vorstellung so viel Blödsinn geschrieben worden.‹«
Wagner hatte auch schon von allerlei kritischen Stellungnahmen innerhalb der gebildeten Kreise Münchens vernommen. Zu seinem grenzenlosen Erstaunen erkannte er, daß er beim überwiegenden Teile der Zuhörer – trotz deren Beifall – unverstanden geblieben war. Den Verlauf der Handlung begriffen die wenigsten. Hiernach schien es sich um einen Ehekonflikt zu handeln, der aber nicht auf die Bühne gehörte. Unsympathisch war, was da sich abspielte, das interessierte keinen. Nur die Musik war schön – stellenweise – und die vorzügliche Darstellung durch die prachtvollen Sänger.
Nur diesen hatte man Beifall gespendet; auch dem Orchester, das dieser Wagner sprechen und singen, weinen und jubeln gemacht hatte. Warum versteifte er sich nur auf eine so unerfreuliche Handlung? In diese Oper konnte man nicht einmal seinen jungen Verwandten mitnehmen.
Vorurteilslose dachten gründiger. Sie empfanden sehr wohl, daß der geniale Komponist hier die ganze Summe seiner zielbewußten Gestaltungskraft, den restlosen Inhalt seiner musikdramatisch- und poesiegetränkten Natur preisgegeben und nur echte Menschen, offenherzig sich gebende Naturkinder gestaltet hatte, die es gar nicht vertrugen, mit heute lebenden Menschen in Parallele gebracht zu werden.
Ob diese Urmenschen wirklich so dachten, so leidenschaftlich leidens- und todesgemut dachten und handelten, war eine zweite Frage. Nur die Dichter glaubten immer an solche Dinge: sie taten wenigstens so. »Geschichtlich« war dieser »Tristan« nicht, ebensowenig wie der »Lohengrin« und der »Tannhäuser«.
Freilich: alle diese Leute, die einem nicht zu enträtselnden Wunder gegenüberstanden, wußten und ahnten nichts von einer Mathilde Wesendonck auf dem »Grünen Hügel« bei Zürich und deren Gatten Otto, dem beinahe ein »König-Marke-Schicksal« geblüht hätte, wenn es keine mißtrauische und eifersüchtige Frau Minna Wagner, geborene Planer, gegeben hätte, die ihren Tristan-Richard, sehr zu seinem Heile, wieder ernüchterte.
Und wie gut, daß die Münchner das alles nicht wußten. Nur Hans von Bülow wußte davon und seine junge Frau Cosima, die freilich zielbewußter empfand als jene unenergisch-zarte biedermeierliche Mathilde-Isolde.
Nur die beiden, die Bülows, verstanden den Dichter Wagner so richtig, richtiger, als er sich selber vielleicht.
Wagner, der Dichter und Mensch, kannte kein Mitleid mit König-Marke-Gestalten. Sein Jugendfreund, der Malerkritiker Pecht, hatte einmal gesagt: »Wagner gehöre durchaus zu den Raubtieren, er sei durch seinen Beruf schon auf ständige Berechnung der Mittel angewiesen, mit denen er wirken wollte. Wo hätte auch bei diesem an Theatern Aufgezogenen, im Pariser Leben Ausgebildeten die Naivität bleiben sollen? Er hatte höchstens die Naivität des Löwen, der mit dem Hasen spielt, bevor er ihn frißt.«
Wie alle anderen Urteile über Richard Wagner als Mensch, bleibt auch das eben erwähnte der Wirklichkeit vieles schuldig. Wagners wahren Charakter erkannte nur der, der längere Zeit als Genosse neben ihm herging, durch dick und dünn. Er war gütig und freigebig und half, wo er konnte, auch wenn er selbst nicht viel hatte. Geldgier empfand er niemals aus Geiz, sondern nur, um seinen Lebensbedürfnissen folgen zu können. Er half seinen Freunden, schon damit sie ihm beistanden. Er verstand es, sie an sich zu ketten, so daß sie sich völlig in ihm verloren, auch zuweilen zu ihrem Schaden.
Jedenfalls war das Bild, in den gehässig getuschten Farben, das damalige Altmünchner von dem Menschen Wagner sich machten, ein völlig verzerrtes.
*
Der glanzvollen Erstaufführung von »Tristan« folgte ein fröhliches Nachtfest in Wagners Hause und Garten in der Briennerstraße. Alle, zum Teil weither gekommene Anhänger Wagners, trugen blühende Rosenstöcke in Händen, weil Wagner abgeschnittene Blumen nicht liebte, und umringten huldigend den Meister, der in dieser herrlichen Juninacht auf einem Höhepunkt seines Lebens zu stehen schien. In einer wundervollen jubelnden Stimmung verlief das Fest, das bis zum Morgen währte.
Schnorrs waren wieder nach Dresden gefahren. Wagner hatte mit seinem Tristan verabredet, daß dieser ganz nach München übersiedeln sollte. Er sollte in die neu zu eröffnende Musikschule als Lehrer für Gesang und dramatisches Opernspiel eintreten, was Schnorr sehr erfreut hatte.
Leider war das mißgünstige Schicksal wieder einmal ablehnend eingestellt. Zehn Tage nach der Abreise Schnorrs kam Hans von Bülow nach der Brienner Straße und fand Wagner weiß im Gesicht und von Entsetzen erfüllt.
»Was ist dir, Richard?«
»Ich gehe zugrunde vor Kummer, Hans – Schnorr ist tot –«
»Schnorr ist tot?«
»Er starb soeben an Gelenkrheumatismus in Dresden – ganz schnell –«
Auch Bülow war wie vom Blitze getroffen. Oh, er ahnte die Ursache des plötzlichen Dahinsterbens eines so kerngesunden, kräftigen Menschen. Auch Ludwig Schnorr mochte sich überanstrengt haben im Verlaufe der einundzwanzig erhitzenden Proben und fünf Theaterabende. Der große starke und schwere Mann mochte in starker körperlicher Erregung nach seinem schwierigen Singen in die Zugluft der Bühne und der Gänge zu den Garderoben geraten sein, was eine schwere innere Erkältung zur Folge hatte. Das war auch schon anderen Bühnenleuten begegnet und wiederholte sich immer wieder.
Wagner und Bülow fuhren sofort zur Bahn, um ihrem lieben Schnorr das letzte Geleit zu geben. Sie trafen aber erst einige Stunden nach der Beerdigung ein.
Beider Kummer war unbeschreiblich, auch derjenige König Ludwigs. War Schnorr doch der einzige ausgereifte Sänger, der volles Verständnis für Wagners Kunstschaffen besaß und es darstellerisch erschöpfend zum Ausdruck zu bringen verstand. Der Tristan, wie Wagner ihn geschaut und Schnorr ihn geschaffen, wurde nie wieder auf einer Bühne gesehen.
Wagner hatte erschüttert gerufen: »›Tristan‹ wird nie wieder aufgeführt werden, das wird meines edelsten Sängers erhabenstes Denkmal sein.«
Ein merkwürdiges Nachspiel hatte der Unglücksfall: Frau Malwine Schnorr, die arme Witwe, verfiel in ihrem Elende auf die Idee, Wagner müsse ihr den Gatten ersetzen und sie heiraten. In ihrer Sinnesverwirrung wandte sie sich an Frau Cosima Bülow, die aber nur überlegen lächelte, und an Peter Cornelius, zuletzt gar an König Ludwig, damit dieser den sich heftig sträubenden Wagner zur Eheschließung veranlaßte.
Wagner war so bald nicht zu beruhigen in seinem Schmerze um Schnorr. Er wollte sich in die Einsamkeit zurückziehen, schon um seine beinahe gelähmten Nerven wieder zum Leben zu bringen.
»Was mein ist, gehört Ihnen«, hatte König Ludwig geschrieben und Wagner eingeladen, zur Erholung auf Bergeshöhen, eines der vielen, seinerzeit von König Max erbauten Jagdhäuschen, zu beziehen. Wagner nahm diese Einladung an und verbrachte die Zeit vom 9. bis 21. August 1865 auf dem »Hochkopf«. Dieser wurde viel seltener bestiegen als der beliebtere »Herzogsstand«. Wagner fand hier auch die ersehnte Einsamkeit und Erholung, die »jene stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur« gewährte.
Hier auf dem Hochkopf erfolgte die Niederschrift des bereits vollständigen Entwurfs der Wagnerschen Parsifal-Dichtung. Viele in seinem bisherigen Erleben ersonnene Züge und Bilder schlossen sich hier zu einer dramatischen Einheit zusammen.
Wie immer, schuf Wagner auch hierbei seine Gestalten ganz anders, als die Sage der Urväter sie gestaltet hatte. Wagners Parsifal war ein anderer als derjenige des bayerischen Dichters Wolfram von Eschenbach. Viele tadelten Wagner wegen dieser Umformung nach eigenem Gusto. Man darf dann aber mit gleichem Rechte auch Schiller tadeln, dessen Wilhelm Tell und Don Carlos ebensowenig der geschichtlichen Überlieferung entsprechen wie der Goethesche Egmont. Vielleicht ist die Geschichte für den Dichter überhaupt nur Lehm oder Rohmaterial, aus denen er immer wieder sich selber zu formen versucht, ob er auch den Menschen gefällt oder nicht. Was geht ihn die Wahrheit an? Es gab immer Leute, meistens klarköpfige Nüchterne, welche alle Dichter ohne Ausnahme von Homer bis Goethe Lügner genannt haben. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht sind aber auch die Lügner für das Menschentum unentbehrlich. Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen hielt sogar alle bis damals bekannt gewordenen Religionsstifter, Moses, Christus und Mohammed für Betrüger. Friedrich war freilich auch der erste Inaugurator der Renaissance und als solcher ein sehr kritischer Dichter.
*
Von der »Purschling«-Hütte aus schrieb Ludwig an Wagner: »Umweht von erfrischenden Alpenlüften, selig in der freien Natur, denke ich an den Stern, der meinem Leben strahlt, an den Einzigen! (Womit er Wagner meinte.) Segne ihn, o Herr und Gott, gib ihm den Frieden, den er bedarf, entziehe ihn den profanen Augen der eitlen und leeren Welt, bekehre diese durch ihn von dem Wahne, der sie gefangenhält.«
Diesem poetischen Wunsche dankte Wagner mit dem Geständnisse: das, was ihn noch am Leben erhalte, sei seiner Werke Pflege durch den königlichen Freund, der in holder Jugend Prangen erwuchs, als Brünnhilde schlief und Tristan liebend starb.
An Frau Eliza Wille aber schrieb Wagner: »Sollte das Wunder dieses himmlischen königlichen Jünglings gedeihen, dann erhielte die deutsche Nation das fürstliche Vorbild, dessen sie so bedarf.« Was freilich ein kleiner Irrtum von Wagner war, einer der vielen.
Am 10. April 1865, am Tage der ersten Orchesterprobe zu »Tristan«, hatte Frau Cosima Bülow ihrem Gatten eine dritte Tochter geboren, die Isolde getauft wurde. Frau Cosima konnte an den großen Geschehnissen also nur wenig Anteil nehmen. Trotzdem freute sie sich ungemein über den Erfolg des von ihr so bewunderten Freundes Wagner. Sie hatte mit ihrem unerschütterlichen Vertrauen zu dessen überlegenem Schaffen recht behalten, während sogar Hans von Bülow, ihr Gatte, zuweilen gezweifelt hatte.
Es kam nicht selten vor, daß Frau Cosima ihren Gatten mit Wagner verglich, obwohl man Vergleiche zwischen beiden eigentlich nicht ziehen durfte. Herkunft, Veranlagung, Weltanschauung waren gänzlich verschieden. Das musikalische Können erst recht. Bülow war es gegeben, als Klaviervirtuose und Dirigent die Werke anderer ideal vollendet wiederzugeben; Richard Wagner aber war der überragende Schöpferische, der Gestalten, Handlung und Form erst schaffen mußte, die Bülow dann wiedergab. Wagner war Cosima auch interessant durch seine vielfachen Erlebnisse mit Frauen, denen er näherkam. Sie grübelte darüber nach: wie war es möglich, daß gerade sehr viele Frauen sich für Wagner erwärmen konnten, ganz gleich, welches Standes sie waren?
Wagner war durchaus kein Adonis, viele fanden ihn von Angesicht unschön, und seine Gestalt war erst recht nicht betörend. Nur seine Ausdrucksweise beim Sprechen war derart, daß er alle zum Zuhören zwang, die um ihn waren. Mit seiner modulationsfähigen Stimme konnte er beim Vorlesen ein ganzes Durcheinander von Dialogen zur Darstellung bringen, wenn er aus eigenen oder fremden Dichtungen vorlas.
Möglich, daß auch frauliches Mitempfinden, ja Mitleid, dieser Vorhof zur Hölle der Liebe, mit dem anscheinend von allen bösen Geistern Verfolgten das Herz auch dieser Liszt-Tochter rührte.
Als Cosima wiederhergestellt war, beschloß sie, sich des Verlassenen in der Briennerstraße auch hausfraulich anzunehmen, seinem böhmischen Dienerpaar Mrazek und Frau auf die Hände zu sehen und ihm in allen prosaischen Dingen, an denen auch Beethoven so gelitten hatte, behilflich zu sein. Nur, damit er auch Laune zum Weiterschaffen behielt.
Wagner begrüßte das dankbar. Es war seine alte Art, jede ihm hingereichte, helfenwollende Hand zu ergreifen, zu streicheln und schalten und walten zu lassen.
Ohne ihr eigenes Hauswesen zu vernachlässigen, verbrachte Frau Cosima bald halbe, bald ganze Tage bei Wagner; sie war seine Sekretärin für alles geworden. Wagner ließ sie Briefe beantworten, mit Besuchern in geschäftlichen oder beruflich-technischen Dingen Verhandlungen pflegen, die sie auch immer befriedigend durchführte. Sie war eine praktisch empfindende Frau, sie kannte das Leben und das Denken der Menschen und machte sich keine Illusionen. Sie verfügte auch über die Gabe, andere, auch streitbar veranlagte Mitmenschen zum Einlenken und Nachgeben zu veranlassen, mit allen wurde sie fertig. Sehr bald war sie Wagner völlig unentbehrlich geworden.
Frau Cosima stand jetzt im achtundzwanzigsten Lebensjahre. Kam sie in Berührung mit der Münchner Gesellschaft, so war sie immer beflissen, für Wagner Stimmung zu machen, allzu verstiegene Behauptungen über ihn zu entkräften und alle Verleumder Lügen zu strafen, ohne aber je aus der Rolle einer vornehmen Dame zu fallen. Ihrem Gatten Hans hätte sie damit als kluges Vorbild dienen können.
Wozu auch eine gewisse Kühnheit gehörte, zur Verteidigung Wagners nämlich. Die Münchner Wagnergemeinde jener Jahre trug alle Merkmale einer übel beleumdeten Sekte, und es war nicht sehr lockend, ihr anzugehören. Hohn und Spott würzten jede Unterhaltung über die »Sekte« der Wagnerhörigen. Ein ständiges Witzwort war, daß viele völlig Unmusikalischen erklärt hätten, sie wüßten jetzt endlich, was eigentlich Musik sei, nachdem sie Wagners »Tristan« gehört hätten.
Frau Cosima war der Gesellschaft aber nur interessant als Tochter ihres so vergötterten Vaters Franz Liszt, nicht als Bülows Gattin oder Freundin von Richard Wagner. Ästheten schätzten ihre schönen blauen Augen und ihr üppiges Blondhaar, aber auch die Lebhaftigkeit ihrer Unterhaltung, die sich meist um künstlerische oder doch literarische Dinge drehte.
Ihrem Gatten Bülow schien Frau Cosima schon damals ein wenig entfremdet zu sein. Aus dem jungen edelmännischen Lieblingsschüler ihres Vaters war ein verärgerter, immer übelgelaunter und polternder Hausgenosse geworden, der mit seiner immer heiseren Stimme auf München und seine Bewohner schimpfte, wie er früher auf die Berliner geschimpft hatte. Das war für einen erst fünfunddreißigjährigen Ehemann der unrichtige Ton, zumal, wenn er eine Cosima Liszt zur Frau hatte und neben sich einen zwar schon zweiundfünfzigjährigen, aber trotzdem noch begeisterungsfähigen, schönheitsempfänglichen Richard Wagner, der alles Üble immer mit einer Handbewegung gelassen zur Seite schob.
*
In dieser Zeit erschien endlich auch Peter Cornelius in München und im Wagnerschen Kreise. Er kam von Weimar zurück, in mäßigster Laune. Seine neue Oper, der »Cid«, war mit einem nur mäßigen Erfolge uraufgeführt worden. Sein »Barbier von Bagdad« hatte besser gefallen.
Cornelius hatte sich in München angekündigt. Als er eintraf, lebte Wagner schon in den Bayerischen Bergen. Sofort gab Cornelius zu, daß es ein Fehler gewesen war, der Münchner Tristanzeit fernzubleiben. Er wußte, daß Wagner das übelgenommen hatte. Als Wagner zurückkehrte, verflogen aber die Wolken wieder.
König Ludwig, der soeben sein zwanzigstes Jahr vollendete, hatte in diesen Wochen einen Ausflug in die Schweiz unternommen. Er hatte vorher im Hoftheater den »Wilhelm Tell« einmal unverkürzt aufführen lassen. In seiner großen Begeisterung wollte er nun alle Örtlichkeiten kennenlernen, welche eine Rolle in dem Schillerschen Drama spielten, den »Rütli«, die »hohle Gasse« und alles andere.
Inzwischen hatte auch Bülow an dem Arbeitsplane für die neu zu errichtende Musikschule gearbeitet, während Wagner eifrig in die Instrumentierung des zweiten »Siegfried«-Aktes vertieft war. Alle wollten dem jungen Könige bei seiner Rückkehr nach München etwas Fertiges vorlegen können. Dann gab es wohl sehr bald Entscheidungen, die man mit Spannung erwartete.
Aber erst im November war Ludwig wieder empfangsbereit. Tage, ja viele Wochen vergingen, in denen Ludwig schon damals nichts hören und sehen wollte von Menschen und Dingen, die sich ihm nahedrängten, obwohl er die Öffentlichkeit noch nicht scheute und haßte wie späterhin. Er war auch diesmal zum Münchner »Oktoberfest« erschienen, worauf die Münchner ein Anrecht hatten. Ein Oktoberfest ohne den »Kini« war gar nicht vorstellbar. Schon im April hatte er die Mitglieder des bayerischen Landtages – was es niemals gegeben hatte – zur Tafel geladen und zwischen den beiden Präsidenten gesessen, von drei Uhr nachmittags bis abends halb acht. Sein Trinkspruch lautete:
»Es freut mich, zum ersten Male die Vertreter meines Volkes um mich zu haben. Ich ergreife diese Gelegenheit, um auf das Wohl Bayerns und seiner Vertreter zu trinken.«
Am 23. August erschienen König Wilhelm von Preußen und Bismarck in München. König Wilhelm weilte dann – ohne Bismarck – am Geburtstage Ludwigs, am 25. August, in Hohenschwangau. Er ernannte Ludwig zum Chef des 1. Westfälischen Husarenregiments Nummer 8. Ludwig schien Bismarck also nicht besonders zu lieben. Wäre er zugänglicher diesem gegenüber gewesen, so hätte er Bayern im nächsten Jahre 1866 manche schlimme Stunde ersparen können.
Im November lud König Ludwig Richard Wagner nach Hohenschwangau ein. Das Zusammensein dauerte vom 11. bis zum 21. November. Wagner sprach später von »Wundertagen, wie sie Sterblichen nur selten beschieden waren«. Auf Hohenschwangau dichtete Wagner, indem er das »wechselvolle Weben« und die »Seelenwonne dieses innigen Verkehrs« besang:
»Vereint – wie mußt' uns hell die Sonne scheinen
Durch bange Schleier, die das Sehnen wob:
Der Trennung heut, wie muß der Himmel weinen
Ob eines Glückes, das so schnell zerstob!«
Bei der Abreise begleitete Ludwig Wagner im Wagen bis zur nächsten Bahnstation Bissenhofen.
*
Dieses herrliche Empfinden des Einigseins mit dem jungen Könige erlitt aber sofort einen Dämpfer, als Wagner nach München zurückkehrte. Schon von seinem Diener Mrazek erfuhr er, daß die Leute in den kleinen und großen Bierstuben wieder emsig am Durchhecheln waren; für alles, was ihnen an ihrem jungen Könige nicht gefiel, machten sie Wagner verantwortlich. Überall war die Rede von dem neuen großen Theater, das »der Kini« seinem Hofpreußen, dem Wagner, bauen wollte. Die Stadt München sollte eigenes kostbares Terrain auf den Isarhöhen dazu hergeben. Der Gemeinderat mußte dem einen Riegel vorschieben!
Auch Frau Eliza Wille schrieb bedenklich an Wagner: »Kunst und Poesie dürfen niemals das höchste Ziel königlicher Gedanken sein. Derjenige, der berufen ist, ein Volk im Herzen zu tragen, hat schwerere und ernstere Verpflichtungen, mein lieber Meister!«
Ganz ähnlich dachten und sprachen die Münchner: dem Könige stände es besser an, nach den schlimmen Ereignissen in Schleswig-Holstein an der Lösung der deutschen Frage mitzuarbeiten, anstatt an den Wagnerschen Interessen um »Tristan« und »Nibelungen«. Bildete dieses Preußen nach den Siegen von Düppel nicht eine Bedrohung auch für das friedliche Bayern? Würde dieser preußische Bismarck die Hegemonie seines Landes nicht nach allen Seiten hin ausdehnen wollen? Aus Schleswig-Holstein würden die Preußen nie wieder herausgehen. Mußte man dann nicht Anschluß an Österreich suchen, an die mächtigen Habsburger? Wartete nicht Österreich darauf? Die Wagnerclique aber sei Österreich feindlich, weil sie in Wien Wagners verrückten »Tristan« nicht hatten aufführen mögen.
»Es müßte bald etwas geschehen«, riet Frau Cosima dem wiedergekehrten Wagner.
»Was soll geschehen? Es ist doch alles in schönster Ordnung!«
»Ordnung? Sind Sie, Meister, ein Emissär Bismarcks, ein preußischer Freimaurergeselle, der dabei helfen will, das schöne katholische Bayern zu vergewaltigen?«
»Das ist dummes Zeug, Frau Cosima.«
»Gewiß. Aber die Münchner glauben das alles.«
»Die Münchner! Was wissen sie denn? Nur das, was sie in ihren Bräukellern hören, zwischen der dritten und vierten Maß. Und dann hören sie schief. Alles ist Wirtshausgeschwätz; die Ehefrau trägt es dann im Hause herum. Auf diese Weise entsteht die öffentliche Meinung in München. Alles, das Geringfügigste und das Erhabenste, zerreden sie hier in den Kneipen.«
»Um so wichtiger ist, daß etwas geschieht, Meister. Ich warne Sie!«
»Was soll ich denn tun? Der König weiß ja das alles. Er lacht, wenn ich Trübsal blase.«
»Sprechen Sie auch über Politik mit dem Könige?«
»Nur allgemein. Als ich in Hohenschwangau war, ersuchte er mich, ihm meine Meinung über die deutschen Angelegenheiten zu sagen und ihm in regelmäßigen Briefen meine Anschauungen auseinanderzusetzen.«
Frau Cosima wurde es angst bei dieser Vorstellung: »Das dürfen Sie nicht, auf keinen Fall dürfen Sie das! Der König würde Ihre Ansichten seinen Räten mitteilen. Wer alles hinter diesen Räten steht, wissen wir doch?«
Wagner wollte die Sache noch überdenken. Er sprach auch mit Bülow und Cornelius über den Fall.
Peter Cornelius hatte eine sehr hohe Meinung von König Ludwig, von »diesem ganz besonderen Menschen, der auch in jeder Jacke oder Kutte die Herzen gewinnen würde«. Er meinte einmal: »So, wie Ludwig, müßte der künftige Kaiser von Deutschland aussehen.« Er war aber vernünftig genug, das nur als unerfüllbaren Wunschtraum hinzustellen.
Wagner erzählte dann, er habe in Hohenschwangau dem Könige den Plan entwickelt, durch weitgehende demokratische Neuerungen sich an die Spitze der deutschen Bewegung für ein Reichsparlament zu stellen und vom Volke sich zum Kaiser erwählen zu lassen.
»Weiterhin schlug ich dem Könige vor«, fuhr Wagner fort, »in Bayern und später in ganz Deutschland das schweizerische Milizsystem einzuführen, also das stehende Heer abzuschaffen.«
Cornelius überflog ein Schauder, als er das hörte: »Du willst also mitregieren in Bayern? Das wäre der Anfang vom Ende, Richard! Nun und nimmer kann es glatt abgehen, wenn ein Künstler entscheidenden Einfluß auf das Gesamtleben des Staates erhält.«
Bülow dachte weniger furchtsam. Er war der Ansicht: »Es könnte sich unter außergewöhnlichen Verhältnissen ereignen, daß ein regsamer, vielseitiger Geist wie Wagner, der doch immer eine ideale Richtung verfolgt, einen guten Anstoß zu günstiger Entwicklung gäbe. Eine gefährliche Sache bleibt es aber trotzdem!«
*
Bei König Ludwig schien der Plan, in Bayern die schweizerische Miliz einzuführen, auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein. Kein Wunder, da er allem Militärischen ablehnend gegenüberstand. Er hatte den bisherigen bayerischen Gesandten beim Frankfurter Bundestag, Herrn von der Pforten, auf Anraten seiner Familie zum Ministerpräsidenten ernannt, als Nachfolger des Herrn von Schrenk, des Ministers von König Max. Diesem Herrn von der Pforten machte er Mitteilung von Wagners Idee mit der Miliz. Von der Pforten hatte nichts Eiligeres zu tun, als sofort den bayerischen Feldmarschall Prinzen Karl zu benachrichtigen. Beide waren längst eifrige Wagnergegner.
Das bayerische Heer mußte vor solchen Anschlägen geschützt werden. Und dieser gefährliche Wagner mußte so bald wie möglich verschwinden!
Wagner hatte es gar nicht so ernst gemeint. Er hatte nur über die Miliz im allgemeinen gesprochen, weil diese in der Schweiz sich bewährt hatte. Freilich war diese Schweizer Miliz auch noch nie auf eine harte Probe gestellt worden.
Gerade in diesen Monaten hatte Herr von Bismarck seinen heftigen Kampf um die Verstärkung des preußischen Heeres auszufechten, im Streite mit Demokraten und Zentrum im preußischen Landtage. Es schienen also neue stürmische Zeiten auf dem Wege zu sein? In Bayern bezog man auch das auf sich selbst. Und da wollte der Wagner, dieser preußische Bismarckspitzel, schnell noch das bayerische Heer abschaffen? Das hätte ihnen so passen können, den Preußen!
*
Wie stark man mit dem Einflusse Wagners auf König Ludwig rechnete, zeigte sich auch auf einem anderen Gebiete. Eines Tages erschien der königliche Kabinettsrat von Lutz bei Wagner. Er hatte ein Anliegen: »Herr Wagner! Sie wissen, daß in Preußen ein heftiger Kampf mit der Demokratie entbrannt ist. Bismarck hat es schwer, sich zu behaupten. Dasselbe kann auch in Bayern Ereignis werden. Unsere Liberalen sind gefährliche Leute.«
» Ihre Liberalen?« lächelte Wagner.
»Im Hintergrunde des Liberalismus lauert immer Umsturz und Feindschaft zur Kirche. Wir haben Beweise.«
»Was ist da zu tun? Der König –«
»Eben vom Könige wollte ich reden, Herr Wagner. Sie sind doch sein befreundeter Ratgeber?«
» Ich?« rief Wagner erstaunt. »Ratgeber? Für Oper und Konzerte, also in Musikangelegenheiten. Das wissen Sie doch?«
Herr von Lutz lächelte schlau: »Wenn Sie beim Könige sind, Herr Wagner, wird auch von Politik gesprochen, man erzählt sich das überall.«
»Hinter der vierten Maß Hofbräu?«
»Auch in der besten Gesellschaft. Sie sind auch Politiker, Herr Wagner, nicht nur Musiker.«
»Wenn ich beim Könige von Politik anfange, blickt er zur Zimmerdecke und fängt dann zu pfeifen an.«
»Ja, ja – das kennen wir schon bei ihm. Aber dann hört er zu und grübelt über das, was er gehört hat. Es geht uns um folgendes. Wir, die ersten Stützen des Landes, halten die jetzige Verfassung für zu weitgehend liberal. Wir wollen nicht haben, daß es auch in Bayern so weit kommt wie in Preußen. Zu Zeiten Ludwigs des Ersten und seines Sohnes Max lag alles anders. Heute stehen wir vor ernstesten Zukunftsdingen. Ein deutscher Krieg ist nicht ausgeschlossen.«
»Der Himmel verhüte dieses Verbrechen.«
»Das sagen auch wir, Herr Wagner. Vorbeugen ist aber besser als heilen. Könnten Sie nicht beim Könige dahingehend vorstellig werden, daß er die politische Lage viel ernster auffaßt, als er bisher getan hat? Nur das Wahlrecht soll ein wenig eingeschränkt werden, damit staatsgefährdende Elemente nicht in den Landtag gelangen können. Das übrige findet sich.«
Wagner wurde schon ärgerlich: »Nein, Herr von Lutz, das kann ich nicht tun. Das müssen Ihre Minister dem König vorschlagen. Ihr Herr von der Pforten soll nur ebenso handeln wie Bismarck.«
»Herr von der Pforten ist aber kein Bismarck.«
»Nie sagten Sie etwas Wahreres, Herr von Lutz. Leider ist er kein Bismarck. Ich selbst habe augenblicklich ein größeres Interesse an meinem ›Siegfried‹, es ist Zeit, daß er fertig wird. König Ludwig drängt auf Fertigstellung meiner ›Nibelungen‹, schon vom ersten Tage unserer Bekanntschaft an. Das sind die Dinge, über die wir sprechen, der König und ich.«
Herr von Lutz hatte sich umsonst bemüht, das sah er jetzt ein.
Natürlich war alles Lüge, was der kleine Sachse da sagte. Und wenn er auch gerade kein Feind des bayerischen Volkes war, wie sie in den Bierkellern schrien, so war er auch nicht dessen Freund: eben ein Preußen-Sachse.
Als Frau Cosima hörte, um was es sich handelte, sagte sie: »Ich habe das kommen sehen, seien Sie vorsichtiger, Meister. Sonst hat alles eines Tages ein Ende. Für diese Minister, die immer fürchten, durchschaut zu werden, sind Sie zu klug und zu welterfahren. Alle diese Leute um den König herum sind Intriganten.«
»Das geht zu weit.«
»Fragen Sie Hans. In der vorletzten Woche erlebte er Seltsames. Man ist in sein Arbeitszimmer eingebrochen und hat seine Schriften durchstöbert. Es fehlten zwei Briefe.«
»Und weiter?«
Frau Cosima hatte empörte Augen: »Vor einigen Tagen stand der Inhalt dieser Briefe in einem Wiener Journal abgedruckt.«
»Österreichische Spionage also. Welchen Inhalt hatten die Briefe?«
»Nur einen privaten, ganz unverfänglichen. Auch in Wien hält man uns für preußische Emissäre, für Bismarckspione zum Nachteil Österreichs. Es sei unsere Aufgabe, glaubt man in Wien, König Ludwig auf die preußische Seite zu ziehen.«
»Sind diese Leute verrückt?« brauste Wagner auf. »Alles, was wir hier tun, tun wir bei Tageslicht, außerdem führen wir hier Musikdramen auf. Jedes Kind weiß das jetzt in Europa. Die Zeitungen schreien es laut genug in die Welt hinaus.«
Frau Cosima lächelte: »Ihr Einfluß auf den jungen König ist allen zu groß, Meister.«
Wagner rang verzweifelt die Hände: »Aber, ich sehe doch den König gar nicht so oft? In der Hauptsache schreiben wir Briefe.«
»Noch etwas anderes Peinliches, Meister. Ich weiß, Sie sind schon wieder in Geldnöten. Was tun Sie mit Ihrem Gelde? Es rinnt Ihnen aus den Händen. Frönen Sie kostspieligen Leidenschaften, von denen wir noch nichts wissen?«
»Unsinn!« rief Wagner, »es kommen nur immer wieder Mahnungen von alten Gläubigern. Alle glauben, ich schwimme im Golde. Leute, die schon alles gestrichen hatten, weil sie nichts kriegen konnten, melden sich jetzt. Sie werden wieder munter und singen vor Freud'.«
»Decken Sie doch alles das endlich ab, um ein Ende zu machen!«
»Alle noch schwebenden Schulden? Wovon denn? Ich kenne nicht einmal die ganze Summe, ich habe nie Buch über diese Dinge geführt, ich bin kein Krämer.«
»Sie sind ein ganz großes Kind, lieber Meister. Man merkt, daß Ihnen die Hausfrau fehlt.«
»Leider. Wenn ich an eine Frau denke, sehe ich immer nur Sie, liebe Cosima.«
»Zur Sache, Meister. Ich rate Ihnen: entlehnen Sie von König Ludwig aus dessen Privatvermögen einen größeren Betrag zur Schuldendeckung. Sonst kommen Sie nie aus dem Elend heraus.«
»Unmöglich! Nicht schon wieder! Erst neulich, vor der ›Tristan‹-Aufführung, löste der König den hohen Wechsel ein. Und jetzt –«
»Es soll nur ein Darlehen sein, Meister, das Sie aus den Einkünften aus Ihren Werken zurückzahlen. Ich will in Ihrem Namen an die königliche Kabinettskasse schreiben. Wir wollen aber nicht wieder zu wenig fordern. Sie müssen eine Art Fonds übrigbehalten, aus dem Sie schöpfen können.«
»Wieviel dachten Sie, daß wir fordern?«
»Um mindestens fünfzigtausend Gulden wollen wir bitten.«
»Die werden sie uns nicht geben, liebe Cosima.«
»Es muß versucht werden. Sie müssen auch an den König schreiben, Meister, und Ihre Notlage schildern.«
»Oh, es ist jammervoll! Wann endlich wird die Zeit kommen, daß die Menschen mich mit solchen Dingen verschonen? Ich schenke den Deutschen eine ganz neue deutscheste Kunst, und die Menschen lassen mir nicht einmal den Atem zum Leben.«
»Ganz so schlimm ist es nicht, Meister. Sie müssen nur besser haushalten. Ich werde Ihnen von jetzt an scharf auf die Finger sehen. Ich werde Ihre Kasse verwalten und Ihre Ausgaben kontrollieren.«
»Sie sind ein Engel, Cosima.«
»Schreiben Sie lieber an Ihren König, und ohne Verzug. Aber nicht etwa wieder in Versen – nur in Prosa!«
Wagner tat das Verlangte. Nicht gern. Aber Cosima hatte recht. Hätte er nur damals, als der König ihn zu sich berief, eine höhere Summe erbeten! Von seinen jetzigen 4000 Gulden im Jahre konnte er nicht auch noch alte Schulden abdecken. Sie reichten kaum zur Führung des Haushaltes aus. Wagner hatte sogar seinen Verleger Schott in Mainz schon wieder um Vorschüsse angehen müssen.
*
Auch von dem neu zu erbauenden Festspielhaus für deutsche Kunst war in den Unterredungen und Briefen zwischen Ludwig und Wagner wieder viel die Rede gewesen. Gottfried Semper, der Architekt, kam aus Dresden und stieg im Wagnerschen Hause ab. Seit Zürich hatten die beiden Achtundvierziger einander nicht mehr gesehen.
Den Beratungen über die von Semper bereits entworfenen Baupläne wohnten auch Bülow und Gattin bei und Peter Cornelius. Wagner war völlig einverstanden mit Sempers Ideen.
Dieser hatte ganz richtig begriffen: nicht für Wagner wollte König Ludwig das neue Theater erbauen, sondern für seine Königsstadt München.
Der König befahl Semper zu einer Privataudienz und ließ sich die Pläne erklären. Jede Einzelheit erregte sein hohes Interesse. Er gab Semper den mündlichen Auftrag zur endgültigen Fertigstellung der Pläne, damit man jeden Tag anfangen könne.
Hochbefriedigt reiste Semper wieder nach Dresden zurück. Er staunte über seinen alten Freund Richard Wagner. Bisher hatte er ihn nur für einen unruhigen Außenseiter gehalten, der die übrige Welt, diese misera contribuens plebs, höchstens zum Anhören Wagnerscher Musik für würdig erachtete, der er im allgemeinen aber nichts Gutes zutraute. Genau wie sein Philosophenabgott Schopenhauer zum Beispiel.
Jetzt stand er einem echten Könige der Zeit zur Seite, als Helfer, Berater, keinem unbeständig zögernden, sondern einem tatkräftigen jungen Manne mit edelsten Absichten. Und wenn man auch republikanisch dachte: einen solchen König konnte man sich gefallen lassen. Hätte es immer nur solche Ludwig-Könige gegeben, hätte man niemals Revolutionen erlebt.
So dachte Gottfried Semper, der Erbauer der damaligen »Großen Barrikade« in Dresden.
*
So dachten aber die Münchner nicht.
Keiner machte die Bevölkerung darauf aufmerksam, daß es sich um einen neuen herrlichen Bau zur Veredlung und weiteren Verschönerung des Münchner Stadtbildes handelte.
Als jetzt, nach Sempers Anwesenheit, in weiteren Kreisen bekannt wurde, was Ludwig, der König, im Sinne hatte, kam großer Widerstand auf. Von neuem gingen die Wogen hoch: »Der Kini will dem Verschwender Wagner auch ein neues Theater bauen? Diesem Geldvergeuder und Bayernfeind, der das bayerische Heer abschaffen wollte, damit die Preußen das wehrlose Bayern einstecken konnten, wie sie schon Schleswig-Holstein eingesteckt hatten? Und der Münchner Gemeinderat sollte auch noch Grund und Boden hergeben? Und ganz umsonst?
Noch ein neues Theater? Und wer würde die Kosten tragen? Der Richard Wagner ganz sicher nicht. Wohl aber der Münchner Bürger, der fleißige Beamte und Kaufmann, der biedere Handwerker. Zuerst würden sie natürlich wieder den Bierpreis erhöhen!
Brauchte man in München ein neues Theater? Wahrhaftig nicht. Es gab schon genug Theater in München – oft genug standen sie leer.
Nur der Richard Wagner brauchte es für seine noch zu schreibenden Opern, also für die Zukunftsmusik, welche die Stimmen aller Sänger kaputt machte. Der arme Schnorr, der Tristansänger, hatte sogar sterben müssen an ihr.
Und nicht etwa ein Münchner Architekt sollte das neue Theater bauen, sondern schon wieder ein Norddeutscher, der Barrikadenerbauer aus Dresden. Als ob es keine Münchner Architekten gäbe, die so ein Theaterchen bauen konnten, und mochte es noch so groß sein!
Ebenso erbittert dachte man im Kreise der Kabinettsräte und der Minister. Diese hatten es dem so sparsam bescheidenen Ludwig gar nicht zugetraut, daß er den Wert und die Bedeutung des Geldes so wenig beachten würde. Hatte er keine Vorstellung von den Kosten eines solchen Theaterneubaus? Wo sollte das Geld herkommen? Seine Privatkasse vertrug keine neue Belastung, die in die Millionen gehen würde. Und der Staat benötigte sein bißchen Geld für Heeresausgaben viel dringender. Oder sollte man auswärts Anleihen aufnehmen, nur damit der Wagner-Richard zu seinem Nibelungen-Theater kam?
*
Der Minister von der Pforten und der Kabinettsrat von Pfistermeister, diese beiden überreaktionärsten Gestalten aus der Umgebung des Königsthrones, machten dem jungen Monarchen Vorstellungen, das war ihre Pflicht. Aber sie malten auch in schwärzesten verlogenen Farben die Folgen aus, die eine solche Geldvergeudung haben konnte, und König Ludwig wurde wankelmütig. Was seine Minister und Räte auseinandersetzten, blieb nicht ohne Eindruck auf ihn. Aber er hatte dem Architekten Semper sein Wort gegeben. Ein Königswort war ein Königswort, daran gab es wenig zu deuteln.
Alles hing von der politischen Entwicklung ab. Blieben die Preußen ruhig, begann dieser Herr von Bismarck keinen Streit mit Österreich, was zu hoffen war, so konnte auch der bayerische Staat an dem Festspielbau sich beteiligen. Also verschob man zunächst den herrlichen Plan. Von Aufgeben war keine Rede.
Gottfried Semper wartete also vergeblich der Aufforderung zum Baubeginn. Er schrieb an den König. Er erhielt eine ausweichende Antwort: man sei noch nicht ganz so weit!
Mehrere Wochen später erhielt Semper die Nachricht, er möge nach München kommen, um das Baugebiet zu studieren. Semper setzte sich auf die Bahn, aber König Ludwig war nicht zu sprechen, er war in seine geliebten Berge gefahren. Die Menschen hatten ihn, den König, wieder geärgert. Wie durften sie das? Wozu war er dann König? Ludwig wollte niemand sehen, und Gottfried Semper mußte unverrichteterdinge wieder nach Dresden fahren.
Anfang November, kurz vor der Reise Wagners nach Hohenschwangau, erhielt Semper ein Handschreiben König Ludwigs: »Ich begrüße es, daß der größte Architekt und der größte Dichter und Tonkünstler dieses Jahrhunderts sich vereinigen, um ein Werk zu vollbringen, welches dauern soll bis in die spätesten Zeiten, zum Segen, zum Wohle der Menschheit. So rufe ich Ihnen nun ›Heil!‹ zu, aus ganzer Seele: Gedeihen Ihrem Werke!«
Wagner hatte schon von München aus den König darum ersucht, in der Angelegenheit des Festspielhauses seinen Warnern und Übelrednern nicht nachzugeben. Wenn ein König seine Residenz verschönern und veredeln wolle, so habe ihm keiner dreinzureden. Wer sonst solle für Kunst und Kultur sorgen, wenn nicht die Fürsten? Die Fürsten hätten das immer getan; schon im Altertum. Die Oper sei von Anfang an auf fürstliche Mäzene angewiesen gewesen. Oft habe man diese deswegen angefeindet, so auch die Medici in Florenz. Um ihnen später bewundernden Dank auszusprechen und Denkmäler zu errichten.
Ludwig aber sagte in Hohenschwangau zu Wagner: »Mehr und mehr muß ich einsehen lernen, daß meine Absichten, mein Wirken zur Förderung der Kunst, nur von wenigen Auserwählten verstanden wird.« Ludwig war richtig übellaunig, als er das sagte. Er hatte lange wieder über das Königsein nachgedacht. Wenn er gar nichts zu sagen hatte, hatte es dann überhaupt noch Sinn, von einem »König« zu sprechen? Bei allem, was er sich vornahm und was er zum Ausdruck für seine Freude am Schönen zu gestalten beabsichtigte, mochte es sein, was es wollte, lehnte seine Umgebung das ab, entweder seine Minister oder seine Familie. Er mochte alle diese Menschen schon gar nicht mehr sehen; am liebsten wäre er vor ihnen geflohen.
Nur vor dem einen nicht: vor seinem geliebten Freunde und Meister!
*
Dieses freudige Vertrauen, diese unüberwindliche Liebe erhielten aber einen kleinen störenden Riß, als er Wagners Brief wegen des Darlehens erhielt. Ging der »Geliebte«, wie Ludwig den Freund immer in seinen Briefen anredete, nicht ein wenig zu scharf ins Treffen?
Wie konnten immer neue Schulden bei Wagner entstehen? In München lebte er doch zurückgezogen und nur seiner Arbeit verbunden? Man hörte nichts von rauschenden Festen oder Gesellschaften in der Briennerstraße. Schulden von früher? Wagner hatte doch nie ein wüstes Leben geführt oder gespielt? Das sah ihm nicht ähnlich, diesem Idealisten und hehren Geistesarbeiter. Die erste große Schuldenlast hatte Wagner, wie Ludwig wußte, damals in jungen Jahren in Dresden auf sich geladen, als er die Partituren seiner drei ersten Opern, um sie allen Theatern einsenden zu können, auf eigene Kosten stechen und vervielfältigen ließ. »Auf eigene Kosten« hieß so viel, daß er diese dem Drucker schuldig blieb, da seine Partituren fast sämtlich wieder zurückkamen, also nichts einbrachten. Diese Bergeslast – ein sehr hoher Betrag – wurde er gar nicht mehr los. Und immer neue Schulden kamen im Laufe der Jahre hinzu.
Wagner wußte selbst nicht mehr, wie alle diese Schulden entstanden waren, wie sollte König Ludwig es wissen?
Nicht, daß der König seinem Freunde den Betrag nicht gönnte. Ihm graute nur vor den Gesichtern seiner Kabinettsräte, die er einweihen mußte. Von neuem würden sie ihm jeden einzelnen Gulden vorrechnen, den er bereits für Wagner, dessen Anhang und dessen Werke geopfert hatte.
Herr von Pfistermeister erschrak, als Ludwig über das erbetene Darlehen zu sprechen begann. Ein Darlehen? In diesen unruhigen Zeiten? Das kannte man schon! Ein Darlehen auf Nimmerwiedersehen wahrscheinlich. Wie wollte dieser von niemand für voll angesehene Musiker Wagner je in seinem Leben vierzigtausend Gulden zurückerstatten? Auf diese Summe war man im Hause Wagner herabgegangen.
»Euer Majestät«, erläuterte Pfistermeister mit gerunzelter Stirn, »die königliche Kabinettskasse wird diesen hohen Betrag gar nicht aufbringen können – wie alles liegt.«
Ludwig machte Einwendungen, aber auch die anderen Räte schüttelten eigensinnig die Köpfe. Viel zuviel sei für die ganze »Wagnerei« bereits aufgebracht worden, das müsse endlich ein Ende nehmen!
»Ich sah es mit eigenen Augen, Majestät«, grollte Pfistermeister, »wie die Gläubiger in Wien dem Wagner seine unbezahlten Prunkstücke in Kisten aus dem Hause geholt haben.«
Ludwig, auf lange Zeit wieder stark verärgert, schrieb Wagner einige tröstende Zeilen: die Sache verzögere sich. Dann reiste er wieder in seine geliebten Berge zurück.
*
Als Ludwig zum Oktoberfest wieder in München war, drängte Frau Cosima: »Sie müssen jetzt eine Audienz nachsuchen, Meister. Die Mahnungen nehmen noch zu. Die Drohungen hören nicht auf. Wollen Sie wieder die Schuldhaft riskieren?«
Wagner geriet in helle Verzweiflung: diese liebe Cosima hatte ihre eigene Art, die Menschen zu nötigen, aber sie hatte recht, wie immer.
Die Audienz kam zustande, Ludwig war freundlich wie sonst.
Es kam zu einer tiefschürfenden Auseinandersetzung; nicht über das Schuldenmachen, sondern über das Königtum dieser Zeit. Ludwig beteuerte, daß es sehr schwer sei, den Anschauungen aller gerecht zu werden: »Alle Augenblicke stehe ich Hemmungen gegenüber. Keiner versteht mich oder will mich verstehen, alle belügen mich. Immer soll ich nur ausführen, was meine Umgebung mir zumutet. Weigere ich mich, dann kommen sie und drohen mit dem Umsturz alles Bestehenden durch Anarchisten und Gottesleugner. Man stellte mir auch schon ewige Höllenqualen in Aussicht, für den Fall, daß ich nicht dieses oder jenes veranlaßte.«
Auch Wagner klagte über die Mitwelt. Keiner sehe ein, daß er das Beste wolle. Alle paar Tage ständen gehässige Malicen über ihn in der Münchner Presse: »Diese Elenden zermürben mich noch, bis ich unter der Erde bin.«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Meister«, tröstete Ludwig, »das erbetene Darlehen habe ich bewilligt. Hier ist die Anweisung. Ich mußte meine Räte erst von Ihrem guten Willen überzeugen; das ist mir gelungen.«
Worin Ludwig sich maßlos täuschte. Die Räte hatten nur nachgegeben, weil Königin Marie, Ludwigs Mutter, sich dafür einsetzte und darum bat, ihrem Sohne keinen Ärger mehr zu bereiten. Das errege ihn immer und schade seiner Gesundheit.
Als Wagner nach vielen Dankesbeteuerungen Ludwigs Zimmer verließ, sah er Herrn von Pfistermeister an einem Tische im Vorzimmer sitzen, der ihn damals in Stuttgart gesucht und gefunden hatte. Heute war er ihm feindlich gesinnt, wie es den Anschein hatte. Wagner konnte sich nicht enthalten, ein wenig zu prahlen, um den Unhold zu ärgern.
»Da – Herr von Pfistermeister – wollen Sie sehen? Der König hat mein Darlehen bewilligt. Oh, er ist gütig und hilfreich – ein echter König. Wenn er nur edelmütigere Ratgeber hätte.«
Pfistermeister gab keine Antwort, aber er bebte vor Zorn und dachte an Rache.
*
Inzwischen war auch die Angelegenheit der »Neuen Königlichen Musikschule« weitergediehen. Das Gutachten, welches der König bei allen Münchner Musikgelehrten hatte einholen lassen, fiel erbarmungslos, ja vernichtend aus. Kein gutes Haar ließen die Gegner an Wagners Vorschlägen. Teilweise trug Wagner auch hieran die Schuld. In der von ihm beliebten Art pathetischer Dialektik stellte er auch eine Reihe verstiegener idealer Forderungen auf, deren Absurdität nachzuweisen, nicht schwer war. Wagner empfand aber nur die Animosität dieser Ablehnungen: wo Herr Franz Lachner und der brave Professor Riehl um ihre Ansicht gefragt wurden, konnte für ihn kein Weizen blühen.
Also sollte es mit dem bisherigen Schlendrian und allen vorhandenen Übelständen am Konservatorium weitergehen? Dieses sollte nach Wagners Vorschlägen zunächst Stilbildungsschule werden, nicht nur eine solche zur Aneignung technischer Fertigkeiten. Gerade diese gesunde Grundidee verklausulierte Wagner mit vielen unpraktischen, ja kaum durchführbaren Nebenforderungen. Wagner ging auch in der Schulfrage von völkischen Erwägungen aus. Was konserviere man eigentlich in den bestehenden deutschen Konservatorien für Musik? Gar nichts, denn es gäbe gar nichts zu konservieren. In den italienischen und französischen Musikschulen sei das anders, dort würde der überkommene Stil der früheren Zeiten gepflegt, der schon rein geschichtlich mit dem nationalen Leben verwachsen war.
Diesem historischen Stile der anderen hätten wir Deutsche nichts Ebenbürtiges zur Seite zu stellen. Es gäbe überhaupt keine Überlieferungen in der Tonkunst. Wir besäßen zwar klassische Werke in Fülle, aber keinen klassischen Vortrag für diese. Diesen Stil solle endlich die kommende neue Musikschule festlegen.
Daß Wagner hiermit auch dem Schematismus und der Schablone das Wort redete, kam ihm wohl kaum zum Bewußtsein. War es nicht künstlerischer empfunden, ohne jede überlieferte Muß-Aufführung jeden Dirigenten, Klavierspieler, Gesangsmeister oder Sänger eigenste musikalische Empfindung in seine Wiedergabe hineinlegen zu lassen, was nur Gutes hervorbringen konnte, vorausgesetzt, daß der Wiedergebende wirklich ein schöpferisch veranlagter Künstler war?
Wagner hatte auch schon bei der Auswahl der Prüfungskommissare Protest erhoben, und zwar gegen Professor Riehl, der auch in der Presse gegen ihn feindlich geschrieben hatte und für den schon Beethoven zu umstürzlerisch fortschrittlich war.
Ohne erst die Fakultät zu befragen, hatte König Ludwig auf Anraten Wagners vorher noch den Heidelberger Privatdozenten Ludwig Nohl zum Professor für Musikgeschichte nach München berufen. Neue Entrüstung – diesmal auf Seiten des Universitäts-Lehrkörpers.
Der Prüfungsausschuß lehnte also Wagners Vorschläge zur Umbildung des Konservatoriums ab. Wagner hatte vorsorglicherweise dem Könige diese Entscheidung vorausgesagt, da er die Leute richtig einschätzte, die zu Gericht über ihn saßen. Der König war also gut vorbereitet; er wollte diesmal aber energisch auftreten. Er schrieb an Wagner:
»Das Konservatorium muß vom Ministerium völlig getrennt werden. Die Kosten muß die königliche Zivilliste übernehmen. Außerdem werde ich das alte Konservatorium schließen und den Lehrkörper sofort entlassen.«
Wagner und seine Freunde erschraken über diesen Gewaltstreich, der dem Könige eigentlich gar nicht lag. Den Lehrkörper auflösen wollte er und soundsovielen Unschuldigen das Brot nehmen? Das gab neue bedrückte Seelen und Unzufriedene, also neue Widersacher.
Es war schon so und immer das gleiche: Wenn er, Wagner, keine Fehler beging, machten andere diese Fehler für ihn. Er aber war immer der Leidtragende.
Wieder liefen Wellen und Wogen allgemeiner Entrüstung durch München.
Die jetzt entlassenen Konservatoriumslehrer erteilten auch Unterricht in den breiten Münchner Bevölkerungskreisen, einige auch in Adelsfamilien. Hier sangen sie Klagelieder gegen den Schädling Wagner, der an ihrer Entlassung die Schuld trage.
Keine andere mit Wagners Tätigkeit in München verbundene Maßregel hat in weitesten Kreisen soviel böses Blut gegen die »Wagnerclique« gemacht, als gerade diese. Aus allen diesen geschädigten Musikern wurden ebensoviele Agitatoren gegen die Wagnersche Richtung. An ihrer Spitze stand der frühere Klavierlehrer des Königs, der Hofrat Wanner, der leidenschaftlich in aller Öffentlichkeit gegen Wagners »verrückte Musik und Ideen« Front machte, seitdem Hans von Bülow und nicht er Vorspieler des Königs geworden war.
Es war also alles wieder sehr schön im Gange – die Hatz begann. Auch die Presse nahm Stellung, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, an Stoff fehlte es nicht und an bissigen Skribenten noch weniger.
Unbeirrt von allem Widerwärtigen gingen Wagner, Hans von Bülow und Peter Cornelius sofort ans Werk, um die neue Musikschule aufzubauen. Man erreichte beim Könige, daß der größte Teil der entlassenen Musiklehrer wieder angestellt wurde. Das besänftigte ein wenig die Wogen, aber nicht die empörten Gemüter der Maßgebenden. Diese predigten unentwegt weiter gegen alle Preußen und Nordlichter.
Peter Cornelius, der schon nicht ohne Gruseln nach München gekommen war, hegte die tollsten Befürchtungen, als die große neue Hetze begann.
»Bald können wir alle unser Bündel schnüren«, erklärte er Bülow, »alles hier war viel zu schön, als daß es von Dauer sein konnte!«
*
Künstlerischer Leiter der neuen Musikschule war Hans von Bülow geworden. Auch Cornelius wurde angestellt und Eduard Lassen aus Jena berufen. Nur der Gesangspädagoge Schmitt verblieb in der schon gegründeten Opernschule. Er erschien Wagner und Bülow zu einseitig und eigensinnig in seinem Bestreben, den Schülern in der Hauptsache den von ihm selbst erfundenen »Schmittschen Ton« beizubringen, ohne den – nach seiner Ansicht – die Schaffung einer national-deutschen Gesangskunst nicht möglich war.
Auch seine aufdringlichen, burschikosen Umgangsformen mit Schülern und Schülerinnen konnte er sich nicht abgewöhnen. Man konnte keinen Staat mit ihm machen.
Auch in seiner Opernschule erzielte er keine Fortschritte, er hatte Pech. Es fanden sich weder vielvermögende, kunstbegnadete männliche noch weibliche Schüler ein, die bei ihm zu lernen wünschten. Friedrich Schmitt, der unzulängliche, verschwand eines Tages wieder aus München und ging nach Wien.
*
Eines Tages gelangte eine Benachrichtigung aus der königlichen Kabinettskasse in das Wagnersche Haus, daß der Betrag des Darlehens in Höhe von 40 000 Gulden bereitstehe.
»Wen schicken wir«, fragte Wagner, »der das Geld abholt?«
»Ich gehe selbst«, erklärte Frau Cosima, »Sie brauchen nur eine Vollmacht und eine Quittung zu schreiben, Meister.«
An der Kasse erwartete Frau Cosima, eine Banküberweisung zu erhalten. Der Kassierer schüttelte aber den Kopf: »Eine Überweisung? Nein, meine Gnädigste. Der Betrag steht nur in bar zur Verfügung – da, sehen Sie, bitte?«
Auf einem Tische der Kanzlei standen eine größere Anzahl von Geldsäcken nebeneinander – 40 000 Gulden in Silberstücken. War das eine neue Malice, oder wollte man aufgesammeltes Silbergeld unterbringen? Frau Cosima kam nicht dahinter. Aber sie, die praktische Frau, dachte sich wenig dabei: Geld war Geld, das Silber konnte man auf jedem Bankkontore in Geldscheine umwechseln.
»Wie bekomme ich diese schweren Säcke nach Hause?« fragte Frau Cosima.
»Wir senden sie Ihnen per Fuhrwerk«, versprach der Kassierer und lächelte gönnerhaft.
Am nächsten Mittage rollte ein von zwei Pferden gezogener Lastwagen über die Briennerstraße, umgeben von zwanzig Soldaten und gefolgt von einer großen Menge von Mitläufern und Straßenjungen. Alle schrien und lärmten. Was sie schrien?
»Da geht es hin, das Geld der armen Leute.«
»Jetzt können sie wieder fein leben, die Preußen.«
Eine ganze Horde erregter Menschen versammelte sich vor dem Wagnerschen Hause, als der Lastwagen haltmachte. Auch noch beim Abladen der Geldsäcke schrien alle weiter, pfiffen und johlten.
Frau Cosima wußte jetzt: alles das war eine abgekartete und vorbereitete Sache. Man wollte die gesamte niedere Münchner Bevölkerung gegen den Meister mobilmachen: wiederum verschwand »ein ganzes Vermögen« im Hause der »Bayernfeinde«!
Am nächsten Tage sprach die ganze Stadt München nur noch davon, daß der junge König »viele Millionen in Gold und Silber« in das Haus der Feinde des bayerischen Heeres habe schaffen lassen. Diese Millionen würden wahrscheinlich nach Berlin wandern, zu den preußischen Hungerleidern. Und arme Münchner Bürger mußten darben und durch neue Steuern aufbringen, was der Herr Richard Wagner »mit sei Theaterbudn« verschwende.
Frau Cosima hatte große Mühe, den erregten Wagner zu besänftigen, der sofort beim Könige Beschwerde einlegen wollte: »Seien Sie klug, Meister, bereiten Sie dem Könige keinen neuen Kummer. Freuen wir uns, daß wir das Geld haben – was gehen uns diese Schreier an?«
Sie schwiegen aber nicht still, die Schreier. Sogar auf Straßen und Plätzen ergriffen Redner das Wort. Sie forderten, daß die Bevölkerung einen großen Demonstrationszug nach der Briennerstraße veranstalte und dem Wagner alle Fensterscheiben einschlage. Auch vor der königlichen Residenz müsse das Volk erscheinen und eine Deputation zum Könige schicken, damit dieser endlich die wahre Meinung seiner Münchner erfahre.
Auch an den alten guten abgedankten Ludwig den Ersten trat man heran: er solle seinem lieben Enkel, dem Könige, einmal ein Licht aufstecken darüber, daß es nun an der Zeit sei, dem »hergelaufenen Musikanten Wagner den Marsch zu blasen«. Der alte König drückte sich philosophisch aus: »Alles kommt schon von selber wieder zurecht«, sagte er. Oh, er wußte aus eigener Erfahrung am eigenen Leibe, was es bedeutete, wenn diese zart empfindenden Münchner es einmal mit der moralischen Entrüstung bekamen. Als er damals, vor siebzehn Jahren, der graziösen spanischen Lola Montez ein wenig verspätetes Jugendfeuer zuwendete, außer einigen sonstigen nahrhafteren Emolumenten, hatte es in der Barerstraße, wo die Tänzerin wohnte, auch schon Volksaufläufe gegeben.
Ein richtiges »Vaterunser« war damals gegen diese Lola gedichtet worden, worin man den Himmel anflehte, dieser Lola den Garaus zu machen. König Ludwig der Ältere wußte nicht einmal, daß es auch jetzt schon wieder Leute in München gab, welche Richard Wagner nur noch den »Lolus« nannten und im Begriffe waren, jenes alte Vaterunser zeitgemäß umzudichten.
Die Drahtzieher, welche das alles auf dem Gewissen hatten, wollten für alle Fälle ein Druckmittel in die Hand bekommen: man mußte König Ludwig nachweisen können, daß das Volk energisch auf der Entfernung des Schädlings Wagner aus München bestehe. Politisch standen diese Drahtzieher auf der klerikalen, österreichfreundlichen Seite. Diese Leute begannen jetzt auch, die bayerischen katholischen Gesellenvereine mobil zu machen mit dem Hinweis darauf, daß wieder einmal die Religion in Gefahr sei!
*
Auch in den gebildeteren Bürgerkreisen griff allmählich die Meinung durch, daß Wagner und Genossen kaum nur aus künstlerischen Beweggründen in München sich aufhielten. Der nüchterne Bürgerverstand sträubte sich dagegen, daß man des bißchen Theaterkrams wegen einen so bombastischen Apparat in Szene setzte. Das alles mochte sozusagen nur Vorwand sein. Die »Patriotenpresse«, dieses und jenes klerikale Lokalblättchen in München, bestätigte das.
Daß Wagner, Bülow und alle anderen im Solde Bismarcks stehenden Norddeutschen nichts anderes im Sinne hatten, als den Wohlstand des bayerischen Volkes zu zermürben, war die allgemeine Ansicht seit Monaten schon. Zuerst sollten sie versuchen, einen starken Einfluß auf den König zu gewinnen, der noch jung genug war, um auf alle phantastischen Dinge einzugehen, die man ihm vorschlagen mochte. Alles lief auf die beabsichtigte Verpreußung des bayerischen Denkens hinaus: die preußischen Protestanten wollten das frommkatholische bayerische Volk an der Seele schädigen, um es dann um so leichter auch politisch unterjochen zu können.
*
Und Ludwig, der junge König?
Er hatte noch seine bescheidenen Illusionen vom Leben und schwebte noch allzusehr in den Wolken, um klar zu sehen. Er glaubte noch allerhand von dem, was seine Ratgeber sagten, wenn auch nicht alles.
Man tadelte an ihm, daß er es weniger mit den realen Dingen des Lebens hielt, als vielmehr mit einer Scheinwelt, mit einer Art Traumleben, in dem er sich besonders wohl zu fühlen schien, der junge König.
Was erzählte man nicht alles von ihm an Absonderlichem!
Die königliche Residenz in München umfaßte auch einen Wintergarten, der außer prächtigen Pflanzengruppen zudem einen Teich enthielt; aber auch allerhand Niedlichkeiten, auch eine Grotte mit einem Miniatur-Wasserfall. Der Teich war eben breit und tief genug, daß Ludwig ihn mit einem kleinen Kahne befahren konnte: mit einigen Ruderschlägen war er am anderen Ufer. Eine junge Hofopernsängerin und der Tenorist Nachbaur durften hier den König mit ihren Liedern erfreuen.
Das Fräulein durfte eines Tages sogar zum Könige mit in den Kahn steigen.
Da die Liebliche aber mehr Walküre war als Fee oder Traumengel, kippte das überladene Boot und beide kühnen Kahnfahrer fielen ins Wasser. Arg durchnäßt kamen sie wieder »an Land«, und Ludwig entfloh. Die Sorge für seine nasse Walküre überließ er der Dienerschaft.
Das zierliche Schiffchen war auch vergoldet. Irgendwie erinnerte es den jungen König an den Nachen des Lohengrin in der Wagnerschen Oper. Das verlockte ihn, den Romantiker von Wagners Gnaden sogar zur Verkleidung. Als Schwanenritter gekleidet soll er dann oftmals auf dem kleinen Teiche gerudert sein, während bunte Lämpchen, die aus dem Blättergewirr der Palmengewächse hervorleuchteten, alles in magische Farben tauchten.
Auch sonst zeigte Ludwig oft das Bestreben, seine romantischen Träume Wirklichkeit werden zu lassen, was aber erst einige Jahre später stärker in die Erscheinung trat. Man darf wohl annehmen, daß Ludwig hierdurch immer nur Vergessen suchte und Ablenkung von dem ihm widerwärtigen Treiben seiner Hofschranzen und Störenfriede aus Eigennutz. Sie trieben es schon in seinem zweiten Regierungsjahre ein wenig zu stark. Und da er sich ohnmächtig fühlte, als König ohne eigentliche Macht, mied er diese Leute, wo er nur konnte.
Die Beheizung des königlichen Wintergartens in der Residenz soll an die 2000 Klafter Holz im Jahre beansprucht haben, was allerdings nicht verbürgt ist. In allen Dingen um König Ludwig herum kam es auf die Genauigkeit der Zahlen nicht so sehr an. Diese wurden immer vergrößert von allen Beteiligten oder nur Miterlebenden, je nach Bedarf an Sensation, die man erzielen wollte.
*
Der Kampf gegen Wagner von Mund zu Mund und das Aufhetzen ganzer Bevölkerungsteile gegen »die Wagnerei« genügte anscheinend nicht mehr oder noch nicht. Jetzt griff auch die Presse ein. In der Umgebung Wagners stieg das Verlangen nach Abwehr von Tag zu Tag immer mehr an. Die Macht des jungen Königs genügte anscheinend nicht, um seine Wagnerfreunde zu schützen.
Zugunsten Wagners konnte Ludwig nur dessen bißchen Musik und Theater anführen, das wog nicht sehr schwer. Die Gründe der anderen waren die stärkeren.
Nur um Wagner zu helfen, hatten einige liberale Zeitungen dessen Partei ergriffen. Das schadete Wagner in München aber noch mehr. Es schadete ihm und Bülow aber auch oben in Preußen. Maßgebende dortige Kreise zählten Wagner und dessen Freunde bereits zu der bismarckfeindlichen Fortschrittspartei.
Hans von Bülow wollte da eingreifen. Er verfaßte einen Artikel für die Berliner »Kreuzzeitung«, der aufklären sollte. Was aber kümmerte die Münchner Patrioten vom Schlage Pfistermeisters oder von der Pforten diese am falschen Orte erfolgende Abwehr? Wer las das in München?
Da erschien plötzlich im liberalen »Nürnberger Anzeiger« ein heftiger Angriff, betitelt: »Ein freies Wort an Bayerns König und sein Volk über das Kabinettssekretariat«. Der Artikel gipfelte in der Forderung: »Fort mit diesen Kabinettsräten, diesem gänzlich verfassungswidrigen Institut, das die gerechten Besorgnisse des Volkes erweckt.«
Der klerikale »Bayerische Volksbote« bezeichnete Wagner als den Verfasser dieses Artikels und fügte hinzu: »Dieser Angriff gilt nicht dem Sekretariat, sondern nur zweien seiner Vertreter, Pfistermeister und Hofmann. Diese sollen verschwinden, damit gewisse Gelüste auf Ausbeutung der königlichen Kabinettskasse leichter Befriedigung finden; hat doch Herr Richard Wagner in kaum Jahresfrist nicht weniger als einhundertneunzigtausend Gulden gekostet und vor kurzem weitere vierzigtausend Gulden für seinen Luxus verlangt und trotz Abratens Pfistermeisters auch erhalten.«
Mit den einhundertneunzigtausend Gulden konnten nur die Unkosten der Neuinszenierung der Wagnerschen Opern, einschließlich »Tristan«, gemeint sein.
Wagner nahm nicht mit Unrecht an, daß dieser plumpe Angriff nur von den Kabinettsräten selber ausgehen konnte und übersandte das Blatt dem Könige nach Hohenschwangau. Ludwig antwortete:
»Schändlich ist der Artikel geschrieben, den Sie mir schickten. Oh, böse verdorbene Welt! Kehren wir uns nicht an das Gewäsch der Presse, es ist ja seinem Wesen nach ohnmächtig. Sie werden jenen Aussprüchen des ›Volksboten‹ kein großes Gewicht beilegen, nicht wahr, mein geliebter Freund? Wir kennen, wir verstehen, wir lieben uns; die Macht der Finsternis prallt ab von unserem festen Panzer.
Ihr treuester Freund Ludwig.«
Das klang sehr schön und beruhigend, genügte Wagner aber sehr wenig. Er ließ am 29. November in den »Münchener Neuesten Nachrichten« einen eigenen Abwehrartikel einrücken, scheinbar von Freundeshand herrührend:
»Aus allen Zuwendungen des Königs würden für Wagner noch keine Mißhelligkeiten erwachsen sein, wenn nicht der Neid ins Spiel geführt worden wäre. Dieser spielte auch in der Angelegenheit eines neuen Festspielhauses mit, das ein Auswärtiger bauen sollte.« Wagner geht dann auf seine Kunstpläne für München ein und schließt mit der Feststellung einer »Verschwörung, die man angezettelt, um Wagner den Aufenthalt in München endgültig zu verleiden. Alle diese Intrigen werden aber an der Festigkeit des Königs scheitern, der allein Wagner richtig zu beurteilen imstande ist. Der gesamte Kampf spielt sich nur innerhalb kleiner Kreise ab, und ich wage zu versichern, daß mit der Entfernung zweier oder dreier Personen, welche nicht die geringste Achtung im bayerischen Volke genießen, der König und sein bayerisches Volk mit einem Male von diesen lästigen Beunruhigungen befreit wären.« –
Die Pressehetze nahm daraufhin noch groteskere Formen an. Die klerikalen Blätter beschimpften Wagner als politisch Anrüchigen, als Demagogen, als Ausbeuter der königlichen Kasse, als schlimmen Dämon des Königs. Und der Münchner »Punsch« dichtete:
A Häuserl am Roa (Rain)
Und an Garten net kloa (klein),
's Jahr vierz'gtausend Guld'n,
Nachher will i mi geduld'n.
I wünsch' allen Leuten,
Daß s' g'sund bleiben soll'n,
Nur zwoa, drei Persona
Dürft' der Teufel wohl hol'n.
Auf Veranlassung des Verlegers der offiziellen »Bayerischen Zeitung« wurden in allen großen Geschäftslokalen Münchens Listen zur Einzeichnung der Bevölkerung für eine Ergebenheits-Adresse an die Kabinettsräte ausgelegt. Aber nur achthundertundzehn Personen zeichnen sich ein. Dem Könige erzählt man von viertausend Einzeichnern.
Peter Cornelius klagte: »Also wird die Sache demnächst wohl biegen oder brechen?« Er sah die Dinge ein wenig zu unklar; er, der einfache ehrliche Lebenskämpfer konnte an nichtswürdige Intriganten nicht glauben. Er hielt es aber für schädlich, wenn ein »Fremder, ein Künstler und Privatmann in die Räder des Staatsgetriebes eingreifen und über die Entlassung wichtiger Personen am Hofe eines Königs mitentscheiden wolle«.
Über den Artikel Wagners in den »Münchener Neuesten Nachrichten« war auch König Ludwig ungehalten. Daß Wagner der Autor war, wußte er nicht. Er schrieb an Wagner:
»Der Artikel ist ohne Zweifel von einem Ihrer Freunde geschrieben, der Ihnen einen Dienst leisten wollte. Leider hat er Ihnen geschadet, nicht aber genützt.«
Es half nichts, daß heiter veranlagte Münchner die Sache ins Humoristische umbiegen wollten. Der Münchner Schriftsteller Joseph Ruederer veröffentlichte einen Dialog zweier Altmünchner im Hofbräuhause, die die Namen Schöps und Trottelberger führten:
Gemeinderats Mitglied Schöps trifft im Hofbräu beim Maßkrugausspülen den Bürger Trottelberger.
Schöps, nach langer Pause, sehr zufrieden: Dem hammer's g'steckt, dem gar andern.
Trottelberger: Wem denn?
Schöps: Dem Wagner-Richardl, dem hergelaufana Musikanten.
Trottelberger: Habt's es eahm g'steckt?
Schöps: G'höri hammer's eahm g'steckt, und 'm Kini grad extra, 'm Kini grad extra!
Trottelberger: Was habt's denn 'tan?
Schöps: Nausg'schmiss'n hammer'n, den verhungerten Dudelsackpfeifer, jetzt kann er schau'n, wo er sei Theaterbuden hinbaut, der Freimaurerg'sell, der dreckige. Mir geben koan Strich her vom heil'gen Münchner Boden, am wenigsten für so an preuß'schen Schwimmer.
Trottelberger: Recht habt's, des vom Gemeinderat, ganz recht.
Schöps: Nix da, mür san mür und bleiben's aa! Soo – jetzt kaaf i mür aan Stoa, auf d' Anstrengung hin.
Trottelberger: Hammer oan Weg, Herr Nachbar. (Beide gehen zum Ausschank.)
*
Aber man lachte in München nicht. Es lag trübe Stimmung über der Stadt. Nicht etwa, daß die gesamte Bevölkerung ausnahmslos damit einverstanden gewesen wäre, was die Verhetzer gegen Wagner und den König begannen. Aber sie wußten zu wenig von den Zusammenhängen.
In Hohenschwangau erzählte man dem bekümmerten Könige, daß in München eine Art Revolution im Anzuge sei, daß in der Briennerstraße schon Straßenaufläufe vor dem Wagnerschen Hause stattfänden.
Als Ludwig das hörte, wurde er ängstlich. Er beurteilte alle Menschen sehr milde, aber jetzt befürchtete er Allerschlimmstes für Wagner: sogar ein Attentat auf den Freund hielt er für möglich.
Wäre dieser junge Ludwig nicht so weltfremd gewesen, so hätte er sich nicht so grob bluffen lassen. Straßenaufläufe gab es öfter im München der damaligen Zeit. Jeder kleine Aufschlag zum Bierpreise war die Ursache, daß in den Wirtschaften Maßkrüge und Fenster zertrümmert wurden; der alten verstaubten Bürgerwehr gingen dann aus Versehen einige Flinten los. Das war eine »Gaudi« wie jede andere. Sobald dann Kürassiere erschienen, waren alle wieder besänftigt.
König Ludwig hörte später von offenherzigen höheren Beamten seiner Umgebung, daß man ihn wieder angelogen und alles stark aufgebauscht dargestellt habe.
Vorläufig nahm er aber alles noch ernst und war nur auf schleunigste Rettung seines geliebten Freundes bedacht. Wagner mußte für einige Zeit aus München verschwinden, bis die Wogen der allgemeinen Erregung wieder abgeebbt waren. Sonst stürmten die Leute am Ende noch Wagners Haus. Polizei und Militär mußten eingreifen – Blut würde fließen –
Welcher Wahnwitz, das Ganze!
Ein der Not entrissener, hochbegabter, schöpferischer Musiker sollte innerhalb von eineinhalb Jahren der Stadt München und dem gesamten Bayernvolke gefährlich geworden sein, als Preuße und Bismarckspitzel? Gewiß, er hatte einen Fehler begangen bei seiner Abwehr ungerechtfertigter Angriffe auf ihn, auch Hans von Bülow und dessen Frau hatten in ihrer Geringschätzung der Münchner ein wenig zu kindlichen Mentalität so manches geäußert, was besser im Gehege der Zähne geblieben wäre. Man hatte sie heftig gereizt, diese Wagnerleute, diese hatten aber nicht angefangen.
Ludwig kehrte umgehend nach München zurück. Am 6. Dezember traf er ein und empfing noch am Abend seine Mutter, seinen Oheim, den Prinzen Karl, den Erzbischof Scherr und den Staatsminister von der Pforten in Audienz. Letzterer überreichte im Namen des Ministeriums ein Memorandum gegen Richard Wagner und stellte in Aussicht, daß er sein Portefeuille niederlegen würde, falls Richard Wagner Bayern nicht schnellstens verlasse. König Ludwig befragt aber auch einfache Hofbedienstete nach der Stimmung der Münchner Bevölkerung, diese faseln von einer drohenden Revolution, auch die Polizei glaubt für die Sicherheit des Herrn Wagner nicht mehr einstehen zu können.
Ludwig erfährt zum ersten Male in seinem Leben, daß seine erhabene Stellung unter den Menschen in Wirklichkeit mit tiefer Tragik verbunden sei, und er hat bis zum Abend noch einen schmerzlichen Kampf mit sich selbst zu bestehen. Wiederum bestürmt seine Familie ihn, allem ein Ende zu machen, damit wieder Ruhe und Frieden kämen. Er beruft den Minister von Lutz zu sich und beauftragt ihn, noch am selben Abend Herrn Wagner eine Botschaft zu überbringen.
Er berief auch seine Kabinettsräte zu sich und verkündete: »Sie behaupten, meine Herren, daß das Volk die Abreise des Herrn Wagner wünsche, ich gebe dem nach. Der Entschluß wird mir sehr schwer. Ich will aber meinem teuren Volke zeigen, daß sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht. Ich will in Frieden leben mit meinem Volke.«
Der alte Maler Cornelius, der noch in München lebte und durchaus kein Anhänger Wagners war, erzählte seinem Neffen Peter Cornelius:
»Ludwig I., der Großvater, hätte in solchem Falle ganz anders gehandelt als Ludwig, der Enkel. Der alte Ludwig hat seine Leute erst recht gehalten, wenn man sie angriff. Er setzte zum Heile des Landes seine als verrückt gescholtenen Pläne durch, trotz allen Widerständen. Der Enkel aber läßt sich im entscheidenden Augenblick von seiner üblen Umgebung beschwatzen.«
Was nützte diese einsame Stimme in einer Wüste? Keiner ahnte, daß man dem jungen König mit der Ablehnung Wagners ein unheilbares Leid zufügte. Man warf ihm nicht nur ein Kartenhaus ein, man zerstörte ihm Zukunft und Leben schon heute.
*
Am Abend des 6. Dezembers 1865 erschien im Wagnerschen Hause, wo auch Frau Cosima und Cornelius anwesend waren, der Kabinettsrat von Lutz mit einer Botschaft von König Ludwig. Seine Majestät lasse Herrn Wagner doch innigst bitten, die Stadt zu verlassen, damit wieder Frieden einkehre in die bayerische Hauptstadt.
»Man jagt mich fort?« rief der entrüstete Wagner.
»O nein, Herr Wagner, es handelt sich nur um eine Entfernung auf Zeit.«
Wagner war wie erstarrt. War also alles wieder einmal zu Ende? Jetzt, im Winter, kurz vor Weihnachten, jagte man ihn wie einen lästigen Hund aus der Stadt hinaus? Was hatte er dem König angetan? Wie oft hatte dieser ihn seines Schutzes und seiner Liebe versichert? In Prosa und in Gedichten? Gab es kein Königswort mehr?
Begann das Wandern von neuem? Wo sollte er unterkommen?
Wagner verbrachte eine schlaflose Nacht.
Zeitig am Morgen kam ein Brief seines Königs und Schirmherrn:
»Glauben Sie mir, ich mußte so handeln. Meine Liebe zu Ihnen währt ewig … Ich weiß, Sie fühlen mit mir, können vollkommen meinen tiefen Schmerz ermessen. Ich konnte nicht anders. Seien Sie davon überzeugt. Zweifeln Sie nie an der Treue Ihres Freundes.
Bis in den Tod, Ihr treuer Ludwig.«
In einem Nachworte versprach der König Geheimhaltung des Ausweisungsbefehls.
Seine triumphierenden Kabinettsräte aber hatten nichts Eiligeres zu tun, als diesen sofort in der Staatszeitung zu veröffentlichen.
Hatte König Ludwig gehofft, die bayerische Ruhe wiederherzustellen, so hatte er sich getäuscht. Die »Schöps und Trottelberger« beantragten am 8. Dezember im Gemeinderate einen Fackelzug und eine Dankdeputation, um Seiner Majestät den Dank der Stadt über die Entfernung Richard Wagners aus Bayern auszusprechen.
Der Münchner Magistrat indessen hatte soviel gesundes Empfinden, diese offenbare Beleidigung des Königs zu hintertreiben. Die liberale Partei erklärte acht Tage später auf einer Tagung in Nördlingen öffentlich:
»Der König ist durch die Behauptung, daß die Anwesenheit des Komponisten Wagner das Vertrauen und die Liebe des Volkes zum König beeinträchtige, gröblich getäuscht worden. Die Person Wagners hatte mit den öffentlichen Angelegenheiten des Landes nicht das mindeste gemein.«
Wagner aber schrieb an den König:
»Mich schmerzt, daß Sie leiden, wo der einfache Gebrauch Ihrer königlichen Macht Ihnen Ruhe verschafft hätte. Die mir unbekannten Gründe, die Sie hiervon abhielten, ehre ich; für den schönen ernsten Brief danke ich Ihnen innigst. Die mir von Ihnen erwiesenen königlichen Wohltaten setzen mich in den Stand, weltvergessen an der Vollendung der Werke zu arbeiten, an deren Schöpfung Ihnen vor allem selbst mehr als an deren einstiger Aufführung gelegen sein muß. Ihre Wohltaten sind aber durch den Verrat Ihrer Beamten der Öffentlichkeit in einem Lichte gezeigt worden, das Ihnen einen Vorwurf zu machen scheint.«
Wagner bat dann den König noch, für die Richtigstellung der verlogenen Behauptung in der Presse zu sorgen, daß er eine Summe von einhundertundneunzigtausend Gulden erhalten habe, daß diese vielmehr die Gesamtaufwendungen der königlichen Zivilliste für Musik und Oper darstelle, damit jeder weiteren Agitation der Stachel genommen werde.
Ludwig antwortete sofort:
»Mein teuerer inniggeliebter Freund! Worte können den Schmerz nicht schildern, der mir das Innere zerwühlt. Was nur irgend möglich, soll geschehen, um jene eilenden Zeitungsberichte zu widerlegen. Daß es bis dahin kommen mußte! Unsere Ideale sollen treu gepflegt werden, schreiben wir uns oft und viel, ich bitte darum. Wir kennen uns ja, wir wollen von der Freundschaft nie lassen, die uns verbindet. Um Ihrer Ruhe willen mußte ich so handeln!
Verkennen Sie mich nicht, es wäre eine Höllenqual für mich. Heil dem geliebtesten Freunde! Gedeihen seinen Schöpfungen! Herzlicher Gruß aus ganzer Seele von Ihrem treuen Ludwig.«
Wagner glaubte nicht mit Unrecht die Ursache des ganzen Geschehens in der Weltfremdheit des jungen Monarchen zu sehen. »Seine zu große Liebe zu mir«, schreibt er an Frau Eliza Wille, »machte ihn für alles andere blind. Er kennt niemand und muß erst Leute kennenlernen. Doch hoffe ich noch für ihn.«
Am 4. August 1865 hatte Ludwig an Wagner geschrieben:
»Wenn wir beide längst nicht mehr sind, wird unser Werk noch der späteren Nachwelt als leuchtendes Vorbild dienen, das die Jahrhunderte entzücken soll, und in Begeisterung werden die Herzen erglühen für die Kunst, die gottentstammende, die ewig lebende!«
Diese prophetisch klingenden Worte sollten auch Wahrheit werden. Das, was König Ludwig in diesen ersten zwei Jahren seiner jungen Königszeit etwa verfehlte, eben weil er die Menschen zu ernst nahm und es allen recht machen wollte, hat er späterhin in unwandelbarer Treue durch seine königliche Hilfe in kritischen Tagen wieder gutgemacht. Nicht allen Königen kann dieses Lob nachgesagt werden.
*
Wagner aber sah sich wiederum vor einen neuen Anfang gestellt. Er wußte: das Ende war immer wieder der Anfang von neuen Dingen. Darum zeigte er sich auch bei diesem neuen Zusammenbruch völlig gefaßt. Sein Jahresgehalt entzog ihm der König nicht, er hatte also zu leben und konnte arbeiten, ganz gleich, wo es war.
Hans von Bülow befand sich gar nicht in München, sondern auf einer Konzertreise. Also blieben nur Frau Cosima Bülow und Peter Cornelius übrig, die trösten, planen und handeln konnten. Frau Cosima war ganz gebrochen. Auch an ihren Mann und sich und die Kinder dachte sie. Was sollte da werden? Was war aus ihnen geworden, aus allen großen Hoffnungen, die man mit hierher gebracht hatte?
In frühester Morgenstunde des 10. Dezember geleiteten Frau Cosima und Cornelius den Meister zur Bahn. Auch der treue Diener Franz Mrazek begleitete seinen Herrn nach der Schweiz, wo Wagner aus alter Anhänglichkeit hinwollte. Es war eine weite Reise nach Vevey am Genfer See, wo Wagner bis auf weiteres Quartier nehmen wollte.
Als Wagners Waggon hinter den Pfeilern des Bahnhofs verschwand, war es den beiden Zurückbleibenden, als sei eine Vision zerronnen.