
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Hofstetten am 4. Mai 1897.
Diesen Morgen habe ich die Stadt Freiburg verlassen, um wieder ins »Paradies« zu ziehen. Am Bahnhof traf ich unsern Landeskommissär, Ministerialrat Reinhard, der mit dem gleichen Zug landabwärts fahren wollte. Er hat als »höherer Staatsbeamter« das Recht, erster Klasse zu fahren, und ihm zulieb tat ich ausnahmsweise das gleiche. Ich sage ausnahmsweise; denn Volksschriftsteller und Bäckerbuben von Hasle sollten nicht erster Klasse fahren. Ich würde auch, was ich aber nie tue, gerne stets dritter Klasse fahren, wenn immer nur echtes Landvolk in derselben säße und nicht so viele offene Fenster dem Windzug alle Tore öffneten.
Ministerialrat Reinhard gehört zu den wenigen Leuten in Freiburg, mit denen ich öfters verkehre, und wenn ich es machen könnte, der feine, vornehme Mann müßte Reichskanzler werden; denn er hat trotz seiner körperlichen und geistigen Eleganz ein so warmes Herz für das »gemeine Volk«, wie ich es in unsern Tagen noch bei keinem Staatsbeamten getroffen habe.
In ihm steckte das Zeug zu einem Obervogt Huber, von dem ich in den »Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin« erzählt.
Trotzdem er der Sohn eines Professors ist, kennt er des Volkes Wohl und Wehe durch und durch und hat als langjähriger Amtmann zu Kehl im Hanauerland den Bauer schätzen und lieben gelernt.
Die Hanauer, dieser urwüchsige, alemannische Bauernschlag mit seiner schmucken Tracht und seinem kecken Standesgefühl, sind Reinhards erste und letzte Liebe. Sein Herz schlägt höher und seine Wangen färben sich, wenn man vom Hanauerland spricht.
Wir reden oft und mit Vorliebe miteinander übers Landvolk und über die Sünden, so in unserer Zeit an demselben begangen werden.
Aber Reinhard kennt nicht bloß das Volksleben, er ist auch daheim im Kulturleben aller Völker und besitzt eine allgemein wissenschaftliche Bildung, wie sie immer seltener wird bei den »Herrenleuten« unserer Tage, die sich nur noch notdürftig fürs Berufs- und Brotfach dressieren lassen.
Es gibt ja heutzutage so viele sinnliche Genüsse und Erholungen und so vielen Zeitvertreib, daß man keine Muße findet, auch noch anderes zu lernen, als was man »ins Haus« braucht. –

Mein Begleiter von Freiburg bis Offenburg hat nur zwei Fehler. Einmal ist er Junggeselle und gedenkt dies auch zu bleiben. Es ist aber jammerschade, daß er nicht unter das »süße Joch« der Ehe gegangen ist; denn er ist von einer Friedensliebe, die ihn zum liebenswürdigsten aller Gatten gemacht und ihn befähigt hätte, mit einem weiblichen Drachen auszukommen.
Sodann hat er die Untugend der meisten höheren badischen Beamten: er schreibt bei Unterschriften seinen Namen so undeutlich, daß einer, der nicht wüßte, wie es heißen sollte, ihn nie entziffern könnte, und wenn er eine Ewigkeit lang es versuchte.
Es ist dies ein Mißbrauch der Schrift, den man allen Staatsbeamten gesetzlich verbieten sollte. Alle unleserlichen Unterschriften sollten ungültig sein.
Unsere badischen Staatsdiener könnten sich ein Beispiel an ihrem Landesfürsten nehmen, der viel zu unterzeichnen hat, aber stets seinen Namen schön und deutlich schreibt.
Zu den obigen zwei Fehlern meines verehrten Begleiters kam in der letzten Zeit für mich noch ein dritter, an dem er aber unschuldig ist. Er wurde zum Geheimen Oberregierungsrat ernannt, ein aus Preußen importierter Titel, der mir ob seiner Herkunft und seiner Länge zuwider ist. –
Dr. Reinhard hatte heute ein Dienstgeschäft in seinem lieben Hanauerland; drum trennten wir uns in Offenburg.
Da ich hier nur kurze Zeit gehabt hätte, ein Billett zu lösen, und mir nichts verhaßter ist als das Springen an den Schalter auf Bahnhöfen, so hatte ich erster Klasse genommen bis Hasle. Drum traf ich auch auf der Schwarzwaldbahn wieder »bessere Gesellschaft«. Zunächst eine von Geburt aus adelige, ältere Dame und Leserin meiner Schriften. Sie kennt alle Berge und Täler des Kinzigtals und auch mich, an dem sie heute tadelte, daß meine Bücher, die ihr sonst so gut gefielen, durch Schimpfen über die Wibervölker und durch demokratische Grundsätze verunstaltet würden.
Ich nahm ihr diesen Tadel viel weniger übel als ihre kurz geschnittenen Haare. Jüngere Wibervölker sehen mit solchem Schnitt aus wie Friseurs – und Kellnerjungen, ältere aber wie die Damen in einer Weiberstrafanstalt oder in einem Irrenhaus.
Sie stellte mich dann noch einem Herrn vor, der ihr gegenüber saß und Sekretär eines Klubs in Baden-Baden ist, dem viele hochadelige Herren angehören.
Sage mir, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist – heißt ein bekanntes Sprichwort. Dem Geheimschreiber des adeligen Klubs sieht und hört man fernen Umgang mit Fürstlichkeiten unschwer an. Sein vornehmes, höfisches Wesen verbirgt durchweg seine bürgerliche Abstammung und seine nichtakademische Bildung.
Er war auf dem Weg zum neuen Fürsten von Fürstenberg im Auftrage seiner Klubherren, die ein sehr großes Interesse daran nehmen, ob der neue Fürst seines Vorgängers Rennstall beibehalten werde.
Mich interessierte in diesen Tagen auch eine fürstenbergische Frage, die nämlich, ob der Fürst die Erbschaftsakzise werde zahlen müssen für sein ihm unverhofft in den Schoß gefallenes Fürstentum in der Baar und auf dem Schwarzwald.
Wenn ein armer Mann von seiner verstorbenen. Frau was erbt, muß er Steuer bezahlen, und der Bauer und der Taglöhner müssen in ähnlichen Fällen das ererbte Äckerle »verakzisen«. Ein Fürst aber, der gleich ein Fürstentum im Wert von Hunderten von Millionen erbt, sollte steuerfrei sein?
Unsere Zeit versteht so was gottlob nimmer, und die Privilegien machen die Privilegierten in unseren Tagen nur verhaßt. –
Im »Paradies« kurz vor Mittag angekommen, traf ich drei mir nur äußerlich bekannte Herren aus Freiburg. Sie waren zu Fuß vom Elztal herübergestiegen. Einer von ihnen sagte zu mir: »Ich möchte um keinen Preis, wie Sie, in dieser Stille und Einsamkeit Wochen zubringen; es wäre mir zu langweilig!«
Zu allen Fenstern lachte der blühende Frühling herein, Berge und Wälder ringsum strahlten im Sonnenglanz und der tiefste Friede lag in dem lieblichen Tälchen. Und da wohnen dürfen, heißt der Mann langweilig!
Aber Langeweile ist eben ein sehr subjektiver Begriff; drum kann man miteinander darüber streiten. Nur so viel steht fest, daß die Langeweile die Menschen um so mehr plagt, je kultivierter und blasierter sie sind, und daß zahllose Sterbliche von ihr geplagt werden. Drum hat der berühmte Abbé Galliani schon gesagt, »man müsse die Kinder frühzeitig lehren, sich an Ungerechtigkeit und Langeweile zu gewöhnen.«
Uebrigens sollte ein Schriftsteller meiner Art das Lob der Langeweile singen, weil die Menschen Bücher, wie ich sie schreibe, nur zum Zeitvertreib lesen, nicht um daraus zu lernen. –
Am Nachmittag spazierte ich hinaus nach Mittelweiler, dem stillen Winkel am dunkeln Tannenwald. Kuckucksrufe begrüßten mich wie alte Bekannte und mahnten, daß schon wieder ein Jahr vorüber sei, seitdem ich sie gehört.
Die bäuerlichen Freunde, die ich da und beim Rückweg ins Dorf in den einzelnen Gehöften besuchen wollte, waren alle ausgeflogen und droben in den Halden an der Arbeit. Nur »der Lepold«, der Weber, war daheim; er saß in seinem Keller und schlug den Weberbaum. Weiter unten traf ich den Dorfmurer, wie er sein Häuschen vergrößerte; denn sein einzig Maidle und Kind, die Genovef, hat kürzlich geheiratet, und nun ist in der Hütte nicht mehr Raum genug.
Die Genovef, ein schlankes, schaffiges Wibervolk, hat eine Schönheits-Marke, die in zahllosen Volksliedern und selbst in der Heiligen Schrift vorkommt. Sie ist »schwarzbraun«; »schwarzbraune Mädichen« aber figurieren als die schönsten in den Liedern, die das Volk gemacht hat. Und schon im Hohenlied sagt die schöne Sulamit von sich: »Schön bin ich, schwarz aber.«
Ob das Volk wohl von dieser schwarzen Braut im Hohenliede her in seinen Liedern die schönen Mädchen »schwarzbraun« nennt?
Der Mann der Genovef, der vor der Hütte seine »Sägez« dengelte, entpuppte sich bei meiner näheren Nachfrage als ein Vetter von mir. Er ist von Bollenbach an der Kinzig, und in seinem Geburtshaus brachte ich manch selige Knabenstunde in der Herbst- und Kirchweihzeit zu. Seine Großmutter war ein Sprosse meines Geschlechtes; denn ihr Vater, der »obere Müller« Toweis von Steine, war der Bruder meines Großvaters »Eselsbeck«.
Ihr Enkel, der sich in Hofstetten niedergelassen, hat seine Ahnfrau, meine Base, nimmer gekannt. Ich sah sie noch als stattliche, lebensfrohe Büre. Aber so schnell vergehen die Jahre und wir mit ihnen.
Ich schritt, wehmutsvoll an jene längst entschwundenen Tage denkend, von dannen.
Am Dorfbach wohnt der »Großvater«, den meine Leser längst kennen. Ich besuche ihn, und jeder von uns beiden freut sich, den andern wieder zu sehen; denn der Großvater geht ins sechsundachtzigste, und ich bin auch eine alte, zerfallende Ruine.
Sooft ich drum seit Jahren im Herbst von Hofstetten scheide, ist es unsicher, ob wir uns im Frühjahr wieder treffen werden.
Der Großvater hat diesmal »gut überwintert«, und er meint, »dem Aussehen nach müßt' ich auch einen guten Winter gehabt haben«.
Nach kurzer Rast bei ihm steige ich zu meiner Hütte hinauf. Auch sie hat trotz Wetter, Sturm und Graus gut überwintert, und ich finde sie so »wohl auf«, wie ich sie im Herbst verlassen.
Von ihr aus grüße ich alles ringsum: die Tannen im Bächlewald, die Birken auf der Brand, die mit Blumen übersäten Matten, die in der Abendsonne glänzenden Gehöfte und Berg und Tal, soweit ich sie sehe bis hinauf zu der fernen Höhe, wo »Martin, der Knecht«, haust.
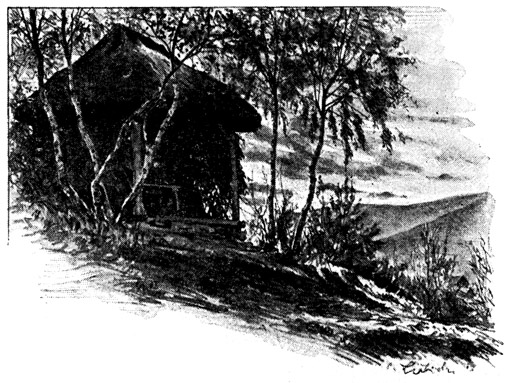
Ich grüße sie wie alte, treue Freunde, die mir schon viel Gutes getan. Und ich komme mir wieder vor wie ein Mann, der nach stürmischer Meeresfahrt stilles, ruhiges Land erreicht hat und nun ausruht in einsamer Hütte bei den Seinen.
Lange saß ich so bei dieser besten, ewig treuen Freundin Natur, die durch ihre Ruhe die Stürme bannt in unserer Seele und durch ihre Gottesnähe Balsam legt auf unsere Wunden.
Am 5. Mai.
Diesen Morgen begleitete ich bei prächtigem Maiwetter Jörg, den Schneeballenwirt, auf seine Äcker hinter der Kirche. Auf einem derselben war der alte Dorfschmied mit dem Hacken von Kartoffeln beschäftigt.
Der Schneeballenwirt stellt seinem Forellenfischer, dem Schmied, alljährlich ein Stück Feld zur Verfügung, um darauf Kartoffeln pflanzen zu können.
Es ist im Kinzigthal überhaupt Sitte bei den Bauern, daß sie Leuten, die wenig oder gar kein Land besitzen, solches zum Bepflanzen überlassen teils um Gotteslohn, teils für kleine Dienste, die sie in der Heu- und Fruchternte ihnen leisten.
Drum leidet hier auch niemand Hunger. Der Ärmste bekommt Feld, um Erdäpfel setzen zu können, und wenn er keine zur Saat hat, so leiht ihm der Bauer noch solche bis zur Ernte. Und im Herbst bringt manch armes Weib den Überfluß der so gewonnenen Kartoffeln nach Hasle auf den Markt und nimmt ein schönes Stück Geld dafür ein. –
Ich setzte mich später allein auf einen Stein, an dem neuen Weg, der in den Salmersbach führt, und träumte in den lichten, stillen Maientag hinein. Die Sonne that meinem welken Leib so wohl, ihre Ätherstrahlen wirkten wie ein leiser elektrischer Strom auf meine kranken Nerven.
Und ich sagte mir: Was wären wir Menschen, und alles, was rings um uns lebt und schwebt, ohne das Licht, ohne die Sonne? Licht heißt für uns Leben. Was wären wir ohne das künstliche Licht? Und welch elendes Dasein mag der Mensch gehabt haben, ehe er das Feuer und das Licht erfunden? Wie schauerlich muß das Leben des Höhlenmenschen gewesen sein, wenn das Licht des Tages sank und die Finsternis ihn in seine Felsenwohnung zwang, während draußen die wilden Tiere und die Stürme heulten und Unwetter niedergingen?
Und welche Wonne ist's jetzt, bei Sturm und Wetter im warmen. Stübchen zu sitzen bei der Lampe mildem Schein!
Daß die Kultur uns dieses wonnige Gefühl verschaffte, danke. ich ihr. Diese Errungenschaft stammt, aber aus jenen Tagen, da die Frau Cultura noch ein bescheidenes, anspruchsloses Landmädchen war, das den Menschenkindern nur schüchtern nützliche Gaben ins Haus legte.
Heute ist sie ein tyrannisches, hochmütiges Stadtweib, das alles seinem Zepter unterwerfen will und alles verdirbt durch den Überfluß an Geschenken, die das Leben vergiften und Natur und Poesie aus der Menschheit vertilgen und vertreiben. –
Merkwürdig ist, daß auch im andern, jenseitigen Leben, das unser wartet, Licht und Finsternis eine so entscheidende Rolle spielen. Ewiges Licht ist den Guten verheißen, ewige Finsternis gilt als die Strafe der Bösen.
Licht ist darum nicht bloß Leben, es ist auch Seligkeit hüben und drüben. Wie trübselig stimmt uns sonnenloses Wetter! Und wie jubelt und singt alles, was Stimme hat, an sonnigen Tagen, und wie lachen Fluren und Wälder, wenn das Licht der Sonne über sie hingeht!
Und drüben, im Jenseits, wohnt der »Vater der Lichter« in ewigem Lichte, und die Fülle dieses Lichtes ist die Seligkeit der Seligen.
Darum beten wir auch für unsere Toten: »Das ewige Licht leuchte ihnen.« –
Aus meinem Träumen weckte mich ein Metzger von Hasle, der von der Breitebene herabkam mit einem Kälblein, das von des Metzgers Hund »gehetzt« wurde.
Zitternd schleppte sich das arme Tier, dem der Hund immer wieder beißend in die Beine fuhr, des Weges daher. In seinen Augen lag ebensoviel Leid wie Geduld. Tiefes Mitleid erfaßte mich über das Los des unschuldigen Geschöpfes, aber auch Zorn über den Schlächter und seine Hundsbestie.
Am liebsten wäre ich mit dem Stock auf beide losgegangen. So aber mußte ich mich begnügen, den Metzger zu mahnen, seinem Hund zu wehren und der Quälerei der Unschuld ein Ende zu machen.
Der junge Haslacher, dessen Vater ein Schulkamerad von mir war, meinte aber lächelnd: »Oh, das spürt das Kalb gar nicht,« und zog des Weges weiter.
So sind die Menschen; für Schmerzen, die sie nicht am eigenen Leib spüren, haben sie kein Verständnis, am wenigsten einem Tier gegenüber.
Man nennt unser Zeitalter gerne das der Humanität. Es mag sein. In vielen Dingen ist man selbst überhuman, so daß ein ehrlicher Mann keinem boshaften Buben mehr ungestraft eine wohlverdiente Ohrfeige verabfolgen darf. Aber unschuldige Tiere dürfen die Metzger nach Herzenslust noch von Hunden hetzen und plagen lassen.
Ich hielt es für viel humaner, böse Buben zu prügeln und unschuldige Kälber vor Roheiten zu schützen. –
Vor unserem Wirtshaus traf ich später den jungen Buren Augustin, den ich im vorigen Jahr zur gleichen Zeit gesprochen hatte. Damals war er stumm und still, weil sich nirgends eine passende Hochzeiterin für ihn finden wollte. Seit wir uns nimmer gesehen, hat er eine gefunden, und Heiterkeit und Zufriedenheit leuchtete wie Sonnenschein aus allen Mienen des wackern Augustin.
So flechten die Wibervölker Rosen selbst in das Leben des einfachsten Mannes! –
Am Nachmittag saß ich in meiner Hütte und schaute in die wunderbar klare, kleine Welt hinaus, die zu meinen Füßen sich ausbreitete. Am ganzen Himmel war kein Wölkchen; nur von den Hanfäckern, auf denen kleine Feuerhaufen »glumsten«, sandte der Rauch seinen weißen Schleier in die Höhe.
Ich zweifelte an der Beständigkeit des Wetters; denn wenn der Himmel zu rein und zu klar ist, gibt's bald Regen, sagt eine alte Bauernregel. Ist's im Menschenleben nicht auch so? Wenn die Sonne des Glücks uns armen Menschen am hellsten zu strahlen scheint, steht allermeist das Unglück und der Wandel hintendran. –
Bei mir sind die Stunden glückliche zu nennen, in denen ich, allein in meiner Hütte sitzend, nichts höre und nichts sehe als Natur in ihrer stillen Andacht: das Lispeln der Birken, das Rauschen der Tannen und die Lieder der Vögel. Und zu alledem nichts denken, das ist mir Wonne.
Ja, nichts denken, gar nichts denken können und nichts denken müssen für Stunden und Augenblicke, ist für einen nervenschwachen Menschen, der gar oft an Zwangsgedanken leidet, ein wahres Glück – abgesehen von der Meinung, die ein Genie über das Denken hat. Rousseau nämlich meint: »Der Zustand des Nachdenkens ist ein widernatürlicher, und der Mensch, der nachdenkt, ist ein entartetes Tier.«
Im Volke gilt das Denken allgemein für eine Plage; drum treibt dasselbe diese Funktion auch nur selten. Es läßt lieber andere für sich denken, wenn es dabei auch gar oft schlecht fährt.
Während ich so, nichts denkend, in der Hütte träumte, kam mein Bruder, der Sonnenwirt von Hasle, das Tal herauf. Er brachte seinen Jüngsten mit, der morgen als Buchbindergeselle in die Fremde soll.
So wanken und schwanken die Familien. In der einen Generation ist ein Buchschreiber, die andere aber bringt nur noch einen Buchbinder fertig.
Am 6. Mai.
Die gestern erwähnte Bauernregel ist eingetroffen. Sturm und Regen jagten in der Nacht den blauen Himmel von gestern fort, und trüb und naß schaute die Welt am heutigen Morgen drein. Es gibt eben in der Natur wie im Menschenleben mehr Regen als Sonnenschein, mehr trübe als freudige Tage.
Gar treffend singt hierüber der schwäbische Dichter Justinus Kerner:
Zählt man die Zeit im Jahr,
Drin freudvoll war ein Herz,
Sind's wen'ge Stunden nur.
Die andern trug es Schmerz.
Zählt man die Zeit im Jahr,
Drin blau der Himmel blieb,
Sind's wen'ge Tage nur.
Die andern war er trüb.
Drum, da der Himmel selbst
So oft in Tränen steht,
Klag' nimmer Menschenherz,
Wenn's dir nicht besser geht.
Das Wetter ist nicht einladend zum Aufenthalt im Freien. Ich bleibe in meiner Stube und nehme eines der Bücher in die Hand, welche ich zum Zeitvertreib mitgenommen habe. Es ist ein Band von Löb Baruch, genannt Ludwig Börne.
Ich bin sonst in gewissem Sinne Antisemit; aber, was jüdische Dichter und Literaten wie Börne, Heine, Nordau betrifft, bin ich Philosemit.
Börne ist der erste Demokrat, von dem ich als Studentlein etwas gelesen. Der erste Volksmann, den ich sprechen hörte, Wunibald, der Schmied von Hasle, hat mir auch das erste politische Buch in die Hand gegeben, und das waren Börnes Briefe. Bis heute hab' ich diesen jüdischen Demokraten nie lange vergessen. Ich nehme von Zeit zu Zeit noch einen Band seiner Schriften zur Hand, und was er schreibt, sooft ich es auch gelesen, es kommt mir immer neu und immer wahrer vor.
Ich schlage heute aufs Geratewohl einen Band auf und treffe den sechsundachtzigsten seiner Pariser Briefe vom 4. Dezember 1832.
»O teure Freundin!« so beginnt dieser Brief, »was ist der Mensch? Ich weiß es nicht. Wenn Sie es wissen, sagen Sie es mir. Vielleicht ein Hund, der seinen Herrn verloren. Das Leben ist ein ABC-Buch. Ein bißchen Goldschaum auf dem Einband ist all unser Glück, unsere Weisheit nichts als ba, be, bi, und sobald wir buchstabieren gelernt, müssen wir sterben.«
Börnes Freundin, die Madame Wohl, wußte jedenfalls noch weniger als er selber Auskunft zu geben über feine Frage, was der Mensch sei. Aber Börne, der 1818 Christ geworden war, hätte im christlichen Glauben eine wenigstens befriedigende Antwort finden können.
In der Antwort, die er gibt: »Vielleicht ein Hund, der seinen Herrn verloren,« liegt aber doch der Grund, warum so viele Menschen nicht wissen, was sie sind. Sie haben längst ihren Herrn, d. i. ihren Gott verloren und rennen darum durch alle Straßen und Gassen der Wissenschaft und fragen: »Was ist der Mensch?«
Ganz vortrefflich ist, was Börne über unser Wissen sagt, daß es nur ba, be, bi sei, und daß wir über das Buchstabierenlernen nicht hinauskommen, solange wir leben.
Wir möchten überall wissen, statt glauben; denn die Seele des denkenden Menschen verlangt nach nichts so sehr als nach Wahrheit. Und trotz dieses Sehnens steht sie immer wieder vor unauflösliche Rätseln.
Was wir wissen über Welt und Schöpfung, über unser Leben und Sterben, über unser Schlafen und Wachen, geht im Grund genommen nicht tiefer als die Buchstabenkunde eines Kindes.
Aber dies ungestillte Suchen unserer Seele nach Wahrheit sagt uns, daß diese Seele mehr ist als bloßer Stoff, mehr als Nervenmasse, und daß es eine Zeit geben muß, wo wir alle Rätsel in ihrer Lösung schauen. Hienieden aber werden wir im Wissen nicht über die Kindheit hinauskommen. –
Kaum hatte ich mich einige Augenblicke mit Börne beschäftigt, als von der Straße her ein dumpfes Rollen, wie das ferne Nahen des wilden Heeres, an mein Ohr drang. Ich trat ans Fenster und sah den Arzt Wörner von Hasle in seinem Motorwagen dahersausen.
Ich lernte nun dieses neueste Beförderungsmittel das erstemal in seinen Einzelheiten kennen und staunte über die Vielseitigkeit des menschlichen Geistes, der in unseren Tagen wie ein zweiter Prometheus früher nie gekannte Kräfte in seinen Dienst stellt.
Der Mensch ist eben der kleine Gott vom großen Gott und hat darum Anteil an allen Eigenschaften des Schöpfers, so auch an seiner Allmacht.
Es tritt ein Stück Allmacht vor uns hin, wenn wir sehen, wie der Menschengeist in unserem Jahrhundert bisher verborgene Naturkräfte entdeckt und sich dienstbar gemacht hat. Und es grenzt ans Wunderbare, was er darin leistet.
Aber das Wesen dieser Kräfte und wie sie entstanden, wird unser Geist nie ergründen. Doch vorwärts drängt er, vorwärts bis in die Unendlichkeit, an der er seine Grenze findet, weil dorthin kein geschaffener Geist dringt in irdischer Hülle. Doch, wie der Dichter sagt,
Unendlichkeit kann nur ein Wesen ahnen,
Das zur Unendlichkeit geboren ist.
Wer wollte diesen Fortschritt tadeln, wer ihn aufhalten? Er ist Gesetz Gottes und darum unaufhaltsam.
Steht nicht in der Heiligen Schrift, daß der Mensch wuchern soll mit seinen Talenten und sie nicht brach liegen lassen?
All die Errungenschaften des menschlichen Geistes, durch die er Wunder wirkt in unseren Tagen, stammen von Gott; aber, und das ist der Fehler, sie führen nicht immer zu Gott. Statt daß die Menschen den Schöpfer um so mehr verherrlichen, je mehr seine Gaben sie allmächtig machen im Reiche der Natur, entfernen sie sich von ihm und geben sich allein die Ehre.
Es steigt empor der Mensch im Lauf der Zeit
Zur Allmacht und Allwissenheit –
singt übermütig ein Dichter unserer Tage.
Deshalb ist meines Erachtens auch so wenig Segen bei all diesem Fortschritt. Er macht die Menschen gottlos und damit herz- und poesielos.
In wenig Jahren wird vielleicht in Gegenden, in denen Wasserkräfte sind, jeder Bauer elektrisches Licht in Stube und Stall haben. Ob aber der alte Glaube und die gute Sitte wachsen mit dem höheren Licht, das möcht' ich baß bezweifeln. –
Ich begleitete den Dr. Wörner zu Fuß hinauf zu einem Patienten, zu einem alten Freund, dem Rotbur, der an Asthma leidet. Sein Sohn, der brave Fridolin, dessen ich im »Paradies« Erwähnung getan, ist nicht mehr daheim. Er ist in einem Kloster im Elsaß.
In Baden kann man das Bedürfnis, in ein Männerkloster zu gehen, bekanntlich nicht befriedigen. Hätte der Rotbur ein Maidle, das lateinisch und griechisch lernen wollte, so gäbe es im Lande Baden Gelegenheit. Ein Mädchengymnasium – ein Ding so unnötig wie ein Kropf und so verderblich wie ein Hagelwetter – gibt's bei uns, aber eine Hochschule für Entsagung und Einsamkeit, ein Kapuzinerkloster, nicht. –
Auf dem Rückweg sprach ich dem Doktor gegenüber meinen Neid aus über den Beruf eines Landarztes in einer so schönen Gegend, wie das Kinzigtal eine ist. Tag für Tag inmitten von Wald und Wiese von Tal zu Tal fahren und von Berg zu Berg steigen und Kranken Heilung und Labung bringen, sei ein beneidenswertes Los.
Der Beneidete meinte, dies Los habe auch seine Schattenseiten bei Wind und Wetter, bei Eis und Schnee, und auch seine seelischen Nachtseiten. Die letzteren erfaßten einen Arzt besonders dann, wenn er in eine einsame Hütte komme, alles krank finde und dabei noch die bitterste Armut und das größte Elend, wie er es bei der Influenzaepidemie des Jahres 1894 mehr denn einmal getroffen habe.
Damals habe ihn einmal in der Nacht ein Bauersmann jenseits des Hessenbergs zu seinem kranken Weib geholt. Tiefer Schnee lag in den Bergen, über die der dreistündige Weg zu Fuß ging bei grimmiger Kälte.
Als er nach mühsamer Wanderung erschöpft und halb erfroren den Hof erreicht hatte, war die Frau tot und all die Strapazen umsonst gewesen.
Mißstimmt kehrt er den weiten Weg zurück. Es ist längst Tag, da er heimkommt. Der arme Mann aber, der sein Weib verloren, hintersinnt sich, verläßt seine mutterlosen Kinder und endigt sein Leben durch Selbstmord.
Wer ist imstand, ein Gesetz zu finden, das die Wege der Vorsehung vereinigt mit dem Geschick, das in die einsame Hütte am Hessenberg einfiel und schuldlosen Kindern so tragisch Vater und Mutter hinwegnahm? –
Ich hatte vor einiger Zeit in Freiburg dem Dr. Wörner die Erinnerungen des berühmten russischen Arztes Pirogow zum Lesen mitgegeben. In denselben kommen sehr viele philosophische und spekulative Betrachtungen vor, die ich teils nicht verstand, teils langweilig fand.
Bei meiner heutigen Unterredung mit dem Doktor merkte ich, daß er jene philosophischen Exkurse viel besser verdaute als ich.
Nach seinem Weggang nahm ich den Börne wieder in die Hand und fand da eine Stelle über philosophische Schriften, die mir vortrefflich zusagte. Börne schreibt: »Ich lese nie philosophische Bücher, mein Kopf ist zu schwach, er verträgt sie nicht. Ein deutsches philosophisches System kommt mir vor wie ein Getreidefeld, zu dem man uns hinführt und freundlich einladet, uns satt zu essen. Ganz gewiß ist in der deutschen Philosophie die beste, gesundeste und unentbehrlichste Nahrung des menschlichen Geistes; doch wäre es artiger von unseren Philosophen, wenn sie uns statt des Getreidefeldes gebackenes Brot vorsetzten. Wenn wir vor jeder Mahlzeit erst die Schnitter, die Drescher, die Müller, die Bäcker machen sollen, kommen wir zu spät an den Tisch.« –
Am 7. Mai.
Diesen Morgen erlebte ich eine Freude. Mein alter Rastatter Studienfreund, der Rechtsanwalt Otto Armbruster von Karlsruhe, besuchte mich.
Meine Erzählung »Der Vogt auf Mühlstein« hat's ihm angetan, daß er seit einigen Jahren das Reichstal Hamersbach durchstreift und den Spuren meiner Kinzigtäler Geschichten nachgeht. Auf solch einer Fahrt begriffen, erfuhr er, ich sei in Hofstetten, und kam.
Freund Otto war vor 45 Jahren das schönste Studentlein in Rastatt; sein langes, goldenes Haar und sein zartes Damengesicht machten ihn dazu.
Heute ist all diese Schöne fort, und grau und alt und verwittert steht der einst so schöne Otto vor mir. Aber eines ist ihm geblieben, der Idealismus der Jugendzeit. Ich mußte staunen, wie er sich im Gespräch mehr und mehr als Idealist unverwüstlichster Observanz entpuppte trotz der trüben Erfahrungen, die er im Menschenleben zur Genüge hat machen müssen.
Aber so soll es sein. Ohne Idealismus und ohne Ideale kann die Menschheit nicht bestehen. Und wenn sie dieselben tausendmal auch nicht erreicht und die Menschen immer nur hoffen und träumen von »glücklichen, besseren Tagen«, so bleiben die Ideale doch die Lebenssterne des armen Adamsgeschlechtes.
Je weniger die Menschen einer Zeit Ideale haben, um so unglücklicher und unzufriedener sind sie; unser Jahrhundert ist ein schlagendes Beispiel dafür.
Wem entstammen aber diese Ideale, die der Materialismus aus der Menschheit nie zu vertilgen und noch viel weniger auf seine Art zu erklären vermag? Antwort: dem angeborenen Verlangen des Menschen nach Glück und Glückseligkeit.
Sollte der Schöpfer dieses unvertilgbare Verlangen in unsere Seele gepflanzt haben, um uns zu täuschen? Nie und nimmermehr. Nur ist die Glückseligkeit, die Erfüllung der Ideale, einer andern Welt vorbehalten. Darum sind wir Menschen unsterblich und darum kennt das Tier keine Ideale.
Es gibt Zeiten, in denen man glauben möchte, die Menschheit habe die Ideale lediglich, um das Gegenteil derselben zu tun. Was machen die Menschen oft aus den Idealen der Freiheit, der Wahrheit, der Gerechtigkeit? Knechtssinn, Lüge und Unrecht beherrschen manchmal ganze Generationen, und Menschen mit Idealen sind zu gewissen Zeiten so selten wie weiße Raben.
Darum werden gar oft die idealsten Menschen am meisten angesteckt von Pessimismus, von Welt- und Menschenverachtung. Und es ist ihnen dies wahrlich nicht zu verübeln. –
Es ist mir schon öfters begegnet, daß Landleute es ungut aufnahmen, wenn ich von ihnen redete in meinen Büchern. Der Mensch aus dem Volk sieht sich nicht gerne in die Oeffentlichkeit gezogen, selbst wenn man nur Gutes und Lobenswertes von ihm sagt.
Heute nachmittag nun begegnete mir mein Nachbar der Mattenmüller, dessen Mühle unterhalb meiner Hütte gar malerisch am Talbach gelegen ist, und beklagte sich, daß so viele Hofstetter in meinen Büchern stünden, er aber nicht.
Das freute mich von dem alten Müllersmann. Ich sagte ihm aber, daß ich nicht alle Leute in meine Dorfgeschichten brauchen könne, sondern nur solche, die in ihrem Leben schon lustige oder leichtsinnige Streiche ausgeführt oder viel erfahren und mitgemacht hätten.
Lustige oder leichtsinnige Streiche, meinte nun der Müller, habe er keine zu erzählen; es sei ihm nie so wohl gewesen, um solche auszuführen.

Erlebt habe er auch nicht viel; denn er sei in seiner Mühle geboren, erzogen und groß geworden und habe keine Nacht seines Lebens außerhalb derselben verbracht.
In seiner Knabenzeit habe er einen harten Stiefvater und damit eine unfrohe Jugend gehabt, aber das sei alles längst vorüber und vergessen.
In Mühe, Arbeit und Sorge sei er alt geworden, habe aber jetzt seine Mühle und das Gütle dem Sohn übergeben und warte in seinem »Libdingsstüble« auf den Tod. Bis der komme, trinke er am Sonntag in Hofstetten und am Montag in Hasle seine Schöpple und lasse fünfe g'rad sein.
Das alles erzählte mir der Müller mit seiner Fistelstimme nicht ohne Humor, und dabei ging über seine geröteten Züge eine gewisse Zufriedenheit.
Ich aber sage: Glücklich, wer nicht mehr erlebt hat als der Mattenmüller von Hofstetten, dem die Tage dahingingen wie die Wasser unter seinem Mühlrad, das mit seinem Müller am Morgen an die Arbeit ging und mit ihm am Abend aufhörte. Wenn das Bächlein auch bisweilen Eis und Gestrüpp brachte, die seinen Lauf hemmten, es ging doch immer wieder, wie auch des Müllers Dasein trotz seiner Mühe und Arbeit.
Ich beneidete im Weggehen von ihm den Mattenmüller um sein Libdingsstüble. Er ist nicht viel älter als ich und kann sich zur Ruhe setzen. Unsereiner muß noch arbeiten ums tägliche Brot und selbst das Mühlrad seiner Schriftstellerei noch laufen lassen, obwohl das Mehl immer schlechter wird.
Allerdings des Müllers Stüble im eigentlichen Sinne möchte ich nicht. Es liegt finster im Schatten des Daches, und das Mühlrad rauscht unter seinem Fenster und nimmt die Ruhe fort. Aber des Müllers Zufriedenheit und seine Genügsamkeit wünscht' ich mir, dann könnte ich mich auch eher von täglicher Mühe und Arbeit losmachen wie er. –
Als ob das Schicksal mich heute zum Neid reizen wollte, begegnete mir, da ich am Abend von meiner Hütte herabschritt und auf die Straße gen Hasle kam, mein alter Volksschulkamerad, der Bäcker Wilhelm Buß, der Sohn Valentins, des Naglers.
Er ging, trotzdem es heller Werktag war, im Kleid eines wohlsituierten Hoteliers oder Rentiers; selbst die goldene Kette fehlte nicht, auf behäbigem Leibe glänzend.
Und in der Tat ist der Wilhelm Rentier, hat sich gänzlich von der Bäckerei zurückgezogen, lebt in einer Art Villa gegenüber dem ehemaligen Garten meines Großvaters und hat das sorgenloseste Leben der Welt. Und so weit hat er's gebracht aus eigener Kraft – als Bäcker von Hasle. Das will viel, sehr viel heißen.
Wenn ich, der einstige Becke-Philipple, meines Vaters Beruf ergriffen und auch Bäcker an der Kinzig geworden wäre, ich hätte es zweifellos nie und nimmer so weit gebracht wie der Wilhelm. Die Lumperei ist ohnedies in vielen Gliedern meines Stammes erblich, und mir wäre wohl als Bäcker eher das Mehl ausgegangen als der Durst.
Und erst die Zufriedenheit, die aus des Wilhelms Gesicht strahlt! Sie gleicht einem Sommerabend, der Berge und Täler mit Gold überflutet, nachdem die Menschen den Tag über reiche Ernte eingebracht haben.
O selig, ein privatisierender Bäcker von Hasle zu sein, dachte ich, an diesem glänzenden Bild von Zufriedenheit neidvoll meine Sinne labend.
Wahrlich, es hätte mich Reue erfaßt, kein Brotmacher geworden zu sein, wenn ich nicht sicher wüßte, daß mir nie und nimmermehr solche Bäcker-Lorbeeren geblüht hätten wie dem Wilhelm – dem glücklichen Sohne eines armen, aber idealen Mannes.
Am 8. Mai.
Seit einigen Tagen sind alle Zeitungen voll von dem Brandunglück in dem Wohltätigkeits-Bazar zu Paris. Die Opfer desselben sind gewiß zu bedauern, aber man kann dabei sehen, wie die Welt selbst im Tode noch einen Unterschied macht zwischen den Menschen.
Wenn in einem Bergwerk Hunderte von armen Arbeitern den Tod finden, so berichten die Blätter einmal darüber, und dann wächst Gras über das Unglück. Und doch sind Weiber und Kinder der Verunglückten weit elender daran, und ihr Tod wird viel schmerzlicher empfunden an Leib und Leben – als es in Paris der Fall war.
Hier sind aber adelige und fürstliche Personen verbrannt, und darum hören die Tagesblätter nimmer auf mit ihrem Beileid und ihren Schilderungen.
Und doch hat gerade bei der Pariser Katastrophe die bessere Welt gezeigt, wie voll sie ist von erbärmlichen Feiglingen und elenden Wichten. Die vornehmen Kerle in dem Bazar retteten sich auf Kosten der Frauen, die sterben mußten, damit solche Helden weiter leben konnten.
Bei Bauern und Proletariern wäre so was nicht vorgekommen.
Doch eine Entschuldigung haben diese alten und jungen Pariser Gigerl. Sie sind entnervte und blasierte Kulturmenschen; zu Mut und Tapferkeit aber gehören gute Nerven. Ja, diese beiden Tugenden sind vielfach nur das Produkt eines starken Nervensystems.
Mit der fortschreitenden Kultur schwinden Heldentum und Mannesmut. Darum haben die unkultivierten, nervenstarken, germanischen Völker auch seinerzeit das römische Weltreich niedergeworfen und die entnervten römischen Legionen besiegt. –
Heute aß ich zu Mittag in dem eine Stunde von Hasle an der Kinzig gelegenen Dorfe Steinach. Ich hatte dazu den Schneeballenwirt geladen, damit er auch sehe, wie andere Wirte ihre Gäste traktieren.
Mein alter Freund, der Zimmer- und Fischermeister Krayer von Steine, der oberhalb des Dorfes sein Häuschen und seine Fischweiher hat, stellte die Forellen zu dem Mahle; der Adlerwirt kredenzte herrliche Talweine, so daß selbst Jörg, mein Hausherr, zufrieden war und strahlte wie die Maiensonne vor den Fenstern draußen.
Der Zimmermann Krayer, heute ein guter Siebziger, ist auch einer jener Volksmenschen von Gottes Gnaden, die auf allen Sätteln reiten können von Natur aus, ohne jede Fachschule.
Er macht vorab die Pläne zu jenen stattlichen Bauernhöfen alten Stiles, die der Bauer aber heute, den Feuerversicherungsgesellschaften zulieb, nicht mehr mit Stroh decken darf.
In Karlsruhe versammelt sich alljährlich eine Art Feuerparlament, d. i. Männer aus allen Teilen des Landes, die der Regierung ihre Erfahrungen im Feuerversicherungswesen mitteilen sollen.
Vor kurzem waren diese Leute auch beisammen, und ein braver Mann, Namens Haas von St. Georgen auf dem Schwarzwald, erhob seine Stimme und klagte, wie die Feuerversicherungsgesellschaften den Bauer auf dem Schwarzwald immer mehr plagten und hinaufschraubten wegen der Strohdächer, Ringe bildeten und unsinnige Prämien verlangten.
Der Vertreter der Regierung gab den elenden Trost, es seien eben wieder neue Gesellschaften im Lande konzessioniert und die Konkurrenz würde Abhilfe bringen. Auch wolle die Regierung den betreffenden Gesellschaften die Sache der Bauern empfehlen.
Als ob Dividendenjäger auf Empfehlungen hörten!
Heißt solche Antwort, sich des Bauern annehmen? Statt daß die Regierung allen Gesellschaften kündigt und den Profit im Interesse des Landes selbst einsteckt, oder ihnen wenigstens die Auflage macht, angesichts des riesigen Gewinns die Häuser mit Strohdächern nicht teurer zu nehmen als die mit Ziegel gedeckten – konzessioniert sie neue Gesellschaften, die alsbald dem Ring beitreten und wie die andern dem Bauer sein sauer verdientes Geld abnehmen werden.
Dabei, so erzählte mir einer, der's wissen kann, verteilen diese Versicherungs-Gesellschaften von 9 bis zu 60 Prozent Dividenden!
Und bei solchen Zuständen fragt man sich noch, warum es so viel Sozialdemokraten gibt!
Wahrlich, wenn auch ich einmal Sozialdemokrat werde, so geschieht's vielfach aus dem Grund, weil ich mich immer und immer wieder darüber empöre, daß man zuläßt, daß geldgierige Kapitalmenschen unsinnige Dividenden machen dürfen auf Kosten des Bauern, der Poesie und des Volkswohls!
Wie herzlos und rücksichtslos in unseren Tagen das Kapital und die Gewinnsucht sind, zeigt auch der Petroleum-Ring, dem die Bürger und Bauern fast der ganzen Welt einfach fürs Licht bezahlen müssen, was einem einzigen Goldkönig und Generalprotzen, dem Mister Rockefeller in Amerika, beliebt.
Doch dauern mich die Schwarzwaldbauern in dem Punkt weniger. Würden sie noch die eigenen Holzspäne brennen wie ihre Eltern und Großeltern, die auch alt geworden sind beim »Spanstock«, dann brauchten sie dem amerikanischen Rockefeller und seinen Spießgesellen nicht ihre Millionen vermehren.
Die herzlosen und gewinnsüchtigen Kapitalmenschen unserer Zeit geben scheints nicht nach, bis in der ganzen zivilisierten und ausgebeuteten Welt auf Straßen und Gassen, in Feld und Wald die Marseillaise der ausgepreßten und bewucherten Arbeiter und Bauern ertönt und verschiedene Leute, die heute noch nicht sehen und nicht hören wollen, fühlen werden. Und dies von Gottes und Rechts wegen. –
Dr. Wörner holte mich in Steinach mit seinem Motorwagen ab und führte mich mit Sturmwindseile wieder gen Hofstetten.
Unterwegs trafen wir am »Marterberg« italienische Steinbrecher, die oben an dem Granitfelsen hingen und Löcher bohrten zum Sprengen.
Überall, wo schwere und gefährliche Arbeit zu leisten ist, finden wir diese fleißigen und genügsamen Leute. Was könnte dies Volk seinem Heimatlande werden, wenn dieses nicht so miserabel regiert und so schmählich ruiniert würde.
Fürwahr, wenn ein Volk in Europa Grund hätte, sich zu empören, es wäre das italienische. Wie in diesem Lande betrogen und geschwindelt wird, das ist geradezu himmelschreiend.
Man rede aber auch einmal mit solchen Italienern, die längere Zeit in Deutschland waren, und man wird finden, wie verbittert die Leute sind über die Mißwirtschaft und die öffentlichen Ungerechtigkeiten in ihrem Heimatlande.
Am 9. Mai.
Es ist Sonntag heute, aber kein Sonnentag, sondern trübes Regenwetter. Ich schaue dem Landvolk zu, wie es aus Berg und Tal der Kirche zuzieht. Es fällt mir auf, wie tief rot und wie malerisch die farbigen Tücher der Frauen und Mädchen leuchten in der dunkeln Luft.
Gegen Mittag kam einer meiner Brotherren, der Chef des Welthauses Herder in Freiburg. Es sind aber nicht Geschäftssachen, die den Verlagsfürsten nach Hofstetten führen, sondern es ist die Freude am »Paradies«, in dem er schon öfters mich aufgesucht hat.
Herder ist nicht bloß einer der deutschen Verlagskönige, bildlich gesprochen, sondern er hat auch in seinem ganzen Auftreten etwas wahrhaft Fürstliches. Dabei besitzt er gar keine fürstlichen Passionen und ist der anspruchsloseste Mann der Welt.
Er liebt weder Weib, noch Wein, noch Gesang und könnte Abt in einem Trappistenkloster sein.
Es ist ihm all das um so höher anzurechnen, als er glücklicher Besitzer eines fürstlichen Vermögens ist, das ihn aber nicht abhält, seine Arbeit zu tun, als ob er ein Angestellter seines Hauses wäre. Vom Morgen bis zum Abend ist er im Geschäfte tätig.
Dies ist der Grund, warum ich ihm schon oft sagte, ich möchte seine Millionen nicht geschenkt, wenn ich so arbeiten müßte wie er.
Große, reiche Geschäftsleute sind die Sklaven ihres Soll und Haben, und da ich die Sklaverei hasse und die Freiheit liebe, will ich lieber ein armer Pfarrer und Schriftsteller als ein reicher Geschäftsmann sein.
Und wenn Verlagsfürst Herder, der ein lediger Mann ist, mir heute sein Geschäft bedingungslos zu eigen gäbe, ich würde es morgen schon an eine Aktiengesellschaft verkaufen, um ein freier, reicher und damit unabhängiger Mann zu werden. –
Je älter ich werde, um so kleiner wird die Zahl derer, die schon zu den Erwachsenen zählten, da ich noch ein Knabe war. Bald sind alle, alle verschwunden in und um Hasle, die Bürger und die Bauern, die ich in meiner Knabenzeit trinken und jauchzen und sich des Lebens freuen sah.
Heute besuchte mich einer der wenigen aus längst entschwundenen Tagen, der Lehrer Stäuble von Steinach, welcher als Pensionär in Hasle sitzt.
Er war schon 1843 als Lehrer in Steinach tätig, also zu der Zeit, da ich als Sechsjähriger meines Großvaters Bruder, den Müller Toweis in Steine, an den Kirchweihtagen heimsuchte und Küchle holte.
Und heute ist der Mann noch rüstiger als ich und mit dem Lebensmut eines Dreißigers ausgestattet. –
Morgen will ich das Paradies für zwei Wochen verlassen. Ich muß, um Stoff für meine »Erzbauern« zu sammeln, ins Wolftal hinauf.
Im Ochsen in Schapbach hab' ich Quartier gefunden, wie ich es wünsche. Dr. Wörner hatte die Freundlichkeit, als ärztlicher Quartiermeister mir ein Plätzchen auszusuchen, wo ich das fände, was ein Nervenkranker braucht – Ruhe und nochmals Ruhe und gute Luft dazu.
Ich bin also über den Hauptpunkt beruhigt und freue mich, einige Tage im oberen Kinziggebiet, wo ich seit dreißig Jahren nimmer war, verleben zu können. Mein Leibkutscher, Wendel, der Roserbur, wird mich dahin bringen.
Schapbach am 10. Mai.
Hier sitze ich seit gestern nachmittag in einem Asyl, das Hofstetten an Ruhe fast, an landschaftlichem Reiz völlig übertrifft. Die Natur ist wilder und waldiger hier, und das gefällt mir, die Heimatgefühle weggedacht, noch besser als ihr lieblich grünes Wesen in und um Hofstetten.
Das Gasthaus zum Ochsen liegt eine kleine halbe Stunde unterhalb des Dorfes Schupbach einsam an der Straße durchs Wolftal.
Die Wolf springt mit ihrem braunen, hellen Wasser lustig und frisch neben der Straße her.
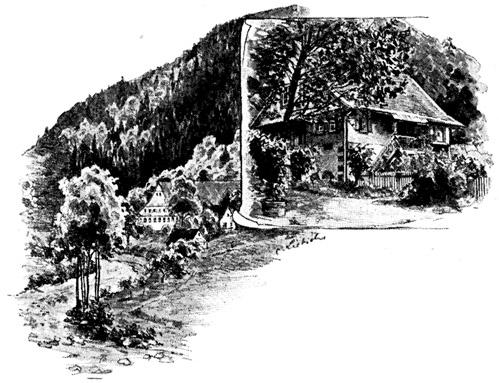
Ihr Tal ist naturgemäß enger als das der Kinzig, welche die Wolf aufnimmt. Wie Kulissen schieben sich rechts und links des Flüßchens waldige Berge bis auf die Talsohle und bilden zwischen sich wieder eine Menge zerklüfteter, reizvoller Tälchen.
Holz ist drum der Hauptreichtum der Buren im Wolftal. Und da die Tannen wachsen, ob gute oder schlechte Sommer sind, und auch das Hagelwetter ihnen nichts schadet, so sind diese Buren besser daran als ihre Kollegen um Hasle rum, die meist mehr auf den Ertrag von Wein, Obst und Früchten angewiesen sind als aufs Holz.
Mit seinen vielen dunkeln Wäldern hat das Wolftal etwas Melancholisches, und das ist die Stimmung, die mir behagt. Dazu wohne ich mutterseelenallein in einem Gartenhäuschen des Ochsenwirts, abseits vom Hauptgebäude.
Im Hochsommer füllen Kurgäste dies sonnige Häuschen, und dann möchte ich um keinen Preis darin wohnen. Jetzt aber ist es mir eine wahre Wonne, allein darin hausen zu können.
Gen Süden schauen eine Menge waldiger Bergspitzen zu mir herab, und meinem Fenster gegenüber stürzt der Holdersbach mit brausendem Gischt in die Wolf. –
Ich hatte gestern noch erfahren, daß mein nächster Nachbar talaufwärts der Marxenbur sei, mein einstiger Leidensgefährte in Illenau. Ihm galt drum heute mein erster Besuch.
Ich fand ihn noch so still duldend und so viel leidend wie vor drei Jahren. Aber er freute sich, einen Leidensgenossen wiederzusehen und einer Seele klagen zu können, die ihn verstund.
Nerven- und Gemütsleidende finden unter den Gesunden so selten Menschen, die einen Begriff haben von dem, was jene mitmachen müssen, daß es ihnen ein wirklicher Trost ist, wenn jemand für ihre Klagen und Peinen ein williges und verständnisvolles Gehör hat.
Einsam liegt der arme Marxenbur die meiste Zeit im Bette und seufzt und stöhnt in hartem Weh. Sein Weib, seine Knechte und Mägde müssen Haus und Hof umtreiben und können ihm keine Gesellschaft leisten.
Einsamkeit aber ist bei solchen Leiden kein Heil-, sondern ein Förderungsmittel der seelischen Plagen.
Ich riet dem Marxenbur, wieder nach Illenau zu gehen, und er hat später meinen Rat befolgt.
Wie mir der Ochsenwirt erzählt, finden sich Geistes- und Gemütsleiden in manchen besseren Bauernfamilien des Tales. Vor etwa achtzig Jahren sollen sieben Bauerntöchter vom Schmiedsberg, dem einst größten Hof im Gebiete der Wolf, hinab ins Tal geheiratet haben.
Sie alle waren erblich belastet mit obigen Leiden, und seitdem leben einzelne ihrer verschiedenen Nachkommen ein elendes Dasein, und stets ist die eine oder andere Person aus ihrem Blute in Illenau.
So unbarmherzig geht das Gesetz der Vererbung durch die Geschlechter der Menschen.
Seitdem ich mein Buch »Aus kranken Tagen« veröffentlicht, haben viele Nervenleidende von mir Rat gewollt – alle aber ohne Ausnahme, wie ich dabei erforschte, Eltern oder Voreltern gehabt, die Ähnliches gelitten.
Als ich vom Marxenbur heimkehrte, begegnete mir der Postillon, der mit seinem Wagen von Wolfach nach Rippoldsau fährt. Ich freute mich seines Anblicks; denn da, wo noch die Postwagen fahren, sind Poesie und Volkstum noch nicht so geschädigt wie dort, wo das Dampfroß durchkeucht. –
Am 12. Mai.
Nachts komme ich mir in meinem Häuschen vor wie eine von der Welt abgeschiedene Seele. Keine Uhr schlägt durch die Nacht hin, kein Hund bellt in der Finsternis, kein Glöcklein tönt an mein Ohr, und kein Lichtstrahl dringt am frühen Morgen durch die dicht schließenden Läden meiner Schlafkabine.
Nur den Holdersbach höre ich rauschen – als müßt' er das Rad treiben, das die Welt draußen in Gang setzt, während ich in der Ewigkeit bin.
Wenn es mir in dieser dereinst nicht schlechter geht als bei diesem Nachtleben am Wolfbach, so will ich zufrieden sein. Denn es liegt für mich eine gewisse Wonne darin, in dieser ewigen Ruhe zu wachen.
Als ich diesen Morgen, aufgestanden, die Läden öffnete, siehe, da lag Schnee auf allen Tannen, und es schneite lustig weiter, als ob wir Dezember hätten statt Mai. Die Rosenknospen in dem Gärtchen vor meinem Fenster lassen betrübt die Köpfchen hängen, und der Postle von gestern abend, der eben wieder angefahren ist und umspannt, flucht über das Hundewetter.
Trotz dieses Wetters fuhr ich diesen Morgen in den Hirschbach zum »Benedikt auf dem Bühl«, von welcher Fahrt ich in den »Erzbauern« erzählt habe.
Am Nachmittag saß ich in meinem Stübchen, das der Ochsenwirt mit allem eingerichtet hat, was ich brauche, selbst mit einem sehr bequemen Ruhebett – und las in dem alten Satiriker Juvenalis, der trotz seines Verrufs ein tief moralischer und sittenernster Mann war.
Da kam der Hausherr zu mir herüber und meldete: »Der Altbürgermeister Waidele von Schupbach sei drüben in der Wirtsstube und wolle mich sprechen; er kenne mich gut von früher her.«
Es wollte mir nicht einleuchten, je einen Mann dieses Namens aus dem Schappe kennengelernt zu haben, erklärte mich aber gleichwohl bereit, den Angemeldeten zu empfangen.
Bald darauf erschien ein behäbiger Fünfziger im Habit eines besseren Städtlebürgers und sagte, er habe, da ich noch Student gewesen, in der Nachbarschaft meines Elternhauses, beim Schreiner Hauschel, gelernt.
Mir kam der also Sprechende wildfremd vor, und er war sichtlich in Verlegenheit, daß ich ihn nimmer erkennen wollte.
Endlich fand er das erlösende Wort und fragte, ob ich mich denn nimmer ans Hauschels Severin erinnerte. Jetzt ging mir ein Licht auf, und meine Freude war doppelt. Ja, den Severin hab' ich wohlgekannt, hatte aber keine Ahnung, daß er Waidele hieß, und seit bald vierzig Jahren nichts mehr von ihm gehört.
Aus den blauen Augen des Mannes schaute nun plötzlich der dicke, gemütvolle Lehrbub Severin, den ich und meine Schwestern so oft plagten, da er beim Nachbar Schreiner-Hauschel lernte.
Noch in den oberen Klassen des Gymnasiums war ich ein alter Kindskopf und vertrieb mir manche Stunde, wie in der Knabenzeit, in der Werkstätte des Nachbars Schreiner.
Hier war eines Tages der Severin eingetreten und trug eine blaue Wollkappe, die ihm seine arme, brave Mutter gestrickt. Die Kappe endigte in einem Wollknopf, der alle Fäden derselben zusammenhielt. Ich war nun boshaft genug, dem schüchternen Büble aus dem Wolftal den Knopf abzuschneiden und so seine ganze Kappe zu zerstören.
Er erinnerte mich heute lachenden Mundes wieder an diese Schandtat, und es überkam mich jetzt erst eine wirkliche, echte Reue über diesen Studenten-Bubenstreich einem armen Bauernbüble gegenüber.
Aber auch sonst ward der Severin geplagt von den Sprößlingen des Nachbars Becke-Philipp. Die Schapbacher sprechen, wie alle Bewohner des oberen Kinziggebiets, viel in Kehllauten. Die mittleren Kinzigtäler nennen das kretzen oder reißen, und die Haslacher, ein spöttisch Völkle, höhnten von jeher gerne über dieses Kretzen.
Ein Dienstmädchen, das einmal aus dem Schappe nach Hasle verschlagen worden war und wegen seines »Reißens« ausgespottet wurde, wehrte sich dagegen und meinte allen Ernstes: »Der Vatter rißt, d' Muatter rißt, alle riße, nur ich riß nit!«
Dieses geflügelte Wort mußte fortan jeder Schapbacher hören, der in die Nähe des Geheges Haslacher Zähne kam, und meine Schwestern und ich riefen dem Schreinersbüble unzähligemal zu: »Severin, der Vatter rißt, d' Muatter rißt, alle riße, nur ich riß nit!«
Auch davon sprach der wackere Mann heute wieder als von einem lieben Gedenken. So verklärt uns die Erinnerung an die Jugendzeit selbst die damals erlittenen Unbilden.
Nun wollt' ich, nachdem wir so unser Wiedererkennen festgestellt, auch seinen Lebensgang wissen, und da lernte ich erst begreifen, wie unrecht ich dem kleinen Severin einst getan hatte; denn in ihm steckte, wie ich heute erst erfuhr, ein ganzer Mann.
Er wurde von Hasle weg Soldat, zog später einige Jahre in der Fremde umher und ließ sich dann in seiner Heimat Schapbach als armer Schreiner nieder. Von seiner Werkstätte aus aber gingen soziale Gedanken in die Hütten der Armen, und sie trugen Früchte zum Ruhme Severins.
Überall auf dem Schwarzwald wird man finden, daß Buren und Taglöhner einer Dorfgemeinde in einem sozialen Gegensatz zueinander stehen, der sich vorab geltend macht bei den Gemeindewahlen.
Es ist dies der alte Kampf zwischen Plebejern und Patriziern. Zu den erstern im Schappe gehörte auch der Schreiner Severin und viele Taglöhner, deren Hütten zahlreich in den Tälern und Bergen zerstreut liegen.
Sie alle sammelte um sich der Dorf-Schreiner und führte sie, die ja stets die Majorität haben, wenn sie einig sind, zum Sieg über die Patrizier, d. i. über die Buren, welche bisher immer einen der Ihrigen an die Spitze der Gemeinde gestellt hatten.
Jetzt wurde der Dorf-Schreiner Severin Bürgermeister einer großen, reichen Waldgemeinde. Die Buren murrten. Aber Severin, der Gerechte, gewann ihnen bald Achtung und Respekt ab, so daß er siebzehn Jahre lang am Ruder blieb und erst abtreten mußte, als das neue, unfreie, badische Gemeindegesetz den Buren den Sieg wieder in die Hände spielte.
Die badischen Bürger und Bauern dürfen seit einigen Jahren kraft eines »liberalen« Gesetzes ihren Bürgermeister nicht mehr direkt wählen.
Die Furcht vor den Sozialdemokraten hat dies Gesetz geschaffen zugunsten der »besseren Bürger und Bauern«.
In unserer Zeit aber derlei Gesetze zu schaffen ist sehr unklug und rächt sich bitter.
Doch brauchen sich die Schöpfer dieser Unfreiheit und Bevormundung nicht zu schämen und die armen Taglöhner und Bürger sich nicht zu grämen – denn die katholischen Pfarrer, die viele Jahre studiert haben, dürfen ihre Bischöfe auch nicht wählen, nicht einmal indirekt. –
So fiel der Severin als Bürgermeister, aber Finanzminister, d. i. Gemeinderechner im Schappe ist er heute noch und bei allen andern Wahlen das Zünglein an der Wage; denn er ist beredt und hat in Hasle das Zeug geholt zu einem Agitator.
Ich aber sage: Respekt vor dem Severin; denn der boshafte Becke-Philipple, welcher ihm einst die Wollkappe aufschnitt, hätte es, so er ein Bäcker oder ein Schreiner in Hasle geworden, nicht einmal zum Nachtwächter, noch viel weniger zum Bürgermeister in seiner Vaterstadt gebracht.
Am 13. Mai.
Ein originelles Meidle Die obern Kinzigtäler sagen Meidle, die untern Maidle., unbeleckt von jeder Kultur und mir drum lieber als eine Hofkammerjungfer, ist die Magd des Ochsenwirts, welche mich in meinem Häusle bedient.
Sie heißt Monika, stammt aus dem Hirschbach, wo ich gestern ihren Vater und ihres Vaters Hütte sah, und ist ein schwarzbraunes Mädchen älteren Datums. Sie ist schon zwölf Jahre im Ochsen und längst Obermagd, während ihre viel jüngere und viel schönere Schwester, die Lisbeth, unter ihr dient.

Beide sind kreuzbrave Meidle und bringen, was sie erwerben, den alten Eltern. Der Vater war Holzmacher und Steinbrecher, kann aber jetzt nichts mehr verdienen.
Die Monika ist so eifrig bei der Arbeit, daß sie immer springend zu mir herüberkommt und ebenso wieder davoneilt. Ihrer Obsorge ist gar vieles anvertraut; sie hat nach ihren eigenen Worten »die Schweine, die Kälber und die Kurgäste« zu bedienen, während die Lisbeth der Kühe wartet.
Zur Sommerszeit, wenn die Kurgäste im Tal sind, bekommt die Monika nicht einmal Zeit zum Beten. Sie ist darüber beunruhigt und fragt mich, ob das eine Sünde sei.
Ich tröstete sie, weil ich bemerkt hatte, daß im Ochsenwirtshaus morgens, mittags und abends laut zum und vom Tisch gebetet wird, wobei die Monika vorbetet.
Dies und die gute Meinung, alles Gott zu Ehren zu tun, genüge für die vielseitig beschäftigte Monika, so sagte ich ihr.
Auch gab ich ihr den Rat, im Widerstreit ihrer Pflichten gegen Kälber, Schweine und Kurgäste eher die letzteren zu vernachlässigen als die ersteren. Denn die Kurgäste kämen nur aus Pläsier und Lebensluxus, die Vierfüßler aber hätten ihre Hilfe viel nötiger.
Wenn ich so und ähnlich mit ihr sprach, lachte das Meidle so naiv und frisch, wie nur gottfrohe Menschen lachen können. –
Ich schritt diesen Morgen wieder hinüber zum Marxenbur. Er lag im Bett und betete den Rosenkranz, das Bild eines Märtyrers, der inmitten seiner Qualen zu seinem Gott fleht um Geduld und Stärke.
In der Stube nebenan saß einsam ein Dorfschneider und machte neue Hosen. Ich sah nach langer Zeit das erstemal wieder einen Schneider »im Kundehus«. Der Mann schimpfte, daß so wenig Zwilchhosen mehr gemacht würden, obwohl das neumodische Lumpenzeug die Arbeit nicht wert sei.
In der Küche traf ich die Büre und staunte über den eleganten, neumodischen Herd. In keinem Hotel ersten Ranges steht ein größerer und eleganterer. So sollen auf vielen Höfen im Schappe Feuerherde stehen.
Das tut mit seinen hohen Holzwerten der Tannenwald, der die Buren reich und die Bürinnen üppig macht.
Drum sieht man auch im Schappe in den großen Bauernhöfen selten mehr ein Strohdach. Teure Falzziegel decken die Dächer, und ihre grellrote Farbe schreit mißtönend in die grüne Waldlandschaft.
Als gegen Abend der mir bekannte praktische Arzt Moser von Wolfach an meinem Häuschen vorbeifuhr hinauf ins Dorf, fuhr ich mit ihm.
Ich war seit 1867 nicht mehr in Schupbach und staunte, wie städtisch alle Häuser aussahen, die das eigentliche Dorf bilden. Malerisch liegen Kirche und Pfarrhaus auf einer Anhöhe, um welche waldige Berge noch malerischer sich gruppieren.
Der Pfarrherr Fehrenbach, ein Freiburger, den ich besuchte, ist krank, und der Arzt ist auch seinetwegen heraufgefahren. Die Pfarrei ist sehr beschwerlich, und drum kann ein Pfarrer schon krank werden. Auch soll sonst mit den Schapbachern nicht gut Kirschen essen sein.
Ich suchte dann noch den Severin auf. Er hat ein freundliches, sonniges Haus an der Landstraße. Unten ist die Werkstatt, in der jetzt sein Sohn schreinert; der alte Bürgermeister und jetzige Finanzminister rührt keinen Hobel mehr an.
Im zweiten Stock traf ich ihn und sein Weib. Daß die Frau trotz der modernen Eleganz ihres Severin die Volkstracht beibehalten, flößte mir Respekt vor ihr ein. Leider konnte ich ihr das nicht sagen, da die Arme infolge eines Falles von der Treppe herab gänzlich taub ist.
Sie weinte, da sie mich mit ihrem Mann reden sah und nichts verstehen konnte. Noch einen zweiten Sohn traf ich in der Stube, den ältesten Sprößling Severins. Ich hatte ihn auf den ersten Blick für einen Kellner oder Friseur taxiert. Und richtig, er war das letztere. Er hat seine Studien in aller Herren Länder gemacht zu Wasser und zu Land und ist jetzt Haarkünstler im benachbarten Bade Rippoldsau.
Severin, der Vater, aber fährt auf seinem Stahlroß talauf und talab und macht in Feuerversicherung und allerlei Agenturen. Dabei hat er ein Herrenleben und außerdem zwei Kühe im Stall und Feld ums Haus rum. Kein Wunder, wenn aus allen Zügen seines Gesichtes ein Mann schaut, der keine Sorgen hat.
Mir zauberte der Meister Severin noch eine Menge Bilder aus Alt-Hasle aus seinen Erinnerungen vor, Bilder, die längst untergegangen waren in meinem Gedächtnis.
Er kennt heute noch genau die Eigenart aller Bürger von Hasle aus jenen Tagen und weiß sie in staunenswerter Weise wiederzugeben. Und es ging mir bei seinen Schilderungen wie dem Dichter Chamisso, wenn er einmal singt:
Ich träume als Kind mich zurücke
Und schüttle mein greises Haupt.
Was sucht ihr mich heim, ihr Bilder,
Die längst ich vergessen geglaubt?
Heimgekehrt in meine kleine Klause am Wolfbach, lag ich noch einige Zeit auf dem Ruhebett und gedachte trüben Sinnes der jungen Jahre, die der Severin mir eben wieder so lebhaft heraufbeschworen, und gedachte des Alters, das nun uns beide erfaßt und dem Ende zuführt.
Ich setzte mich dann ans Fenster und las noch die zehnte Satire des Juvenal und schöpfte aus ihr Mut in meiner elegischen Stimmung.
Wie wunderbar wahr und schön spricht der heidnische Dichter von dem, was wir von der Gottheit uns wünschen und erbitten sollen. Er fragt:
Nichts soll also der Mensch sich wünschen? Soll ich dir raten,
Mußt du den Himmlischen selbst die Entscheidung lassen darüber,
Was sich schicket für uns und dienet zur Wohlfahrt.
Denn es verleihen statt des, was uns erfreut, das uns beste die Götter.
Mehr ist ihnen der Mensch als sich selbst wert …
Wie trefflich sagt Juvenal dann weiter, um was wir die Götter bitten sollen:
Bitte darum, daß die Seel' in gesundem Leibe gesund sei;
Fordere mutigen Geist, der Furcht nicht hat vor dem Tode,
Der nur als ein Geschenk der Natur ansiehet des Lebens
Endziel; der es vermag, der Bedrängnisse jede zu tragen.
Der nicht kennet den Zorn, noch Begier und für werter des Wunsches
Herkules' Drangsal hält und der Arbeit bittere Mühen,
Als die Genüsse der Lieb' und des Mahls und Sardanapals Flaum.
Sieh' hier, was du dir selbst verleihen kannst; wahrlich es stehet
Nur durch Tugend der Pfad zu des Lebens Ruhe dir offen!
Nie fehlt' göttliche Macht, wenn Weisheit herrschete; wir sind's,
Wir, die zur Göttin dich weih'n, o Glück, und zum Himmel versetzen.
Fürwahr, kein christlicher Kirchenvater könnte Besseres lehren als hier der verrufene Heide und Mitbürger des heiligen Thomas von Aquino! –
Trotzdem ist Juvenal kein Lesestoff für die Jugend, weil er die Laster, die er geißelt, zu nackt und zu offen schildert.
Am 14. Mai.
In aller Frühe kam der Moosbur vom Schwarzenbruch herab, um mich einzuladen, ihn einmal auf seiner einsamen Höhe zu besuchen. Zugleich brachte er eine Gabe mit aus jener Heide, eine Flasche Heidelbeerschnaps, von ihm selbst gebrannt, und das Feinste, was dort droben gedeiht.
Meine Freundschaft mit dem Moosbur ist noch nicht alt, ihr Zustandekommen aber interessant.
Im letzten Herbst erschien eines Tages bei mir in Hofstetten ein Bauersmann in der Volkstracht der Obertäler: kurze Rohrstiefel, über ihnen blaue Strümpfe, Kniehosen, Tuchkittel, offenes Brusttuch, aus dem ein gefälteltes und durchbrochenes Hemd herausschaute.
Der Mann hatte meine volle Sympathie um seiner Tracht willen, ehe er noch ein Wort gesprochen. Und was sprach er? Er sei der Moosbur vom Schwarzenbruch, und ein Hausierer hab' ihm den Rat gegeben, zu mir zu gehen. Ich nähme mich, so hab' jener gesagt, gerne der Buren an.
Nun hätte man den meist armen Bewohnern auf dem Schwarzenbruch den Stier genommen, und sie sollten mit ihren Kühlein fast zwei Stunden weit den Berg hinunter, was im Winter bei Eis und Schnee unmöglich und im Sommer eine Plage und viel Zeitverlust sei. Er selbst habe für sich zwar einen Stier, dürfe ihn aber den anderen Viehbesitzern nicht zur Verfügung stellen, weil er nicht »gekürt« sei, d. i. nicht alle Eigenschaften habe, die ein neumodischer Stier haben müsse.
Niemand aber wolle den Schwarzenbruchern helfen, damit sie zu einem gekürten Stier kämen; überall, selbst beim Ministerium seien sie abgewiesen worden.
Jetzt habe der Hausierer ihm, der sich seiner Nachbarn annehme, Mut gemacht, bei mir Hilfe zu suchen. –
So weit hat es die Überkultur in der Viehzucht gebracht, daß die Bauern nur noch der Stiere und nicht diese der Bauern halber zu existieren scheinen.
Die Stiere werden zentralisiert, und die Buren und Taglöhner sollen ihnen nachlaufen. In der Nähe vom Schwarzenbruch, am Wildsee, kamen die armen Leute im Winter manchmal nicht mehr am gleichen Tage mit ihren Kühlein heim; sie mußten unterwegs übernachten und am andern Tag ihre Tiere oft mit dem Schlitten heimführen. Alles das der Rindvieh-Kultur zu Ehren! Es wäre zum Lachen, wenn's nicht so traurig wäre.
Ich nahm mich der Sache an, und die Schwarzenbrucher und die Taglöhner am Wildsee bekamen wieder einen Stier.
So wurden der Moosbur und ich gut Freund. Und heute kam er, um mich einzuladen, auf dem Schwarzenbruch einen Besuch zu machen.
Ich sagte ihm denselben gerne zu, und am kommenden Montag, so ward ausgemacht, sollte er mich mit seinem Wägele abholen und den Berg hinaufbringen.
Der Moosbur schied. Er nahm den nächsten Weg, der hinter dem Ochsenwirtshaus steil durch den Wald hinaufzieht. Ich aber schritt auf der ebenen Talstraße in den kühlen Morgen hinein, um mich etwas zu ergehen.
Die Sonne zeigte sich schüchtern aus schneebeladenen Wolken. Und doch sangen ringsum die Vögelein so unverzagt, als ob kein Schnee auf den Tannen läge.
Vom Tal herab schreitet eine ältere Weibsperson, der Tracht nach eine Gutacherin. Ich schließe mich ihr an, um mit ihr ins Gespräch zu kommen. Schnell sind wir bekannt.
Man sagt ihr in ihrer Heimat nur »das Mareile«. Es hat mit Strohtaschen gehandelt im Glaswald, gottlob fast alle verkauft und geht jetzt heim ins Gutachertal, um andere zu holen und auf den Kniebis und in den Holzwald zu tragen.
Das ist des Mareiles »Vertrieb« in der Maienzeit. Im Spätsommer, wenn's Preiselbeeren gibt in den Hochwäldern an der Kinzig, Gutach und Wolf hin, handelt das Mareile mit solchen, aber nit bei den Bursleuten, sondern bei den Vornehmen, die »so Zeugs mögen«.
Bei diesem Handel kommt das Mareile hinauf bis nach Konstanz und sogar bis nach St. Gallen. Hier sind die Leute aber viel christlicher als in Konstanz, wo es »kalt hergeht«.
»Dem Herrn leben und dem Herrn sterben« ist des Mareiles einziger Trost. Alles andere ist wertlos. In jungen Jahren sieht man das nicht ein, und alles in der Welt scheint grün und goldig. Im Alter aber sieht's finster und schwarz aus.

Das alte, runzelige, ledige Weible kam mir, während es so redete, vor wie eine Seherin und Wahrsagerin. Ich dachte bei seinen Worten an Walter von der Vogelweide, der einmal singt:
O weh, nach dieser Erden Lust ging unser Streben!
Ich seh' die Galle mitten in dem Honig schweben.
Die Welt ist schön von außen, weiß und grün und rot,
Doch innen schwarz von Farbe, finster wie der Tod.
Dem Mareile aber, das mich so gut unterhalten, ließ ich im Ochsen eine Erfrischung reichen, auf daß es leichter den weiten Weg mache hinab ins Gutachertal. –
Schon als ich auf dem Weg hierher durch die »alt' Wolfe« Die Gemeinde Oberwolfach heißt im Volksmund »die alt' Wolfe«, offenbar weil sie früher bestund als das Städtchen Wolfe. fuhr, suchte ich mit den Augen einen Hof, an den sich mir selige Jugenderinnerungen knüpfen, weil aus ihm meines Vaters Lehrbub, der Sepp, stammte und ich als Knabe bisweilen mit ihm in seine Heimat ging.
Ich fand und erkannte das alte Haus wieder. Es ist der Jochemshof an der Grenze von Oberwolfe und Schappe. Es hat sich seit dem halben Jahrhundert an ihm nichts geändert, und er ist noch die gleiche alte, malerische Strohhütte von damals.
Drinnen aber wohnen Enkel und Urenkel des alten Jochemsburen, mir natürlich fremde Leute. Ich fragte nach den vielen Geschwistern des Sepp und erfuhr, alle seien tot; nur drunten in der »alte Wolfe«, unfern der Kirche, wohne noch eine Schwester.
Die wollt' ich aufsuchen, um zu erfahren, was aus dem Sepp geworden, den ich, seitdem er meines Vaters Backstube verlassen, nicht mehr gesehen und von dem ich nur gehört hatte, er sei in jungen Jahren nach Amerika ausgewandert.
Der Ochsenwirt führte mich nun heute talaufwärts und war mir behilflich, Sepps Schwester zu finden. Nach einigem Fragen entdeckten wir die Gesuchte in einem freundlichen, neumodischen Haus an der Landstraße.
Auf den ersten Blick erkannte ich in der rüstigen Alten die Schwester meines Jugendfreundes Sepp, mit dem ich manchen Abend meiner Knabenzeit in der väterlichen Backstube verbracht habe. Sie hat eine zwischen Bruder und Schwester seltene Ähnlichkeit mit ihm.
Sie staunte nicht wenig, die Frau Viktoria, genannt die alt' Schorne, als ein alter Pastor nach dem Sepp fragte. Nachdem ich mich aber mit ausführlichen Worten ihr vorgestellt hatte, rief sie aus: »Gucket ou, gucket ou, des isch des Beckebüeble von Hasle, wo als mit dem Sepp in unser Hous komme isch!«
Sie wußt nichts weiter mehr, als daß der Sepp in Hasle bei einem Beck die Lehre gemacht habe. Der Name des Bäckers war ihr gänzlich unbekannt; aber sie erinnerte sich an »des bleich' Büeble«, das mit dem Sepp bisweilen auf dem Jochemshof erschien.
Als sie meinen Namen hörte, wollte sie wissen, ob ich der Pfarrer Hansjakob von Hasle sei, der »Bücher stelle«. Im zweiten Stock ihres Hauses wohne der Unterlehrer, und der hab' ihr schon von diesem Pfarrer erzählt und von seinen Büchern.
Da ich die Frage bejahen mußte, staunte die Alte noch mehr über den Freund ihres Bruders, von dem ich nun erfuhr, daß er vor zehn Jahren schon in Pittsburgh im Staat Pennsylvanien gestorben sei.
Er habe in Wolfe beim »Winkelbeck« gearbeitet, dort ein Meidle kennen gelernt, das bei seinen Meistersleuten als Magd diente. Es war auch aus der alte Wolfe, auf dem Harzbühl daheim und hieß Agatha. Mit der sei der Sepp schon anfangs der fünfziger Jahre nach Amerika. Hier wäre er Straßen- und Wegbauer geworden, habe ein eigenes Haus erworben, auch einmal eine Wirtschaft betrieben und schließlich nach vielen Mühen und Sorgen das Zeitliche gesegnet.
Ich fragte dann auch noch nach ihrem Schwager, dem Mann ihrer Schwester, der Rosine, den man nur den Ronge-Murer nannte und der mir auch gar wohl bekannt und ein Original war.
Der Ronge-Murer stammte von Hausach und hieß im Taufbuch Sebastian Heizmann, sonst aber, ehe er nach dem Schlesier Ronge benamst wurde, »'s Mathesen Basche«.
Er war Küfer, Bierbrauer und Kunstmaurer und in letzterer Eigenschaft weithin berühmt als der beste Erbauer von Feuerwerken für Bäckereien, Brennereien und Siedereien. Er verdiente als Maurer ein Heidengeld, das er aber alles wieder verjubelte.
Alljährlich kam er Ende der dreißiger und anfangs der vierziger Jahre in seine Vaterstadt Huse, um hier die Fastnachtstage zu verbringen. Wer Zeit und Lust hatte, durfte dann auf seine Rechnung trinken.
Auch die Jugend vergaß er nicht in dieser Zeit der Lustbarkeit. Mit einer großen Angelgerte, an der Brezeln und Würste hingen, stellte er sich auf den Gassen unter die Kinderschar und ließ sie nach den Leckerbissen langen.
Später heiratete er eine Schwester von unserem Sepp und baute ein Häusle unterhalb des Jochemshofs, das heute noch steht und gerade neu errichtet war, als ich zum erstenmal mit dem Sepp in die alt' Wolfe kam.
Seine Narrenstreiche verlegte er fortan in der Fastnachtszeit in das näher gelegene Städtle Wolfe. Hier spielte er einmal den Johannes Ronge, der in den vierziger Jahren als Erfinder des Deutsch-Katholizismus so viel von sich reden machte, und bekam den Namen der Ronge-Murer.
Er war – ich sehe ihn noch lebhaft vor mir – ein großer, stattlicher Mann und ob seines lustigen Wesens und seiner Kunst als Maurer überall bekannt und beliebt.
Heute erfuhr ich, daß er schon vor dem Sepp nach Amerika gezogen und längst in Buffalo das Zeitliche gesegnet habe. Auch sein Weib, die Rosine, starb dort vor kurzem, und die Viktoria erbte noch 100 Dollars.
Des lustigen Murers Name aber lebt im Wolftale fort; denn die Gegend, in der sein Häuschen steht, heißt bis auf den heutigen Tag »in der Ronge«. –
Meine Unterhaltung mit der Viktoria hatte sich gänzlich auf der Landstraße vor ihrem Heim abgespielt. Im Verlauf unseres Gespräches waren auch ihr zweiter Mann und ihr Sohn zu uns getreten, um das Beckebüeble zu beschauen. Ihr Mann heißt Klemens und scheint seinem Namen alle Ehre zu machen; denn er ist das Bild eines milden, friedlichen Mannes, und auf seinem Haupte thront das Symbol der Zufriedenheit, die Zipfelkappe.
Der Sohn ist Maler, Krämer und Hausbesitzer, während die Eltern die Felder bebauen, die ringsum ihr Eigentum sind.
So hat die noch ungemein lebhafte Viktoria ein sorgenloses Alter, und das freute mich um ihres Bruders Sepp willen, der zu den vielen Sternen meines Knabenhimmels gehörte.
Als ich auf dem Rückweg wieder am Jochemshof vorbeifuhr und der Tage gedachte, da ich dort ein- und ausging, überkam es mich wie jenen alten Minnesänger, der da klagt:
O weh, wohin entschwanden meine Jahr!
War nur ein Traum mein Leben oder ist es wahr?
Was stets ich hielt für wirklich, war's ein Traumgesicht?
So hab' ich denn geschlafen und weiß es selber nicht.
Ja, wo sind die fünfzig Jahre, die verflossen seit der Zeit, da der Sepp mich da heraufführte? Wahrlich, ein ordentlicher Traum kommt mir heute länger vor als sie. –
Am 15. Mai.
Der Sommerkurs beginnt mit heute in der Omnibusfahrt durchs Wolftal, und vier Postwagen spannen von nun an täglich beim Ochsen um.
Außer dem rotbackigen, dicken Postle Andres, der bisher allein hier verkehrte, ist noch ein zweiter »Schwager« angerückt. Er heißt, wie er mir eben sagte, Remigi, und um seines Namens und seines poetischen Amtes willen ist auch er mir sympathisch, obwohl er seinem Kollegen, dem Andres, leiblich, geistig und fachlich das Wasser nicht bieten soll.
Ich rede, ehe er wieder abfährt, mit ihm und bewundere seine stolzen Rosse. Der Remigi lobt aber nur den zur rechten Hand und meint: »Der hot ebe eine ganz andere Temperatur als der linkhändig. Er louft daher wie ein Offizier; so hebt er den Kopf in d' Höh'!« Sprach's und fuhr schmunzelnd von dannen.
Trotz des Sommerkurses heult der Nordwind über die Berge, daß die Tannen ächzen wie im November.
Bei einem kurzen Gang talab begegnet mir, die Sense auf der Schulter, der Müller, dessen kleine Mühle dort drunten am Wolfbach geht. Er hat, wie er mir erzählt, als armes Knechtlein sich 1200 Mark erspart und die Mühle gekauft, nachdem er als deutscher Krieger den Feldzug gegen die Franzosen mitgemacht.
Bei Chenebier bringt er seinen Hauptmann, der gefallen ist, in Sicherheit. Da der so Gerettete aber an seinen Wunden stirbt, denkt niemand an die tapfere Tat des Schwarzwälder Soldaten.
Seit 1872 hat er aufgebrochene Füße, die einzige Errungenschaft für ihn vom Feldzug her, und niemand will ihm helfen zu einem Invalidensold.
Das Hochwasser im vorigen Frühjahr hat ihn auch noch schwer geschädigt; drum will er es nochmals versuchen, etwas aus dem Invalidenfonds zu bekommen.
Leider kann ich dem braven Mann nicht helfen, da ich bei preußischen Mächten nichts vermag und all mein Liebeswerben dort umsonst wäre.
Ich bin ein Freund des Deutschen Reiches und seiner Macht und seiner Einheit; aber für seine Krieger, die all das erkämpft haben, sollte besser gesorgt sein, wenn sie später darben oder in Not geraten. –
Seit Sommer 1867 war ich nimmer im Peterstal gewesen, und da von hier aus eine bequeme Straße durch den Wildschapbach über den Freiersberg ins Renchtal geht, ließ ich mich heute nach Tisch vom Ochsenwirt dahin führen.
Das felsige Waldtal des Wildschapbachs liegt kaum vier Stunden oberhalb Hasle, und doch kam ich heute zum erstenmal in dasselbe.
In ihm befindet sich der Reichtum der Schapbacher Erzbauern, ihre Waldungen. Überall, zu beiden Seiten des rauschenden Waldbaches sind üppige Matten und über ihnen stattliche Tannenwälder – auf zahllosen Felsbergen und in wildromantischen Schluchten.
Ich staunte, noch so schöne Holzbestände im Privatbesitz zu sehen, trotzdem die Schapbacher Buren täglich vom frühen Morgen bis zum späten Abend Wagen an Wagen, mit Tannenbäumen beladen, das Wolftal hinabführen.
Das Heidentum hatte manches vor unserer Zeit voraus, und zu den Dingen, in welchen es uns über war, gehörte auch der Schutz der Wälder. Wie wunderbar sinnig wußte es diesen Schutz ins Leben einzuführen. Es sagte dem Volke, in den Wäldern und Hainen wohnten die Götter. Es heiligte so die Forste, und ihre Verwüstung galt als ein Frevel gegen die Religion.
Und die Quellen, deren Bewahrer die Wälder sind, wurden ebenfalls geheiligt durch göttliche Wesen, und die Menschen wandelten deshalb mit Ehrfurcht vorüber an Wald, Hain und Quelle.
So stunden die Träger der Gesundheit und des Wohlstandes, Wald und Wasser, unter dem direkten Schutz der Götter, die in den Wäldern wohnten und segneten.
War das nicht sinn- und poesievoll, herz- und gemüterhebend?
Heutzutag sind die Wälder nur noch ein Objekt des Gelderwerbs. Was sind sie wert, welche Holzsorte verspricht am schnellsten einen klingenden Ertrag? – Das sind die Fragen, unter denen die Menschen unserer Tage die Wälder ansehen und behandeln. –
Oben auf der Höhe des Freiersbergs, der Wasserscheide zwischen Rench und Wolf, trafen wir heute noch zweierlei Schnee, neuen und alten. Und der Himmel sah so trüb drein, und die Temperatur war so tief, daß man jeden Augenblick neuen Schneefall zu befürchten hatte.
Auf der Seite des Renchtals hat der Freiersberg noch herrliche Buchenwälder, die mit ihrem frischen Grün mein Herz erfreuten. Was gibt es Fröhlicheres als einen Buchenwald im Frühjahr, und was Elegischeres als einen solchen im Herbst?
Im Frühjahr machen die Buchen rings um sich lichten, smaragdnen Schein, und im Herbst vergolden sie mit ihren sterbenden Blättern Berg und Tal.
Aber diese Poesie schwindet auf dem Schwarzwald mehr und mehr; denn die neuzeitige, herz- und gemütslose Forstwirtschaft lehrt: »Fort mit den Buchen! Sie tragen zu wenig. Fichten und Tannen her! Die geben bald Nutzholz.«
Schon in diesem gang und gäbe gewordenen Wörtlein Nutzholz liegt die ganze geldgierige Rohheit unserer Zeit den Wäldern gegenüber. –
Ein alter Buchenwald gleicht einem großen, hellen Saal mit Marmorsäulen, deren Kapitäle Laubkronen bilden. Und in einem solchen Gottessaal waren heute am Freiersberg Bauern aus dem Renchtal lustig an der Arbeit; die einen schlugen Holz, die andern verluden es. Weithin sah man ihre Gruppen unter den lichten Bäumen.
Es ging so steil bergab, daß wir Schritt fahren mußten. Am Wege trafen wir einen Straßenwart, ein altes Männlein, das die heute bodenlos schlechte Fahrbahn zu verbessern suchte.
Er grüßte mich so freundlich und so freudig, daß ich auf den Gedanken kam, der Mann sähe in mir einen alten Bekannten. Wir hielten an, und ich erfuhr, daß der Alte mich anno 74 einmal draußen im Renchtal »im Finken« gesehen und gehört habe als Reichstagskandidaten.
Trotz der 23 Jahre, die seitdem verflossen, hatte er mich wiedererkannt und meinte, »ich sei zwar älter, aber vollkommener (dicker) geworden.«

Als wir zu den ersten Häusern von Freiersbach kamen, trafen wir auf einen Bauern, den der Ochsenwirt als den Hofer-Peter kannte und nannte. Der rief meinem Kutscher zu: »So bringet Ihr de Bure-Vater au wieder amol ins Renchtal!« Dann reichte er mir die Hand und gestand ebenfalls, mich anno 74 gesehen zu haben und bis heute nie mehr.
Daß diese einfachen Leute nach so vielen Jahren und trotz flüchtigen Sehens mich noch erkannten, freute mich aufrichtig. Ich glaube aber, daß mein großer Hut die meiste Schuld trägt an diesem Wiedererkennen nach so langer Zeit. –
An Sägmühlen und Fabriken vorbei, die Holz und Harz verarbeiten, gelangten wir nach dem Badeort Peterstal, der mir völlig fremd vorkam, als wär' ich noch nie dagewesen. Mein Gedächtnis zeigte sich nicht so getreu, wie das der zwei Männer aus dem Volke.
Oder hat sich der Ort so verändert? Mir schien alles Dorfmäßige geschwunden und ein Städtle an Stelle des Dorfes getreten zu sein, das ich vor dreißig Jahren acht Tage lang bewohnte.
Eines aber freute mich, daß die Leute noch die alte Volkstracht in Ehren halten, wie denn das ganze Renchtal in dieser Beziehung alle Schwarzwald-Täler übertrifft; denn auch die Männer sind hier noch der Tracht ihrer Väter getreu.
Ich machte einen Gang durch das Badstädtle; aber alles war noch öde, viele Häuser geschlossen und noch kein Badegast im Ort; wie denn diese kleineren Mineralbäder im Schwarzwald riesig abgenommen haben in den letzten Jahrzehnten.
Vor dreißig Jahren verkehrten im Bad Peterstal noch Kaiserinnen und Königinnen; heute sind selbst in der Hochsaison gewöhnliche Sterbliche nur in beschränkter Anzahl vorhanden.
Die Luftkuren sind schuld an diesem Niedergang der Mineralbäder. Alles zieht in die Höhe, um in der Luft zu baden. –
Ich war nicht zwei Stunden in Peterstal, und nach kurzer Rast um des Pferdes willen ging's wieder bergauf dem Schappe zu. Die Bauern waren aus dem herrlichen Buchenwald verschwunden; aber die Vögel sangen trotz des düstern, kalten Wetters überall ihr Abendlied.
Die guten Waldvögel sind eben nicht so gleich mißmutig und verstimmt, wie wir Menschen bei schlechtem Wetter; drum singen sie auch bei solchem. Uns Herren der Schöpfung vergeht der Humor am allerersten, wenn der Schöpfer nicht alles nach unsern Wünschen einrichtet. –
Als wir uns spät am Abend wieder Schapbach näherten, hörte ich zu meiner Freude aus den Höfen der Bauern das laute Gebet der Bewohner zum offenen Fenster hinaus.
Diese fromme, schöne Sitte, die auf dem Land in meiner Knabenzeit im mittlern Kinzigtal überall herrschte, dort aber jetzt ziemlich abgegangen ist, trifft man bei den Schapbachern noch allgemein. Die Eisenbahn fehlt im Wolftal; die liebe Kultur zieht deshalb langsamer ein, und die alten Sitten und Gebräuche sind drum noch nicht so in alleweg gefährdet.
Um dieser gottgefälligen und poesievollen Übung willen verzeihe ich den Schapbacher Buren ihre Falzziegel und den Bürinnen ihre Kunstherde und sage: »Respekt vor dieser Burschaft!« – Wo der Mensch noch betet, laut und öffentlich betet und seine Arbeit und sich und sein Haus nach des Tages Mühen unter den Segen Gottes und unter die Fürbitte seiner Heiligen stellt – da ist noch echter christlicher Sinn und christlicher Glaube. –
Am 16. Mai.
Der Ochsenwirt führte mich heute zeitig zur Kirche; denn es ist Sonntag, und ich will die heilige Messe lesen. Während ich am Altare stund, rückte, da die Zeit des Hauptgottesdienstes nicht mehr fern war, die Jugend der ausgedehnten Pfarrei an.
Weil die Kirche zu klein ist für die große Gemeinde, scheint der Platz der Knaben rechts und links vom Hochaltar zu sein. Die vordersten knieten alsbald auf die untersten Stufen des Altars. Sie schauten, die Hände gefaltet, mit ihren unschuldigen Augen wie Waldvögelein an dem langen, fremden Priester hinauf und kamen mir vor wie kleine Bauernengel, die das Heiligtum Gottes anbetend umknien. –
Als ich die Kirche verließ, stunden am Hügel hin, auf dem das Gotteshaus thront, viele Mannsvölker jeden Alters, die auf das »Zusammenläuten« warteten, um dann beim Gottesdienst anzutreten.
Ich war verblüfft, so wenige von ihnen in Volkstracht zu sehen, und die sie trugen, waren meist alte Männer oder junge Burschen unter zwanzig Jahren.
Wie man mir sagte, ist die allgemeine Wehrpflicht und das Kasernenleben schuld an dieser bedauerlichen Tatsache. Ehedem kauften sich die vermöglicheren Bauernsöhne los vom Militär, blieben daheim und der alten Tracht getreu. Heute kommen alle, reich und arm, in die Kaserne und in die Städte und kehren mit Modekleidern heim.
Sie mußten ja während ihrer Dienstzeit so viel von »dummen Bauerjungen« hören, daß sie wenigstens äußerlich den »Bauer« ablegen wollen und sich in Stadtkleider stecken.
Von einem Preußen, der in Baden lebt, hörte ich vor nicht langer Zeit, daß er mit Vorliebe von den dummen Bauern und von der Dummheit der badischen Bevölkerung spricht, auch von »Schlappmicheln«, die zwischen Heidelberg und Basel wohnen.
Die Verdummung des badischen Volkes schreibt der preußische Bruder dem vielen – Weingenuß zu. Daß die Preußen uns badischen Schlappmicheln in alleweg über sind, wird doch nach dieser geistreichen Logik nicht von dem vielen – Schnapsgenuß herrühren, dem unsere nordischen Brüder huldigen?
Richtig dürfte sein, daß zwischen Basel und Heidelberg Schlappmichel wohnen; denn wäre dies nicht der Fall, so würde der genannte Preuße nie in die Lage gekommen sein, vor »dummen badischen Bauernjungen« seine liebenswürdigen Redensarten loszulassen.
Und bei solchen Sprüchen wundern sich die Herren Preußen noch darüber, daß sie in Süddeutschland nicht beliebt sind. Ich aber frage, was würde z. B. einem badischen Offizier geschehen, der ähnliche Reden vor einer Kompagnie Soldaten preußischer Abkunft sich erlauben wollte? –
Heute nachmittag lernte ich einen Nachbar kennen, dessen Hof meinen Fenstern gegenüber jenseits der Wolf im Holdersbach liegt. Es ist dies der alte Hermenazisbur, Daniel Armbruster, ein rüstiger Achtziger, der jeden Sonntag nachmittag mit seiner stattlichen Frau zum Ochsenwirt herüberkommt, beide in echtester Volkstracht.
Der Hermenazisbur zeigt schon in seinem Vornamen Daniel, daß er aus guten, alten Tagen herkommt. Heutzutag sähe es ein Bauer selbst im Kinzig- und Wolftal als eine Ehrenkränkung an, wenn man ihm zumuten wollte, seinen Sprößling nach einem der erhabensten Diener Gottes und einem der glänzendsten Propheten des alten Bundes – Daniel zu nennen.
In unsern Kulturtagen müssen die Buben auch bei den Bauern Erwin, Alfons, Alfred und Kamill heißen, weil das »vornehme« Namen sind, Daniel, Andres, Jörg aber »gemeine«. Angesichts dieser Anschauung möchte ich mit dem obigen Preußen auch von dummen Bauern reden.
Ein russisches Sprichwort sagt: »Der Deutsche hat den Affen erfunden.« Es mag was Wahres daran sein; denn in der Nachäffung leisten wir Erstaunliches. –
Die Hermenazisbüre ist aus dem Seebach im obern Wolftal und war, wie ich heute erfuhr, noch eine Schülerin »vons Hutmachers Xaveri von Hasle«, der von 1842-46 im »Säbe« Lehrer war und den ich gar wohl kannte; denn sein Geburtshaus grenzte an das meinige.
Der Xaveri, seines Geschlechtes ein Kilgus, war, wie jeder normale Haslacher, Demokrat, und sein Herz glühte anno 48 für Volksfreiheit. Er war dazu noch ein herrlicher Sänger und sang den Buren im Wolftal so begeistert von Liebe und von Freiheit, daß sie ihn ehrten wie einen Propheten.
Drum sah ich ihn auch, wie er im Frühjahr 1848 beim Franzosenlärm mit den Buren aus dem Säbe in Haste einzog als Hauptmann und Führer von Sensenmännern.
Während der darauffolgenden Revolution blieb der Xaveri, ein blasser, rotbärtiger Mann, Gewehr bei Fuß stehen; aber er sprach und sang von Freiheit und von Manneswürde.
Und wegen dieses unschuldigen Singens und Sagens wurde er im Herbst 1849 seinen Seebachern genommen und in ein elendes Dorf bei Ettlingen, nach Etzenroth, versetzt. Hier starb er bald aus Gram, wie mir die Hermenazisbüre heute erzählte, und dort haben sie ihn begraben in jungen Jahren.
Die alten Buren und Bürinnen aber reden jetzt noch mit Begeisterung von dem Lehrer Kilgus.
Und ich selbst ward stolz darauf heute, da ich den Daniel und seine Büre so begeistert von einem Haslacher reden hörte, stolz darauf, auch von Hasle und ein Nachbarsbub vons Hutmachers Xaveri, dem Sänger und Märtyrer der Freiheit, zu sein.
Der Daniel hat noch mit dem Xaveri gesungen in der Schapbacher Kirche, wohin auch die Seebacher eingepfarrt sind. Und der Hermenazisbur ist heute noch beim Kirchenchor, dem er schon über fünfzig Jahre lang ununterbrochen angehört. Es war ihm auch nie zu viel, in diesen langen Jahren jeden Samstag abend den Weg zu machen vom Holdersbach ins Dorf hinauf zu den Gesangproben.
Jetzt, so meinte er, habe er aber bald genug, nicht Alters und des Weges halber, sondern ob der lateinischen Messen, die seit einigen Jahren gesungen werden müßten. Da sei noch zu des Kilgus Zeiten ein anderer Gesang gewesen, der Gott und Menschen erbaut habe; von »dem latinischen Gesing« hätten aber die Menschen gar nichts mehr.
Ich bin, offen gestanden, der letzte, welcher dem Hermenazisbur es verübelt, wenn er in seinen alten Tagen nicht mehr »latinisch« singen will. –
Gegen Abend machte die Sonne den ersten schüchternen Versuch, seitdem ich hier bin, die Schneewolken zu verjagen und einige volle Strahlen auf die kalte Erde zu senden. Mein freundlicher Gastwirt schlug deshalb vor, mich mit seinem Wagen noch auf den »Segenberg« zu führen, der unfern von seinem Haus gegen Süden sich erhebt.
Ich war gleich dabei, und eine Stunde später stund ich auf dem Segenberg, so genannt, weil am Himmelfahrtstag die Schapbacher da heraufwallen in Prozession und der Pfarrer den Wettersegen gibt.

Fürwahr, es kann auf – keiner schöneren Stelle des Schwarzwalds der Segen des Allmächtigen besser herabgefleht werden als auf dem Himmelfahrtsberg der Schapbacher!
Es ist zwar fast nur Wald und wieder Wald und nochmals Wald, was wir von ihm herab sehen; aber dieses Tannenmeer ist auf so viele Berge und Gipfel, Täler und Schluchten verteilt, daß einem das Herz aufgeht und man hellauf singen möchte:
Wer hat dich, du schöner Wald,
Aufgebaut so hoch da droben?
Wohl den Meister will ich loben.
So lang noch mein' Stimm' erschallt.
Und wenn auch nicht, wie in diesem Liede Eichendorffs, auf dem Segenberg »einsam Rehe grasen«, so werdet doch der Hirt des Buren in der »Bäch« heute hier seine Tiere. Der mir so unsagbar sympathische Klang ihrer Glocken tönt wie ein herrlich Abendläuten in meine Seele.
In ihr aber rief's mit dem genannten Dichter: »Schirm dich Gott, du schöner Wald!«
Und dies Gebet ist nicht unnötig heutzutage, wo es viele Buren gibt, die ihren Wald Geldes halber gern verwüsteten und klagen, daß sie daran gehindert werden vom Staat. Wenn ich aber den »Racker Staat« einmal lobe, so geschieht's wegen seines Schutzes, den er dem Wald angedeihen läßt. Ich wollt' nur, er tat hierin noch mehr. –
Schöner als heute kann's am Morgen des Himmelfahrtstages nicht sein auf dem Segenberg an der Wolf.
Die Sonne war im Untergehen. Sie hatte gegen Abend die Wolken ganz verjagt dem Kniebis zu, mußte aber jetzt selber weichen in dem Drehen des Weltrads.
Aber sie scheint die gleiche Freude zu haben wie ich an den Tannenbergen der Schapbacher; denn sie küßte auf ihrem Rückzug immer wieder bald da, bald dort die Wipfel mit ihren goldenen Strahlen, und ihr Licht zögerte und zitterte wie voll Abschieds-Wehmut in den gewaltigen Tannenwänden gen St. Roman hin.
Und auch den Menschen, die in zerstreuten Hütten an den hohen Halden unter den waldigen Kuppen wohnen, sagte sie liebend gute Nacht. Ihr Äther glänzte wie Feuer aus den kleinen Fenstern, auf die ihre letzten Strahlen fielen und hinter denen gläubige Menschenkinder ihr Abendgebet verrichteten und für die Seelen ihrer Toten um das ewige Licht flehten.
Nie nämlich vergißt das Landvolk in diesen Bergen, beim letzten Gebet des Tages derer zu gedenken, die sich einst gefreut hier im Tal und die nun eingegangen sind in die Nacht des Todes. –
Zum Schlusse des heutigen Abends machte mir meine Kammerjungfer, die Monika, noch eine Freude. Sie ging, während ich am Fenster in meinem Häuschen saß, auf der Straße auf und ab mit einem Kinde ihres Dienstherrn und lehrte dasselbe das Vaterunser beten. Unermüdlich sagte sie dem Kleinen die heiligen Worte vor, um sie dann von ihm nachstammeln zu lassen.
Mir wäre es eine Qual, solch einem Kind unzählige Male etwas vorzusagen. Mich ärgert es schon, wenn mich jemand das erstemal nicht versteht und ich etwas zweimal sagen muß.
Drum ist die braune Monika mit ihren runden Kinderaugen und ihrem frommen Sinn zweifellos auch ein Gott viel wohlgefälligeres Geschöpf als ich, trotzdem sie nur Schweine, Kälber und Kurgäste pflegt. –
Am 17. Mai.
Heute ist der Tag, den ich mit dem Moosbur ausgemacht hatte zur Fahrt nach dem Schwarzenbruch. Schon vor neun Uhr kam der Bur angefahren mit seinem feurigen Gelbschimmel, und talab gings eine Strecke und dann bergauf gen Norden durch den »Dohlenbach«, ein tief zerrissenes Waldtälchen, eingeengt von hohen Berghalden. In seinem untersten Grund rauscht ein Bächlein, das des Hanselesburen Mühle treibt, dessen Hof hoch oben wie ein Bergschloß im Äther des Himmels glänzt.
Zum ersten Male, seitdem ich im Wolftale bin, sehe ich die Morgensonne. Sie wirft ihre Lichter selbst in die Schluchten des Dohlenbachs, verwandelt die Tautropfen aus den unzähligen Haselstauden am Wege hin in blitzende Diamanten und läßt die Vögelein jauchzen, daß es widerhallt von einer Bergwand zur andern.
Unterwegs mußte mir der Moosbur seine Familie vorstellen und erzählen von Weib und Kindern, so daß ich, auf dem Hofe angekommen, alle bereits kannte.
Nach einstündiger Fahrt hatten wir den Schwarzenbruch, eine Hochmulde, die einstens wohl ein Bergsee gewesen, erreicht. In ihrem Herzen liegt der Mooshof, ein Bauernhaus alten, echten Stiles und mit Stroh gedeckt.
Der Moosbur ließ mich aber nicht absteigen bei seiner Residenz, sondern wollte mir zuerst die Herrlichkeit des Schwarzenbruchs zeigen, indem er mich im Kreis auf den Rändern der Mulde hinführte, damit ich nach allen Seiten hin einen Blick tun könnte, hinüber auf die Berge und hinab in die Täler.
Hatte ich gestern auf dem Segenberg ein Waldmeer gesehen im Abendlicht, so sah ich heute ein Meer von tannengrünen Bergspitzen im Schein der Morgensonne.
Hunderte von waldigen Kuppen schauten vom Kinzig- und Harmersbachertale zu mir herauf und zwar so verändert, daß ich keine von ihnen kannte. Mich aber ergriff bei ihrem, ob ihrer Menge majestätischen Anblick ein wahres Hochgefühl, ein Schwarzwälder und inmitten dieser dunkeln Waldfürsten geboren zu sein. Und ich dachte: Mögen die Morgen- und Südländer sich freuen ihrer winzigen Palmenwälder und stolz sein auf sie. Ihre Freude und ihr Stolz müßten klein werden, wenn sie einmal vom Schwarzenbruch aus die Tannenberge des Schwarzwaldes sähen, und sie würden begeistert ausrufen: »Allah ist groß, aber am größten auf dem Schwarzwald!« –
Wo wir auf unserer Rundfahrt an einem Hof oder an einer Taglöhnershütte vorbeikamen, rief der Moosbur die Leute heraus und sagte ihnen freudig: »Des isch der Herr, der uns den Stier auf den Schwarzenbruch gebracht!« Und die guten Leute kamen zu mir heran und schüttelten mir dankend die Hand.
Es gibt nichts Dankbareres auf Erden als das »gemeine Landvolk«. Mit wie wenig könnten die Fürsten dieses getreue Volk glücklich und zufrieden machen; aber wie viel wird an demselben oft gesündigt durch die Beamten der Regenten und des Staates!
Ich las im vergangenen Winter die Erinnerungen eines russischen Geistlichen, der, eine Art Dekan oder Superintendent, dabei war, als in seinem Sprengel die Aufhebung der Leibeigenschaft verkündigt wurde.
Kam die Kommission in ein Dorf, dessen Herr ein Bluthund war, der seine Bauern quälte, und verlas der Pope in der Kirche das Manifest ihrer Befreiung von dem gutsherrlichen Henker, dann riefen die Leute weinend: »Freiheit, Freiheit, gebt uns die Freiheit!«
Wurden aber irgendwo die armen Leibeigenen menschlich behandelt, so waren sie zufrieden und riefen, als man ihnen die Freiheit verkündigte: »Nehme die Freiheit, wer sie will, wir bedürfen ihrer nicht!«
So bescheiden ist das Volk überall, wo man es ruhig sein Feld bebauen läßt, ihm nicht unsinnige Lasten auflegt, nicht durch bureaukratische Maßregeln das Leben verbittert und es nicht durch »Bildung und Aufklärung« um seine alten, guten Sitten und um seinen Glauben bringt.
Es ist aber bei uns die höchste Zeit, den Bauernstand in seiner Eigenart zu wahren, ihm aufzuhelfen, wo und wie immer man kann. Es ist schon viel, sehr viel gesündigt worden an unserem Landvolk in den letzten fünfundzwanzig Jahren, und wenn's so fortgeht, wird auch der urkonservativste Bauer ein Freund der Revolution, der man vielfach von oben herunter die Wege bahnt.
Schon vor einem halben Jahrhundert hat der schwäbische Dichter Weitzmann ein trefflich Mahnwort ausgesprochen, wenn er sagt:
Jez hot der Bur no Tuach am Kittel,
Jez isch zum Helfe no a Stund,
Sonst greift er sel zum letzte Mittel
Und frißt mit euch wie's Fuggers Hund.
Ein Graf Fugger hatte einen Hund, der seinem Herrn täglich das Fleisch in einem Korbe, den er mit den Zähnen trug, heimholte. Er wehrte sich dabei tapfer gegen andere Hunde, die ihm sein Fleisch nehmen wollten. Als diese ihn aber eines Tages zu mächtig angriffen und er sein Fleisch verloren sah, ließ er den Korb fallen und fraß selber mit von dessen Inhalt. –
Auf der höchsten Höhe trafen wir einsam in der Heide ein kaum sechsjähriges, reizendes Bauernbüble mit seinem Schlafsack. Der Kleine gehört einer Ledigen und wird dort drüben im »Hasenhäusle« aufgezogen. Das arme Kind hat zwei Stunden Wegs bis zur Schule durch Regen und Wind, durch Wald und Heide, jäh bergab, steil bergauf, allein, ohne Kameraden und Mitschüler.
Kommt dann solch ein Kind matt und müd in der Schule an, so soll es aufpassen und wird als faul gezüchtigt, wenn ihm die Augen zufallen. Und das alles um der Kultur willen, welche die schlimmste Tyrannin ist.
Wahrlich, so sagte ich mir angesichts des Bübleins, die Wilden sind nicht bloß bessere, sondern auch glücklichere Menschen; sie müssen nicht vom sechsten Lebensjahr an stundenlang über Stock und Stein in die Schule wandern. –
Ich hab' mir schon oft, wenn ich wie gestern und heute in die Herrlichkeit der Natur geschaut habe, den Gedanken gemacht, daß es mit unserem Auge beschaffen ist wie mit jedem anderen Genuß unserer Sinne. Dieser ist in alleweg nur ein vorübergehender, er läßt sich nicht festhalten.
Wenn ich ein Glas Champagner trinke, ist der Augenblick, in welchem der Wein über die Zunge gleitet, der Genuß, und dann ist's fertig mit all der Herrlichkeit.
Und wenn ich auf einem Berge mein Auge weide im Anblick der Natur, so liegt der Genuß in den Momenten des Anschauens und hört auf, sobald das Auge sich abgewendet hat.
Ich wollte mich heute einmal förmlich satt trinken an den Bergen und Wäldern des Kinzig- und Wolftals; aber es gelang mir nicht, die Bilder und die innere Freude festzuhalten, nachdem unsere Fahrt vollendet war.
So ist alles unvollkommen hienieden, und selbst die reinsten und edelsten Freuden und Genüsse sind flüchtig. –
Bei des Moosburen Hof abgestiegen, ging ich zuerst ums Haus herum, um an seiner alten, schönen Bauart mich zu erfreuen.
Daß der Moosbur über seiner Residenz ein großes Feldkreuz aufgestellt hat, zeigte mir, daß die alte, schöne Volkssitte des Schwarzwalds, das Sieges- und Leidenszeichen des Weltheilandes im Freien aufzurichten, auch auf dem Schwarzenbruch herrscht.
Aber das hab' ich doch bemerkt in den wenigen Tagen, die ich im Wolftale zugebracht, daß man hier nicht so viele Kreuze am Wege sieht wie im mittleren Kinzigtal oder gar im Elztal.
Die ganze Fülle religiöser Poesie, wie sie im gläubigen Landvolk so vielfach sich findet, liegt meines Erachtens in diesen Kreuzen, die an Wegen und Pfaden, auf den Bergen und in den Tälern des Schwarzwaldes so häufig uns begegnen, um dem leidenden Menschenkind auf seinem mühsamen Lebensweg den rechten Trost zu geben.
Wie sehr wird aber diese Poesie verkannt, nicht bloß von Andersgläubigen, sondern auch von Katholiken! Drum hat es mich doppelt gefreut, als mir im vergangenen Winter ein Leser meiner Bauernbücher aus der Schweiz ein Gedicht sandte, das ein Protestant, Rudolf Hagenbach, Professor der Theologie in Basel († 1874), zu Ehren dieser Feldkreuze verfaßt hat. Es ist so schön, daß ich es hier wiedergeben will:
Mich soll es freuen jedesmal.
Tritt mir auf meinen Wegen
Auf Bergeshöh', in Feld, im Tal
Des Kreuzes Bild entgegen.
Mir soll es heben jedesmal
Den Blick zum Vater droben,
Der uns das Kreuz nach seiner Wahl
In Weg und Steg verwoben.
Wo Kreuze steh'n, da flammt das Licht,
Da läßt sich Hoffnung fassen;
Wo Kreuze steh'n, da sind wir nicht
Vergessen, nicht verlassen.
Wo Kreuze steh'n, ist auch nicht weit
Der Brüder Wohl und Wehe;
Ein Kreuz auch in der Einsamkeit
Verkündet Gottes Nähe.
Wo Kreuze sind, wo Kreuze steh'n,
Da kann
mein Fuß auch stehen
Und nach dem Stern, noch ungeseh'n.
Durch Nacht und Dunkel gehen.
Das Kreuz ist's, was uns aufrecht hält,
Wo Sturm und Wetter hausen;
Des Kreuzes Stamm, wo der nicht fällt,
Mag's durch die Berge brausen.
Nur Eines bitt' ich, Herr, von dir
Nach meinem schwachen Dichten;
Willst du am Lebensweg auch mir
Ein stilles Kreuz errichten –
Stell's mir ins freie, grüne Feld,
Umstrahlt vom Sonnenlichte,
Auf Bergeshöh', wo dir's gefällt.
Nur daß mich's aufrecht richte!
Umwallt von deines Himmels Blau,
Von reinen Lebenslüften,
Getränkt von deinem süßen Tau,
Wird's Balsam von sich düften.
Von ihm geht aus der Hoffnungsstrahl,
Daß wir das Ziel erreichen.
Drum sei gegrüßt auf Berg und Tal,
Holdseliges Siegeszeichen!
Nach diesen herrlichen Worten des protestantischen Sängers brauche ich kein Wort der Verteidigung mehr zu sagen für die Feldkreuze, die der katholische Bauer des Schwarzwaldes in richtigem Gefühl in Feld und Wald errichtet, und die ihm, wie ein »ewiges Licht«, Tag und Nacht in Sturm und Graus zur Seite stehen. –
In der »Brennkuche«, in welcher der Moosbur seine wilden Kirschen und Heidelbeeren in Lebenselixier verwandelt, saß heute der Besenmacher, der des Buren Birkenreis zu Besen verarbeitete.
Für tausend Stück bekommt er vom Bur 30 Mark, und der Bur verkauft das Tausend für 65 Mark nach Straßburg.
Der Besenbinder bekam meine Sympathie alsbald wegen seines schönen Vornamens. Er heißt nämlich Desiderius, ein Wort, in dem mehr Kraft und Mannheit liegt als in einem Dutzend der neumodischen Gigerlnamen.
Der Moosbur schickt alljährlich einige Tausend Birken-Besen von der Hand des Desider nach Straßburg, und es kam mir der Gedanke, wie der Mensch so viele Geschöpfe entwürdigt und ihnen ein schlimmes Los bereitet.

Diese Birkenreiser, die auf den Höhen des Schwarzwalds im Äther sich baden, auf denen die Vöglein ihre schönsten Lieder singen, denen die Sterne in hellen Nächten Gesellschaft leisten und die am Morgen den ersten Tau des Himmels trinken: sie erniedrigt der Mensch zu Besen und läßt in Kot und Staub sie untergehen.
Was könnten sie in kurzer Zeit erzählen, diese Birkenkinder vom Schwarzenbruch, aus dem Menschenleben, in das sie kommen, aus den Gassen, die sie fegen, aus den Küchen, in denen sie stehen und von den Wibervölkern, die sich ihrer bedienen!
Im Ernst gesprochen, die Erinnerungen eines alten Kehrbesens wäre noch lange nicht das Dümmste, so man schreiben könnte. Ich versuch's vielleicht noch. Es ist indes geschehen in dem Büchlein: »Aus dem Leben eines Unglücklichen«. –
Im Libdingstüble, klein und hell, hatte die Moosbüre mir ein Frühstück zugerichtet auf »gebild'ter Leinwand«: Speck und Schnaps und Schwarzbrot, und ihre Meidle, soweit sie noch ledig und daheim sind, die Creszenz und die Zezile, kamen, sich vorzustellen.
Draußen in der Stube sammelten sich indes die Völker zum frühen Mittagessen. Unter ihnen fiel mir ein Kretin auf, ein junger Bursche mit unheimlichem Blick. Er gehört blutarmen Eltern drunten im Tal, und der Moosbur hat ihn von der Gemeinde »in Pacht«, d. h. er bekommt jährlich eine kleine Summe für Kost und Lager des Armen, der ihm das Vieh hütet.
Er heißt Kilian und soll, gereizt, sehr bösartig sein und selbst zum Messer greifen.
Es gibt Leute, die an eine Reinkarnation glauben, d. h. annehmen, daß die Seelen Verstorbener wieder erscheinen in lebendigen Leibern. Gewisse Kretinen scheinen diesem Glauben Nahrung zu geben, denn man ist oft versucht, in ihnen einen fremden Geist zu wähnen. Obwohl wegen ihrer geistigen Defekte von jedem äußeren Einfluß unberührt, zeigen sie oft einen so bösartigen, unsittlichen und wüsten Charakter, daß man glauben möchte, sie seien von ähnlichen Geistern besessen. –
Bei der Rückfahrt erfuhr ich im Gespräch mit dem Moosbur, daß im Wolftal die kleinen, selbständigen Gütler, welche im mittleren Kinzigtal Taglöhner heißen, Burger genannt werden im Gegensatz zu den Bauern, d. i. den Hofbesitzern.
Mir gefiel diese Unterscheidung. Sie zeigt einen mir sympathischen Bauernstolz. Wie man in der Welt draußen ehedem Bürger unterschied und Adelige, unter deren Burgen die kleinen Leute Schutz suchten und fanden, so rechnet sich der Bur im Wolftal zum Adel gegenüber dem kleinen, unbedeutenden Taglöhnertum, das im Schatten seiner Höfe sitzt.
Das Wort »Burger« bezeichnet ihm demnach einen abhängigen Mann; drum gibt er diesen Namen dem Taglöhner. –
Wo das Dohlenbächle in die Wolf mündet, liegt der Dohlenbacherhof, und als wir wieder in seine Nähe kamen, stund der »alte Dohlenbacher« auf der Brücke, die über den Wolfbach zum Hofe führt. Er ist der Schwiegervater des Moosburen, und wir begrüßen ihn, den Vierundachtzigjährigen, der im vorigen Jahre seine diamantene Hochzeit feierte.
Bei derselben erschienen 106 Enkelkinder; denn der Dohlenbacher hat zehn Töchter, alle noch am Leben und alle Bürinnen.
Der greise Mann schaut so heiter und zuversichtlich in die Welt, als ob er erst dreißig Jahre alt wäre, und wandert noch jeden Sonntag eine gute Wegstunde hinab zur Dorfkirche.
Ich beneidete den Alten um seine Lebensfreudigkeit, sagte mir aber gleich: »Wärst du im Leben schlichter, einfacher Bur am Dohlenbach gewesen, hättest du wohl auch die gleiche Heiterkeit.« –
Der Moosbur aß mit mir zu Mittag und fuhr dann wieder bergauf; ich aber war glücklich, einmal vom Schwarzenbruch aus die Berge der Heimat gesehen zu haben. –
Diesen Nachmittag ward mir noch ein anderer Genuß zuteil. Der Ochsenwirt hatte mir vor einigen Tagen gesagt, der Bühl-Mathis in der Sulz sei ein Original und den wolle er mir einmal bestellen.
Heute nun kam richtig der Mathis, ein großer, hagerer, alter Bauersmann mit einem im nördlichen Schwarzwald höchst seltenen kurzen Schnurrbart. Er trug die Volkstracht und auf dem Arm, in ein Tuch gewickelt, ein weiteres Kleidungsstück, das er mir alsbald enthüllte und als seinen Hochzeitsrock vorstellte, den er nur an hohen Feiertagen anziehe.
Der Mathis hat Hochzeit gehabt anno 50. Sein Rock ist also heute netto 50 Jahre alt, aber noch wie neu, das rote Futter leuchtet aus dem schwarzen Tuch wie Karfunkelstein.
Wir sitzen beisammen in meinem Stüble, und der Mathis erzählt. Er ist der Sohn des Vizebure im Schappe; der Vater hatte einen großen Hof, aber 14 lebendige Kinder, von denen der Mathis Numero 13 war.
Für die vielen Kinder hielt der Vizebur einen eigenen Lehrer, den Stelzemichel, einen Korbmacher seines Zeichens. Er wohnte in einem kleinen Häusle neben dem Hof, wo er Körbe und Schieden (Zainen) flocht und die Kinder lehrte. In freien Stunden »studierte er in Büchern«. Der Mathisle war sein letzter Schüler. Ein Siebziger, starb der Stelzemichel im Amte.
Trotzdem der Mathis das dreizehnte Kind seiner Eltern war, wurde aus ihm ein »stolzer Rekrut«, aus diesem ein Dragoner im ersten badischen Reiter-Regiment unter Oberst Hinkeldey, aus dem Dragoner aber »der erste Reiter« bei der Schwadron Seldeneck.
»Kein Offizier,« so spricht heute noch der Mathis in seinem 77. Lebensjahr mit Stolz, »konnte mit mir wechseln in der Postur und im Reiten.«
Ein rechter Soldat muß auch Pulver gerochen haben, und das hat der Mathis. Er war dabei, als 1848 die Freischärler bei Kandern gegen die Bundestruppen fochten. Er sah den General Gagern fallen, worauf des Mathisen Oberst, der Hinkeldey, »das Geschäft übernimmt und über die Freischärler herfährt.«
Ebenso das Gefecht bei Staufen, wo »es auch geraucht«, hat der stolze Dragoner aus dem Schappe mitgemacht. Und anno 49 mußte der Mathis, weil er Einsteher war, wieder mit. Er lag in Freiburg beim Erzbischof von Vicari im Quartier, wo unser Schapbacher die erste Rolle spielte; denn »wenn der Herr Erzbischof einen Anstand hatte«, berief er jeweils nur den Mathis.

Dieser bleibt seinem Fahneneid getreu; er macht nit mit, als die Soldaten »umfallen«, und zieht dem Schappe zu. Hier wird er von Freiheitsmännern verhaftet und gen Freiburg transportiert. Unterwegs brennt er aber durch und kehrt wieder heim. Die Preußen machen dem Mathis Luft vor neuer Verhaftung.
Bald nachdem die Revolution niedergeworfen und wieder Friede im Land ist, erwirbt der Mathis das wunderbar gelegene Taglöhnergütle auf dem Bühl in der Sulz und heiratet eine Tochter vom Schlangenhof. Sie gebiert ihm acht Kinder, und dann stirbt sie, um das Jahr 1860.
Jetzt wird aus dem tapfern Dragoner ein Friedensheld. Er bestellt allein sein Gütle, kocht und wascht und pflegt seine acht kleinen Kinder, bis er wieder ein ander Weib findet. Zehn Jahre später stirbt ihm auch das zweite Weib und hinterläßt ihm abermals sieben Sprößlinge.
Seine Tapferkeit wächst. Er heiratet nimmer und sorgt allein für seine Kinder, von denen vierzehn am Leben bleiben und von ihm großgezogen werden.
Jede Stunde, die ihm übrig blieb von der Sorge für seine Haushaltung und seine kleine Landwirtschaft, bringt der Mathis entweder im Wald zu als Holzmacher oder auf dem Wildschapbach und auf der Wolf als Flößer.
Flößen war sein Hauptvergnügen, und das erforderte im Wildschapbach einen tapferen Mann. Der Mathis bedauert deshalb mit mir, daß dies gefahr- und poesievolle Gewerbe ein Ende genommen hat.
Er war dabei, als sie das letzte Floß durch die Wolf hinab in die Kinzig führten. Auf dem Floß hatten sie einen grünen Tannenbaum errichtet und eine Tafel an denselben geheftet, auf welcher der folgende sinnige Vers stand:
Jetzt flößen wir zum letztenmal
Durch dieses schöne Wolfachtal;
Was lange uns're Freude war.
Ist wohl dahin auf immerdar.
So fühlt es auch das Volk, wenn ein Stück Poesie zu Grabe getragen wird. Andere Leute, Kulturhuber, jubeln, wenn Altes fällt und Neumodisches entsteht; das gemeine Volk aber trauert, weil seine Seele ahnt, daß nichts Besseres nachkommt. Was hat, um beim Flößen zu bleiben, die Eisenbahn gebracht? Sie hat den armen Flößern im Schwarzwald guten Verdienst und manche Freude genommen und der Waldverwüstung Vorschub geleistet.
Ich habe vor kurzem ein »Flößerlied« zur Hand bekommen, das ein Kinzigtäler Volks- und Naturdichter, der Buchbinder und Ratschreiber Eyth in Schiltach († 1889), zu Ehren der Kinzigtäler Flößer im Dialekt des oberen Kinzigtales niedergeschrieben hat und zwar so vortrefflich, daß ich einige Strophen daraus hier wiedergebe:
Mer (man) trifft halt net grad überall
So Flaizer wia im Kinzichtal.
Drom hot mer au um veil, veil Gold
Nô (nach) Ungra eis (uns) und Östreich g'holt.
Und nau (nur) bei eis, es isch verruckt,
Wurd d' Flaizerei ganz unterdrückt.
Fabrike hoaßt's (heißt's) und d'Eisebâh,
Dia stehnt d'r Welt veil besser â.
Fabrike! Jo, er heut äm (habt ihm) g'steckt!
Wer nau en a Fabrik nei schmeckt,
Der sieht schau aus wia Unschlichliacht,
Net z'schwäzet dervau (davon), wianer (wie er) riacht.
Sie schleichet äll' wia Goaschter rum.
Heut g'schwollne Fiaß, send schiaf und krumm;
Se kennet's net verschnaufe schiar,
Und Knöchle hent se wia Papier.
Do b'sehnet eisre Knocha â!
Derf Stahl und Eise nebe drâ?
Und hot a Blosbalg so veil Wend,
Wia eisre Lungeflügel hent?
Das macht, miar (wir) müaßet Tag und Nacht
Und send drum au net gar so g'schlacht,
Wias Weibervolk und b'Herreleit
Und wianes Fabrikler geit.
Miar müaßet naus in Sturm und Schnai,
's sieht koaner oft da andere maih;
Miar müaßet naus, wenn Stoa und Boa
Schau gfrora isch am Bach und Roa (Rein).
Miar müaßet naus bei d'r graischte Hitz,
Miar müaßet naus, wenn Blitz uff Blitz
Grad nebetis en Bach nei fährt
Und eis 's Vaterunser bete lehrt.
… Wo koar gôht nâ,
Der Flaizer ruckt sei Lebe drâ.
Und send mer (wir) au im ganze Land
Verschria, mer brüahlet, sei a Schand –
Soll au en anderer uff de Bach
Und soll verrichta eiser Sach,
Er Word grad brüahla so wia miar,
Hoaßt des, wenn er's ka wia miar.
Was moanter (meint ihr), es sei a G'spaß,
Wenn oar (einer) bis uff d' Haut nei naß
De ganze Tag em Bach dren stoht,
Wenn eisigkalt der Sturmwind goht –
Und 's Wasser schaußet, tuat und macht,
Daß 's ganz Flauz nau so zemme kracht,
Wie wenn's grab abenanber gäng
Und nau no amme Fabe häng; …
Miar leugnet's net und g'stanbet's ei,
Jo, so a Fahrt ins Land isch fei;
Mer isch dô z'saget au a Mensch,
Dahoam goht älleweil älles wensch.
Au kriagt mer bo veil besser Sach
Als untram oagne Dach und Fach
Und hört und sieht so ällerhanb,
Was oam (einem) do obe unbekannt.
Vau Wolfe ka mer net veil saa (sage);
Doch kommt mer nau uff Hasle na.
Uff Steine, Bibre, Gengabach
Und dann uff Offeburg ällsg'mach. –
Aijoh! Do isch an anber Gschäft
Als z' Schilta in däam alte Heft;
Do sieht mer nents (nichts) als Lustbarkeit
Und lauter feine, propre Leit …
Ich möchte dem Buchbinder Eyth jetzt noch unter dem Boden die Hand drücken, daß er die alten Kinzigtäler Flößer und das Fabrikwesen so trefflich im Liede gezeichnet hat. Drum soll dieses Lied auch nicht ganz ungedruckt untergehen. –
Heute sind des Mathisen Kinder zerstreut im ganzen Tal als Knechte und Mägde und Holzmacher. Sein Gütle hat er samt den Schulden an einen andern verkaufen müssen, aber noch die Herberge darin sich vorbehalten bis an sein Ende.
Seit Jahren lebt er allein, taglöhnert, kocht sich täglich zwei Suppen, wenn er daheim ist, und »den Schnaps trinkt er ou gern.« Durch Rindenschälen und Holzmachen verdient er heute noch sein täglich Brot und seinen Schnaps.
Er ist dabei seines Lebens und Schicksals baß zufrieden. Mit keinem Wort klagt er über die Fäden, so ihm die Schicksalsgöttin gesponnen. Er schaut aus wie ein Mann, der stets in vollster Seelenruhe alles genommen hat, wie's gekommen ist.
Und das ist die wahrste und beste Lebensphilosophie. Diese Philosophen aber findet man nur im Volke. Und der biedere Bühl-Mathis gehört zu jenen Leuten, von denen schon Cervantes schreibt: »Ich weiß aus Erfahrung, daß man auch in den Wäldern Dichter und in den Hütten der Bauern Philosophen findet.«
Ich begleitete den wackeren Mathis, der elegant und stramm wie ein alter Reitergeneral neben mir herschritt, noch eine Strecke talauf, nahm dann beim Marxenhof herzlichen Abschied von ihm und besuchte den Marxenbur.
Heute erst erfuhr ich von meinem Leidensgefährten, daß er schon dreimal in Illenau gewesen sei; das erstemal schon mit achtzehn Jahren.
Wenn Nervenübel so früh kommen, sind sie selten heilbar; mein guter Marxenbur wird drum ein unschuldiger Märtyrer bleiben, bis der Tod ihn erlöst. –
Seitdem ich hier bin, leistet mir nach Feierabend, wenn die Lampe brennt, in meinem Stübchen der Ochsenwirt Gesellschaft. Er ist eigentlich Kaufmann, hat in Pruntrut im Jura gelernt und spricht französisch. Aber die Fehler, die in meinen Augen einem solchen Hotelier ankleben, sind bei ihm verwischt durch ein stilles, bescheidenes Wesen.
So kam es, daß ich mich gerne mit ihm unterhielt, und ich fand ihn, der selber großer Hofbesitzer ist, wohl daheim in allen Fragen, die den Bauer und somit auch mich interessieren.
Er hat den letzten Krieg mitgemacht und weiß auch davon vieles zu erzählen. Und ich hab' mich mit ihm an den stillen Abenden aufs beste unterhalten, während draußen der Holdersbach rauschte.
Rippoldsau am 19. Mai.
Gestern hat mich der Ochsenwirt in den Kaltbrunn und auf den Roßberg geführt, und ich hab' in den »Erzbauern« von dieser Fahrt erzählt. Heute morgen verließ ich das mir lieb gewordene Häuschen am Wolfbach und fuhr mit dem Postillion Remigi hierher.
Rippoldsau, am Anfang des Wolftales und am Fuße des Kniebis gelegen, ist wohl das älteste Schwarzwaldbad, und ich hab' im »Leutnant von Haste« manches berichtet aus seiner Vergangenheit.
Seit drei Jahrzehnten war ich nicht mehr hier gewesen. Da jetzt noch keine Saison ist und demnach die Kurgäste einen nicht stören, wollte ich einige Tage im »Surbrunnen«, wie man noch in meiner Knabenzeit allgemein sagte, zubringen.
Der Besitzer Göringer, Hôtelier du premier rang, der mich vor einigen Tagen im Schappe besuchte, hatte mir zudem ein absolut ruhiges Quartier versprochen und auch im besten Sinne Wort gehalten. Ich wohne allein in einem ganzen Stockwerk und in einem Salon, der in der Hochsaison nur von Grafen oder jüdischen Bankiers und sonstigen Inhabern mehrerer Millionen bewohnt wird.
Ich gönne es aber auch einem armen Teufel meiner Sorte, wenn er einmal wohnen kann wie reiche Leute. Das heiße ich überhaupt im besten Sinne demokratisch, wenn ein Mensch aus dem Volke aus eigenen Mitteln zeitweilig oder stets so wohnen und leben kann wie ein Aristokrat.
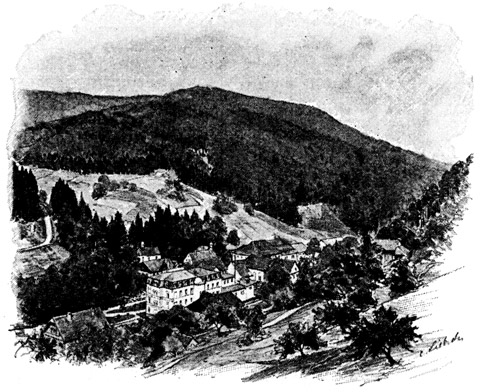
Es gehört zu einem richtigen Demokraten auch ein Stück vom Aristokraten, und ein rechter Demokrat ist ein solcher eigentlich auch deshalb, weil er aristokratisch fühlt und sich für zu gut hält, um zu wedeln und den Servilen zu spielen.
Und was das Wohnen betrifft, so sagt der bekannte Schriftsteller Kotzebue nicht mit Unrecht: »Sage mir, wie deine Wohnung möbliert ist, und ich sage dir, wer du bist.« –
Rippoldsau hat sich seit der Zeit, da ich es nimmer gesehen, zu einem modernen Badeort umgestaltet. Prächtige Neubauten verdunkeln die alten Badgebäude und verkünden, daß auch hier in diesem Schwarzwaldwinkel das verfeinerte Wohnen und Leben seinen Einzug gehalten hat und daß die Menschen weit mehr Ansprüche machen als ehedem.
Ich bin sicher kein Freund der Kultur und der übertriebenen Verfeinerung des Lebens, aber, ehrlich gestanden, wohne ich auch lieber neumodisch als altmodisch, und der Salon im neueren Hauptbau hier ist mir auch lieber als ein niedriges, kleines Zimmer im alten »Fürstenbau«.
Aber so viel ist auch sicher, daß dieses bequeme Wohnen und Schlafen verweichlicht und damit dem Leib und der Seele schadet. Je mehr die Bequemlichkeiten, Genüsse und Bedürfnisse des Lebens wachsen, um so blasierter, entnervter und kränker wird die Menschheit und um so unzufriedener und damit unglücklicher.
Drum ist der Holzmacher auf dem Kniebis, der seine von Arbeit ermüdeten Glieder auf einem Laubsack ausruhen läßt, unter einem Schindeldach wohnt und von Milch und Schwarzbrot lebt, meist und in der Regel ein viel gesünderer, viel zufriedenerer und viel glücklicherer Mensch als die vornehmen Weltleute, die kränklich und mit allerlei Bresten behaftet zur Sommerszeit am Fuße des Kniebis, in Rippoldsau, fürstlich wohnen und königlich essen und trinken. –
Was sich nicht verändert hat im Surbrunnen, ist das Brunnenhaus, wo die Eisenquellen zu Tage treten. Hier fand ich alles noch wie im Jahre 1850, da ich zum erstenmal als Knabe nach Rippoldsau kam.
Damals trank man im ganzen Kinzigtal in jedem Wirtshaus zum Wein »Surwasser«, und der Fuhrmann Krämer von Hasle, genannt der Bachsepp, holte dasselbe in kleinen Flaschen und verkaufte es, das Fläschchen zu drei Kreuzer, an die Wirte.
Mit seinem Sohne August, einem Vetter von mir, fuhr ich vor bald fünfzig Jahren das erstemal nach Rippoldsau an einem kühlen Maimorgen.
Wir füllten selbst einige Hundert Fläschchen am Brunnen, spundeten und siegelten sie in einem Pechsud, den der Brunnenmeister gegen Bezahlung zur Verfügung stellte.
In unserem »Blachenwagen« ein Wagen, der mit einem Tuch überspannt ist. fuhren wir am Nachmittag wieder talab und kamen spät in der Nacht in Hasle an. Verzehrt hatten wir im Bad nichts, es war uns zu teuer. Brot, Käs und Bier in den kleinen Herbergen am Wege hin war unsere Nahrung auf der mehr denn zwölfstündigen Fahrt.
Und doch war ich an jenem Tage lustiger, glücklicher und zufriedener als heute, wo das damalige Beckebüble in einem Grafen- und Bankiers-Salon wohnt und alle Tafelgenüsse des Hauses Göringer zur Verfügung hat. –
So sehr auch überall im Bad Rippoldsau zeitgemäßer Komfort herrscht: in einem Punkt ist das Alte und Volkstümliche in schöner Weise gewahrt. Die Bedienung besteht aus echten, eingeborenen Trachten-Meidlen des Wolftals. Und das lob' ich mir.
Man kann auf dem Schwarzwald in viele kleinere Luftkurorte kommen, in denen die Bevölkerung noch in der alten Tracht geht. Die Wirtinnen aber und ihre Töchter und Dienstmädchen glauben, sich, der Fremden wegen und weil es »nobler« sei, in die modernen Hudeln stecken zu müssen. Sie sind zu dumm dazu, um einzusehen, daß die Fremden eine Freude an den Volkstrachten haben und daß sie selber viel nobler aussehen in der alten Tracht als in der neuen, welche die Wirtinnen den besseren Stadt-Waschweibern und ihre Mädchen den Fabrikarbeiterinnen im Sonntagsputz gleichstellt. –
Heute nachmittag lernte ich auch noch den einzigen Nachbar des Bades kennen, den fürstenbergischen Oberförster, der in einer reizenden Villa unterhalb der kleinen Badestadt seine Residenz hat.
Er ist ein noch junger Mann aus Bayern und durchaus von der liebenswürdigen, gemütlichen Art aller Leute aus diesem Lande. Ich liebe jedes bayerische Menschenkind, das mir begegnet, um seines Dialektes willen, welcher in meinen Augen der schönste, weil der gemütlichste ist in deutschen Landen.
Man sagt bekanntlich, der Stil, d. i. die Schreibart, sei der Mensch. Ich aber meine, man könnte mit noch viel mehr Recht sagen: Die Mundart ist der Mensch. In dieser liegt auch der Charakter der Bayern, der Preußen, der Sachsen, der Schwaben, der Juden und der Christen. –
Hochsaison ist in Rippoldsau von Mitte Juli bis Ende August. Während dieser Zeit, wo auch im Forsthaus Kurgäste wohnen, möcht' ich nicht Förster in Rippoldsau sein; aber vor und nachher wäre es mir ein Hochgenuß, in dieser Waldeinsamkeit zu leben und zu wirken.
Der ganze Kniebis und all die herrlichen Waldungen bis zum Wildsee sind des Försters Revier, in welchem in Menge die Auerhähne balzen, die Haselhühner durch das Heidekraut huschen und die Rehe sich rufen lassen. –
An Winterabenden sind der Förster, der Badbesitzer und der Pfarrer beim Klösterle, zwanzig Minuten unterhalb des Bades, lediglich auf sich angewiesen, wenn sie Gesellschaft wollen. Bislang saßen sie dann in einer Stube des Badhauses und machten ein Caeco. Da kam das Verbot, daß kein katholischer Pfarrer in seiner Pfarrei ein Wirtshaus besuchen solle.
Dieses Verbot, das jeden katholischen Geistlichen der Erzdiözese Freiburg auf die gleiche Stufe stellt mit den Fortbildungsschülern und den notorischen Lumpen, sprengte auch das Caeco in der einsamen Winterstube zu Rippoldsau. Es starb zwar nicht, wie's in jenem Liede von Eichendorfs heißt, von den dreien der eine, aber der eine erstarb in Gehorsam und blieb weg.
Ich kenne einen Pfarrer, der, wenn er in Rippoldsau seines Amtes waltete und bisweilen an langen Winterabenden gern ein Caeco spielen möchte, nicht weggeblieben wäre, da er der Ansicht ist, nur Lumpen und Schulbuben könne und solle man das Wirtshaus verbieten, nicht aber anständigen und gebildeten Männern, die durch solch ein Verbot vor ihren Gemeinden blamiert werden.
Ich halte nichts auf das Wirtshaus-Gehen und habe seit dreißig Jahren jedem derartigen Besuch entsagt. Ja, es wäre mir seit vielen Jahren eine wahre Qual, im Wirtshaus zu sitzen.
Aber es ist in meinen Augen nicht recht, Geistliche, unter denen ja viele ältere, angesehene und verdienstvolle Männer sind, zu behandeln wie Unmündige. Man überlasse es jedem Pfarrer, was er in der Hinsicht tun will. Die allermeisten sind Männer, die, ihrer Standespflicht wohlbewußt, entscheiden können, was für sie und ihr Amt paßt oder nicht paßt, frommt oder nicht frommt. –
Blind gehorsam sein und seinen Willen beugen auch unter ein unbilliges, hartes Gebot ist zwar in meinen Augen etwas Großes. Ich bin aber leider zu solcher Größe nicht veranlagt.
Am 20. Mai.
Ich war noch nie am Wildsee, obwohl er in das Kinzigtal gehört. Hier bin ich in seiner Nähe, drum ließ ich mich diesen Nachmittag hinauffahren.
Der Weg geht durch das liebliche Seebachtälchen, das mir bis heute fremd war, sooft ich auch schon seinen Namen gehört hatte.
Prächtige Schindel- und Strohhütten an den Waldrändern hin erfreuten in ihrer poesievollen Art mein Herz doppelt, da ich von den Villen und Modebauten von Nippoldsau herkam.
Ein Gewitter zog über die Berge daher. Die Hagelkörner fielen so dicht, daß der feurige Braune unruhig wurde an dem leichten Viktoriawagen und auch mich aufregte.
Doch der Kutscher Müller, ein Veteran in seinem Amt, der den Feldzug gegen Frankreich im ersten württembergischen Reiterregiment mitgemacht hat, er forcht sich nit, stieg ab, nahm den Gaul am Kopf, und fort ging's trotz Wetter, Sturm und Graus; denn die schutzverheißenden Hütten lagen alle weit ab, droben am Wald.
Es kam mir wie ein Unrecht vor, daß ich im gedeckten Wagen saß, während der wackere Schwabe und das brave Pferd von Regen und Hagelkörnern überschüttet wurden.
Beide fuhren mich, so weit es ging. Eine Strecke weit mußte ich aber doch zu Fuß gehen, die letzte Viertelstunde vor dem See.
Um 6 Uhr abends stehe ich allein vor dem kleinen Bergsee inmitten düstersten Tannenwaldes. Noch rollt der Donner über die Wipfel, und zwischen das Rollen und Dröhnen hinein gellt eine Drossel ihr Abendlied.
Das Wasser ist leblos, schwarz und voll stiller Melancholie, in welche der Himmel heute leise seine Tränen sendet. Mit Recht hieß der See im vorigen Jahrhundert noch im Volksmund »der schwarze See«.
Es ist gefährlich für einen Melancholiker, an solchem Ort zu weilen, an welchem die Schwermut wie eine Zauberin lockt und der düstere Geist, der in der Seele wohnt, sich verbunden fühlt mit der süßesten Elegie in der Natur.
Ich lasse mich auf eine nasse Bank nieder und schaue unverwandt in die schwarzen Wasser, während der Donner rollt und die Drossel singt.
Nie in meinem Leben hat die Natur einen so wunderbar elegischen Reiz auf mich ausgeübt wie in der halben Stunde, da ich am Wildsee saß. –
Als ich wieder aus dem Walde und zu meinem Wagen gekommen war, hörte der Regen auf, die Abendsonne lachte über Berg und Tal und verscheuchte die süße, aber unheimliche Wehmut, welche dieser See über meine Seele gezogen hatte.
Eine Stunde später war ich wieder im Surbrunnen. –
Am Abend redete ich noch mit dem Oberförster, und diesem Gespräch verdanke ich die Lösung eines Rätsels, über das ich schon oft vergeblich nachgedacht hatte. Dieses Rätsel aber heißt: »Woher mag der Schild meines Paradies-Wirtshauses in Hofstetten ›zu den drei Schneeballen‹ kommen?«
Der Oberförster sprach nun diesen Abend zufällig von den drei Schneeballen im Wappen der Fürsten von Fürstenberg, und siehe da, das Rätsel war gelöst. Die uralte Herberge in Hofstetten, das ein urfürstenbergisches Besitztum war, hat ihren Schild zweifellos zu Ehren der drei Schneeballen im Wappen des Herrscherhauses.
So mußte ein Bayer dem altfürstenbergischen Untertan von Hasle zu einer Aufklärung helfen, die er schon längst von selbst hätte finden können. –
Als ich nachts noch einige Zeit am Fenster meines Salons stund, erfreuten mich die Rufe der Käuzchen aus dem nahen Walde. Ihr monotones, melancholisches Rufen, das ich auch in Hofstetten so oft höre, ist mir ungemein sympathisch.
Sehr schön ist die Sage der alten Griechen über die Entstehung dieser Nachtvögel. Die drei Töchter eines Mannes namens Minyas versäumten es ob dem Wollspinnen, den Festtag des Gottes Bacchus zu feiern. Der darob erzürnte Gott erschien ihnen, um sie zu erschrecken, nacheinander als Stier, als Löwe und als Panther, bis sie ihn erkannten. Sie wurden nun rasend vor Schrecken, die Gottheit beleidigt zu haben, und schweiften in diesem Zustand, von Kräutern lebend, in den Bergen herum, bis der Gott Hermes sich ihrer erbarmte. Er berührte sie mit seinem Stabe und verwandelte die eine in eine Eule, die zweite in eine Fledermaus und die dritte in ein Käuzchen.
So rufen bis zur Stunde die Töchter des Minyas mit tausend Käuzchen- und Eulenstimmen, daß man die Feste der Gottheit feiern solle.
In unserer Zeit versäumen die jungen Damen den Gottesdienst an Sonn- und Feiertagen nicht mehr wegen des Wollspinnens, sondern wegen viel unnötigerer Dinge. Im Winter gehen sie aufs Eis und im Sommer aufs Rad.
Wenn aber der Christengott ebenso schnell strafen würde wie die heidnischen Götter, so wären in unsern Tagen alle Berge voll von rasenden Jungfrauen, und die aus ihnen gewordenen Eulen, Fledermäuse und Käuzchen würden zur Landplage.
Möge aber jedes neumodische Wibervolk, sooft eine Fledermaus an ihm vorbeischwirrt oder es in düsteren Nächten ein Käuzchen oder eine Eule rufen hört, denken, wenn die Heidengötter, die eigentlich meist Lumpen waren, weil belastet mit allen menschlichen Lastern und Leidenschaften, die Entheiligung ihrer Feste so rächten, wie wird einst der dreimal heilige, wahre Gott sein Gebot rächen: »Gedenke, daß du den Sabbat heiligest!?« –
Am 21. Mai.
Diesen Morgen sah ich viele Leute, der Tracht nach aus dem Renchtal, hier durchgehen und erfuhr, es kämen jeden Freitag Renchtäler über die Holzwälder-Höhe, um ins Klösterle zu wallfahrten.
Klösterle heißt die Pfarrkirche von Rippoldsau, weil sie und das Pfarrhaus aus dem kleinen Kloster hervorgingen, das durch viele Jahrhunderte herauf bis in unsere Tage die Benediktiner von Villingen hier besaßen.
Ein Madonnenbild, eine Pietà zu Ehren der Schmerzen Marias, zieht heute noch wie zu Klosterszeiten die Wallfahrer an.
Ich verglich dieselben im Geiste mit den Badegästen, die im Sauerbrunnen Erholung und Genuß suchen, und kam zu dem Schluß, den ich schon oft gezogen habe, daß nämlich das gemeine Volk viel idealer ist als die sogenannten besseren und besten Menschen der bevorzugten Stände.
Was führt diese hierher zur Sommerszeit? Antwort: Lediglich der Genuß, das behagliche Dasein, die Sorge für den lieben, tierischen Leib, für dessen Wohlsein und Gedeihen.
Was aber bestimmt die Landleute, auf dem beschwerlichen Gebirgsweg aus dem Renchtal herüber und hinab ins Klösterle zu wallen? Die Sorge für die Seele, das Suchen nach Trost und Hilfe in den Leiden und Mühen dieses Lebens und die Hoffnung auf eine bessere, ewige Welt.
Hungrig und durstig machen sie die Reise ins Klösterle und wieder heim, wenn's gut geht, mit einem Stück Brot in der Tasche. Und ohne sozialdemokratische Gedanken zu bekommen, ziehen sie an den »vornehmen« Genußmenschen der Badewelt vorüber, zufrieden mit ihrem Los, weil getröstet durch die Mutter der Schmerzen, diesem höchsten menschlichen Vorbild der Ergebung in den Willen Gottes.
Mitleidig, wohl bisweilen auch verächtlich, mögen in der Haute-Saison von Rippoldsau die aufgeputzten Wibervölker auf die Bauernweiber aus dem Renchtal herabsehen, wenn diese vom Klösterle herauf wieder der Heimat zuwandern. Und doch steckt der bessere, der höhere, der idealere Mensch im »Burehäs«. –
Der Badbesitzer Göringer, ein ebenso rühriger und liebenswürdiger als korpulenter Mann, fuhr heute nachmittag über den südlichen Kniebis nach Freudenstadt, um morgen dort eine Hochzeit mitzumachen. Er lud mich ein, ihn bis auf den Zwieselberg zu begleiten, wo dann die Equipage des Oberförsters mich gegen Abend wieder abholen sollte, weil ich nicht imstande wäre, zu Fuß zurückzukehren.
Auf prächtigem Gebirgsweg und durch noch prächtigern Hochwald fuhren wir dem Zwieselberg zu. Unterwegs begegnete uns ein mit vier Rossen bespannter Lastwagen, der meinem Begleiter gehörte. Und was zog der stolze Viererzug mühsam über den Kniebis her? Moor aus Franzensbad in Böhmen, das mit der Bahn nach Freudenstadt befördert worden war.
So weit haben es Kultur und Verkehr gebracht, daß die Menschen böhmische Moorbäder irrt Schwarzwald nehmen können. Ich meine, das sei doch des Guten zu viel, und die Torfmoore des Schwarzwaldes würden auch Moorboden liefern, damit jene, die in schwarzem Schlamm sich wälzen wollen, ihrem Gelüste genugtun könnten.
Bald wird man den verwöhnten Kurgästen noch indische Schwalbennester zu der böhmischen Moorerde kommen lassen müssen.
Aber so sind die Menschen! Immer verlangen sie nach dem, was Mode ist – in der Heilung des Leibes wie in dessen Bekleidung.
In neuester Zeit sind die Moorbäder wieder aufgekommen und als allerneuestes Heilmittel die elektrischen Bäder. Flugs verlangen alle hysterischen Weiber und alle blasierten Mannsleute nach diesen Modebädern, und ehe sie einen Kurort besuchen, fragen sie an, ob dieselben auch da zu haben seien.
Drum muß der ehrliche Göringer Moorboden von Franzensbad an den Fuß des Kniebis kommen lassen. Ich muß offen gestehen, in dem vorliegenden Fall wäre ich als Badbesitzer von Rippoldsau nicht so gewissenhaft wie er. Ich würde meinen Wagen füllen an irgendeinem Torfstich auf dem Kniebis und die Leute in diesem Schlamm baden lassen. Und ich bin überzeugt, die Wirkung wäre die gleiche; denn der Glaube, in böhmischem Schlamm zu baden, würde völlig hinreichen, die Leute gesund zu machen. Auch bei leiblichen Heilmitteln gilt der Satz, daß der Glaube an dieselben selig und gesund mache. –
Der Zwieselberg, ein echtes, rauhes Schwarzwald-Hochplateau, enthält eine Waldkolonie, die in diesem Jahrhundert von Kaltbrunn herauf bevölkert wurde. In den einsamen, zerstreut zwischen Wald und Wiese gelegenen, malerischen Schindelhütten wohnen Holzmacher.
Da aber überall, wo nur drei deutsche Männer sind, ein Wirtshaus sein muß, hat auch die kleine Kolonie Zwieselberg ein solches, das heute mir als Rastort willkommen war. Hier stieg ich ab und erwartete den Wagen, der mich wieder den gleichen Weg zurückführen sollte.
Ein Gewitter zog über den Kniebis hin, und unter Donner und Blitz saß ich in der kleinen, aber freundlichen Wirtsstube.
Unweit von mir trank ein armer, alter Mann eine Flasche Bier und rauchte dazu aus einer Pfeife einen wahren Höllenknaster.
Ich lasse mich mit ihm in ein Gespräch ein und erfahre von ihm, daß er ein geborener Elsässer sei, aber seit dem großen Krieg in der württembergischen Kniebisstadt sich niedergelassen habe.
Er war ehedem sieben Jahre Soldat beim 47. französischen Linienregiment, das in Constantine in Algier seine Garnison hatte, als er zuging. Er machte dann den Krimkrieg mit, wenig Jahre später den in Italien, wo er bei Solferino kämpfte. Nach dem Frieden lag er auch einige Zeit in der Papstburg zu Avignon, und er freute sich nicht wenig, als ich ihm sagte, ich sei auch schon in der dortigen Kaserne gewesen.
Als seine Heimat »preußisch« wurde, ging er als Tuchmacher »auf die Walz« und fand Arbeit in Freudenstadt, wo er ein Weib nahm und blieb als ehrsamer, schwäbischer Untertan.
Seit Jahr und Tag kann er auf dem Handwerk nimmer schaffen und muß schauen, wie er sonst Brot findet. Ein eigener Erwerbszweig, von dem ich heute zum erstenmal hörte, führt ihn nun im Frühjahr über den Kniebis und hinab ins Wolftal, um im Schappe, auf dem Kupferberg, Stechpalmen-Reiser zu holen.
Er hat für hin und her neun Wegstunden zu machen und dazu einen Karren zu ziehen. Sein Weib begleitet ihn. Sie hat heute Gelegenheit gehabt, den Karren mit den Stechpalmen, die in Säcke verpackt sind, einem von Pferden gezogenen Wagen anzuhängen, und ist drum voraus gen Freudenstadt, während der Mann noch seinen wohlverdienten Schoppen trinken will.
Morgen werden nun die einzelnen Blätter mit vieler Mühe abgezupft und dann verkauft, das Pfund zu elf Pfennig.
Heute hat das Ehepaar Freudenstadt um drei Uhr des Morgens verlassen und kommt abends neun Uhr wieder heim. Der folgende Tag geht mit Abzupfen vorüber, und dann können die zwei Leute 30 Pfund Blätter abliefern und erhalten dafür 3 Mark und 30 Pfennig.
Das ist der Lohn für zwei mühevolle Tage und für zwei Menschen. Fürwahr, die soziale Ungleichheit im Verdienst schreit angesichts solcher Tatsache zum Himmel! –
Der Mann ist auch ein Beispiel dafür, wie Familien oft in der Welt verschlagen werden. Sein Großvater war von Ansbach in Bayern und führte Hopfen nach Straßburg. Er ließ sich später daselbst nieder; sein Sohn zog nach Bischweiler, und der Enkel lebt und stirbt auf dem Kniebis.
Ich versüßte dem alten, französischen Soldaten bei unserm Scheiden auf dem Zwieselberg den heutigen harten Tag und schied ungern von ihm.
Draußen stund das Gefährte des Oberförsters, ein riesiger Maulesel vor einem leichten Korbwagen.
Geritten bin ich schon auf Eseln, auf meiner Reise nach Italien und Sizilien, aber noch nie gefahren mit einem solchen. Daß dies aber auf dem Kniebis und nicht etwa in Italien geschehen sollte, war mir eine wunderliche Neuheit.
Das Grautier vor dem Korbwagen läßt sich, wie ich höre, zum Fahren und Reiten gebrauchen, sei aber bissig und von einem mächtigen Eigen- und Starrsinn und nicht mehr vom Platz zu bringen, wenn derselbe es erfasse.
Ich lobe diese Eigenschaften, welche allen Kultur-Eseln, d. i. allen diesen Tieren, soweit sie der Mensch in seinen Gebrauch genommen, in der Seele steckt. Denn zweifellos hat der Mensch dieselben in die Eselswelt gebracht durch die Art und Weise, wie er mit den Eseln von jeher umging, und sind jene Eigenschaften nur die lobenswerte Reaktion gegen die Mißhandlungen, welche die armen Tiere von den Menschen erfahren haben.
Ja, daß der Esel eigensinnig ist und schlägt und beißt, wenn einer seiner Tyrannen ihm naht, hebt ihn in mancher Hinsicht über die Menschenwelt hinaus. Die Völker haben, trotzdem sie in ihrer langen Geschichte politisch meist das Los der Esel erfahren, alle Lasten und Leiden tragen mußten und geschlagen und geschunden wurden, selten den Mut gehabt, starrsinnig zu sein, ihre Dienste zu versagen und zu beißen und zu schlagen.
Im Gegenteil, sie machen allzeit noch Komplimente und Bücklinge vor ihren Herren, rufen Hoch, feiern Feste zu Ehren der größten Tyrannen und lassen sich in Geduld schinden und plagen.
Börne sagt in der Richtung einmal Ähnliches, wenn er schreibt: »Kein Hund läßt sich ruhig vom andern beißen, noch weniger Tausende von Hunden von einem einzigen. Tausende von Menschen lassen sich aber von einem einzigen prügeln und wedeln noch dazu.« –
Der oberförsterliche Esel mußte ahnen, daß ich auch eine Art Esel, weil Demokrat, sei und das Wesen der Esel zu würdigen wisse, denn er brachte mich tadellos und ohne eine seiner schlechten Seiten zu zeigen, hinab ins Wolftal.
Selbst der Ungeduld entsagte er, als ich beim Klösterle abstieg, um den Pfarrer zu besuchen, und deshalb die Equipage längere Zeit auf der Straße stehen ließ. –
Als ich in den siebziger Jahren in und um Offenburg für den Reichstag kandidierte, war der heutige Pfarrer von Rippoldsau ein junger, schlanker Vikar in der genannten Stadt.
Seitdem hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Er hat sich aber indes zu einem Riesen an Körperumfang entwickelt, trotzdem er eine der beschwerlichsten Bergpfarreien pastorieren und jede Woche zweimal bis auf den Kniebis hinauf in die Schule gehen muß.
Worüber ich aber noch mehr staunte als über sein Volumen, das war die ungemeine Höflichkeit und das ungesucht galante Wesen, mit dem er mir gegenübertrat.
Der, so sagte ich mir im stillen, ist der Stadtpfarrer, wie er im Buche steht, und du bist der reinste und echteste Bauernpfarrer ihm gegenüber.
Und doch beneidete ich den feinen Mann nicht um seine Feinheit und Höflichkeit, obwohl man mit solchem Wesen zweifellos besser, beliebter und glätter durch die Welt kommt als mit meiner Art. Allzu höfliche Leute sind aber selbst im Himmel nicht ihrer ewigen Ruhe sicher, weil sie immer ängstlich um sich schauen und fürchten werden, sie könnten einer andern Seele den Platz versperren.
Mit dem Hut in der Hand, sagt ein bekanntes Sprichwort, kommt man durchs ganze Land. Ja, man kommt durch als armer, geduldeter Schlucker. Mit dem Säbel in der Hand bringt man's aber weiter. Den Tapferen und den Groben gehört die Welt, aber nicht den Höflichen und den Zahmen.
Besonders in unsern Tagen, wo die Parole »der Kampf ums bessere Dasein« ist, wird der rücksichtsvolle und anständige Mensch sicher zu keinem »besseren Dasein« kommen.
Selbst derjenige, welcher die Welt mit seiner Wahrheit erobert hat, Christus Jesus – er hat seinen Aposteln, da er sie aussandte, empfohlen, nicht allzu höflich zu sein und den Staub alsbald von den Füßen zu schütteln, wo man sie nicht willig anhöre.
Auch Johannes der Täufer, der Vorläufer Christi, zeichnete sich nicht aus durch besondere Höflichkeit den besseren Bürgern seiner Zeit gegenüber; er und nach ihm Jesus selbst griffen die Edelsten und Besten der jüdischen Nation mit sehr ungalanten Reden an. –
Der Pfarrherr zeigte mir auch seine reich geschmückte Kirche. Der Patron derselben, Sankt Nikolaus, ist ein reicher Herr, besitzt viele Waldungen, und drum finden wir in Rippoldsau ebensowenig eine Bauernkirche wie einen Bauernpfarrer. Beide passen zusammen; beide sind vornehm angelegt und könnten sich in jeder Stadt sehen lassen.
Daß es übrigens auch die Bauern zu würdigen wissen, wenn sie einen höflichen Pfarrer haben, geht aus dem Ansehen hervor, das der liebenswürdige Pastor von Rippoldsau bei seinen Pfarrkindern genießt. Er ist eben gerade so eifrig in der Seelsorge wie human im Umgang.
Der Pfarrer von Rippoldsau ist indes Stadt- und Hofpfarrer in Sigmaringen geworden und somit der rechte Mann am rechten Ort, was nicht immer vorkommt. Schon Napoleon I. sagte: »Mancher sitzt im Staatsrat und sollte hinter dem Pflug hergehen, und mancher geht hinter dem Pflug her, der Staatsrat sein sollte.«
Am 22. Mai.
Der Oberförster stellte mir gestern abend noch seinen Mulo zur Verfügung, damit ich heute in den Burgbach fahren könnte, wo der Ländere-Karle wohnt, ein Vetter des Ländere-Xaveri, eines eifrigen Lesers meiner Schriften, der mich diesen Morgen besucht hat.
Der Xaveri, ein stiller, sinniger Siebziger, ist zweifellos der einzige Taglöhner und Bauersmann im Kinziggebiet, der alle meine Bücher sich gekauft hat.
Von seinem Vetter wußte ich schon länger, daß er ein Original sei. Ich kannte ihn aber nicht, drum suchte ich ihn heute noch vor Tisch auf. Der Esel brachte mich in einer guten Viertelstunde an den Eingang des Burgbachtälchens.
Ich hatte dieses von Süden her sich öffnende Waldidyll gar nicht bemerkt, als ich gen Rippoldsau fuhr, und war heute nicht wenig erstaunt über seine reizende Schönheit.
Mitten in dem kurzen Tälchen erhebt sich ein breiter, waldiger Felsberg, oben von nacktem Gestein gekrönt, wie von Burgzinnen. Rechts und links und hinter diesem Naturschloß schauen tannenwaldige Kuppen in den Äther des Himmels.
Da oben eine Villa zu haben, dachte ich, müßte einen Krösus glücklich machen. Und die Leute, welche in der Schindelhütte dort droben wohnen, fühlen es sicher nicht, in welch wunderbarer Einsamkeit sie ihr Leben zubringen.
Doch schon vor mehr als einem halben Jahrtausend haben Edelknechte sich dort eine Burg gebaut, zweifellos eine der einsamsten und verstecktesten Waldburgen dieser Erde. Aber kein Lied, kein Heldenbuch meldet mehr von ihnen; die letzten Steine der Burg sind schon verschwunden, als die Villinger Mönche unten im Tal sich »das Klösterle« bauten. Und nur das Totenbuch der Abtei St. Peter meldet uns aus dem zwölften Jahrhundert einen einzigen des Geschlechts, das einst auf diesen malerischen Felsen hauste, einen Egino von Burgbach. Alle andern sind versunken und vergessen wie die armen Bäuerlein, die vor sieben Jahrhunderten im Wolftal ein kärgliches Dasein fristeten.
Wer das Burgbachtälchen betritt, dem fällt zunächst nur der malerische Felsberg in die Augen, und er übersieht das niedliche, einstöckige, mit Schindeln gedeckte Haus, das gerade über dem Waldbächlein gebaut ist und gleich am Eingang steht. Und doch wohnt in ihm ein Edelknecht alten Schlags – der Ländere-Karle.
Unter einem Edelknecht aus alter Zeit verstehe ich einen Mann, der mit gleicher Kraft sein Schwert schwingt wie seinen Humpen, und der in des Waldes düstern Gründen dem Wild nachgeht und mit seinem Wurfspieß die Beute sicher erlegt.

Solch ein Mann aber ist der Ländere-Karle im heutigen Burgbach. Er schwingt, obwohl ein guter Siebziger, im Tannenwald seine Axt noch, daß die Burgbachfelsen widerhallen, und trinken kann er, wenn's sein muß. Tag und Nacht, und ein Jäger war er, bis vor kurzem sein Auge sich trübte, wie kein zweiter an der Wolf hin pirschte. Er fehlte nie eine Schnepfe und bekam deshalb auch frühzeitig den Ehrennamen »der Schnepfe-Karle«.
Daheim ist er »in der Ländere«, oberhalb des Surbrunnens, wo einst die Flöße vom Kniebis her landeten. Aber seit einem halben Jahrhundert sitzt er am Eingang in den Burgbach, und nennt da ein kleines Gütle sein eigen. Doch seine Hauptbeschäftigung ist bis zur Stunde das Holzmachen in den fürstenbergischen Waldungen. Wegen seiner Treue und Redlichkeit war er allezeit der Jagdaufseher des fürstlichen Oberförsters in Rippoldsau, und den Fürsten von Fürstenberg selbst leistete er Dienste als Auerhahnen-Verhörer.
Nirgends hat es wohl mehr dieser Sportvögel als in der Forstei Rippoldsau; drum kommt der Fürst von Fürstenberg mit seinen Gästen alljährlich in diesen Bezirk zur Jagd.
»Wenn die Könige bauen,« sagt Schiller, »haben die Kärrner zu tun.« Und wenn die großen Herren auf Auerhähne jagen, haben die armen Holzmacher im Wolftal Samen. Sie werden für ihre Verhörgänge gut bezahlt; denn sie bekommen von jedem Jäger, der auf einen Hahn schießt, auch wenn er ihn nicht trifft, zehn Mark.
Gegen dreißig Waldhüter und Holzmacher liegen im Frühjahr wochenlang dem Verhören ob, damit sie, wenn die Jagdherren kommen, angeben können, wo die Tiere balzen.
Der Karle war der König dieser Verhörer und darum und wegen seiner derben Offenheit bei den Fürstlichkeiten allezeit wohlgelitten. Nur einmal passierte es ihm, daß er beim Morgenrapport, den der kürzlich verstorbene junge Fürst entgegennahm, traurige Mär brachte.
»Beim Schneckenburger«, einem Wirt unweit vom Klösterle, war eine Hochzeit gewesen den Tag über und der Karle auch dabei. In der kommenden Nacht sollte er aber aufs Verhören im »Sonnenberg«. Er meinte nun, es wäre am praktischsten, wenn er bei der Hochzeit bliebe und tränke, bis es Zeit wäre zum Verhören. So tat er. Gegen drei Uhr des Morgens brach er vom Trinken auf, um dem Balzen der Vögel zu lauschen. Aber die Kraft des Weines machte dem Karle Schlaf, und er schlief den Schlaf des Gerechten, während die Hähne balzten und falzten.
Als er erwachte, eilte er dem Hauptquartier zu, das im Bad Rippoldsau sich befand, wo der Fürst, eben angekommen, den Rapport der Verhörer selbst entgegennahm. Dieser fragt den daherschwankenden Karle: »Wie steht's in Ihrem Revier?«
»Do stoht's lüderli, ganz lüderli, Herr Fürst! I ha wit und breit kei Vogel g'hört« – antwortet der Karle. Dann lüpfte er seinen Hut und sprach: »Ich bin ein Deutscher, und die Deutschen trinken immer eins vor dem Verhören.« Sprach's und verschwand in der Wirtsstube des Badhauses. Der junge Fürst aber nahm des biedern Verhörers und Trinkers Verhalten mit vollem Humor auf. –
Als noch geflößt wurde im Wolftal, war der Karle erster Dirigent der fürstlichen Flöße. Er überwachte die Stauungen, sorgte fürs Wasser und kommandierte die Abfahrt. Daß er bei diesem Gelegenheiten in dem unweit von seiner Hütte stehenden Wirtshaus zum »letzten G'stör« auch eins trank, versteht sich von selbst. Denn diese Kneipe verdankte ja Entstehen und Namen den Flößern, die ihre Flöße nach »G'stören« einteilten und, wenn das letzte fertig war, jeweils tüchtig zechten.
Die alte Flößerkneipe besteht heute noch mit dem alten Schild und ist das letzte, sichtbare Zeichen der untergegangenen, fröhlichen Flößerzeit.
Mehr denn einmal hat der Karle im letzten G'stör mit seinem Kollegen und Freund Severin Schmid in einer Sitzung zweimal vierundzwanzig Stunden lang gespielt und gezecht und gesungen.
Sein Lieblingslied ist das bekannte:
Der Jäger in dem grünen Wald
Wollt' suchen seinen Aufenthalt;
Er ging im Wald wohl hin und her,
Ob auch nichts, ob auch nichts anzutreffen wär'.
Der Karle ist aber nicht bloß Sänger, er ist auch Deklamator. Bei Hochzeiten und sonstigen größeren Gesellschaften trägt er seine Späße vor und zwar ein Rezept fürs Podagra und ein Zwiegespräch zwischen Doktor und Patient über die gleiche Krankheit. Beim Dialog half ihm jahrelang sein alter, jetzt toter Freund Firner vom Holzwald.
Wenn bei einer Hochzeit der Karle und der Firner übers »Podagram« zu deklamieren anfingen und der eine als Doktor anhub: » Bonus vesper, gestrenger Herr!« – und der andere als Patient antwortete: »Großen Dank, wo kommt Ihr her?« – dann schwiegen alle Buren, alle Völker und alle Geigen – und was Ohren hatte, lauschte den zwei greisen Holzhauern.
Auch Jägerlatein spricht der Alte unter den Burgbachfelsen. So erzählt er gerne Leuten, die es glauben, die folgende Jagdgeschichte: Der Rentmeister in Wolfe habe ihm eines Tages als Holzhauerlohn eine Rolle mit silbernen Zwanzigpfennigstücken gegeben. Er steckte sie in seine Jagdtasche, wo die Patronen für sein »Lancastergewehr« sich befanden.
Einige Tage darauf geht der Karle auf die Jagd, verwechselt seine Geldrolle mit einer Patrone und schießt sie auf einen Rehbock ab. Erst als es an den Tannenbäumen klapperte wie Hagelwetter, kam er zum Bewußtsein seines Fehlgriffs.
Der Rehbock sei munter davon gesprungen, und am folgenden Sonntag hätten seine Buben die Zwanzigpfennigstücke mühsam wieder zusammengesucht.
Als sein Sohn, der Sepp, von dem Dienst als Artillerist heimgekehrt war, erzählte der Vater, er habe eine Kanone mitgebracht und auf dem Arm heimgetragen. Er meinte nämlich die Kanone, welche der Sepp mit blauer Farbe auftätowiert auf dem Arme trug.
Kein Jägerlatein ist die folgende Leistung des braven Waldmannes. Als in der Kirche von Rippoldsau ein neuer Boden gelegt wurde und alle Stühle entfernt waren, mußten die Leute einige Sonntage während des Gottesdienstes stehen. Der Karle aber war der einzige, der zum Sitzen kam. Er nahm seinen Jagdstuhl mit, stellte ihn an die Wand, setzte sich und – schlief.
Heute kann der Karle, wie schon gesagt, nicht mehr jagen, aber etwas will er doch noch von der Jagd haben. Drum geht er bei großen Jagden bescheiden als Treiber mit. Gerne erzählt er dann beim »letzten Trieb« im Wirtshause seine vielen Erlebnisse als Nimrod. –
Er ist längst Altersrentner und trägt auch das Ehrenzeichen für treue Arbeit in des Waldes düstern Gründen.
Sein Anblick hat mein Herz erfreut, weil er viel origineller aussieht, als ich es erwartet hatte.
Ein großer, stämmiger Mann mit langem, weißem Backenbart, eine Zipfelkappe auf dem Haupt, mit Kniehosen, weißen Strümpfen und schweren Pechschuhen angetan, trat er mir vor seiner malerischen Hütte entgegen.
Aus seinem Gesicht strahlte eine Biederkeit und eine Geradheit, wie ich sie so stark noch nie aus einem Schwarzwälder Bauernantlitz leuchten sah.
Die Sorte Menschen, wie der Karle sie in bester und ausgeprägtester Art darstellt, ist am Aussterben, selbst auf dem entlegensten Schwarzwald. In hundert Jahren wird man das Bild eines Mannes, wie der Karle einer ist, anschauen, wie wir jetzt ein solches von einem Ritter des zwölften Jahrhunderts in voller Wehr betrachten.
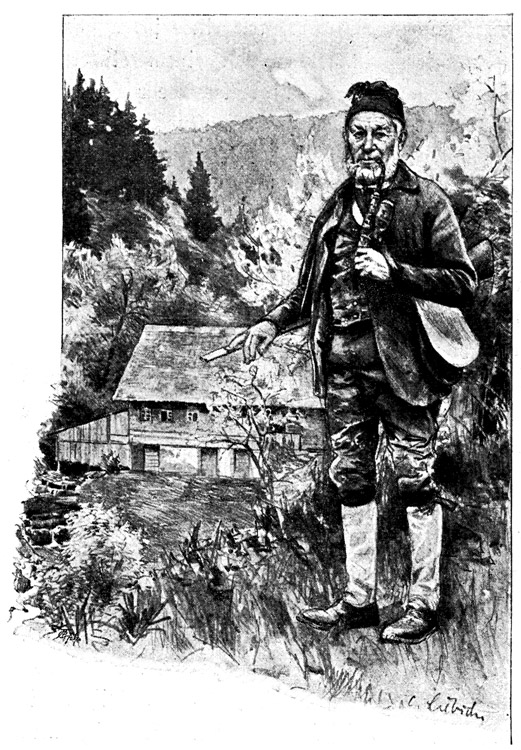
Es wird, wenn die liebe Kultur so fortmacht, auch auf dem Schwarzwald nur noch ländliche Gigerl geben mit Frack und Zylinder und faden, blasierten Gesichtszügen.
Und wird dann das ersehnte goldene Zeitalter gekommen sein? Im Gegenteil, das goldene Zeitalter, die glücklichste Zeit der Kultur-Menschheit, ist längst vorüber. Sie war, wie schon der römische Dichter Tibull sagt, in jenen Tagen, »da es noch keine gebahnten Wege gab, die Häuser noch keine Türen hatten und die Menschen in Tierfelle sich kleideten«. –
Von den sechs Buben des Karle traf ich nur einen daheim, den Sepp, einen starken, schönen jungen Mann, den Erben der väterlichen Hütte.
Daß die Kultur auch schon am Burgbachfelsen leckt, zeigen die Namen der Söhne des Karle. Während die älteren die schönen Namen Kosmas, Isidor, Melchior und Sepp tragen, heißen die jüngsten schon Wilhelm und Emil. Das hat aber offenbar nicht der Karle verschuldet, sondern sein zweites Weib.
Der Kosmas zog als Holzhauer ins bayerische Gebirg und ließ sich im Schatten des Watzmann häuslich nieder.
Der Melchior gar ist Wirt und Bäcker im »letzten G'stör«, der Stammkneipe des Alten. Die Liebe einer reichen Bauerntochter, die keinen andern wollte als des Karles Melchior, hat ihm dies Besitztum möglich gemacht.
Der Isidor gründete sich eine Existenz in Straßburg. Alle drei aber waren viele Jahre die Gehilfen des Vaters im Wald, wo der Sepp heute noch an seiner Seite Tannen fällt.
Der jüngste aber, Emil, kann bei so modernem Namen kein Holzhauer werden; drum »studiert er auf Lehrer.« Ihm hat der Vater auch das Zwiegespräch über »das Podagram« diktiert und mir zugesandt.
Ich schied voll Freude, einen echten, biederen Waldmann kennen gelernt zu haben, aus dem Burgbachtälchen. –
Im Bad kommen jetzt mehr und mehr Kurgäste an, und es ist Zeit, daß ich abziehe. »Bei der Tafel« sind heute viele fremde Gesichter.
Mir ist nichts mehr zuwider als das Essen an der sogenannten » table d'hôte«, und ich hab's auf meinen vielen Reisen in früheren Jahren vermieden, so gut ich es konnte. So oft ich's aber über mich ergehen lassen mußte, habe ich gefunden, daß nirgends fader und nichtssagender geredet wird als an solchen Orten, besonders wenn, viele »Damen« dabei sind.
Fürwahr, Kinder, die auf einem Sandhaufen spielen, reden gescheiter. –
Trotz des leichten Regens am heutigen Nachmittag fuhr ich in Begleitung des Pfarrherrn im Klösterle durch den Holzwald auf den Kniebis.
Tief unten im Tal, droben im Wald und versteckt in Schluchten grüßen uns überall noch malerische Schindelhütten. In einer derselben sitzt der Holzwälder- oder Pariserschneider, auch der Hoppsassa genannt, von dem ich in diesen Tagen viel gehört hatte, dessen Residenz mir aber zu hoch gelegen war, um ihn aufzusuchen.
Er hat die originelle Art, daß er nur dann preußisch spricht, wenn er nicht mehr nüchtern ist. Sonst mühen sich bei uns viele alemannische Schafe im nüchternen Zustand ab, preußisch zu reden. Der Holzwälder Schneider bringt sein »sehr jut« nur, wenn er nicht mehr zurechnungsfähig und darum zu entschuldigen ist.
Dann spricht er wohl auch lateinisch, und seine Hauptredensart lautet: » Muja, tuja, gloria.«
Am liebsten wendet der Markus vom Holzwald alte Kleider, damit ihn kein Vorwurf trifft wegen schlechten Sitzens.
Er ist auch Hofschneider für die Kurgäste im Bad, wobei er keine Reparatur, auch die kleinste nicht, unter »einem Märkle« macht; denn die Herren, meint er, haben Geld, sonst täten sie keine Badereisen »genießen«.
Unsichere Kantonisten sind ihm die Kellner, die nicht immer bar bezahlen. Ist ihm einmal ein solcher ein paar Märkle schuldig, so bekommt der Schneider Angst, der Schuldner könnte ihm durchbrennen. Er steigt drum täglich vom Holzwald herunter, trinkt eins und überzeugt sich von des Schuldners Gegenwart. Brennt ihm trotzdem bisweilen einer durch, so verstummt sein »sehr jut« und sein » Muja, tuja, gloria« wochenlang.
Auch die Köche im Bad sind des Pariserschneiders Kunden; sie schwärzen dem Maestro aus dem Holzwald aber bisweilen sein Schneidersgesicht, oder binden dem kleinen Männlein zum Abschied den Schwanz eines Kalbes an den Rock.
Ich hätte den Mann gerne kennen gelernt, schickte nach ihm und bestellte ihn ins Bad. Er bekam aber die Nachricht zu spät und traf erst nach meiner Abreise ein. –
Auf der rauhen Höhe des Kniebis angekommen, staunte ich, wie die Neuzeit auch hier ihre Kurhäuser und ihre Sommerfrischen errichtet hat innerhalb der drei Jahrzehnte, die vergangen sind, seitdem ich das letztemal da oben war.
Selbst das damals einzige und bescheidene Wirtshaus zum Lamm hat sich neuzeitig so geändert, daß ich's nimmer erkannte.
Aber eines hat sich darin noch erhalten aus jenen Tagen – das Fremdenbuch, und in diesem fand ich beim ersten Aufschlagen den Tag, an welchem ich hier gewesen. Es war der 19. August 1867 und mein Geburtstag.
Ich war an diesem Tage morgens vom Renchtal heraufgestiegen mit dem Pfarrer und Sänger Matt von Peterstal, der jetzt längst ausgesungen hat, und wir zogen erst am Abend weiter gen Freudenstadt.
Den ganzen sonnigen Nachmittag über spielte mein Begleiter auf einem Klavier und sang dazu, daß die Wälder ringsum widerhallten und ich, ich sang mit ihm.
Dreißig Jahre war ich alt an jenem Tage und mein Freund siebenunddreißig, wir beide also noch in einem Alter, in dem man fröhlich sein und singen kann.
Heute, da ich dreißig Jahre später wieder des Weges daherkomme, bin ich ein alter Mann, und des Lebens Lust ist dahin. Draußen in der Natur fehlt heute der Sonnenschein. Es regnet, und die Fichten träufeln, und alles stimmt zu meiner Seele Elegie. –
Wir fuhren im Regen durch Wald und Weide, bis wir hinabsahen ins Murgtal, ins waldige, und auf die Reste des ehemaligen Elbach-Sees.
Im Hinschauen auf das kleine Gewässer, welches still inmitten dunkler Forste liegt und von Jahr zu Jahr mehr und mehr versiegt, kam mir der Gedanke, daß unser Menschenleben ein ähnliches Los hat. Es versinken unsere Tage fort und fort im Meere der Zeit und, alt geworden, gleicht unser Leben einem kleinen, einsamen Gewässer, das zwischen düstern Waldbäumen ein ödes Dasein fristet und mehr und mehr versickert, bis es alle ist. –
Auch zu den malerischen Ruinen des einstigen Klösterleins auf dem Kniebis ließ ich mich fahren. Sie sind gotischen Stiles, aber seit drei Jahrhunderten im Zerfall. In allerletzter Zeit dachte man endlich daran, die schönen Reste zu erhalten.
Einst waren die Mönche, die hier lebten, die einzigen Bewohner des winterlichen Kniebis. Ihr Klösterlein war das Hospiz für die Wanderer, welche aus den Tälern der Donau, des Neckars und des Rheines über diesen Paß hinzogen und eilenden Fußes mildere Gegenden aufsuchten.
Jetzt sind zwei Kolonien auf dem Kniebutz, wie er im Mittelalter hieß, eine badische und eine württembergische, und im Sommer schwärmen zahlreiche Touristen zum Vergnügen über seinen waldigen Rücken hin, und Luftkurleute in Menge wohnen auf ihm zur Erholung.
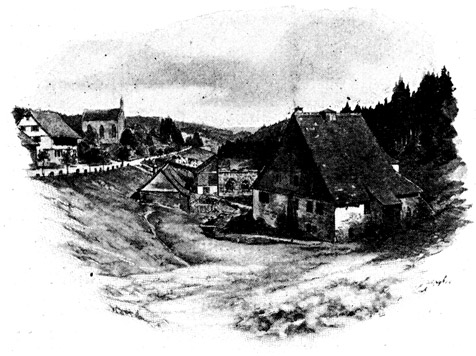
Ehedem hatten die Menschen es nicht nötig, auf dem Kniebis sich aufzuhalten. Er galt ihnen drum nur als rauher Uebergang vom Rheintal in das Neckar- und Donautal. In unseren Tagen sind die Menschen von lauter Kultur siech und elend und müssen Gesundheit holen in der Unkultur der Berge.
Heute war es übrigens kein Vergnügen, auf dem Kniebutz auch nur umherzufahren; denn immer und immer wieder kamen Regengüsse, und ein kalter Wind schüttelte die Tannen.
Drum hielten wir uns nirgends lange auf und waren schon vor Abend wieder tief unten im Tale von Rippoldsau, das ich morgen verlassen will.
Schapbach am 23. Mai.
Der Sonntag macht heute seinem Namen alle Ehre. Regen und Nebel sind völlig verschwunden, und des Sonnengottes goldene Strahlen scheinen über Berg und Tal.
Ich mußte mich zur Kirche fahren lassen, da ich nicht imstande gewesen wäre, die kurze Strecke bis zum Klösterle zu Fuß zu machen.
Gegen Mittag verließ ich Rippoldsau und fuhr hierher, wo ich, dies schreibend, wieder in dem kleinen Häuschen sitze – ganz allein. Nur die Abendsonne ist bei mir.
Draußen auf der Straße ziehen Mädchen vorbei hinauf zur Maiandacht in der Dorfkirche. Sie singen Marienlieder und machen mir so mehr Freude als die schönste table d'hôte-Gesellschaft im Surbrunnen.
Die Glocken der Rinder des Danielsburen läuten zu mir herüber, der Holdersbach stürzt vor meinem Fenster tosend in die Wolf, zwischenhinein singen die Vögelein im Walde ihr letztes Tageslied, und ich verstehe, was vor vier Jahrhunderten schon der Humanist und Dichter Petrarca schrieb: »Ich beneide alle jene, denen es gegönnt ist, nichts zu hören als das Brüllen der Herden, das Murmeln des Wassers und den Gesang der Vögel.«
Die Monika kommt zu mir herein und frägt, ob ich heute abend statt der Milch nicht Spargeln essen wollte. Mein Spargellieferant hatte noch eine Sendung ins Wolftal abgehen lassen, die vorgestern im Ochsen angekommen war.
Die verehrlichen Leserinnen werden bei dieser Meldung der braunen Monika denken: So, da haben wir den Kulturbeschimpfer. Er ißt Spargeln, und läßt sie sich nachschicken in die einsamsten Täler des Schwarzwaldes, dieser Lucull! Und dabei predigt er Einfachheit in Sitte und Leben und räsoniert über die Genußmenschen.
Liebe Leserin! Wenn die Kultur der Menschheit nichts Schlimmeres gebracht hätte als die Spargeln, so würde ich sie in Ruhe lassen, ja loben und jedem Bauer diese Kulturerrungenschaft gönnen. Bis jetzt ißt aber der »gemeine Mann« viel lieber Kartoffelschnitz als Spargeln, und unser Volk wird viel eher zu allen andern, schlimmern Kulturdingen verführt werden als zum Spargelessen.
Ich selbst esse sie nicht als Genuß; denn sie schmecken mir so wenig als einem jeden Bauersmann. Ich genieße sie als Medizin, weil man mir sagte, sie bekämen meinem Körper gut, und diesem Leib muß ich schmeicheln, sonst macht er mich zum Märtyrer.
Der Spargel ist zweifellos eine Kulturpflanze im raffinierten Sinn; aber warum soll die Kultur nicht auch einmal etwas produzieren, das unschädlich, ja selbst gesund ist!
Der Römer Plinius, der ältere, ein Mann erster Güte, Reitergeneral, Admiral und Gelehrter in einer Person, welcher die Hyperkultur seiner Zeit scharf geißelte, nennt jedoch das Spargelessen eine Schlemmerei. Er warnte mit seinen großen Zeitgenossen Seneca und Terentius Varro vergeblich vor der Verfeinerung und Verweichlichung des Lebens.
Aber in jener Zeit war die Spargelkultur zu übertrieben. In Ravenna hatten es Gärtner so weit gebracht, Spargeln zu züchten, von denen drei Stück ein Pfund wogen.
Im übrigen bin ich in alleweg der Meinung der genannten drei Römer, und wir deutsche Kulturmenschen könnten uns am Schicksal des Römervolkes ein Exempel nehmen.
Wann war des römischen Volkes größte Zeit? Als in den besten Tagen ihrer Republik die vornehmsten Frauen, die der Konsuln, Senatoren und Feldherrn, das Brot selbst buken, als es gar keinen Bäcker gab in der Weltstadt, und es durch Senatsbeschluß (vom Jahre 161 v. Chr.) verboten war, Geflügel zu mästen.
Aus jenen Tagen stammt der Grabstein einer Frau, der in unserer Zeit ausgegraben wurde und auf dem also geschrieben steht: »Hier liegt Amymone, die Frau des Marcus. Sie war gut und schön, eine fleißige Spinnerin, fromm, züchtig, häuslich und sparsam.«
Wenn man heute einer »besseren Kulturdame« den Leichenstein ehrlich beschreiben wollte, so müßte es heißen: »Hier liegt Lilli, die Gattin eines dummen Mannes. Sie war weder schön noch gut, eine fleißige Radfahrerin, ein Freigeist, möglichst viel außer dem Hause und hat für Putz und Vergnügen ausgegeben, was in ihre Finger kam.« –
Und wann ging das Römervolk unter? Als die Lebensverfeinerung und alle Laster, welche mit der Kultur in die Menschheit einziehen, ihre Orgien gefeiert und ihren Höhepunkt erreicht hatten. Da kamen die von der Kultur unbeleckten, in Tierfelle gekleideten germanischen Barbaren und schlugen alles kurz und klein, was die Kultur geschaffen hatte. Reich und Volk der Römer verschwanden.
Ich meine, es war der gleiche Plinius, der da gesagt hat: »Das erste Segelschiff, welches von den italienischen Küsten fortfuhr und mit fremden Erzeugnissen beladen heimkehrte, war ein Unglück.«
Man kann das gleiche von der ersten Lokomotive sagen, die auf den Schienen in die Welt fuhr und damit den Anfang machte, die »Segnungen der Kultur« überall hinzubringen. –
Die Monika hatte mir vergeblich frische Spargeln angetragen. Ich blieb bei der Milch, von der allein ich sicher weiß, daß sie mir auf die Nacht gut bekommt.
Eine nörgelnde Leserin könnte bei meinem Spargelessen und meiner strengen allabendlichen Diät auf den folgenden Gedanken kommen: Der Bücherschreiber im einsamen Häusle an der Wolf, der so oft schon gesagt hat, das Leben sei ihm gleichgültig und der Tod stets willkommen, geht so schonend mit seiner Gesundheit um, daß man das, was er über Leben und Sterben behauptet, nicht glauben kann.
Ich finde darin keinen Widerspruch; denn ich schone mein Leben und pflege meine Gesundheit, nicht weil ich den Tod, sondern weil ich die Krankheit und das Siechtum fürchte und dem letzteren vorbeugen will. –
Die Theologen sagen, die Krankheiten kämen von Gott als Strafe für die Sünden, und das gläubige Volk sieht sie darum an als eine »Schickung Gottes.«
Die alten Ärzte hielten bis ins 19. Jahrhundert herauf die Krankheit für ein eigenes Wesen, für einen Kobold, der sich im Leib bald da, bald dort festsetze und verjagt werden müsse, wie man eine Katze mit dem Stock aus dem Zimmer jagt.
Ich halte es weder mit den Theologen noch mit den alten Doktoren, sondern ausnahmsweise mit den »ungläubigen« Söhnen des Äskulap in der Neuzeit.
Krankheiten sind Störungen im Organismus unseres Leibes. Die Störungen können herkommen von eigenen Sünden oder von Sünden unserer Eltern oder Voreltern gegen die Gesetze unserer leiblichen Natur. Sie können aber auch von außen in unsern Körper eindringen, wobei die geringere oder größere Widerstandsfähigkeit abermals abhängt von unserer Leibesbeschaffenheit, die wieder bedingt ist von der Art unseres Lebens und desjenigen unserer Erzeuger und Ahnen.
Daß Gott Krankheiten schicken und heilen könne, wird kein Vernünftiger bestreiten; aber er wird beides meines Erachtens höchst selten tun.
Die eigenen Sünden sorgen schon für die nötige Leibesstrafe, und Gott rächt auch durch Krankheiten, die von selbst kommen, die Sünden der Väter bis ins dritte Glied.
Der göttliche Heiland sagt bei der Heilung des Blindgeborenen: »Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern seine Blindheit geschah, damit die Werke Gottes offenbar werden.«
Aus diesen Worten geht hervor, daß bei dem Blindgeborenen ausnahmsweise weder eine eigene noch eine ererbte Sünde vorlag.
Die obigen Worte der Heiligen Schrift wiederholte mein braver Vater in seiner langen Krankheit immer und immer wieder, weil er sich in seiner unwandelbaren Rechtschaffenheit nicht erklären konnte, warum er so lange leiden müsse. Und doch waren seine Leiden eine Folge von jahrelangen Erkältungen und ererbter Anlage. –
Die Redensart: »Es hat Gott gefallen, den und den aus diesem Leben abzurufen«, enthält oft, streng genommen, ein Unrecht, das man dem lieben Gott zufügt.
In gar vielen Fällen hat es Gott nicht gefallen, daß der oder jener Verstorbene durch eigene Schuld oder durch die seiner Eltern sein Leben dem Tod überliefern mußte. –
Auf all diese Gedanken wäre ich heute wohl nicht gekommen ohne die braune Monika mit ihren Spargeln, die mein Hoflieferant Nikolaus Heil in Graben-Neudorf ins Wolftal gesandt hatte.
Ich packe diese Kulturstengel aber in meinen Koffer und genieße sie »im Paradies«, in das ich morgen zurückkehre.
Hofstetten am 24. Mai.
Heute mittag bin ich wieder hier angekommen. Die stillen Tage im Schappe werden mir unvergeßlich sein. Ich schied aus dem kleinen Häuschen und von den guten Menschen, die ich da kennen gelernt, nicht ohne Wehmut. Der Ochsenwirt hat mich bis hierher begleitet und den Kutscher gemacht.
Im Herfahren besuchte ich in Oberwolfach noch den Pfarrer Knöbel, einen Freiburger, der zu gleicher Zeit mit mir im Konvikt war.
Schon auf dem Schwarzenbruch, der in seine Pfarrei gehört, hatte ich sein Lob verkünden hören.
»Unser Herr,« meinte der Moosbur, »predigt kurz und gut, daß man auch wieder heimkommt, und singen kann er, wie noch keiner ›in der alte Wolfe‹ gesungen hat.«
In seinem sonnigen Pfarrhaus, das eine liebliche Schau bietet in Berg und Wald und Tal, traf ich den biedern Kollegen, wie er eben an einer Federzeichnung arbeitete. Er ist nämlich nicht bloß im Singen, sondern auch im Zeichnen und Radieren ein Meister.
Das idyllische Leben eines Landpfarrers heimelte mich wieder an, und ich beneidete den Pfarrer von der alte Wolfe um den stillen Frieden in ihm und außer ihm. –
Im Weichbild der Hauptstadt des oberen Kinzigtales, in Wolfach, verließ ich den Wagen, um auch den dortigen Pfarrherrn Rieder zu besuchen. Er war noch Student, da ich als Vorstand der höheren Bürgerschule in Waldshut, wo sein Vater Oberamtmann war, fungierte. Heute ist er ein grauer Mann geworden, und die Fünfziger drücken auf seine Schultern. Aber er ist auch Dekan, steht auf der ersten Stufe der Hierarchie und bekleidet eine Würde, die mir nie zuteil werden würde, auch wenn ich das Alter eines Methusalem erreichte.
Zum Glück hat mich noch keine Stunde im Leben das Verlangen beseelt, irgend etwas auf der Leiter der katholischen Hierarchie zu werden. Ich bin zufrieden, daß ich nichts bin als der Pfarrer Hansjakob von Hasle. Und ich würde selbst das nimmer werden, wenn ich wieder auf die Welt käme, sondern ein simpler, ungebildeter Bäcker, wie meine Ahnen es gewesen sind. –
Kaum saß ich heute in dem hinter der Kirche versteckten Pfarrhäuschen zu Wolfe, als die Schwester des Pfarrers mit einer Champagnerflasche hereintrat und ihr Bruder anhub: »Sie haben in den siebziger Jahren einmal in Karlsruhe eine Wette eingegangen mit meinem Vater und dieselbe – sie galt eine Flasche Champagner – gewonnen. Oft sprach, solange er noch lebte, mein Vater davon, daß er Ihnen noch die Flasche Sekt schulde, und trug es mir auf, bei der ersten Gelegenheit diese seine Schuld abzutragen.«
Ich war nicht wenig erstaunt über diese Rede, erinnerte mich aber doch bald wieder der Wette und auch des Ortes, an dem sie gemacht wurde; sie geschah am Karlstor in Karlsruhe im Jahre 1878 und galt dem sogenannten Staatsexamen der Geistlichen, von dem ich behauptete, es würde bald fallen. –
So gerne ich ein Glas Champagner trinke, so wenig konnte ich es heute tun, weil es Morgen war und ich mir den ganzen Tag verderbe, wenn ich zu dieser Zeit etwas anderes trinke als Wasser oder Milch.
So blieb die Flasche uneröffnet; ich versprach aber, sie ein andermal zu trinken. Wenn's jedoch wieder so lange geht wie diesmal, bis ich das Pfarrhaus von Wolfe betrete, bleibt die Wette mit dem alten biedern Oberamtmann ungesühnt. Denn mehr denn dreißig Jahre lang hatte ich die Schwelle dieses Hauses nicht mehr überschritten, als ich heute eintrat.
Ich ließ mir alle Räume wieder zeigen, und es erfaßte mich tiefe Elegie, da ich jener Tage gedachte, die ich im Sommer 1864 hier verlebte, und der Lebenslust, die damals mich erfüllte. –
Vor dem Pfarrhause traf ich beim Weitergehen ein steinaltes Männle aus dem Spital, das mich, ich weiß nicht wie, erkannte und mir sagte, es sei bei meines Großvaters, des Eselbecken, Bruder, der in seiner Knabenzeit Pfarrer in Wolfe gewesen, in die Schule gegangen. Oft habe er denselben begleitet, wenn er bei der Kapelle von St. Jakob am Walde droben Meisen gefangen.
Daß mein »Großonkel«, dessen Porträt, vom »närrischen Maler« gezeichnet und koloriert, in meinem Besitze ist, auch Meisenfänger gewesen, hatte ich bis jetzt nicht gewußt, wohl aber wußte ich, daß der Eselsbeck diesem in jenen Tagen beliebten Sport ebenfalls oblag.
Damals fing man die Meisen im großen, zu meiner Knabenzeit schon im kleinen, und wenn die Kultur den Tierchen jeden Schlupfwinkel nimmt, gibt's bald gar keine mehr. –
Ich besuchte auch noch im Vorbeigehen Theodor, den Seifensieder, und seine Johanna, die heute ihren achtzigsten Geburtstag beging.
Verklärend, wie die Sonne in ihrem Stübchen, lag der Friede des Alters auf diesen zwei greisen Menschen, und ich dachte mir: Alt werden hat nur einen Sinn, wenn es einem vergönnt ist, so guter Gesundheit und so stillen Glücks teilhaftig zu sein wie diese Eheleute. –
Am Ende des Städtchens, im alten, fürstenbergischen Schloß, mußte ich noch dem Oberförster Geyer guten Tag sagen. Ich traf ihn in einem Zimmer, dessen Wände über und über bedeckt waren mit. Geweihen von Rehböcken, die der Nimrod im Kinzig- und Wolftal selber erlegt hat.
Kuriose Leute diese Jäger! Sie tapezieren die Wände ihrer Wohnungen mit den Merkmalen ihrer Mordtaten. Wie der wilde Indianerhäuptling prunkt mit den Skalpen seiner getöteten Feinde, so unsere Jägersleute mit den Geweihen unschuldig getöteter Rehböcke.
Wenn ich's befehlen könnte, müßten diese Tiertöter, so oft sie ausgehen, die Geweihe an ihre Kleider hängen, hinten und vornen und so viele Platz haben. Ich bin aber überzeugt, dies würde nicht abschreckend wirken, sondern manch einer, der sich mit keinem Orden schmücken kann, noch eine Ehre darein setzen, mit Rehhörnern dekoriert unter seinen Mitmenschen umherstolzieren zu können. –
Ich war ordentlich froh, als ich vor Wolfe draußen wieder beim Ochsenwirt auf dem Wagen saß; denn so viele Besuche an einem Morgen hab' ich in Freiburg in zehn Jahren nicht gemacht.
Das Besuchmachen gehört zu jenen Dingen, die mir aus ganzer Seele zuwider sind. Besuche machen heißt für einen vernünftigen Menschen leeres Stroh dreschen, und deshalb sollte diese Unsitte lediglich den Wibervölkern, die nichts Besseres zu tun wissen, überlassen bleiben. –
Der Ochsenwirt schied zeitig aus meinem Paradies, und ich machte noch einen Spaziergang. Die höhere Luftlage im Wolftal hatte scheint's meine Nerven etwas gekräftigt. Ich konnte im Wald »an der Steig« viel weiter hinauf gehen, als das in den letzten drei Jahren der Fall war.
Ich kam bis zu dem Buchwald, ärgerte mich aber sofort. Ein großer Teil dieses Waldes, welcher in der Frühjahrs- und Herbstzeit so viele Jahre meine Freude war, ist gänzlich abgeholzt, und an seiner Stelle sind junge Fichten angepflanzt.
Also auch hier, sagte ich mir, der verfluchte Zug der Zeit! Dieser Zug aber heißt: Geld! Ueberall, in Feld und Wald, in Haus und Hof, in Fabrik, Werkstätte und Kanzlei – ist das Geld die Parole. »Was trägt's?« »Was bekomme ich?« – das sind die Kardinalfragen im heutigen Leben.
Drum wird auch der Wald, der schöne, deutsche, stolze Wald, wie schon einmal gesagt, nur noch bewirtschaftet nach der Frage: »Was trägt er?« »Welche Holzart bringt am meisten Prozente?« Wir leben ja im Jahrhundert der Prozente und Dividenden. Und weil die Forstleute herausgerechnet haben, daß die Fichte und die Tanne eher sich rentieren als die Buche, wird diesem wunderbaren Waldbaum der Krieg erklärt.
Im Wolftal hat ein jetzt toter Förster alle Buchen in den fürstenbergischen Waldungen vertilgt, und im Schappe sind ihm bis heute die Bauern tapfer nachgefolgt. Jetzt tun's, wie ich mich heute überzeugte, auch die Hofstetter.
Was ist schöner im Frühjahr als ein Buchwald mit seinem frischen, fröhlichen Grün, durch das die Sonne herabzittert! Und was erhebt unser Herz im Spätherbst mehr als die sterbenden, goldenen Blätter der Buche. Ja selbst im Winter mutet uns der helle. Stamm und das weiße Geäste der Buche an.
Aber all diese Poesie, all diese Gemütserhellung hat kein Recht mehr auf Pflege in der heutigen Prozenten- und Protzenwelt. Drum muß auch der Buchenwald fallen im Schwarzwald.
Man bringt es mit dieser kalten Berechnung und mit dieser Gemütslosigkeit und Geldgier sicher noch so weit, daß die armen Teufel auf Erden auch kalt rechnen und meinen, es »rentiere sich besser«, andere totzuschlagen und ihre Habe an sich zu nehmen, anstatt mühsam zu arbeiten.
Am 25. Mai.
Es gibt doch noch edle Seelen unter den Wibervölkern! Heute kam mir ein Brief zu, in welchem mir eine meiner Leserinnen aus Amerika schreibt, sie möchte mir gerne einige Jahre ihres jungen Lebens schenken, damit ich noch länger Bücher schreiben könnte.
Ist das nicht hochherzig, und heißt das nicht glühende Kohlen sammeln auf dem Haupte eines Feindes!
Aber diese Schwärmerin ist auch kein normales Wibervolk. Wie sie mir mitteilt, lebt sie nur von Wasser, Früchten, Brot und Milch und geht in selbstgesponnenem, »ristenem Tuch« durchs Leben. Nur solche Entsagung mag zu solch einem Opfer befähigen.
Andere ihres Geschlechtes machen mir Vorwürfe über meine Bücher und wären froh, wenn ich zu schreiben aufhörte; diese Urwaldstochter aber möchte mit einem Stückchen eigenen Lebens das meinige verlängern, auf daß ich weiter schreiben könnte.
Was mir an dieser Amerikanerin imponiert, ist nicht etwa ihr unmögliches Anerbieten oder das darin liegende Wohlwollen für mich, sondern daß sie den Mut hat, vegetarianisch zu leben, und daß sie ihre Hemden selber spinnt.
Solche »Närrinnen« gibt's wenige unter dem schönen Geschlecht unserer Tage. –
Der Stube gegenüber, in welcher ich hier schreibe, steht der Speicher des Schneeballenwirts, d. i. das Häuschen, in welchem er seine Frucht, seinen Schnaps, seinen Speck und seine Schinken aufbewahrt.
Unter dem First dieses Häuschens befindet sich, wie ich bei meinem ersten Hiersein zu Anfang des Monats bemerkte, ein Vogelnest mit Jungen. Unermüdlich kamen und gingen die Alten, kleine Klettervögel, unter den Ziegeln aus und ein, um Futter zu holen und ihren Jungen zu bringen.
Auch heute schaute ich ihrem Eifer lange zu, und es kam mir der Gedanke: Wie emsig sind diese Tierchen bemüht, ihre Jungen zu ernähren. Kaum sind diese aber imstande, allein für sich zu sorgen, so verlassen und vergessen sie die Eltern, und diese können, alt geworden, sterben und verderben, ohne daß die Kinder ihnen Nahrung bringen.
Ist es im Menschenleben nicht ähnlich? Doch es scheint ein Gesetz der Natur zu sein, daß, wer einem Geschöpf das Leben gegeben, dasselbe auch erhalten muß. Die Kinder haben ihren Eltern gegenüber diese Verpflichtung von Natur aus nicht. Darum mußte die Religion eintreten und ein Gebot geben: »Du sollst Vater und Mutter ehren!« Ein Gebot: »Du sollst deine Kinder lieben und ernähren« – ist unnötig, weil das Naturgesetz dies schon verlangt und durchführt. –
In der Wirtsstube traf ich heute Musikanten aus dem Elztal. Sie hatten jenseits der Kinzig bei einer Hochzeit aufgespielt und waren auf dem Heimweg. Alle vier sind Brüder und alle Söhne eines musikalischen Schneiders, den ich noch wohl kannte.
Der »Schnidertoni us'm Prächt« hatte sechs Buben, und alle wurden wie er Dorfmusikanten und Spielleute. Einer brachte es gar zum Regimentskapellmeister. Ich kannte auch ihn.
Leider haben die überlebenden Söhne die Spielart des Vaters verlassen und machen jetzt zeitgemäße, unvolkstümliche Blechmusik. –
Am 26. Mai.
Heute las ich in der Frankfurter Zeitung, wie feierlich die Republikaner von Genf den König von Siam empfangen haben. Ein Dreiviertelsbarbar, in dessen Land das Wort Freiheit gar nicht gekannt ist, wird von kultivierten, europäischen Freistätlern fetiert! Wie muß der rohe, siamesische Tyrann sich freuen, wenn er sieht, daß freie Männer in Europa Bücklinge vor ihm machen wie seine Sklaven in Siam, und wie muß er sich deshalb bestärkt fühlen, in seiner Tyrannei zu beharren!
Aber es ist eben die alte Geschichte; es gibt wenig wahre Männer der Freiheit mehr unter den besseren Ständen in Europa. Wenn man noch Männer sehen will, die sich souverän fühlen und keinen Katzenbuckel machen vor den »Großen« dieser Erde, so muß man zu den Buren der »südafrikanischen Republik« gehen und zu ihrem Papa Krüger, der sich mit Recht al pari stellt mit jedem Fürsten altadeligen Stammes.
Die liebe Kultur, deren erstes Treibhaus sich in Europa befindet, macht eben keine Männer, sondern Sklaven. So waren auch die gebildeten Römer in den Zeiten ihrer entwickeltsten Kultur die elendesten Sklaven ihrer bluthündischen Kaiser.
Unsere Voreltern, die alten Germanen, nannten die Erde »das Männerheim«, und in jenen Zeiten war dies Wort am Platz; denn die alten Deutschen waren und blieben Männer, denen die Freiheit als das höchste Gut galt.
In unseren Tagen ist man oft versucht, Deutschland ein Heim von Byzantinern und Bedientenseelen zu nennen.
Es braucht bei uns einer nur ein Fürst zu sein oder ein hohes Amt zu bekleiden oder zu erlangen, und alsbald verwandelt sich alles rings um ihn, und wo immer er sich zeigt, in Schmeichler, Kriecher, Katzenbuckler und Lobredner.
Und jener ältere, deutsche Schriftsteller, der gemeint hat, in Italien wachse der beste Wein, in Rußland mache man das beste Leder und in Deutschland gerieten die besten Bedienten – hat nicht so weit daneben geschossen. –
Ich habe schon öfters darüber nachgedacht, ob nicht der Byzantinismus und der mit ihm zusammenhängende Bureaukratismus Früchte unserer »klassischen Bildung« wären. Ich sollte in dieser Meinung bestärkt werden.
Vor einigen Wochen hat ein mir persönlich unbekannter Schriftsteller, ein Dr. Grävell, in Brüssel wohnend, mir seine Broschüre geschickt: »Klassisch oder volkstümlich.« Leipzig, Verlag von Gustav Fock.
Ich habe schon viel gelesen, aber etwas Besseres nie als diese kleine Schrift, die mir voll und ganz aus der Seele geschrieben ist. Aufjauchzen hätte ich oft mögen beim Lesen derselben, um meinen Beifall zu dem darin Gesagten auszudrücken.
Schon öfters war ich versucht, zu glauben, ich sei der einzige närrische Mensch, der die Rückkehr zum Volke und zum Volkstümlichen predige. Drum freue ich mich jeweils doppelt und dreifach, wenn ich auch noch als » rari nantes in gurgite vasto« einen und den andern Mitmenschen finde, der die gleiche Ansicht hat und sie noch viel besser auszudrücken versteht als ich. Und zu diesen gehört Dr. Grävell.
Wie klassisch schildert er die Früchte der Abkehr vom Volk, und wie trefflich sagt er: »Das niedere Volk ist der ewige Quell, aus dem den höheren Ständen neuer Zufluß kommt, ohne den sie mit der Zeit versiegen würden, der natürliche Born der Poesie, der Jungbrunnen der Volkskraft!«
Und wie taxiert er unsere klassische Bildung mit ihren fremden Sprachen bei Vernachlässigung der Muttersprache so vortrefflich! »Nirgends,« sagt er, »findet man weniger gesunden Menschenverstand und selbständiges Denken als in Deutschland. Nirgends herrscht die Schablone so sehr vor und die Pedanterie. Das sind Folgen der klassischen Bildung, die den Geist des zehnjährigen Knaben durch die lateinische Grammatik in spanische Stiefel schnürt.«
Wie richtig bezeichnet er als die natürliche Basis jeder Schule – die Religion, die Naturwissenschaft und die Liebe zum Volke!
Mit vollem Recht sagt Dr. Grävell, die klassische Bildung, wie sie jetzt getrieben wird, trenne vom Volke und das sei ein Hauptübel.
Fürwahr, jeder, der ein bißchen Latein versteht und einige Klassen des Gymnasiums besucht hat, dünkt sich erhaben über das »dumme Volk«, über jenes Volk, dem allein er das bißchen Menschenverstand verdankt, das er aus den Windeln und aus der Hütte seines Dorfes mitgebracht hat.
Darum sagt Grävell ganz vortrefflich: »Der Gebildete sollte es sich zur Ehre anrechnen, mit dem Volke umgehen zu dürfen.«
Wie können alle unsere »gebildeten« Streber und alle vom Kastengeist erfüllten Beamten im Volk und für das Volk wirken, wenn sie dasselbe weder kennen noch lieben, ja in ihrem Bildungs- und Standeshochmut verachten!?
»Das Gymnasium«, schreibt Grävell, »erzeugt naturgemäß die Verachtung der niedern Stände« und damit, so sage ich, das Kriechertum und den Byzantinismus nach oben, wie wir ihn heute in vollster Blüte sehen, nicht bei den Bauern und Handwerkern, sondern bei den »Gebildeten«.
Unsere Zukunft ist großen Gefahren ausgesetzt, und diese werden um so größer und unbesiegbarer, je mehr man in den obern Ständen Volk und Volkstum verkennt, verachtet und vernachlässigt.
Ganz vortrefflich sagt Grävell in der Beziehung: »Wir brauchen und wollen Männer mit warmer Liebe zum Volk. Wir haben genug graue Theorie gehabt und unfruchtbare Gelehrsamkeit, Buchwissen und Phrasentum. Wir wollen Männer mit Rückgrat, mit Haaren auf den Zähnen, von praktischem Blick und idealem Streben, frei von Philisterhaftigkeit, Drückebergertum und Michelei.«
Wie weit wir aber noch entfernt sind von derlei Männern, möge daraus hervorgehen, daß die Schrift Dr. Grävells bei uns verlacht und verspottet und nur in einem Dutzend Exemplaren in Deutschland abgesetzt wurde. Und doch ist in den letzten fünfzig Jahren kein besseres und wahreres Buch in deutscher Sprache geschrieben worden als das seine.
Die Sozialdemokraten dürfen sich freuen, wenn solche Bücher und solche Mahnworte so wenig Gehör finden! –
Den Nagel auf den Kopf trifft Grävell auch, wenn er meint: »Es ist merkwürdig, daß trotz des veredelnden Einflusses der klassischen Bildung und der heiligen Philologie die Roheit der Jugend immer mehr fortzuschreiten scheint und daß seltsamerweise die klassischen Philologen, an denen man doch die Früchte der Beschäftigung mit dem klassischen Altertum greifbar erkennen müßte, nicht gerade durch Schönheit des Auftretens, Gewandtheit im Verkehr, Feinheit des Benehmens und Urbanität berühmt zu sein pflegen.« –
Man legt in unsern Tagen so großes Gewicht darauf, unsere Jugend patriotisch zu erziehen und für ihre Nation zu begeistern. Aber, und da hat Grävell abermals recht, die deutsche Poesie, das deutsche Volkslied und die deutschen Heldengedichte, die mächtigsten Hebel zu der erwünschten Begeisterung lernt der junge Kulturgermane nur sehr wenig oder, richtiger, gar nicht kennen auf der Schule, wohl aber die Epen und Oden der Griechen und der Römer.
Ich bin überhaupt der Ansicht, daß man auf den Gymnasien nicht mehr als zwei oder drei Jahre Latein und Griechisch treiben sollte; denn was der Gebildete später von diesen zwei Sprachen ins Leben rettet, geht doch nicht über die Kenntnis des heutigen Tertianers oder des alten Quartaners hinaus.
Man gebe in den oberen Klassen eine gute Literaturgeschichte der Römer und Griechen mit Proben in deutscher Übersetzung und gehe mit den Primanern Friedländers klassisches Werk, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, durch, und sie werden weit mehr fürs Leben behalten und profitieren als von all dem heutigen Lesen der schwierigeren Klassiker. Bei dieser klassischen Lektüre trocknen die Grammatik und die Silbenstecherei wie ein Wüstenwind jede Freude am Inhalt aus und zerstören und machen dem Gymnasiasten die Schule zur Hölle.
Wie der preußische Drillunteroffizier dem Rekruten die Kaserne entleidet und das Soldatenleben, so verbittert der pedantische Schulfuchser in Latein und Griechisch dem jungen Menschenkind das »Studieren«.
Es ist jammervoll, wenn man hört, mit welchen lächerlichen Kleinlichkeiten die heutigen Philologen sich abgeben.
Seit einem Jahrzehnt müssen die Buben in den Gymnasien im Lateinischen statt » Nazio«, wie man seit Jahrhunderten las, lesen » na– ti– o«. Diese Lesart ist irgendeinem verrückten lateinischen Schulmeister eingefallen, und flugs wird sie eingeführt.
Die Italiener, welche dem Römertum und den alten Lateinern wahrlich näher stehen als die heutigen Philologen, sagen » nazzione«; also sprachen die Römer zweifellos » nazio«. Aber ein deutsches Pedantengehirn weiß das besser.
Solange auf unsern Mittelschulen derlei Dummheiten eingeführt und geduldet werden, gelangen wir zu keinem echten Deutschtum trotz des Deutschen Reiches, seiner Macht und seiner Größe.
Der alte, deutsche Pädagoge Diesterweg sagt einmal: »Wir kommen zu keinem kräftigen Volksleben, wenn unsere Bürger abgestumpft werden durch fremde Dinge. So lange wird es mit dem deutschen Volke nichts, so lange man das Griechen- und Römertum abgöttisch verehrt.«
Aber angesichts solcher Erscheinungen, wie na– ti– o, sind wir noch weit entfernt von jener Zeit, welche der gleiche Diesterweg prophezeit: »Es wird eine Zeit kommen, wo ein deutscher Mann das Deutschtum, deutsche Volkstümlichkeit ehrt und achtet und das Franzosen-, Griechen- und Römertum in die Dachstuben einiger Gelehrten verdrängt; eine Zeit, in der unsere künftigen Bürger und Vaterlandsverteidiger deutsch schreiben, deutsch fühlen und deutsch – deutsch sein lassen. Diese Revolution wird eine der größten, eine der mächtigsten sein, die je die Welt erfahren hat, und eine der wohltätigsten.«
Es könnte diese Revolution niemand freudiger begrüßen als ich; aber ich glaube viel eher an die soziale Revolution als an eine im Sinne Diesterwegs, des braven, deutschen Mannes. –
Wenn Wendel, der Roserbur und mein Leibkutscher, wichtige Geschäfte hat im Feld, so lasse ich mir zum Spazierenfahren einen Wagen von Hasle kommen. Die Frau Schick beim Sebastianibrunnen sendet mir dann ihren flotten Braunen und ihren tadellosen Kutscher, den Sepp.
Der Sepp ist aus dem Fischerbach, jener Tal- und Berggemeinde, in der ich einst jeden Menschen kannte. Drum kannte ich auch meines Kutschers Vater, »den großen Toni«, einen stillen, arbeitsamen Mann, der ein kleines Gütle bebaute unweit der einstigen Burg des Ritters Töbelin von Fischerbach.
Auch des Tonis Bruder kannte ich, den »Schnaps-Jörgle«, der viele Jahrzehnte auf dem Hechtsberg Schnaps brannte und alle Welt mit »Chriese-Wasser« versorgte.
So haben mein zweiter Kutscher, der Sepp, und ich Anknüpfungspunkte genug, wenn wir während unserer Fahrten diskurrieren wollen.
Ich fuhr heute nachmittag mit ihm von Hasle am rechten Kinzigufer hinauf nach Gutach. So oft ich auch schon diesen Weg gemacht, er ist mir immer neu und immer lieb.
Ich sehe da noch die alten Höfe in Eschau, in denen ich als Knabe aus- und einging, ihre prächtigen Kollegen im Gächbach und in der Frohnau, und im Gutacher Tal erfreuen mich die Bewohner durch ihre kleidsame Volkstracht und durch das treue Festhalten an derselben.
Die Gutacher Frauentracht ist zweifellos die schönste im ganzen Schwarzwald; drum haben sich auch die hervorragenden Maler und Illustratoren Hasemann und Liebich bleibend da niedergelassen. Ich traf aber heute keinen in seinem Atelier.
Im »Löwen«, wo ich in jungen und alten Tagen schon so manche heitere Stunde verlebte, ist Trauer eingezogen. Der junge Wirt ist tot, seine Frau todkrank, und sein Vater, der alte, biedere Mann, bei dem ich als Student schon einkehrte, erblindet. –
Auf der Rückfahrt am linken Flußufer hinab fiel mir auf, daß das naßkalte Wetter der vergangenen Tage den vielen Kirschbäumen am Wege hin großen Schaden gebracht hatte. Als ich vor wenig Wochen in den Schappe fuhr, stunden sie noch vielverheißend in voller Blüte.
Der Kinzigtäler Bur, dem die Kirschenernte viel ausmacht, ist wieder um eine Hoffnung ärmer.
Man hört so oft sagen, Mißwachs und Mißernten seien Strafen Gottes. Ich frage aber: Wer wird von diesen Strafgerichten am meisten getroffen? Und antworte: Das brave, gläubige, arbeitsame Landvolk, welches täglich zu seinem Gott betet und am Sonntag seinem Dienste gewissenhaft obliegt.
Den leichtlebigen Stadtmenschen, den gottlosen Wucherern, den glaubenslosen Geldmenschen schadet weder das Hagelwetter, noch der Frost, noch der Mißwachs.
Es hagelt und regnet den Großkapitalisten, die nur einem Gotte dienen, dem Mammon, nicht in ihre feuerfesten Kassenschränke. Sie leben üppige und vergnügte Tage, ob gute oder schlechte Jahre im Lande sind, während das brave Volk, welches im Schweiße seines Angesichts den Boden bebaut, oft hungert und darbt.
Fürwahr! Wenn wir keine anderen Gründe hätten, an ein besseres, jenseitiges Leben zu glauben, wir müßten ein solches annehmen allein um des armen Volkes willen.
Dieses Volk wird hienieden von »den besseren Menschen« ausgesogen, belogen, betrogen, mißregiert und hat daneben noch alle Schläge der Elemente, alle Kriegsschäden und Heimsuchungen teils ausschließlich, teils größtenteils zu tragen, während es meist allein noch an Gott glaubt, ihn ehrt und ihm dient.
Aber um seines Gottesglaubens willen und der Hoffnung wegen auf ein besseres Leben trägt eben das Volk diese Lasten und Heimsuchungen in Geduld. Man nehme dem Landvolk diesen Glauben und diese Hoffnung, und es wird sich keine Stunde besinnen, sozialdemokratisch zu werden, und das von Rechts wegen.
Am 27. Mai.
Es ist Himmelfahrtstag heute. Die Prozession der Hofstetter zieht wieder an meinen Fenstern vorbei wie voriges Jahr am gleichen Feste.
Warum geht das Landvolk heute allüberall in katholischen Gegenden mit der Bittprozession? Weil es glaubt, daß der Herr Jesus von den Toten auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, und daß er dort lebt als unser ewiger Mittler und Fürsprecher.
Darum bittet das Volk auch in der Litanei des Tages Gott um seinen Segen und um seine Gnade in allen leiblichen und geistigen Anliegen.
Es betet, daß der Herr den ausgestreuten Samen segnen, den Arbeiten des Landmanns Gedeihen schenken, die Früchte der Erde geben und bewahren, Blitz und Hagel von Haus und Flur abwenden, den christlichen Völkern und Fürsten Frieden und Eintracht verleihen wolle.
Es betet aber auch um Geduld in Unglück und Heimsuchung und daß der Herr Jesus es vor ewigem Verderben erretten und ihm eine Wohnung im Hause seines Vaters zubereiten wolle.
Wie turmhoch steht so das Volk mit seinen religiösen Prozessionen und Litaneien an Idealismus und Erhabenheit über den sonst üblichen Festen und Umzügen, wie Sänger, Turner und Studenten sie halten!
Und doch würden sich Menschen dieser Sorte, die stolz aufmarschieren bei ihren nichtssagenden Prozessionen, schämen, einer Bauernprozession sich anzuschließen. Ja, sie spotten noch, diese Helden, über die Prozessionen. –
Heute nachmittag kam der Kapellmeister von Hasle, Otto, der Schmied, nach Hofstetten und besuchte mich. Er erzählte von den Strapazen, die er zur Zeit in seiner Eigenschaft als Kapellmeister mitzumachen habe.
Er sei deshalb genötigt gewesen, »im Blättle« bekanntzugeben, daß er »wegen der vielen Hochzeiten, Morgensuppen, Tanzmusiken und wegen des auf diese folgenden Katzenjammers seine Schmiede auf einige Zeit schließen müsse.«
Wir sehen, der Haslacher Humor ist noch nicht am Aussterben, und Otto, der Schmied, kann sich so was leisten; denn er ist ledig und hat nur für sich und seinen Durst zu sorgen.

Von seinem Großvater, dem Bäcker Fischinger in der Vorstadt, erzählte heute »die Kapell'« noch eine mutige Tat, die mir neu war. Als Jourdan, mit seinen Horden 1799 bei Stockach geschlagen, dem Rhein zueilte. lag beim Nachbar des Bäckers, beim Schmied Isele, den ich noch gar wohl kannte, ein Franzose im Quartier. Der sah am Abend den stattlichen Bäckermeister vor seinem Hause sitzen in seinen mit silbernen Schnallen gezierten Schuhen.
Diese reizten den Franzmann, und er ging hinüber, um dem Brotmann die Schuhe abzuziehen und zu nehmen; eine Manipulation, welche damals die schlechtbeschuhten Rothosen gerne vornahmen.
Der Bäcker wehrt sich und überwindet den Soldaten, der ohne Schuhe abziehen muß, aber mit »Kaputtmachen« droht.
Nachts, da der Bäcker in seiner Backstube hantiert, hört er ein Geräusch. Er denkt an die Drohung des Franzosen und holt, da er Jäger ist, sein Gewehr. Kaum ist er mit diesem bewaffnet, so steht der Soldat vor ihm und legt an. Der Bäcker, nit faul, tut das gleiche, und der Franzmann liegt, zum Tod getroffen, zu seinen Füßen.
Im Keller begräbt er ihn und legt ein halbes Klafter von seinem »Bachholz« auf die Grube.
Am andern Morgen ziehen die Franzosen weiter und keiner fragt nach dem, der im Keller des Bäckers liegt.
In der folgenden Nacht gräbt dieser die Leiche wieder aus und gibt ihr ein Grab in seinem Garten hinter dem Haus.
Doch der Hund des Nachbars, des Engelwirts, begann an dem neuen Grab zu scharren und konnte so leicht zum Verräter werden. Der Bäcker erschoß darum auch den Hund.
Jetzt hatte der Franzose Ruhe; der Erschießer aber bewahrte sein Geheimnis bis in sein hohes Alter, und erst dreißig Jahre später gab er es zum besten.
Ich erinnere mich wohl, anfangs der vierziger Jahre den alten Bäcker-Waidele, wie er nach einem seiner Vorfahren genannt wurde, noch gesehen zu haben, einen Mann mit großen Augen und ernsten Zügen, wie er auf der Bank vor seinem Hause saß in seinen Kniehosen und Schnallenschuhen. –
Sein Enkel teilte mir noch mit, daß er demnächst das Schmiedhandwerk aufgeben und sein Haus einem Neffen, der Metzger ist, überlassen würde.
Er selbst wolle dann nur noch der Frau Musika und seinem Vergnügen leben. Ähnlich seinem verstorbenen Freunde »Waldteufel« will er müßige Stunden im Urwald zubringen und in des »Sandhasen Hütte«.
Dieser Waldteufel, ein lediger Hutmacher, streifte in seiner freien Zeit mit Vorliebe im Wald herum und in des Waldes düstern Gründen, ganz allein. Oft blieb er, wie einst der »närrische Maler«, in dessen Waldhütte über Nacht.
Als er ziemlich jung sterben mußte, sandten ihm die poesievollen Haslacher vom Urwald herab Böllerschüsse nach ins Grab, und zu seinem Andenken gaben sie einer alten Eiche, unter welcher der Waldteufel gerne saß und ins Tal hinabschaute, den Namen »Waldteufel-Eiche«.
An ihrem Fuße nun soll, wie Otto, der Schmied und Kapellmeister, mir heute sagte, sobald er sein Handwerk aufgegeben habe, sein Amboß auf einem Steinsockel als Monument aufgestellt werden. Dies Monument wird eine Erinnerung sein an ihn und seinen Vater, die auf dem Amboß schmiedeten und nebenbei als Kapellmeister funktionierten.

Alle Handwerker, die zur Herstellung des Denkmals vonnöten sind, haben bereits unentgeltlich ihre Arbeit zugesagt.
Ich müßte die Haslacher schlecht kennen, wenn nicht das Amboß-Denkmal, noch ehe dies Buch in die Welt tritt, am Urwald oberhalb Hasle erstellt wäre. –
Ich hab' mich nicht getäuscht. Da ich dies Büchlein korrigiere, ist das Monument schon errichtet, und eine eherne Tafel besagt:
Ein Schmied und Junggeselle,
Genannt nur die »Kapelle«,
Faßt den Entschluß
Als Musikus,
Dem Handwerk zu entsagen.
Und wie gesagt, so er auch tut,
Sein Amboß hier in Frieden ruht.
Bei Hörnerschall und Becherklingen
Mög' er noch lang den Taktstock schwingen. –
Als die »Kapell'« heute fort war, saß ich noch einige Zeit mit dem jungen Dorfschmied, dem Wendel, auf dem Steingeländer der Brücke über den Dorfbach. Er gebrauchte im Laufe unseres Gesprächs ein Wort, das mir ebenso neu als zutreffend erschien. Er hatte von einem jungen Weib gesprochen, das mit seinem Mann nicht auskomme, und meinte dann: »Die Wibervölker sind eben alle kurzrätig,« womit er sagen wollte, sie hätten wenig Verstand und Überlegung.
Ich finde diesen Ausdruck unseres Dorfschmieds durchaus originell und der Wahrheit und Wirklichkeit ziemlich nahekommend. Gescheite Frauen sind gottlob so selten wie weiße Raben. Aber das ist kein persönlicher, sondern ein Naturfehler; die Frauen können also nichts dafür und der Schöpfer wird wohl wissen, warum es nötig war, sie »kurzrätig« zu schaffen.
Mir schrieb vor kurzem eine Leserin meiner Bücher im Lande Bayern, sie kenne einen Herrn, der noch weniger gut als ich von den Wibervölkern rede und der Ansicht sei, die zwei Haupteigenschaften eines weiblichen Wesens müßten und sollten sein – »gesund und dumm«.
Ich wage es nicht, dem Herrn völlig recht zu geben, um es mit meinen Leserinnen in meinen alten Tagen nicht ganz zu verderben. Doch meine ich, der Schmied von Hofstetten und der Herr aus Bayern hätten nicht weit voneinander feil.
Soviel ist aber sicher, daß eine gescheite Frau einen dummen Mann haben muß, wenn es »einen guten Klang« geben soll, und dann leistet sie, völlig am Regiment, oft im größten Geschäft so viel als ein tüchtiger Mann.
Am 28. Mai.
Diesen Morgen kam der Markus vom weißen Brunnen, ein zehnjähriger Knabe, und brachte mir, auf dem Weg zur Schule, wie voriges Jahr einen Strauß von Maiblumen.
Ich fragte ihn, ob er lieber einen Helgen (Heiligenbild) oder einen Wecken als Gegengabe wolle. Er entschied sich sofort für den Helgen und zeigte dadurch einen Idealismus, der sonst Knaben nicht eigen ist. Als Belohnung bekam nun der wackere Markus beide Dinge.
Kurz vor Mittag kam meine alte Freundin, die Fev, Büre auf dem Tochtermannsberg, im Sonntagsstaat von Hasle her, um in den Schneeballen zu rasten, und dann vollends heimzukehren.
Sie erzählt mir auf mein Befragen, wo sie herkomme: sie sei diesen Morgen schon um vier Uhr vom Berg herab durch Hofstetten gewandert auf dem Weg nach Biberach, um die »vierzehn heiligen Nothelfer« anzurufen.
Sie ist nüchtern daheim fort, hat drunten in Biberach gebeichtet und kommuniziert, ist nüchtern wieder hierhergelaufen und hat im ganzen einen Weg von sieben Stunden gemacht. Alles zu Ehren der genannten Heiligen.
Und warum? Ihr einziger Bua, der Xaverli, ist krank und will nit einnehmen, was der Doktor ihm verschrieben. Drum hat sie die Wallfahrt gemacht, damit die vierzehn Heiligen helfen, auf daß der Xaverli seine Medizin nehme und wieder gesund werde.
Die Fev hat schon längst mein Wohlgefallen, weil sie eine tüchtige Büre und ein kluges Weib ist, das den Hof regiert, und weil sie treu zur alten, schönen Volkstracht hält.
Aber heute, da sie mir von ihrer mühseligen Wallfahrt erzählte und von deren Veranlassung, bekam sie meine Bewunderung. Ihr Büble ist krank; sie ruft den Arzt, dessen Hilfe der Kranke verschmäht. Alles Zureden nützt nichts. Da geht die Mutter unter Fasten und Beten wallfahrten. Sie reinigt sich von Sünden durch die Beicht, empfängt den Leib des Herrn, um der Erhörung würdiger zu sein, und bittet dann die heiligen Nothelfer, den Xaverli auf andere Gedanken zu bringen.
Ein Schaf oder sonst ein gedanken- und poesieloses Geschöpf muß der sein, welcher die Tat dieser Büre nicht begreift und nicht zu würdigen weiß!
Sie hätte ja auch im stillen Kämmerlein zu Gott beten können. Zweifellos. Aber ist der weite Weg, unter Entsagung gegangen, und der Empfang der heiligen Sakramente nicht ein viel größeres Mittel, die Huld Gottes zu gewinnen?
Aber wozu die Nothelfer, da man ja direkt sich an Gott wenden kann?
Das Christentum ist in allweg in wunderbar göttlicher Art unserer menschlichen Natur angepaßt; deshalb hat Gott auch in erster Linie diese Natur angenommen. Und überall finden wir im christlichen Glauben Rücksicht genommen auf menschliche Bedürfnisse, Gewohnheiten und Anschauungen. Darum auch der große Einfluß desselben auf unser Herz und auf unser Gemüt.
Wir Menschen sind gewohnt, in den Nöten dieses Lebens Helfer zu suchen und nicht bloß in den Nöten, sondern bei jedem Wunsch, den wir gerne erfüllt sehen möchten, aber allein nicht erreichen können.
Demjenigen, der die Erfüllung dieses Wunsches und die Hebung unserer Not in Händen hat, sagen wir es gar oft nicht gerne selbst. Drum nehmen wir andere zur Hilfe, die bei ihm was gelten und mehr gelten als wir.
Das Kind geht zur Mutter, wenn es vom Vater etwas will, damit sie Fürbitte einlege.
Erwachsene Leute, die von einem Höheren was wollen, gehen zu dessen Freunden und Vertrauten und tragen diesen ihre Not vor.
Tagtäglich kommt dieses Suchen von Nothelfern in unzähligen Formen vor in der menschlichen Gesellschaft, und vieles im Leben wird nur erreicht durch Protektion und Fürbitte.
Das gläubige Volk aber verlacht man, wenn es in höheren Anliegen, und wo menschliche Hilfe nicht zureicht, Nothelfer sucht, die ein gutes Wort einlegen beim Herrn des Himmels und der Erde, dessen Wohlgefallen sie haben und dessen Freunde und Vertraute sie sind als Heilige.
Ist es nicht menschlich, so zu tun, und kommt diesem menschlichen Bedürfnisse der Glaube an die Fürbitte der Heiligen nicht in wunderbarer Art entgegen?
Wie armselig sind oft die Wünsche, für deren Erfüllung die Menschen Nothelfer suchen! Der eine möchte einen Orden, der andere einen Titel haben vom Landesfürsten und sucht dazu Fürsprecher. Beide armselige Streber spotten aber, wenn sie hören, daß ein Bur oder eine Büre zur Mutter Gottes oder zu einem Heiligen wallfahrten gegangen sei für ein krankes Kind oder gar für ein sieches Stück Vieh. Und doch ist es viel wichtiger, daß ein Bauernbüble wieder gesund wird, oder dem Bauer ein Stück seiner lebenden Habe erhalten bleibe, als daß irgendein eitler Geck einen Orden oder einen Titel bekomme.
Ich hab' einst einen Minister gut gekannt. Ein akademisch gebildeter Herr erfuhr das und schrieb mir, ich sollte ihn dem Minister für einen Orden empfehlen. Mit Verachtung warf ich den Brief in den Papierkorb. Ich frage aber: Steht die Büre vom Tochtermannsberg, die zu den heiligen Nothelfern wallfahrtet, damit »der Xaverli Medizin nehme«, nicht turmhoch über dem alten Kindskopf, der einen Nothelfer suchte, um einen Orden zu bekommen?
Aber wie hören die Heiligen das Gebet zu ihnen, fragen spöttisch die Ungläubigen. Ich sage, wenn selbst ein so freisinniger Philosoph wie Hartmann von einem Telephonanschluß ins Unbewußte spricht und in einer Zeit, in der es drahtlose Telegraphie gibt, sollte man die Möglichkeit, daß die Heiligen uns hören, nicht bestreiten. –
In meine Hütte nahm ich heute ein Buch mit, in welchem ich noch nie gelesen. Es enthält, von Paul Heyse übersetzt, die Gedichte und Prosaschriften des italienischen Poeten Leopardi, des Sängers des Pessimismus.
Wenn einer wie ich zu Schwermut und Pessimismus veranlagt ist, wird ihm Leopardi vielfach aus ganzer Seele schreiben und dichten. Drum war es mir eine gewisse Wonne, in die schauerlichen Abgründe hinabzusteigen, die der Weltschmerz dieses Dichters in seinen Versen auftut. Es ist grauenhaft schön, zu lesen, wie ein Genie mit gewaltiger Sprache sein Unglück und seine Verbitterung in die Welt stöhnt und wie richtig er diese Welt selbst beurteilt.
Wie spottet Leopardi dem Wahne eines goldenen Zeitalters hienieden und dem Hoffen auf bessere, glückliche Tage! Wie wahr ist's, wenn er sagt:
Frechheit und Tücke werden
Stets herrschen nebst der Mittelmäßigkeit
Und obenauf sein Herrschaft und Gewalt.
Ob du sie wenigen wünschest oder vielen,
Mißbrauchen wird sie stets, wer sie besitzt,
Wie er auch heiße. Diese Satzung gruben
Natur und Schicksal einst in Diamant,
Und nicht mit ihren Blitzen löschen sie
Volta und Davis aus und nicht mit seinen
Maschinen England, nicht mit einem Ganges
Von Leitartikeln diese neue Zeit.
Stets wird der Gute trauern, stets der Wicht,
Der Schuft frohlocken. Erd' und Himmel werden
In Waffen immer gegen hohe Seelen
Verschworen sein. Der wahren Ehre folgt
Verleumdung, Haß und Neid. Der Starke zehrt
Den Schwachen auf. Der Hungrige front
Und dient dem Reichen stets, in welcher Form auch
Der Staat regiert wird; nah und fern den Polen
Und der Ekliptik wird's unwandelbar
So sein, solang der Mensch auf Erden wohnt
Und ihm des Tages Fackel nicht erlischt. –
Wie oft saß ich schon in dieser Hütte und schaute wehmütig das Tälchen hinaus, an dessen Ende Hasle liegt und seine Wälder und Fluren, und suchte die Träume der Jugendzeit heraufzubeschwören.
Heute lese ich bei Leopardi:
In Tälern, wo das Lied
Des fleiß'gen Landmanns hinterm Pflug ertönt
Sitz' ich versenkt in Sehnen
Nach meinem Jugendtraum, der längst entfloh'n
Und an einer andern Stelle:
Oh, all ihr Hoffnungen, du holder Trug
Der Jugendtage! Immer kehrt die Seele
Zu euch zurück. Denn wie die Zeit eilt.
Wie sich Gedanken und Gefühle wandeln.
Niemals vergeß ich euch.
Hätt' ich, da meine erste italienische Reise mich an dem Städtchen Recanati in der Mark Ancona vorüberführte, schon gelesen gehabt von Leopardi, was ich heute las, so wäre ich ausgestiegen und hätte seine Vaterstadt besucht.
Der Dichter starb im gleichen Jahre, da ich geboren ward, und hatte jedenfalls keine Ahnung davon, daß sechzig Jahre später ein alter Schwarzwälder, unter einem Strohdach am Waldrande sitzend, sich erfreue an seinen Gedanken. –
Am 29. Mai.
Über den Berg aus dem Elztal herauf zogen heute vormittag Bauern aus dem Renchtal. Sie begegneten mir im Walde und hatten Vieh geholt, das sie jetzt durchs Kinzigtal in ihre Heimat transportierten.
Die wackeren Renchtäler halten noch wie wenige Männer des Schwarzwalds an der Tracht ihrer Väter fest, und von ferne schon leuchteten mir ihre hellroten Brusttücher entgegen, da sie den Wald herab auf mich zukamen.
Wie sie mir erzählen, brauchen sie die Tiere den Sommer über zum Zug, machen sie im Herbst etwas fett und verkaufen sie an die Metzger.
Auf meine Frage, was sie dann profitierten, sagten sie mir, 100-200 Mark am Paar.
Das gleiche bestätigte mir auch der Schneeballenwirt, der es ähnlich macht mit seinen Stieren.
Aber so ist's beim Bauernstand überall: viele Mühe, große Arbeit, mannigfaltige Lasten und wenig »Dividenden«.
Reiche Leute und Profitmenschen muß man in unserer Zeit nicht auf dem Lande suchen. Die Industrie allein macht Millionäre und ruiniert nebenher den Bauer.
Doch so ist nun einmal der Welt Lauf; den Besten geht es am schlechtesten. Der Bauer ist der beste Christ, der beste Untertan, der beste Soldat, der beste und fleißigste Arbeiter und in alleweg der Jungbrunnen der Menschheit, aus dem sie geistig und leiblich neues Leben schöpft, und ihm geht es am schlechtesten. Er hat für seine Mühe und Arbeit geringen Lohn und für seine Treue und seine Leistungen keine Anerkennung und kein Ansehen.
Halt! Der Bauer hat Ansehen gewonnen in letzter Zeit; man nennt ihn staatlicherseits »Landwirt«, und auf den Diplomen, welche die landwirtschaftlichen Feste für schönes Vieh und beste Früchte ausstellen, heißt es gar: »Herr N. N., Landwirt.«
Und es gibt bereits Bauern, die sich den letztern Titel mündlich und schriftlich beilegen. Sooft ich aber einen derselben sich selbst so nennen höre, denke ich mir hinter dem Worte »Landwirt« stets noch zwei andre, und die heißen: »und Esel«.
In Wahrheit! Ein Bauer, der sich dieses schönen, alten Namens schämt, ist und bleibt ein Esel. Einst nannten die Städter sich stolz mit diesem Namen, und im alten Wappen von Köln stunden die Worte: »Halt fast am rîch, du köllnisch bur!«
Und Luther übersetzte die Worte des Alten Testaments im Buche der Richter: »Es fehlten die Tapfern in Israel«, vortrefflich mit: »An Bauern gebrach's Israel«; denn die Bauern sind die Kraft und Stärke eines Volkes in alleweg.
Und durchs ganze Mittelalter ging das wahre Sprichwort, das heute vergessen wird: »Bauern machen Fürsten«.
In unserer Zeit kann man sagen: »Fabriken machen Millionäre und Revolutionäre«. Und doch geht die Industrie dem Bauernstand in unserem heutigen Staatsleben vor. –
Also, ihr Bauern, schämt euch eures Namens nicht, seid stolz darauf; denn ein rechter Bauersmann ist mehr wert für die menschliche Gesellschaft als ein protziger, herzloser Millionär!
Hocherfreut war ich, in diesen Tagen zu lesen, der »Hunsrücker Bauernverein« habe beschlossen, seine Mitglieder sollten sich in Zukunft und alleweg »Bauern« nennen und schreiben.
Man überlasse das Wort Landwirt den sogenannten Herrenbauern und den Rittergutsbesitzern und den Ochsen-, Blumen- und Sonnenwirten auf den Dörfern; denn die letzteren sind Landwirte in des Wortes eigenster Bedeutung. –
Es wird in unsern Tagen viel Unfug getrieben mit dem Worte »Herr«. Ich habe anderorts schon davon gesprochen. Noch im 18. Jahrhundert war der Titel »Herr« so rar, daß erst 1794 durch eine kaiserliche Verordnung die Universitäts-Professoren der österreichischen Staaten zu »Herren« und ihre Weiber zu »Frauen« erhoben wurden.
Heute gibt's überall nichts als Herren und Damen. Die kleinen Buben sind junge Herren, und jede Nähmamsell zählt unter die Damen. Und alles will »Herr« sein, der Lehrbub, der Geselle und der Meister. Drum so viel soziale Gefahren. Wenn nun auch noch der Bauer durch den Titel »Herr Landwirt« zu dem Glauben kommt, er sei ein Herr, dann können die eigentlichen Herren ihre Bündel schnüren.
Mir gefällt der Titel »Bürger«, den die französische Revolution erfand, sehr wohl; selbst der »Genosse« der heutigen Sozialdemokraten ist vernünftiger als das in seiner Allgemeinheit sinnlose »Herr«. –
Als ich aus dem Walde heimkehrte, begegnete mir ein Hochzeitsläder. Er kam aus dem »Ullerst« und »vom Flachenberg« her, hatte einen roten Strauß auf dem Hut und unter demselben, wie es bei einem richtigen Hochzeitsläder Brauch ist, etwas zu viel.
Erst nachdem er seinen Spruch getan und mich eingeladen hatte »zu's Kienzle-Andresen im Welschbollenbach und zu's Keller-Sepples Marie us'm Mühlenbach Hochzit – in d' Kirch, us der Kirch' und ins Wirtshus, ins Kriz in Bollenbach« – erkannte ich den Läder. Es war der Kolmännle aus dem Mühlenbach.
Er ist ein armer Taglöhner und trägt den jetzt seltenen Namen des Patrons von Österreich, des heiligen Märtyrers Kolomann.
Er nennt nichts sein eigen als ein Weib und viele Kinder. Die Zahl der letzteren zwang ihn schon in schlechten Zeiten, die Unterstützung der Gemeinde anzurufen.

Der Bürgermeister meinte, der Kolmännle habe auch gar so viele Kinder. Da meinte das arme, kleine Männle trotzig: »Über die Zahl der Kinder laß ich mir keine Vorschriften machen; denn sie alle stammen aus dem heiligen Ehestand, der das mit sich bringt.« –
So klein er ist und so schwächlich, ebenso kräftig trägt er seinen Hochzeitsspruch vor; stolz wie der Herold eines Weltenkaisers tut er seine Pflicht als »Hosigläder«.
Des Hochzeiters, des Kienzle-Andresen Großvater hab' ich noch gar wohl gekannt. Er kam, als ich noch ein Knabe war, oft in meines Vaters Wirtsstube und war ein schwarzer, heiterer Bur.
Jetzt heiratet schon sein Enkel und erinnert mich durch den Kolmännle an den Flug der Zeit. –
Diesen Nachmittag führte mich der Fabrikant und Reichsbote Schättgen, ein Haslacher, der es viel weiter gebracht hat im Leben als ich, trotzdem er zehn Jahre jünger ist, in seiner eigenen Equipage nach Gengenbach, wo ich schon lange nicht mehr gewesen war.
In Steinach trafen wir den Oberamtmann Becker von Wolfach, dem die Männer aus dem Volke, welche in Verwaltungssachen eine Art Schöffen bilden und in Baden Bezirksräte genannt werden – im Adler z'Steine ein Abschiedsessen gaben.
Wir hielten einen Augenblick an, und ich sah die Bezirksräte, meist Bauern. Doch nur die von Gutach und Einbach trugen Volkstracht und machten ihrem Stand alle Ehre; die übrigen sahen in ihrer Städtletracht aus wie ältere, ehrsame Dorfschreiner.
Ich halte auf Schöffengerichte, soweit Bauern darin sitzen, gar nichts und nicht vielmehr auf die Bezirksräte. In den erstern hat mir der Amtsrichter und bei den letztern der Amtmann zu viel Ansehen. So ungereimt es auch aussieht, so sage ich es doch: Wenn ich vor ein Schöffengericht müßte und ich hätte kein Vertrauen zur Unparteilichkeit des Richters, so wären mir zwei Sozialdemokraten lieber als zwei Bauern, so lieb mir auch die letztern als Menschen sind.
Und warum möchte ich in diesem Falle keine Bauern? Weil sie mir zu viel Respekt hätten vor der Weisheit des Richter-Engels.
So schön und so gut es ist, daß der Bauer noch Autoritätsglauben besitzt, im obigen Fall wäre mir der autoritätslose Sozialdemokrat lieber, weil sein Rechtsgefühl nicht wie beim gutmütigen Bauer in Gefahr käme, dem Autoritätsglauben zu unterliegen. –
Die Eisenbahn, welche seit 1866 durchs Kinzigtal zieht, ist schuld daran, daß ich seit bald vierzig Jahren den Weg auf der Landstraße nach Gengenbach nicht mehr gemacht habe.
Wie oft bin ich ihn gegangen in den fünfziger Jahren als Studentlein von Rastatt her, und wie hab' ich mich auf der heißen, staubigen Straße zwischen Gengenbach und Biberach unter den großen Apfelbäumen hin gesehnt, zum Bierbrauer Rothmann an der Kinzigbrück bei Biberach zu kommen, um meinen Durst löschen zu können. –
Man sieht es dem Städtchen Gengenbach heute noch an, daß es über ein halbes Jahrtausend eine freie Reichsstadt war. Seine Hauptstraße, sein Rathaus, die vielen Patrizierhäuser, die Tore und Türme zeigen, daß hier ein weit mächtigeres Stadtwesen daheim war als in Hasle.
Das bewirkte aber lediglich die größere Freiheit und Selbständigkeit, obwohl auch die nicht reichsunmittelbaren Städte des Mittelalters sich wahrlich nicht über Mangel an Freiheit beklagen konnten.
Das Bürgertum jener Tage war überhaupt viel selbstbewußter und freier als das des 18. und 19. Jahrhunderts. Es kannte den Servilismus dieser Jahrhunderte nicht. Aber nach dem Dreißigjährigen Krieg lag das Bürgertum ausgeplündert und ausgestorben darnieder, und die Fürsten hatten leichte Arbeit, ihren Absolutismus zu begründen und den freien Bürgersinn der alten Zeit zu unterdrücken. –
Eben sind die Gengenbacher auf Anregung ihres Pfarrherrn und unter der künstlerischen Leitung des Baudirektors Meckel daran, die alte, romanische Klosterbasilika ihrer Verunstaltungen aus der Zopfzeit zu entkleiden, und sie werden auf solche Weise bald eine Pfarrkirche erhalten, die zu den Sehenswürdigkeiten des Landes zählen dürfte. –
Ich besuchte auch die anfangs dieses Buches erwähnte Dame in ihrem »Herrenhaus« und staunte über den Geschmack der inneren Ausstattung ihres Palais.
Ich erinnere mich, die Dame vor 45 Jahren in ihrem Garten an der Landstraße gesehen und ihre jugendliche Schöne bewundert zu haben, trotzdem ich ein armseliges Studentenbüblein war. Damals wäre Shakespeares Wort:
Ein Klausner, hundert Jahre alt, wirft fünfzig ab,
Wenn ihn ihr Blick verklärt –
auf sie anwendbar gewesen. Heute ist jede Spur der einstigen Blüte verschwunden, und sie kann mit dem weisen Sirach bekennen: »Eine Täuschung ist die Grazie und vergänglich die Schönheit.«
Ich suchte dann noch den Medizinalrat Dr. Tritschler auf. Der war schon praktischer Arzt in Gengenbach, als ich in meinen letzten Studienjahren dahin kam, und sieht heute noch so frisch aus wie damals. –
Als ich gegen Abend zum oberen Tor der alten Reichsstadt hinausfuhr, sagte ich mir: Die Gengenbacher sind zweifellos die gescheitesten aller Städtle-Bürger im Kinzigtal. Sie allein haben ihre alten Tore und Türme nicht eingerissen, während die andern diese ehrwürdigen Wahrzeichen vergangener Jahrhunderte und einstiger Bürgergröße der Kultur und dem »Verkehr« geopfert haben. Heute hat die Eisenbahn den Verkehr übernommen, und die Tore könnten wohl stehen, den Städtchen zum malerischen Schmuck.
Wir fuhren am rechten Ufer der Kinzig auf einsamen Wegen Hasle zu. Es war ein unvergleichlich schöner Maienabend. Unter blühenden Bäumen, an Rebhalden hin lagen versteckt die Weiler Einach, Schwaibach, Bergach, Schönberg. Die Landleute kehrten von der Arbeit heim oder saßen, Feierabend haltend, friedlich vor ihren Hütten.
Von den Bergspitzen herab sandten die Tannenwälder kühlende Abendwinde, die Vögelein jubilierten, die Halme der Kornfelder wogten leise hin und her, und die Wasser des Flusses zogen langsam an dieser Idylle vorüber, als wollten auch sie diesen Abendfrieden mitgenießen.
In meiner Stube im Paradies brannte schon das Licht, als ich, innerlich froh der schönen Fahrt, heimkehrte in die nächtliche Dorfstille von Hofstetten.
Am 30. Mai.
Der heutige Sonntag brachte eine Menge Gäste in die drei Schneeballen. Über den Hühnersedel her kam der Schwarzwaldverein Freiburg unter Führung des Professors Thomas. Während diese Touristen, etwa 40 an der Zahl, unten speisten, saß ich oben in meiner Klause. Da hörte ich auf einmal »Hoch« rufen, und bald darauf erschienen einige der Herren, um mir zu sagen, daß dieses Hoch mir gegolten habe als einem Schwarzwald-Dichter.
Ich und Dichter! Das kommt mir gerade so vor, als wenn man einen Dorfmaurer, der den Bauern ihre Häuser rot und weiß anstreicht, einen Kunstmaler heißen wollte.
Das Roß des Dichtergottes Apollo, der Pegasus, hat bekanntlich Flügel, und wenn es bisweilen eine seiner alten Federn verliert, so hebe ich sie auf und kritzle damit wie ein Schulbüble, das Schreiben lernt, oder ich versuche Bilder aus dem Dichterhain von Gottes Gnaden, aus der Volksseele zu zeichnen – das ist meine ganze Dichtkunst.
Wohl oder übel mußte ich nun zu der heitern Schar der Bergfahrer hinab und mich bedanken für das unverdiente Hoch. Ich toastete auf den »Vorredner«, Professor Thomas, und sprach davon, daß die Norddeutschen den Schwarzwald besser kennen als wir. Jensen schrieb das erste größere Buch über ihn, und Dr. Thomas, ein Sachse, weiß alle Wege und Stege auf dem Schwarzwald sicherer als jeder Schwarzwälder.
Norddeutsche mußten uns erst aufmerksam machen auf die Schönheiten unseres Waldes, geradeso wie die Engländer die Schweiz entdeckten.
Professor Thomas könnte uns Schwarzwäldern auch noch eine andere Lehre geben. Er zieht tagelang über die Berge und Höhen, ohne Wein oder Bier zu trinken und begnügt sich mit Milch und Wasser. Wir Einheimische aber überlassen uns um so mehr dem Alkohol, je weiter wir gelaufen sind. Und was wir mit den Bergfahrten der Gesundheit nützen, entziehen wir derselben wieder durch zu vieles Trinken. –
Was ich an den vielen Schwarzwaldvereinen des badischen Landes auszusetzen habe, ist der Fehler, daß sie sich nur um den Schwarzwald und seine Naturschönheiten kümmern, aber nicht um das Volk, welches den Wald bewohnt.
Auch dem Volkstum, seinen alten Sitten und Gebräuchen und der Volkstracht sollten sie ihre Sorgfalt zuwenden. Sie sollten ganz besonders kämpfen gegen den Prozententeufel der Brandversicherungsgesellschaften, welcher der Tod der malerischen Hütten des Schwarzwalds ist.
Denn dieser herrliche Wald wird einen großen Teil seiner Reize einbüßen, wenn einmal lauter Ziegeldächer die Häuser decken, die Bauern am Sonntag im Zylinder zur Kirche kommen und die Maidle und die Frauen an Festtagen sich kleiden wie Schusters- und Schneidersfrauen und wie Fabrikarbeiterinnen in den Städten. –
Als die Schwarzwaldvereinler wieder abgezogen waren, um mit der Bahn durchs Kinzigtal heimzufahren, besuchten mich noch Theodor, der Seifensieder, und seine Jeannette.
Er kann es nicht erwarten, bis mein Buch »Waldleute« mit seinem Leben erscheint, und fürchtet, noch vorher sterben zu müssen.
Ich begreife seine Ungeduld, denn ein Achtziger muß mit jedem Tag rechnen und stündlich darauf gefaßt sein, daß die Parze seinen Lebensfaden abschneidet.
Ich werde in drei Monaten sechzig Jahre alt und meine oft, es sei nicht mehr der Mühe wert, irgend etwas anzufangen oder zu unternehmen, auf irgend etwas im Leben zu warten und zu hoffen. Um wie viel mehr wird ein Achtziger es empfinden, wie wenige Tage ihm noch zugemessen sind.
Was den Genuß einer seligen Ewigkeit in einer andern Welt steigern muß, ist sicher das Gefühl, daß man dort nicht mehr mit der Zeit zu rechnen hat. Drum sagt schon ein römischer Dichter treffend: »Im Himmel ist viel Zeit.« –
Ich war am heutigen Abend todmüde von all dem Jahrmarkt, der sich den Tag über hier abgespielt hat.
Am 31. Mai.
Als ich diesen Morgen die Kirche verlassen wollte, bat mich eine Wöchnerin, sie »auszusegnen«. Es ist dies eine schöne, alte, christliche Sitte, daß die Mutter den ersten Gang nach der Geburt ihres Kindes in das Haus Gottes macht, um dem Herrn alles Lebens zu danken und ihm zu geloben, ihr Kind zu seiner Ehre nach der Lehre Jesu Christi zu erziehen, damit es dereinst würdig werde eines andern, ewigen, besseren Lebens.
Dementsprechend waren auch im alten Ritual die Gebete und die Mahnungen, welche der Priester für die Mutter spricht und an sie richtet. Nach dem neuen, vor einigen Jahren eingeführten Ritual soll nun alles lateinisch gemacht werden, und die Mutter hört kein Wort der Mahnung und der Erbauung mehr.
Fürwahr, das heiße ich in diesem Falle dem Volk, das um Brot bittet, einen Stein geben!
Daß ich die Büre aus dem Salmersbach heute nicht so abspeisen wollte, wird mir vernünftigerweise niemand verübeln. Drum nahm ich das alte Ritual und betete die schönen Gebete desselben über die Büre.
Ich habe für meine Abweichung von der neuesten, sehr unzeitgemäßen Vorschrift einen guten Bürgen. Es ist dies kein anderer als der heilige Apostel Paulus. Dieser schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther: »Es ist besser, fünf Worte zu reden, die verstanden werden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend Worte in einer unverständlichen Sprache.«
Die lateinische Sprache als Kirchensprache bildet in der katholischen Kirche ein schönes Band der Einheit und als solches ist sie gewiß nicht zu tadeln bei allen streng gottesdienstlichen Verrichtungen. Aber einen Toten begraben oder eine Wöchnerin aussegnen in lateinischer Sprache, das verstehe ich nicht. Die Lebenden haben auch noch ein Recht am Grabe, und eine Mutter, die sich aussegnen läßt, will auch was hören von diesem Segen.
Es ist Montag heute, ein heller, lichter Sonnentag. Von Hasle her kommen gegen Mittag Wibervölker, die Eier und Butter zu Markt getragen haben.
Sie sind »ab der Hochmunde«, hoch oben auf der Wasserscheide zwischen Kinzig und Elz, und trinken je ein Viertele beim Schneeballenwirt. Ich leiste ihnen Gesellschaft und erfahre, daß sie zu klagen haben über die Füchse, welche ihnen wirklich nächtlicherweile so viele Hühner holen. Sie wünschen, daß die Haslacher Jäger einmal kämen und Fuchsjagd hielten.
Ich nahm die Füchse in Schutz und meinte, dieselben seien, wenn sie ein Huhn holten, geradeso unschuldig, wie ein menschlicher Vater und eine menschliche Mutter, die tagsüber auf die Arbeit gingen, um ihre Kinder ernähren zu können.
Jetzt hätten die Füchse Junge und müßten nachts stundenweit laufen, um Nahrung für ihre Kinder zu suchen. Sie nähmen auch mit Mäusen vorlieb, aber die seien nicht immer zu haben, und die Fuchskinder wimmerten nach Fleisch, wie die Kinder der Menschen nach Milch und Brot.
Auch hätten die Füchse keinen Begriff von Eigentum und stammten aus Zeiten, in denen es noch keine Marksteine und keine Hühnerbesitzer gab, sondern wo alles allen gehörte und jeder da nahm, wo er was fand.
Die Wibervölker wollten mir nicht recht glauben, schüttelten mißtrauisch die Köpfe und meinten, ich wollte sie zum besten haben. Ich hatte alle Mühe, bis sie einsahen, daß der Fuchs nur seine Pflicht tue und der Pfarrer sie nicht anlüge.
Das Landvolk ist durchweg mißtrauisch, aber warum? Weil man ihm seit Jahrtausenden die Haut über den Kopf gezogen und ihm unter allerlei Vorwänden und Versprechungen stets neue Lasten aufgeladen hat.
Drum will der Bauer mit Recht auch nichts von Neuerungen wissen, weil er glaubt, es bleibe doch immer wieder beim alten, d. h. daß er brav zahlen und in alleweg die Katz' durch den Bach schleifen müsse. –
Ich sitze gegen Abend lange in der Hütte und schaue in die stille Natur hinein, die im Sonnenschein glänzt wie ein Spiegel, in welchem Wald und Berg und Tal und Bach und Wiese sich wiedergeben.
Nie verkündigt die Natur mir mächtiger und inniger den Geist Gottes, der aus ihr zu unserer Seele dringt, als wenn ich, einsam auf dieser Höhe weilend, lange in ihre Stille hineinschaue und sie allein in meinem Innern wirken lasse.
Wie Balsam strömt's dann in mein krankes Gemüt, und wie milder Tau auf dürres Erdreich, so senkt sich die Ruhe der Natur in meine Seele und ich fühle Gottesnähe.
Wie wahr und wie sinnig haben die Menschen in ihrer Kinderzeit überall in der Natur die Gottheit gesehen und Berge, Wälder, Haine und Bäche mit Göttern und Göttinnen bevölkert. Sie fühlten es eben in ihrer Seele, daß Gott in der Natur wohne, und haben in kindlicher Art sich dieses Wohnen gedeutet.
Das alte Heidentum, das so überall die Gottheit sah und suchte, steht mit diesem Sehen und Suchen weit über unsern Neuheiden, die überall nur Stoff und Stoffwechsel sehen. –
Es war Abend geworden. Von Hasle herauf tönte die Betglocke, die gleiche, die mir vor einem halben Jahrhundert schon läutete und den fröhlichen Knaben heimrief von der Gasse.
Der erste Ton der Abendglocke war damals für alle Kinder das Zeichen zur Heimkehr ins Vaterhaus. Diese schöne Sitte, deren Übertretung scharf geahndet wurde, soll zu meiner großen Freude in Hasle auch jetzt noch Geltung haben.
Mich stimmte die Glocke meiner Knabenzeit heute wehmütig. Sie rief mir so lebhaft jene Tage in die Erinnerung, da ihr Abendläuten dem Spiel und dem Lärm sorgloser Jugendtage ein Ende machte.
Wie oft bekam ich Schläge, weil ich nicht gleich »an Betzit« heimkehrte, da ich im Lärm des Kinderhimmels die Glocke nicht gehört hatte oder zu weit vom Städtle entfernt war! –
Wie viele Kinder, so dachte ich, hat die »groß' Glock« in den vier Jahrhunderten, die sie auf dem Kirchturm von Hasle hängt, in dieser langen, langen Zeit allabendlich heimgerufen vom fröhlichen Spiel.
Und wie vielen hat sie nach dieses Lebens Mühen und Leiden den letzten Gruß gesandt auf ihrem Weg zum Grabe.
Soll die Glocke, die so zahllosen Sterblichen im Leben und im Tode läutete, gleichsam unsterblich sein, die Menschenseelen aber nach kurzem Lebensgang tot für immer?
Sollten die Seelen nicht mehr wert sein und nicht länger leben als das Werk unserer Hände, welche die Glocke schufen?
Sollten die Leiden und die Kämpfe, die wir durchgemacht, seitdem die sorgenlose Jugendzeit vorüber ist, umsonst gelitten und umsonst gekämpft sein und die Glocke, welche ihr schmerzloses Dasein nach Jahrhunderten zählt, uns, wenn wir dies Leben überstanden haben, nur nachrufen zu ewigem Staub und Moder?
Wenn dem so wäre, müßten wir Menschen, die wir Unendliches ahnen und fühlen, die Glocke beneiden um ihr Dasein und dem uns'rigen fluchen. –
Während ich so sann, läutete auch der Sakristan von Hofstetten seine Betglocke. Sie ist klein und fein und klang herauf zu mir wie eine Engelsstimme, die sagen wollte: »Seid getrost, ihr Mühseligen und Beladenen, ihr seid unsterblich. Es kommt für euch ein ewiger Feierabend, an dem der Gott alles Lebens alle Tränen trocknet und alle Klagen stillt. Ehre sei drum Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind!«
Daß die Abendglocke nicht bloß kleine Geister meiner Sorte, sondern auch große bewegt, das zeigt Napoleon I.
Der General Montholon, Gefährte des Kaisers auf St. Helena, erzählt in seiner »Geschichte der Gefangenschaft Napoleons«, wie dieser oft bedauert habe, daß auf der Insel keine Glocke läutete. »Ich hörte,« so sprach der Kaiser einmal zum General, »nie einen Glockenton, ohne daß er Gefühle und Erinnerungen aus meiner Jugend weckte. Das Angelus-Glöckchen führte mich zu angenehmem Traume zurück, wenn ich in dem schattigen Walde von St. Cloud den Ton hörte, selbst mitten unter ernsten Gedanken und unter der Last der kaiserlichen Krone. Oftmals meinte man, ich dächte über einen Feldzugsplan oder ein kaiserliches Gesetz nach, während meine Gedanken sich ausdrücklich mit den ersten Jugendeindrücken beschäftigten.« –
Aus meinen Gedanken über das Abendläuten, das von Hasle und vom Dorf her zu mir heraufgeklungen hatte, störten mich Stimmen von Menschen, die den Berg herabkamen. Ich trat ins Freie und schaute nach den späten Wanderern.
Es waren Haslacher Jäger mit Treibern und Hunden, unter ihnen der Haser-Xaveri, der mir auch alte Erinnerungen weckte. Bei seinem Vater, dem Haser-Hans, einem Bierbrauer, hatte ich in meinen letzten Studienjahren in den Ferien meine Stammkneipe. Damals war der datiert ein blauäugiges und schwarzlockiges Büble und hatte mein Wohlgefallen. Wir waren gute Freunde.
Heute ist der Xaveri ein Fünfziger, aber ein Rentier. Er zog als Bierbrauer nach Amerika und kam von dort als reicher Mann zurück und will in Hasle sein Leben beschließen.
Zum Zeitvertreib, bis die große Brauerei fertig ist, die er in seiner Vaterstadt gründen will, geht er auf die Jagd.
Sie haben, die Jäger, welche mich aus meiner Hütte lockten, droben in den Felsen einen Fuchsbau aufgegraben. Die Beute sind drei lebendige junge Füchse und ein toter alter Fuchs. Die Wibervölker ab der Hochmunde können also zufrieden sein; es sind der Hühnerdiebe vier weniger in der Gegend.
Aber welches Unheil haben die Jäger über eine unschuldige Familie gebracht! Drei Fuchskinder, die ebenso schuldlos als klug in die Welt blickten, da ein Jäger sie aus einen Sacke zog und mir zeigte, sind zu Waisen geworden. Der Fuchsvater ist tot, und die Mutter eilt, ihrer Kinder und ihres Gatten beraubt, verwundet durch die Wälder, Weh im Herzen.
Und warum verfolgen die Jäger so grausam die armen Füchse? Nicht weil sie den Wibervölkern ab der Hochmunde an die Hennen gehen, sondern weil sie den Nimroden die jungen Hasen und Rebhühner holen, die sie, die Herren Menschen und Jäger, selber töten wollen.
Sie morden die Füchse, weil sie selber aus Lust morden wollen, was jene um ihres Lebens willen töten.
Der Mensch ist eben der Massenmörder der Schöpfung. Er mordet zum Vergnügen, der Fuchs aus Lebensnot. Wer ist das bessere Geschöpf? –
Ich ging mit den Jägern hinab ins Dorf, wo bald die nächtliche Ruhe einkehrte. Nur die Birken und Tannen flüsterten noch im Abendwind, und auf dem Kirchhof zirpten zwischen Gräbern die Zikaden. Ich schaute zum Fenster hinaus in die dunkle Nacht und gedachte aufrichtigen Mitleids der armen Fuchsmutter, die unglücklich und ruhelos durch den Wald ging. –
Am 1. Juni.
Ich ersparte heute dem Pfarrer von Hasle einen Gang und taufte an seiner Stelle ein Kindlein, welches sie von der Hochmunde herabgebracht hatten. Der Vater ist ein Neffe des Knechtes Hugo, von dem ich in »meiner Jugendzeit« erzählt habe, und das Kind in der gleichen Hütte geboren, zu welcher ich vor mehr denn fünfzig Jahren als Knabe mit Hugo die erste größere Reise in meinem Leben gemacht habe.
Die Hebamme war eine Biederbacherin und zierte den ganzen Taufzug durch ihre malerische Volkstracht. –
Wie wunderbar hat Gott das Wasser gewählt als das sichtbare Zeichen der Taufgnade! »Das Wasser,« sagte ein berühmter Theologe, »ist die Mutter der Welt und das Blut der Natur.« Aus dem Schoße des Wassers sind Erde und Himmel hervorgegangen. Schon der heilige Petrus sagt, was die heutige Wissenschaft noch nicht widerlegt hat: »Himmel und Erde sind das erstemal aus Wasser und durch Wasser mittelst Gottes Wort entstanden.«
»Der Geist Gottes schwebte,« wie die Heilige Schrift auf ihren ersten Blättern erzählt, »über den Wassern,« ehe er Himmel und Erde schied.
Sankt Petrus war auch der erste Lehrer der Geologie. Sein Schüler, der heilige Papst Clemens, berichtet uns darüber also: »Ich will, sagte Petrus zu mir, dich lehren, wie und durch wen die Welt gemacht worden ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde als ein einziges Gebäude. Das Wasser, welches die Welt einnahm, verdichtete Gott gleichsam zu Eis und machte es fest wie Kristall; er bildete das Firmament, durch welches der ganze Raum zwischen Himmel und Erde abgesondert wird.«
Und der heilige Augustinus spricht ähnlich: »Im Anfang wurden Himmel und Erde aus dem Wasser und durch das Wasser gemacht. Es ist deshalb nicht ungereimt, zu sagen, das Wasser sei der Urstoff; denn alles Irdische – Tiere, Bäume, Kräuter und ähnliches – verdankt seine Nahrung dem Wasser.«
Der griechische Weltweise Thales nennt das Wasser »den Ursprung alles Geschaffenen.«
Am schönsten aber besingt der Römer Plinius das Wasser: »Es ist die Königin von allem, es erhält die Welt, ertötet das Feuer, steigt in die Luft und herrscht am Himmel. Sein Fallen ist die Ursache all dessen, was auf der Erde wird. Ein ganzes Wunder der Natur! Wenn man erwägt, wie die Früchte erzeugt werden, wie die Bäume und Pflanzen leben, wie das Wasser zum Himmel steigt und wie es den Kräutern von da Lebenskraft mitteilt, so muß man gestehen, daß alle Kräfte des Wassers Wohltaten sind.«
Und der lateinische Grammatiker Festus meint, das lateinische Wort aqua, Wasser, bedeute »Mutter aller Dinge«.
Begreifen jetzt die Verächter des Taufwassers, wie wunderbar passend der Heiland der Welt zu dem Sakramente der Wiedergeburt der Menschheit und der geistigen Neuschöpfung der Erde das Wasser nahm?
Auch über diesem Wasser schwebte und schwebt der Geist Gottes und bewirkte und bewirkt durch dasselbe alle Wunderwerke des Christentums in der Seele der Menschheit.
Aus dem Wasser sind Himmel und Erde gekommen; aus dem Wasser kam auch die christliche Welt; es ist die Mutter auch dieser Welt und das Blut des Gnadenlebens. Und so wie die irdische Welt ohne Wasser nicht bestehen kann, so hängt auch die Existenz des Christentums, die Welt der Erlösung und des natürlichen Lebens, ab vom Wasser der Taufe, über dem der Geist Gottes schwebt. Wenn der Menschengeist zum Wasser tritt, so wird es Dampf und Kraft und Eisenbahn und Industrie. Was wird erst der Geist Gottes vollbringen, wenn er das Wasser befruchtet!« –
Nachdem das Kindlein um 2 Uhr des Nachmittags getauft war, machte ich mit Sepp, dem Gerechten, und seinem feurigen Braunen eine Spazierfahrt.
Wir fuhren durch Hasle, das Tal von Mühlenbach hinauf bis zur Wasserscheide des Elztales und dann auf der Höhe hinüber und wieder hinab nach Hofstetten. In nördlicher Richtung zogen wir von dannen und kehrten von Süden her heim.
Je höher man im Mühlenbacher Tal hinaufkommt, um so reizendere, strohbedeckte Höfe zeigen sich. In einem malerischen Winkel machte mich mein Begleiter auf den »Kußhansen-Hof« aufmerksam. Sein Besitzer, der Kußhansenbur, war im letzten Winter in Freiburg, um sich von einem Halsleiden kurieren zu lassen. Er kam öfters zu mir, den Tod auf der Stirne.
Heute erfuhr ich nun, daß sie ihn in diesem Frühjahr begraben hätten. Mich dauerte der Mann doppelt, da ich sah, in welch prächtiger Mulde er sein Heim hatte, das er in jungen Jahren für immer verlassen mußte.
Ein Habenichts, wie unsereiner, so dachte ich im Weiterfahren, stirbt doch leichter als nur ein Bauer, der Haus und Hof und Matten und Felder und Wälder sein eigen nennt.
Auf der Höhe angekommen, hielten wir an. Ich verließ den Wagen und ließ frohlockend mein Auge hinabgleiten ins Kinzig- und ins Elztal. Aus beiden Tälern schauten unzählige Waldberge zu mir herauf, und über die Berge und Wälder ging wie ein ewiger Gottesfrieden die Abendsonne; Herden läuteten und Vögel sangen – den gleichen Frieden.
Unweit von mir hackten Landleute ihre Erdäpfel, und neben ihnen schlichen Feldhühner ihrer Nahrung nach, als wären sie Haustiere.
An den riesigen Bergwänden des Kandel und des Gschasi lagen schon die Schatten des Abends und machten das Tannen- und Buchenmeer an diesen Wänden noch gewaltiger und feierlicher.
Von diesen tiefen Schatten zog etwas herauf in meine über alles andere, was ich sonst sah, frohlockende Seele und bewirkte jene halb süße, halb bittere Elegie, die so gerne der Schwermut in die Arme fällt.
In dieser Stimmung fuhr ich auf dem Grate der Wasserscheide hin weiter, bald ins Kinzig-, bald ins Elztal meine Blicke werfend, fuhr dahin zwischen lichten Föhrenhainen, in denen der Auerhahn wohnt, fuhr durch Düfte, die aus der Blüte der Föhren strömten, und war begleitet vom Läuten der Herden, die, überwacht von singenden Hirtenknaben, in den Matten unter und zwischen den Hainen weideten.
Bei den Hirten traf ich auch die Buben meines Freundes, des Funi-Klaus, des Steinhauers auf der Heidburg. Ich fuhr diesmal aber unter dieser durch und besuchte den Mann nicht, der mir meine Lieblingsburg durch sein ewiges Steinbrechen zerstört.
Erst auf dem Tochtermannsberg machte ich halt, ohne abzusteigen. Ich rief meiner Freundin, der Fev, und bat sie um frische Milch.
Sie eilt, holt ein Glas, schwenkt's am malerischen Bergbrünnele, geht in den Stall, milkt direkt in den Becher und kredenzt mir den Trank der Labe aufs Wägele. Champagner, Marke Heidsieck-Monopol, kann nicht besser sein.
Die Büre sagt mir auch, daß die Wallfahrt zu den Nothelfern eine gesegnete gewesen. Der Xaverli habe von Stund' an die Medizin genommen und sei wieder gesund. Er hüte eben die Schafe oberhalb des Hofes. –
Dort drüben sehe ich jetzt auch den Taufzug von diesem Nachmittag wieder. Sie steuern durch Moos und Ginster über die Heide der Hochmunde zu. Die Goldkappe der Göttle strahlt im Abendsonnenschein, und die seidenen Bänder an den Kleidern der Hebamme flattern im Abendwind.
Sie sind bis jetzt drunten im Tale beim Taufschmaus gesessen in den Schneeballen, während das Kindlein ohne Speise und Trank auf einem Tische lag. Nun der Abend herangerückt, tragen sie es heim über die Heide – zur Mutter.
Was, so sagte ich mir, da der Sepp in scharfem Trab von der Höhe zu Tal fuhr, sind alle Genüsse der Großstadt mit ihren Theatern, Konzerten, Promenaden und Restaurants gegen die Bilder eines Abends, wie du ihn eben verlebt hast. –

Am 2. Juni.
Ich komme nochmals auf die Glocken zurück. Fast jeden Morgen höre ich um 5 Uhr die Betglocke vom nahen Turm der Dorfkirche läuten. Während die gleiche Glocke am Abend friedlich ihre kleine Stimme erhebt, tönt sie am Morgen an mein Ohr ganz elegisch; sie wimmert förmlich, wie voll Leid im Herzen, das sie leise klagen will.
Es kommt mir vor, als wüßte sie, daß ihr Läuten die Menschen in Berg und Tal wecke aus dem Reiche der Träume, des erquickenden Schlafes und der seligen Vergessenheit, wecke zur Arbeit, zu Mühe und Sorge. Und sie hat drum Mitleid mit den armen, mühseligen und beladenen Menschen und weint und wimmert.
Während sie so ein Herz zeigt für die geplagte Menschheit, klingt wie Spott in den frühen Morgen hinein das Krähen der Hähne, die sich von einer Bergwand zur andern ihr höhnisches »Kikeriki« zurufen. –
Der heutige wieder so sonnige Tag reizte mich am Nachmittag abermals, eine Spazierfahrt zu machen. Hatte ich gestern »das Paradies« von Norden nach Süden umkreist, so wollte ich dies heute von Westen nach Osten tun.
Diesmal war Wendel, der Roserbur, mein Fuhrmann. Mit den mächtigen Schritten seiner zwei Riesengäule ging es bergauf, der »Breitebene« zu.
Beim »Palmenwald«, von dem ich »im Paradies« gesprochen, ließ ich anhalten und genoß in vollen Zügen den Blick über die Hochebene hin. Was mich am meisten entzückte, waren die wunderbaren Ginsterfelder, welche mit ihren Blüten einen riesigen, goldigen Teppich über die Ebene hin gewoben hatten.
Mitten auf diesem Goldgrund hütete ein Hirtenmaidle mit rotem Rock und grüner Schürze seine Schafe. Auf einer einsamen Föhre neben ihm schaukelte sich wonnig und wohlig ein Vögelein und zwitscherte sein Lied.
Auf dieses Heideland, auf dem nur Ramsen (Ginster) gedeihen und zwischen diesen ein spärlich Gras für Schafe und Geißen, hatte die Natur durch dies gelbe Blumenmeer einen wundervollen Zauber gelegt. Es fesselte mich lange und gab mir den Gedanken ein, wie der Schöpfer auch die Einöden nicht vergißt und Gold säet auf die unfruchtbare Heide und sie dadurch schöner macht als das gepflegteste Kulturland.
Ist diese Einöde in ihrem Goldglanze nicht ein Bild des verachteten, gemeinen Volkes, in welchem unser Herrgott mehr goldenes Gemüt und goldene Poesie gedeihen läßt als in den Palästen der Großen und auf den Lehrstühlen der Gelehrten, die so verächtlich auf das ungebildete Volk herabschauen? –
Ich habe bis jetzt nur einen Dichter gefunden, der den Ginster besingt. Es ist dies Leopardi. Der fand ihn blühend auf dem Vesuv, nennt ihn »die Blume der Wüste« und singt von ihm:
Hier auf dem dürren Grat
Des schreckenvollen Berges
Vesuvio, des Verwüsters,
Wo sonst nicht Baum noch Blume fröhlich grünt,
Verbreitest du dein einsam wuchernd Laub,
Duftvolle Ginsterblume,
Genügsam in der Öde.
Rings eine Wüstenei,
Wo du, o holde Blume, blühst und, gleichsam
Mitfühlend mit so großem Weh, zum Himmel
Den Hauch entsendest süßesten Gedüfts,
Der Wüste Trost und Labsal. –
Bald waren wir bei einer der malerischen Hütten, in denen Severin, der Schofschnider, haust. Vor der einen stund er heute hemdärmelig und über die goldenen Fluren hinschauend. Ich lud ihn ein, uns bis zum nahen »Höhwirt« zu begleiten und einen Schoppen mit uns zu trinken.
Er folgte meiner Einladung zögernd. Wie friedlich und bescheiden war heute der Severin, den ich noch nie auf heimischem Boden getroffen, sondern stets drunten im Tale, wo des Weines Kräfte ihn zum dumpfen Brüter oder zum gefährlichen Krakeeler machen.
Beim Höhwirt trafen wir »den Polizei« von Biederbach, der heraufgekommen war, weil er gehört hatte, der vielgenannte Einbrecher Maude sei im Höhwirtshäusle gewesen. Es war so, aber der Maude war längst wieder seines Weges gezogen. Aber auch, wenn er gewartet, bis »die Sicherheit« von Biederbach gekommen wäre, hätte dieser ihm sicher nichts anhaben können.
Mit Rücksicht auf den Maude hatte der Wendel bei unserer Abfahrt seinen Revolver geladen, und beim Höhwirt erfuhren wir nun, daß dies nicht grundlos geschehen war. Wenige Tage darauf verübte der Maude einen Raubanfall in der Nähe, wurde bald hernach von den Gendarmen gefangen genommen und erhängte sich im Gefängnis. –
Waren wir im vorigen Jahr vom Höhwirtshaus weg südlich gefahren, dem Hühnersedel zu, so nahmen wir den Weg diesmal direkt westlich gegen »die Hallen« und den Geisberg.
Auf den Hallen angekommen, öffnete sich der Blick gen Norden ins Kinzigtal. Ich sah weit drunten im Tal einen reizenden Ort liegen, konnte ihn aber trotz des Fernglases nicht erkennen. Da kam des Wegs daher der »Finsterbur«, dessen Hof in einer dunkeln Mulde zu meinen Füßen liegt, und sagte mir, der Ort dort drunten sei Zell. Schon hundertmal hatte ich das alte Reichsstädtchen von allen Seiten gesehen, selbst von den Hallen herunter, und doch heute nicht mehr erkannt. Aber das Abendlicht, welches im Scheiden das Städtle verklärte, mag schuld sein, daß es in dieser Zauberpracht mir fremd war, wie man eine alte Jungfer, in glänzende Gewande gehüllt, auch nicht leicht wiedererkennt.
Die Hallen nennt man einen Bergsattel zwischen dem Elz-, Schulter- und Kinzigtal. Malerische Hütten armer Taglöhner zieren ihn.
Zwei Greise, Großväter, aus diesen Hütten erfreuten mich, da wir vorbeifuhren. Sie promenierten, jeder sich auf einen Stock stützend, im Abendfrieden, der auch in ihren Gesichtern glänzte, auf dem Sattel hin und her.
Kein Korso der Welt kann reizender gelegen sein als der, über den diese zwei armen Männer lustwandelten. Unter sich haben sie eine Wunderwelt von Tannenwäldern, Matten und Bächlein und in sich zweifellos einen Frieden, den die Korsogänger in unsern Weltstädten und Weltbädern sicherlich nicht kennen.
Und warum haben diese zwei »Hallenser« diesen köstlichen Frieden? Weil sie ihre Sache auf nichts gestellt haben hienieden und zufrieden sind in ihrer Armut.
Nach der Promenade wartet ihrer heute eine Suppe und ein Lager auf Stroh oder Laub, und sie schlafen den Schlaf der Gerechten, bis der Hahn sie weckt und die Sonne über den Wald herabsteigt zu ihren Hütten.
Unfern von ihnen sitzen heute oberhalb des Weges im Heideland zwei Hirtenmaidle; eines ist beschäftigt, dem andern seine Haare in zierliche Zöpfe zu flechten, während einige Schafe und Ziegen, ihrer Obhut anvertraut, neben ihnen weiden.
Die Maidle kehren uns den Rücken, und finden es nicht der Mühe wert, auch nur umzuschauen, und das gefiel mir. –
Jetzt öffnet sich uns der Blick den Tälern der Schutter und weiterhin dem Rheine zu. Die uns zugewandte Seite der nächstgelegenen Waldberge liegt schon in mächtig wirkenden Schatten, die Vogesen und das Straßburger Münster aber schauen in der Abendsonne zu uns herauf.
Selbst der Wendel ist entzückt von diesem Bilde und, anstatt zu jauchzen, schießt er eine der Kugeln los, welche er dem Maude zugedacht hat.
Bald sind wir auf der schönen Landstraße, die von der Schutter herauf ins Kinzigtal hinabführt, und in scharfem Trab geht's bergab diesem zu.
Am Geisberg muß der Wendel halten und seine Freunde grüßen, die Steinbrecher. Jahraus jahrein schießen diese wetterbraunen Gestalten von der schneeweißen Porphyrwand die Steine los für alle wichtigen Straßen im Kinzigtal. Blaue Brillen schützen ihre Augen gegen die Sonne, die auf diese weiße Felswand ihre grellsten Lichter wirft.
Der Wendel holt hier mit seinen zwei Gäulen auch die Steine auf die Hofstetter Straße. Morgens vier Uhr fährt er daheim fort, das Kinzigtal hinab und das Welschensteinacher Tal hinauf. Am Nachmittag kommt er wieder von der für schwerbeladene Wagen gefährlichen Bergfahrt heim, und dann hat er nur zwölf Mark verdient und ist doch zufrieden.
Ich würde um dies Geld, selbst wenn ich noch ein rüstiger Läufer wäre, den Weg nicht unbelastet und unbeschäftigt zu Fuß machen. Aber der gemeine Mann ist eben in alleweg bescheiden, und nur der Kulturmensch taxiert seine Leistungen so hoch, weil er mehr Bedürfnisse hat als der andere. –
Es war die Abenddämmerung hereingebrochen, als wir im Dorfe Welschensteinach ankamen. Der Wendel mußte hier im »wilden Mann« seine Gäule erquicken und sich selber. Ich ging hinauf zur Kirche, die mitten im Friedhof auf einem Hügel gelegen ist.
Seit mehr denn dreißig Jahren war ich nicht mehr hier gewesen, so nahe das Dorf auch bei Hasle und Hofstetten liegt.
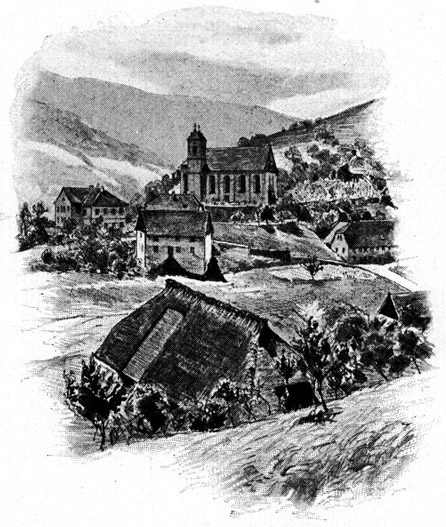
Es gehört zu meinen Liebhabereien, auf einem Kirchhof von Grab zu Grab zu gehen und die Namen der Toten zu lesen.
Als Student hatte ich den Kirchhof von Welschensteinach schon in diesem Sinne abgesucht und erinnere mich noch einer originellen Grabschrift. Sie lautete:
Johann Mellert ist allhier gestorben.
Hat sich etwas Geld erworben;
Er war fleißig und brav
Und geduldig wie ein Schaf.
Der Dichter dieser Verse war ein Dorfschreiner und der Tote ein lediger Knecht. Heute ist dies Grab verschwunden samt der Inschrift und der Dichter wohl auch.
Ich traf diesen Abend bei einem Gang an den Gräbern hin ein armes Maidle, das ebenfalls von Grab zu Grab ging und die Blumen begoß. Da dies unmöglich lauter Verwandten gelten konnte, so fragte ich und erfuhr, daß es die Gräber von Toten begieße, deren Angehörige in den Bergen und Tälern ringsum wohnen und einen zu weiten Weg haben zum Kirchhof.
Das Maidle bekommt dafür von den Bürinnen Milch und Speck und Bohnen, und damit ernährt es sich und seine Mutter, die dort drüben in einem Häuschen an der Halde krank in ihrem Kämmerlein liegt.
Beide sind so arm, daß sie nicht einmal eine Ziege halten können; ihr ganzes lebendes Inventar ist eine Henne.
Und doch scheint die Pflegerin der Gräber so zufrieden als die zwei Männer auf den Hallen. Ich mußte ihr noch zureden, von mir ein Geschenk anzunehmen, und während ich dann noch einige Augenblicke in der dunkeln Kirche weilte, sang sie draußen über den Gräbern ein Lied. Ich aber sagte mir: »Glückselig der Mensch, der nur ein Huhn besitzt, über die Gräber der Toten geht und singt, singt aus der Fülle seines Herzensfriedens!« –
Es war indes Abend geworden, und wir fuhren das Tal hinaus. Trotz der Dunkelheit erkannte uns ein Mann, der zu Fuß des Weges ging und ums Mitfahren bat.
Es war der Heinrich Mannheimer vom Stamme Levi, der Bruder des Isaak, von dem ich »im Paradies« erzählt. Er kam vom Viehhandel und war auf dem Heimweg. Wir ließen ihn gerne aufsitzen, und ich sagte ihm, es sei eine Ehre für mich, wenn einer vom Stamme Levi mit mir fahre; denn seine Ahnen hätten schon vor mehr denn zwei Jahrtausenden im Tempel auf Sion dem Herrn gedient.
Fürwahr, einer vom Stamme Levi zu sein ist in meinen Augen eine Ehre und mehr wert, als einen Streber zum Vater zu haben, der ob seiner Katzenbuckeleien und seines Servilismus geadelt wurde.
Ich halte aber auch auf alle jene gelehrten und wirklich verdienstvollen Männer nichts, die ob ihrer Leistungen geadelt werden und es annehmen. Sie trennen sich dadurch von ihrer seitherigen Sippe, der sie das Talent verdanken, durch welches sie empor gekommen sind. Und das ist nicht recht, vielmehr meines Erachtens eine Schande, weil man nie Vater und Mutter verleugnen soll, auch wenn sie noch so arm und niedrig waren.
Freilich, wer in der Welt und bei dem großen Haufen der gebildeten und ungebildeten Menschen was gelten will, darf derartige Auszeichnungen nicht verschmähen; denn nach diesen wird der Mann in der »öffentlichen Meinung« und in der »Gesellschaft« geschätzt und geehrt.
Titel, Orden und, wo diese fehlen, ein Sack voll Geld, diese Dinge machen den Mann aus im heutigen Leben und haben ihn schon lange ausgemacht.
Ich meine aber, eine Kuh gebe nicht mehr Milch und sei nicht mehr wert, wenn sie zehn Glocken am Halse hängen hat, und das Pferd ziehe nicht besser und habe keine hervorragenderen Eigenschaften vor seinen Mitgäulen, wenn es auch ein Dachsfell auf dem Kummet trägt.
Und ob die Kuh Bläß oder Scheck heißt, sie ist und bleibt doch eine Kuh. Und Esel bleibt Esel, und Schaf bleibt Schaf – wenn ich ihnen noch so viele Titel und Bänder anhänge.
Doch wer den zwei allmächtigen, alten Weibern – der öffentlichen Meinung und der Gesellschaft – imponieren will, der lasse sich Kreuze, Sterne und Titel anhängen, und er wird ein »angesehener Mann« sein, wenn auch nicht vor dem Herrn des Himmels oder vor den wenigen Vernünftigen, so doch vor den genannten zwei Kinderstuben-Weibern. –
Aus den Höfen und Hütten am Weg und an den Halden hin zuckten bei unserm Weiterfahren bereits die Lichter wie Sterne. Bei allen aber konnte mir der Levite sagen, wer darin wohne. Er kennt die Geschichte von zwei Generationen und weckte mir die Erinnerung an manchen Bur, der längst unter den Toten ist, den ich aber in meiner Knabenzeit jung und lustig auf den Märkten von Hasle gesehen habe. –
Einsam steht am Weg eine Hammerschmiede. In ihr wohnt als Greis ein Nachbarssohn aus den Tagen meiner Kindheit, des »Sandhasen Xaveri«, ein Schmied und Schmiedssohn.
Wie oft hab' ich dem Xaveri zugeschaut, wenn er Pferde beschlug, und ihm geholfen bei seiner Arbeit; und wie glücklich war ich, wenn er mich anstellte, gemeinsam mit ihm ein Stück glühendes Eisen zu schmieden.
Um dieses Glückes willen wollte ich ihn heute wenigstens von der Straße aus begrüßen trotz der Dunkelheit.
Seine Söhne kamen auf unser Rufen ans Fenster und sagten, der Vater sei krank und längst zu Bett. Ich fuhr von dannen und sagte mir im stillen: So klopft denn der Tod auch schon beim Xaveri an; und doch meine ich, es seien erst zwanzig Jahre, seitdem wir zusammen geschmiedet haben, während es fünfzig sind. Und es überkam mich die Flüchtigkeit und Armseligkeit unseres. Lebens derart, daß ich schwieg und in mich hineinbrütete bis Hasle, wo der Levite uns verließ.
Außerhalb des Städtchens wandelte die heutige Jugend ihren abendlichen Korso ab wie ehedem, wo auch ich dabei war.
Meine Melancholie steigerte sich, und ich war froh, als wir in Hofstetten landeten und ich im Bette meine Stimmung begraben konnte.
Am 3. Juni.
Ein harter Tag; es gilt, das Paradies wieder zu verlassen und heimzukehren. Pfingsten ist nahe, und ich will dieses Jahr nicht in Hofstetten, sondern in Freiburg über den Heiligen Geist predigen.
Den Heimweg nahm ich, wie im vorigen Jahre, durchs Elztal. Der Sepp führte mich bis Waldkirch, wo die Bahn einmündet. Als wir auf der Höhe der Wasserscheide zwischen Kinzig und Elz angekommen waren, brach ein Gewitter los. Blitze zuckten, Donner rollten, und strömender Regen fiel nieder.
Die Donnerschläge, welche mächtig dröhnten in ihrem Widerhall an den Bergspitzen hin, übertönten die elegische Stimmung in meinem Innern.
Als wir aus dem Wald heraus waren, hatte das Gewitter aufgehört. Die Sonne brach siegreich zwischen dunkeln Wolken hervor, die Vögel sangen wieder, die Hirtenknaben jauchzten, und die wilden Rosen und die goldigen Ginsterblumen lachten unter Tränen mich an. Lachen unter Tränen ist Elegie, und diese Elegie der Naturkinder war Balsam für die meinige. Ich schwieg völlig, um die Natur reden zu lassen.
»Herr Pfarr'!« meinte der wackere Sepp, »hat Euch das Wetter so verschreckt, daß Ihr so still sinn?« Er hatte keine Ahnung davon, daß die wilden Rosen, die goldenen Blumen, die siegende Sonne, die singenden Drosseln und die jauchzenden Hirten es mir angetan und mich still gemacht hatten.
Ich machte einen Versuch, dem Sepp meine Stimmung zu erklären, und siehe da, er verstand mich, weil die Volksseele von Gottes Gnaden ist.
Und wie drang ich in seine Seele? Ich sprach: »Sepp, wenn Ihr am frühen Morgen, da die Sonne über dem Urwald von Hasle herauskommt, hinausgeht, mit Eurer Sägez, um Klee zu mähen für Euern Gaul – und wenn dann der Tau glitzert auf allen Gräsern und die Vögel singen und die Blumen blühen und vom Kirchturm her die Morgenglocke dazu läutet – und es ist niemand draußen als Ihr allein auf dem Kleeacker am Walde – wie ist es Euch dann? Spürt Ihr da nichts?«
»Frili spür' i's,« gab der Sepp laut zur Antwort; »es grift mi jedesmol a, aber i kann's nit sage, und i weiß nit, will i singe oder bete vor Freud', drum bin i still.«
»So geht's mir jetzt, Freund,« sprach ich, »da ich schaue und horche, wie's singt und sonnt und lacht und jauchzt nach dem heutigen Gewitter. Aber sagen kann ich's auch nit. Das läßt sich nur spüren, aber nit sagen.«
Jetzt wurde dem Sepp mein Schweigen sonnenklar. Still fuhren wir weiter; denn der Geist Gottes in der Natur ging durch zwei Menschenseelen; sie spürten ihn, und sie schwiegen. Ihr Schweigen aber war ein Gebet.
Oh, was ist das Volk ein Meer! Und was ist es ein Genuß, in seinen Tiefen zu fischen und in seiner großen Naturseele zu lesen!
Volk und Meer, wie viele Ähnlichkeit haben sie. Das Meer als der Urquell alles Wassers ist das Blut der Erde, das Volk als der Jungbrunnen des Menschengeschlechts das Blut der Menschheit.
Das Meer brandet und wogt über drei Vierteile der Erde hin, und das Volk ist der größere Teil der Menschenwelt. Es ist in seinem Seelenleben so unbekannt wie das Meer in seinen Tiefen. Und so wie dieses reicher ist an Lebewesen als das Land, so ist auch das Volk reicher an allen menschlichen Vorzügen als die Welt der Städter und der Gebildeten. –
Am Bahnhof in Waldkirch schied ich von meinem wackern Fuhrmann. Ich beneidete ihn; denn er durfte zurückkehren in die Berge des Paradieses, ich aber mußte ins »feindliche Leben«.
Eines tröstete mich. »In drei Monaten,« so sagte ich mir, »ist September, und da kannst du wieder ins friedliche Tal.«
Mit den Erinnerungen an diese Septembertage des Jahres 1897 will ich das Abendläuten fortsetzen und beschließen.
Hofstetten am 13. September.
Heute bin ich zu meinem Herbstaufenthalt wieder hier eingetroffen. Auf der Herreise fuhr ich mit dem Freiburger Weihbischof Dr. Knecht, der durchs Kinzigtal ins »Reich«, d. i. in den preußischen Regierungsbezirk Sigmaringen, sich begab, um dort zu firmen.
Dr. Knecht ist ein »Studienfreund« von mir aus den Rastatter Tagen her, aber, obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen, sehen wir uns nicht jedes Jahr zweimal.
Es hängt dies mit meinen demokratischen Grundsätzen zusammen, die schuld sind, daß ich einerseits keine Besuche mache bei »hohen Herrn« und anderseits bei solchen auch nicht gerne gesehen bin.
So bringt mich das verfluchte demokratische Wesen, welches seit 1849 wie eine Erbsünde mir in allen Gliedern liegt und drum auch in allen meinen Schreibfedern und selbst in der Tinte steckt, um manche Ehre und um manchen Genuß.
Doch das eine Gute hat dann wieder mein demokratisches Blut; es tröstet mich über diese Verluste und läßt mich im Umgang mit dem »gemeinen Volk« Perlen finden, die man vergeblich suchen würde bei den obern Zehntausend.
Drum liebe ich – im Gegensatz zu dem alten Hofpoeten Horazius – das gemeine Volk und suche es auf.
Christus Jesus, unser herrlichstes Vorbild in allem, verkehrte nicht mit Hohenpriestern und nicht im Palaste des Herodes, sondern er weilte mit Vorliebe beim gemeinen Volke, und seine Jünger waren Fischer und Zöllner. –
Ich finde hier kein so schönes Herbstwetter, wie sonst. Graue Nebel hängen an den Bergen herunter, und aus ihnen rieselt ein feiner Regen herab auf Feld und Flur. Aber gleichwohl bin ich froh, wieder allein und im Paradiese zu sein.
Napoleon I. hat gesagt, den Boden seiner Heimat und seiner Jugendzeit würde er jederzeit am Geruch wieder erkennen, selbst wenn er nichts von ihm sehen könnte. So geht es mir, wenn ich ins Kinzigtal komme, und drum rieche ich selbst durch Nebel und Regen hindurch den heimatlichen Boden und die Jugendjahre. Und das ist Grund genug, froh zu sein, auch bei Regenwetter.
Was zieht mich, je älter ich werde, um so mächtiger in die Heimat? Es ist die Erinnerung an die Tage des Jugendglücks. Je älter man wird, um so strahlender steht vor unserer Seele der Jugendhimmel mit seiner sonnigen Morgenröte. Und immer und immer wieder in diese Morgenröte zu schauen, selbst durch Nebel und Regen hindurch, während rings um mich Friede herrscht, das ist hier mein Paradies.
Heute umfing mich dieser Friede doppelt; denn das naßkalte Wetter trieb die Menschen von der Straße und von den Feldern.
Nur der Tierarzt von Hasle fuhr diesen Nachmittag hier durch zu einem kranken Vierfüßler, und arme Schulkinder ziehen naß und frierend der Heimat zu.
Früher hatten die Tierärzte viel weniger zu tun als heutzutag, wo die Seuchen unter dem Rindvieh nicht aufhören wollen. Warum? Weil man seit Jahrzehnten selbst das liebe Vieh, vorab die Ochsen und die Kühe in »Kultur« genommen hat. Wo aber die Kultur hinkommt, da geht's mit der Gesundheit und mit der Widerstandskraft gegen Krankheiten abwärts.
Das Vieh wird in unseren gebildeten Tagen von der Weide fern gehalten und jahraus jahrein in die Ställe gesperrt, hier an Ketten gelegt und mit allerlei Kunstfutter und künstlich getriebenem Gras- und Heuwerk gefüttert.
Ein alter Bauer, dem diese neumodische Viehkultur auch nicht einleuchten will, sagte mir einmal die folgenden vortrefflichen Worte: »Jetzt haben wir die verkehrte Welt; das Vieh, das auf die Weide gehört, bindet man an, und unsere Buben, die sowieso den ganzen Tag springen, müssen turnen!«
Je mehr man auf obige Art unsere Viehzucht »veredelt« und je mehr unser Viehfutter künstlich hergestellt wird, um so empfänglicher werden die Tiere für Seuchen und um so geringer ihr Widerstand gegen Krankheiten.
Ich bin überzeugt, daß die vielen Seuchen, die unter dem Vieh sind, von der »Kultur« herkommen und von den künstlichen Mineralien, welche die Tiere im Futter in sich aufnehmen.
Mir erzählte der Besitzer einer Schafherde, sein Schäfer habe einen Herbst und einen Winter hindurch auf Wiesen geweidet, die mit Kunstdünger gesegnet waren – und alle Tiere wurden, wie es sich beim Schlachten erwies, lungenkrank.
Die Kultur ist eben auch eine Art Kunstdünger, der mit seinem Kali und Kainit alles ins Kraut schießen läßt, aber alle Säfte vergiftet und die arme Menschheit wie das liebe Vieh siech und krank macht.
Alles Naturwüchsige und Wilde ist kraftvoll, stark und gesund. Die wilde Rose hält jeden Kältegrad aus, die veredelte dagegen ist empfindlich. Ähnlich verhält es sich auch mit dem wilden und dem veredelten Kirschbaum und mit der Rebe.
So auch beim Menschen; der Stadt- und Kulturmensch ist trotz Kanalisation und aller möglichen hygienischen Vorsichtsmaßregeln für hunderterlei Krankheiten disponiert, die der Naturmensch nicht kennt.
Das Gegenteil zu behaupten, kann nur einem deutschen Universitäts-Professor einfallen. Und es ist einem solchen auch eingefallen.
Vor einiger Zeit brachten mit großem Behagen alle Manchesterblütter – die Frankfurterin voran – die Nachricht, daß ein Professor in München herausgerechnet habe, daß die städtische Fabrikbevölkerung einen größeren Prozentsatz militärtauglicher Leute liefere als das Land.
Lujo Brentano nennt sich in undeutscher Art der große Rechenkünstler und Bauernfresser. Der Mann und seine Nachbeter haben aber uns zu sagen vergessen, wie viele dieser diensttauglichen Fabrikarbeiter von Eltern abstammen, die im Laufe der letzten Jahrzehnte mit gesundem Bauernblut in die Städte gezogen sind. Die Herren mögen einmal die zweite und dritte Generation dieser in die Fabrikstädte eingewanderten Bauernfamilien abwarten, dann werden sie sehen, wie die Stadtkultur die Menschen degeneriert.
Solange die Auswanderung vom Land in die Fabriken derart zunimmt, daß wir schließlich mehr Fabrikarbeiter als Bauern haben, wird der Prozentsatz sich eine Zeitlang immer brillanter stellen zugunsten obiger Berechnung.
Den Herren am Steuerruder des Staates aber, die so besorgt sind für den Aufschwung unserer Fabriken und ganze Kriegsflotten zum Schutze der Industrie ausrüsten, möchte ich bei der Gelegenheit auch eine kurze Berechnung vormachen.
Je mehr Leute vom Lande in die Städte ziehen und dort Fabrikarbeiter und Taglöhner werden, um so mehr wird sich unser Militär aus den untern Klassen der städtischen Bevölkerung rekrutieren und um so mehr werden damit sozialdemokratische Elemente in unsere Kasernen kommen. Das Volk in Waffen, dessen konservatives Fundament bis jetzt noch der Bauernsohn war, wird so, um es gelind zu sagen, mehr und mehr sozialdemokratisch »angehaucht«.
Diese Rechnung dürfte viel richtiger sein als die des genannten Professors Lujo.
Ein fernerer Segen in der gleichen Richtung wird der folgende sein: Wenn es zu einem Kriege kommt, so stehen alle Fabriken mehr oder weniger still, und da die große Masse der Bevölkerung Fabrikarbeiter sind, werden diese brotlos. Die Folge davon wird wohl Revolution zu Hause sein, während das Heer draußen im Feld steht.
Am 14. September.
Die Herbstsonne will auch heute nicht kommen. Der Regen hat zwar aufgehört, aber der Himmel bleibt bedeckt. Auf den Matten im Tal wenden die Landleute ihr Öhmdgras, um es in der Luft zu trocknen, dieweil die Sonne fehlt.
Ich gehe kurz vor Mittag talabwärts an ihnen vorbei, setze mich aber bald, ermüdet, auf einen Stein in ihrer Nähe und bewundere im stillen die Geduld, mit der diese Menschen sich jeder Laune des Wetters fügen, und die Mühe, die sie sich geben, um die Erträgnisse ihrer Felder und Wiesen unter Dach zu bringen. –
Zu meinen Füßen kämpfen Ameisen mit enteilt Wurm, den sie töten wollen, um ihn zu verzehren. Schmerzvoll windet sich der überwältigte Staubkriecher unter den Bissen seiner zahlreichen Feinde.
Ueberall, so sagte ich mir, diesem Kampfe zuschauend, Streit und Krieg auf Leben und Tod in der Natur, wie im Menschenleben.
Ja, selbst im Himmel ging es seinerzeit nicht ohne Kampf ab; denn die Heilige Schrift erzählt uns auf ihren ersten Blättern: »Es erhob sich ein großer Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt samt seinen Engeln.«
Also Kampf im Himmel, Kampf auf Erden, Kampf unter den Elementen, Kampf unter den Tieren, Kampf unter den Menschen und Kampf selbst unter den Engeln!
Und so, denk ich mir, muß es sein, und so wird's drum bleiben, solange diese Sonne über diese Erde geht. Darum werden die Friedensapostel unserer Tage ihr ideales Ziel nie erreichen, weil Kampf und Streit herrschen werden bis zum Weltgericht, d. i. bis zum Ende der irdischen Tage.
Aber Krieg kann sein, wenn die Völker auch nicht immer in einer Rüstung stecken, die sie niederdrückt und alle höheren Aufgaben der Menschheit beeinträchtigt.
Der Militarismus hat in unserer Zeit in einer Art zugenommen, von der selbst das römische Weltreich keine Ahnung hatte, und die alten Römer, welche doch die ganze Welt unter ihrer Gewalt hielten, waren Zwerge an Militärmacht der unsrigen gegenüber.
Zur Zeit des Kaisers Hadrian schützten 350 000 Legionäre das Weltreich, welches vom atlantischen Ozean bis zum Euphrat und von Schottland bis an den Atlas und an die Wasserfälle des Nil reichte.
Heute hat Europa allein über drei Millionen Krieger in Friedenszeiten auf den Beinen, und die Völker des 19. Jahrhunderts lassen sich das gefallen.
Ja noch mehr, die Bürger unserer Städte, die im Bierhaus immer über den wachsenden Militarismus jammern, betteln und petitionieren förmlich um Kasernen und Soldaten. Die Städte des römischen Weltreichs dagegen verbaten es sich, daß man Soldaten in ihre Mitte lege. Die Legionen und Kohorten der römischen Kaiser lagen alle in Standlagern außerhalb der Städte, und in den fünfhundert Städten Asiens sah man zur Zeit Hadrians nicht einen Soldaten und nicht einen Offizier. Und selbst die Wibervölker jener Tage scheinen diesen Verlust verschmerzt zu haben.
Die ernsten Römer duldeten auch nicht, daß Frauen den militärischen Übungen anwohnten. Der große Geschichtschreiber Tacitus erzählt darüber einen interessanten Fall. Ein Prokonsul in Asien, aus dem angesehensten Geschlechte der Pisonen, Cnejus Piso, der mutmaßliche Mörder des Germanikus, hatte zur Zeit des Kaisers Tiberius sein Weib Plancina den Manövern der Legionen anwohnen lassen.
Tacitus sagt, daß dies überall Mißbilligung fand und mit ein Grund war, daß Cnejus Piso seines Oberbefehls entsetzt wurde. Er tadelt die Dame mit folgenden Worten: »Plancina hielt sich nicht in den Schranken weiblichen Anstandes, sondern wohnte den Übungen der Reiterei und den Manövern der Kohorten bei.«
Heutzutag sind Damen Chefs von Regimentern, nehmen Paraden derselben ab und wohnen den Manövern bei.
Die Römer hatten scheint's in der Richtung eine andere Auffassung von ihrer Armee als die Heereskönige unserer Tage. Ich für meine proletarische Person halte es in dem Punkt mit den Römern.
Freilich hatten diese auch keine regierenden Königinnen und Kaiserinnen. Sie überließen es den wilden Völkern jener Jahrhunderte, sich von Weibern regieren zu lassen. –
Kein Wunder, wenn die Römer bei den geringen Militärlasten für wirkliche Kulturausgaben Geld im Überfluß hatten.
Wir haben einen unparteiischen Zeugen hiefür an dem afrikanischen Kirchenschriftsteller Tertullian, der unter den Kaisern Septimius Severus, Caracalla, Heliogabal und Alexander Severus lebte und schrieb. In seinem Buche »über die Seele« spricht er sich über das römische Reich also aus: »Die Welt ist mit allem ausgerüstet, sie kultiviert sich täglich mehr, sie ist an Wissen reicher als in der Vorzeit. Alles ist zugänglich, alles bekannt, alles voll Geschäftigkeit. Einst unfruchtbare Einöden sind von schönen Landgütern bedeckt; Saatgefilde haben die Wälder, Herden die reißenden Tiere verdrängt. Getreide sprießt im Wüstensande, Felsen werden bepflanzt, Sümpfe trockengelegt. Es gibt jetzt so viele Städte als ehedem Häuser. Nicht flößen starrende Inseln und Klippen mehr Schrecken ein; überall ist Wohnung, überall Staat, überall Leben. Das Menschengeschlecht ist so zahlreich, daß es der Welt schon zur Last wird.« Mit Recht sagt der berühmte Kenner der römischen Geschichte, Mommsen, die römische Kaiserzeit sei mehr geschmäht als gekannt. Und Tertullian spricht für diese Ansicht.
Als Heilmittel gegen diese Übervölkerung betrachtete Tertullian Pest, Hungersnot, Kriege und Erdbeben.
Merkwürdig! Als der Afrikaner so schrieb, hatte das ganze römische Reich etwa 85 Millionen Einwohner. Was würde er heute erst sagen, wo auf dem gleichen Ländergebiet einige hundert Millionen wohnen?
Hungersnot, Krieg, Pest und Erdbeben können uns, in Deutschland wenigstens, nicht viel »helfen« gegen die Übervölkerung. Hunger gibt's bei uns nicht mehr wegen der außerordentlich entwickelten Verkehrsverhältnisse. Kriege sind bald vorüber in unserer Zeit, und wenn auch einige Millionen Menschen dabei das Leben lassen, so gleicht sich das rasch wieder aus.
Auch die Pest wird nie mehr so verheerend hausen wie im Mittelalter, weil unsere Heilkunst viel weiter voran ist und die Krankheiten erfolgreich bekämpft und lokalisiert werden.
Es bleiben also nur noch die Erdbeben übrig; aber auch diese sind bei uns nicht besonders zu fürchten, wenn nicht auf Gottes besondern Befehl die Erde sich spaltet und Millionen verschlingt.
Was hilft aber, wenn weder die Erde ihren Schlund auftut, noch die Menschen sich selber auffressen wollen – gegen die drohenden Gefahren der Übervölkerung?
Antwort: Das, was in China und Indien auch geholfen hat und noch hilft, Hunderte von Millionen zu ernähren – die Landwirtschaft, die Kultur des Bodens.
Wenn einmal der Erdboden bei uns bebaut wird wie in China, wo die Menschen auf dem Wasser wohnen, um Boden für die Kultur zu gewinnen, dann werden noch Millionen Brot finden, Millionen, welche der Industriestaat in die Welt setzt, aber mit der Zeit nicht mehr wird ernähren können.
Der Sakristan von Hofstetten weckte mich aus meinen Gedanken auf durch die Mittagsglocke. Ich erhob mich von meinem Stein und ging wieder dem Dorfe zu.
Ich habe es nie gerne, wenn ich im Freien bin und der Mesner seine Angelusglocke läutet, sei es am Morgen, sei es am Abend. Um den braven Hofstettern, die in alter, schöner Sitte beim ersten Glockenton den Hut abnehmen und beten, kein Ärgernis zu geben, muß ich meine Behauptung ebenfalls abnehmen. Dies bekommt aber, namentlich bei kühlem oder windigem Wetter, meiner ziemlich kahlen Kopfhaut nicht gut, und rheumatische Schmerzen stellen sich gerne ein. Drum ist es mir unlieb, wenn die Betglocke von Hofstetten mich aus freiem Felde trifft.
In der Stadt gibt man heute kein Ärgernis mehr, so man bedeckten Hauptes bleibt beim Läuten des Angelus. Als ich noch Student in Freiburg war, zogen wir junge Theologen alle um 12 Uhr, wenn die Münsterglocke den Angelus läutete, barhäuptig durch die Straßen dem Konvikt zu. Heute geschieht das nimmer.
Wenn ich, sicherlich kein Betbruder, etwas zu sagen hätte, so müßten mir alle Theologen, ob Studenten oder Priester, die alte schöne Sitte auch in der Stadt beibehalten; denn man gibt auch hier oft Landleuten ein Ärgernis durch sein bedecktes Haupt.
Im Mittelalter knieten die Menschen auf der Straße nieder und beteten, wenn die Glocke sie an die Menschwerdung des Sohnes Gottes erinnerte. Und wer da glaubt, daß das ewige Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, der brauchte sich fürwahr vor den Ungläubigen unserer Tage nicht zu schämen, sein Haupt zu entblößen und zu beten.
Wenn bei den Türken der Muezzin fünfmal des Tages von der Moschee herab zum Gebete ruft, so läßt jeder Gläubige Mohammeds die Arbeit ruhen und betet, der Kaufmann und seine Kunden im Laden, wie der Beamte in seiner Kanzlei und der Wanderer auf der Straße.
Wahrlich, die Türken sind doch bessere Menschen ihrem Gott gegenüber als wir neumodische Christen! –
Beim Dorfe angelangt, wurde ich Zeuge einer eigenartigen Szene. Ein armes Weib, die Frau eines Taglöhners, stund auf der Straße neben dem Unterlehrer, der eben einen Spaziergang angetreten hatte, und machte ihm laute Vorwürfe.
Sie weinte dazu, und das kleine Mädchen, das sie an der Hand führte, weinte mit ihr. Und warum schrie das Weib den jungen Kultur-Pionier an? Weil er ihren Kindern so viel aufgebe und ihnen so viele Tatzen aufmesse, wenn sie die Aufgaben nicht können.
»Ich brauch' meine Kinder zur Arbeit ums tägliche Brot,« meinte sie, »und kann sie nicht noch lange hinter die Bücher setzen, wenn sie einen halben Tag in der Schule gewesen sind. Und zu was auch Kinder, die später nur Knechte und Mägde werden, so plagen mit Lernen!«
Das Weib, mir wohl bekannt, hatte ob der letzten Worte meinen ganzen Beifall. Ich vermittelte aber zwischen ihr und dem ob des unerwarteten Angriffs ziemlich fassungslos gewordenen jungen Pädagogen.
Der Frau sagte ich, der Lehrer sei nicht schuld, daß ihre Kinder so viel lernen müßten, was sie im späteren Leben nicht brauchten. Diese Weisheit käme von oben, beziehungsweise von unten, von Karlsruhe, und werde dem Lehrer befohlen. Diesem aber riet ich, die Kinder armer Leute, denen es tagsüber oft an Zeit und abends an Licht fehle, milder zu behandeln und nicht zu schlagen, da sie durch ihre Lebensstellung schon geschlagen genug seien.
Der Vater des derzeitigen badischen Kultusministers Nokk pflegte als Gymnasiumsdirektor seinen Schülern nie Hausaufgaben zu geben, und sie haben bei ihm doch was gelernt. Sollte, was bei Primanern und zukünftigen Staatsdienern möglich war, nicht auch möglich sein hei Bauernkindern, die später nur Knechte und Mägde werden?
Mir kamen die Tränen des Weibes und ihres Kindes vor wie ein Fluch über die Kultur- und Bildungswut unserer Zeit.
Aber, um gerecht zu sein, will ich auch sagen, daß selbst im Religionsunterricht viel zu viel auf das Auswendiglernen daheim gehalten wird. Da gibt es Katecheten, bei denen die Kinder so lange geplagt werden, bis sie eine biblische Geschichte wörtlich hersagen können. Ich nenne das sinnlose Dressur und Gehirnplage. Man mache es doch wie jede alte Großmutter, die ihren Enkeln mit dem gesunden Menschenverstand in schlichten Worten Geschichten erzählt und die Kinder wieder eben so schlicht sie nacherzählen läßt.
Aber es ist ja viel leichter, den Kleinen zu sagen: »Die und die Geschichte wird aufs nächstemal auswendig gelernt,« als es zu machen, wie die Großmutter. Und doch hat Christus, der Herr, gesagt, man solle seine Wahrheit lehren und nicht auswendig lernen lassen.
Die besten Christen lebten in jenen Jahrhunderten, da man den Menschen das Christentum durch mündliche Lehre und nicht durch Bücher und durch Auswendiglernen beibrachte!
Aber heutzutag. ist ja die ganze Erziehung nur Schablone und Dressur. Wir leben in alleweg im Zeitalter des Unteroffiziers, und jener Franzose, der gesagt hat, Deutschland gehöre den Preußen und den Unteroffizieren, hat nicht fehlgeschossen. –
Am 15. September.
Diesen Morgen waren zwei Kinzigtäler Pfarrer bei mir, der von Husen und der von Wittichen. Als sie wieder fort waren, kam mir der Gedanke, daß der sogenannte niedere Klerus das »gemeine Volk« der Hierarchie bilde mit allen Leiden und Vorzügen dieses Volkes.
Der niedere Klerus stammt aus dem Volke und lebt unter dem Volke.
Er trägt wie das Landvolk die meisten Lasten und Pflichten und hat die wenigsten Rechte und Privilegien.
Er ist geduldig und gehorsam wie das Volk und läßt sich von seinen Obern so viel gefallen, wie der Bauer von den Herren Beamten.
Er muß wie das Volk mit wenigem zufrieden sein, während die Obern meist in guten Pfründen leben.
Nie wäre es dem niedern Klerus eingefallen, um eine Aufbesserung seiner elenden Besoldung zu petitionieren. Alle niedern Beamten des Staates haben sich gewehrt um die Erhöhung ihres Einkommens, der niedere Klerus nicht. Er nimmt, was er bekommt, und schweigt, wenn er nichts bekommt.
Er muß wie der Bauer arbeiten im Schweiße seines Angesichtes bei Wind und Wetter, während seine und des Volkes Herren in behaglichem Papierregiment dahinleben und harte Arbeit nicht kennen.
Er muß, wie das Landvolk die Stadt-Menschheit regeneriert durch gesundes Blut, ähnlich auch in den oberen Stufen der Hierarchie den gesunden Menschenverstand erneuern, indem einzelne seiner Glieder dorthin aufsteigen.
In Kriegszeiten hat das gemeine Volk die größten Opfer zu bringen an Gut und Blut, und ähnlich muß in religiösen Kämpfen vorab der niedere Klerus im Vordertreffen stehen und die meisten Schläge aushalten, während andere oft fern vom Kampfplatz den Frieden abwarten.
Der niedere Klerus endlich glaubt alles, trägt alles und duldet alles, was von oben her über ihn beschlossen wird, wie der Bauer, ja noch mehr.
Ein Bauer darf doch seine Ehre selbst retten, wenn er sie angegriffen fühlt. In der Erzdiözese Freiburg aber muß ein Geistlicher, der an seiner privaten Ehre gekränkt wird, erst bei der Kirchenbehörde anfragen, ob er klagen darf.
So selten es auch vorkam in der Geschichte, daß die Bauern Revolution machten und sich empörten, beim niederen Klerus kam das gar nie vor. Er ist also geduldiger als der geduldigste Bauer, und das verleiht ihm die Gloriole des Märtyrers; sein Lohn wird und muß drum sein: » Centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit«. (Er wird hundertfach empfangen und das ewige Leben besitzen.)
Und der Glaube an diesen Lohn gibt dem niederen Klerus wie dem Volke die Kraft, Lammesgeduld zu üben alle Tage seines Lebens.
Ist das nicht alles bewunderungswert?
Wie hab' ich räudiges Schaf schon die »Mitbrüder« beneidet, die alles dulden und alles loben oder zu allem schweigen können!
Wenn's keinen Himmel gäbe, er müßte erfunden werden für das gemeine Volk der Bauern und der Kleriker; denn hienieden sind beide die Getreuen, die Geduldigen und die Gehorsamen, meist ohne Lohn und ohne Anerkennung. –
Als sollte ich in meinem Vergleich bestärkt werden, kam am Nachmittag noch der Pfarrer von Weiler, jenseits der Kinzig. Von ihm erfuhr ich, wie der Landpfarrer sich abmühen muß, nur um seine leibliche Nahrung genießen zu können.
Hasle ist, wie ich in meiner »Jugendzeit« erzählt, berüchtigt ob des schlechten Fleisches, das seine Metzger verkaufen. Das uralte Sprichwort:
Isch amme Ort a alte Kuah,
So goht sie immer Hasle zua –
ist heute noch wie vor fünfzig Jahren in voller Geltung, wie ich selbst erfahre, so oft ich »im Paradiese« weile.
Der obige Pfarrer nun sagte mir, er habe sich längst eine kleine Fleischhackmaschine angeschafft. Wenn das Haslacher Kuhfleisch gekocht auf seinen Tisch kommt, so hackt er es zuerst klein, und dann erst genießt er's.
Meine Vaterstadt hat in dem halben Jahrhundert, das vergangen ist, seitdem ich in ihren Straßen als Gassenjunge lebte, riesige Fortschritte gemacht. Sie besitzt heute Fabriken, ein Liebhabertheater, hat Symphoniekonzerte und elektrisches Licht – aber immer noch altes, zähes Kuhfleisch. Ich gäbe alle jene Fortschritte um ein gutes Stück Ochsenfleisch. –
Als ich gen Abend noch einige Zeit vor dem Haus auf und ab ging, begegnete mir ein altes Mütterle. Es war auf dem Heimweg von Hasle her, wohin es »um 70 Pfennig Himbeere« getragen und verkauft hat.
Die Frau ist 78 Jahre alt und wohnt auf der Hochmunde in mir wohl bekannter, einsamer Hütte. Sie legte heute einen Weg von vier Stunden zurück, um 70 Pfennig zu verdienen, und hat noch vorher droben in den Bergen einen halben Tag gebraucht, um die Himbeeren zu sammeln.
Ich nehme sie mit in die Wirtsstube, erquicke sie mit Brot und Wein und leiste ihr Gesellschaft.
Sie hat nur noch einen einzigen Vorderzahn und, um mit einem römischen Dichter zu reden,
Kauen muß sich die Arme das Brot
mit entwaffnetem Zahnfleisch.
Ich fragte das Mütterle, zu was es das mit Himbeersuchen verdiente Geld verwende, und erfuhr, daß dafür in Hasle alsbald ein halbes Pfund Kaffee gekauft wurde.
Diesen Kaffee trinkt die Großmutter mit ihrer Schwiegertochter, und beiden ist ein »Schüssele voll Kaffee« das liebste Trinken und mehr wert als Essen.
Und das heutige halbe Pfund freut sie doppelt, weil es gleichsam gefunden sei und sie es verdient habe mit dem Beerensammeln. Den vierstündigen Marsch, den sie hin und her gemacht, rechnet sie für nichts.
In meiner Knabenzeit tranken nur an Hochfesten die reichsten Bäuerinnen des Kinzigtals Kaffee; heute hat er leider in jeder Hütte seinen Einzug gehalten. Ja manche arme Wibervölker auf dem Lande leben nur von Kaffee oder richtiger – von Zichorienbrühe.
Zweifellos ist der Kaffee nicht so schädlich wie der Alkohol, sonst müßten die Wibervölker in Stadt und Land ebenso viele Krankheiten haben wie die Bier, Wein und Schnaps vertilgenden Mannsleute.
Schlimmer wird's werden, wenn auch einmal der Tee beim Landvolk Mode geworden sein wird. Und diese Zeit kommt sicher. In meiner Jugendzeit hörte ich in Hasle nie von einem andern Tee als von Kamillen-, Magdalenen- und Lindenblütentee, und ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, daß kein Tropfen chinesischen Tees im Städtle getrunken wurde.
Heute ist Tee bei vielen ehrsamen Bürgersleuten in Hasle an der Abendordnung, und ich bin fest überzeugt, daß schon einzelne Bürinnen Tee trinken, weil es vornehmer ist.
Und wie die Stadt- und Städtle-Mode in den Kleidern die alte Tracht auf dem Lande vielfach verdrängt hat und noch verdrängt, so wird die Zeit kommen, wo die Weiber auf dem Lande auch den Kaffee dem Tee opfern. Mit ihm werden dann auch Migräne und Nervenleiden aller Art die Landweiber ergreifen zum Schaden der menschlichen Gesellschaft und des häuslichen Friedens.
Das Landvolk wird dann nicht mehr imstande sein, mit gesundem Blut die Stadtbevölkerung zu regenerieren, und in den Hütten und Höfen des Schwarzwaldes werden, wie in den Städten, nervöse, aufgeregte, hysterische und migränebehaftete Wibervölker sitzen, die ihren Männern das Leben verbittern.
Wenn die Weibsleute auf dem Lande wenigstens nur einen Absud von Heublumen trinken wollten; der schmeckt genau wie der chinesische Tee, schadet gar nichts und würde nichts kosten. –
Ich fragte das greise Mütterle noch, ob es in seinen alten Tagen und in seiner Einsamkeit, wenn alle andern im Felde arbeiteten und es allein daheim sei, keine Langeweile habe.
»Lange Zit,« so sprach es, »Henn nur die fule Lit. I weiß den ganzen Tag ebbis z'schaffe. I spinn Sommer und Winter und koch d'Suppe und mach d'Knöpfle, wenn die andere uf'm Feld sin, daß sie z'esse henn, wenn sie heimkomme.
Un nit amol z'Nacht han i lange Zit. Der Mond weckt mi vilmol, wenn er vom Gutachertal rufstiegt und über der Heidburg stoht. Aber no nehm' i de Rosekranz und bet für die arme Seele, bis es Morge word.« –
Wenn ein Gebet durch die Wolken dringt, so muß es der Rosenkranz sein, den diese alte Menschenseele auf der Hochmunde nächtlicherweile betet.
Der Mond steht über der Heidburg und streut sein Licht aus wie Silberschaum über das stille Land. Die Sterne ziehen vom Kandel her wie friedliche Schäflein, die im Mondlicht am Himmelszelt weiden. Die Föhren lispeln im nahen Walde. Ueber die Heide schleicht einsam der Fuchs. Drunten im Tobel ruft der Uhu, und in der kleinen Hütte zwischen Heide und Abgrund betet im mondbeglänzten Kämmerlein ein armes, altes Menschenkind – betet für die Toten um die ewige Ruhe und um das ewige Licht.

Wahrlich, solch ein Nachtgebet, es muß zum Himmel bringen und zum Gott des Himmels, der jenseits der Sterne ewig wacht und das Weiblein auf der Hochmunde sieht und hört und erhört; denn Gott, der alle Poesie geschaffen, muß solch poetisches Gebet lieben!
Mir erschien das greise, runzelige Frauenbild mit dem einzigen Zahn, da es so zu mir sprach, wie verklärt, und ich sah es von dannen ziehen wie ein Menschenkind das in alleweg Gottes Wohlgefallen hat, und ich beneidete die arme Matrone oder, richtiger, ich wünschte mir den Seelenfrieden, den sie hat, sie, die glücklich ist, ein halbes Pfund Kaffee verdient zu haben mit Beerenbrechen, und für die armen Seelen betet, wenn der Mond sie weckt im stillen Kämmerlein. –
Am 16. September.
In der Frankfurter Zeitung lese ich diesen Morgen, daß der preußische Prinz Heinrich bei Einweihung eines Schiffes den Ausspruch getan habe, des Kaisers Name sei sein und der Anwesenden Schlacht- und Sterberuf.
Früher lautete der Schlachtruf: » Kyrie eleison«, Herr erbarme dich unser, und der Sterberuf eines jeden Christenmenschen sollte sein: »Herr Gott, sei mir armem Sünder gnädig«, oder »Jesus, dir lebe ich; Jesus, dir sterbe ich; Jesus, dein will ich sein im Leben und im Tode.«
Freilich, noch viel früher, als die römisch-heidnischen Kaiser über die Welt geboten und der Despotismus zugleich Religion war, kannte man einen ähnlichen Sterberuf wie den des Prinzen, und der lautete bekanntlich: » Morituri te salutant, Caesar!«
Daß der Despotismus je wieder zur Religion wird, wie zur römischen Kaiserzeit, davor ist mir nicht bange. Die Zukunft gehört allem eher als dem Despotismus. –
Heute erhielt ich eine Postkarte mit einem poetischen Erguß, den man in seiner Gemütstiefe sicherlich keinem ersten Staatsanwalt zutrauen würde, und doch ist er von einem solchen. Mein Freund Gulat, erster Ankläger in Freiburg, mit dem ich vor kurzem im Elztal bei einem Volksfeste war, weilte zurzeit im Seebad Blankenberghe. Hier wohnte er am 12. d. M. einer Kirmeß bei, und diese begeisterte ihn zu den folgenden Strophen an den einsamen Mann in Hofstetten:
Vor vierzehn Tagen im Tale der Elz,
Wo raget im Tann der moosige Fels:
Ein biederes Volk in ehrsamer Freud',
Geschmückt in der Altvordern würdigem Kleid.
Und heute – am flandrischen Meeresstrand,
Im dünenbewehrten, weitebenen Land:
Der vlämischen Kirmeß derbheitere Art,
Wie Hals und Jordaens sie uns bewahrt!
Und beides – erklingend in einem Akkord –
Läßt fassen sich in ein einzig Wort:
Ein heit'res Völklein auf Gottes Erd,
Wo immer sich's findet – ist liebenswert.
Diese Strophen machen ihrem Dichter sicher alle Ehre. Doch ist derselbe auch in der Lage, fröhlichen Herzens seine Weisen erklingen zu lassen. Er ist ein reicher Mann, verfügt über ungezählte Schätze, hat dazu von den Göttern die Gabe ewiger Jugend und die Gnade, alles zu wissen, ohne sich, wie andere, die Mühe des Lernens nehmen zu müssen.
Wem so alle Schätze der Pandora in den Schoß fielen, der kann leicht singen und fröhlich sein.
Wenn ich ein unabhängiger, geldkräftiger Mann wäre, würde ich auch Verse machen. So aber habe ich mit dem Dichter nur das gemein, daß ich bei der Teilung der irdischen Güter zu kurz kam.
Ein Aufenthalt in einem Seebad tat unsereinem auch gut. Seeluft soll ja besonders heilsam sein für kranke Nerven. Aber die Geschichte ist zu teuer für arme Leute, drum muß unsereiner mit Kinzigluft sich begnügen.
Die Luftkuren für den Leib haben übrigens in meinem Alter, wo jeder ehrliche Mensch den Tod herbeiwünscht, keinen großen Wert mehr. Ich kann hier »im Paradies« meine wunde Seele baden in den Erinnerungen an die goldene Jugendzeit, und das ist mir mehr wert als die Meeresluft und die Kirmeß zu Blankenberghe.
Was ich aber an dem glücklichen Dichter obiger Verse loben muß, ist seine Liebe zum gemeinen Volk, die er stets kundgibt, trotzdem er ein Stadt- und Residenzkind von Geburt und Erziehung ist.
Freilich hat er seinerzeit, da er als Referendar in Hasle amtierte, fleißig Studien gemacht auf den »Hosigen« des Kinzigtales, und es datiert wohl aus jenen Zeiten seine Sympathie für die Buren und ihre Maidle. –
Die Schulknaben von Hofstetten sind meist friedliche Leute. Wenn die Schule aus ist, eilen sie still an meiner Wohnung vorbei, taleinwärts und bergauf. Viele haben einen weiten Weg, bis sie daheim sind, und dort wartetet ihrer die Arbeit; darum haben sie keine Zeit zu Lärm, Zank und Streit.
Nur heute sah ich einem kurzen Kampf derselben zu. Einige wuschen ihre Schiefertafeln in dem Brunnen vor »der Schneeballen«, und dabei gerieten zwei in Zwietracht.
Der eine warf den andern zu Boden, gab ihm einige Faustschläge und ging davon. Die andern, Unbeteiligten, schlossen sich alsbald dem Sieger lachend an und ließen den Besiegten, der weinend von der nassen Erde sich erhob, unbeachtet zurück.
Also auch hier bei diesen sonst harmlosen Knaben ist der Erfolg König und gehört dem, der obenauf ist und obenauf bleibt, die Gunst!
Aber so ist's überall in dem großen Narrenhaus, Welt genannt. Stets beten die Menschen den Erfolg an, halten es mit den Starken und verlachen die Schwachen. So war es zu allen Zeiten, und so wird es bleiben.
Reichtum, Macht, Sieg, Erfolg werden stets die allermeisten Menschen zu Anbetern haben. Ob die Macht und der Reichtum mit Recht oder Unrecht erworben wurden, ist ganz gleichgültig. Dem, der siegt, und dem, der hat, folgt die Ehre und das Vertrauen.
Schon Juvenal sagt:
Niemand fragt, woher der Besitz? Doch mußt du besitzen.
So viel jeglicher Geld in seinem Kasten bewahrt, so viel hat er Vertrauen.
Und wer im Leben eine hohe Stelle erringt, sei's durch Glück, Zufall oder Verdienst, sobald er sie einnimmt, gibt's Knechte genug, die ihn ehren, ihm dienen und ihm schmeicheln. Wenn er noch so unfähig wäre – in den Augen seiner Mitmenschen, denen er schaden oder nützen kann, ist er ein Genie, besitzt alle Weisheit Salomons, und die dümmsten Worte von seinem Munde gelten für geistreich.
Die Menschen gleichen da völlig den Hunden, die vor jedem wedeln, der sie am Strick führt, den Stock schwingt und den Brotkorb hinhält.
Aber auf der andern Seite stehen sie unter dem Hund. Dieser bleibt seinem Herrn getreu und wedelt ihn auch noch an, wenn er arm und ehrlos geworden ist. Nicht so der Mensch. Er wedelt und kriecht nur, solange der Herr in Ansehen und Ehre, in Macht und Würde, in Reichtum und Besitz steht. Fallen diese Eigenschaften, so verläßt er seinen Mann und kriecht vor einem andern.
Nur der Erfolg ist und bleibt König bei den Menschen; geht aber das Kind des Erfolgs oder des Glucks unter, so verlassen die Ratten das sinkende Schiff.
Die sogenannten gebildeten und besseren Menschen sind in der Richtung viel schlimmer als das gemeine Volk. Der gemeine Mann ist an sich kein Erfolgsanbeter, weil er kein Streber ist und von Natur aus nicht so lügen, heucheln und wedeln kann wie die besseren Leute der menschlichen Gesellschaft. Er bricht darum auch sein Wort und seine Treue nicht so leicht.
Als bei Waterloo, wie Napoleon I. noch auf St. Helena selber erzählte, die Sache dieses Kaisers verloren schien, gingen viele französische Offiziere zum Feinde über, aber kein einziger französischer Soldat. Bei den gebildeten Offizieren, die dem Kaiser sicher viel mehr zu verdanken hatten als die gemeinen Soldaten, war der Erfolg König, bei den letztern nicht.
Drum ärgerten mich heute die Hofstetter Buben, die dem Sieger folgten und den Besiegten in Tränen stehen ließen, weil das sonst nicht bäuerliche Art ist.
Doch es wird ja unser Landvolk immer mehr kultiviert, und die Spuren dieser Kultur zeigten sich wohl schon heute auch an den Schulbuben vor meinen Fenstern.
Am 17. September.
Schon den vierten Tag sitze ich hier ohne einen Sonnenstrahl, und man könnte meinen, es wäre November. Der Jörg hat mir auch meine Stube geheizt, als wäre längst Allerheiligen vorbei.
Der Wind schlägt den Regen an die Fenster, ein Vorgang, der mich in warmer Stube allezeit ergötzt. Denn je kühler es draußen ist, um so wohliger wird's einem im behaglichen, wettersichern Raume.
Ich sitze ans Fenster und schaue dem Wind- und Wasserspiel zu. Während dieses Zuschauens kam mir nach einiger Zeit der Gedanke, daß eigentlich Wasser und Wind (Luft) zusammengehören wie Leib und Seele. Das Luftmeer ist der Geist, die Seele, der Hauch – das Wassermeer der Leib.
Zwischen beiden liegt die Erde, die mit all ihren Wesen von Lust und Wasser abhängt.
So wie die Seele den Leib bewegt, so bringt die Luft, der Wind, Bewegung in die Wasser der Meere, und die Quellen der Erde brechen auf bei ihrem Druck.
Und so wie die Seele des Menschen höher steht als sein Leib und ihn völlig beherrscht, so auch die Lust über dem Wasser. In ihr atmen und leben die Geschöpfe. Sie ist stärker als das Wasser. Sie spielt mit diesem, deckt die tiefsten Abgründe des Meeres auf und türmt seine Wogen zu Bergen.
Sie ist, wie unsere Seele im Leibe, der Odem Gottes in der Natur. In ihrem leisen Wehen wie im gewaltigen Sturme spricht Gottes Geist zu uns. Und in einem Sturmwind kam dereinst dieser Geist am Pfingsttag auf die Erde, um die Erlösung unserer Seelen einzuleiten. –
Da ich bei dem Wetter nicht ins Freie konnte und zum Lesen oder Schreiben nicht aufgelegt war, so ging ich hinunter in die Wirtsstube, hoffend, dort eine Unterhaltung zu finden.
Ein altes Männlein mit grauem Schweizerbart und mit einer Brille vor seinen Zufriedenheit leuchtenden Augen saß in der Stube. Er trug über seiner armseligen, aber anständigen Modekleidung eine große Ledertasche, und ich glaubte, er sei etwa ein Uhrmacher, der als Reparateur auf den Bauernhöfen umherziehe.
Ich setzte mich zu ihm und erfuhr, daß er seines Handwerks ein Buchdrucker sei und zwar ein sogenannter »Schweizerdegen«, d. i. einer, der setzen und drucken zugleich kann, aber diese Kunst schon längst nicht mehr ausübt.
Er ist gebürtig von Rimsingen am Tuniberg, unweit Freiburg, und lernte sein Metier bei der Weltfirma Herder in Freiburg. –
Ich halte die Arbeit eines Schriftsetzers für die ungemütlichste auf Erden und wollte wahrlich lieber Steine klopfen an offener Landstraße, als Manuskripte setzen, vorab wenn sie von Schriftstellern mit meiner Schrift kämen.
Der Rimsinger muß ähnlich gedacht haben; denn kaum ausgelernt, läßt er sich lieber unter die päpstlichen Fremden-Legionäre anwerben, als länger Setzer sein.
Bei Castelfidardo, wo die päpstliche Armee vernichtet wurde, ward der Rimsinger Krieger gefangen und nach Oberitalien transportiert, von wo er wieder heimkehren durfte.
Das Buchdrucken hatte er aber während seiner Militärjahre ziemlich verlernt, so daß er mit dieser Kunst sein Brot nimmer fand. Nach einigen vergeblichen Versuchen trat er in die Reihe der Fabrikarbeiter.
Jahre um Jahre schlug er sich als solcher durch, bis er zur Einsicht kam, daß es nirgends schöner sei als auf dem Lande. Er wurde darum Taglöhner und Holzmacher bei den Bauern im waldigen Tale der Elz.
Im vergangenen Frühjahr ist er von einem Heuboden herabgefallen und hat eine Anzahl Rippen gebrochen; ein Unfall, der ihn 170 Tage im Spital zu Waldkirch krank legte.
Die letzten drei Monate hat er bei einem Bur im Katzenmoos gearbeitet, was der dortige Bürgermeister in dem Arbeitsbuch mit dem »Katzensiegel« beurkundet.
Zurzeit ist noch nichts los bei den Buren im Elztal; zum Holzmachen und zum Dreschen ist's noch zu früh, und die Feldgeschäfte sind durch das »teufelmäßige Regenwetter« beeinträchtigt.
Der greise Jünger Gutenbergs weiß aber Rat. Er hat sich heute in aller Frühe vom Katzenmoos aufgemacht und ist herübergestiegen ins Kinzigtal. Hier will er eine »kleine Bettelreise« machen, bis das Wetter besser wird; dann zieht er wieder hinüber ins Elztal.
Der Mann gefiel mir, weil er seine Geschichte vortrug wie einer, dem nichts zu Herzen geht, und den des Lebens Kummer und Sorgen nicht plagen, weil er sich zu helfen weiß.
Ich durfte es daher schon wagen, ihn in eine Versuchung zu führen, und fragte ihn, wie er sich bei seinen Verhältnissen zur Sozialdemokratie stelle.
»Von den Sozialdemokraten«, so antwortete er feierlich, »will ich nichts wissen; denn das sind unzufriedene Leute, ich aber bin ein Mann, der zufrieden ist. Ich habe jeden Tag mein Brot, und wenn ich's nicht mit Arbeiten verdiene, bekomm' ich's mit dem ›Heischen‹ (Betteln). Hunger leid' ich keinen, Kleider hab' ich auch, und ein Lager find' ich bei jedem Bur im Kinzig- und Elztal. Mehr brauch' ich nicht und will ich nicht.«
Auf diese Rede hin kam mir der Mann apostolisch vor und wie ein Heiliger der letzten Tage vor der großen sozialen Revolution.
Und in der Tat, wenn alle Menschen so zufrieden wären wie der herabgekommene Kunstjünger von Rimsingen und nicht mehr begehrten als er, dann wäre die soziale Frage gelöst und die Erde ein Paradies.
Ich selbst kam mir als ein armseliger Tropf vor dem armen Mann gegenüber, der seinen Lebensunterhalt mit harter Arbeit oder mit Bettel verdienen muß – und trotzdem mit seinem Schicksal völlig ausgesöhnt und zufrieden ist.
Ja, zufrieden sein ist alles, und mit je weniger der Mensch zufrieden ist, um so größer sein Glück und seine Seelenruhe. –
Stillvergnügt nahm der Alte seine Reisetasche um die Schultern und zog von dannen, begleitet von meiner Bewunderung und von dem ersten Beitrag zu seiner kleinen Bettelreise im nebelfeuchten Kinzigtale. –
Kaum war er fort und ich wieder in meiner Studierstube, als es heftig anklopfte, und herein trat der in meinen »Schneeballen« besungene Weber und Tonkünstler, der »Gotthard auf dem Bühl«.
Er ist ziemlich aufgeregt, der alte Maestro; denn einmal hat er diesen Morgen sicher schon einen tüchtigen Schluck Schnaps genommen, und dann wird er demnächst siebzig Jahre alt und »sie wollen ihm keine Altersrente geben,« weil er nicht genug Marken im Büchle hat und man ihm seine Webertage nicht anrechnen will.
Das ist sein Hauptkummer, und den muß ihm »der Hansjakob nehmen und ihm helfen«.
Daß der Gotthard zu wenig Marken im Büchle hat, diesen Fehler zu verbessern, biete ich mich ihm alsbald an, wenn das »Nachkleben« erlaubt ist, worüber ich ihm heute keine Auskunft geben kann.
Daß es unrecht ist, einem armen Weber, der für eine Bäuerin webt, die Elle um 18 Pfennig, und so mit aller Mühe zwei Mark pro Tag verdient, diese Tage nicht anzurechnen, gestehe ich dem Gotthard auch gerne zu und will seinem Wunsch gemäß mit dem »neuen Oberamtmann« reden. Der Oberamtmann Flad hat geholfen, und der Gotthard bezieht seine wohlverdiente Altersrente.
Er hat aber noch etwas auf dem Herzen. Der Bürgermeister will ihn auf die Lumpenliste setzen und ihm durchs Bezirksamt das Wirtshaus verbieten lassen. »Das kann sich der Gotthard nicht gefallen lassen,« meinte er, »denn er ist bigott g'scheiter und trinkt weniger als die meisten Bürgermeister im Tal.«
Daß es Bürgermeister im Kinzigtal gibt, die dümmer sind als der Gotthard, und auch solche, die mehr trinken als er und doch nicht auf der Lumpenliste stehen, konnte ich dem stürmischen Weber ebenfalls zugestehen und versprach ihm, auch in der Richtung für ihn Zeugnis zu geben »beim Amtmann«.
Der Gotthard ist sehr nervenschwach und blutarm und darum sehr aufgeregt. Wenn er nur wenig trinkt, steigt's ihm deshalb gleich in den Kopf, und in diesem Zustand sagt er dann den Leuten, die neben ihm im Wirtshaus sitzen, dick und dünn die Wahrheit.
Es trinkt manch einer das Fünffache dessen, was der arme Weber vertilgt, und hat nicht hoch. Warum soll nun dem, der weniger trinkt und dafür um so mehr die Wahrheit sagt, das Wirtshaus verboten werden?
Wenn jeder, der seinen Nebenmenschen bisweilen sagt, was er denkt, auf die Lumpenliste käme, gehörte unsereiner schon längst darauf. –
Da ich so den Gotthard in alleweg meines warmen Beistandes versichern konnte, war er hocherfreut und ging singend seinem »Bühl« zu.
So hatte ich in kurzer Zeit zwei glückliche Menschen gesehen – einen zufriedenen Bettler und einen zufrieden gewordenen Weber. Und diese beiden machten auch mich für einige Zeit zufrieden.
Am 18. September.
Die Sonne ist da, das erstemal, seitdem ich hier bin, und alles lebt neu auf. Selbst die Mücken in meiner Stube, die sich trotz der Ofenwärme bereits zum Sterben anschickten, summen an den von der Sonne erwärmten Fensterscheiben hin.
Machen wir Menschen es im Alter anders als diese Mücken? Verdrossen und verdrießlich leben wir in der Regel unsere alten Tage, geplagt von allerlei Bresten, verstimmt über des Daseins Armseligkeit und Flüchtigkeit. Da fällt wieder einmal ein Sonnenstrahl in diese Melancholie, und wir summen und sind für Augenblicke lebensfroh wie die Mücke im Herbst.
Aber so wie es bei ihr nur ein kurzes Aufflackern der letzten Lebenskraft ist und sie doch in Bälde sterben muß, so ist's auch mit den fröhlichen Stunden bei alten Menschen. Über ein kleines und der kalte Herbstnebel des Lebens liegt wieder auf ihrer Seele, und Winter und Tod stehen vor der Türe.
Spärlich wandert ihnen das Blut durch den eisigen Leib, und in geschlossener Heerschar umschwärmt sie Krankheit jeglicher Art.
Während ich so den kurzlebigen Mücken zuschaute und meines mühsamen eigenen Lebens Kürze bedachte, flogen vom nahen Walde her einige Krähen schreiend über das Haus hin. Ihr Krächzen klang mir wie Hohn, den sie ausstießen über des Menschen flüchtiges Dasein, während sie selber steinalt werden. Denn also schrieb schon der alte Hesiod:
Neun Geschlechter von Männern durchlebt die geschwätzige Krähe. –
Ich ging hinaus in den Sonnenschein und wanderte talab fröhlichen Mutes. Da begegneten mir zwei leibhaftige – Sozialdemokraten, die im Begriff stunden, mir einen Besuch zu machen.
Das ist der Fluch der bösen Tat! Weil ich der Demokratie von jeher zu viele Finger gegeben habe, streckten mir heute zwei Sozialdemokraten die ganze Hand entgegen.
Den einen kenne ich längst, den andern sah ich heute zum erstenmal. Er gehört zu den Wort- und Schriftführern der Partei. Drum war mir sein Kommen nicht unangenehm. Ich verkehre gerne mit Menschen jeder Religion und jeder Partei, weil man dabei immer was lernen kann und es Menschen- und Christenpflicht ist, niemand von sich zu stoßen ob seines religiösen oder politischen Glaubens.
Heute lernte ich von den Sozialdemokraten, daß es bei dieser Partei auch Leute gibt, die ruhig und vernünftig denken.
Es gibt eine Menge Menschen, die sich Sozialdemokraten nennen und die da meinen, Sozialdemokrat sein heiße möglichst wenig arbeiten und möglichst viel verdienen oder den Besitzenden mit Gewalt nehmen, was sie zu viel haben, und davon gemütlich leben. Diese Elemente sind sicher ein Schaden für die Partei und werden den Führern noch allerlei zu schaffen machen.
Was mir an dem heutigen Manne gefiel, war seine vernünftige Anschauung über den Zukunftsstaat, über Religion und über die eben genannten Elemente in der Partei.
Wenn die Sozialdemokraten aufhören wollten, ihren Zukunftsstaat, der wahres Blech und eine Utopie zu Pferd ist, auszumalen; aufhören wollten, in den Blättern die Religion zu mißachten, und aufhören wollten, mit dem jüdischen Großkapital zu liebäugeln, so würden sie weit bessere Geschäfte machen.
Die von einer glaubenslosen Wissenschaft beeinflußte Weltanschauung, die Hartherzigkeit und die Selbstsucht des Kapitals, die Entwickelung unserer Industrie, welche immer mehr Proletarier schafft und den Bauernstand mehr und mehr schädigt, das Treiben und Gebaren der oberen Zehntausend und endlich der demokratische Zug der Zeit – das alles ist den Sozialdemokraten günstig, und die Zukunft gehört ihnen einmal in irgendeiner Art, ohne daß sie sich noch besondere Mühe geben müßten.
Die Sozialdemokratie wird aber, selbst wenn sie zur Macht gelangt, nicht die Retterin der Gesellschaft sein – sondern nur die Rächerin ihrer Sünden. Und so wenig sie selbst auf Religion hält, wird sie doch dereinst durch ihren Sieg die Menschen wieder beten und die Religion achten lehren, weil sie die Zuchtrute Gottes ist, durch welche unser Herrgott die menschliche Gesellschaft wieder zur rechten Erkenntnis peitscht. –
Was ich den Sozialdemokraten hoch anrechne, ist die Offenheit, mit der sie nicht bloß den Regierenden und den Besitzenden die Meinung sagen, sondern auch sich selber.
Wenn sonstige Parteien und Vereine ihre Generalversammlungen halten, wird ängstlich jeder Mißton ferngehalten, damit er der Sache nicht schade. Die Sozialdemokraten spielen auf ihren Generalversammlungen mit offenen Karten, sie vertuschen nichts, geraten sich in die Haare und zerzausen sich vor der Öffentlichkeit, so daß jedermann in ihr Hauswesen einen Einblick gewinnen kann. Das ist ehrlich und gefällt mir.
Nur sollten sie die Wibervölker nicht so zum Wort kommen lassen in öffentlichen Versammlungen. Diese »Genossinnen« sind meist hysterische Personen, die allerlei unverdautes Zeug deklamieren und deren Eitelkeit es schmeichelt, recht übertriebene Behauptungen aufzustellen, um Schillers Satz von den Weibern, »die zu Hyänen werden«, zu illustrieren. –
Item der Sozzen-Führer, welcher mich heute besuchte, gefiel mir, nicht bloß als solcher, sondern auch, weil ich in ihm einen literarisch durch und durch gebildeten Mann erkannte.
Er hält, wie er mir sagte, heute abend, nachdem er gestern in Hasle gesprochen, eine Versammlung in einem Dorfe des obern Kinzigtales ab.
Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit, daß daselbst ziemlich viele Landleute, nicht nur Fabrikarbeiter, den Sozialdemokraten gerne zuhören.
Der Bauer im Kinzigtal ist durchweg noch christlich-konservativ. Wenn ihm im Unmut über manche Vorkommnisse auch bisweilen das Wort entschlüpft: »Der Bur muß au no Sozialdemokrat were, un es Word nit besser, bis es drunter und drüber goht« – so ist's ihm doch keineswegs Ernst mit der Revolution.
Daß die Fabriken das Kinzigwasser verderben für Menschen, Vieh und Pflanzen und dem Bauer die Knechte und Mägde entführen, daß er in so viele Kassen zahlen und stundenweit »zum Stier« fahren muß – erbittert die Landleute vielfach, aber sozialdemokratisch sind sie deshalb keineswegs.
Je mehr aber zu den eben genannten Mißständen die Segnungen der modernen Kultur kommen, die man von allen Seiten dem Landvolk aufdrängt, um so mehr wird die Volksseele vergiftet und reif für einen Umsturz der Gesellschaft.
Einstweilen hört der Bauer, so es Gelegenheit gibt, den Sozialdemokraten gerne reden, lediglich, weil dieser über »die Herren« schimpft und über die Lasten des Volkes räsoniert. Wenn aber ein anderer das laut sagt, was der Bauer denkt und sich nicht zu sagen getraut, so gefällt das dem Bauersmann allezeit und gilt ihm als eine kleine Rache, die er selber zu nehmen weder den Mut noch das Zeug hat. –
Spät am Abend kam heute noch ein Student der Theologie namens Wizigmann, aus der Diözese Augsburg, zu mir ins »Paradies«.
Er kannte Hasle aus meinen Büchern, wollte es auf einer Ferienreise sehen, erfuhr dort, daß der ehemalige Becke-Philipple in Hofstetten sei, und suchte ihn auf.
Ich bin kein Freund davon, mich wegen meiner literarischen Sünden beschauen zu lassen, und drum wollte ich den späten Besucher nicht mehr vorlassen. Ich hatte zudem heute Besuch genug gehabt und mehr als genug »geschwätzt«. Aber Jörg, der Wirt, welcher den Studenten anmeldete, meinte: »Er dunkt mi a orndtliche, junge Herr. Sie sollte ihn doch ruflosse.«
Ich folgte seiner Meinung, und nachdem ich den jungen, bescheidenen Studenten gesehen und gehört, hätte es mir leid getan, ihn abgewiesen zu haben. Ich hätte ihn eigentlich schon um seines Bischofs willen empfangen sollen. Denn der jetzige Bischof von Augsburg, Petrus Hötzl, ist ein alter Freund von mir.
Vor bald dreißig Jahren lernte ich den jugendlichen Franziskaner-Pater in München kennen und schloß mich eng an ihn an.
Wie oft saß ich im August und September des Jahres 1868 mit dem Pater Petrus in meiner Wohnung bei d'Orville am Marienplatz, und wie erlabte mich des geistreichen heitern Mannes Rede, während er ein Schöpplein Wein trank!
Sooft er mich besuchte, begleitete ich ihn in sein Kloster zurück und schwelgte bei dem Bier-Nektar, den damals noch die Franziskaner brauten.
Der junge Theologe erzählte mir heute von meinem alten Freunde und versetzte mich für den ganzen Abend in wehmütige Erinnerungen an jene Zeiten. Wie schnell sind diese drei Jahrzehnte dahingeflogen, und was haben sie alles mitgenommen an mir und in mir – an Lebenskraft und Lebenslust!
Und doch würd' ich sie nimmer zurückholen, selbst wenn ich könnte. Da wir Menschen doch sterben müssen und dies irdische Dasein keinen vernünftigen Menschen befriedigt – so ist es am besten, man stirbt möglichst bald. Und in den Jahren, in welchen man bald sterben kann, bin ich jetzt angekommen.
Am 20. September.
Gestern war, trotz des Sonntags, ein so schändliches Novemberwetter in Regen, Sturm und Nebel, daß mir alle Lebenslust, die sonst nicht groß ist, verging, aber auch alle Lust, einen Gedanken in mein Tagebuch einzutragen.
Gegen Abend waren noch drei Buren gekommen aus dem Wolftale: der Hermesbur und sein Sohn, der den Hof übernommen, und der Goresbur. Sie verkürzten mir in etwas die lange Zeit dieses Tages, der zu den vielen gehört, an denen man eigentlich nicht gelebt hat und die man seinen Lebensjahren abzählen sollte.
Es war gestern von der Kanzel herab eine Betstunde verkündet worden »um bessere Witterung«, und in hellen Scharen kamen heute die braven Hofstetter aus den Tälern und ab den Bergen, um gemeinsam zu beten.
Ich schloß mich ihrem Gebete an. Und als ich nun hörte, wie die ganze gläubige Gemeinde, vom greisen Bauersmann, der von seiner Berghütte herabgewankt war, bis zum rotbackigen Schulkind – zu beten anfing: »Ich glaube an Gott Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde« – da kamen mir die Tränen in die Augen.
Ich meinte, solch ein Gebet aus kindlich gläubigem Herzen müßte den Himmel stürmen und alle seine Segnungen herabströmen machen auf die mühseligen und beladenen Schwarzwaldmenschen.
Und doch, wie oft beten sie, die guten Menschen, und das Elend und der Regen dauern fort!
»Sie sollen es bleiben lassen,« sagt der Unglaube, »denn die Naturgesetze bringen unaufhaltsam ihren Regen und ihren Sonnenschein. Und Wunder kann Gott keine wirken, weil er die Naturgesetze nicht stören darf in ihrem Lauf und nicht stören kann, ohne daß alles in Unordnung gerät.«
Drum lächelt der ungläubige Professor, und viele andere Gebildete lächeln mit ihm, wenn sie hören, daß man in katholischen Kirchen um gut Wetter oder um Regen, d. i. um ein Wunder bete.
Ich frage aber die Herren: Verdanken nicht die ganze Natur und ihre Gesetze ihr Dasein einem Wunder? Ist nicht die Schöpfung und Entwicklung der ganzen Welt aus dem »Urnebel« und aus der »Urzelle« – um mit der neuesten Forschung zu reden – auch ein Wunder? Sollte nun die Macht, welche die Naturgesetze so wunderbar erschaffen hat, nicht auch Abänderungen an denselben treffen können? Oder soll der Schöpfer abhängen von seinen eigenen Gesetzen?
Das Wesen Gottes bedingt seine absolute Souveränität über alle Gesetze und Ordnungen, die er dem Weltall gegeben. Und hat nicht jeder irdische Gesetzgeber das Recht und die Macht, Ausnahmen von seinen Gesetzen zu machen? Sollte Gott dies Recht nicht auch haben? Diese seine Ausnahmen sind aber die Wunder.
Als Gott die Welt ins Dasein rief, war alles, was er schuf, ein Wunder, auch die Gesetze, die er der Welt gab. Sollte es ihm nun nicht erlaubt sein, diese Wunder abzuändern und neue zu schaffen?
»Wenn Gott Wunder wirkte, ginge die Natur aus Rand und Band,« sagt der Ungläubige; und selbst der ebenso exakte als berühmte englische Forscher Tyndall meinte, einen einzigen Regenguß außerhalb des natürlichen Verlaufs herbeizuführen oder einen Sonnenstrahl da- oder dorthin zu lenken, setze eine solche Störung in den Naturgesetzen voraus, wie das Zurückfließen eines Stromes oder das Stillstehen einer Sonnenfinsternis.
Wenn dem so wäre, so vermöchten wir Menschen mehr als Gott. Wir können nicht bloß Sonnenstrahlen da- und dorthin leiten, auch der Blitz folgt unserer Weisung. Und unsere Ärzte greifen in den natürlichen Verlauf der Krankheiten und ihrer Gesetze ein, treiben Fieber zurück und bringen oft selbst den Tod zum Weichen.
Was wir Menschen können, kann sicher Gott in noch höherem Maße, ohne daß die Welt aus Rand und Band geht.
Aber das gestehe ich den Herren gerne zu, daß Gott selten in den natürlichen Lauf der Dinge eingreift und in den allermeisten Fällen die Naturgesetze schalten und walten läßt.
Wozu dann doch beten? Wir Christen beten, weil Gott in Christo Jesu uns das Beten gelehrt und geboten und Erhörung zugesagt hat.
Ob er uns dann in unserem oder in seinem Sinne erhört, das müssen wir ihm, dem Allweisen, überlassen.
Wir tun das Unsrige und beten, vergessen aber dabei nicht, daß wir nicht auf der Welt sind, um auf wunderbare Art von allen Heimsuchungen befreit und jeder Not enthoben zu werden.
Wir Christenmenschen wissen, daß die Erde nicht das Land der Vollkommenheiten ist und daß Gott auch einen anderen, nicht so vielen Katastrophen ausgesetzten Planeten hätte schaffen können.
Aber warum er uns und unseren irdischen Wohnplatz so und nicht anders konstruiert hat, darüber ist der Schöpfer uns, den Geschöpfen, keine Erklärung schuldig, so wenig als der Töpfer den Schüsseln und Häfen den Grund anzugeben hat, warum er sie so und nicht anders geformt.
Und wenn wir bei schädlichen Naturereignissen zu Gott beten, so erkennen wir ihn als den unumschränkten Souverän aller Elemente an, als den, der helfen kann, wenn er will, und als denjenigen, dessen Größe, Herrlichkeit und Majestät über die Unvollkommenheiten dieses Erdenlebens unendlich erhaben sind.
Lassen wir also die Hofstetter und andere Bauern ruhig beten um besseres Wetter. Sie tun jedenfalls etwas viel Vernünftigeres als jene Professoren, die sich bemühen, Gott als von den Gesetzen der Natur abhängig zu erklären.
Die braven Hofstetter kamen mir heute vor wie ein geistiges Kriegsheer, das mit den übernatürlichen Waffen des Glaubens kämpft gegen den Trutz der Elemente. –
Es ist Wochenmarkt in Hasle heute; aber den Hofstettern ging das Beten vor, und in unserer Wirtsstube traf ich nur eine einzige Person, die in Hasle gewesen war.
Ich setzte mich zu ihr. Sie ist eine »Ueberländerin«, d. h. eine Elztälerin, und wohnt jenseits der Wasserscheide zwischen Kinzig und Elz.
In der »Bachere«, jener grünen, waldigen Bergmulde unter der Heidburg, ist ihre Heimat. Dort wohnten schon ihre Großeltern beim »Schüsselebur« als Hintersassen, dort wohnte auch ihr Vater, und dort hat auch sie das Licht der Welt erblickt.
Vater und Großvater waren ehrsame »Schnider«, die von Hof zu Hof, von Hütte zu Hütte mit Schere und Nadel zogen, um den Mannsvölkern ihr Häs zu machen und zu flicken.
Drum heißt sie, meine Gesellschafterin, auch »die Schnider-Karli« (Karoline) bis zum heutigen Tag, trotzdem ihre Ahnen alle gestorben sind und sie allein mit ihrem »Bua« beim Schüsselebur haust.
Der Bua ist ihr Sohn, den sie »lediger Wis verwitscht het«, aber »der arme Kerle« ist blind.
Der Schüsselebur ist ein braver Mann; denn er gibt der Schnider-Karli und ihrem blinden Bua die Herberge um 22 Mark jährlichen Zinses, und dazu darf sie noch zwei Geißen laufen lassen auf des Buren Weide und zwei Säule halten.
Der Bua hütet die Geißen und die Säule, trotzdem er blind ist, und findet überallhin, wo er nur einmal gewesen, den Weg allein.
Ihren Hauszins bringt die Karli auf mit »Fröschefangen«. Im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist über den Matten und das Eis fort von den Weihern der Bachere, zieht sie mit ihrem blinden Bua nächtlicherweile aus, um Frösche zu fangen bei brennenden Holzspänen.
Der Bua hält das Licht, und sie fängt die Tiere. Am andern Tag trägt sie die Frösche hinab nach Elze oder Hasle und bringt ein »schön Stück« Geld heim. Aber während sie früher in einer Nacht 30-40 Dutzend Frösche fing, bringt sie in den letzten Jahren nur 5-6 Dutzend zusammen. Die Buren werfen die Weiher zu, und die Frösche sterben ab.
»Der Teufel,« meint die Schnider-Karli, »isch afange (anfangs) überall drin. Es git keine Frösche meh und git keine Vögel meh.«
Ich hätte die alte, zahnluckige, runzelige Karli umarmen können, so sehr gefiel mir der Schluß ihrer Rede. Ja, ja, der Teufel ist überall drin und kommt selbst auf die Bachere, und dieser Teufel heißt Kultur.
Wo irgend noch ein kleines Bergseele aus den Matten herausguckt, wie ein Auge Gottes in der Natur, so muß es zugeworfen werden, damit Gras darauf wachse, so lehrt man die Bauern.

Und wo am Abend die Libellen spielten, die Seerosen blühten und Frösche ihr friedlich Lied sangen, wo die Bögelein sich badeten und erfrischten und wo in milden Frühlingsnächten bei Spanlicht die Schnider-Karli und ihr blinder Bua ihren Hauszins holten, da ist jetzt alles tot und still.
Die Natur und alles in ihr wird, wie ich schon oft gesagt, nur noch betrachtet und behandelt nach dem Grundsatz: »Was trägt's, was bringt's?«
Die Kultur ist auch ein »Mädchen aus der Fremde«, das zu guten Hirten kommt; aber man kann von ihr nicht sagen, was Schiller sagt:
Doch schnell war ihre Spur verloren.
Sobald das Mädchen Abschied nahm.
Die Kultur läßt ihre Spuren zurück, und sie nimmt auch nicht mehr Abschied, wo sie einmal sich festgesetzt. Sie bleibt und teilt jedem ihre Gaben aus, aber keine Blumen, wie Schillers Mädchen aus der Fremde.
Sie kommt mir vor, die Kultur in ihrem Vormarsch beim Landvolk, wie eine Pariser Kokotte, die durch ihre Schönheit, Frisur und Kleidung einen einfachen Mann aus der Provinz unter allerlei Schmeichelei in ihre Garne zieht und nimmer losläßt, bis sie ihn ausgesogen und ruiniert hat.
Ja, die Kultur ist eine holde Teufelin und hat noch fünf andere Teufel im Leib, die sie überallhin mitbringt, wo immer man sie einläßt. Diese fünf Teufel aber sind: der Geldteufel, der Modeteufel, der Luxusteufel, der Aufklärungsteufel und der Genußteufel.
Und diese fünf Teufel werden unsern Bauernstand ruinieren und überall den Frieden, die Einfachheit, die Genügsamkeit, die Religion und die große Göttin – Poesie vertreiben. –
Ich fragte die Karli, was sie in Hasle für Geschäfte gehabt und erfuhr, sie habe beim »Schwarzbeck« Eierschalen geholt für die Hennen der Schüsselebüre. Es gibt keinen Kalk in der Bachere, und die Häuser sind durchweg von Holz; drum muß man den Hennen Eierschalen holen, sonst legen sie schallos.
Der Schwarzbeck in Hasle ist Nudelfabrikant und hat Eierschalen in Hülle und Fülle. Die Karli macht oft den Gang zu ihm, der Büre »z'G'falle«, und trägt die Eierschalen in einem Sack heim.
Fürwahr, die Schnider-Karli tut, indem sie einen Sack voll Eierschalen in die Bachere trägt, weit mehr Gutes und Vernünftiges als jene, welche den dortigen Buren die oben beschriebene Kultur samt den fünf Teufeln beibringen. Drum schied ich von der Karli mit vollster Hochachtung und mit einer Bewunderung, die mir sicherlich im feinsten »Damen-Tee-Kränzle« einer Stadt nicht wäre abgerungen worden, wenn ich, statt mit der Schnider-Karli aus der Bachere, mich in einem solchen unterhalten hätte.
Man sagt mir so gerne nach, ich wisse die Damenwelt nicht zu schätzen. Nun, hier stelle ich meinen Leserinnen ein Wibervolk vor, dem ich Lob spende: es ist die Schnider-Karli in der Bachere.
Sie ist blutarm, hat einen blinden Bua, muß Frösche fangen, um die Miete zahlen zu können, macht öfters einen Weg von sechs Stunden, lediglich, um der Schüsselebüre und ihren Hennen einen Gefallen zu tun, und ist bei alledem von einer Heiterkeit und Zufriedenheit, die nicht einmal der Kulturteufel, welcher die Frösche umbringt, völlig besiegen kann.
Ist das nicht ein so seltenes Wibervolk, wie alle Theaterlogen ersten Ranges in der ganzen Welt keines aufzuweisen vermögen!?« –
Am 21. September.
Ich gehe fast täglich zwischen dem Dorfbach und dem Hofe meines Leibkutschers Wendel durch, um zur Dorfmühle zu gelangen.
Als ich diesen Morgen vorbeiging, sah ich Wendels Magd, die Pauli, von der ich »im Paradies« schon erzählt und mit der ich oft plaudere, weinend im Stalle stehen.
»Wo fehlt's, Pauli?« fragte ich die Weinende, ein Naturkind erster Güte, das noch nie auf der Eisenbahn gefahren ist. Sie kam eilig auf mich zu, gab mir die Hand und sprach, während die Tränentropfen einander schlugen: »Herr Pfarr', d' Großmuatter isch g'storbe; betet au a wenig für sie!«
Sprach's und weinte und schluchzte weiter. Ich brachte noch von ihr heraus, daß die Leichensagerin eben dagewesen sei und ihr die »Leiche angesagt habe«.
Die Großmutter ist 80 Jahre alt geworden, wohnte weit weg von der Hütte ihrer elf Enkel, und diese kamen gar selten zu ihr. Und wenn sie kamen, konnte die Großmutter, eine blutarme Frau, ihnen nichts geben als ein Stück schwarzes Brot und einen Trunk Milch. Und doch weint die Pauli, als ob ihr das Teuerste im Leben genommen worden wäre.
Ich habe das alte Mütterle und ihren Mann auch gekannt. Ihre Hütte steht auf dem Höllsberg mitten im Föhrenwald und ist so wunderbar malerisch, daß ich sie hier wiedergebe.
Tränen über eine Großmutter findet man in der Regel nur bei den Naturkindern, bei den Armen, kurz beim gemeinen Volke.
Je reicher die Großmütter sind und je gebildetere und blasiertere Enkel sie hinterlassen, um so weniger und seltener wird man die letzteren weinen sehen.

Kinder von Millionären, die von Kindsbeinen an alles hatten und bekamen, was das Herz selbstsüchtig und kalt macht, sie weinen nicht, wenn Vater und Mutter sterben, und noch viel weniger, wenn die Großeltern das Zeitliche segnen.
Ich kenne Männer, die es aus ärmlichen Verhältnissen zu Vermögen gebracht haben. Sie gönnen sich selbst aber wenig oder nichts, um ja den Kindern recht viel hinterlassen zu können.
Diese dummen Leute sehen nicht ein, daß ihre Kinder, je mehr sie ihnen im Leben geben und nach dem Tode voraussichtlich hinterlassen, um so geld- und habgieriger, genußsüchtiger und herzloser werden und froh sind, wenn »die Alten« gehen, damit sie den Mammon einsacken können.
Nach meiner Ansicht sind die Eltern ihren Kindern nichts schuldig als eine rechtschaffene Erziehung. Geld ist Nebensache; je weniger die Kinder bekommen, um so mehr sind sie darauf angewiesen, aus sich selbst was zu werden, und das ist mehr wert als des Vaters Geldsack.
Lieder hat die Lerche wohl,
Tränen hat sie nicht –
heißt's in einem bekannten Liede.
Von den Reichen dieser Erde kann man sagen: Sie haben Millionen, aber keine Tränen und keine Lieder. Diese beiden Gottesgaben sind beim armen Volke, dem Gott die Gnade gegeben, unter Tränen ein freudiges Herz zu bewahren und trotz aller Mühen, Sorgen und Leiden zu singen, wie der Vogel singt, der in den Zweigen wohnet. –
Die Pauli gilt schon lange was bei mir, weil sie ein kreuzbraves, schaffiges Maidle ist und ein Naturkind, so echt, wie das Vögelein im Walde. Aber ihre Tränen um die Großmutter haben ihr aufs neue einen großen Stein ins Brett gelegt bei mir.
Das Herz könnte einem bluten, wenn man sehen müßte, wie solch ein Waldkind in die Stadt zöge und dort wie Tausende ihre stille Naturgröße verlöre und dafür die ganze moderne Lumperei eintauschte.
Mein Vater pflegte mich oft, wenn in meiner frühesten Knabenzeit von größeren Städten wie Straßburg oder Freiburg die Rede war und ich die Lust aussprach, auch einmal dorthin zu kommen – zu warnen und zu sagen: »Da mußt du nicht hin; denn jeder, der in eine große Stadt kommt, muß am Eingang in eine große Kette beißen, und jenseits der Kette springen ihm allerlei wilde Tiere ins Gesicht.«
Wie spricht in dieser Warnung die Volksseele wunderbarerweise den Gedanken aus, daß ein Naturkind das Stadtleben meiden solle, weil seiner dort allerlei Gefahren warten!
Ich glaube nicht, daß die brave Pauli in die obige Kette beißt, sondern noch viele Jahre bei meinem Freund Wendel, dem Roserbur, bleibt und ihr Leben, sei es ledig, sei es verheiratet, in einer der malerischen Hütten ihrer Heimat beschließt. –
Wo man noch Dienstboten trifft, wie sie sein sollen, da werden sie von der Dienstherrschaft auch gehalten, wie sich's gehört.
Auf den Höfen des Schwarzwaldes, da gilt die Magd wie die Tochter und der Knecht wie der Sohn; sie essen mit dem Bur und mit der Büre und mit den Kindern. Da geht es noch nach der schönen Mahnung des Talmud: »Wer einen Knecht oder eine Magd ins Haus nimmt, soll in ihnen den Bruder und die Schwester sehen. Daher darf ihnen der Herr nicht etwa schlechten Wein vorsetzen, wenn er selbst guten Wein trinkt, und nicht minderwertiges Brot, wenn er selbst feines ißt. Er darf sie nicht auf bloßer Streu schlafen lassen, während er auf weichem Pfühle ruht.«
Der Talmud hätte in dieser trefflichen Vorschrift nur statt Herr das Wort Frau setzen sollen; denn wo in unsern Städten bei »vornehmen Leuten« die Dienstboten nichts Ordentliches zu essen bekommen, ja selbst Hunger leiden müssen, ist in der Regel nicht der Herr schuld, sondern der Geiz und die Hartherzigkeit der Frau.
Die Dienstboten, die Gesellen und Lehrlinge sind in den Städten nicht mehr wie früher, aber die Herrschaften sind es auch nicht mehr. Ehedem war alles eine Familie, am gleichen Tisch, im gleichen Haus.
Jetzt will keine Schusterin und keine Schneiderin mehr Lehrbuben und Gesellen im Haus haben; es gäbe zu viel Arbeit und die Frau Knieriem und die Madame Zwirn könnten weniger die unbeschäftigten Damen spielen.
Auf der andern Seite hilft auch der moderne Staat die Dienstboten vollends verderben, und man meint oft, die Herren, welche die Sozialdemokraten so fürchten, studierten Tag und Nacht, wie sie denselben entgegenkommen und helfen könnten.
Da kommt mir, während ich an diesem Büchlein schreibe, im »Freiburger Tagblatt« eine Bekanntmachung zu Gesicht, welche die Bestimmungen des neuen badischen Dienstbotengesetzes mitteilt. Ich lese und staune.
Ich bin gewiß ein Freund des Volkes und der Freiheit, aber dieser Beschluß moderner Staatsweisheit, sanktioniert von den Volksvertretern, ist mir unbegreiflich.
Man höre: »Eine jede minderjährige Person muß ein Dienstbuch haben. In dieses Buch darf der Dienstherr, beziehungsweise die Dienstfrau keinen Eintrag machen über die Führung des Dienstboten. Nur auf Verlangen des letztern kann dies geschehen. Erlaubt sich die Dienstherrschaft gegen den Willen desselben ein Urteil über ihren Dienstboten ins Dienstbuch zu schreiben, das dem letzteren schaden könnte, so wird sie mit Geldstrafe bis zu 150 Mark belegt.«
Ich glaubte, um die Dienstboten, die unsere Zeit so unbotmäßig gemacht, etwas an ihre Pflicht zu erinnern, müßte jede Herrschaft ein Zeugnis abgeben, und nur falsche Zeugnisse würden bis zu 150 Mark bestraft.
So wie die Dinge jetzt liegen, kann ein Dienstbote sich Lug, Trug, Diebstahl, kurz jede Lumperei erlauben, ohne daß ein Vermerk darüber ins Dienstbuch kommen darf.
Nur wenn das Mägdlein es gestattet, darf die Frau ihm ein gutes Zeugnis geben.
Wenn diese unsinnige Rücksicht auf die Ehre des Individuums so weiter geht, dann darf schließlich kein Gymnasiallehrer einem Studentenknaben mehr einen Fünfer geben; denn das Prädikat »schlecht« könnte der Ehre und dem Fortkommen des jungen Herrn schaden. –
Aber in dem genannten Gesetze steht noch mehr: Zur Ausstellung eines Dienstbuches, d. i. zum Eintritt eines Minderjährigen in ein Dienstverhältnis außerhalb des Elternhauses muß der Vater des Betreffenden seine Zustimmung geben.
Verweigert er dieselbe ohne genügenden Grund zum Nachteile des Dienstboten, so kann die Gemeindebehörde die Zustimmung ergänzen.
Diese Bestimmung ist noch haarsträubender als die das Zeugnis betreffende, weil sie die väterliche Autorität förmlich vernichtet.
Ich frage: Wer ist berechtigt, von einem Vater zu verlangen. Gründe anzugeben, wenn er sein Kind daheim behalten will? Und wer befugt, die Stichhaltigkeit dieser Gründe zu prüfen?
Man könnte angesichts dieses Gesetzes-Paragraphen glauben, die Väter aller Minderjährigen seien Seeräuber oder Sklavenhalter und nur darauf bedacht, den Schaden ihrer Kinder zu fördern.
So schlecht steht es aber denn doch noch nicht, und die allermeisten Eltern auf dem Lande wollen das Glück ihrer Kinder. Wenn nun aber ein Vater zu einem minderjährigen Kinde sagt: »Du bleibst mir daheim, ich habe hier Arbeit genug für dich und will nicht, daß du in die Stadt oder in die Fabrik ziehst und verkommst und später verelendest« – dann kann das als Nachteil für den Minderjährigen erklärt werden, die väterliche Autorität wird lahm gelegt, und das Kind kann gehen, wohin es will.
Das alles heiße ich aber dem Leichtsinn und dem Ungehorsam aufhelfen und die Autorität in alleweg untergraben.
Drum, ich wiederhole es, wir bekommen den Umsturz aller Verhältnisse von oben, auf gesetzlichem Wege, und die Sozialdemokraten brauchen sich gar keine besondere Mühe zu geben, den großen »Kladderadatsch« herbeizuführen. Er kommt »von Aasen«, wie die Schwarzwälder sagen, d. i. von selbst. –
Von der weinenden Pauli ging ich das Dorf hinauf und traf noch die Leichensagerin oder, wie sie im nördlichen Schwarzwald heißt, die »Lichtbetere«.
Es war die »Jokin«, ein armes Weib von jenseits der Berge, so genannt von ihrem Manne, der Jok (Jakob) heißt und ein armer Taglöhner ist.
Die Jokin war einst ein schönes, hoffärtiges Maidle und eine Näherin. Als sie den Jok heiratete, machte sie natürlich ihr Hochzeits-Häs selber und dabei einen Schurz, der als ein Wunder galt bei den Wibervölkern im ganzen, weithin zerstreuten Kirchspiel.
Von diesem Schurz reden die alten Weiber heute noch und erzählen, er sei so mit Stickerei verziert gewesen, daß die stolze Näherin 27 Strängle farbige Seide gebraucht habe, um das Kunstwerk zu vollenden.
Mit diesem Schurz machte die Jokin viele Jahre lang an hohen Feiertagen Staat, und sie soll ihn jetzt noch haben, aber nimmer tragen. Denn ein Schurz von solchem Kunstwert paßt nimmer für eine Lichtbetere, ein Amt, das nur ganz arme Wibervölker übernehmen.
Aber die Jokin hat doch noch, wie viele ihresgleichen, eine »einz'ge Säule« vergangener Herrlichkeit, und sie mag dieser Jugend-Herrlichkeit manchmal mit Wehmut gedenken, wenn sie ihren Kasten öffnet und den gestickten Schurz sieht.
Wie viele hoffärtige und stolze Maidle kommen durchs Heiraten um all ihre Hoffart und um all ihren Stolz, essen ihr späteres Brot in Tränen und suchen es in armseligem, verächtlichem Erwerb.
Sie alle können mit dem alten Volkslied singen:
An allen meinen Leiden
Ist nur die Liebe schuld.
Wie manch eine stolze Köchin und wie viele hoffärtige Dienstmädle, welche die besten Tage hatten bei ihren Herrschaften, sitzen wenige Jahre später, verheiratet, in einem Dachzimmerchen in einsamer Stadtstraße, umgeben von einem Häuflein Kinder, die nach Brot schreien, während die arme Mutter weint und hungert und sich nach den Brosamen sehnt, die von den Tischen ihrer früheren Herrschaften fallen! –
Aber so ist's eben im Menschenleben. Der Genius der Menschheit, um mit Schopenhauer zu reden, ruht nicht, bis jede Grete ihren Hans hat, und wenn sie dann im Elend sitzt, lacht und höhnt er.
Daß ich diese Bosheit des Genius der Menschheit nicht hatte, da mir die Jokin begegnete, versteht sich von selbst. Ich habe jeweils Mitleid mit seinen Opfern und in der Stadt schon mehr als einem derselben das Elend zu erleichtern gesucht. –
In meiner Knabenzeit kam aus der gleichen Gegend, aus der heute die Jokin kommt, um »zum Gräb« zu sagen, eine unheimliche Leichenbitterin. Sie hieß »die rot' Ann'« und war einst auch ein »suber un stolz Maidle«, aber leichten Sinnes und Wandels.
Eines Sommertages, da sie beim Schloßbur unter der Heidburg mit dessen Völkern Frucht schnitt, kam die Stunde, da sie gebären sollte, während niemand von ihrem Zustand wußte.
Sie lief dem nahen Föhrenwald zu, gebar dort ihr Kind, zerstückelte es mit der Sichel, vergrub es unter Moos und Steine und ging wieder zu den Schnittern, als ob nichts Besonderes geschehen wäre.
Als aber die Schnitter und Schnitterinnen am Abend beim fröhlichen Mahl saßen in des Schloßburen Stube, kam der Hofhund und brachte den Arm eines Kindes heim.
Die unglückliche Ann' war verraten, gestand und büßte ihre Bluttat im Zuchthaus.
Ihre alten Tage brachte sie mit Betteln und Leichensagen zu; aber sie wurde an keiner Türe abgewiesen. Sie galt überall als ein unglücklich Menschenkind und als eine Büßerin. –
Die Leichensagerinnen sind noch ein Stück der mehr und mehr auch auf dem Lande schwindenden Poesie. Es wird nicht fünfzig Jahre gehen, und an ihre Stelle werden auch beim Landvolk die gedruckten Todesanzeigen und Kondolationen treten. Die liebe Kultur schreitet ja immer weiter und duldet's nicht anders.
Ich aber frage, was ist gemütvoller und christlicher: diese gedruckten, schwarzberänderten Holzstoffzettel mit ihrer »herzlichen Teilnahme« oder die Art, wie's hergeht beim »Lichtbeten«?
Die Lichtbetere tritt ein und spricht: »Guate Tag! Der Vogelsbur im Fischerbach isch g'storbe. Si Wib un sine Kinder losse bitte, daß Ihr ihne dienet im Leid un mit der Licht gennt und ihne bete helfe für den Abgestorbene. Am Zischtig Morge am halb zehni word er vergrabe.«
Der angeredete Bur oder die Büre antwortet: »Verzeih' ihm Gott un geb' ihm die ewig Ruah!«
Enthalten diese Worte nicht einige Pferdelängen Poesie und Religion mehr als die »herzliche Teilnahme« und die »aufrichtige Kondolation«? –
Ich schritt von der Jokin weiter das Dorf hinauf und kam zum Kettererbur.
Es geht dem Mittag zu, und der Bur ist nach uraltem Brauch am Füttern. Schon im Talmud war den Juden befohlen, ihre Haustiere zu füttern, ehe sie selbst essen. Und diese schöne Sitte herrscht bei uns überall noch auf dem Lande.
In fürstlichen Häusern ist es auch Mode, das Hausgesinde zu speisen vor der Tafel. Es hat dies aber zweifellos nur den Sinn, die Diener zu sättigen, ehe sie der Herrschaft aufwarten, damit sie nicht hungrig und neidisch zusehen, wenn diese speist.
Doch auch in dieser Mode liegt ein schöner Zug.
Die Buben des Kettererburen fuhren mit einer Stande voll Herbstpflaumen, die sie den Morgen über gebrochen hatten, beim Hause an und erweckten in mir alte Erinnerungen.
Vor fünfzig und mehr Jahren habe ich draußen auf dem Hügel, der Hasle und Hofstetten verbindet, auch noch Herbstpflaumen gebrochen.
Sie waren die letzte Obsternte des Jahres, und jene schönen Herbsttage, da ich auf den Pflaumenbäumen saß, während die Sonne die ringsum sterbende Natur verklärte, kommen mir heute vor wie ein seliger Traum oder wie ein Bild aus einer andern Welt.
Aber darüber wunderte ich mich heute, daß man die Herbstpflaumen so früh brach. Als ich noch ein Knabe war, geschah dies nicht vor der zweiten Hälfte Oktober, und diese Pflaumen hießen deshalb auch »Gallepflumme«, weil die katholische Kirche um diese Zeit, am 16. Oktober, das Fest des heiligen Gallus begeht.
Doch ich fand den Unterschied begreiflich, indem ich mir sagte: »Heutzutag wird ja alles früher reif als vor einem halben Jahrhundert, vorab die Menschen. In einer solchen Zeit werden wohl auch die Pflaumen früher zeitig als ehedem.« –
Der Kettererbur aber bekam von mir ein Lob, weil er den »Wannenwebern«, von denen ich »im Paradies« gesprochen, ein neues Nest an den First seines Hauses hat machen lassen.
Wo und wie immer ich alte Sitten und alte Gebräuche erneuert sehe, freue ich mich, selbst wenn, wie bei den Wannenwebern, der so verpönte Aberglaube eine Rolle dabei spielt. Denn der Aberglaube ist mir in alleweg lieber als der Unglaube, und ich habe, wie schon anderwärts ausgesprochen, die feste Überzeugung, daß manches, was man als Aberglaube verschreit, auf geheimnisvollen Beziehungen der Seele des Menschen zur Naturseele beruht und Wahrheit ist. –
Am 22. September.
Am heutigen Tage feiert die Diözese Freiburg das Fest des Märtyrers Landolin, eines heiligen Einsiedelmannes, der in der Nähe von hier, am westlichen Fuße des Hühnersedels, lebte und starb.
Er war aus Irland gekommen, dem Heimatlande der ersten Apostel Deutschlands, hatte sich im Walde eine Hülle gebaut und den umwohnenden Kelten die Lehre Jesu gepredigt. Ein Jäger erschlug ihn eines Tages in seiner Waldhütte, weil er ihn für einen Räuber hielt.
Neuere Untersuchungen verweisen übrigens die Anwesenheit eines heiligen Landolin im Breisgau ins Gebiet der Fabel. –
In der Epistel der heiligen Messe zu Ehren dieses Blutzeugen stehen die Worte aus den Klageliedern des Propheten Jeremias: »Gut ist's dem Manne, zu tragen das Joch von seiner Jugend an. Da wird er sitzen einsam und wird schweigen. Er drücket in den Staub seinen Mund, reicht dem, der ihn schlägt, die Wange und sättigt sich an Schmach.«
Diese Worte der Heiligen Schrift beschäftigten mich in Gedanken einige Zeit. Sie beschämten mich, der ich auch einsam sitze, aber nicht schweige, und den Mund nicht in den Staub drücke, sondern rede und mich auch nicht auf die Wange schlagen lasse, ohne mich zu wehren.
Und doch meine ich, es müßte auch Leute meiner Sorte geben. Allerdings wird man diese Sorte nie zu den Heiligen zählen. Aber unser Herrgott hat auch nur wenigen Menschen die Gnade verliehen, Heilige zu werden.
Die Heiligen sind die Monumental- und Säkularmenschen auf religiös-sittlichem Gebiet, und derartige Menschen sind in alleweg selten. Gott hat auch in der physischen Natur mehr Kleineres und Mittleres geschaffen als Großes. Es gibt viel mehr kleine Flüsse und Bäche als Ströme, viel mehr kleine Berge als große, viel mehr Mäuse als Elefanten und viel mehr Spatzen als Adler und unter uns Menschen weit mehr billige Denker als Genies und viel mehr Lumpen als Heilige. –
Ich sparte dem Pfarrer von Hasle diesen Morgen einen Gang und beerdigte an seiner Statt eine Kindsleiche.
In alter, sinniger Art trug die Patin des Kindleins Leiche in einem weißen Särglein frei auf dem Kopfe vom Berge daher und trug es bis zum Eingang des Kirchhofs, wo der Priester stund und die Leiche einsegnete.
Nachdem dies geschehen, nahm der Pate das Särglein in seine Hände und brachte es zum stillen Grab.
Dort betete ich aus dem alten Ritual den Psalm 148: »Lobt vom Himmel her den Ewigen, lobt ihn dort in jenen Höhen!«
»Alle Berge und die Hügel, fruchtbelad'ne Bäum' und Zedern.«
»Was im Feld und Walde lebet; Wurm im Staub und hoch die Adler.«
»Alles lob' des Ew'gen Namen; denn sein Nam' ist hocherhaben.«
Dieser Psalm, gebetet inmitten von Bergen, Hügeln und Wäldern, gebetet am Grab eines unmündigen Kindes, dessen Seele der Ewige ohne Leid und ohne Sünde aus dieser armseligen Zeitlichkeit in seine Ewigkeit aufgenommen, versetzte mich in eine erhabene Stimmung, und ich hätte die Psalmverse laut singen mögen.

Und das Kindlein, das sie von dem Berg herabgetragen, beneidete ich um seinen frühen, seligen Tod, der es schmerzlos aus diesem Dasein rief, ehe es dessen Elend fühlte und ehe es erkannt hatte, was leben und sterben heißt. –
Es ist ein lieblicher Herbsttag heute, und ich will ihn gegen Abend noch benützen zu einer Ausfahrt.
Der Sepp kommt von Hasle her und holt mich; wir kutschieren bald darauf »hinter Hasle rum« und der Kinzig zu.
Bei der Brücke ließ ich halten, stieg ab und schaute dem Fluß zu, wie er ruhig aus den Waldbergen des Obertales seine Wasser daherströmen läßt.
Und wie mächtige Wellen schlugen dabei die Erinnerungen aus meiner Knabenzeit an meine Seele.
Dort drüben am rechten Ufer unweit der Brücke war die Stätte, wo wir als Knaben unzähligemal beim »Gänsjokele« saßen, dem kleinen, koboldartigen Hirten aller Gänse im Städtle, und ihm andächtig zuhorchten, wenn er aus dem Leben seiner Gänse und Gänseriche erzählte.
Unter der Brücke badeten und fischten wir, und auf ihr sahen wir den Flößen zu, die aus dem Obertal daherschwammen, und reizten die Flößer durch Spottrufe.
Heute ist alles still und tot ringsum, und nur die Wasser des Flusses ziehen, leise klagend, zwischen den Ufern hin.
Es gibt keinen Gänsehirten mehr an der Kinzig, die Flöße sind verschwunden, und der Fluß selbst ist in ein Steinbett gezwängt wie in eine Zwangsjacke.
Auch die Fischlein scheinen ausgestorben; denn die Jauche, so die Papierstoffabrik in Wolfe sendet, hat ihnen das Leben entleidet und das Steinbett des Flusses ihnen jeden wohligen Schlupfwinkel genommen.
Und das alles hat die liebe Kultur getan, die große Fortschrittsdame, um welche die heutige Welt tanzt wie einst die Juden in der Wüste um das goldene Kalb.
Aber dieses scheinbar goldene Kalb wird sich auswachsen zu jenem Moloch, jenem ehernen Stier der alten Ägypter, in dessen Umarmung alles jämmerlich zugrunde ging. –
Ich fuhr betrübt weiter und am Herrenberg hin, wo einst der gute Wein der alten Haslacher wuchs, wo aber jetzt die Rebstöcke seit vielen Jahren meist ihre Frucht versagen, weil sie die heutige Kultur auch nicht mehr aushalten und hinsiechen und sterben aus Heimweh nach der guten, alten Naturzeit.
Als wollte der Zufall mir noch einen Menschen aus jener vergangenen Zeit vorführen, traf ich am Herrenberg den alten Matte-Sepp von Schnellingen, auf einem Felde arbeitend. Er war schon ein verheirateter Mann und taglöhnerte bei meinem Vater in jenen Tagen, da ich als Knabe beim Gänsjokele an der Kinzig saß.
Ein guter Achtziger, lebt er heute noch und sucht sein Brot mit der Hände Arbeit. Ich aber habe immer eine Freude, sooft ich ihn sehe; denn er kommt mir vor wie ein alter Wegweiser mit der Inschrift: »Kinderhimmel«. Und nie fahre ich an seiner Hütte unterhalb Schnellingen vorbei, ohne ihn zu grüßen und ihm sein altes Dasein etwas zu versüßen. –

Weiter oben kommen wir durch den Weiler Eschau. Hier kannte ich vor einem halben Jahrhundert alle Menschen. Der Sepp weiß aber ihre Geschichte aus den letztvergangenen Jahrzehnten, und wo immer ich ihn fragte nach den alten Leuten, hieß es: tot, schon längst tot; selbst ihre Söhne und Töchter vielfach tot.
Wir fuhren hinauf zur Kirche, in deren Schatten meine alte Jugendfreundin wohnt, die »Beckekäther«, die Tochter des Bäckers von Willer, eines Freundes meines Bäckervaters.
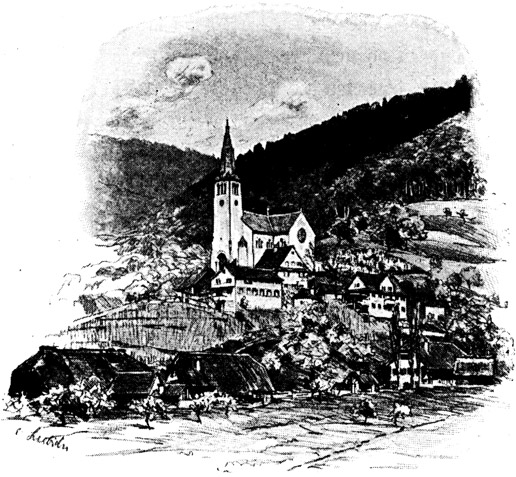
Sie hat von ihrem freundlichen Häuschen aus eine Sicht auf Hasle, auf Hofstetten, auf Husen und auf Wald und Wasser und Weid, die so schön ist, daß ich sie nicht zu schildern vermag.
Das liebe, alte Hasle, es lag heute da drunten im Glanz der Abendsonne so heiter und so verklärt wie vor einem halben Jahrhundert, da mein Kinderhimmel über ihm strahlte.
Was allein mir wehe tat bei seinem Anblick, das waren vier riesige Fabrikschlote, welche so kalt und so poesielos und so störend ihre Industrie-Nasen in dies wonnigliche Naturbild streckten und mir verkündeten, daß die Feindin aller Poesie, die Verderberin des Landvolks, die Totengräberin des Ackerbaues und die Mutter des Proletariats auch in Hasle ihren Einzug gehalten hat.
Aber wehe tat es mir auch, als ich sah, daß die Käther alt und gebrechlich geworden war und mit dem Atem rang wie mit dem Tod.
Was war die Beckekäther von Willer in meiner Studentenzeit ein schönes, starkes, schwarzbraunes Maidle! Und heute ist sie greisenhaft und gebrechlich und vermag kaum noch mehr zu tun, als auf ihre Enkelkinder achtzugeben.
»Man word halt immer krüppliger in unserem Alter,« meinte resigniert die Käther. –
Ich aber fuhr melancholischen Sinnes wieder Hofstetten zu und sagte mir: »Das Kind, so sie diesen Morgen im weißen Totenbäumle zu Grab getragen haben, ist solcher Erfahrungen, wie du sie diesen Nachmittag gemacht hast, überhoben. Drum selig die Toten, die als Kinder gestorben sind.«
Am 24. September.
Gestern war für mich ein Tag innerer Aufregung und Verstimmung. In aller Frühe war einer meiner Vikare, der kleine Leible von Bittelbrunn, gekommen mit der Kunde, es sei am Abend zuvor in meinem Hause ein Brand ausgebrochen.
Um dem armen Martinsfonds und dem noch ärmern Pfarrer von St. Martin etwas aufzuhelfen und zugleich dem großen Pfarrhaus, das einem verlassenen Siechenhaus nicht unähnlich sah, eine gründliche Restauration zu verschaffen – kam ich im Jahre 1885 auf den Gedanken, in dem untersten, unbewohnten Stockwerk des Hauses Ladenlokale einzurichten.
Es gelang mir, den Gedanken zu realisieren, aber erst nach vielen Mühen und Schikanen. Denn ich habe fast allzeit meiner pfarramtlichen Tätigkeit in Freiburg das Unglück gehabt, meiner vorgesetzten Behörde zu mißfallen. Drum, so oft ich was will, wollen andere nicht, eben weil ich es will.
So kommt es, daß ich viel schwerer tue als andere, loyalere, schweigsamere und demütigere Pfarrer und erst nach vielen Hindernissen und Umwegen zum Ziele gelange.
Ich könnte darüber ein ganzes Buch schreiben, aber ich fürchte, mein Ingrimm könnte zu laut schreien und Kindern und kleinen Leuten ein Ärgernis geben.
Und dann geschieht es mir eigentlich recht, wenn ich Unrecht erfahre, warum bin ich, wie ich bin.
Wenn ich noch einmal auf diese charaktervolle Welt käme, würde ich, falls Kirchen- oder Staatsdiener zu sein mein Los wäre, es ganz anders machen. Ich würde nicht bloß Gott und die Wahrheit und das Recht loben, sondern unter allen Umständen und zu jeder Zeit auch jede geistliche und weltliche Obrigkeit. Ich würde dumm für gescheit, Esel für Genies und Lüge für Wahrheit erklären, wenn's oben so gewünscht und gerne gesehen würde.
Dann, dessen bin ich sicher, würde ich ruhige Tage sehen und ein beliebter Mann sein. Jetzt bin ich aber alt, und es lohnt sich der Mühe nicht mehr, anders, d. h. ein Charakter-Lump und ein serviler Knochen zu werden. –
In einem der so mühsam erkämpften Ladenlokale brach nun durch die Nachlässigkeit eines Mieters Feuer aus – zum Glück am Abend und nicht in der Nacht, sonst wäre das Leben meiner Schwester und mein ganzes, schlecht versichertes Hab und Gut im höchsten Grade gefährdet gewesen.
Der Brand wurde von den wackeren Pompiers der Stadt bald überwältigt, und der Schaden war nicht allzugroß. Nur meine Vögel im Hausgang, die der Rauch erstickte, mußten ihr unschuldiges Leben lassen.
Daß meiner Schwester nichts geschehen, war mir die Hauptsache, und ich drum bald gefaßt. Doch ging mir das Ereignis, welches so schwere Folgen hätte haben können, den ganzen Tag nicht aus meinen kranken Nerven heraus, und ich blieb verstimmt. –
Das schöne Herbstwetter lockte mich am heutigen Nachmittag zum erstenmal seit meinem Wieder-Hiersein in meine Hütte hinauf. Mit Vergnügen bemerkte ich, daß die Vögel des Himmels nachts Schutz suchen unter ihrem Strohdach.
Überall sah ich Spuren ihres nächtlichen Weilens.
Die Tierchen mochten inne geworden sein, daß es sich in der einsamen, menschenleeren Hütte besser übernachten lasse als auf den Zweigen der Bäume, besonders wenn Sturm und Regen über Berg und Tal gehen.
Ich dachte heute wieder lebhaft daran, an Stelle dieser Hütte ein kleines Kapellchen zu bauen für fromme Beter, wenn ich einst nicht mehr da bin. Aber bis jetzt fehlen mir dazu die überflüssigen Mittel, und ob ich sie bei meinem Alter noch zusammenbringe, ist sehr fraglich. –
Als ich vom Berg herabkam, begegnete mir der Briefträger und übergab mir »die Post«. Ich las auf der Straße einige Briefe, nahm sie dann in die Hand und ging über den Dorfbach.
Knaben aus der obersten Schulklasse zogen eben über die Brücke ihren Höfen und Hütten zu.
Da fiel mir ein, ihre Lesekunst zu prüfen, und ich hielt ihnen einen Brief zum Lesen hin, der ziemlich deutlich geschrieben war.
Sie starrten das Geschreibsel an und schwiegen, als ob sie Hieroglyphen entziffern sollten. Ich hörte nun von ihnen und später auch vom Lehrer, daß es in den Schulen längst nicht mehr Mode sei, fremde Schriften lesen zu lernen.
Daß man diese praktische Methode der alten Lehrer aufgegeben habe, hätte ich mir eigentlich denken können; denn etwas, das dem ganz gesunden und normalen Menschenverstand entspricht, ist sicher nicht mehr zeitgemäß.
Als ich noch ein Schulbube war, mußten wir jede Woche eine Stunde fremde Schriften lesen lernen. Unser alter, braver Oberlehrer Blum brachte Geschäftsbriefe, die sein Neffe und Nachbar, der Kaufmann Gotterbarm, erhalten, oder er holte alte Schriftstücke vom Rathaus, und diese mußten wir zu lesen versuchen, was uns jeweils großes Vergnügen machte.
Mit Feuereifer saßen immer drei von uns über einem Schriftstück und rieten und buchstabierten, bis wir es enträtselt hatten.
So was ist der heutigen Pädagogik zu dumm. Man führt lieber die unsinnige und lächerliche »Steilschrift« ein, und wenn dann die Menschenkinder, der Schule entlassen, ein bürgerliches Schriftstück in die Hand bekommen, so stehen sie davor wie eine Kuh vor einem neuen Scheuertor. –
»Heringegen« sind die Schulhäuser unserer Tage um so brillanter. Auch die guten Hofstetter müssen im kommenden Jahre eines bauen. Der Amtmann und der Kreisschulrat wollen es haben. Ich und viele Bauern wären der Ansicht, daß das alte Schulhäusle noch lange gut genug gewesen wäre.
Aber die Schulzimmer sind nicht hoch genug für die Forderungen der heutigen Hygiene, drum muß ein neues her.
Merkwürdig! Trotz dieser Schulpaläste und trotz aller Hygiene werden die Kinder immer blutarmer, zahnloser, krüppliger und siecher; Dinge, die man in den alten Schulhäusern nicht kannte. In den großen Städten stellt man bereits eigene Ärzte an, um den Übeln zu wehren; natürlich vergeblich, weil die Ärzte hier nur die Wirkungen und nicht die Ursachen bekämpfen können.
Übrigens dürften unsere Heilkünstler die Kultur mit Fug und Recht zu ihrer Patronin machen anstatt des heiligen Lukas, der bekanntlich Arzt war. Denn die Frau Cultura bringt den Ärzten die meiste Kundschaft.
Dieselbe liebe Dame, die schuld ist an den schönen Dorfakademien unserer Tage, trägt auch die Schuld am Siechtum der Schulkinder und der heutigen Menschheit überhaupt.
Sie ist jene Pandora, die eine Menge von Geschenken in ihrem Füllhorn hat; aber diese Gaben stammen nicht alle vom Himmel, sondern auch zum Teil aus der Hölle. Die wachsende Genußsucht, der Wind der Geldgier, der durch alle Herzen weht, die Verfeinerung des Lebens, die Scheu vor rechter Arbeit, vor Selbstverleugnung und Abhärtung – sind Höllengaben der Kultur.
Diese macht, vom Rasierhobel und vom Bleistiftspitzer an bis zur Dreschmaschine und zur Bergbahn, den Menschen die Arbeit, die Anstrengung so leicht und so gering als möglich, dadurch aber die gleichen Menschenkinder fauler, bequemer, weichlicher. Und das ist der Fluch.
Täglich schlagen jetzt hier vom frühesten Morgen an die Töne der Dreschflegel von den Bergen herab und das Tal herauf an mein Ohr und, so wenig ich sonst Geräusch mag, ich höre sie gerne. Ich stelle mir dann jeweils lebhaft vor, wie der Bur mit seinen Knechten in der durch Laternenlicht magisch beleuchteten Tenne drischt, die beste Zimmergymnastik der Welt. Und wenn die Büre um sechs Uhr zur Suppe ruft, haben die Mannsbilder schon zwei Stunden draufgeschlagen, sind munter und frisch und hungrig.
So geht's fort bis gen Lichtmeß, wo die Feldarbeit wieder beginnt.
Ich sehe aber jetzt schon jene wandernden Dreschmaschinen, die überall im offenen Lande von Dorf zu Dorf ziehen, auch in die Täler des Schwarzwaldes eindringen. Die Bauern werden dann ihre Frucht zu Tal führen, von der Maschine dreschen lassen und im Winter mit ihren Knechten auf der faulen Haut liegen, ihrem Leib und ihrer Seele zum Schaden.
Item, wer diese und hundert ähnliche Segnungen der Kultur ehrlich näher betrachtet, kann getrost sagen: »Kultur, dein Name ist Teufelin.«
Am 25. September.
Ich hatte bei unserer letzten Fahrt mit dem Sepp ausgemacht, daß wir heute, Samstag, nach Schapbach fahren. Ich wollte die Stätte, auf der ich im Frühjahr gewohnt, auch im Herbstkleide sehen.
In echtem, mir lieblichen Herbstmorgennebel, der aber schon seinen Kampf mit der Sonne kämpfte, um besiegt zu werden, fuhren wir am linken Kinzigufer talauf Wolfe zu.
Der Sepp war gesprächig heute. Wir redeten, wie fast immer, von den Bauerngeschlechtern in Berg und Tal. Er erzählte mir, da wir an einem Hof im Obertal vorbeifuhren, von einem Bur, den ich nicht gekannt, daß er vor Jahr und Tag nachts in der Kinzig ertrunken sei.
Er sei ein braver Mann gewesen, aber etwas »ruhfunkig«. Dies Wort hatte ich in meinem Leben nie gehört, verstand es aber alsbald und erkannte darin wieder den feinen Sinn des Volkes in der Sprachbildung.
Ruhfunkig ist ein Mensch, der, wenn gereizt, mit scharfen, groben Blitzen antwortet.
Wenn man an einen Kieselstein schlägt, gibt's Funken, und so sprüht eine derbe Menschennatur Feuer, wenn man ihr zu nahe kommt.
Ich meinte zu meinem Begleiter, ich gehörte auch zu den Ruhfunkigen, worauf der Sepp mich tröstete mit den Worten: »Des sinn oft die beste Lit.« Trotzdem glaub' ich, daß es manche Menschen gibt, die mich zwar gerne zu den ruhfunkigen, aber nicht zu den besten Leuten zählen. –
In Wolfe wollte ich vor dem Städtle draußen, im Löwen, dem Sepp einen Schoppen bezahlen und seinen Gaul etwas schnaufen lassen. In dem kleinen Nebenzimmer traf ich einige Honoratioren der Amtsstadt, den Doktor, den Apotheker, den Oberförster und einige bessere Geschäftsleute, beim Frühschoppen. Es war kurz vor Mittag.
Ich hatte seit vielen Jahrzehnten keine Frühschoppengesellschaft mehr beisammen gesehen. Aber es heimelte mich an, und ich meinte, es seien erst wenige Jahre vorüber, seitdem ich in Hasle in ganz ähnlicher Gesellschaft einen Frühschoppen getrunken habe, und doch sind es bald vierzig Jahre.
Es sind köstliche Leute, diese Frühschöppler in einem kleinen Städtle. Abends um zehn oder elf Uhr haben sie einander vor ihrem Kneipstüble verlassen und andern Morgens nach elf Uhr treffen sie am gleichen Ort wieder zusammen.
Der eine oder andere weiß was Neues und wenn dies fehlt, reden sie vom vergangenen Abend, oder wie sie geschlafen und wie das Bier bekommen habe. Der Doktor hat vor dem Schlafengehen noch ein Schnäpsle genommen, dem Apotheker hat »seine Alte« eine Gardinenpredigt gehalten, weil er zu spät heimkam; der Oberförster spricht von dem Pech, das er gestern beim Caecospielen gehabt hat; ein vierter erzählt, was ihm am Morgen der Barbier beim Rasieren berichtet.

Und zu all dem harmlosen Gespräch scheint die Morgensonne durch die kleinen Fenster der Bierstube so lieblich und so friedlich auf die braven Männer, daß man schon um dieses Friedens willen den Frühschoppen einführen müßte, wenn er noch nicht existierte.
Bekanntlich heißt es:
Wo man singt,
Da laß dich ruhig nieder.
Böse Menschen haben keine Lieder.
Was hier vom Singen gesagt ist, gilt auch vom Trinken eines Frühschoppens in kleinen, weltfernen Städtchen. –
Es läutete schon die Mittagszeit vom altersgrauen Kirchturm von Wolfe herab, als der Sepp und ich die Hauptstadt des oberen Kinzigtales verließen und das Wolftal hinauffuhren.
In der »alte Wolfe« war der Pfarrherr schon am Mittagsschläfle, als ich vom Wagen aus ihn begrüßen wollte. Es war mir leid, daß seine Nichte wider meinen Willen ihn aus dieser Siesta aufstörte. Denn ich halte es für ein Verbrechen, ohne große Notwendigkeit einen Sterblichen aus seiner Mittagsruhe aufzuwecken.
Der Schlaf nach dem Essen sei ungesund, sagen die Herren Ärzte und ihnen nach viele andere Leute. Allgemein behauptet, ist diese Lehre zweifellos falsch, so falsch, als wenn die Feinde des Alkohols behaupten, das Weintrinken sei schädlich.
Es gibt viele Menschen, denen ein Glas Wein vortrefflich bekommt, selbst zwei; und so gibt es viele, denen ein Mittagsschläfchen ein wahres Lebenselixier ist, und zu denen gehöre auch ich.
Wenn ich eine Viertelstunde geschlafen habe nach Tisch, bin ich fähig zu jeder Arbeit; wenn nicht, bin ich den ganzen Nachmittag wie betrunken oder betäubt und unfähig zum Denken.
Alles ist eben individuell, und eines schickt sich drum nicht für alle; was dem einen nützt, schadet dem andern und umgekehrt. –
Weit droben im Tal stund auf einem Kartoffelacker die Viktoria, die Schwester meines Jugendfreundes Sepp. Sie hatte mich alsbald erkannt und grüßte mit freudigstem Winken.
Als die Leute ihre Erdäpfel in den Boden legten, war ich im Tale, und jetzt, da sie dieselben ernten, bin ich wieder da, glaube aber, es seien kaum einige Wochen seitdem vergangen. So rast die Zeit mit uns jenem Tage entgegen, an dem der Tod und das Grab uns erwarten.
Und die vielen Blumen, die damals im Tale geblüht auf den Matten am Wolfbach und an den Halden unter den Tannen hin, sind verschwunden heute. Die Sense hat sie niedergemäht, sie sind verdorrt.
Aber sie haben doch einmal geblüht, während es so vielen Menschen versagt ist ihr Leben blühen zu sehen. Das Gras auf dem Felde erreicht seine irdische Verklärungszeit, der Mensch aber, der wie kein anderes Wesen nach Verklärung strebt, er findet sie nicht hienieden.
Überall suchen wir das Glück, weil wir fühlen, daß wir fürs Glück geschaffen sind, und bei all dem Suchen und Fühlen schleppen wir unser Dasein dahin wie eine schwere Kette von Mühsalen, Kämpfen, Leiden und Täuschungen. Was allein hält uns aufrecht bei diesem traurigen Los? Der Glaube an ein jenseitiges, besseres Leben, wo wir die Verklärung und das Glück finden sollen, das wir auf Erden vergeblich suchen. Denn der Schöpfer kann unmöglich den Drang nach Glück in unserer Seele geschaffen haben, um uns ewig zu täuschen. –
Bald nach ein Uhr sind wir droben beim Ochsen, wo ich alles finde, als wäre ich erst gestern dagewesen.
Die Kurgäste des Sommers sind alle fort. Das sonnige Häuschen, in dem ich die Maitage zugebracht, grüßt mich so sympathisch wie die Monika, welche »die Kühe, die Schweine und die Kurgäste« besorgt. Sie schaute so treuherzig und so gutmütig und so naturfrisch einen an, daß ich mich wieder förmlich labte an ihrem innern Frieden.
In eines armen, aber unschuldigen, glücklichen und zufriedenen Menschenkindes Augen zu schauen und darin ein ganzes Himmelreich zu finden, ist mir stets ein Labsal.
Zu den Augen schaut, wenn man genau sieht, die ganze Seele des Menschen heraus mit all ihren Vorzügen und Fehlern, Verstand und Herz und des Herzens Frieden und sein Gegenteil. –
Ich ging nach Tisch in das Häuschen hinüber, um Siesta zu halten und die Räume, die ich im Frühjahr bewohnt, wiederzusehen.
Unsere Seele und unser Leib sind von Natur aus dankbar, wo und wie immer man ihnen entgegenkommt.
Mit einem Gefühl des Dankes weilte heute mein Geist in dem kleinen Häuschen, weil es ihm einige Tage der Ruhe und der Stille geboten hatte in der Maienzeit.
Ähnlich ist's auch mit unserem Leib. Wenn wir ihm einige Tage Erholung gönnen, wenn wir seine Gesetze einmal einige Zeit nicht übertreten und mäßig und enthaltsam leben, wie dankt er uns durch erhöhtes Wohlbefinden und durch besseren Schlaf! –
In dem kleinen Gärtchen, in welchem im Frühjahr die Rosenknospen unter dem Schnee seufzten, blühten heute noch Rosen und andere Blumen, die ich hier oben nicht gesucht hätte.
Bei den Blumen billige ich die Kultur durchweg, und je weiter sie hier fortschreitet und je mehr sie der Natur neue Farben und neue Formen abgewinnt, um so erfreulicher ist es. für Aug' und Herz des Menschen.
Allerdings werden die Blumen auch, je mehr man sie kultiviert und veredelt, um so verzärtelter und verweichlichter.
In der Menschenwelt aber wirkt die Kultur unheilvoll. Je mehr sie da an Leib und Seele, an Körper und Geist kultiviert, um so elender wird der eine und um so unzufriedener und unglücklicher der andere. –
Ende September wird's bald Nacht, drum fuhren der Sepp und ich noch bei Sonnenschein wieder der Heimat zu.
Es war eine herzerfreuende Fahrt. Überall Leute auf den Feldern; die Frauen und Mädchen in den bunten Farben ihrer Tracht, deren Rot so malerisch wirkt in der Natur. An den Abhängen weidende Herden und singende Hirtenknaben; auf kahlen Bergspitzen leuchtende Reutefeuer. Nach zwanzig und mehr Jahren wird der Bestand der Birken und Eichbösche von den Bauern im Kinzigtal niedergehauen. Das kleinere Holz wird, in lange Linien gelegt, auf der Stelle, wo es gestanden, als Düngungsmittel verbrannt und dann Frucht angesät. Die Bauern nennen dieses Verbrennen »Rüttibrennen«.
Und über all diesen wechselnden Bildern die milde Herbstsonne, wie sie alles verklärte und überall die feinste Farbenstimmung hervorrief. –
Die Sonne war schon im Sinken, als wir am Eingang zum Gelbach, einem Seitentälchen der Wolf, vorbeifuhren.
Da kam mir der Gedanke, schnell noch dem Hermesbur guten Abend zu sagen.
Gesagt, getan. An echten, alten Höfen vorbei geht's ins enge Waldtal hinein bis hinauf zum Hermeshof. Der alte Bur steht vor seinem »Libdinghus« und spaltet Holz und staunt nicht wenig, als ich so spät und so unerwartet daherfahre.
Aber daß ich nicht einmal absteige, will er gar nicht begreifen. Doch freuen tut's ihn, daß ich gekommen, ihm guten Abend zu sagen.
Er ruft der alten Büre und der jungen, der Tochter meines Freundes, des Moosburen – der junge Bur ist noch droben im Wald – und ich sage allen mit Handschlag »Grüß Gott und B'hüt Gott« in einem Atem und fahre wieder das Tälchen hinaus. –
Es will schon dunkel werden, da wir durchs Städtle Wolfe fahren und bei der Wohnung Theodors, des Seifensieders, anhalten. Ich eile schnell hinauf ins freundliche Stüble, begrüße das greise Paar, freue mich seines heiteren Lebensabends und gehe wieder von dannen.
Am Brunnen vor dem Hause stehen einige Mägde, die Wasser holen. Eine flüsterte so laut, daß ich's hören konnte, der andern zu: »Des isch der Pfarrer Hansjakob, wo die Burebüacher schriwt.«
Der Ausdruck »Burebüacher« freute mich, und ich wandte mich den Mägdlein zu und sprach: »Jo, ihr Maidle, des isch der Burebüacherschriwer.« Sie lächelten still verschämt, und wir fuhren davon. –
Je dunkler es ward, um so heller leuchteten die Reutefeuer auf den Bergen, besonders aus dem Kirnbachertal heraus, und die Lichter aus den Höfen an den Halden und Bergen hin zuckten in die Nacht hinein wie Fixsterne.
Unter Husen konnten der Sepp und ich jeden Hof und jede Hütte, aus denen die Lichter zu uns herübergrüßten, mit ihrem Namen bezeichnen.
Am »geschwigen Loch«, wo der Haslacher Wald beginnt, hören wir Stimmen, die dem Fährmann von Esche, in meiner Knabenzeit der lustige Kumismathis, riefen, auf daß er sie über den nächtlichen Fluß ans andere Ufer bringe.
Es sind Arbeiter, die im Steinbruch diesseits der Kinzig gearbeitet Haben und nun heimkehren. Sie sind trotz harter Tagesarbeit noch lebhaft und rufen mit Löwenstimmen über den Fluß herüber. Sie gehören zweifellos, um mit Sepp zu reden, zu den »Ruhfunkigen«.

Beim »Mühlekäppele« z'Hasle stehen noch Leute im stillen Abendgespräch.
Von weitem winkte mir bald darauf das Licht aus meiner Stube in Hofstetten, welches die sorgsame Helene längst angezündet, entgegen, und noch vor sieben Uhr bin ich wieder stillvergnügt im Paradies.
Am 26. September.
Ein herrlicher Herbst-Sonntag liegt über dem Kinzigtal. Friede und Stille und Sonnenschein ringsum. Selbst die Kirchenglocken stören diesen Frieden nicht; sie erhöhen ihn, indem sie den Tag des Herrn verkünden in die stille Natur hinaus.
Nach dem Gottesdienst fährt der alte Rechgrabenbur aus dem Fischerbach vor »der Schneeballen« an. Er hat einen Sohn im Dorfe verheiratet; den will er besuchen.
Was mich an dem Bur, den ich seit seinen Knabenjahren kenne und der in meinem Alter ist, freute, war seine Tracht. Er trug noch den alten, echten Samtrock mit dem roten Futter, wie er in unserer Jugendzeit allgemein von den Buren getragen wurde.
Heute sieht man selten noch einen solchen Rock. Die jungen Buren im mittleren Kinzigtal tragen sich meist wie Fuhrknechte in den Städten und meinen dazu noch, das sei schön und neumodisch.
Die Wibervölker allein halten noch an der malerischen Tracht der Alten fest, und drum sind sie auch in alleweg noch bräver als die Mannsleute.
Ich hielt dem Rechbur in Gegenwart einiger Hofstetter eine Lobrede und diesen selbst eine »Standrede« über ihre Fuhrknechts-Uniform. –
Ich bin, wie schon »im Paradies« erwähnt, kein Freund vom Besuchtwerden, wenn ich im Kinzigtal weile. Ich schwärme auch in der Stadt nicht für Besuche, weder im tätigen noch im leidenden Sinn, und mache deshalb unanständig wenig Gegenbesuche; nicht zwei in jedem Jahr.
Heute aber kam ein mir sehr angenehmer Besuch – der Finanzminister Buchenberger. Angenehm war mir dieser Besuch nicht wegen der Ministereigenschaft dieses Herren; denn ich taxiere und ästimiere die Menschen nie nach ihrem Amt oder ihrer Würde. Es kann ja ein höchst unbedeutender, schwachköpfiger und charakterloser Mensch in den oberen Regionen stehen. Drum macht bei mir das Amt den Mann ebensowenig wie das Kleid oder die Geburt.
Bei Minister Buchenberger decken sich Mann und Amt in passendster Art, und es wird selten ein Minister seine Stelle so trefflich ausfüllen wie er, den man geradezu einen idealen Finanzminister nennen kann.
Was aber in meinen Augen mehr für ihn spricht als all seine Begabung und sein geistvolles, feinsinniges Wesen – das ist der Umstand, daß er als Minister der liebenswürdige Mann geblieben ist, der er vorher war.
In der Regel werden Leute, die in Staat oder Kirche zu hohen Ämtern gelangen, alsbald, nachdem sie erhöht wurden, wie Schillers »Mädchen aus der Fremde«. Sie verkehren zwar bisweilen noch mit den Hirten, d. i. mit ihren Studiengenossen, aber dabei schaut ihnen die Hoheit und die Würde zu allen Knopflöchern heraus und verjagt die frühere Vertraulichkeit.
Das ist nun bei Minister Buchenberger nicht der Fall. Er ist der gleiche geblieben, und die Standeserhöhung hat ihm den Kopf nicht wirbelig gemacht wie so vielen kleinen Geistern.
Diesen dient es übrigens zur Entschuldigung, da in der Regel andere ihnen die großen Rosinen in den Kopf setzen, indem sie vor ihnen kriechen und wedeln, als wären sie Halbgötter.
Buchenberger kommt durch solche Byzantiner nicht außer Fassung, und darum blieb er menschlich wahr und liebenswürdig.
Wir saßen heute so gemütlich und ungezwungen in den Schneeballen zu Hofstetten beisammen, wie fünfzehn Jahre früher im kleinen Pfarrhäusle zu »Hange« am Bodensee.
Und was mich ferner noch an ihm freut, ist sein Herz fürs Volk, für den Bauer und für den kleinen Mann.
Er sieht, daß unsere Bauern zu hoch besteuert sind, und hat bereits die Vorbereitungen getroffen zu einer neuen, gerechteren Einschätzung.
Nicht grundlos bemerkte er übrigens heute, daß manche Bauern bei der letzten Katasteraufstellung selig waren, als sie hörten, ihre Sache sei so viel wert. Sie meinten nun, sie seien reiche Leute und könnten sich was leisten.
Diese dummen Bauern wurden aber bald eines andern belehrt, als der Steuerzettel kam, und bei der neuen Taxierung werden ihre Nachkommen die Augen schon besser aufmachen, wenn die Güter- und Steuereinschätzer an die Arbeit gehen. –
Minister Buchenberger könnte aber noch mehr für die Bauern tun, wenn er, wovon ich ihm schon oft sprach, das Feuerversicherungswesen monopolisieren und so den Dividendenfurien der Aktiengesellschaften das Handwerk legen wollte. Er würde dadurch unserem Schwarzwald seine ebenso praktischen als poesievollen Schindel- und Strohdächer erhalten und den Bauern ein Wohlgefallen werden.
Trotzdem Buchenberger als Finanzminister und Generalkassier die badischen Volksvertreter an dem Punkte faßt, bei welchem bekanntlich die Gemütlichkeit aufhört, am Geldbeutel nämlich, ist er doch bei den Ständen der beliebteste seiner Kollegen. Wenn das badische Zentrum unter der Führung des Löwen von Zähringen einen Ministersturz versucht durch ein »Mißtrauensvotum«, wie mein alter Hausherr in Waldshut zu sagen pflegte, so wird der Finanzminister unter Verneigung vor seinen Leistungen davon extra ausgenommen. Ähnlich tun die Sozialdemokraten.
Man sieht daraus, welch ideale Männer in der badischen Kammer sitzen. Freiheit und Recht sind ihnen lieber als Geld, das keine Rolle spielt, wenn man um die erstern kämpft. –
Buchenberger war ein wilder Student und ist jetzt ein so milder, abgeklärter Mann, daß ich von ihm lernen könnte, ich, der ich der gleiche geblieben bin wie in meinen Studienjahren, wild und krakeelisch.
Ja, ich bin heute in manchen Dingen, die man mit der Zunge, verrichtet, fast schlimmer als früher; aber ich kannte eben in meinen jungen Jahren die Charakterlosigkeit der Menschen nicht so. Entschuldigend mag ferner für mich sein, daß bei mir vielfach gerechte Erbitterung die Verse macht. –
Merkwürdigerweise stund ich auch mit Buchenbergers Vorgänger, Ellstätter, stets auf »gutem Fuße«, selbst mitten in der Kulturkampfzeit, in welcher die andern Minister mich verklagten und ins Gefängnis brachten.
Da ich als junger Abgeordneter im Jahre 71 zum erstenmal in die Kammer trat, ward ich Mitglied der Budgetkommission. Bei einem Hoffeste sah mich der Finanzminister Ellstätter das erstemal und fragte mich als angehenden Budgetmann ziemlich höhnisch: »Ob ich denn auch ein guter Rechner wäre?«
Ich antwortete ihm, das Rechnen sei in meinem Wissen von jeher die schwächste Seite gewesen und geblieben. Aber eine Manipulation verstünde ich doch noch von der Volksschule her, das Abziehen, und das genüge für ein Mitglied der Budgetkommission dem Finanzminister gegenüber.
Der Minister fand diese Antwort genügend, und fortan waren wir »gut Freund« in und außerhalb der Kammer.
Es ist zu bedauern, daß Exzellenz Ellstätter, der fast ein Vierteljahrhundert und in großen Zeiten badischer Minister war, keine Memoiren aus seinem Leben schreibt. Der geistreiche und feinfühlige Mann könnte sicher vieles erzählen und mehr Interessantes als ein Proletarier und Subalterner meiner Sorte.
Doch es ist sicher schwerer für einen Staatsmann, Memoiren zu veröffentlichen, als für unsereinen. Sagen kann und will er sicher nicht alles, was vorgeht in der Staatskunst, und lügen soll er als ehrlicher Mann auch nicht. Memoiren haben aber nur Wert, wenn sie der vollen Wahrheit dienen.
Der Fürst dieser Welt ist, wie der Heiland sagt, der Teufel. Er ist als solcher der Vater aller Diplomaten, welche ihm ja die Welt regieren helfen. Er ist aber bekanntlich auch der Vater der Lüge; drum wird in der Staatskunst so viel gelogen und geheuchelt. –
Geld- und Finanzmenschen sind vielfach kalte, abstoßende Leute. Bei den genannten zwei Ministern trifft dies durchaus nicht zu, weil sie neben ihrem Amt Geist und Herz bildeten. Beide sind auf allen Gebieten der schönen Literatur durchweg daheim.
Mit dem Finanzminister Buchenberger waren heute noch nach Hofstetten gekommen seine Frau und seine Schwester und deren Mann, ein Kaufmann aus London. Frau Buchenberger ist eine halbe Kinzigtälerin. Als ich noch Student war, amtierte ihr Vater als Oberförster in Zell, und ich bin in jener Zeit manchmal biertrinkend bei ihm »im Raben« gesessen.
Beide »Damen« machten auf mich einen gewinnenden Eindruck durch die geschmackvolle Einfachheit ihrer Toilette. Bessere Wibervölker im wahren Sinne des Wortes erkennt man auf den ersten Blick am Anzug.
Je mehr sich weibliche Wesen unschön und auffallend herausputzen, um so mehr nähern sie sich innerlich und äußerlich städtischen Kellnerinnen an ihrem Ausgehtag. –
Zu gleicher Zeit mit diesen werten Gästen war noch ein zweiter Finanzminister im »Paradies« eingetroffen, mein eigener nämlich.
Der Zentrumsführer und Generalstabschef des bekannten Pfarrherrn Wacker von Zähringen, Wilhelm Fischer in Freiburg, ein Finanzgenie und Präsident der Gewerbebank, ist seit Jahren mein Finanzminister. Er sorgt als Hausfreund dafür, daß das Soll in meinem Budget das Haben nicht überschreitet, sondern daß das letztere allmählich überwiegt.
Dank seiner weisen Finanzpolitik, die nur einmal fallierte, als er mir »Portugiesen« empfahl, wird bei dem Tod des armen Pfarrers von St. Martin so viel übrig sein, daß seine Schwester so lange, bis auch sie das Zeitliche segnet, täglich dreimal Kaffee mit Weißbrot genießen und er den Armen noch ein Scherflein hinterlassen kann. –
Die Herbstsonne schien mild und verklärend in meine Stube, in der wir heute beisammen saßen und die Becher kreisen ließen.
Leider muß ich derartige Stunden nachher büßen. Als die werten Gäste gegen Abend wieder fort waren, überfiel mich eine Müdigkeit, die nur der hochgradige Neurastheniker kennt und welche mir ankündigte, daß es die kommende Nacht nicht zum Schlafen kommen werde ohne Schlafmittel.
Einem so nervenschwachen Menschen, wie ich einer bin, sollte man alle Sünden verzeihen, weil er fast beständig im Zustande der Buße sich befindet.
Unterhält er sich angenehm oder ergreift Freude sein Gemüt, so strengt das seine Nerven an; ärgert er sich, so geraten diese kleinen Lust- und Leidteufel in Raserei und peitschen den kranken Mann wie Furien.
Drum sollten alle jene Nebenmenschen, die ich schon geärgert habe in Schrift und Wort, denken: Der Friede sei mit ihm – denn er büßt die Strafe für seine Vergehen am eigenen Leibe, und er duldet weit mehr an sich und in sich selber als wir durch seine spitze Feder und seine Haslacher Zunge. –
Am 27. September.
Der einzige größere Ort im Kinzigtal, den ich im Leben noch nie betreten, war bis heute das württembergische Städtchen Alpirsbach an der oberen Kinzig.
Diesen Morgen nun fuhr ich dahin. Vor elf Uhr bestieg ich in Hasle den Zug, und vor Mittag war ich schon dort.
Zwischen waldigen Bergen gelegen und von der jungen, lustigen Kinzig durchflossen, machte das kleine Städtchen mit seinen großen, alten Holzhäusern auf mich den besten Eindruck.
Echt deutsch und echt kleinbürgerlich schaute es einen aus allen Gassen an, und man konnte meinen, die Herbstsonne, welche warm wie im Juni an die hohen Giebel der alten Häuser schien, verkläre ein Landstädtchen des vorigen Jahrhunderts.
Und da ich das Alte und Kleinbürgerliche liebe, so gefiel mir Alpirsbach, noch bevor ich zu Mittag gegessen hatte.
Daß auch die Bewohner altbürgerlichen, biedern Charakter haben, sah ich an den vielen Gänsen, welche lustig schnatternd im Sonnenschein durch die Gassen stolzierten, der Kinzig zu.
Sie machten mir eine helle Freude, und ehe ich auch nur einen Alpirsbacher gesprochen, sagte ich mir:
Wand'rer! In Alpirsbach, da laß dich ruhig nieder;
Denn, wo noch Gänse schnattern, sind die Menschen bieder.
In Wahrheit! Mit den Gänsen, Kühen und Schweinen und ihren vom Gemeinwesen angestellten Hirten ist der gute, alte Bürgersinn aus den kleinen deutschen Landstädtchen gewichen, und an ihre Stelle ist der Mode- und Großstadtteufel getreten. Die Schuhmacher-, Schneider- und Bäckermeister lassen sich jetzt Herren titulieren, deren Wiber Frauen und ihre Maidle Fräulein.
Und diese Herren wollen keinen Klee mehr holen und mit dem Graskarren nicht mehr durch die Gassen fahren wie zu meiner Zeit. Die Frauen und Fräulein aber wollen keine Kühe mehr melken, keine Schweine mehr füttern und keine Gänse mehr rupfen.
Drum wurden diese Haustiere abgeschafft, und die Gänserolle spielen die Wibervölker selber.
Ehre und Achtung aber den Alpirsbacher Wibervölkern ihrer Gänse halber! –
Ehe ich mich in Alpirsbach zu Tische setzte, wollte ich noch sein Kleinod sehen, die dreischiffige Klosterbasilika, ein romanischer Bau aus den Jahren 1095-1098.
Ruotmann von Husen bei Hasela, Adalbert von Zollern und Graf Alwick von Sulz legten 1095 den Grund zu einem Kloster nach der Regel des heiligen Benedikt und ließen die herrliche Kirche erbauen.
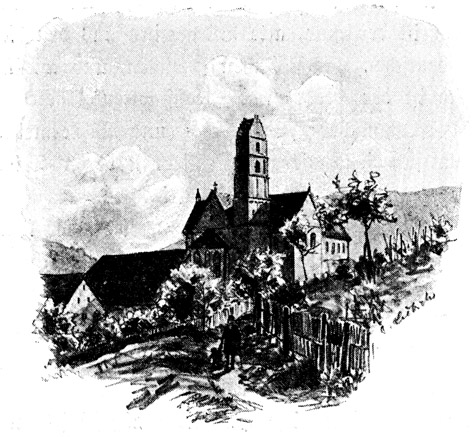
Die zwei erstgenannten Stifter wurden selber Mönche im neuen Kloster, das, wie die Zimmerische Chronik meldet, »anfangs schier ein weltlich closter gewesen, darin die grafen, herrn und vom adel, die uf ihr alter kommen und unvermögenlich worden, sich begeben und neben kurzweiligen ordentlichen übungen, die ihrem alter gezimpt, auch ein abgesonders und gotzferchtigs leben furen kunden.«
Die drei genannten Herren haben sich durch den Bau der Klosterkirche ein unvergängliches Denkmal gesetzt, dem ich leider nur von außen meine Bewunderung zollen konnte.
Ich suchte und fand zwar den Sakristan, der mir die Kirche aufschloß. Als ich aber eintreten wollte, kam mir eine solch eisige Kälte entgegen, daß ich, erwärmt von den Strahlen der Herbstsonne, alsbald wieder hinausging, weil ich eine starke Erkältung fürchtete.
Ich gab dem Türöffner seinen Sold und ging von dannen.
Die Alpirsbacher gehen entweder zur Frühjahrs- und Sommerszeit nicht in die Kirche – was ich aber bei ihrer Gänse-Biederkeit nicht glauben kann – oder sie haben eine Gesundheit wie die Fischottern, die an der Kinzig hausen, sonst müßten Lungen- und Brustfell-Entzündungen bei ihnen endemisch sein. –
Das Kloster ist längst aufgehoben, seit 1648, und hatte bis 1807 lutherische Äbte, die zugleich Pfarrer von Alpirsbach waren.
Leider! ist keine Chronik dieser alten Abtei erhalten, und über das innere Klosterleben wissen wir fast nichts; auch nicht den Namen des Baumeisters der Kirche, noch den des Mönchs, der den Taufstein und den Kruzifixus, die sich heute in der Kirche zu Freudenstadt befinden, so kunstvoll aus Stein gebildet hat. –
Die Wirtshäuser in Alpirsbach sind der alten Sitte gemäß im zweiten Stockwerk, und auch das gefiel mir natürlich. Aber was mir nicht mundete, war der Wein.
Es war, um preußisch zu reden, »ein schöner Wein«. Ein solcher muß aber nach norddeutschen Begriffen süß sein und schnapsig.
Da nun solch schöne Weine nicht überall wachsen und auch der echte deutsche Wein nicht süß ist in dem gewünschten Sinne, so machen die Weinhändler eben solch schöne Weine, und diese lieb' ich nicht.
Ich alter Weinbauer und Weintrinker merke beim ersten Schluck die weinhändlerische Absicht, unfern norddeutschen Brüdern gerecht zu werden, und werde alsbald verstimmt. –
In Alpirsbach ist eine kleine katholische Diaspora-Gemeinde, deren Kirchlein und Pfarrhaus im ehemaligen Klostergebäude untergebracht sind.
Ich kannte den Pfarrvikar persönlich noch nicht; er hatte mir aber schon schriftliche Mitteilungen gemacht zu meinen »Erzbauern«. Drum besuchte ich ihn, nachdem ich gegessen und den »schönen Wein« hatte stehen lassen, und fand ihn im alten Klostergebäude in einer kleinen, sonnigen Wohnung, die er mit Mutter und Schwester teilt.
Ich habe einmal geschrieben: »Wer einen Jesuiten kennt, kennt alle.« Das gleiche kann man auch von den württembergischen katholischen Geistlichen sagen, deren ich schon gar viele kennen gelernt habe.
Alle diese schwäbischen »Hairle« sind helle, geweckte Leute, keine »Betbrüder« und keine Kopfhänger, und schauen frisch und froh ins Leben und ihren Mitmenschen ins Gesicht. Dabei haben sie eine Eigenschaft, um welche ich sie in hohem Grade beneide. Ich kann dieselbe nur umschreiben, und sie besteht in einer Mischung jener Schlangenklugheit, welche der göttliche Heiland empfiehlt, mit der angeborenen württembergischen Schlauheit.
Diese, im besten Sinne des Wortes genommen ist jedem echten Schwaben von Natur aus eigen und der Grund, warum dieselben in Handel und Wandel, in Wissen und Können ihren Nachbarn in Baden und Bayern in alleweg überlegen sind.
Vermöge dieser Eigenschaft sind die Schwaben, geistliche und weltliche, vorsichtig, überlegt und lieber hörend als sprechend, wenn sie mit andern deutschen Leuten zusammenkommen. Und das lob' ich um so mehr, je mehr ich die gegenteiligen Prädikate verdiene.
Ich habe in meinem ziemlich langen Leben keinen Menschen kennen gelernt, der im Reden, Tun und Schreiben unkluger, unvorsichtiger, unüberlegter und in all diesen Fehlern unverbesserlicher wäre als ich, der ehemalige Becke-Philipple von Hasle und derzeitiger Pfarrer von St. Martin zu Freiburg.
Schon Salomon, der Weise, spricht: »Glückselig der Mensch, der reich ist an Klugheit. Besser ist der Besitz derselben als Erwerb an Silber, und mehr als reines Gold ist ihr Ertrags Menge der Tage ist in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre.«
»Mein Sohn,« so fährt der Sprosse Davids fort, »das möge nie deinen Augen entschwinden: Bewahre Gesetz und Überlegung, und Leben wird sein deiner Seele und Zierde deinem Halse.«
Schon oft hab' ich diese Stellen mit Andacht gelesen, aber leider nie beachtet. Drum geschieht es mir recht, wenn ich alt geworden und ein Mensch bin ohne Reichtum, ohne Ehre und ohne Zierde am Halse. –
Schon vor drei Uhr des Nachmittags verließ ich mit der Bahn wieder das sonnige Waldstädtle, obwohl ich in Rom war und den Papst, hier die Basilika zu Ehren der allerheiligsten Dreifaltigkeit, im Innern nicht gesehen hatte.
Aber gleichwohl zog ich befriedigt von dannen, befriedigt, weil ich ein altes Städtle, die Gänse der Alpirsbacher und einen Mitbruder gesehen, der durch sein heiteres Wesen, vorab aber durch seine evangelisch-württembergische Klugheit mein Herz erfreut und mich selbst wohltuend beschämt hatte.
In Schenkenzell stieg ich aus und trank bei der Ochsenwirtin einen Wein, der gar nicht schön, dafür aber um so besser und echter war. Die Ochsenwirtin gehört noch zu jenen ziemlich seltenen Wirtsleuten im Kinzigtal, die im Herbst ins Weinland fahren, hinab ins untere Kinzigtal, und den Traubensaft vom Stock weg holen.
Ihr Sohn führte mich alsdann das enge Waldtälchen hinauf gen Wittichen, dessen wunderbare Klostereinsamkeit mich vor sechs Jahren schon so angezogen hatte.
Ich fand das alte Klosterkirchlein schön restauriert und bemalt; aber das Bergwasser, welches von Südosten her in die Kirchenmauern sickert, lief an den Wänden herunter und wird bald alle und jede Malerei zerstört haben.
Am Grab der heiligen Luitgard, der einzigen bekannten Heiligen, welche das Kinzigtal hervorgebracht hat, betete ich einige Augenblicke.
Die Landleute um Wittichen glauben, daß die heilige Beguine, von der ich in dem Buch »Waldleute« erzählt habe, durch ihre Fürbitte besonders helfen könne gegen Kopfleiden. Und da mein Kopf oft auch nicht in Ordnung ist, bat ich sie um Ruhe für meinen unruhigen Geist und um jene Klugheit und Überlegung, die den schwäbischen Priestern eigen ist, mir aber gänzlich abgeht. –
Ich wollte den Pfarrer besuchen, der im ehemaligen Kloster in zerfallenen Räumen wohnt; aber er war über den Berg gegangen, hinüber ins Schapbacher Tal.
Wenn ich die Klosterwälder Wittichens so billig bekommen hätte wie das Haus Fürstenberg bei der Aufhebung des altehrwürdigen Frauenstifts, dann dürfte der Pfarrer von Wittichen nicht in einer so trostlosen Ruine wohnen. –
Ich ließ mich noch ins Kaltbrunner Tal fahren, um das Grab des Erzbauern Andreas Harter zu suchen und zu besuchen.
Wie im Hochsommer, so kräftig sandte die Sonne ihre Strahlen auf Wälder und Matten. Auf den letztern waren die Leute noch mit Mähen und Dörren des Öhmdgrases beschäftigt. Überall herbstliche Bilder und herbstliche Stimmung, nur der Himmel schien sich im Kalender versehen zu haben.
Bei der Rückfahrt aber zeigten die langen Schatten an den Berghalden hin, daß Frau Sonne doch noch wußte, was sie um diese Jahreszeit zu tun habe, nämlich früh zu Bett zu gehen.
In Hasle läutete es eben Betzeit, da ich mit Jörg, dem Gerechten, der mich am Bahnhof abgeholt, hinter dem Städtle durchfuhr dem Paradies zu.
Am 28. September.
Meine Bewegungsnerven gestatten mir nicht oft, einen Weg von mehr als zehn Minuten zurückzulegen. Heute ließen sie es zu, daß ich etwas weiter gehen und wieder einmal meinen alten Freund, den Rothbur, auf seiner reizenden Anhöhe besuchen konnte.
Wir saßen vor seinem Hause unter dem schützenden Strohdach, schauten ins stille Tal hinab und diskurrierten.
Er erzählte mir, wie er von seiner Heimat weg und nach Hofstetten gekommen sei. Droben auf dem Dochbach, westlich von Hasle, hinter dem Strickerwald, ist der Rothbur daheim, auf dem »Maternehof«, der herabschaut auf Hasle und von dem aus man eine der entzückendsten Aussichten im ganzen Kinzigtal hat.
Sein Vater starb frühe und hinterließ zwei Buben, Jörg und Florian. Schon bei der Teilung hintergeht die Mutter ihre zwei Kinder. Sie nimmt ein Ziegenböcklein, trägt's hinab nach Hasle und besticht damit den »Teilungs-Kommissär«, der dafür in die Teilungsurkunde einen Paragraphen zu ihren Gunsten macht.
Dann heiratet sie wieder, bevorzugt die neuen Kinder und jagt, kraft jenes Paragraphen, die zwei älteren, da sie kaum erwachsen sind, aus dem Vaterhause fort.
Beide werden Knechte und dienen viele Jahre den Buren, bis der Jörg, der Erbin des Hofes »auf der Roth« zu Hofstetten rekommandiert, Rothbur wird.
Sein Weib war Erbin geworden, weil ihr Bruder, der Wendelin, den Hof nicht wollte und nach Amerika zog, um etwas Besseres zu werden. Es gelang ihm; er wurde Schullehrer in einem Dorfe des Staates Minnesota, wo er heute noch lebt, jedenfalls ein kurioser Heiliger. Ich wollte millionenmal lieber Rothbur in Hofstetten, als Dorflehrer oder selbst Universitäts-Professor in Amerika sein. –
Es hat den Jörg vom Dochbach noch keine Stunde gereut, Rothbur geworden zu sein; aber das behauptet er heute noch: »Wenn man heiratet, gibt es vom ersten Tage an Gedankenveränderungen.«
Der Rothbur wollte damit sagen, daß zwischen ledig und verheiratet ein Unterschied sei, weil mit dem Heiraten ernste Pflichten beginnen, die der ledige Mensch nicht habe. Diese Auffassung ehrt ihn und die originelle Art, mit welcher er ihr Worte verlieh, auch. –
Sein Bruder, der Florian, kam auf ein Gütle weit droben an der Wutach, in Ewattingen, hat aber der Welt schon Adieu gesagt.
Dagegen lebt der Stiefvater der beiden noch, der alte Matern, unter dem die Buben enterbt wurden. –
Als ich wieder von der Anhöhe herabschritt und allein war, kam mir nochmals die Bestechung mit dem Ziegenböcklein in den Sinn, und ich sagte mir: »Die alte Zeit war doch in alleweg die bessere, selbst in den Formen der Bestechung. Wie anspruchslos und bescheiden erscheint einem in unsern Tagen ein Beamter, der um eines Ziegenböckleins willen den Weg des Rechten verläßt. Heutzutag ist eine Bestechung nicht mehr so billig; die kostet gleich Hunderte und Tausende, nicht weil es den Betreffenden schwerer wird, dem Recht eine Nase zu drehen, sondern weil sie mehr Ansprüche ans Leben machen. –
Das herrliche Wetter verlockte mich diesen Nachmittag, zum Abschied noch mit Wendel meine Lieblingsfahrt zu machen über die Höhhäusle und durchs Welschensteinacher Tal, den gleichen Weg, den ich im Mai schon beschrieben habe.
Diese Tour ist bei Sonnenschein so schön, daß ich sie jeden Tag mit Genuß machen könnte.
Ich nahm die Generalstabskarte mit, weil ich gerne an Ort und Stelle die Namen der Berge, Wälder und Halden studiere. Die Höfe kenne ich alle, aber nicht alle Berg- und Waldnamen; in diesen liegt aber oft sinnige Bedeutung, die uns das Volk, so sie gegeben, auch hierin von Gottes Gnaden macht.
Schon hundertmal hab' ich die Karte von Hasle und Umgebung in Händen gehabt, und doch fand ich heute auf der »Breitebene«, über die ich schon so oft gezogen, einen Namen, der mir neu war.
Hinter dem alten Strohhof, in welchem der Dufnerjörg wohnt, dies prächtige Original, von dem ich schon öfters erzählt, auf dem Kamm des »Hessenbergs«, der die Breitebene vom Harmersbächle trennt, las ich heute aus der neuesten Ausgabe der Karte bei einem Stein den Namen »Alemannorum«.
Das war mir neu und befremdend, und ich dachte gleich an fines Alemannorum. Ich suchte später Gewißheit und fand sie beim alten Vater Kolb, dem ersten Topographen und Ortsbeschreiber des badischen Ländles.
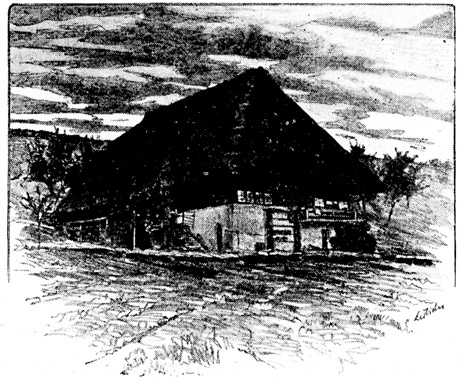
Er sagt, auf dem Hessenberg und eine Stunde südwärts stünden zwei Steine; der eine bezeichne das confinium, der andere das commarchium Alemannorum, und beide seien die alten Grenzsteine zwischen Alemannen und Franken gewesen seit der Zeit Pipins von Heristall.
Nun erzählen uns die Annalen des Klosters Lorsch, daß dieser Pipin 710 gegen die »Schwaben« d. i. gegen die Alemannen, zu deren großem Stamm die Sueven Schwaben, gehörten. zog unter ihrem Herzog Willehari. Im folgenden Jahre sandte er gegen sie seinen Heerführer Walarich und 712 den Bischof Anopos. Nach des letzteren siegreichem Feldzug wurden die genannten Grenzsteine gesetzt.
Jetzt wurde mir auch der Name Schwabenberg und Schwabenkreuz klar, den der Bergrücken südlich von den Höhhäuslen trägt und das Kreuz, so bei dem zweiten Markstein steht.
Die Bauern der diesseitigen Gegend meinen, die Namen kämen daher, weil sie einst österreichisch-schwäbisch, ihre Kollegen jenseits aber Untertanen des Klosters Ettenheim gewesen seien, und das Kreuz habe ein Mann namens Schwab gestiftet.
Nun hängen aber beide Namen mit der uralten Grenze zwischen den Schwaben und Franken zusammen und sind durch ihr Alter ebenso ehrwürdig als interessant.
Mich freut es aber, daß mein alter Freund, der Dufnerjörg, dieser originelle, durstige Alemanne mit seinen blauen Augen, Wache hält am confinium Alemannorum als ein würdiger Vertreter eines tatendurstigen, deutschen Volksstammes.
Ich war zu spät daran und mein Weg noch weit, sonst hätte ich den Jörg und den Markstein besucht und den ersteren mitgenommen zu einem Trunk beim »Höhwirt«.
Bei diesem angekommen ließ ich halten. Denn beim Höhwirt ziehe ich nie vorbei, ohne mit ihm einen Schoppen von seinem berühmten Ettenheimer zu trinken, den kein norddeutscher Bettler »schön« finden würde, der aber, wie der Höhwirt sagt, »so isch, wia er am Wistock g'wachse isch – und drum eine Gottesgabe.«
Ich stieg nicht ab, sondern betrachtete, während der Wendel und der Höhwirt das Gewächs des Weinstocks vom Ettenbach tranken, vom Wagen aus die Welt.
Was man vom Höhwirtshaus aus und kurz vor und gleich hinter den Höhhäuslen schaut, ist mir das liebste Stück Erde in der Nähe von Hasle, ja vom ganzen Schwarzwald. Und schon mehr denn einmal und ganz besonders heute wieder habe ich ein Luftschloß da gebaut.
Arme Leute leben viel von der Phantasie und träumen sich künftige bessere Tage, um im gegenwärtigen Elend den Mut nicht zu verlieren.
Da auch ich in die Zunft der armen Leute gehöre, mache ich es auch so und baue mir bald da, bald dort um Hasle rum in Gedanken ein Häusle, um darin leben und sterben zu können.
Heute träumte ich von einem solchen auf dem »Hülenfeld« nächst den Höhhäuslen. Es hat seinen Namen Heulenfeld zweifellos daher, weil über es hin die Winde Gottes in drei Flußtäler hinunter heulen, wenn sie vom Kandel oder vom Farrenkopf her ins Land einbrechen.
Aber es gewährt auch eine Fernsicht, das Hülenfeld, in die Täler und Berge der Elz, der Kinzig und der Schutter, die von Gottes höchsten Gnaden ist.
Hier ein wetterfestes Häusle haben und wohnen dürfen bis zum letzten Lebenstag, wäre mir eine Seligkeit, von der ich leider nur träumen kann.
Am hellen Morgen durch den Rotzelwald hinüberwandeln auf den Hühnersedel und trunkene Blicke tun in die weite Gotteswelt; am Abend über die »Hallen« schreiten und hinabschauen zum nebelverschleierten Münster von Straßburg; an Sonntagen mit den Nachbarn, mit dem »Hinnechriste« und mit dem »Finsterbur« und ihren Völkern hinunterpilgern zum Kirchlein von Oberbiederbach und am Nachmittag beim Höhwirt sitzen mit den genannten Buren und mit den alten Freunden, mit Severin, dem Schofschnider, und Jörg, dem wackern Trinker von der Grenzmark der Alemannen – das wäre mir ein Hochgenuß und die Fülle aller Poesie.
In Wahrheit! So gewiß ich an Gott glaube, der dies wunderbare Stück Schwarzwald geschaffen hat, so gewiß könnte mir die Welt drunten und draußen mit all ihren Freuden, Genüssen, Gütern und Ehren gestohlen werden, wenn ich sorgenlos und pflichtenlos hier oben in einem eigenen, sonnigen Heim beständig wohnen und leben dürfte. –
Der Wendel und der Höhwirt haben indes ausgetrunken, während ich mein Lufthäusle und seine Wonnen zusammenphantasierte, und wir ziehen weiter über die Hallen; aber meine Gedanken über diesen Fleck des Schwarzwaldes bringe ich nicht so bald los.
Auf dem südlichen Schwarzwald um den Feldberg und um den Turner herum mehren sich von Jahr zu Jahr die Kurhäuser und die Fremden. Aber auf die Höhe, über die ich heute fuhr, ein Kurhaus zu stellen, ist noch niemand eingefallen, und doch wäre hier ein Paradies für Menschen, die noch Sinn für Poesie und Verlangen nach Waldlust haben.
Persönlich bin ich froh darum, daß es hier zu Land noch keine Kurgäste gibt; denn wo immer sie hinkommen auf den Schwarzwald, diese Weltmenschen, verderben sie mit und ohne Schuld viel am alten, echten Volkstum und an der guten Volkssitte. Sie machen die einfachen Naturmenschen bekannt mit allen Schäden des Kulturlebens und so nach und nach unzufrieden und unglücklich.
Und doch ist das Verlangen nach Naturgenuß auf den Bergeshöhen bei den Kulturmenschen unserer Tage ein so begreifliches. Was treibt diese Städtemenschen hinauf auf den Schwarzwald und in die Alpen? Antwort: Der Katzenjammer, der Weltschmerz, die Unruhe und die innere Zerrissenheit.
Diese Menschen wollen ihre durch alle Genüsse des Kulturlebens nicht befriedigte Sehnsucht nach Glück suchen in der Einsamkeit der Natur. Sie wollen aus all der Unruhe des Stadtlebens wieder zu sich selbst kommen und es ruhig werden lassen in ihrem Innern. Sie wollen ihren Weltschmerz heilen, indem sie der Welt sich entziehen und in der Natur, in Wäldern und Schluchten, die innere Zerrissenheit begraben.
Und je wilder und unheimlicher und großartiger die Natur ist, um so mehr paßt sie zu der Seelenstimmung und zur Geistesrichtung der Menschen unserer Zeit.
Immer höher steigt der Menschengeist, immer größer werden seine Fortschritte, aber immer wilder und unheimlicher auch die Stimmung, der Katzenjammer und der Weltschmerz der Menschen, weil sie bei all ihrem Fortschritt den Geist nicht kennen, der sie allein zum höchsten Glück befähigt – Gott.
Die blasierte Menschenseele unserer Tage sucht und verlangt unbewußt nach dem höchsten Geist; sie sucht ihn aber nicht da, wo er direkt zu finden wäre, in der Religion; sie sucht ihn in der Natur, in seiner Schöpfung.
Der Natur klagen darum die Menschen ihr Leid, ihren Jammer, ihren Schmerz, ihre Zerrissenheit; sie klagen sie so indirekt Gott, dem Herrn, in seiner Schöpfung und finden Erleichterung.
Drum hab' ich schon einmal in den »Dürren Blättern« gesagt, wie gut es wäre, wenn geistvolle christliche Prediger zur Sommerszeit den armseligen, Ruhe und Frieden suchenden Kulturmenschen auf die Berge nachgingen, ihnen Bergpredigten hielten und ihre Bewunderung der Schöpfung auf den Schöpfer zu übertragen wüßten. –
Es ist merkwürdig, wie wenig das größte Kulturvolk des alten Heidentums, die Römer, Sinn hatte für die Herrlichkeit der Alpenwelt, des Schwarzwaldes und für das Romantische in der Natur überhaupt.
Es kam das teils von ihren religiösen Begriffen, teils von ihren sozialen Verhältnissen her. Die Religion sagte ihnen, daß in wilden, waldigen Gegenden der Gott Pan wohne mit seinen Frauen und Satyren und die Menschen verfolge. Mit Schauern zogen drum die römischen Soldaten durch die deutschen Wälder.
Sodann gab es bei den Römern keinen Kampf ums bessere Dasein, wie in unseren Tagen, weil damals zwei Dritteile der Menschheit gewohnt waren, widerspruchslos dem andern Dritteil als Sklaven zu dienen und dessen Wohlsein zu fördern und zu erhalten.
Erst als die Lehre der christlichen Glaubensboten die besseren Seelen der alten Welt ergriff, da flüchteten diese ihren Weltschmerz auf die höchsten Höhen des Christentums. Sie entsagten allem, was sie besaßen, und wurden Einsiedler und Büßer.
Das Mittelalter hatte es auch nicht nötig, in der Romantik der Natur seinen Weltschmerz loszubringen, weil auch es keinen Kampf ums Dasein kannte, keine ruhe- und keine herzlosen Reichen und keine unzufriedenen Armen, und weil die Menschen Gott in der Religion suchten und fanden.
Item, die Menschen waren, genau betrachtet, zu keiner Zeit so weltschmerzlich und so unzufrieden angelegt wie in der unsrigen, und darum suchen sie Frieden und Ruhe, wo sie allein noch zu finden sind: im Hochgebirg und im Hochwald, wohin die Kultur und ihre Teufeleien noch nicht gedrungen sind.
Sie verkehren hier, wie gesagt, indirekt mit Gott, und schon das beruhigt in etwas ihre kranken Seelen. –
Stumm und still und in diese Betrachtungen vertieft saß ich neben dem Wendel, während er über die Hallen hinaus am Geisberg hinabfuhr.
Es fiel selbst dem wackern Roserbur von Hofstetten auf, daß ich so schweigsam war am Geisberg herunter, und er sprach endlich: »Herr Pfarr', hit sinn Ihr gewiß wieder trurig, wil Ihr morge fort gennt; denn Ihr schwätzet nimme.«
Der gute Wendel weiß längst, daß es mir nahe geht, wenn die Zeit kommt, aus dem Paradiese zu scheiden. Drum deutete er mein Schweigen also. Aber er weckte damit auch die Wehmut des Scheidenmüssens, welche sich bisher noch nicht geregt hatte.
Jetzt war auch diese Saite angeschlagen, und ich wurde noch stiller. Sonst hatte ich dem Wendel jeweils im »wilden Mann« in Welschsteine eine Erfrischung reichen lassen. Heute fragte ich ihn, ob er und seine Gäule es aushalten könnten bis Hasle, was er aufs entschiedenste bejahte.
So ging's ohne Aufenthalt in den dämmernden Abend hinein. Die Bächlein rauschten, die Tannen lispelten, die Hirten kehrten heim, und über den Gehöften stieg friedlich der Rauch der Abendküchen den Höhen zu.
In Hasle, wo ich das Elternhaus nochmals von innen sehen wollte vor meiner Abreise, kehrten wir beim Bruder Sonnenwirt ein.
In der halbdunkeln Stube stiegen alsbald, da ich allein in der Ecke saß, die in der Knabenzeit mein Lieblingswinkel war, Gestalten vor mir auf aus längst vergangenen, seligen Tagen.
Ich sah Vater und Mutter, die längst Toten, und mich als fröhlichen Knaben wieder in der Stube. Und es ward dem alten Mann in der Ecke so wehe ums Herz, daß er zum Fortfahren drängte.
Heute, da ich diese Erinnerungen für den Druck zu Papier bringe, ist auch der Bruder Sonnenwirt ein toter Mann. Er starb im Herbst 1898 in Freiburg, wo er in der Universitätsklinik Heilung suchte. Der Wendel, mein Fuhrmann auf den Lustfahrten im Heimattal, hat seine Leiche geholt und in dunkler, langer Nacht durchs Elztal hinauf heimgeführt ins Vaterhaus.
Sechs Jahre jünger als ich, hat er das Zeitliche vor mir gesegnet, und ich beneide ihn darum, daß er dies Leben überstanden hat.
Der Kampf ums Dasein war ihm härter beschieden als mir; aber er hatte keine inneren, idealen Kämpfe und trug des Lebens Last mit Humor, der ihm selten ausging.
Er teilte mit mir die unzeitgemäße und unbeliebte Eigenschaft, stets und rücksichtslos zu sagen, was ihn Wahrheit dünkte und Recht. Er war in seinen Kreisen trotzdem beliebter als ich in den meinen; denn er war ein unabhängiger Bürger, und ich bin Kirchendiener und ein abhängiger Mann, aber kein – Knecht. –
Wiederum läutet es Betzeit, da Wendel und ich zu Hasle hinausfahren. Die »groß' Glock«, welche den Morgen, den Mittag und den Abend einläutet, hat seit vielen Jahren einen Riß, und darum tönt ihr Klang so sympathisch in zerrissene Gemüter, und es harmonierte ihr schrilles Abendläuten heute mit meiner Abendstimmung.
Abendläuten bedeutet Friede und Ruhe. Mir galt diese Bedeutung heute nicht. Ich war müde, lebensmüde, aber Ruhe fand sich doch keine in meiner Seele. Es wogte darin auf und ab wie wildes Wehe.
Ich dachte daran, da wir am Bächlewald hinfuhren, dessen alte Tannen wie unheimliche, dunkle Gespensterriesen zu uns herüberschauten, daß mit dem heutigen Tage das Büchlein schließt, dem ich den Titel »Abendläuten« gegeben habe und welches das letzte sein soll aus der Heimat.
Seit zwanzig Jahren schreibe ich Erinnerungen an diese Heimat und aus ihr. Ich hab' viel geschrieben und vieles davon mit meinem Herzblut. Und heute, da ich schriftstellerisch Abschied nehmen will von Land und Leuten im Heimattal, möchte das Herz mir bluten, wenn ich zurückdenke, was die Kultur und der Zeitgeist in den 55 Jahren, in die meine Erinnerungen zurückreichen, zerstört haben im heimatlichen Tale an Poesie, an altem, echtem Volkstum, an Volkssitte, an Lebens-Art und Lebens-Genuß.
Ich habe in meinen Schriften die Menschen der guten alten Zeit und ihre gemütvolle Ursprünglichkeit und Natürlichkeit festzuhalten gesucht. Ich habe, was heute noch an Poesie und Gemüt, an Sitte und Glaube im Volke des Kinzigtales lebt, geschildert. Wer aber nach hundert Jahren meine Erzählungen und Schilderungen liest, wird meinen, er lese Märchen aus einer vor tausend Jahren schon gestorbenen Menschenwelt.
Es ist geradezu unheimlich, wie die Erfindungen des Zeitgeistes sich in den letzten Tagen vor Ablauf des Jahrhunderts drängen, wie Zeitgeist und Kultur alles Alte zu stürzen drohen und wie sie der Menschheit immer neue Lebenswege und neue Lebensgenüsse eröffnen und zeigen.
Ein himmelstürmendes Geschlecht von Titanen scheint mehr und mehr aus der Erde zu wachsen, das für die gute alte Zeit, für ihre Poesie und ihre gemütvolle Einfachheit nur noch ein mitleidiges Lächeln hat und keine andern Ideale mehr kennt als – Geld und abermals Geld und Dampf und Licht und Elektrizität und Eisenbahnen und Handel und Verkehr und Industrie und Export und Import.
Dieser Zeitgeist und diese seine Söhne sind mir der Antichrist, der alles verführt und alles verdirbt, was zum wahren Volks- und Menschentum gehört.
Und darum blicke ich beim Abschied so trübe in die Zukunft meiner lieben Kinzigtäler, und darum ward mir heute das Herz so schwer, als die groß' Glock' von Hasle Abend läutete. Ich kam mir, da ich in kommende Zeiten schaute, vor, wie ein alter Wegweiser, der einsam an weltferner Straße steht und nach einem Ort hinweist, der längst untergegangen ist. –
Spät am Abend packten der Jörg und der Wendel, wie üblich, meinen großen Koffer, eine Arbeit, der ich nicht gerne zuschaue, weil sie mich ans Scheiden erinnert.
Ich meine jeweils, es müßten selbst meine Bücher und meine Kleider es fühlen, daß es wieder aus dem Frieden ländlicher Stille fortgehe.
Es war eine sommerliche Nacht draußen; ich verließ die Packer und ging im Schlafrock und in Pantoffeln hinab auf die Straße und hinüber zum einsamen Kirchlein und zu seinem Gottesacker.

Ringsum herrschte Todesstille. Selbst der Nachtwind von der Heidburg her flüsterte nicht in den Bäumen. Aus dem Kirchlein schimmerte geisterhaft das »ewige Licht«. Aus dem Waldtälchen des Ullerst schlich leise murmelnd das Bächlein an den Erlen vorbei, die zu schlafen schienen.
Am tiefdunkeln Himmelszelt leuchteten wie Diamantsteine unzählige Sterne und zogen in feierlicher Stille ihres Weges am Firmament hin.
So ziehen, dachte ich, zu ihnen aufschauend, die Millionen Menschen über die Erde und verschwinden nach kurzem Lebensgang. Wie die Sterne erblassen und untergehen am Himmelszelt, wenn die Sonne aufsteigt, so gehen die Menschen unter, wenn die Nacht des Todes kommt.
Doch die Sternlein kommen wieder, der Mensch aber, wenn er fortgeht, er kommt nimmermehr.
Wie viele Tausende von Menschenkindern haben hier gelebt und sind von dannen gegangen, seitdem diese Sterne über diese Berge hinziehen!
Bald wirst auch du, der so oft sich gefreut in diesem Tal, vorübergegangen sein, die Sternlein aber werden fortglänzen in stillen Nächten noch Jahrtausende lang, bis auch sie sterben müssen.
Doch die Ewigkeit sprach zu mir vom Himmel herab in dieser dunkeln, stillen Nacht, und sie tröstete mich über mein und aller Menschen Scheiden von dieser Erde.
Friede am Himmel heute, Friede auf Erden, tiefer Friede über den Gräbern, über Berg und Tal. Dieser Friede senkte sich jetzt auch in meine Seele, und der Schluß des Abendläutens wurde mir zum Nachtgebet.
* * *