
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
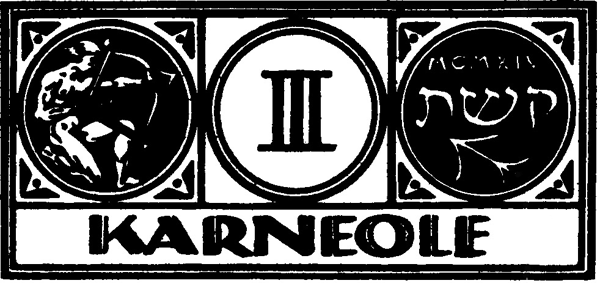
»Talisman ist
Karneol,
Gläubigen bringt er Glück und Wohl.
Alles Übel treibt er fort,
Schützet dich und schützt den Ort.«
Goethe, Westöstlicher Diwan
»Die, so eine schwache Stimme haben und zaghaft sind beim Sprechen, mögen einen Karneol nehmen; der wird ihnen den nötigen Mut geben, daß sie frei und leicht reden können.«
Lapidario del Rey Don Alfonso X.
Und doch war es kein Sieg für Lotte Lewi. Nicht, daß er den Joseph spielte in dieser Zeit, o nein! Er tat stets, was sie wollte, war gehorsam und gefügig wie ein artiges Kind. »Küß mich,« sagte sie, und er küßte sie.
Nur – so müde war er.
Er saß zu Tisch mit ihr und vergaß zu essen. »Iß!« sprach sie – dann nahm er ein paar Bissen. »Trink doch!« sprach sie – dann leerte er sein Glas.
Er saß auf dem Diwan neben ihr, und sie nahm seine Hand. »Sprich,« sagt sie, »erzähle.« Nun erzählte er. Aufgezogen wie ein Uhrwerk, ruhig und still. Aber plötzlich schwieg er. »Was ist?« fragte sie. Aber er wußte es nicht, hatte längst vergessen, was er noch eben gesagt hatte.
Sie sah ihn an, lange, aufmerksam.
»Etwas –« murmelte sie. »Denk nach.«
Er gehorchte gleich, sann nach, angestrengt. Aber er fand nichts.
Sagte: »Ich weiß nicht, liebe –«
Er stockte – wie hieß sie denn nur?
Sie merkte es gut. »Weißt du nicht, wer ich bin?« drängte sie.
Da fiel es ihm ein. »Doch, doch!« rief er, »Lotte Lewi!«
Sie schüttelte nachdenklich den Kopf. Sehr ernst sah sie aus.
Da lachte er. »Es ist gewiß nichts Sonderliches. Nur ein wenig müde bin ich – so hie und da – in der letzten Zeit.«
»Hast du Schlaf?« fragte sie.
Nein, nein – Schlaf hatte er nicht. Jetzt nicht – und auch sonst nicht, wenn er sich müde fühlte. Ja – das war wohl seltsam – schläfrig machte ihn diese Müdigkeit nicht. Oft war es gerade umgekehrt: eben wenn er geschlafen hatte, lange, tief und fest – nachts oder auch tagsüber – gerade dann fühlte er sich so matt und abgespannt.
Was war es denn? Er sprang auf, machte ein paar Schritte durchs Zimmer, setzte die Beine, hob langsam die Arme. Er fühlte all seine Muskeln – stark war er und kräftig wie stets. Er trat vor den Spiegel, lachte. Und dann gleich – taumelte er. Wie ein leichter Schwindel war es, der dennoch sein Hirn völlig freiließ, nur den Körper griff.
Er hielt sich fest an dem Sessel. Er blickte in den Spiegel, studierte sich, sah jeden seiner Züge. Er fand nichts, nichts. Das alles war ihm bekannt, seit vielen Jahren nun. Genau so und nicht anders.
Und doch war da irgendein Fremdes. – Was denn nur?
Er ging zurück zum Diwan. Da sprach sie: »Du bist krank.«
Er zuckte die Achseln: »Dummes Zeug, Lotte.« »Laß nur!« sagte sie. Sie seufzte leicht. »Du – heute Nacht bin ich nicht deine Geliebte. Heute nicht. Morgen nicht – und wer weiß, wann? Du bist krank, Frank Braun: so werde ich deine Mutter sein.«
Er fühlte: nun mußte ein stechender Witz kommen. Eine höhnische Frechheit, ein häßlicher Peitschenhieb, der ihre Liebe traf. So sollte es sein.
Aber weich klang seine Stimme und nicht schneidend. Er sprach – und ein Schluchzen wurde daraus –: »Lotte, du – du – Etwas fehlt mir. Etwas – etwas brauche ich. Ah – wie ich mich darnach sehne!«
»Wonach?« fragte sie.
Tonlos – verzweifelt fast klang es: »Ich weiß es nicht.«
Da sprach die Frau: »Ich werde es finden, lieber Junge.«
* * *
In Baltimore saß er im Hotelzimmer, vor ihm stand der Heroldredakteur. Der hielt sein Manuskript, verbesserte darin.
»Nein, nein, das geht nicht,« sagte er. »Da, an dieser Stelle müssen Sie knapp werden. Kurz, kräftig, nur ein Schlagwort. Sagen Sie: ›Deutsche Treue auf immerdar!‹ Das knallt!«
Frank Braun meinte: »Wir haben die ›deutsche Treue‹ schon dreimal.«
»Um so besser!« rief der Journalist. »Dann begreifen sie's.«
Unten auf der Straße wehten die Fahnen. Sterne und Streifen überall, von allen Fenstern und allen Balkonen. Und quer über die Straßen gespannt riesige Flaggentücher. Dicht gedrängt die Massen.
»Warum keine schwarzweißrote Fahnen zum Deutschen Tage?« fragte er.
»Deutscher Tag?!« Der lange Tewes lachte. »Baltimore feiert das Fest des Liedes vom ›Star Spangled Banner‹ – Hundert Jahre ists heute alt – und die schlechten Phrasen sind gewiß nicht schöner geworden in der Zeit. Aber hier ists höchste Poesie. Eine ganze Woche lang dauert das Fahnenfest – da ist der Deutsche Tag nur eine kleine Einlage.«
Der Festzug kam, hundert aufgeputzte Wagen und wieder hunderte. Frauen in römischen Schlachtwagen, als Amazonen ausstaffiert, Wagen mit riesigen Bierfässern, mit Häusern, Pappdrachen, Klavieren und allem möglichen Zeug. Wie im Kölner Karneval war es, nur viel geschmackloser, kleinlich, plump, unsäglich albern.
›Was soll ich hier?‹ dachte er.
Der Redakteur klopfte ihm auf die Schulter, gab ihm das Manuskript zurück. »Da, so wirds gut sein. Lesen Sie's noch ein paarmal durch. Und nun kommen Sie, es wird Zeit.«
Sie stiegen ins Auto, fuhren durch die Stadt; dann hinaus dem Meere zu. Ein mächtiger Vergnügungspark war da, Ringelspiele, Schaukeln, Schaubuden, Biergärten; da stiegen sie aus.
»Ein Rummelplatz!« sagte Frank Braun. »Hier soll ich reden?«
Der Redakteur nickte. »Freilich!«
Er führte ihn durch die Menschen, hinauf auf die große Musikestrade. Da saß das Komitee – zwei Dutzend schwere Männer im Bratenrock. Und im Hintergrund stand der Gesangverein: noch ein paar hundert Festtagleute. Der Redakteur stellte ihn vor, zweien oder dreien. »Sie kommen gerade recht!« sagte einer. »Gleich gehts los.« Sie mußten sich setzen, vorne, dicht an der Rampe.
Frank Braun blickte hinab. Da standen die Menschen – Männer, Kinder, Frauen – dicht an dicht. Menschen, Menschen den weiten Platz durch – unabsehbar fast.
»Wieviel sind es?« fragte er. »Sechstausend wohl!«
Der Journalist lachte: »Sechstausend? Was denken Sie! Gut vierzigtausend drängen sich da.«
Hier sollte er sprechen? Hier? Vor ein paar hundert Menschen, ja, vor tausend, vor zweitausend vielleicht – aber vor dieser gewaltigen Masse? Und im Freien – nur hinaus auf den Platz! Er griff nach seinem Manuskript – nicht eine Silbe wußte er mehr. Dann lächelte er: es gilt gleich – wird ja doch niemand eine Silbe verstehn.
Da fiel dreimal ein riesiger Hammer auf den eisernen Amboß. Der Pastor Hufner schwang ihn, der Vorsitzende des Deutschen Tages.
Sonor und voll schallte diese gewaltige Männerstimme über den riesigen Garten; wie tiefe Glocken klang sie. Nur ein paar Worte sprach er, und dann, zugleich mit den Tausenden, das Vaterunser.
›Man versteht ihn!‹ dachte Frank Braun. ›Ihn versteht man!‹
Der Pastor stellte den ersten Sprecher vor, ein Parlamentsmitglied aus Missouri.
»Passen Sie gut auf,« flüsterte der Journalist, »das ist ein rechter Volksredner – der weiß, wie mans macht. Lauschen Sie ihm die Technik ab.«
Der Amerikaner begann. Demagogengeschwätz, Schmeichelkram für das Volk, um das deutsche Stimmvieh zu fangen. Dann Witze, dicke plumpe schallende Witze, uralt – da lachte die Menge und kreischte. Er schwenkte die langen Arme in der Luft, schritt hin und her an der Rampe mit großen Schritten. Einen Satz spie er hinaus – laut, dröhnend. Nicht wie die Glockentöne des Pastors klang es – mehr wie eines Hammers rasche Hiebe. Dann eine Pause, breit gedehnt, länger noch wie sein Satz.
Und wieder aus vollen Lungen zehn, zwölf heulende Worte. Und die Pause wieder.
So also gehts, dachte Frank Braun. Er versuchte, sein Manuskript zu lesen, aber kein Wort sah er. Er sah nur – schwarz und wieder schwarz – diese Massen von Menschen, diese erdrückenden endlosen Menschenmassen. Die Bäume dahinten, hohe kahle Bäume – und das Riesenrad der russischen Schaukel.
»Ich kann es nicht,« flüsterte er. Er sah sich um – konnte er nicht aufstehn, still verschwinden – sich verstecken hinter die Sangesbrüder?
Aber der Redakteur hielt seinen Rock.
Wieder dröhnte die Hammerstimme, wieder – und noch einmal. Schlug ein Klatschen und Lachen mit mächtigen Hieben aus der schwarzen Menschenerde. Schwieg dann – hob sich wieder – dröhnte nieder.
Noch ein Witzwort – breit, fett – älter als alle. Alle kannten es – so lachten sie alle.
Der Amerikaner wischte den Schweiß von der Stirne, schwenkte dann sein Tuch, dankte für den lauten Beifall der Menge.
»Nun sind Sie dran,« rief der Journalist.
Er zitterte. »Nein, nein,« flüsterte er, »sagen Sie dem –«
Da fiel der Hammer, der aus Eisen. Und weithin über den Platz klangen die vollen Glocken des Pastors. Was sagte er? Ein Gast – ein Deutscher aus Deutschland – ein gefeierter – ein sehr berühmter – ein Halbgott – ein –
Von wem sprach er denn? Von ihm, Frank Braun? So mochte man Bismarck vorstellen – Goethe – Beethoven –
»Bravo!« sagte der Journalist. »Das nennt man vorstellen!«
Frank Braun zischte: »Unsinn schwatzt er. Keiner da kennt auch nur meinen Namen, keiner!«
»Natürlich nicht!« lachte der Journalist. »Ihren nicht – und überhaupt keinen! Wozu auch? – Aber gerade darum nimmt ers Maul so voll. Und prachtvoll macht ers.«
Der Pastor trat hin zu ihm, griff seine Hand, zog ihn hoch.
»Und hier ist er, meine deutschen Brüder, hier ist er selbst.«
Da stand er vor der klatschenden Masse, er allein vor vierzigtausend. Er zitterte vor Erregung, glühte hochrot in verletzter Scham. Biß in die Lippen, schluckte und würgte –
Pang, pang, fiel der Eisenhammer – da schwieg die Menge. Still, atemlos – vierzigtausend.
Alle Farbe verließ ihn. Blaß wurde er, bleich und weiß. Stand da, angewurzelt, starr und regungslos. Unfähig, ein Glied nur zu rühren.
»Reden Sie doch!« flüsterte der Redakteur.
Er begriff nicht. Reden sollte er? Er? Was denn?
»Lesen Sie!« scholl es wieder. »Nehmen Sie doch Ihr Manuskript!«
Ja, das war in seiner Hand. Er fühlte es, fest umklammerten es die Finger. Da hob er die Hand, entfaltete es, blickte hinein. Aber instinktiv nur, ohne Bewußtsein fast.
Von der schrecklichen Zeit – stand da etwas. Von der Heimat – von der Kriegsnot. Von Helden – von Tod und Sterben. Und davon – daß man geben solle – geben – geben – für die Brüder da drüben – geben.
Nichts begriff er, nichts. Ein Wort nur bannte sein Auge, ließ es nicht los mehr –
Weinen – stand da – Weinen –
»Fangen Sie an, zum Kuckuck!« flüsterte es.
Er riß den Arm herab, schloß die Augen. Zerknüllte sein Papier – warf es fort, sog die Lungen tief voll von Luft.
Und dann plötzlich schrie er hinaus:
»Reden? – Zu euch reden – die ihr lacht in diesen Tagen? – Weinen solltet ihr, Männer und Frauen, weinen und weinen!«
Etwas trug ihn, etwas hob ihn hoch in die Luft. Etwas riß ihn hinauf auf die Schneeberge, ließ ihn laut hinaussingen in die schwarzen Tale. Von Deutschland sang er und von seinem gewaltigen Ringen, sang von Siegesjubel und von Heldentod. Sang, sang von großem Sterben und der Heimat Not. sang, sang von dem einen gewaltigen Willen, von dem Willen, der Tat ward und reißendes Feuer.
Sang – –
Er fühlte nichts – er sah nichts – wußte nicht einmal, daß er war.
Nur eine Stimme hörte er. Er – er war die Stimme. Nur eine Stimme war er – und nichts sonst.
Nichts. Kein Wort. Kein leises Geräusch.
Das wunderte ihn. Eben noch sprach doch jemand. Sprach – er! Er?
Er zuckte. Heiß war ihm, sehr heiß. Auf Erden war er, stand da auf Brettern. Und gesprochen hatte er – eben noch – irgend etwas.
Das war ganz gewiß.
Dann – von unten her – ein Schluchzen. Und ein Weinen hinten. Was war denn nur?
Sie weinten, weinten. Vierzigtausend weinten. Warum nur?
Er stand wieder, regungslos, unbeweglich, Nur heiß war ihm, zum Sieden heiß.
Nun aber schrien sie. Klatschten. Brüllten.
»Verbeugen!« rief der Redakteur.
Da nickte er ungeschickt. Stand hilflos in all dem Jubel.
Aber die Herren kamen heran, preßten ihm die Hand. Die rechte hielt der Pastor und der Redakteur seine linke.
Der sagte: »Wie Raketen war es – wie himmelhohe Raketen!«
Und der Pastor sprach: »Das war sehr schön, was Sie sagten, von den Tränen, die sie weinen sollten! Die zu Perlen würden – zu Perlen und Schmuck und Gold und Geld! Und die sie geben sollten – heute noch – für der Heimat Not.«
Er murmelte: »Sagte ich das?«
Der Pastor schwang seinen Hammer. Nun verstand er gut, was der sagte. Alle sollten vorbeimarschieren an dem Musiktempel. Sollten ihre Gabe bringen für Deutschland – was immer es sei.
Dann gab ihm einer einen Mantel.
»Ziehen Sie ihn an,« rief der Herr, »Sie sind ganz naß.«
Er befühlte sich – o, naß war er. Nicht Hemd nur und Unterzeug – auch Weste, Jacke und Hose.
»Zum Auswringen!« lachte der Journalist. »Besser als ein Dampfbad! Vier Pfund wenigstens!«
Er zog den Mantel an, dankte.
Einer brachte ein mächtiges Tischtuch; vier Herren nahmen je einen Zipfel davon. Sie stiegen die Estrade hinunter, stellten sich auf – vorne der Pastor und Frank Braun neben ihm.
Die Musik setzte ein, und der Männerchor sang. Hundertundzwanzig Männerstimmen.
Dann kamen sie heran – die Tausende.
»Darf ich gehn?« fragte er.
»Nein, nein!« rief der Redakteur. »Sie sind sehr notwendig hier: jetzt kommt die Hauptsache.«
Die Menschen warfen Geld in das Tuch – und viele Scheine. Ringe und Broschen und Uhren. Volle Börsen gaben manche – zogen Nadeln aus den Krawatten, nahmen die Ohrringe ab. Er sah ein kleines Mädchen, das seinen Ball hineinwarf – sah ein Dienstmädchen, das eine goldne Schnalle vom Kleide trennte –
Und ihm, ihm gaben sie die Hand. Zehn, hundert – tausend –
Erst gab er den Händedruck zurück, preßte wieder. Aber die Hand begann zu schmerzen.
»Nicht drücken,« riet ihm der Journalist. »Nur die Finger hinhalten.«
Das Tuch war voll – man brachte ein neues. Wieder fielen Geldstücke – und Uhren – und Ringe –
Und wieder drückte er Hände. Schwarze Fäuste und rote, schwielige und sehr schmutzige. Auch – selten einmal – eine reine und weiche –
Die Hand schwoll ihm auf – aber er hielt sie hin.
Er dachte: ›Hättest du sonst je einem von allen die Hand gereicht? Einem nur?‹
Dann zwang er sich. Da drüben liegen sie im Schützengraben. – Du – du – brauchst nur die Hand zu geben.
Deine Hand – deutschen Händen. Deutsch – wie deine Hand.
Aber es half nichts. Es ekelte ihn – dennoch!
Warum tust du es denn? dachte er. Was gehts dich an?
Kling, kling – fiel es in das Tuch – und wieder: kling!
»Das ist Ihr Geld,« lachte der Pastor. »Sie allein machten es! Es werden wohl hunderttausend Taler werden – nur das Bargeld gerechnet!«
Er freute sich. O ja! Aber er dachte doch: ›Was gehts mich an?‹
Nun gab er die linke Hand – bis sie schmerzte. Aufschwoll wie die rechte. Wechselte dann – rechts – links –
Und immer mehr kamen – immer noch mehr.
Da schloß er die Augen.
* * *
Was sie nur wollte, tat er, willenlos. Er wohnte nicht bei Frau van Neß – aber er war doch immer da. Selten nur – einmal am Tage kaum – ging er nach Hause, sich umzuziehn oder etwas zu holen. Tagsüber lag er herum auf ihren Diwans und Sesseln, las ein wenig, plauderte mit ihr. Oder saß still versunken da – blickte vor sich hin. Aber er träumte nicht.
Ihr Kind war er – tagsüber. Sie pflegte ihn, dokterte so herum.
Nachts war er ihr Geliebter. Lag bei ihr – ließ sich küssen und küßte sie. Gesund sah er aus, stark und blühend. Er lachte, wenn er neben ihr stand vor dem großen Spiegel. Sie – weiß, weiß und kaum ein paar Flecken darin: oben das Rothaar – dann die roten Knospen ihrer Kinderbrüste. Und die aufgelegten Stellen: Hennah auf den Nägeln – und ein klein wenig Rot auf den Lippen – an den Nüstern und Ohrläppchen. Und er – tiefbraun der ganze Leib – noch hielt die Schminke der Tropensonne.
Er hob sie auf – zum Zerbrechen war sie. Er – war stark.
Und doch fühlte er: unter der braunen Haut bist du bleicher als sie. Viel, viel bleicher.
Und: sie ist stärker als du – sie.
Und dann, zuweilen: du bist die Frau. Sie – sie ist dein Mann. Sie.
Sie beobachtete ihn, unausgesetzt, tagsüber und nachts. Selbst in ihren Umarmungen fühlte er, daß ihn etwas umlauerte.
»Kannst du nicht vergessen?« sprach er. »Jetzt?«
Sie fragte: »Was?«
»Was?« gab er zurück. »Dich. Mich. Alles!«
Sie sah ihn voll an, küßte ihn. »O ja,« antwortete sie. »Wenn du wieder gesund bist, Frank Braun.«
Sie ließ Ärzte kommen, einen um den andern. Ließ ihn untersuchen, viermal, fünfmal. Herz und Lunge – und Nieren – und alles.
Die sagten, daß er gesund sei. Stark, gesund, kräftig. Nichts fehle ihm, gar nichts. Diese Müdigkeit – diese Apathie – eine kleine Nervenschwäche nur –
Tüchtig essen solle er. Und nicht so viele Zigaretten rauchen.
Aber Lotte van Neß schüttelte den Kopf.
»Ich werde es finden,« bestand sie.
* * *
In dieser Nacht lief er durch die Straßen.
Er war aufgewacht, in dem breiten Bette, neben ihr. Aber anders als sonst, nicht müde – frisch, o so frisch! Nur – eine Angst hatte er – eine große Angst. Und er wußte es gleich: es war eine Furcht vor der Frau da.
Er saß auf dem Bettrand, einen Augenblick nur. Griff nach Strümpfen und Hemd, suchte die Hosen. Kleidete sich an. Das war gewiß, daß er fortmußte.
Die Lippen klebten ihm – er wischte sie ab am Hemdärmel – da sah er ein wenig Blut. Aus der Kehle – aus der Lunge? So war er doch krank?
Aber so jung fühlte er sich, gerade jetzt.
Er trat vor den Spiegel, zog Weste an und Jacke. Hinten vom Bett her kam ein Weinen, ein Schluchzen fast. Aber so leise, so sehr leise. Sie schlief gewiß, weinte im Schlaf.
Er ging nicht zurück, küßte sie nicht. Eilte aus dem Zimmer, fuhr hinab im Aufzug, öffnete die Haustüre.
Er atmete, atmete. Er wußte nichts, aber er empfand: er war krank gewesen. Und war nun – ganz plötzlich – gesund. Und er fühlte: das alles hängt zusammen mit dieser Frau – mit Lotte van Neß.
Sie hielt ihn fest, nur sie. Und schlimmer ward es und schlimmer, seit er mit ihr war. Wie ein Verwelken war es.
Ihre Puppe war er, ihr Spielzeug.
Dann fiel ihm was ein. Lotte Lewi, ein Kind damals, das doch mit fünfzehn Jahren die suchenden Nerven hatte und die wilden Sehnsüchte nach allen verschleierten Sünden, wie nur eine kluge, schöne – o so erfahrene Frau der Welt. Und dennoch ein Kind war – unschuldig und blank. Und sie nun, Lotte van Neß – dreißig Jahre – so wie einst sehnsüchtig und verlangend in allen Nerventräumen – und dennoch: Kinderbrüste und Kinderseele.
Sie fraß ihn auf, sie saugte ihn aus – ja, das tat sie. Aber sie tat es, wie ein liebes kleines Mädchen, das froh war und glücklich, wenn es sein Zuckerl lutscht.
Er war das Zuckerl.
Das gefiel ihm, er lachte. Ein Zuckerl war er schon, freilich, süß und ein wenig sauer und bitter zugleich. Langweilig nicht, fad nicht – war so ein rechtes Fressen für eine verwöhnte Kinderzunge. Aber er war mehr noch, war ein Wunderzuckerl, so ein großes, dickes, wie er es sich immer gewünscht hatte als kleiner Junge. Man lutscht und schleckt, bis es kleiner wird und ganz klein – und dann, plötzlich, ists wieder groß und dick wie zuvor. So eins war er – fast aus wars mit ihm, fast vergangen war er in den Küssen dieser Frau. Und war nun doch wieder dick und groß und war hinausgesprungen aus Lottekinds Mäulchen. Atmete alle fröhliche Freiheit. Lief durch die Nacht über Broadway.
Schmutz, viel Schmutz. Überall Papierfetzen, die im Winde tanzten. Er ging über den Fahrweg – da stieß sein Fuß an einen toten Hund. O ja, er war in New York, und in keiner Stadt der Welt liegt das Aas so lange auf den Straßen. Oben waren Sterne vielleicht – wer sollte es wissen? Denn so hoch reckt man den Kopf nicht, um nach oben zu sehn, hinüber über die zwanzig, vierzig, sechzig Stockwerke an beiden Seiten. Steinmauern, häßlich und schmutzig – da krabbelt man unten hin. Über den Boden – den sie Pflaster nennen in dieser Stadt. Steine, Asphalt – Holz, viel Holz. Eisen und Glas. Alles durcheinander, sinnlos, zwecklos, wie es gerade der Augenblick verlangt. Nichts glatt, mächtige Beulen überall, Zementbeulen über irgendein Zerbrochenes, wie Eitergeschwüre. Und Risse dazu und Löcher – wie die eines Leprakranken ist die Haut New Yorks.
Leer die Schmutzgassen. Nur ein Betrunkener, schwankend, hier und da – und dann, pfeifend, ein irischer Schutzmann. Oder, an den Ecken, ein Bettler. Keiner von Beruf, wie in Andalusien, keiner, der davon lebt und glücklich ist. Bettler nur, die nichts zu sagen brauchen. Frierend, bleich, mit blauen Lippen und verglasten Augen. Die schreien: ›Ich suche Arbeit seit Monden. Ich finde nichts. Ich hungre.‹ O ja, zehntausend verhungern auf der zerfressenen Leprahaut dieser Stadt. Oder erfrieren auch – da ists gleich, wie das Totenzeugnis lautet. Beides ist richtig – so oder so – und tot ist er.
Er war kein Bettler. Er gab, gab, sein ganzes Leben hindurch. Gab allen, die kamen, allen und immer – sein bißchen Geld – und sein Herzblut und seine Seele. Aber ihm, freilich, wer gab ihm?
Was tats – blieb er nicht reich? Mochten sie nehmen, mochten sie doch. Fressen und saugen! Heute fühlte ers gut: ein Zauberzuckerl war er und nicht kleinzuschlecken!
* * *
Früh genug stand er auf. Badete, zog den Kimono an. Schellte um seinen Tee.
Dann griff er den Fernsprecher, klingelte die Frau an »Ich bin gesund, Lotte,« rief er, »ich bin gesund.«
Sie antwortete: »Ich weiß es.«
Das ärgerte ihn. Was konnte sie davon wissen! »Du!? Ach wie klug du doch bist. So sag doch, was du weißt!«
Er hörte: »Diese Nacht –«
Aber nichts mehr. Da rief er: »Diese Nacht? Ich lief fort – ja! Dir – fort! Daraus schließt du –?«
Langsam kam es, zögernd: »Nein. Daraus nicht. Ich wußte es – vorher schon. – Ach nein!«
Da drängte er: »Geh, Lotte, sags!«
»Nein!« gab sie zurück. »Nein! Was gehts dich an? Verzeih – das lernte ich von dir.«
Und er wieder: »Gut, gut! Aber du mußt es doch sagen. Komm her, Lotte, hol mich ab in deinem Auto. Wir fahren den Strom hinauf, hinaus aufs Land.«
Da schluchzte es. »Ich kann nicht. Ich – ich bin krank. Ich will auch nicht, daß du zu mir kommst – heute – diese Woche. – Wart, bis ich rufe.«
»Lotte,« rief er, »Lotte –«
Keine Antwort kam.
Der alte Diener brachte den Tee und die Morgenblätter. Stumm, gefühllos, idiotisch.
›Frag doch, wo ich war?‹ dachte Frank Braun, ›Frag doch, ob ich nun wieder hier schlafe?‹ Aber der alte Diener fragte nichts. Er ging schweigend durch die weiten Zimmer, nahm sein Staubtuch auf.
»Mach, daß du raus kommst,« fuhr ihn Frank Braun an. Da schlich er fort.
Eine Pampelmuse. Tee und Brot. Die Zeitungen und die erste Zigarette.
Dann klopfte es. Der Diener meldete den Redakteur.
»Laß ihn eintreten,« befahl er. Er war froh, daß jemand kam; nun konnte er sprechen.
»Doktor,« sagte der Tewes, »nun ist alles in Ordnung. Hier ist der Reiseplan – in drei Tagen sollen Sie fahren. Wir fangen oben an, in Neu-England – Boston zuerst. Dann den Mittelwesten, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Chicago. Achtundzwanzig Städte im ganzen – das ist genug für die erste Rundfahrt. Ich fahre voraus, heute noch. Ich glaube, daß alles gut vorbereitet ist – wir hatten schon Angst, daß Sie uns dennoch im Stiche ließen.«
»Im Stiche ließen?« lachte er. »Habe ich denn irgendwas versprochen?«
Der Redakteur sagte: »Sie nicht, Doktor!«
»Wer denn?« fragte er.
Ganz geschäftsmäßig klang es: »Frau van Neß.«
Da fuhr er auf: »Frau van Neß? Sie hat Ihrem Ausschuß versprochen, daß ich fahren würde? Vermutlich hat sie Ihnen dann auch angedeutet, daß ich nicht so ganz zuverlässig wäre – und daß ich Sie vielleicht doch aufsitzen ließe?«
»Ja,« nickte Tewes. »Wir hörten, daß Sie krank seien?«
»Von wem, bitte?« fragte er.
»Von Frau van Neß,« antwortete der Journalist.
Frank Braun trommelte mit dem Finger auf dem Tisch. »Frau van Neß!« brummte er. »Und die Dame hat Ihnen vermutlich auch gesagt, daß ich nun wieder gesund sei?«
Der Tewes machte ihm nach. »Ja. Die Dame hat uns das gesagt. Die Frau – Frau van Neß – hat mich soeben angerufen – hat mir gesagt, daß alles in Ordnung sei. Daß Sie fahren würden.«
Er stand auf, trat dicht vor dem Redakteur. »Bitte!« rief er. »Ob ich für Ihren Arbeitsausschuß Reden halte – ob ich fahre oder nicht – was geht das Frau van Neß an? Und wieder: wenn ich und die Dame – ja was zum Kuckuck geht das Sie an und Ihr Komitee?«
Der Redakteur lachte. »Gehn Sie, Doktor, seien Sie kein Kindskopf! Seit Kriegsausbruch haben wir hier wohl dreißig Arbeitsausschüsse – für alle möglichen patriotischen Zwecke – und wenn er ein Jahr dauert, werdens dreihundert sein. Und die Alliierten – glauben Sie mir – haben zehnmal soviel. Bilden Sie sich ein, daß alle die Komitees umsonst arbeiten könnten? Ein Rückgrat brauchts – backing nennt mans hier: Geld! Unser Rückgrat – oder gut dreiviertel davon – ist Frau van Neß. Und wenn unser Interesse an Ihrer Redetätigkeit im Lande sich zufällig mit dem Interesse, das die Dame persönlich an Ihnen nimmt, deckt – so kanns uns nur recht sein: um so runder sind ihre Schecks. Begreifen Sie nun?«
Begreifen? Gewiß – die Herren des Ausschusses verstand er gut. Er wußte, was Agitation, was Propaganda kosteten in diesem Lande, wußte sehr wohl, daß alle die Vereine und Komitees immer herumliefen mit dem Klingelbeutel: Geld – Geld! Manche Tausende mußte man schon hinauswerfen, um die Millionen einzunehmen – die Traummillionen für die Heimat drüben.
Aber sie? Lotte Lewi? Was sollte sie dabei? Ein bißchen Geld geben, Schecks schreiben – in Gottesnamen ja! Sehr reich war sie ja. Und wenn sie Tausende gab, wie er Centstücke – so war es doch noch kaum der Rede wert.
Dies aber war ein anderes. Sie hatte ihn den Herren vorgeschlagen, sie hatte den Redakteur zu ihm geschickt. Und das Komitee – aber noch mehr, sie – hatte ihn nach Baltimore gesandt.
Um ihn – auszuprobieren. Ja, das war es.
Und – mit ihrem Gelde – schickte ihn nun der Ausschuß auf die Redereise. Oder auch: sie schickte ihn – durch den Ausschuß. Nicht daß man ihn zahlte – o nein – aber man schuf ihm doch die Möglichkeit zu sprechen und – zwang ihn dazu!
Warum denn nur? Was hatte sie davon – Lotte Lewi?
Nichts begriff er. Er strich die Haare zurück, zog die Lippen hoch.
»Ich fahre – doch!« sagte er.
Der Tewes pfiff. »Doch!? Was: doch? – Natürlich fahren Sie!«
* * *
Er sprach in Boston, sprach in Buffalo, Rochester und Albany. Er sprach in Columbus, in Milwaukee. Jeden Tag redete er und manchmal zweimal am Tage. Redete in Sälen, in Theatern, in Feuerwehrhallen – zweimal auch herab von der Kanzel. Das Publikum drängte sich, nicht weil es eine Ahnung hatte, wer er war – sondern weil die Vorreklame gut war, die der Redakteur machte.
Viele Hände schüttelte er und empfing Reporter, jeden Tag neue. Erzählte immer wieder dieselben Sachen – morgens den Reportern, abends dem großen Publikum und hernach den einzelnen Leuten. Stieg in den Zug, zog sich aus, schlief: kam in stets das gleiche Hotelzimmer überall, badete in immer derselben Badewanne, fand auf jedem Nachttisch die gleiche schwarze Bibel. Jeden Morgen brachte man ihm Zeitungen – stets war sein Bild darin, immer dieselben Phrasen schwatzten von ihm. Wie eine Maschine ging das alles.
Dann aber, irgendwo, setzte ein Rädchen aus. Er fühlte es kaum, aber der Redakteur merkte es, der ihm nicht von der Seite wich. Er führte ihn gleich weg von der Bühne, sowie nur der Applaus zu Ende war, ließ ihn nicht mehr sprechen mit den Leuten. Er empfing nun auch die Zeitungsleute selber, ließ ihm Sekt bringen jeden Abend vor dem Auftreten.
»Was ist denn?« fragte Frank Braun.
»Sie müssen sich schonen,« sagte Tewes. »Sie sind wieder müde. Sie sind krank. Ich habe die Verantwortung.«
»Vor wem?« lachte er. »Vor Ihrem Ausschuß? Der fragt den Kuckuck darnach, ob ich ein wenig müde bin.«
Da sagte der Journalist: »Sicher nicht! Aber ich habe einen Extrajob. Zwanzig Dollar auf den Tag.«
»Einen Extrajob?« fragte er. »Sie? Von wem denn – und was?«
»Es ist durchaus in Ordnung,« sagte Tewes. »Ich soll auf Sie aufpassen – und Frau van Neß zahlt es.«
Wieder?! Er wollte auffahren, aber der Redakteur kam ihm zuvor. »Verschieben Sie es!« sagte er ruhig. »Eben hats geklopft – der Arzt ist da!«
Er schrie: »Schmeißen Sie ihn hinaus! Ich will keinen Arzt sehn, verstehn Sie!«
Der andere zuckte die Achseln. »Schon gut, ich werde ihn fortschicken. Ich habe meine Pflicht getan.«
An diesem Abend sprach er schlecht. Er sagte genau dasselbe, wie an allen Tagen, hob seine Stimme, senkte sie, machte eine Pause, genau wie immer. Aber irgend etwas fehlte, das, was die Menschen gefangen nahm. Es war ihm, als ob eine weite Wüste liege zwischen ihm und den Leuten da, als ob die Rampe zur starken Mauer würde, die sich vor ihn dränge. Er kam nicht hinüber heute. Er stand da, sprach, einsam, gleichgültig – und so müde.
»Kein Blut mehr!« sagte der Redakteur. Noch in der Nacht telegraphierte er, sagte die zwei, drei übrigen Abende ab. »Aber morgen, morgen muß es noch einmal gehn. Reißen Sie sich zusammen, Doktor.«
Er brachte ihn zum Zuge, bereitete ihm das Bett. »Schlafen Sie sich aus, recht fest!«
Frank Braun schlief, fest genug und ohne sich zu regen in den hellen Tag hinein; wachte erst auf dicht vor Philadelphia. Müder als je, dennoch.
Diesmal war es eine Debatte, in dem mächtigen Theater der Musikakademie. Das Haus war voll zum letzten Platze, weit auf der Straße standen die Menschen. Tewes führte ihn den Bühnenaufgang hinauf, geleitete ihn in seine Garderobe. Er drückte ihm einen Zettel in die Hand. »Da, lesen Sie! Damit Sie wissen, was heute los ist! Sie scheinen es ganz vergessen zu haben!«
Frank Braun las. Er wußte genau, was da stand, erinnerte sich gut, das alles im Manuskript gelesen zu haben, und dann wieder in Korrekturbogen. Sein Bild war da und sein Name, dazu das übliche Geschrei über seine angebliche Berühmtheit. Dann auf der andern Seite das Bild einer schönen Frau: Miß Maud Livingstone stand darunter. Und daß sie die berühmteste Schauspielerin der Welt sei, die intime Freundin und beste Interpretin G. Bernard Shaws, daß sie –
O ja, er wußte es. Sie würde für England sprechen. Er für Deutschland. Sie zuerst – dann er – und noch einmal sie. Ein Turnier war es, ein Hahnenkampf –
Der Journalist nahm eine Sektflasche aus dem Kübel, schenkte ihm ein. »Trinken Sie, trinken Sie! Überwinden Sie Ihre Apathie! Nur heute noch.«
Er goß den Sekt herunter wie Wasser, aber er blieb müde und kalt, blickte völlig gleichgültig auf den zappelnden Mann, der da vor ihm stand. Er hörte jedes Wort, das der Journalist sagte, aber es war ihm, als ob er gar nicht zu ihm spräche.
»Fünftausend sind da! Die beste Gesellschaft der Quäkerstadt! Pro-englisch dreiviertel! – Trinken Sie doch! – Und dann: Ihr Gegner heute ist eine Frau – eine Dame – bedenken Sie! Das ist nicht wie gegen Chesterton in Cleveland oder den Hillis in Cincinnati! Eine Frau steht gegen Sie – in Amerika! Sie dürfen mich nicht blamieren heute. – Jedermann hat mir abgeraten, die Herausforderung anzunehmen für Sie – und ich habs doch getan. – Trinken Sie! – So fest habe ich auf Sie vertraut. Sie müssen siegen heute – Doktor – hören Sie? Selbst über eine Frau! Noch ein Glas! Neun Chancen von zehn sind gegen Sie – es muß doch gehn, verdammt noch mal!«
Frank Braun nickte, gelangweilt stand er auf, zupfte seine Krawatte zurecht. Dann sagte er ruhig: »Vielleicht gehts – vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht.«
»Um Gottes willen –« begann der Redakteur.
Aber er unterbrach ihn: »Lassen Sie nur. Ich weiß es jetzt gut: etwas in mir spricht – nicht ich. Und wenn das nicht mag –«
»Was nicht mag?« rief der andere. »Was? Was spricht in Ihnen?«
Da lachte er: »Was –? Ja, das weiß ich so wenig wie Sie, lieber Herr.«
Er ging hinaus, hinter die Kulissen. Da stand mit einem älteren Herrn eine Dame im Abendkleide, sehr groß, sehr stark, mit mächtig ausladenden Hüften und Brüsten.
»Ist das die Livingstone?« fragte er.
Der Redakteur schüttelte den Kopf. »Die – nein! – Aber das ist ja die Farstin! Kennen Sie sie nicht?«
O ja, er kannte sie, Emaldine Farstin, die beste Sängerin zweier Welten. Kannte sie von der Dresdener Oper, von Berlin, von Neuyork.
Tewes stellte ihn vor, die Diva reichte ihm die Hand.
»Ich habe morgen ein Konzert hier,« sagte sie, »aber ich bin einen Tag früher gekommen, um Ihre Debatte zu hören. Sie haben Mut, Doktor, – gegen eine Dame zu sprechen in diesem Lande.«
Sie sah ihn an mit großen schwarzen Augen. ›Warum brennen sie nicht?‹ dachte er.
»Hals- und Beinbruch!« wünschte ihm die starke Frau. »Ich halte Ihnen die Daumen.«
Die Glocke klang schrill und durchdringend. »Kommen Sie,« drängte der Redakteur. »Auf die Bühne! Gehn Sie nicht mit, Gnädigste?«
Sie lachte: »Kein Platz mehr – so voll ists kaum, wenn ich singe! Wir sind froh, ein paar Stühle zu haben, hier in der Kulisse.«
Der Journalist zog ihn mit auf die riesige Bühne; noch war der Vorhang nicht herauf. Im Halbkreise saßen hinten zwölf Reihen Menschen; vorne, dicht an der Rampe, standen drei Tischchen und drei Stühle.
»Der Herr da ist der Unparteiische,« sagte Tewes, »die beste Karte der Stadt. Ein Schotte, Oberrichter – kost' uns hundert Dollars!«
Er stellte ihn vor. Dann, von der andern Seite, kam die Schauspielerin mit ihrem Impresario – man begrüßte sich und gab sich die Hände.
Der Schotte nahm den Zettel, las laut:
»Also: ›Wird der Sieg der Zentralmächte oder der der Alliierten – der Welt – und ganz besonders Amerika – Fortschritt bringen?‹«
Die Engländerin lachte: »Das ist sicher: nichts auf Erden wird je diesem Affenlande Fortschritte bringen!«
Frank Braun blickte auf. Sie ist gescheit, dachte er. Er schaute sie an, suchend, prüfend, so wie ihr kritischer Blick ihn maß.
Sehr elegant war sie in ihrem lavendelfarbenen Kleid. Graue Augen, scharf und klug. Und ebenmäßig, edel das Gesicht. Ungeschminkt. Und keine Perücke. Welliges Blondhaar, einfach zurückgekämmt und ein wenig ergraut an den Schläfen. Keine Komödiantin – eine große Frau.
»Raffiniert ist sie!« flüsterte Tewes. »Die versteht ihr Publikum!«
Noch ein Zeichen; dann hob sich der Vorhang.
Der schottische Richter stellte sie dem Publikum vor, und mit gutem Witz. Nichts wußte er von den beiden, als was er eben auf dem Zettel gelesen hatte – aber wußte das Publikum mehr? Er log und schwatzte – und die Leute klatschten und amüsierten sich. Sprach von dem mörderischen Europa, wo man sich gegenseitig totschlug, und von diesem herrlich zivilisierten Lande, wo die Kämpfer mit Geisteswaffen einander gegenüberständen. Erzählte einen langen Roman von der Berühmtheit der beiden Kämpen – und von der seinen – schloß natürlich mit dem ›Star-Spangled-Banner‹: da war die Stimmung da.
Und gab das Wort der Frau.
Bescheiden sprach sie und klug. Gleich im Anfang ein paar volltönende Sätze über dies Wunderland Amerika, dann schnell einen raschen Witz. Sie zeigte ihre prächtigen Zähne, betonte jedes ihrer Worte, redete einfach und gewinnend.
Frank Braun fühlte: sie kennt die Menge. Kennt sie und fängt sie und hält sie. Fest, sehr fest – in dieser kleinen nervösen Hand.
Er würde die Masse heute nicht halten – er nicht. Er schaute hinab: atemlos lauschten sie; jedes Auge hing an dieser geschmeidigen Frau. Keiner blickte hin zu ihm.
Da stand er auf, ganz ruhig und leise. War mit zwei Schritten in der ersten Kulisse. Er lächelte – so gewiß war er, daß kaum einer es bemerkt hatte.
Einer doch – Tewes.
Der kam ihm nach im Augenblick. »Wo wollen Sie hin?« fragte er. »Weg? Fort? Das ist –«
Frank Braun sagte: »Feige. Ja. Meinetwegen.«
Der andere faßte ihn am Rock, redete auf ihn ein. Bitten und Schelten – wie Hagelschlag fiel es. Feigheit – Verrat – schlimmer als Desertion – sich schämen solle er! Erbärmliche Flucht –
Er hörte zu, geduldig genug. Antwortete nichts.
Immer aufgeregter wurde der Redakteur. Ließ ihn doch los am Ende, als er sah, daß das alles vergebens war.
Sagte: »Gehn Sie nur, wenn Sie wollen! Und für mich ists schließlich auch besser!«
Frank Braun fragte: »Warum für Sie?«
Da zog Tewes ein Telegramm aus der Tasche, gab es ihm:
»Da, lesen Sie! Das ist die Antwort auf meinen Bericht von heute morgen.« – Er las: »Auch heute absagen. Ihn sofort zurückbringen. Van Neß.«
Der Journalist sagte: »Ich habe doch nicht abgesagt – um der Sache willen. Das hätte mich meinen Job gekostet – und ich kann die Groschen wahrhaftig gebrauchen. Darum ists besser für mich, wenn Sie nicht reden.«
Frank Braun zerknüllte das Papier. »Sie soll ihren Willen nicht haben!« zischte er. »Ich rede.« Dann zu Tewes: »Gehn Sie nur – ich komme auf die Bühne zur rechten Zeit.«
Er drehte ihm den Rücken, ging mit langen Schritten um die Kulissen herum. Trat in seine Garderobe, trank den Rest der Sektflasche aus, ging wieder auf die Bühne. Lief auf und ab.
Er quälte sich und zerquälte sich. Er krampfte die Finger und biß die Zunge. Strich mit beiden Händen über das Gesicht. »Es muß – es muß –« flüsterte er.
Aber er zwang es nicht. Leer blieb er, leer.
Wie ein Samum war es – und nirgend ein grünes Hälmchen.
Dann fieberte er, zitterte, fühlte die Tränen in seinen Augen, fühlte, wie die Knie ihm brechen wollten –
Taumelte, hielt sich an der Kulisse fest.
Ein Lärm schreckte ihn auf – drinnen klatschten sie und jubelten. Verzweifelt, hoffnungslos starrte er vor sich hin – wie einer, der gehängt werden soll.
Etwas zog ihn – da schwankte er vorwärts einen Schritt. Blickte auf – traf das dunkle Auge der Diva.
»Was ist Ihnen?« fragte sie.
Er winselte: »Ich weiß nicht.« Dann aber – plötzlich, ohne Übergang: »Darf ich Sie küssen?«
Er wartete nicht auf ihre Antwort. Er griff sie, zog sie an sich, wild, tierisch. Er riß ihre Arme herab, preßte seine Brust an ihre mächtigen Brüste. Faßte ihren Kopf, küßte sie.
Er fühlte wohl, wie sich ihre Lippen öffneten. Er schloß die Augen, trank, trank diesen rasenden Kuß –
Lärmen hinten und Klatschen und Schreien –
Da riß er sich los; lief wieder herum um die Bühne, am Hintergrund vorbei. Er hörte die Schelle des Unparteiischen, fühlte das plötzliche Schweigen der Menge, hörte dann des Richters Sätze, der ihm das Wort gab. Nun war er vorne, nun trat er auf die Bühne, dicht an seinen Tisch.
Aber die Leute wollten ihn nicht. Ein paar begannen – und alles fiel ein. Klatschte von neuem, und immer wieder, der Frau zu.
Er stand da, bebend, nervös, lächelnd, strich sich das Haar zurück, wartete –
Wieder erhob sich der Unparteiische, bat um Stille. Wieder schwieg die Menge, aber sie zischte und schrie, so wie er den Mund öffnete. Klatschte von neuem für die Frau.
Er begriff es gut: sie wollten ihn nicht zu Worte kommen lassen. Aber er lachte.
Dann winkte die Schauspielerin mit der Hand, da schwiegen sie. Und sie bat – für ihn. Das sei nicht gerecht – man solle fair sein – in diesem Lande der Freiheit und Gerechtigkeit – solle auch ihn reden lassen.
Da klatschten sie wieder.
Wie gescheit sie ist, dachte er. Und wie sicher ihres Sieges. Sicher wie der Major auf der ›Ryndam‹!
Nun schwiegen sie. Nun konnte er beginnen. Er sprach leicht, leichter als je. Er machte keinen guten Witz und sagte kein schönes Wort über dies herrliche Amerika. Er sprach gewandt und flüssig, vollbewußt jeden Wortes und jeder Wirkung. Sprach so gut wie die Dame auch –
Und sicherer noch –
Denn er fühlte, daß es kommen mußte. Jetzt vielleicht – oder im nächsten Satze – oder im übernächsten. Einmal mußte es kommen –
Das, was sie nicht hatte. Das, was er verloren hatte heute und nun wiederfand in dem Kuß der großen Frau. Das, was die vielköpfige Bestie da unten zahm machte und artig, wie ein Kätzchen, das hübsch aus der Hand frißt und die Peitsche leckt –
Das, was ihm die Macht gab, seine Gedanken einzuhämmern in des Tieres Hirn und seines Augenblicks Glauben in des Tieres zottige Brust.
Und nun griff er ein Wort, zwei oder drei – einen Satz. Geschmeidig, geschliffen und spitz – schlug ihn hinab wie einen Reitgertenhieb. Noch einmal und wieder – da flogen weit auf die eisernen Tore vor dem schwanken Schlage seiner Zaubergerte.
Und das Tier der fünftausend Köpfe hatte doch eine große Seele nur. Und die Seele war gewaltig und weit wie ein Dom – da trat er hinein durch das Eisentor. Berauscht von seiner Reitgerte Pfiff – berauscht von der Brandfackel, die seine Linke trug. Die warf er hinein in die Tiefen des Domes: da flammte es auf. Nun sah er nichts mehr: Rot nur trank sein Auge. Blut, dachte er. Blut. Durch das Flammenmeer schritt er – laut schreiend. Lachend. Wie ein Prophet –
Das blieb ihm, das nur. Seine Worte hörte er nicht, und nicht den Sturm der Menge, als er schwieg. Hörte nicht die Sätze des Richters, noch das ängstliche Schlußwort der englischen Frau. Noch das Toben und Klatschen und Schreien am Ende – das ihm nur galt – ihm und seiner Sache. Sah die Flammen nur und all das Blut –
* * *
In der vierten Kulisse stand er mit der starken Diva. »Wohnen Sie auch im ›Ritz‹?« fragte sie. Er nickte.
»So speisen Sie zu Nacht mit mir,« fuhr sie fort. »Und –«
Er nahm ihre Hand, küßte sie. »Ja,« sagte er, »das will ich tun.« Er hielt ihren Blick – und jetzt brannte der warm und gut. Weich auch und heimlich zugleich, wie ein Kaminfeuer.
Er begehrte sie rasch, wie er fühlte, daß sie ihn wollte – und das sprach sein Auge. Das ihre antwortete: heute nacht.
Sie nahm seinen Arm, preßte ihn.
Dann lachte sie: »Ich trinke ein Glas Bordeaux vor jedem Auftreten. Mancher muß Chartreuse haben, mancher Bier oder sonst was. Aber Sie –?! Dann wünsche ich Ihnen nur, daß Sie immer ein so gutmütiges Schaf finden wie mich!«
Der alte Herr lachte, und der Redakteur und die andern, die herumstanden. Tewes scherzte: »Sekt hat er bekommen – eine ganze Flasche voll! Das wirkt nicht mehr bei ihm.«
Er verbeugte sich: »Schöne Frau – ist Ihr Kuß nicht besser als Champagnerwein?«
Sie zog die Lippen hoch. »Lassen Sie das doch – das steht Ihnen nicht.« Sie zog ihn herein in die Kulisse, sagte leise: »Meinst du, ich weiß nicht, was du wolltest? Da!« Sie hielt ihm ihr Taschentuch hin – das war rot von Blutflecken.
Er starrte auf das Tuch. Das – das hatte er gewollt?
Sie flüsterte: »Meine Lippe hast du zerbissen! Ich werde dirs heimzahlen – heute nacht!«