
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bei genauerer Untersuchung der von Cuvier unter dem Namen »Weichflosser« vereinigten Fische fand Johannes Müller, daß eine namhafte Anzahl derselben sich durch einen von der Schwimmblase ausgehenden Luftgang von den übrigen unterscheidet. Auf dieses Merkmal gründet er die Ordnung, mit der wir uns nunmehr zu beschäftigen haben werden, und auf dieses Merkmal bezieht sich auch der wissenschaftliche Name, den ich nicht habe übersetzen wollen, weil es mir nicht notwendig erscheint, daß der deutsche und der wissenschaftliche Name wirklich ein und dasselbe bedeuten. Edelfische nenne ich die »Mund- oder Schwimmbläser«, weil zu ihnen wirklich die edelsten aller Fische und weitaus der größte Teil unserer Flußfische gehören. Anderweitige Kennzeichen liegen in den weichen Flossen, der Stellung der Bauchflossen, falls sie vorhanden, hinter den Brustflossen und der Bekleidung, die bei allen schuppentragenden Arten aus Rundschuppen besteht. Die Gestalt rechtfertigt den von mir gewählten deutschen Namen in jeder Hinsicht. Die Edelfische sind regel- und ebenmäßig gebaut, ihr Leib ist gestreckt, walzig oder zusammengedrückt; ihr Kopf und die Flossen stehen im rechten Verhältnis zur Körpergröße. Beschuppung und Färbung zeichnen sich zwar nicht durch besonders auffallende Gestaltung und Pracht, aber doch durch Zierlichkeit und Gefälligkeit aus.

Edelfische:
Unter den Edelfischen stellen wir die Welse ( Siluridae) obenan. Ein massiger, ungeschlachter, niemals mit Schuppen, sondern entweder mit nackter Haut oder mit Knochenschildern bekleideter Leib, der große Kopf mit weitem Maule und mannigfach abwechselnden Bartfäden sind Merkmale dieser Familie.
Die Welse bewohnen in großer Mannigfaltigkeit und Menge die Gewässer Amerikas, Asiens, Ozeaniens und Afrikas, werden aber in Europa nur durch eine einzige Art vertreten. Sie lieben ruhigfließende oder stehende Gewässer mit schlammigem Grunde, fehlen jedoch auch rascher strömenden nicht, siedeln sich sogar in Gebirgsbächen an und steigen hier ebenso hoch empor wie irgendein anderer Fisch. Dieser Verbreitung entspricht der Aufenthalt. Während die einen am häufigsten in der Nähe der Strommündungen gefunden wenden, woselbst sie auf dem sandigen oder schlickigen Grunde liegen, bemerkt man andere auf felsigem Boden, nach Art der Quappe zwischen und unter Steinen versteckt, und während diese, wie es scheint, bloß in den Flüssen sich ansiedeln, herbergen jene nur in Binnenseen, andere aber bald hier, bald dort. Die großen Arten sind ebenso schwerfällig in ihren Bewegungen wie plump gebaut, die kleineren im Gegenteile rasche und behende Fische, manche insofern vor anderen Klassenverwandten bevorzugt, als sie trotz den Labyrinthfischen und Schlangenköpfen über feuchten, schlammigen und selbst über trockenen Boden Reisen unternehmen, nötigenfalls auch im Schlamme sich einwühlen und bis zur Wiederkehr des Wassers hier verweilen. Alle ohne Ausnahme gehören zu den Raubfischen. Die meisten liegen bewegungslos auf der Lauer, spielen mit ihren Bart- oder Fangfäden, locken so andere Fische heran und schnappen im rechten Augenblicke zu; einzelne besitzen die Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen und damit ihre Opfer zu betäuben. Ihre Vermehrung scheint, obgleich die Rogener eine bedeutende Anzahl von Eiern absetzen, verhältnismäßig gering zu sein, das Wachstum der Jungen langsam vor sich zu gehen, unsere Fische dafür aber ein sehr hohes Alter zu erreichen. Für den menschlichen Haushalt spielen sie bei uns keine bedeutsame Rolle, wogegen sie in einzelnen Gegenden Afrikas, Asiens und Amerikas zu den gemeinsten und geschätztesten Küchenfischen gehören.
Das Urbild der Familie, unser Wels oder Waller ( Silurus glanis), Vertreter der Sippe der Waller ( Silurus), hat mit einigen asiatischen Verwandten gemein: nackten Rumpf, kurze Rückenflosse ohne Stachelstrahlen, sehr lange Afterflosse, weites Maul und in Binden gereihte, hechelförmige Zähne auf Zwischen-, Unterkiefer und Pflugscharbeinen. »Dieß scheußliche Thier«, sagt unser alter Freund Geßner, »möcht ein teutscher Wallfisch genennt werden. Ist ein sehr scheußlicher, grosser Fisch, hat ein scheußlich weit Maul vnd schlauch, grossen Kopff, keine Zän, sondern allein rauhe Kynbacken, ist an der gantzen Gestalt nit vngleich einer Trüschen, so grosse ding kleinen zu vergleichen sind, hat keine schüppen, sondern eine glatte schlüpfferige Haut.« In der Tat, schön oder wohlgestaltet kann man den Wels nicht nennen, und der Name »deutscher Walfisch« ist auch nicht übel gewählt; denn der Waller, Scheit usw. ist wirklich der größte aller europäischen Flußfische. In der Donau erreicht er bei einer Dicke, daß ihn kaum zwei Männer umspannen können, laut Heckel und Kner, nicht selten eine Länge von drei Meter und ein Gewicht von zweihundert bis zweihundertfünfzig Kilogramm. Scheitel, Rücken und Flossenränder sind blauschwarz, die Seiten grünlichschwarz, gegen den Bauch hin auf hellerem Grunde mit ölgrünen Flecken gezeichnet; die Unterseite ist rötlich oder gelblichweiß, bläulichschwarz gemarmelt; Bauch- und Afterflossen haben in der Mitte eine hellere gelbliche Binde; die zwei Bärtel des Oberkiefers sind weißlich, die vier kurzen des Unterkiefers rötlich.
Von Südschweden an verbreitet sich der Wels über das ganze mittlere und östliche Europa, auch einen Teil von Westasien, fehlt jedoch hier und da, so beispielsweise im Rhein- und Wesergebiet, fast gänzlich, kommt ebensowenig in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien vor. Besonders häufig ist er in der unteren Donau, tritt jedoch auch im oberen Laufe dieses Stromes, seinen Nebenflüssen und den mit diesen in Verbindung stehenden Seen auf, ebenso wie er, der im Rhein zu den seltensten Erscheinungen zählt, im Bodensee gefangen wird. Unsere Meere besucht er erwiesenermaßen nicht, meidet sogar die schwachsalzigen Haffe der Ostsee, wogegen er dem Schwarzen und Kaspischen Meere nicht fehlt, hier wie da sogar einen wichtigen Gegenstand der Fischerei bildet. Ruhige Tiefen mit Schlammgrund bilden seinen Standort. Hier lauert er träge hinter Steinen, versenkten Baumstämmen, Schiffstrümmern und dergleichen auf Beute, spielt mit seinen Bärteln und fängt die nach diesen schnappenden Fische weg, frißt aber außerdem Krebse, Frösche, Wasservögel, überhaupt alles, was er erreichen und verschlingen kann. »Ob der gestalt des Thieres«, fährt Geßner fort, »ist wol abzunemmen sein tyrannische, grimmige vnd frässige art. Also daß zu zeiten in eines Magen ein Menschenkopff vnd rechte Handt mit zweyen güldinen Ringen sind gefunden worden; dann sie fressen allerley daß sie bekommen mägen, Gänß, Enten, verschonen auch dem Viehe nit, so man es zur Weth oder Wäschen, oder sonst zu träncken führt, also daß sie auch zu zeiten die Pferd zu grund ziehen vnd ersäuffen, verschonnt dem Menschen gar nit wo er jn kriegen mag.« Letzteres ist keine Übertreibung; denn man kennt mehrere Fälle, die Geßners Angaben bestätigen. In dem Magen eines bei Preßburg gefangenen Welses fand man, laut Heckel und Kner, die Reste eines Knaben, in einem anderen einen Pudel, in einem dritten Gänse, die er ersäuft und verschlungen hatte. »Die Bewohner der Donau sowohl wie anderer Gegenden«, sagen die genannten Forscher, »fürchten sich daher vor ihm, und der Aberglaube der Fischer meinte früher, daß ein Fischer sterben müsse, wenn ein Wels gefangen werde.« An anderen Orten urteilt man günstiger über ihn, indem man ihn für einen Wetterpropheten ansieht, wohl deshalb, weil er nur bei Gewitterluft die Tiefen des Gewässers verläßt und in die Höhe steigt.
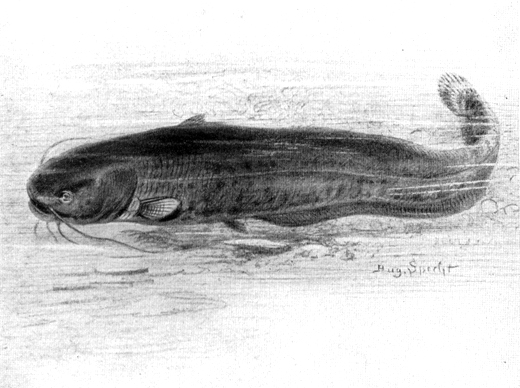
Wels ( Silurus glanis)
Die Laichzeit fällt in die Monate Mai bis Juli. Solange sie währt, findet man die Welse gewöhnlich paarweise zusammen. Sie nähern sich dann dem Ufer, um im Ried und Rohr ihre Eier abzusetzen, und bleiben auch, was sie sonst nicht zu tun Pflegen, tagsüber in seichtem Wasser liegen. Nach angestellten Zählungen legt der Rogener nur etwa siebzehntausend Eier ab, aus denen nach sieben bis neun Tagen die Jungen, sonderbar aussehende Geschöpfe, die mit Kaulquappen wirklich überraschende Ähnlichkeit haben, hervorkommen. Bei hohem Wasserstande erreicht die Brut schon im ersten Jahre bis dreiviertel, im zweiten bis anderthalb Kilogramm, bei niederem hingegen im ersten nur einviertel, im zweiten bis höchstens ein Kilogramm Gewicht. Erfahrene ungarische Fischer geben, laut Heckel und Kner, die Lebensdauer des Welses auf zehn bis zwölf Jahre an, unzweifelhaft mit Unrecht, da man, wie Baldner erwähnt, einen in der Ill bei Straßburg gefangenen Wels von Fußlänge in einem Weiher von 1569 bis 1620 am Leben erhalten und beobachtet hat, daß derselbe in dieser Zeit erst eine Länge von anderthalb Meter erreicht hatte. Wenn man nun auch annehmen darf, daß gefangene, beziehungsweise im engeren Raume eingesperrte Welse viel langsamer wachsen als solche, die in der Donau oder einem anderen großen Strome nach Belieben jagen, sich tummeln und mästen können, darf man doch glauben, daß Riesen von drei Meter Länge eine viel höhere Anzahl von Jahren zählen müssen. Vielleicht zum Glück für unsere Gewässer erreichen nur wenige Welse ein so hohes Alter. Die meisten der aus den verschont gebliebenen Eiern ausschlüpfenden Jungen werden in der ersten Zeit ihres Lebens von Quappen und anderen Raubfischen, die größeren wohl auch von ihren eigenen Eltern weggeschnappt, viele außerdem in der Blüte ihrer Jahre von Fischern gefangen, kaum weniger vielleicht durch allerlei Krankheiten, die bei hoher Wärme nicht selten seuchenartig auftreten, hinweggerafft.
Ungeachtet des nicht sonderlich geschätzten Fleisches, das, solange der Fisch jung, sehr fett, wenn er alt, zähe und tranig ist, wird dem Welse doch nachgestellt, weil das Fleisch als Speck oder bei der Lederbereitung Anwendung findet und die Schwimmblase als schlechte Hausenblase in den Handel gebracht oder zu Leim verarbeitet wird. Junge Welse erbeutet man meist mit der Angel, alte am häufigsten während der Laichzeit bei Nacht, gewöhnlich mit dem Wurfspieß. Sehr große Stücke machen den Fischern viel zu schaffen. Richter versichert, selbst gesehen zu haben, daß ein großer, an der Angel zappelnder Wels mit Schwanzschlägen einen Kahn umwarf.
Wie die meisten Welse überhaupt hält auch der europäische ohne Schaden längere Zeit außerhalb des Wassers aus, läßt sich demgemäß leicht versenden und in Gewässern, denen er fehlt, einbürgern. In engerem Gewahrsam halten junge Welse, falls man sie nur ordentlich füttert, leidlich aus.
*
Zu den Nagelwelsen zählt eines der merkwürdigsten Glieder der Familie, der Zitterwels, Raasch der Araber ( Malapterus electricus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Malapterus), ausgezeichnet durch die Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen. Äußerlich nur durch die fehlende Rückenflosse, die sie gleichsam ersetzende kleine Fettflosse und die strahlenlosen Brustflossen von anderen Welsen unterschieden, kennzeichnet sich der Raasch innerlich durch das zwischen der ganzen Körperhaut und den Muskeln liegende dünne, einer Fettschicht ähnelnde Gewebe, das aus sechs oder mehr übereinander liegenden Häuten besteht und zwischen ihnen Raum für eine gallertartige Masse gibt, auch von einer besonderen Schlag- und Hohlader und einem vielfach verzweigten Nerv gespeist und geleitet wird. Die Färbung der glatten, sehr schleimigen Haut ist ein schwer zu bestimmendes Grau; die Zeichnung besteht aus unregelmäßigen schwarzen Flecken, die längs der Seitenlinie sich häufen und auch auf den Flossen vorhanden sind. Die Länge beträgt dreißig bis fünfzig Zentimeter.
Unser Fisch erteilt, wenn man ihn mit der Hand berührt, willkürlich Schläge, die denen einer galvanischen Säule ähneln und sehr verschiedene Stärke haben. Während man ihn zuweilen anfassen kann, ohne einen Schlag zu erhalten, empfindet man zu anderen Zeiten bei der geringsten Berührung die Wirkung seines Unwillens; ja, unser Wels läßt sich von einzelnen Personen längere Zeit in der Hand halten und erteilt dem Nachfolger derselben sofort einen Schlag. Letzterer ist nicht besonders schmerzhaft und kann wohl nur kleinen Tieren gefährlich werden.
Forskal entdeckte den Zitterwels im Nil, Adanson fand ihn im Senegal auf. An einzelnen Orten, das heißt hier und da, ist er nicht selten; auf sandigem Grunde scheint er zu fehlen. Das Fleisch wird gegessen, jedoch nicht besonders geschätzt; dagegen schreibt man dem Zellengewebe, von dem die elektrische Kraft ausströmt, heilende Eigenschaften zu.
*
In Europa hat die Familie der Salmler ( Characinidae) keine Vertreter; ihre Mitglieder gehören den süßen Gewässern Südamerikas und Afrikas an. Sie beleben hier namentlich gewisse Stellen der Flüsse in zahlloser Menge, die einen zum Nutzen, die anderen zum Schaden der Anwohner.
Sägesalmler ( Serrosalmo) nennt man hoch- und schmalleibige Arten der Familie, die große, schneidende, dreieckige, in einer Reihe geordnete Zähne in beiden Kiefern und ähnliche in einer Reihe am Gaumen tragen, mit Seitenlappen ausgerüstete, sehr kleine Schuppen, eine hohe, weit hinten stehende Rücken- und lange Afterflosse, zwei Stacheln vor der After- und einen Stachel vor der Rückenflosse haben.
Einer der bekannteren Vertreter dieser Sippe ist die Piraya ( Serrosalmo piraya) ein sehr hochleibiger und gedrungener, kurz- und stumpfschnäuziger Fisch von etwa dreißig Zentimeter Länge, oberseits bläulicher, unterseits gelblicher Färbung und dunkler Fleckung.

Piraya ( Serrosalmo piraya)
Alle Sägesalmler leben in den Flüssen Süd- und Mittelamerikas, selten oder nie in der Nähe der Mündungen, vielmehr durchschnittlich vierzig bis sechzig Seemeilen vom Meere aufwärts, auf stromlosen Stellen, vorzugsweise in Buchten, die von Felsen umgeben oder von ihnen durchsetzt werden. Für gewöhnlich halten sie sich am Boden auf, erscheinen aber, sobald sie eine Beute gewahren, zu Tausenden auch an der Oberfläche des Wassers. Auf größeren Strömen begleiten oder umringen sie die Fahrzeuge, um im rechten Augenblick zur Stelle zu sein. »Wird ihnen«, bemerkt Bates, »nichts zugeworfen, so sieht man höchstens einige zerstreute hier und da, aller Köpfe erwartungsvoll gerichtet; sobald aber irgendein Abfall vom Boot aus ins Wasser geschüttet wird, dunkelt sich dasselbe durch ihre Heere, ein wütender Kampf beginnt um den Bissen, und oft noch glückt es dem einen, Nahrung zu stehlen, die ein anderer schon halb verschlungen. Wenn eine Biene oder Fliege nahe über dem Spiegel dahinzieht, springen sie tobend nach ihr, so gleichzeitig, als würden sie durch einen elektrischen Schlag aufgerührt.« Humboldt hat schon lange vor Bates Ähnliches erzählt. »Gießt man«, sagt er, »ein paar Tropfen Blut ins Wasser, so kommen sie zu Tausenden herauf, an Stellen, wo der Fluß ganz klar und kein Fisch zu sehen war. Warfen wir kleine blutige Fleischstückchen ins Wasser, in wenigen Minuten waren zahlreiche Schwärme von Karaibenfischen da und stritten sich um den Fraß.«
Schomburgk bezeichnet sie mit Recht als die gierigsten Raubfische des Süßwassers und meint, daß man sie die Hyänen desselben nennen könnte. Im Vergleich zu ihnen aber sind die Hyänen harmlose, die Geier bescheidene Geschöpfe. Ihre Gefräßigkeit übersteigt jede Vorstellung: sie gefährden jedes andere Tier, das sich in ihren Bereich wagt, Fische, die zehnmal größer sind als sie selbst. »Greifen sie«, berichtet gedachter Reisender, »einen größeren Fisch an, so beißen sie ihm zuerst die Schwanzflosse ab und berauben damit den Gegner seines Hauptbewegungswerkzeuges, während die übrigen wie Harpyien über ihn herfallen und ihn bis auf den Kopf zerfleischen und verzehren. Kein Säugetier, das durch den Fluß schwimmt, entgeht ihrer Raubsucht; ja selbst die Füße der Wasservögel, Schildkröten und die Zehen der Alligatoren sind nicht sicher vor ihnen. Wird der Kaiman von ihnen angegriffen, so wälzt er sich gewöhnlich auf den Rücken und streckt den Bauch nach der Oberfläche.« Das entschiedenste Zeichen ihrer Raubgier findet Schomburgk darin, daß sie selbst ihre eigenen verwundeten Kameraden nicht verschonen. »Als ich mich eines Abends mit Angeln beschäftigte«, fährt er fort, »zog ich einen ganz ansehnlichen Pirai ( Serrosalmo niger) ans Land. Nachdem ich ihn mit einigen kräftigen Schlägen auf den Kopf getötet zu haben glaubte, legte ich ihn neben mich auf die Klippe; plötzlich jedoch machte er wieder einige Bewegungen, und bevor ich es verhindern konnte, schwamm er, wenn auch noch halb betäubt, auf der Oberfläche des Wassers umher. Im Nu waren sechzehn bis zwanzig seiner Genossen um ihn versammelt, und nach einigen Minuten war nur der Kopf von ihm übrig.« Nicht selten soll es, laut Gumila, ihrem ersten Beschreiber, geschehen, daß, wenn ein Ochse, ein Tapir oder ein anderes großes Tier schwimmend unter einen Schwarm dieser fürchterlichen Fische gerät, es aufgefressen wird. Seiner Kraft beraubt durch den infolge unzähliger Bisse erlittenen Blutverlust, kann sich das Säugetier nicht mehr retten und muß ertrinken. Man sah solche Tiere in Flüssen, die kaum dreißig bis vierzig Schritte breit waren, zugrunde gehen oder, wenn sie das andere Ufer glücklich erreichten, als halbfertige Gerippe hier zu Boden stürzen. Die an den Flüssen wohnenden Tiere kennen die ihnen durch die Sägesalmler drohenden Gefahren und nehmen sich ängstlich in acht, beim Trinken das Flußwasser weder zu bewegen, noch zu trüben, um ihre gräßlichen Feinde nicht anzulocken. Dieser Vorsicht ungeachtet werden ihnen oft genug Stücke aus Nase und Lippen gerissen. Gumilas Meinung, daß diese Fische den Menschen wohl verschonen, widerlegt schon Dobrizhofer, der mitteilt, daß zwei spanische Soldaten, als sie, neben ihren Pferden schwimmend, einen Fluß übersetzten, von den Pirayas angegriffen und getötet wurden. Humboldt sagt: »Der Karaibenfisch ( Serrosalmo rhombeus) fällt die Menschen beim Baden und Schwimmen an und reißt ihnen oft ansehnliche Stücke Fleisch ab. Ist man anfangs auch nur unbedeutend verletzt, so kommt man doch nur schwer aus dem Wasser, ohne die schlimmsten Verletzungen davonzutragen. Verschiedene Indianer zeigten uns an Waden und Schenkeln vernarbte, sehr tiefe Wunden, die von diesen kleinen Tieren herrührten«. Nach diesen übereinstimmenden Berichten wird es einleuchten, daß man die Sägesalmler mehr fürchtet als jedes andere Raubtier, mehr als die giftigste Schlange.
*
Als die edelsten Glieder der Ordnung dürfen wir die Lachse ( Salmonidae) bezeichnen, beschuppte Fische mit gestrecktem, rundlichem Leib, einer strahlenlosen Fettflosse hinter der Rückenflosse und bis zur Kehle gespaltener Kiemenöffnung, deren Maul in der Mitte von dem Zwischenkiefer, nach außen von dem Oberkiefer begrenzt und entweder gänzlich unbewaffnet oder mit sehr feinen Zähnen besetzt oder mit kräftig entwickelten Zähnen bewaffnet ist. Rücksichtlich der Bezahnung zerfallen die Lachse in zwei scharf begrenzte Gruppen: in solche, bei denen das kleine Maul nur mangelhafte, hinfällige Zähne trägt, und in solche, bei denen sämtliche Zähne kräftig entwickelt sind. Erstere erinnern an Karpfen und Heringe; letztere, die als der Kern der Familie angesehen werden müssen, sind den eigentlichen Raubfischen beizuzählen. Die Färbung der einzelnen Arten weicht nicht allein je nach dem Alter wesentlich ab, sondern verändert sich auch vor und nach der Laichzeit.
Mit ganz geringen Ausnahmen gehören die Lachse ausschließlich der nördlichen Halbkugel an. Sie bewohnen die salzigen wie die süßen Gewässer, falls sie rein sind, die im Norden gelegenen in größerer Anzahl als die südlichen. In erfreulicher Menge beleben sie das Eismeer und den nördlichen Teil des Stillen Weltmeeres, minder zahlreich die Nord- und Ostsee sowie den nördlichen Teil des Atlantischen Weltmeeres. Vom Meere aus wandern alle Lachse gegen die Laichzeit hin in die Ströme, Flüsse und Bäche, um hier sich fortzupflanzen, und zwar kehrt jeder einzelne Fisch wieder in denselben Fluß oder doch in das Stromgebiet zurück, in dem er geboren wurde. Der Wandertrieb ist so heftig, daß der zu Berge gehende Fisch vor keinem Hindernis zurückschreckt und die wirklich unübersteiglichen selbst mit Gefahr seines Lebens zu überwinden sucht. Alle zu Berge gehenden Lachse laichen in eine von ihnen vorher ausgehöhlte seichte Grube im Sande oder Kiese und wissen die Wahl derselben mit viel Geschick zu treffen. Andere Arten verlassen die Seen, in denen sie herbergen, während der Laichzeit nur ausnahmsweise, dann ebenfalls die in den See fallenden Flüsse aufsuchend, wählen sich vielmehr regelmäßig seichte Ufer des Sees zum Laichen aus; andere endlich erscheinen während der Fortpflanzungszeit in ungeheuren Massen an der Oberfläche des Wassers, unbekümmert, ob die Tiefe unter ihnen wenige Zentimeter oder viele Meter beträgt, drängen sich dicht aneinander, springen, Bauch an Bauch gekehrt, hoch über das Wasser empor und entleeren gleichzeitig Rogen und Milch, auf weithin das Wasser trübend.
Die Lachse mit schwächlichem Gebisse ernähren sich eher nach Art der Karpfen als nach Art der Raubfische, das heißt, nehmen Gewürm verschiedener Art, Schnecken, Muscheln und dergleichen, auch wohl pflanzliche Stoffe zu sich; die Arten mit kräftig bezahnten Kiefern hingegen lassen sich bloß in den ersten Jahren ihres Lebens mit Gewürm und Kerbtieren oder deren Larven genügen und greifen im höheren Alter alle anderen Fische an, die sie irgendwie zu bewältigen glauben. Übrigens sind die größten Arten der Familie nicht die furchtbarsten Räuber: der Edellachs zum Beispiel steht, schon wegen seines erheblich schwächeren Gebisses, der Lachsforelle, wenn auch nicht an Gefräßigkeit, so doch an Raubfähigkeit nach.
Für den menschlichen Haushalt haben die Lachse eine sehr große Bedeutung. Ihr köstliches Fleisch, das von dem keines anderen Fisches überboten wird, zeichnet sich aus durch schöne Färbung, ist grätenlos, schmackhaft und leicht verdaulich, so daß es selbst Kranke genießen können. In unserem fischarmen Vaterlande gehört es leider zu den selten gebotenen Leckerbissen, wenigstens in allen Gegenden, die nicht unmittelbar an Flüssen oder Bergströmen und Gebirgsseen liegen; schon in Skandinavien, Rußland und Sibirien dagegen ist es ein wesentliches Nahrungsmittel der Bevölkerung. Für die in den Küstenländern am Stillen Weltmeere und am Eismeere lebenden Menschen bilden die Lachse die hauptsächlichste Nahrung; ihre wichtigste Arbeit gilt deren Fange. Während des Sommers fängt, trocknet, räuchert, pökelt, speichert man den Reichtum des Meeres auf, der jetzt durch die Flüsse geboten wird, wendet man alle Mittel an, um sich den für den Winter unumgänglich notwendigen Bedarf an Nahrung zu erwerben.
Die Klage über Verarmung unserer Gewässer bezieht sich hauptsächlich auf die von Jahr zu Jahr fühlbarer werdende Abnahme der Mitglieder dieser Familie. Aus vergangenen Jahrhunderten liegen Berichte vor, die übereinstimmend angeben, daß man vormals den Reichtum der Gewässer nicht auszunutzen vermochte; aber diese Berichte schon gedenken weiter zurückliegender Zeiten, in denen der Reichtum noch größer gewesen sein soll. Bereits vor Jahrhunderten wurden Gesetze erlassen zum Schutze dieser wichtigen Fische, die leichter als alle übrigen aus den Gewässern, wenigstens aus bestimmten Flüssen, verbannt werden können. Die Gesetze haben sich aus den oben angegebenen Gründen wenig bewährt und unsere Nachlässigkeit und leichtfertige Gleichgültigkeit gegen ein so wichtiges Nahrungsmittel bitter gerächt: gegenwärtig sieht man sich überall gezwungen, Maßregeln gegen das Weitergreifen des Übels zu treffen. Seitdem man die künstliche Fischzucht kennen und auszuüben gelernt hat, ist es wenigstens hier und da etwas besser geworden. In den lange Zeit verarmten Flüssen Schottlands macht sich der Segen des menschlichen Eingriffes schon jetzt in erfreulicher Weise bemerklich; in unserem Vaterlande fängt man wenigstens an, bessernde Hand anzulegen. Was erzielt werden kann, beweisen gelungene Versuche, befruchtete Eier verschiedener Lachsarten nach letzteren fremden Erdteilen zu versenden und die aus diesen Eiern erzielten Fische in den Gewässern selbst solcher Gegenden einzubürgern, die von denen der Heimat wesentlich abweichen. So zeigt sich auch in dieser Beziehung ein Fortschritt.
Lachse im engeren Sinne ( Salmo) nennen wir diejenigen Arten der Familie, die die denkbar edelste Fischgestalt haben, mit kleinen Schuppen bekleidet sind, in dem bis unter das Auge gespaltenen Maule ein wohlentwickeltes Gebiß zeigen und eine kurze, durch weniger als vierzehn Strahlen gespannte Afterflosse besitzen.
Als das edelste Mitglied der Sippe bezeichnen unsere Fischer den Lachs oder Salm ( Salmo salar). Ihn kennzeichnet der sehr in die Länge gestreckte, seitlich mehr oder weniger zusammengedrückte Leib, der im Verhältnis zu diesem sehr kleine Kopf mit schmächtiger, lang vorgezogener Schnauze, die zahnlose, kurze, fünfeckige Platte des Pflugscharbeines und die einreihig gestellten, frühzeitig ausfallenden Zähne des Pflugscharstieles. Der Rücken ist blaugrau, die Seite silberglänzend, die Unterseite weiß und glänzend; die Zeichnung des fortpflanzungsfähigen Fisches besteht aus wenigen schwarzen Flecken. Rücken-, Fett- und Schwanzflosse haben eine dunkelgraue, die übrigen eine blasse Färbung; ausnahmsweise zeigt die Rückenflosse einzelne runde, schwarze Flecke. An Länge kann der Lachs bis anderthalb Meter, an Gewicht bis fünfundvierzig Kilogramm erreichen; so große Stücke finden sich jedoch gegenwärtig nur noch in den nordrussischen Strömen; im übrigen Europa hat man derartige Riesen längst ausgerottet. In unseren Tagen gilt hier ein Lachs von Meterlänge und fünfzehn bis sechzehn Kilogramm Gewicht schon für sehr groß.
Als die Heimat des Lachses müssen wir das Eismeer und den nördlichen Teil des Atlantischen Weltmeeres, einschließlich der Nord- und Ostsee, ansehen, obgleich er sich mehr im süßen Wasser als in der See aufhält, in den Flüssen die erste Jugendzeit verlebt und vom Meere aus alljährlich in den Strömen aufsteigt, so weit er kann. In Deutschland besucht er hauptsächlich den Rhein und seine Zuflüsse, die Oder und die Weichsel, ohne jedoch in Weser und Elbe zu fehlen. Gelegentlich seiner Wanderungen erscheint er in allen größeren Zuflüssen der genannten Ströme, falls ihm hier nicht Wehre oder Wasserfälle den Weg versperren. Häufiger als in Deutschland findet er sich in den Flüssen Großbritanniens, Rußlands, Skandinaviens, Islands und Grönlands.
Wie es der Lachs im Meere treibt, wissen wir nicht, so sorgfältig man auch gerade ihn, den wertvollsten aller Süßwasserfische, beobachtet hat. Nur so viel dürfen wir als feststehend annehmen, daß er sich von seinem Geburtsflusse niemals weit entfernt, also keineswegs, wie man früher annahm, Reisen bis zum Nordpol unternimmt, sondern sich höchstens von der Mündung des Flusses aus in die Nähe benachbarter Tiefgründe des Meeres versenkt und hier in einer Weise mästet, die selbst unter den Fischen beispiellos erscheint. Nach den Untersuchungen schwedischer Forscher raubt er während seines Aufenthaltes im Meere allerlei Kruster, Fische verschiedener Art, namentlich Sandaale, Stichlinge, auch wohl Heringe, dürfte aber seinen Speisezettel keinesfalls auf die genannten Tiere beschränken, vielmehr alles fressen, was er erlangen kann. Gänzlich verschieden beträgt er sich während seines Aufenthaltes im süßen Wasser. Im allgemeinen unterscheidet er sich wenig von seinen Verwandten, namentlich von den beiden großen Forellen, die ihm auch leiblich sehr nahestehen. Er schwimmt mit derselben Gewandtheit wie diese und übertrifft sie noch durch die Fertigkeit im Springen, lebt wie andere Edellachse gern in Gesellschaften, frißt aber in süßen Gewässern nur während seiner Jugendzeit ebenso gierig wie die Forelle und enthält sich vor, während und nach seiner Fortpflanzungszeit, überhaupt solange, wie er, vom Meere aufsteigend, in süßen Gewässern verweilt, fast gänzlich der Nahrung. Seine Wanderungen sind daher Lebensbedingung für ihn: das Meer ernährt ihn, das Süßgewässer ermöglicht seine Vermehrung.
Obwohl man in allen Monaten des Jahres aufsteigende Lachse in Strömen und Flüssen wahrnehmen kann, finden deren Binnenlandwanderungen der Hauptsache nach doch in den ersten Monaten des Jahres statt. Der Aufstieg kann durch die herrschende Witterung wie durch die Wärme eines Flusses verzögert oder beschleunigt werden, fällt aber durchschnittlich in die Monate März, April und Mai. Wenn das Eis der Ströme aufgeht, nähern sich die Lachse in Gesellschaften von dreißig bis vierzig Stück den Küsten und Mündungen der Ströme, halten sich eine Zeitlang hier auf, gleichsam, als müßten sie sich erst an das süße Wasser gewöhnen, steigen mit der Flut zu Berge und kehren mit der Ebbe wieder ins Meer zurück, bis endlich die eigentliche Reise angetreten wird. Man hat beobachtet, daß die Rogener vor den Milchnern aufsteigen, und daß die Jungen, die vor wenigen Monaten oder Wochen in die See gingen, früher in die Flüsse zurückkehren als die Alten. Ein Hindernis suchen sie mit aller Kraft zu überwinden, unter Netzen durchzukommen oder sie zu zerreißen, Stromschnellen, Wasserfälle und Wehre zu überspringen. Hierbei entfalten sie bewunderungswürdige Kraft, Gewandtheit und Ausdauer. Unter Aufbietung aller Kräfte dringen sie bis in den stärksten Strom unterhalb der Schnelle, stützen sich wohl auch mit der Schwanzflosse gegen einen Stein, um Halt zu gewinnen, schlagen mit voller Macht kräftig gegen das Wasser und schnellen sich hierdurch bis in eine Höhe von zwei bis drei Meter empor, gleichzeitig einen Bogen von vier bis sechs Meter Durchmesser beschreibend. Mißglücken des Sprunges hält sie nicht ab, denselben von neuem zu versuchen, und gar nicht selten büßen sie ihre Hartnäckigkeit mit dem Leben, auch wenn sie nicht in die für sie aufgestellten Fallen oder Reusen, sondern auf den nackten Felsen stürzen. Senkrechte Wasserfälle von bedeutender Höhe setzen ihrem Vordringen selbstverständlich Grenzen; Stromschnellen hingegen überwinden sie leicht. Darauf gründet sich die mit Erfolg ausgeführte Einrichtung der sogenannten Lachsleitern, die wirkliche Treppen für sie bilden, indem man ein natürliches oder künstliches Rinnsaal abwechselnd auf der einen und auf der anderen Seite mit fest in den Fels gesenkten, vorspringenden Holz- oder Eisenplatten versieht, an denen sich die Kraft des herabstürzenden Wassers bricht, und durch die also Ruheplätze für sie hergestellt werden. Seen, durch die Flüsse strömen, werden von ihnen immer durchschwommen, weil die Wanderung sie stets bis in die oberen Zuflüsse führt. Trotz ihrer Schwimmfähigkeit kommen sie erst nach geraumer Zeit im oberen Laufe der Ströme an, wandern also gemächlich und langsam. So treten sie zum Beispiel bereits im April in den Rhein ein, erscheinen aber erst im Mai bei Basel und selten vor Ende August in den kleineren Flüssen. Im Rheingebiet besuchen sie sehr regelmäßig die Limmat, durchschwimmen von hier aus den Züricher See, gehen in der Linth weiter, übersetzen den Wallenstätter See und ziehen in der Seetz weiter zu Berge. Ein anderer Teil besucht die Reuß und Aar, durchkreuzt den Vierwaldstätter und Thuner See und wandert in eben gedachten Flüssen aufwärts, in der Reuß, laut Tschudi, zuweilen bis zu dreizehnhundert Meter über Meer, obgleich sie hier zahllose Stürze und Strudel überwinden müssen. Im Wesergebiet endet ihre Wanderung erst in der Fulda und Werra und deren Seitengewässern. Im Elbgebiet steigen sie ebenfalls sehr weit zu Berge, auf der einen Seite bis gegen das Fichtelgebirge hin, auf der anderen in der Moldau und deren Zuflüssen aufwärts. Genau dasselbe läßt sich sagen von den in die Ostsee mündenden Flüssen, unter denen die Memel von den meisten Lachsen besucht wird. Neuerrichtete Wehre ohne Lachsleitern ändern die bestehenden Verhältnisse fast gänzlich um; aber auch die Lachsleitern werden oft nicht sogleich, vielleicht erst von den über sie zu Tal gewanderten Fischen angenommen.
Gegen die Laichzeit hin geht mit den Lachsen eine auch äußerlich zu erkennende Veränderung vor: sie legen ein Hochzeitskleid an, färben sich dunkler und bekommen auf den Leibesseiten und Kiemendeckeln häufig rote Flecke. Bei ganz alten Milchnern entwickelt sich, laut Siebold, zur Brunstzeit ein prachtvolles Farbenkleid, indem sich nicht bloß der Bauch purpurrot färbt, sondern auch auf dem Kopfe Zickzacklinien sich bilden, die aus den ineinander fließenden roten Flecken entstehen und sich scharf von dem bläulichen Grunde abheben; auch erhalten die Wurzeln der Afterflosse, der Vorderrand der Bauchflossen und der Ober- und Unterrand der Schwanzflosse einen rötlichen Anschein. Gleichzeitig verdickt sich die Haut des Rückens und der Flossen.
In den Monaten Oktober bis Februar erwählt ein Weibchen, das gewöhnlich von einem erwachsenen und vielen jungen Männchen begleitet wird, eine seichte, sandige oder kiesige Stelle zur Anlage seines sogenannten Bettes, einer weiten, jedoch nicht tiefen Grube, die die Eier aufnehmen soll. Die Arbeit des Aushöhlens geschieht von ihm allein, und zwar vermittels des Schwanzes, während das Männchen auf der Lauer liegt, um Nebenbuhler fortzujagen. Wenn jenes sich anschickt zu legen, eilt dieses herbei, um die Eier zu besamen, die sodann durch erneuerte Schwanzbewegungen wieder bedeckt wenden. Nicht selten sieht man einen Rogener auch nur von kleinen, eben zeugungsfähig gewordenen Milchnern, die noch niemals im Meere waren, umgeben und diese an dem Fortpflanzungsgeschäft teilnehmen. Einzelne Beobachter sprechen gedachten Junglachsen sogar eine sehr bedeutungsvolle Rolle zu. Jedes ältere Männchen nämlich überwacht eifersüchtig das sich zum Laichen anschickende Weibchen und bemüht sich, alle Nebenbuhler fernzuhalten. Naht ein solcher, so kämpft es mit ihm, bis er das Feld verläßt, zuweilen so erbittert, daß sein oder des Gegners Blut das Wasser rötet oder einer von beiden Kämpen sogar sein Leben einbüßt. Den Rogener lassen diese Kämpfe unbekümmert. Anscheinend durch die Anwesenheit der Junglachse befriedigt, fährt er fort zu laichen, wirft sich in Unterbrechungen von einigen Minuten bald auf die eine, bald auf die andere Seite, preßt jedesmal einen Teil seiner Eier aus und überdeckt, indem er sich wiederum wendet, die früher gelegten und inzwischen von den eiligst sich herbeidrängenden Junglachsen besamten mit einer dünnen Sandschicht. Die Junglachse spielen somit dieselbe Rolle wie die Spießer während des Kampfes zweier Hirsche. Demungeachtet genügen sie dem Weibchen keineswegs auch als Genossen. Denn dieses unterbricht sein Laichgeschäft, sobald der erwachsene Milchner gefangen oder im Streit erlegt wurde, schwimmt dem nächsten Tümpel zu und holt von dort ein anderes altes Männchen herbei, um unter dessen Aufsicht weiter zu laichen. Young beobachtete, daß ein und derselbe Rogener nach und nach neun männliche Lachse zur Laichstelle brachte und, als auch der letzte männliche Artgenosse wie die anderen weggefangen worden war, mit einer ihm folgenden großen Forelle zurückkehrte. Der Laich wird nie mit einem Male, sondern in Absätzen gelegt, das Geschäft nach einigen innerhalb drei bis vier, nach anderen innerhalb acht bis zehn Tagen beendet.
Nach geschehener Fortpflanzung sind die Lachse so erschöpft, daß sie weder jagen noch schwimmen können. Mehr vom Wasser getrieben als selbständig sich bewegend, gleiten sie stromabwärts dem nächsten Tümpel zu und verweilen in ihm so lange, bis sie sich einigermaßen erholt haben und imstande sind, die Rückreise nach dem Meere anzutreten. Mit den Hochwässern des Winters und Frühlings schwimmen sie sodann langsam, Fälle und Stromschnellen möglichst vermeidend, weiter und weiter stromabwärts und erreichen günstigenfalls, nachdem sie vorher noch geraume Zeit im Brackwasser verweilt hatten, das Meer. Bis dahin scheinen sie sich, wie mir Baurat Pietsch mitteilt, jeder Nahrung zu enthalten; wenigstens findet man im Magen der zu dieser Zeit gefangenen niemals Nahrungsrückstände. »Ihr Fleisch, das während des Aufsteigens eine schöne rötliche Färbung hatte, wird nunmehr schmutzigweiß und für einen gebildeten Gaumen gänzlich ungenießbar. Die dunklen Flecke auf dem Körper mehren sich, nehmen an Umfang wie an Röte zu und zeigen sich auch an den Flossen, was man an der Weser mit dem Ausdrucke: ›der Lachs wird brandig‹; bezeichnet. Der Haken an der Kieferspitze wird länger und drängt den Oberkiefer derartig zurück, daß die Fische ihre Kinnladen nicht mehr gehörig schließen, ihre Beute daher auch weder fest genug packen noch zerkleinern können. Infolgedessen werden sie so matt, daß sie sich, ohne einen Fluchtversuch zu wagen, oft mit der Hand fangen, in jedem Falle leicht spießen lassen. Ein großer Teil der Talwanderer geht während der Fahrt nach dem Meere zugrunde. Nach dem Abgang des Eises findet man auf den Kiesbänken sowie auf und neben den Buhnen eine Menge von Leichen der edlen Tiere.« Erreichen sie glücklich das Meer, so erholen sie sich überraschend schnell, reinigen ihre Kiemen von weißen Würmern und anderen Schmarotzern, die sich im süßen Wasser ansetzten, im Salzwasser aber sterben, strecken ihre Kiefer, verlieren ihre Brandflecke, fressen gierig und sind bis zum nächsten Aufstiege wiederum ebenso kräftig wie je.
Die Eier entwickeln sich je nach der Witterung früher oder später; doch vergehen in der Regel gegen vier Monate, bevor die Jungen ausschlüpfen. Ihre Länge beträgt kurz nach ihrem wirklichen Eintritt in das Leben ungefähr zwei Zentimeter. Kopf und Augen sind sehr groß; der Dottersack ist noch bedeutend. Die Färbung des Leibes ist ein blasses Braun, das neun oder zehn dunkelgraue, schief auf den Seiten stehende Fleckenbinden zeigt. An Zuchtjungen hat man erfahren, daß sie während des ersten Sommers eine Länge von höchstens zehn Zentimeter erreichen, fortan aber etwas rascher wachsen und im Alter von sechzehn Monaten etwa vierzig Zentimeter lang geworden sind. Um diese Zeit geht das Jugendkleid in das der Erwachsenen über, und nunmehr regt sich auch der Wandertrieb: sie streben dem Meere zu. Ihre Reise stromabwärts geschieht langsam, und ehe sie in das Salzwasser eintreten, verweilen sie noch Wochen an den Mündungen der Flüsse, weil ein rascher Übergang sie, wie es scheint, gefährdet. Junge Lachse, die man aus Flußwasser unmittelbar ins Salzwasser brachte, starben sämtlich nach kurzer Zeit, obgleich das Wasser vollkommen rein und klar war. Unumgängliche Bedingung für ihr Leben ist, wie wir gesehen haben, der zeitweilige Aufenthalt im Meere zwar nicht; von der größten Bedeutung aber ist er wohl. Sie müssen hier ungemein reichliche Nahrung finden, weil sie in sehr kurzer Zeit überraschend an Größe und Gewicht zunehmen.
In Großbritannien hat man die jungen Lachse lange verkannt und dadurch unersetzlichen Schaden angerichtet. Man hielt diejenigen, die noch ihr Jugendkleid trugen, für artlich verschiedene Fische, wollte noch nicht einmal in denen, die bereits im Wechsel dieses Kleides begriffen waren, die so geschätzten Lachse erkennen, nahm also keinen Anstand, sie scheffelweise aus dem Wasser zu fischen und, falls man sie nicht anders verwerten konnte, als Dung auf die Felder zu werfen. James Hogg, ein Schäfer, war der erste, der den allgemein verbreiteten Irrtum nachwies. Beim Hüten seiner Schafe hatte er vielfach Gelegenheit, die Fische zu beobachten, auch nicht geringe Fertigkeit im Fange derselben sich erworben. Hierbei kamen ihm junge Lachse unter die Hände, die eben das zweite Jugendkleid anlegten, und ebenso solche, die aus diesem in das der alten übergingen. Einmal aufmerksam geworden, beschloß er, Beobachtungen anzustellen, zeichnete die von ihm gefangenen Fische, ließ sie frei und bekam sie später als unverkennbare Lachse wieder an die Angel. Seine Entdeckung wurde mit Unglauben und Spott aufgenommen, bis sich endlich doch Naturforscher herbeiließen, der Sache weiter nachzuspüren, und, namentlich durch Hilfe der künstlichen Fischzucht, die Angaben bestätigt fanden. Seitdem denkt man freilich anders als früher und sucht die bis dahin vogelfreien Junglachse soviel wie möglich zu schützen, verspürt davon auch bereits jetzt die erfreulichsten Ergebnisse.
Der Fang der Lachse geschieht in sehr verschiedener Weise, mit mancherlei Garnen, in Reusen, Lachsfallen, die oberhalb der Wehre so angebracht werden, daß der Fisch beim überspringen in sie fällt, vermittels Wurfspeere, sogenannter Gere, mit denen man vom Boote aus die durch Feuer herbeigezogenen Fische ansticht, vorzugsweise aber mittels der Angel, die für den Lachsfang besonders eingerichtet und namentlich von den Engländern mit außerordentlicher Geschicklichkeit gehandhabt wird. In keinem anderen Lande steht der Lachsfang in so hohem Ansehen wie in Großbritannien, und nirgends gibt es so viele und eifrige Fischer wie hier. Nicht nur in der Heimat, sondern an allen Flüssen, die Lachse beherbergen, kann man während des Aufstieges Engländern begegnen. Hoch oben in der Nähe des Nordkaps, am Tana-Elf, habe ich sie sitzen sehen, diese unverwüstlichen Fischer, mit einem aus Mücken gebildeten Heiligenscheine umgeben, eingehüllt in dichte Schleier, um sich vor den blutgierigen Kerbtieren wenigstens einigermaßen zu schützen. In der Nähe ansprechender Stromschnellen hatten sie Zelte aufgeschlagen, inmitten der Birkenwaldungen auf Wochen mit den notwendigsten Lebensbedürfnissen sich versehen, und standhaft wie Helden ertrugen sie Wind und Wetter, Einsamkeit und Mücken, schmale Kost und Mangel an Gesellschaft, zahlten auch ohne Widerrede den Normannen eine Pacht von Tausenden von Mark für das Recht, sechs Wochen lang hier fischen zu dürfen, und gaben außerdem noch den größten Teil ihrer Beute unentgeltlich an die Besitzer der benachbarten Höfe ab. Das Fleisch des Lachses zählt mit Recht zu dem vorzüglichsten, das unsere heimischen Fische liefern, steht aber schon dem der Meer- und Lachsforelle, noch mehr dem der Bachforelle, Äsche und Moräne und am weitesten dem des Saiblinges nach. Nur solange es rot gefärbt ist, hat es Wert; weiß geworden, gilt es bei Kennern nicht allein als wertlos, sondern sogar als schädlich.
Zwei Lachsfischarten unseres Vaterlandes sind schwer zu unterscheiden, daher auch vielfach miteinander verwechselt worden. Die eine derselben ist die Seeforelle ( Salmo lacustris). Sie heißt auch Grundforelle, Silberlachs oder Salfisch und ist noch heutigentags ein zwei-, ja sogar mehrdeutiges Wesen, über das die Anschauungen der Fischkundigen weit auseinandergehen.
Die geschlechtlich entwickelte Form der Seeforelle macht sich nach den Ergebnissen der Untersuchungen von Siebold durch ihre dickere, plumpere Leibesgestalt kenntlich. Ihr Kopf besitzt im Vergleich zu den übrigen Verhältnissen des Körpers einen bedeutenden Umfang; die Schnauze ist verhältnismäßig stumpf, die Zähne sind sehr stark und stehen vorn meist in einfacher, hinten in doppelter Reihe. Der grün oder graublau gefärbte Rücken und die silberglänzenden Seiten tragen bald mehr, bald weniger Flecke von runder oder eckiger Gestalt und schwarzer Färbung, die zuweilen einen verwischten, orangegelben Saum haben. An jungen nimmt man an den Seiten auch einzelne orangegelbe Flecke wahr. Brust-, Bauch- und Afterflosse sehen im jüngeren Alter blaß aus, sind aber bei den älteren bald stärker, bald schwächer grau gefärbt als die Rücken- und Schwanzflosse, die stets diese oder eine noch dunklere Färbung zeigen; in der Rückenflosse bemerkt man immer viele runde schwarze Flecke, während die Schwanzflosse nur zuweilen mit einzelnen verwischten dunklen Tüpfeln besetzt ist.
Ganz verschieden von den fruchtbaren entwickeln sich die unfruchtbaren, am Bodensee unter dem Namen »Schwebeforellen«, in Österreich als »Maiforellen« unterschiedenen Seeforellen. »Ihr Körper bleibt viel mehr seitlich zusammengedrückt und schlanker, weil er weniger Fleisch ansetzt als der einer Grundforelle; die Schnauze streckt sich in die Länge; das Maul erscheint tiefer gespalten, und die Schwanzflosse verliert beim Heranwachsen des Fisches nicht so bald ihren Ausschnitt. Im höheren Alter kommt die Schnauzenverlängerung als äußeres Kennzeichen der männlichen nicht zur Entwicklung, auch bildet sich an der Unterkieferspitze derselben kein Haken aus. Am auffallendsten weicht die unfruchtbare Seeforelle durch ihre Färbung ab. Ihr grüner oder blaugrauer Rücken erhält nie so dunkle, schwarze Flecke wie der Rücken der fruchtbaren Seeforelle; auch kommen diese Flecke nie so zahlreich, sondern meist in sehr geringer Menge vor. An den Seiten stehen nur sehr wenige, ganz vereinzelte, verwischte schwarze Flecke, die auch oft ganz ausbleiben, so daß alsdann die Kiemendeckel und die Körperseiten einen wunderschönen, durch nichts unterbrochenen silberweißen Glanz von sich geben. Die länger und spitziger ausgezogenen paarigen Flossen sowie die Afterflossen sind farblos und nur selten bei älteren Stücken etwas angeschwärzt; die Rücken- und Schwanzflosse erscheinen dunkelgrau, und die erste ist meistens mit weniger schwarzen runden Flecken besetzt als an den fruchtbaren Stücken.« Die Größe ist sehr bedeutend: Seeforellen von achtzig Zentimeter Länge und zwölf bis fünfzehn Kilogramm Gewicht gehören nicht zu den Seltenheiten; man fängt zuweilen solche von einem Meter Länge und fünfundzwanzig bis dreißig Kilogramm Gewicht.
Mit Gewißheit kann man sagen, daß die beschriebene Art die Seen der Alpen und Voralpen bewohnt und hier in fast allen größeren und tieferen Gewässern bis zu anderthalbtausend Meter unbedingter Höhe sich findet; ebenso läßt sich wohl annehmen, daß Linné, der ihr den Namen gab, schwedische und nicht Schweizer Stücke bei seiner Beschreibung vor sich hatte, als er die Art beschrieb; und endlich dürfen wir glauben, unserer Forelle auch in größeren und tieferen Seen Schottlands wieder zu begegnen. In den Alpenseen hält sie sich regelmäßig in bedeutenden Tiefen auf, selten in Schichten von weniger als zwanzig Klaftern Tiefe und mehr, weil solche die Renken, ihre beliebteste Beute, beherbergen. Zwar verfolgt sie außerdem alle Arten kleinerer Fische, stellt aber doch im Alter vorzugsweise diesen leckeren und schmackhaften Familienverwandten nach, während sie, solange sie noch ziemlich jung ist, insbesondere an die Lauben sich hält. »Treffen Seeforellen«, sagt Heckel, »auf einen Schwarm solcher, so werden sie so hitzig in ihrem Verfolgen, daß sie bis an ganz seichte Uferstellen gelangen. Die Laubenschar fährt pfeilschnell auseinander und sucht durch Sprünge über die Wasserfläche sich zu retten; jedoch vergebens: der nicht minder schnelle Feind packt die Beute zuerst am Schwanz und verschlingt sie mittels einer raschen Wendung, so daß der Kopf voraus hinabgleitet.« Haben sie einmal ein Gewicht von zwölf bis fünfzehn Kilogramm erreicht, so begnügen sie sich nicht mehr mit so kleinen Fischen, sondern machen Jagd auf solche im Gewicht von fast einem Kilogramm.
Gegen Anfang September verlassen sie ihre bisherigen Wohngewässer und steigen in Flüssen auf, um zu laichen. Bei denen, die fruchtbar sind, tritt die Fortpflanzungsfähigkeit schon in früher Jugend ein und bekundet sich wie bei den älteren Stücken durch Änderung der Färbung und Hautbedeckung. Sie nehmen nämlich eine sehr dunkle Färbung an und erscheinen auf der Unterseite vom Kinn bis zum Schwanzende oft wie überschwärzt, auch leuchten die tiefergelegenen Hautschichten orangegelb durch, weshalb solche Stücke, laut Siebold, am Chiemsee den Namen »Goldlachse« erhalten. Die Wanderung geschieht gesellschaftlich; doch pflegen die größeren zuerst zu erscheinen. Aufwärts fördert die Reise wenig, weil es den Fischen, wie es scheint, nicht eben darauf ankommt, bald an Ort und Stelle zu sein. Dennoch steigen sie weit in den Flüssen empor, im Rheingebiete, laut Tschudi, bis zu achthundert Meter über dem Meere, im Gebiete des Inn in viel bedeutendere Höhen, weil sie hier die Seen unter eintausendsechshundert Meter über dem Meere noch bewohnen. In kleine Bäche pflegen sie übrigens nicht einzutreten, zum Laichen vielmehr kiesigen Grund in stark reißenden Strömen oder Flüssen aufzusuchen. Das Eierlegen geschieht in ganz ähnlicher Weise wie bei der Bachforelle. Sie wühlen, während sie sich ihrer erbsengroßen, gelben, klebrigen Eier entledigen, muldenförmige Gruben in den Sand, Fische von etwa zehn Kilogramm Gewicht schon so lange und tiefe, daß dieselben einen liegenden Mann aufnehmen können. Solche Gruben werden von den nachfolgenden Rogenern gern benutzt und sind auch allen Fischern recht wohl bekannt. Geraume Zeit nach vollendetem Laichgeschäft kehren sie zu den Seen zurück, um hier den Winter und den Sommer zu verbringen, während die in demselben oder im vorigen Jahre erzeugten Jungen das Frühjahr und den Sommer hindurch in den Flüssen verweilen und erst im zweiten Winter ihres Lebens nach den Seen sich begeben.
Das Fleisch wird, wie uns schon Geßner belehrt, sehr geschätzt. Der Fang ist sehr bedeutend. Die meisten erbeutet man, wie leicht erklärlich, während ihres Aufsteigens in den Flüssen, die man durch sogenannte Fachten oder geflochtene Wände bis gegen die Mitte hin verengt, um besonders starke Strömung zu erzielen, in der dann der Behren eingesetzt wird. In den Nebenflüssen, wo das Wasser seichter ist, erlegt man die größeren Fische mit der Kugel.
Die nächste Verwandte der Seeforelle ist die Lachsforelle, bezeichnender vielleicht Meerforelle genannt ( Salmo trutta). Ihre große Ähnlichkeit mit der Seeforelle erschwert, scharfe Unterscheidungsmerkmale für beide Arten anzugeben. In der Färbung stimmt die Meerforelle, laut Siebold, mit der Maiforelle fast überein. Ihr blaugrauer Rücken sowie ihre silbrigen Seiten sind nur mit wenigen schwarzen Flecken besetzt, zuweilen ganz ungefleckt, die Unterseite ist reinweiß; die paarigen Flossen und die Afterflosse zeigen sich farblos, die Brustflossen bei älteren Stücken grau, Rücken- und Schwanzflosse dunkelgrau gefärbt; erstere sind durch einzelne schwarze Flecke ausgezeichnet. Wahrscheinlich gibt es auch unter den Lachsforellen unfruchtbare Stücke; wenigstens hält man diejenigen dafür, die sich durch silberhelle Färbung, tief ausgeschnittene Schwanzflosse und die leicht abfallenden Schuppen von den übrigen unterscheiden.
Die Lachsforelle ist dasselbe für die See, was die Seeforelle für die großen Binnengewässer. Das Meer beherbergt sie während des Spätsommers, und von ihm aus steigt sie in die Ströme und Flüsse empor, um zu laichen. Ihr Verbreitungskreis erstreckt sich dementsprechend noch bedeutend weiter als der ihrer Verwandten. Sie bewohnt die Ostsee, das nördliche Atlantische Meer, einschließlich der Meerengen und Kanäle um Großbritannien, die Nordsee und das Eismeer bis zum Weißen Meere hin, tritt an den deutschen Küsten nicht selten, an den skandinavischen, englischen, schottischen, irischen, lappländischen und russischen Gestaden und in den betreffenden Flüssen in außerordentlicher Menge auf. Die Fortpflanzung geschieht genau in derselben Weise wie bei anderen Arten ihrer Sippschaft.
Unter allen deutschen Lachsfischen besitzt die Bachforelle, Wald-, Teich-, Gold- und Schwarzforelle ( Salmo fario), die gedrungenste Gestalt. Ihr Leib ist mehr oder weniger seitlich zusammengedrückt, die Schnauze kurz und sehr abgestumpft, die vordere, kurze Platte des Pflugscharbeines dreieckig, am queren Hinterrande mit drei oder vier Zähnen besetzt, der lange Stiel auf der seicht ausgehöhlten Gaumenfläche mit doppelreihigen, sehr starken Zähnen bewehrt. Über die Färbung etwas Allgemeingültiges zu sagen, ist vollkommen unmöglich. Tschudi nennt die Bachforelle das » Chamäleon unter Fischen«, hätte aber hinzufügen können, daß sie noch weit mehr abändert als dieses wegen seines Farbenwechsels bekannte Kriechtier. Wahrscheinlich kommt man der Wahrheit nahe, wenn man annimmt, daß die so verschiedene Färbung nur ein Widerspiel ist von den herrschenden Farben der Umgebung des Wohngewässers, daß die Forelle uns genau dasselbe erkennen läßt wie die meerbewohnende Scholle, die ihr Kleid dem des Bodens anpaßt.
Lassen wir diese Angabe Geßners durch Tschudi vervollständigen. »Wir sind in Verlegenheit«, sagt Tschudi, »wenn wir die Färbung der Bachforelle angeben sollen. Oft ist der schwärzlich gefleckte Rücken olivengrau, die Seite grünlichgelb, rotpunktiert, goldschimmernd, der Bauch weißlichgrau, die Bauchflosse hochgelb, die Rückenflosse hell gerandet, punktiert; oft herrscht durchweg eine dunklere, selten die ganz schwarze Färbung vor; oft sind die Punkte schwarz, rot und weiß, wie bei manchen in den Alpenseen gefangenen, wobei übrigens auch die Form und Farbe der Augenringe wechselt; oft herrscht die gelbe Färbung vor, oft die rötliche, oft die weißliche, und man pflegt diese Spielarten bald Alpenforellen, bald Silber- und Goldforellen, bald Weiß-, Schwarzforellen, Stein- und Waldforellen zu nennen, ohne daß eine Ausscheidung der außerordentlich vielfältigen, schillernden Übergänge bisher festgestellt wäre. In der Regel aber ist der Rücken dunkel, die Seite heller und punktiert, der Bauch am lichtesten gefärbt. Je reiner das Wasser, desto heller ist meistens die Farbe. Ebenso ist es mit der Farbe des Fleisches, das bei den helleren, gold und rot punktierten Goldforellen rötlich, sonst auch gelblich, in der Regel aber schneeweiß ist und sich durch Kochen nicht verändert. Die Forellen des von Gletscherwasser und aufgespültem Sande beinahe milchfarbenen Weißsees auf dem Bernina sind ohne Ausnahme lichter gefärbt als die der benachbarten, auf torfigem Grunde liegenden Schwarzseen. Das Fleisch beider aber ist gleichmäßig weiß, während das der dunklen berühmten Forellen des Sees von Poschiavo beständig rötlichgelb ist. Man hat die Erfahrung gemacht, daß Forellen mit weißem Fleisch in wenig Sauerstoffgas enthaltendem Wasser rotes Fleisch bekommen, und Saussure erzählt, die kleinen, blassen Forellen des Genfer Sees bekämen rote Punkte, wenn sie gewisse Bäche der Rhône hinaufstiegen; in anderen würden sie ganz schwarzgrün, in anderen blieben sie weiß. Kurz, die Willkürlichkeit und Mannigfaltigkeit dieser Fischfärbung bringt den Beobachter zur Verzweiflung.«
Die Bauch- und Brustflossen der Forelle sind in die Breite gestreckt und abgerundet; die Schwanzflosse ändert ihre Gestalt mit dem Alter: bei jungen Forellen ist sie tief ausgeschnitten, bei älteren senkrecht abgestutzt, bei alten sogar etwas nach außen abgerundet. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen meist durch größeren Kopf und wirre, zahlreiche, aber starke Zähne; auch erhöht und schrägt sich im Alter bei ihnen namentlich die Spitze des Unterkiefers nach aufwärts. Die Größe richtet sich, wie die Färbung, nach dem Aufenthalt. In kleinen, schnellfließenden Bächen, wo sich die Forelle mit wenig Wasser begnügen muß, erreicht sie kaum eine Länge von vierzig Zentimeter und ein Gewicht von höchstens einem Kilogramm, wogegen sie in tieferen Gewässern, in Seen und Teichen, bei reichlichem Futter zu einer Länge von neunzig Zentimeter und darüber und einem Gewicht von fünf bis sechs Kilogramm anwachsen kann. Daß derartige Riesen viele Jahre auf dem Rücken haben, läßt sich mit Bestimmtheit behaupten. Die Fischer sind geneigt, den Forellen ein Alter von höchstens zwanzig Jahren zuzuschreiben; man kennt aber Beispiele, die beweisen, daß sie viel älter werden können. Oliver gedenkt einer, die man achtundzwanzig Jahre im Wallgraben eines Schlosses erhalten und im Verlaufe der Zeit ungemein gezähmt hatte, Mossop einer anderen, die unter ähnlichen Verhältnissen dreiundfünfzig Jahre ausgehalten hat.
Unsere bisher gesammelten Forschungen reichen noch nicht aus, den Verbreitungskreis der Forelle zu begrenzen; doch wissen wir, daß sie an entsprechenden Orten in ganz Europa vom Nordkap an bis zum Vorgebirge Tarifa, ebenso in Kleinasien und wahrscheinlich noch in anderen Ländern dieses Erdteiles gefunden wird. Bedingung für ihr Vorkommen und Leben ist klares, fließendes, an Sauerstoff reiches Wasser. Sie findet sich daher in allen Gebirgswässern, zumeist in Flüssen und Bächen, sodann aber auch in Seen, die von durchströmendem Wasser oder von in ihnen entspringenden reichhaltigen Quellen gespeist werden. Die neuerdings so vielfach angestellten Züchtungsversuche haben zur Genüge ergeben, daß geklärtes Wasser, das regelmäßig in Bewegung gesetzt wird, der Bachforelle genügt, gleichviel ob es frischen Quellen oder Bächen und selbst Teichen entnommen wurde. Im Hochgebirge steigt sie, laut Tschudi, bis zum Alpengürtel empor; höher als zweitausend Meter über dem Meere findet sie sich in der Schweiz indessen nicht. So lebt sie noch im schönen Lucendro-See auf dem Gotthard, dem nur dreißig Meter tiefer die Reuß entströmt, in vielen savoyischen, den meisten rätischen Hochalpenseen, im Murgsee an der Tannengrenze, in dem Alpsee unter dem Stockhorne und überhaupt fast in allen Alpenseen innerhalb des Alpengürtels diesseits und jenseits des Gebirges, jedoch merkwürdigerweise fast immer nur in solchen Seen, die einen sichtbaren Abfluß haben, und seltener in solchen, die unterirdisch durchs Gebirge sich entleeren. Wie sie in jene Hochseen, die in der Regel durch steile Wasserfälle mit dem tieferen Flußgebiete verbunden sind, hinaufgelangte, ist nur bei solchen anzugeben, wo sie, wie im Ober-Olegisee, etwa vierzehnhundert Meter über dem Meere, dem Engstlensee, achtzehnhundert Meter über dem Meere, und anderen, von Menschen eingesetzt wurden. Zwar ist sie ein munterer und lebendiger Fisch und besitzt, wie in heißen Sommertagen überall zu beobachten, große Schnellkraft; ja, Steinmüller versichert sogar, er habe selbst gesehen, wie auf der Mürtschenalp eine Forelle sich über einen hohen Wasserfall hinaufschleuderte und während des Hinaufwerfens einzig ein paarmal sich überwarf; allein es gibt Forellenseen in Menge, wo eine Verbreitung vom Tale herauf durch ein solches Hinaufschleudern geradezu unmöglich ist. Indessen müssen wir doch annehmen, daß der Mensch in dieser Beziehung viel getan hat, daß vor der Reformation für die Fastenzeit weislich vorgesorgt und viel Fischbrut in Seen und Teiche eingesetzt worden. In Tirol steigt sie um drei- bis fünfhundert Meter höher und in den Bächen der Sierra de Gredos oder der Sierra Nevada nachweislich bis zu dreitausend Meter unbedingter Höhe empor, weil hier die Schneegrenze höher liegt.
In den Bächen und Flüßchen unserer Mittelgebirge bemerkt man keinen auffallenden Wechsel des Aufenthaltes. Unweit meines Geburtsortes entspringen in einem zwischen mittelhohen Bergen gelegenen Tale reichhaltige Quellen, die sich zu einem Bache vereinigen, kräftig genug, ein Mühlrad zu treiben. Dieser Quellbach fällt in die Roda und klärt deren zuweilen sehr unreines Wasser. Hier leben seit Menschengedenken Forellen, aber nur auf einer Strecke von höchstens acht Kilometer Länge; denn oberhalb und unterhalb derselben kommen sie regelmäßig nicht mehr vor, und bloß während der Laichzeit geschieht es, daß sie ihren eigentlichen Standort verlassen und in der Roda zu Berge wandern, um Laichplätze zu suchen, obgleich sie solche ebensogut auch innerhalb ihres eigentlichen Standgewässers vorfinden. In reinem Bergwasser ist der Aufenthaltsort selbstverständlich weiter ausgedehnt: zu einem eigentlichen Wanderfische aber wird die Bachforelle in Mitteldeutschland nicht. Anders scheint es in der Schweiz zu sein. Unsere Fische richten eben auch ihre Lebensweise ganz wesentlich nach den Umständen ein.
An Gewandtheit und Schnelligkeit der Bewegung wird die Bachforelle höchstens von einzelnen ihrer Verwandten, schwerlich aber von anderen Flußfischen übertroffen. Wahrscheinlich muß man sie zu den nächtlich lebenden Fischen zählen; alle Beobachtungen sprechen wenigstens dafür, daß sie erst gegen Abend ihre volle Munterkeit entfaltet und vorzugsweise während der Nacht ihrem Hauptgeschäft, der Ernährung, obliegt. Tagsüber versteckt sie sich gern unter überhängenden Ufersteinen oder überhaupt in Höhlungen und Schlupfwinkeln, wie sie das in ihrem Wohngewässer sich findende Gestein bildet; wenn aber ringsum alles ganz ruhig ist, treibt sie sich auch um diese Zeit im freien Wasser umher, unter allen Umständen mit dem Kopf gegen die Strömung gerichtet und hier entweder viertelstundenlang und länger scheinbar auf einer und derselben Stelle verweilend, in Wirklichkeit aber mittels der Flossen soviel sich bewegend, wie zur Erhaltung ihrer Stellung erforderlich, oder aber sie schießt plötzlich wie ein Pfeil durch das Wasser, mit wunderbarer Geschicklichkeit der Hauptströmung desselben folgend und so in seichten Bächen noch da ihren Weg findend, wo man ein Weiterkommen für unmöglich halten möchte. Einmal aufgestört, pflegt sie, falls es ihr nur irgend möglich, sich wieder einem Schlupfwinkel zuzuwenden und in ihm zu verbergen; denn sie gehört zu den scheuesten und vorsichtigsten aller Fische. Flußabwärts gelangt sie auf zwei verschiedenen Wegen, indem sie entweder, den Kopf gegen die Strömung gerichtet, langsam sich treiben läßt, oder indem sie unter Aufbietung ihrer vollen Kraft so schnell durch das Wasser schießt, daß die Raschheit ihrer Bewegung die des letzteren bei weitem übertrifft. Solange sie stillsteht, liegt sie auch auf der Lauer und überblickt sorgfältig ihr Jagdgebiet, das Wasser neben und vor ihr und die Wasserfläche oder Luft über ihr. Naht ein Kerbtier, gleichviel ob es groß oder klein, dem Ort, wo sie steht, so verharrt sie noch immer regungslos, bis es in Sprungweite gekommen, schlägt dann urplötzlich mit einem oder mehreren kräftigen Schlägen der Schwanzflosse das Wasser und springt, in letzterem fortschießend oder über dessen Spiegel sich emporschnellend, auf das ins Auge gefaßte Opfer los. Solange sie jung ist, jagt sie vorzugsweise auf Kerbtiere, Würmer, Egel, Schnecken, Fischbrut, kleine Fische und Frösche; hat sie aber einmal ein Gewicht von einem bis anderthalb Kilogramm erreicht, so wetteifert sie an Gefräßigkeit mit jedem Raubfisch ihrer Größe, steht mindestens dem Hecht kaum nach und wagt sich an alles Lebende, das sie bewältigen zu können glaubt, ihre eigene Nachkommenschaft nicht ausgeschlossen. Gleichwohl bilden auch jetzt noch alle als Larven oder Fliegen im Wasser lebenden Kerbtiere und kleine Kruster den Hauptteil ihrer Mahlzeiten.
Die Fortpflanzungstätigkeit der Forelle beginnt Mitte Oktober und währt unter Umständen bis in den Dezember fort. Schon Fische von zwanzig Zentimeter Länge und einhundertfünfzig Gramm Gewicht sind fortpflanzungsfähig; sehr viele von ihnen aber bleiben unfruchtbar und laichen nicht. Ihre Geschlechtswerkzeuge sind zwar, laut Siebold, deutlich als Hoden und Eierstöcke vorhanden, verharren aber im Zustande der Unreife. Niemals zeigen sich die Eier solcher Forellen größer als Hirsekörner; auch sieht man es den Eierstöcken an, daß sie nie reife Eier von sich gegeben haben. Es lassen sich die unfruchtbaren von den fruchtbaren Forellen auch außer der Laichzeit unterscheiden. Das Laichen selbst geschieht in seichtem Wasser auf Kiesgrunde oder hinter größeren Steinen, da, wo eine rasche Strömung sich bemerklich macht. Den suchenden Weibchen folgen gewöhnlich mehrere Männchen, in der Regel kleinere, und keineswegs allein in der Absicht, sich zu begatten, beziehungsweise die Eier zu besamen, sondern auch, um die vom Weibchen eben gelegten Eier teilweise aufzufressen. Nach Versicherung der Fischer soll der Rogener einen der Milchner mehr begünstigen als die anderen und diese zurückjagen, vielleicht gerade, weil er weiß, daß mehrere männliche Begleiter den Rogen gefährden. Vor dem Legen höhlt er durch lebhafte Bewegungen mit dem Schwanze eine mehr oder minder große, seichte Vertiefung aus, läßt in sie die Eier fallen und macht sodann dem Männchen Platz, das gleichzeitig oder unmittelbar darauf einigen Samen darüberspritzt. Durch weitere Bewegungen mit dem Schwanze werden die Eier leicht überdeckt und nunmehr ihrem Schicksal überlassen. Niemals entledigt sich ein Weibchen aller Eier mit einem Male; das Laichen geschieht vielmehr in Absätzen innerhalb acht Tagen, und zwar, wie aus dem Vorhergegangenen erklärlich, regelmäßig bei Nacht und am liebsten bei Mondschein.
Nach ungefähr sechs Wochen, der herrschenden Witterung entsprechend früher oder später, entschlüpfen die Jungen und verweilen nun zunächst mehr oder minder regungslos, d. h. höchstens mit den stummelhaften Brustflossen spielend, auf der Brutstätte, bis sie ihren anhängenden Dottersack aufgezehrt haben und nunmehr das Bedürfnis nach anderer Nahrung empfinden. Zuerst genügen ihnen die allerkleinsten Wassertierchen, später wagen sie sich an Würmchen, hierauf an Kerbtiere und junge Fischbrut, und mit der Größe wächst ihre Raublust. Drei Monate nach dem Ausschlüpfen sind aus den beim Verlassen des Eies unförmlichen Geschöpfen wohlgestaltete, zierliche Fischchen geworden, die, wie die meisten übrigen Lachse, ein Jugendkleid tragen, auf dem dunkelbraune Querbinden hervorstechen. Um diese Zeit beginnt die Geschwisterschaft sich zu vereinzeln, Versteckplätze aufzusuchen und es mehr oder weniger ähnlich zu treiben wie die Eltern.
Viele Feinde bedrohen und gefährden die junge Brut. Noch ehe die befruchteten Eier ausgeschlüpft sind, richten die Grundfische, vor allen die Quappen, arge Verwüstungen unter ihnen an; der Wasserschwätzer liest wohl eines oder das andere mit auf; selbst die harmlose Bachstelze mag einzelne verzehren. Später, nach dem Ausschlüpfen, nehmen außer den Quappen auch die übrigen Raubfische, insbesondere die älteren Forellen, manches Junge weg, und wenn dieses wirklich so weit gekommen, daß es selbst zum Räuber geworden, hat es in der Wasserspitzmaus, Wasserratte und im Fischotter noch Feinde, denen es nicht gewachsen ist.
Es muß auffallen, daß die Alten, die bekanntlich für Gaumenkitzel sehr empfänglich waren, über die Forelle schweigen, da erst Ausonius in seiner »Mosel« ihrer Erwähnung tut, und es scheint fast, als hätten sie den Fisch nicht gekannt oder nicht zu würdigen verstanden. In späterer Zeit gelangte er zu verdientem Ansehen; denn »die Forellen werden einhellig größlich gepriesen bey allen Nationen, zu jederzeit des Jars, insonderheit im Aprilen vnd Mayen. Summa, die besten Fisch auß den süssen Wassern sind die Fören, also, daß sie auch in allerley Krankheit erlaubt werden«.
Die berechtigte Klage über Abnahme unserer Süßwasserfische gilt leider auch für die Forelle; doch hat man es bei ihr noch am ersten in der Hand, geeignete Gewässer wiederum zu besetzen, sie überhaupt sachgemäß zu schonen und zu züchten. Keine andere Lachsart eignet sich in demselben Grade zum Zuchtfisch wie sie; denn sie gedeiht in quellenreichen Teichen ebensogut wie in Bächen, wächst schnell und liefert ein köstliches Fleisch.
In den Alpseen Mitteleuropas wie des hohen Nordens, in den Bergseen Nordrußlands und Skandinaviens lebt mehr oder minder häufig ein mit vollstem Recht ungemein geschätztes Mitglied unserer Sippe, der Saibling, auch Salbling und Rotforelle genannt ( Salmo salvelinus). In der Färbung wechselt er vielfach ab. Am häufigsten zeigt sich, laut Siebold, folgende Färbung: das Blaugrau des Rückens geht nach den Seilen herab allmählich in ein mehr oder weniger gelbliches Weiß und dieses auf dem Bauche in ein lebhaftes Orangerot über, das namentlich während der Brunstzeit hervortritt; an der Seite des Leibes stehen häufig runde helle Flecke, die in der Nähe des Bauches, je nach der Färbung des letzteren, bald weißlich, bald gelblich, bald orangerot gefärbt sind; solche Flecke kommen zuweilen auch an dem unteren Teil der Rückenflosse vor; bei jungen Saiblingen berühren sie sich zuweilen, und es entsteht dann eine Marmelzeichnung. Das Orangegelb des Bauches kann bis zu Zinnoberrot, der Rücken bis zu Braungrün dunkeln. An Länge kann der Saibling bis zu achtzig Zentimeter, an Gewicht bis zehn Kilogramm erlangen; die gewöhnliche Länge aber beträgt beiläufig dreißig Zentimeter und das Gewicht ungefähr fünfhundert Gramm.
Nur wirkliche Gebirgsseen, in unseren Alpen solche bis zu zweitausend Meter über dem Meere belegene, beherbergen Saiblinge; sie steigen in der Regel nicht einmal während der Laichzeit in den einmündenden Flüssen empor. Wie die Renken halten sie sich in den tiefen Gründen ihrer Wohngewässer aus, und wie diese stellen sie hauptsächlich kleinen Tieren, insbesondere verschiedenen Schmarotzerkrebsen, nach. Nebenbei verschmähen sie übrigens kleinere Fische nicht, und sehr große Saiblinge mögen sich wohl zum guten Teile von diesen ernähren. Die Laichzeit beginnt gegen Ende des Oktober und währt bis Neujahr. Um diese Zeit erheben sie sich zu seichteren Uferstellen und setzen hier ihren Laich ab. Doch geschieht es, laut Yarrell, wenigstens in den schottischen Seen, daß sie unter Umständen auch in Flüsse eintreten und in diesen ein beträchtliches Stück zu Berge gehen, um ihrer Fortpflanzung zu genügen. Ihre Vermehrung ist ziemlich stark, ihr Wachstum minder rasch als bei den Forellen, mit denen sie oft in demselben See zusammenwohnen, ohne sich jedoch freiwillig mit ihnen zu vermischen. Mit Hilfe der künstlichen Fischzucht erzielt man neuerdings vielfach Blendlinge von Forellen und Saiblingen, denen man vortreffliche Eigenschaften, insbesondere schnelleres Wachstum als dem Saiblinge und zartes, schmackhafteres Fleisch, als der Forelle eigen, nachrühmt. Durch die künstliche Fischzucht hat man den Bestand einzelner Seen wesentlich gehoben.
Das Fleisch des Saiblings ist unbestritten das vorzüglichste, das Süßwasserfische uns liefern können, steht daher verdientermaßen in höchster Achtung. Als die Benediktiner Admonts die ihrem Kloster zustehenden Rechte der Fischerei in Steiermark aufgaben, behielten sie sich ausdrücklich alle Seen vor, in denen Saiblinge leben. Für den gebildeten Gaumen verhält sich der Saibling zur Forelle wie diese zum Lachs.
Der Huchen ( Salmo hucho) hat einen langgestreckten, walzenförmigen Leib und ist auf Oberkopf und Rücken grünlich dunkelbraun oder blaugrau, auf dem Bauche silberweiß gefärbt, sodaß ein Ton in den anderen allmählich übergeht; Kopf und Rumpf sind bald mehr, bald weniger mit kleinen dunkelgrauen oder schwärzlichen Pünktchen besetzt, zwischen denen, insbesondere auf dem Scheitel, dem Kiemendeckel und dem Rücken, größere schwarze Flecke stehen; diese Flecke nehmen weiter nach ab- und rückwärts allmählich die Form eines Halbmonds an. Bei sehr alten Fischen geht die Grundfärbung in ein blasses Rot über. Die ungefleckten Flossen zeigen eine weißliche Färbung, die auf Rücken- und Schwanzflosse getrübt erscheint. Die Länge beträgt anderthalb bis zwei Meter, das Gewicht zwanzig bis fünfzig Kilogramm.
Den Huchen haben wir nur aus dem Gebiet der Donau kennengelernt, und es ist sogar wahrscheinlich, daß er ausschließlich in dem Hauptstrome und den ihm aus den Alpen zufließenden Gewässern vorkommt. Zuweilen hat man allerdings auch in den von Norden her der Donau zuströmenden Flüssen einen und den anderen Huchen gefangen; solches Vorkommen aber muß als Ausnahme gelten. In seinem Wesen zeigt er sich als echter Lachs; doch übertrifft er, seiner Größe entsprechend, alle Verwandten an Gefräßigkeit. Davy entnahm einem von ihm erbeuteten einen Aland, eine Asche, einen Alben und zwei kleine Karpfen; Siebold erfuhr von den Fischern, daß sie schon mehrmals Wasserratten beim Ausweiden großer Huchen fanden. Die Laichzeit fällt, abweichend von der seiner Verwandten, in die Monate April und Mai, kann jedoch bei günstiger Witterung auch im März beginnen. Um diese Zeit verläßt er seinen Lieblingsaufenthalt, stark strömendes Wasser, sucht seichte und kiesige Flußstellen auf, wühlt mit dem Schwänze Gruben aus und ist während seines Eierlegens so taub und blind, daß man mit einem Kahne über ihn hinwegfahren kann, ohne ihn zu verjagen. Die Jungen wachsen rasch heran und werden bei zwei Kilogramm Gewicht fortpflanzungsfähig.
Das weißliche Fleisch steht an Wohlgeschmack dem des Lachses merklich nach und wird geringer geschätzt als das der Lachsforelle. Der Fang geschieht mit großen Garnen oder mit der Angel; auch sticht man ihn, wenn er ruhig in der Tiefe steht, oder tötet ihn mit der Kugel. Davy nennt ihn scheu und klug und versichert, daß er nicht zum zweiten Male anbeiße; deshalb bekomme man ihn auch nur während der Laichzeit und im Herbst, nicht aber während des Sommers.
*
Zu den Lachsfischen zählt auch der Stint oder Spierling ( Osmerus eperlanus), Vertreter der Stinklachse ( Osmerus), von den bisher genannten Arten der Familie unterschieden durch Bezahnung und Beschuppung. Zwischen- und Oberkiefer tragen in einfacher Reihe sehr feine Zähne, die Unterkiefer solche in einer äußeren und größere, derbere in einer inneren Reihe, endlich auch starke, spitzige Zähne auf dem Pflugscharbeine, Gaumen und Flügelbeine. Die Schuppen sind mittelgroß, zart und lose eingesetzt. Hinsichtlich der Umrisse des Leibes und Kopfes, der Größe und der Färbung ändert der Stint bedeutend ab. Der Rücken ist gewöhnlich grau, die Seite silberfarben mit bläulichem oder grünlichem Schimmer, der Bauch rötlich. Die Länge schwankt zwischen dreizehn und zwanzig Zentimeter; ausnahmsweise findet man übrigens auch Stücke, die fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter lang sind.
Nord- und Ostsee scheinen diesen Fisch am häufigsten zu beherbergen; doch kommt er noch im Ärmelmeere nicht selten vor und hat sich ebenso in den Haffen und größeren Süßwasserseen in mehr oder minder bedeutender Anzahl angesiedelt. Diejenigen, die im Meere wohnen, unterscheiden sich von denen, die in Landseen herbergen, nicht allein durch bedeutende Größe, sondern auch durch Eigenheiten ihrer Lebensweise. Die einen wie die anderen treten in Deutschland lückenhaft und in verschiedenen Jahren in erheblich schwankender Anzahl auf. Besonders häufig erscheint der sogenannte Seestint in den Mündungen der Elbe und Weser, selten dagegen an der ganzen holsteinischen, mecklenburgischen und pommerschen Küste, wogegen er im Kurischen Haff meist in außerordentlicher Menge sich einfindet. Das letztgenannte Haff bevölkert aber auch der sogenannte Flußstint, der anderswo nicht in die See geht und insbesondere die Landseen Ostpreußens, Pommerns, Brandenburgs, Mecklenburgs und Holsteins bewohnt. Der eine wie der andere bildet stets zahlreiche Gesellschaften, hält sich während des Winters in der Tiefe der Gewässer verborgen und erscheint erst im März und April in den oberen Schichten der Gewässer, um behufs der Fortpflanzung eine Wanderung in die Flüsse anzutreten. Die Laichgesellschaften wandern nicht so weit wie die größeren Lachse, aber doch immerhin bis in das Herz der Binnenländer, gehen z. B. in der Elbe bis Anhalt und Sachsen, in der Weser bis Minden, in der Seine bis Paris stromaufwärts. In manchen Jahren erscheinen die aus der See kommenden in unschätzbarer Menge in den Flußmündungen und Haffen, zu anderen Zeiten treten sie wiederum nur spärlich auf, ohne daß man hierfür durchschlagende Gründe anzugeben wüßte. Laut Beerbohm ziehen sich andere Fische, Aale und Kaulbarsche ausgenommen, aus dem Kurischen Haff zurück, wenn die hier lebenden Stinte massenhaft auf den Laichplätzen sich einfinden. Zu Anfang des April legen letztere ihre kleinen gelben Eier auf sandigen Stellen ab und kehren nach dem Meere oder nach den Seen zurück. Bleibender Hochwasserstand befördert gedeihliche Entwicklung der Eier; Zurücktreten der Laichgewässer läßt Milliarden von Eiern nicht zum Ausschlüpfen gelangen. Geht alles gut, so folgen den alten Stinten im August die jungen, verweilen aber, wenn sie der See sich zuwenden, laut Yarrell, noch eine Zeitlang in der Nähe der Strommündungen, mit der Flut in den Fluß emporsteigend, mit der Ebbe gegen das Meer hin zurückkehrend.
Während seines Aufsteigens in den Flüssen wird der Stint oft in unglaublicher Menge gefangen und massenweise auf die Märkte gebracht, findet hier auch willige Abnehmer, weil sein Fleisch einen trefflichen Geschmack besitzt. Der Fang wird auf sehr verschiedene Weise betrieben und liefert eigentlich immer Ertrag, weil man, dank der unendlichen Menge dieser Fische, jedes engmaschige Netz mit Erfolg verwenden kann.
*
Unter dem Namen Renken ( Coregonus) verstehen wir mittelgroße und kleine Lachsfische mit seitlich etwas zusammengedrücktem Leib, kleinem, engem, zahnlosem oder mit sehr feinen, vergänglichen Zähnen bewehrtem Maule, mittelgroßen, leicht abfallenden Schuppen, kleiner Fettflosse und einer dicht vor den Bauchflossen beginnenden hohen Rückenflosse. Die zu dieser Sippe zählenden Lachse, die in namhafter Anzahl an Arten und Einzelstücken die Gewässer der nördlichen Halbkugel bewohnen, ähneln sich in Gestalt und Lebensweise so außerordentlich, daß sie trotz der sorgsamsten Untersuchungen noch keineswegs mit genügender Sicherheit je nach Art oder Spielart unterschieden werden konnten. Das verborgene Leben dieser Fische, die nur zu gewissen Zeiten aus den tiefen Gründen, in denen sie sich umhertreiben, aufsteigen, um ihren Laich abzusetzen, die Schwierigkeit, unerwachsene Junge zu erlangen, und die Ähnlichkeit der als wirklich verschieden erkannten Arten erklären die vorsichtige Zurückhaltung, der sich gegenwärtig unsere Forscher befleißigen, wenn sie von den Renken sprechen. Ich lege im Folgenden Siebolds Untersuchungen zugrunde und beschränke mich auf die Beschreibung der europäischen Glieder der Sippe.
Der Blaufelchen ( Coregonus wartmanni) ist gestreckter gebaut als alle übrigen deutschen Renken, der Kopf verhältnismäßig klein und niedrig, die dünne Schnauze an der Spitze senkrecht abgestutzt, der Mund klein, bis auf die mit feinen Hechelzähnen besetzte Zunge zahnlos, die Rückenflosse höher als lang, das Kleid aus großen, zarten, leicht abfallenden Schuppen zusammengesetzt. Oberkopf und Rücken zeigen auf hellblauem Grunde silbernen Glanz, die Seiten des Kopfes und des Bauches nur den letzteren; die Seitenlinien sind schwärzlich punktiert, die Flossen gelblichweiß, breit schwarz gesäumt. An Gewicht kann unser Fisch ein bis zwei Kilogramm erreichen.
Der Blaufelchen bewohnt die meisten größeren schweizerischen, bayrischen und österreichischen, auf der Nordseite der Alpen und Voralpen gelegenen Seen, fehlt aber in einigen derselben, so z. B. im Königs- und Schliersee; es kommen jedoch auch in den schwedischen und britischen Seen Renken vor, von denen es noch fraglich ist, ob sie mit dem Blaufelchen als gleichartig angesehen werden müssen oder, wie die nordischen Kundigen annehmen, artlich sich unterscheiden.
Für gewöhnlich halten sich die Blaufelchen, wie die meisten ihrer Verwandten überhaupt, in den tiefsten Gründen der Seen auf, nicht selten in Tiefen von hundert Faden unter der Oberfläche, ausnahmsweise nur in Wasserschichten zwischen zwanzig bis fünfzig Faden Tiefe. In die Flüsse treten sie niemals ein, wandern also auch nicht von einem See zum anderen. Die Nahrung besteht hauptsächlich aus sehr kleinen Wassertieren, die in der Tiefe der Binnenseen leben und von denen viele erst durch Untersuchung des Mageninhalts den Forschern bekannt geworden sind. Außerdem fressen unsere Fische von dem auf dem Grunde der Seen befindlichen Schleime, der aus den niedersten Gebilden der Pflanzen- und Tierwelt in deren ersten Entwicklungszuständen gebildet wird. Zu ihrer Beute zählen auch kleine Krebse, Wasserschnecken, Würmer und Kerbtierlarven.
Während der Laichzeit gebaren sich die Blaufelchen ganz in ähnlicher Weise wie die Heringe. Der Fortpflanzungstrieb beschäftigt sie derartig, daß sie ihre bisher gewohnte Lebensweise völlig umändern. Wie andere Lachse auch, fressen sie, laut Siebold, vor und während der Laichzeit wochenlang nicht das geringste. Ihre Eingeweide schrumpfen demzufolge außerordentlich zusammen und sehen, weil sich Umfang und Verhältnis der einzelnen Teile wesentlich verändern, ganz anders aus als während der Jagd- und Freßzeit. Je nach der Witterung, die das Eintreten der Laichzeit beeinflußt, erscheinen sie von Mitte November an bis in den Dezember, also innerhalb eines Zeitraumes von etwa drei Wochen, in zahllosen Gesellschaften an der Oberfläche der Seen, bald so dicht am Wasserspiegel, daß ihre Rückenflossen sichtbar sein können, bald, zurückgeschreckt durch die Kälte der oberen Schichten, Schneegestöber, Eisplatten und dergleichen, mehrere Meter unter dem Spiegel, drängen sich so eng zusammen, daß sie sich gegenseitig durch die Reibung beschädigen, die Hautwucherungen und selbst die Schuppen abreiben und mit ihnen das Wasser streckenweise bedecken und trüben. »Am Neuenburger See«, erzählt Karl Vogt, »war ich oft Augenzeuge des Laichens dieser Fische, wenn sie den seichteren Uferstellen sich genähert hatten. Sie hielten sich paarweise zusammen und sprangen, Bauch gegen Bauch gekehrt, meterhoch aus dem Wasser empor, wobei sie Laich und Milch zu gleicher Zeit fahren ließen. In mondhellen Nächten, wenn viele Fische laichen, gewährt das blitzschnelle Hervorschießen der silberglänzenden Tiere ein höchst eigentümliches Schauspiel«. Die befruchteten Eier sinken langsam in die Tiefe hinab.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese Art der Befruchtung nur höchst ungenügende Ergebnisse liefern kann, daß von den Millionen Eiern, die gelegt werden, bloß ein geringer Teil besamt wird und zur Zeitigung gelangt. Demungeachtet ist die Vermehrung der Blaufelchen bedeutend; wenigstens hat man bis jetzt noch keine wesentliche Abnahme ihrer Menge bemerkt.
Aus den Züchtungsversuchen Karl Vogts geht übrigens hervor, daß sich der Blaufelchen mit Sicherheit und ohne besondere Schwierigkeiten in Seen, die ihn gegenwärtig noch nicht beherbergen, ansiedeln läßt. Dank dem Aufschwunge, den die künstliche Fischzucht gegenwärtig genommen, hält es nicht schwer, von Schweizer Fischern eine genügende Anzahl befruchteter Eier zu erlangen und aus diesen die zur Besetzung eines Sees nötige Brut zu erzielen. Wartmann bemerkt sehr richtig, daß die Blaufelchen für den Bodensee dasselbe sind, was der Hering für das Nordmeer ist.
In denselben Seen, die den Blaufelchen beherbergen, lebt die Bodenrenke ( Coregonus fera), von jenem unterschieden durch kürzere und stumpfe Schnauze und kürzeren und gedrungeneren Schwanz, weniger durch die Färbung, die im ganzen mit der des Blaufelchen übereinstimmt, nur daß die dunkle Farbe des Rückens nicht so lebhaft und mehr auf die Oberseite beschränkt ist. An Größe übertrifft diese Art den Blaufelchen oft bedeutend. Auch diese Form variiert sehr. Eine ihrer Varianten, der Kilch ( Coregonus acronius), hat man sogar als eigene Art beschrieben. Herausgeber.
Zu ihrem Aufenthaltsort wählt die Bodenrenke, die man mit Hilfe der künstlichen Fischzucht auch in geeignete Seen Preußens, Posens und Polens verpflanzt hat, eine Tiefe von etwa vierzig Faden, obwohl auch sie unter Umständen in die untersten Gründe der Seen hinabsteigt. Die Nahrung besteht in den beim Blaufelchen genannten Tieren; doch soll sie in den Sommermonaten öfters an die Oberfläche kommen, um Kerbtiere wegzuschnappen. Dabei geschieht es, daß sich die Luft in der Schwimmblase zu rasch ausdehnt, sie demzufolge an die Oberfläche des Wassers geworfen und hier eine Zeitlang festgehalten wird, nachher aber, wie Schinz versichert, wieder in die Tiefe hinabzutauchen vermag. Wird sie beim Fange jählings emporgeholt, so findet genau dasselbe statt, und sie erwirbt sich dann den Namen »Kröpfling«, weil sich ihre Bauchhöhle, besonders der geräumigere und nachgiebigere Vorderteil derselben, kropfartig erweitert. Während des November steigt die Bodenrenke zum Laichen empor und begibt sich an seichte Uferstellen des Sees, am liebsten auf die sogenannten Halden, da, wo die Untiefen in die Tiefen übergehen. Hier wird der Laich auf steinigem oder kiesigem Grund abgesetzt, und darauf bezieht sich der Name Bodenrenke oder Sandfelchen.
Hinsichtlich der Güte des Fleisches sind die Ansichten verschieden. Einige ziehen die Bodenrenke dem Blaufelchen vor, andere halten diesen für besser. Letzteren schließt sich Siebold an, der behauptet, daß jener Fleisch an Güte und Zartheit dem des Blaufelchens bei weitem nachsteht und deshalb auch weniger geachtet wird.
Noch konnte nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob die Maräne, welche den zwischen Stettin und Stargard gelegenen Madüsee und den Schaalsee im Lauenburgischen bewohnt und von ersterem aus in verschiedenen Seen Brandenburgs und Pommerns eingebürgert wurde, als besondere Art oder nur als Spielart der Bodenrenke angesehen werden muß. Gestalt und Lebensweise scheinen für letzteres zu sprechen; die Unterschiede, welche man zwischen den beiden verwandten Fischen festgestellt hat, sind gering.
Die große Maräne ( Coregonus maraena) unterscheidet sich, laut Siebold, nur in den Umrissen der Schnauze etwas von der Bodenrenke Süddeutschlands; ihr Mundteil ist um vieles gedrungener und breiter, die beiden Zwischendeckel steigen nicht schräg nach unten und hinten hinab; die beiden Oberkieferknochen erscheinen etwas länger als bei dieser. Die Färbung beider Fische ist dieselbe; der Rücken sieht bläulich, der Bauch silberfarben aus, die Seitenlinie ist mit weißen Tüpfeln gezeichnet. Die Länge beträgt sechzig Zentimeter und darüber, das Gewicht sieben bis acht Kilogramm.
Wie die Bodenrenke lebt die Maräne stets in sehr bedeutenden Tiefen der Seen und verläßt diese nur um die Mitte des November, ihre Laichzeit, und wie jene wählt sie sich zur Ablage der Eier verhältnismäßig seichte Stellen in geringer Entfernung vom Ufer. Ihre Nahrung besteht in ähnlichen Tieren, wie die anderen Renken sie fressen.
Der Fang geschieht hauptsächlich im Winter unter dem Eise mit sehr großen Netzen, in manchen Jahren auch im Frühling und ebenso im Herbst. Die erbeuteten Fische sterben außer dem Wasser sofort ab, lassen sich aber doch, in Schnee oder Eis gepackt, ziemlich weit versenden oder werden wie die Bodenrenke eingesalzen und geräuchert. Im Frühjahr gilt ihr Fleisch als besonders schmackhaft.
An dem vorstehenden Unterkiefer, der das Kinn zur Spitze der Schnauze macht, läßt sich die Zwergmaräne ( Coregonus albula) von allen Verwandten Mitteleuropas unterscheiden. Die Färbung ist dieselbe wie bei diesen: der Rücken erscheint blaugrau, Seiten und Bauch sind glänzend silberweiß; Rücken- und Schwanzflosse sehen grau, die übrigen weißlich aus. Die Länge beträgt gewöhnlich nur fünfzehn bis zwanzig, kann jedoch ausnahmsweise bis auf fünfundzwanzig Zentimeter und etwas darüber ansteigen. In Deutschland wird die Zwergmaräne, die auch Kleinmaräne genannt wird, vorzugsweise in den posenschen, oft- und westpreußischen, pommerschen, schlesischen, brandenburgischen, mecklenburgischen und holsteinischen Seen gefunden.
In ihren Sitten und Gewohnheiten ähnelt die Zwergmaräne den Verwandten. Außer der Laichzeit hält sie sich nur in der Tiefe der Seen auf; in den Monaten November und Dezember erscheint sie in dichtgedrängten Scharen an der Oberfläche, bewegt sich unter weit hörbarem Geräusch, wandert auch wohl, durch die größere Wasserfläche desselben angezogen, von einem See in den anderen über. Ihre Eier läßt sie ins freie Wasser fallen. Ungünstige Witterung ändert auch ihr Betragen während der Fortpflanzungszeit mehr oder weniger.
Mit Recht gilt sie als ein ausgezeichnet schmackhafter Fisch, der die auf seinen Fang verwandte Mühe wohl rechtfertigt. In Pommern und Mecklenburg fängt man sie hauptsächlich im Winter unter dem Eis, in Masuren zumeist während ihrer Wanderung von einem See zum anderen. Die erbeuteten werden, wenn Eis oder Schnee vorhanden, in dieses gepackt auf weithin versendet oder sorgfältig von den Schuppen gereinigt, ausgeweidet, in kaltem Wasser abgewaschen, eine Nacht in Salzlake gelegt, sodann an dünne Holzstäbe gespießt und hierauf etwa acht oder zehn Stunden geräuchert, bis sie eine goldgelbe oder bräunliche Färbung angenommen haben. Wo man keine Rauchöfen hat, bedient man sich großer Tonnen zum Räuchern. Früher als andere Edelfische hat man die Zwergmaräne in Seen, denen sie fehlte, eingebürgert und mit Erfolg gezüchtet.
Zu den im Meer lebenden und von hier aus während der Laichzeit regelmäßig in den Flüssen aufsteigenden Renken gehört der Schnäpel, Maifisch und Düttelmann ( Coregonus oxyrhynchus), eine an der weit über dem Unterkiefer vorragenden, nach vorn in eine weiche, kegelförmig verlängerte Schnauze übergehenden Kinnlade leicht kenntliche Art der Sippe von vierzig bis fünfzig, höchstens sechzig Zentimeter Länge, dreiviertel bis einem Kilogramm Gewicht und bläulicher, während der Laichzeit bläulichschwarzer Färbung.
Nord- und Ostsee müssen als die Heimat des Schnäpels betrachtet werden. Von ihnen aus tritt er im Mai, also schon lange vor der Laichzeit, die in die Monate September bis Dezember fallen soll, in mehr oder minder zahlreicher Menge in die mit dem Meere zusammenhängenden Haffe, Ströme und Flüsse ein, um zu Berge zu ziehen. Diese Wanderungen sollen mit einer gewissen Regelmäßigkeit geschehen und die Wandernden, wie die Kraniche, in ein Dreieck sich ordnen; die Reise selbst soll jedoch äußerst langsam vor sich gehen und die Züge binnen vierundzwanzig Stunden kaum mehr als vier Kilometer zurücklegen. Bei ungünstiger Witterung versenken sich die Schnäpel in die Tiefe und rasten; später sammeln sie sich wieder, um ihre Reise fortzusetzen. Diese unterscheidet sich von der der Lachse dadurch, daß die Schnäpel selten weit in den Flüssen aufsteigen, in der Elbe beispielsweise höchstens die Magdeburger und Torgauer Gegend, in der Weser den Zusammenfluß der Werra und Fulda, im Rhein die Höhe von Speier erreichen. Nach dem Laichen kehren sie früher oder später ins Meer zurück, und die Jungen folgen den Alten, wenn sie eine Länge von acht Zentimeter haben, erscheinen auch erst nach erlangter Reife wieder.
Das weiße, zarte und schmackhafte Fleisch des Schnäpels wird sehr geschätzt und ebensowohl frisch wie eingesalzen und geräuchert genossen; der Fisch bildet daher in ganz Norddeutschland einen wichtigen Gegenstand des Fanges.
*
Die weit vor den Bauchflossen beginnende, sehr große, durch Höhe und Länge ausgezeichnete Rückenflosse, die mittelgroßen, steifen, festsitzenden Schuppen, die kleine Mundspalte und die seine Bezahnung der Kiefer-, Pflugschar- und Gaumenbeine gelten als die Merkmale der Äschen ( Thymallus), die in unseren Gewässern vertreten werden durch die weitverbreitete Äsche ( Thymallus vulgaris). Der Kopf ist klein; der Oberkiefer steht über dem unteren vor; die Rückenflosse übertrifft die Afterflosse um das Doppelte an Länge. Die Färbung ändert je nach Aufenthalt, Jahreszeit und Alter bedeutend ab. Auf der Oberseite herrscht gewöhnlich ein grünliches Braun vor, das auf den Seiten in Grau und aus der Bauchseite in glänzendes Silberweiß übergeht; der Kopf ist oben bräunlich, seitlich auf gelblichem Grund schwarz gefleckt, und diese Fleckung setzt sich auch auf der vorderen Seite über einen Teil des Leibes fort oder ordnet sich mit den Schuppenreihen in bräunlichgraue Längsstreifen. Die Rückenflosse prangt in prachtvollem Farbenspiel und trägt zum Schmuck des Fisches wesentlich bei; ihre Grundfärbung ist ein lebhaftes Purpurrot, das gleichsam einen Spiegel bildet und durch drei oder vier schwarze Fleckenbinden noch besonders hervorgehoben wird; die paarigen Flossen sehen schmutzig gelbrot, After- und Schwanzflosse violett aus. Die Länge beträgt meist wenig über dreißig, kann jedoch bis sechzig Zentimeter ansteigen. Das Gewicht schwankt zwischen dreiviertel bis anderthalb Kilogramm.
Unter den europäischen Lachsfischen gehört die Asche zu den verbreitetsten Arten; denn sie kommt in ganz Mittel- und Osteuropa, in den Gewässern der Alpen wie in denen der norddeutschen und russischen Ebenen, auf dem Festlande wie in Großbritannien und ebenso im Obgebiete vor, wenn auch hier einzig und allein in Gebirgsflüssen und Bächen. Zu ihrem Aufenthalt wählt sie sich ungefähr dieselben Gewässer, wie sie die Forelle liebt; aber nicht in allen Bächen, die Forellen enthalten, kommen Aschen vor und umgekehrt. In der Schweiz hegt man die Ansicht, sie vertreibe die Forelle.
Die Äsche ist ein echter Flußfisch, der Seen und große Teiche meidet, ja in stillstehenden Gewässern, nach Versuchen, die man in England angestellt hat, gar nicht gedeiht, wenigstens nicht zur Fortpflanzung gelangt. In den Gebirgswässern fehlt sie selten; in der Ebene hingegen findet sie sich nur da, wo ein klarer, nicht allzu tiefer Fluß oder Bach mit steinigem Grund vorhanden ist. Sie liebt Flüsse, die weder zu kaltes noch zu warmes Wasser haben, in denen rasche Strömungen und ruhige Stellen miteinander abwechseln, und deren Grund aus Kies, Mergel oder Lehm besteht, scheut sich auch vor trüben Gewässern nicht, steigt aber minder hoch als die Forelle zu Berge. Ihre Sitten haben mit denen der Bachforelle viel Ähnlichkeit. Wie diese schwimmt sie ungemein rasch dahin, wenn sie sich bewegt, und wie diese steht sie, den Kopf gegen die Strömung gerichtet, stundenlang auf einer und derselben Stelle, oft so ruhig und fest, daß man sie mit den Händen aus dem Wasser nehmen kann. Ihre Nahrung besteht aus den Larven verschiedener Wasserkerfe und in letzteren selbst; auch nimmt sie kleine Wasserschnecken und Muscheln zu sich, verschmäht ebenso Gewürm und verschont selbst Fischbrut nicht. Wie die Forelle springt sie nach vorüberschwirrenden Kerfen über den Wasserspiegel empor, geht deshalb auch leicht an die Angel. Während der Laichzeit prangt sie in einem Hochzeitskleid, welches durch erhöhte Schönheit aller Farben und einen über die ganze Hautoberfläche verbreiteten, goldgrün schimmernden Glanz sich auszeichnet und wohl größtenteils in der jetzt wie bei andern Lachsen vermehrten Hauttätigkeit seine Erklärung finden mag. In günstigen Frühjahren beginnt sie schon im März mit dem Eierlegen; bei ungünstigem Wetter verzögert sich dieses Geschäft bis zu Ende April. Das Paar, das jetzt regelmäßig sich zusammenhält und innerhalb eines verhältnismäßig kleinen Gebietes auf- und niederschwimmt, wühlt auf sandigem Grund mit der Schwanzflosse Gruben aus; das Weibchen setzt in ihnen die Eier ab, das Männchen befruchtet diese, und beide gemeinschaftlich überdecken dann die Eier wieder mit Sand und kleinen Steinchen. Die Jungen kriechen gewöhnlich im Juni aus und halten sich anfänglich auf den seichtesten Stellen der Gewässer, wachsen aber sehr rasch und nehmen bald die Lebensweise der Alten an.
Viele Feinde, namentlich die größeren Artverwandten und manche Wasservögel, stellen den Äschen nach, und zwar fast ebenso eifrig wie der Mensch, der ihr Fleisch dem der Forelle an Güte gleichschätzt und sie mit Recht zu den besten Leckerbissen zählt.
*
Alle zur Familie der Hechte ( Esocidae) gehörigen Arten bewohnen das Süßwasser, und die meisten von ihnen führen annähernd dieselbe Lebensweise wie unser Hecht ( Esox lucius), der gefürchtetste Räuber der europäischen Seen und Flüsse, der »Hai der Binnengewässer«. Die Sippe, die er vertritt, kennzeichnet sich durch vollständige Bezahnung und kleine, festsitzende Schuppen; die Nebenkiemen sind unsichtbar, die Bauchflossen in der Mitte des Bauches, die Rücken- und Afterflosse am Ende des Leibes unweit der sehr großen, etwas in der Mitte ausgeschnittenen Schwanzflosse angesetzt. Besonders bezeichnend für den Hecht sind außerdem der niedergedrückte Kopf und die breitschnäblige, weitgespaltene Schnauze. In Färbung und Zeichnung ändert unser Fisch außerordentlich ab, und es läßt sich im allgemeinen nur angeben, daß der Rücken schwärzlich, die Seite grau und der Bauch weiß, ersterer mehr oder weniger gleichfarbig, die Seite in Gestalt von Marmel- oder Querflecken gezeichnet und der Bauch mit schwarzen Tüpfeln besetzt ist. Brust- und Bauchflossen sehen rötlich, Rücken- und Afterflosse bräunlich aus; die Schwanzflosse trägt am oberen Rande gewöhnlich schwarze Flecke. An Länge gibt der Hecht keinem Lachsfisch, an Gewicht höchstens dem Lachs und Huchen etwas nach; seine Länge kann bis zwei Meter, sein Gewicht bis zu fünfunddreißig Kilogramm ansteigen, obschon Hechte von einhundertdreißig Zentimeter Länge und fünfundzwanzig Kilogramm Gewicht als seltene Erscheinungen bezeichnet werden müssen.
Der Hecht findet sich in allen Süßgewässern Europas, hier und da wohl auch in der See, laut Pallas, ebenso im Kaspischen wie im Eismeer, nach unseren Erfahrungen mindestens im unteren Ob. In den Alpen steigt er bis zu fünfzehnhundert Meter unbedingter Höhe, in den Gebirgen des südlichen Europa wohl noch höher empor. Selten ist er nirgends, in den meisten Gegenden vielmehr häufig, kaum irgend sonstwo aber so gemein wie im Ob und seinen Zuflüssen, die für ihn alle Bedingungen zum Wohlleben in sich vereinigen. Er weiß sich aber auch je nach des Ortes Gelegenheit einzurichten und scheint sich in einem seichten, sumpfigen Gewässer ebenso wohl zu fühlen wie in einem tiefen, klaren See. Kraft und Gewandtheit im Schwimmen, bemerkenswerte Sinnesschärfe und ungewöhnliche Raubsucht sind seine hervorstechendsten Eigenschaften. Er durchschwimmt, vorwärts getrieben von dem mächtigen Ruder, an dessen Bildung Rücken- und Afterflosse teilnehmen, wie ein Pfeil die Wogen, lugt scharf nach allen Seiten hin und stürzt sich auf die Beute mit einer fast unfehlbaren Sicherheit. Seine Gefräßigkeit übertrifft die aller andern Süßwasserfische. Ihm ist nichts zu schlecht. Er verschlingt Fische aller Art, seinesgleichen nicht ausgenommen, außerdem Frösche, Vögel und Säugetiere, die er mit seinem weitgeöffneten Rachen umspannen kann, packt, wie eine in England angestellte Beobachtung beweist, den untergetauchten Kopf des Schwanes, läßt nicht los, so viel auch der stolze und kräftige Vogel sich sträuben mag, und erwürgt ihn, kämpft mit dem Fischotter, schnappt nach dem Fuße oder der Hand der im Wasser stehenden oder sich waschenden Magd, vergreift sich in blinder Gier sogar an größeren Säugetieren. »Zu Zeiten hat es sich begeben«, erzählt Geßner, »daß einer ein Maulthier in den Rotten getrieben hat zu trinken: als nun das Maulthier oder Maulesel getrunken, hat ein Hecht im sein vnder Lefftzen erbissen, also daß das Maulthier erschrocken von dem Wasser geflohen, den Hecht an der Lefftzen herausgezogen vnd abgeschüttelt hat, der vom Maultreiber lebendig gefangen vnd heym getragen worden.« Junge Gänse, Enten, Wasserhühner und dergleichen hat man oft in seinem Magen gefunden, auch Schlangen, nicht aber Kröten. Fische mit stacheligen Rückenflossen, wie den Barsch, verschluckt er nicht sogleich, sondern hält sie zwischen den Zähnen, bis sie tot sind; den Stichling dagegen läßt er ruhig um sich spielen und wagt nicht, ihn anzugreifen, hat auch Ursache zu solcher Vorsicht: denn Bloch fand einen jungen, unerfahrenen Hecht mit einem Stichling im Maul, dessen Rückenstachel den Gaumen durchbohrt hatte und bei den Nasenlöchern hervorragte. Von der Nahrungsmenge, die der Hecht verbraucht, gewinnt man erst eine Vorstellung, wenn man den Räuber in Gefangenschaft hält und seinem ewigen Heißhunger zu genügen sucht. »Acht Hechte«, erzählt Jesse, »jeder von etwa zwei Kilogramm Gewicht, verbrauchten binnen drei Wochen gegen achthundert Gründlinge. Ihre Freßluft war geradezu unersättlich. Eines Morgens warf ich einem von ihnen nacheinander fünf etwa zehn Zentimeter lange Plötzen vor. Er verschlang vier von diesen, packte auch die fünfte, bewahrte sie eine Zeitlang in seinem Rachen und ließ sie sodann ebenfalls verschwinden.« Kein Wunder, daß das Wachstum dieser Tiere bei solcher Gefräßigkeit ungemein fördert, daß sie bereits im ersten Jahre ein, im folgenden bis zwei, bei genügender Nahrung sogar bis vier oder fünf Kilogramm erreichen.
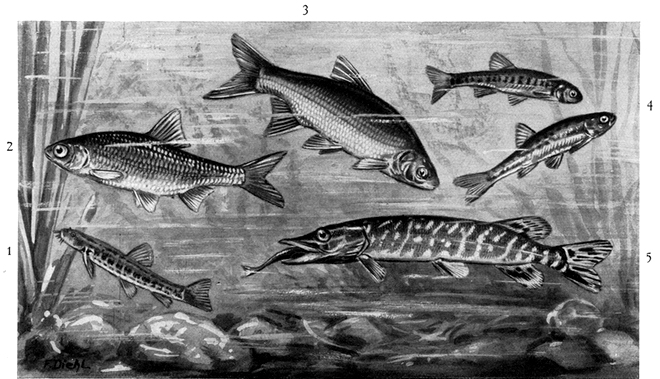
Ihre Laichzeit fällt in die ersten Monate des Frühjahrs, beginnt oft bereits im Anfang März, kann sich aber auch bis zum Mai verzögern. Beeinflußt von dem Fortpflanzungstrieb, ist der sonst ziemlich vorsichtige Hecht taub und blind und läßt sich mit den Händen fangen. In einem Weibchen von vier Kilogramm Gewicht hat man gegen einhundertfünfzigtausend Eier gezählt. Diese werden auf seichten, mit Rohr und anderen Wasserpflanzen bewachsenen Stellen der Gewässer abgelegt und sind bereits nach wenigen Tagen gezeitigt. Von den Jungen findet ein guter Teil in dem Magen älterer Hechte ihr Grab, ein anderer, vielleicht kaum geringerer, fällt den Geschwistern zum Opfer, die um so schneller heranwachsen, je mehr sie Nahrung finden. Man sagt, daß sie ein sehr hohes Alter erreichen können: frühere Schriftsteller sprechen von Hechten, die über Hundert Jahre alt geworden sein sollen.
Zu der Römer Zeiten stand das Fleisch des Hechtes in geringem Ansehen:
»Hier auch hauset, belacht ob der römischen Mannesbenamung,
Stehender Teiche Bewohner, der Erbfeind Nagender Frösche,
Lucius oder der Hecht, in Löchern, die Röhricht und Schlamm rings
Dunkelnd umwölbt; er, nimmer gewählt zum Gebrauche der Tafeln,
Brodelt, wo mit ekelem Qualm Garküchen verdumpft sind«,
so läßt sich Ausonius über ihn vernehmen. In späterer Zeit gewann man anders Anschauung, und jahrhundertelang galt, in England wenigstens, das Fleisch des Hechtes für besser als das des Lachses. Auch gegenwärtig noch hält man einen gut zubereiteten Hecht in Ehren, und verfolgt den Raubfisch dementsprechend nicht bloß des Schadens halber, den er anrichtet. Verschieden ist die Art und Weise des Fanges. Außer Netz und Reuse wendet man hauptsächlich die Angel an.
Zur Teichwirtschaft eignet sich der Hecht vorzüglich, vorausgesetzt, daß man ihn da unterbringt, wo er nicht schaden kann, oder ihm genügenden Vorrat an Fischen gewährt. Er verträgt hartes wie weiches Wasser, darf jedoch nicht während der Laichzeit eingesetzt werden, weil er zu dieser Zeit leicht absteht. In Karpfenteichen hält man ihn, damit er die trägen Karpfen aufrührt; doch muß man vorsichtig sein und nur kleine Hechte einsetzen, die nicht schaden können, beim Ausfischen des Teiches auch sorgfältig sie aufsuchen und entfernen.
*
Zu der von Johannes Müller aufgestellten Familie der Trughechte ( Scomberesocidae) gehört der Hornhecht ( Belone vulgaris), die bekannteste, weil über alle europäischen Meere und weiter verbreitete Art der gleichnamigen Sippe ( Belone). Er erreicht eine Länge von einem Meter und darüber, bei selten mehr als einem Kilogramm Gewicht, und ist auf der Oberseite bläulichgrün, auf der unteren Seite silberweiß gefärbt. Der Leib ist aalartig gestreckt, die Zwischenkiefer sind zu einem langen, beiderseits mit spitzigen Zähnen bewaffneten Schnabel ausgezogen.
An den europäischen Küsten erscheint der Hornhecht gewöhnlich mit den Makrelen, gilt deswegen auch als deren Führer. Je nach der Örtlichkeit trifft er in größerer oder geringerer Anzahl ein. Im Mittelländischen Meere ist er gemein, in der Nord- wie in der Ostsee eine gewöhnliche Erscheinung. Nach Couch nähert er sich dem Strande in der Regel in zahlreichen Heeren, schwimmt nahe der Oberfläche des Wassers mit schlängelnder Bewegung rasch dahin und gefällt sich in gewaltigen Sprüngen, die er unter Umständen sehr oft wiederholt. Diese Art zu springen ist, wie Ball hervorhebt, sehr sonderbar. Der Fisch fährt nämlich senkrecht aus dem Wasser heraus und fällt mit dem Schwänze voran wieder ins Wasser zurück.
Obgleich der Hornhecht, wenn er aus dem Wasser genommen wird, einen sehr unangenehmen Geruch von sich gibt und mageres zähes Fleisch hat, das man am liebsten zum Ködern der Angel verwendet, wird er doch viel gefangen. An der Ostseeküste verzehrt man ihn im frischen, eingemachten und geräucherten Zustande. Zum Fange verwendet man entweder Heringsnetze oder die Angel oder einen Handspeer mit gegen zwanzig Spitzen, letzteren jedoch nur des Nachts bei Fackelschein, der die Fische herbeizieht. Auf den Ionischen Inseln bedient man sich, laut Tonn, eines aus drei Bambusstöcken zusammengesetzten dreieckigen Fahrzeuges, in dessen Mitte ein Mast mit lateinischen Segeln gesetzt wird. Der Fischer begibt sich bei Landwind auf einen vorspringenden Felsen der Steilküste, macht sein eigentümliches Fahrzeug flott und läßt es auf das Meer hinausschwimmen, so weit eine lange, dünne Schnur, die er in der Hand behält, es zuläßt. An dieser Schnur sind in Abständen von einem oder zwei Faden Korkstücke und an ihnen geköderte Angeln mittels feinerer Schnüre befestigt. Wenn der Hornhecht anbeißt, zieht er die Korkstücke mit Heftigkeit in die Tiefe, scheint sich dann aber in sein Schicksal zu ergeben und gestattet somit dem Fischer, zu warten, bis sich zehn oder zwölf gefangen haben; sodann zieht dieser die Leine ein, löst die Fische von den Angeln, ködert letztere von neuem und läßt das Schifflein wiederum aufs Meer hinausschwimmen. Tonna versichert, auf Paxo einem Knaben zugesehen zu haben, der binnen einer halben Stunde auf diese Weise fünfzig bis sechzig Hornhechte fing.
*
Die Flugfische, die der Reisende auf hohem Meere zu sehen bekommt, gehören fast ausschließlich einer Sippe an, der man den Namen Hochflugfische ( Exocoetus) gegeben hat. Ihre Hauptmerkmale bilden die außerordentlich entwickelten Flossen, insbesondere die zugespitzten Brustflossen, deren Länge etwa zwei Drittel und deren Breite ungefähr ein Drittel der gesamten Leibeslänge beträgt, und die sich auf einem sehr starken, unter den dicken Muskeln liegenden Knochengürtel freier als bei andern Fischen bewegen. Der breiten Rückenflosse steht die Afterflosse gegenüber; die Bauchflossen sind unterhalb der Brustflossen eingelenkt; die Schwanzflosse ist tief gegabelt und der untere Lappen größer als der obere. Sehr kleine Zähne bewehren die Kiefer; Gaumen und Zunge sind nicht bewaffnet. In der Gestalt haben die Hochflugfische, abgesehen von der Beflossung, mit dem Hering eine gewisse Ähnlichkeit, und der Name »fliegender Hering« ist also nicht übel gewählt.
Unter den inneren Teilen fällt, wie Humboldt zuerst hervorgehoben, die ungeheure Größe der Schwimmblase auf, die bei einem sechzehn Zentimeter langen Fisch, den dieser alles umfassende Forscher untersuchte, neun Zentimeter lang und fünfundzwanzig Millimeter breit war, also etwa sechzig Kubikzentimeter Luft enthielt. »Die Blase nimmt die Hälfte des Körperinhaltes ein und trägt somit wahrscheinlich dazu bei, daß der Fisch so leicht ist. Man könnte sagen, dieser Luftbehälter diene ihm viel mehr zum Fliegen als zum Schwimmen; denn die Versuche, die Provenzal und ich angestellt, beweisen, daß dieses Organ selbst bei den Arten, die damit versehen sind, zu der Bewegung an die Wasserfläche herauf nicht durchaus notwendig ist.« Für die erstaunliche Größe der Schwimmblase ist durch ringförmige Ausbuchtung der Querfortsätze mehrerer Schwanzwirbel noch besonders Raum geschafft worden: eine Einrichtung, die man bei keinem anderen Fisch beobachtete.
Die verschiedenen Arten der Hochflugfische scheinen mehr oder weniger dieselbe Lebensweise zu führen. Sie bevölkern die zwischen den Wendekreisen oder doch im gemäßigten Gürtel gelegenen Meere, namentlich die Weltmeere, in unermeßlicher Menge und keineswegs nur die Küstengewässer, sondern buchstäblich alle Teile der Meere; ja, sie kommen fernab vom Lande in größerer Menge als in der Nähe desselben vor. Selten verirren sie sich in unsere Gewässer.
Ihr Erscheinen über dem Wasser ist sehr eigentümlich. Wenn man erst in ihr Wohngebiet gelangt ist, sieht man die Schiffe nach allen Seiten hin von ihnen umringt, das heißt, so weit das Auge reicht, unablässig einzelne oder mehrere von ihnen sich erheben und wieder im Meer versenken. Humboldt sagt, daß man ihre Bewegungen und die eines flachen Steines, der, auffallend und wieder abprallend, ein paar Meter hoch über die Wellen hüpft, ganz richtig zusammengestellt hat. Die Hochflieger springen nämlich in der Regel, und solange sie nicht einen besonderen Beweggrund haben, nur anderthalb bis zwei Meter hoch über die Oberfläche des Wassers empor, streichen auch nicht weit in einem Zuge fort, sondern fallen bald wieder ein; aber einer folgt dem andern so rasch, daß es aussieht, als ob der erste immer nur wieder eben das Wasser berührte, sich einen neuen Anstoß gebe und einen zweiten Sprung ausführe, während in Wirklichkeit einer über den andern wegschnellt. Nicht selten geschieht es auch, daß mit einem Male eine zahlreiche, nach Hunderten und Tausenden zu schätzende Anzahl aus dem Wasser aufsteigt. Dann bemerkt man, daß stets ein guter Teil der aufgestiegenen nach kurzem Sprung ins Wasser fällt, während die übrigen ihren Satz fortsetzen und erst in viel größerer Entfernung die Wellen wieder berühren. Die Entfernung, die in solcher Weise zurückgelegt wird, kann sehr verschieden sein. Bei ruhigem Flug erheben sich unsere Fische etwa meterhoch über dem Spiegel des Meeres, so daß sie eben über den Wellenkämmen hingleiten, und fallen, nachdem sie eine Strecke von sechs Meter zurückgelegt, wieder ein; bei größerer Kraftanstrengung schnellen sie sich bis sechs Meter empor und durchmessen in flachen Bogen eine Strecke von ein- bis zweihundert Meter. Fast immer geht der Sprung in gerader Richtung fort; doch sind sie auch imstande, eine Schwenkung auszuführen. Beim Springen halten sie Brust- und Bauchflossen wagerecht ausgespannt, ohne jedoch mit ihnen die Luft zu schlagen, wie es der Vogel tut. Eine Schwenkung in der Luft wird wohl nur im höchsten Notfalle ausgeführt, etwa um einen Anprall mit einem andern Gegenstand zu verhindern oder um einem räuberischen Seeflieger auszuweichen, weil die hierzu nötige Anstrengung der Schwanzflosse den springenden Fisch aus dem Gleichgewicht bringt und ihn daher gleich wieder ins Wasser hinabdrückt. Krumme Linien beschreibt er in anderer Weise, indem er rasch nacheinander viele kleine Sprünge, jeden von etwa einem Meter Weite, ausführt und nach dem jedesmaligen Einfallen die Richtung entsprechend ändert. Solange nicht Gefahr droht, ist der sogenannte Flug sehr sicher, dem eines Vogels wirklich ähnlich; wird der Hochflieger aber von Feinden verfolgt oder durch ein Schiff erschreckt, so bekommt sein Sprung etwas Ängstliches, Unregelmäßiges, Steifes und Ungeschicktes, gleichsam etwas Zappelndes; der Fisch fällt auch oft ins Wasser ein, aber nur, um im nächsten Augenblick sich wieder zu erheben und in derselben Weise fortzuzappeln.
»Die Hochflugfische«, fährt Humboldt fort, »bringen einen großen Teil ihres Lebens in der Lust zu; aber ihr elendes Leben wird ihnen dadurch nicht leichter gemacht. Verlassen sie das Meer, um den gefräßigen Goldmakrelen zu entgehen, so begegnen sie in der Luft Fregattvögeln, Albatrossen und andern Seefliegern, die sie im Fluge erschnappen.« Auch Kittlitz stimmt hiermit überein. »Der Flug dieser Fische«, meint er, »scheint das letzte Mittel zu sein, das sie anwenden, um ihren Verfolgern, die man beständig nach ihnen springen sieht, zu entgehen. So groß ihre Anzahl, so heftig ist auch die Verfolgung durch die Raubfische. Die Vermehrung dieser Tiere muß außerordentlich sein, da bei solchen Verfolgungen ihre Anzahl noch eine so beträchtliche ist.« Bennett glaubt Humboldt und Kittlitz oder überhaupt allen, die von diesen Verfolgungen reden, widersprechen zu dürfen. »Ich meinesteils«, sagt er wörtlich, »bin geneigt, die Sache zu bezweifeln; denn wenn auch eine derartige Jagd gelegentlich beobachtet worden sein mag, so habe ich doch große Schwärme von Hochfliegern aus dem Wasser springen sehen, ohne daß sie hier ein Fisch oder in der Lust ein Vogel verfolgt hätte, während sie unzweifelhaft beschäftigt waren, Jagd zu machen, also als Angreifer, nicht aber als Opfer erschienen.«
Auf den meisten Schiffen verzehrt man die zufällig gefangenen, das heißt auf Deck gesprungenen Flugfische gewöhnlich nicht; an der Küste Süd- und Mittelamerikas aber gilt ihr Fleisch überall, und gewiß mit Recht, als eine treffliche Speise.
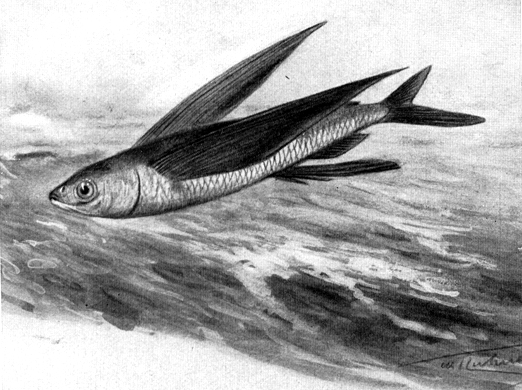
Schwalben- oder Flugfisch ( Exocoetus volitans)
Die bekannteste Art der Familie ist der Schwalbenfisch ( Exocoetus volitans), der im Mittelmeer lebt. Seine Länge beträgt höchstens fünfzig Zentimeter. Die Färbung der Oberseite ist azurblau, die der unteren silberweiß; die Haut der Brustflossen hat eine schöne, durchscheinend blaue Färbung.
*
Weitaus der größte Teil aller südeuropäischen und ebenso eine namhafte Anzahl der in den Binnengewässern Asiens, eines Teiles von Afrika und Nordamerika hausenden Süßwasserfische gehört einer Familie an, die wir, dem wichtigsten Mitglied derselben zu Gefallen, Karpfen ( Cyprinidae) nennen. Sie sind länglich eirund gebaute, kleinmäulige, mit großen Rundschuppen bekleidete Fische mit schwachen, zahnlosen Kinnladen, deren Rand von dem Zwischenkiefer gebildet wird, hinter dem der Oberkiefer liegt; an Stelle der Kieferzähne finden sich entsprechende Gebilde in dem untern Schlundknochen, die gegen einen am Schädelgrund gelegenen, meist mit einer Hornplatte verdeckten Fortsatz des Schädels, den sogenannten Karpfenstein, wirken. Unter diesen Merkmalen haben die Mundbildung und die Schlundknochen für die Einteilung der Familie besondere Wichtigkeit. Der Mund wird entweder von dicken, fleischigen Lippen umgeben, oder von dünnschneidenden, oft knorpelig überdeckten Kieferrändern begrenzt; die Schlundzähne unterscheiden sich bezüglich ihrer Form, Anzahl und Stellung, und diese Verschiedenheiten sind so beständig und verläßlich, daß sie geeignet erscheinen, zur Kennzeichnung der einzelnen Arten benutzt zu werden.
Die Karpfen, von denen gegen eintausend Arten beschrieben wurden, lieben stehende Gewässer mit weichem, schlammigem oder sandigem Grund, der ihnen ihre bevorzugte Nahrung, Würmer, Kerbtierlarven und verwesende Pflanzenstoffe, bietet. In ruhigfließenden Strömen finden sie sich ebenfalls; Gebirgswässer dagegen werden von ihnen mehr oder weniger gemieden. Sie leben größtenteils gesellig und vereinigen sich gern zu zahlreichen Scharen, die, wie es scheint, längere Zeit gemeinschaftlich miteinander schwimmen und jagen, auch während der rauhen Jahreszeit dicht nebeneinander in den Schlamm sich betten und hier gewissermaßen einen Winterschlaf abhalten. Ihr Nahrungserwerb bedingt, daß sie oft und lange unmittelbar über dem Grunde sich aufhalten. Sie ziehen den größten Teil ihrer Beute aus dem Schlamm selbst hervor, indem sie denselben förmlich durchsuchen, wenigstens oft ihre Köpfe in ihn einbohren und längere Zeit in solcher Stellung verweilen. Gegen die Laichzeit hin trennen sich die Schwärme in kleinere Haufen; die Rogener ziehen voran, und die Milchner folgen ihnen getreulich nach, gewöhnlich in größerer Anzahl, so ungefähr, daß zwei oder drei Männchen ein Weibchen begleiten, überwiegt das eine Geschlecht bedeutend an Zahl, so kann es geschehen, daß verwandte Arten der Familie sich gesellen und gemeinschaftlich laichen; wenigstens nimmt man jetzt, und wohl mit Recht, an, daß mehrere von den in den Büchern der Gelehrten aufgeführten Karpfenarten nichts anderes als Blendlinge sind. Die Geneigtheit der verschiedenen Karpfenarten, miteinander sich zu paaren, findet vielleicht in dem auch bei diesen Fischen sehr lebhaften Begattungstrieb ihre Erklärung. Schon seit alter Zeit gilt das Urbild der Familie, der Karpfen, mit Recht als ein Sinnbild der Fruchtbarkeit. Als solches war er der Venus geheiligt; auf diese Fruchtbarkeit bezieht sich der in die lateinische und von dieser in unsere Sprache übergegangene Name. Schon in dem Rogen eines drei Pfund schweren Weibchens hat man dreihundertsiebenunddreißigtausend, in ausgewachsenen Rogenern bis siebenhunderttausend Eier gezählt.
Sind nun diese Vermischungen verschiedener Arten Ursache zu abweichenden Formen geworden, so tritt noch ein zweiter Umstand hinzu. Mehrere Arten der Familie sind seit vielen Jahrhunderten als Zuchtfische vom Menschen beeinflußt worden, und so haben sich infolge der den Karpfen gewissermaßen unnatürlichen Verbreitung, der Beschaffenheit der Zuchtteiche und Seen, der verschiedenen Behandlung usw. Ausartungen gebildet, die mit der Zeit Ständigkeit erlangten. Dementsprechend ist die Anzahl der Ab- und Spielarten innerhalb der Familie der Karpfen größer als in jeder andern.
Mit Ausnahme weniger, unsern Fischern und Hausfrauen wohlbekannter Arten der Gruppe haben die Karpfen ein weiches, saftiges und höchst wohlschmeckendes Fleisch, lassen sich, dank ihrer Zählebigkeit, ohne besondere Vorkehrungen weit versenden, leichter als alle übrigen Fische in verschiedenartigen Gewässern einbürgern, vermehren sich, wie bemerkt, sehr stark, zeigen sich andern Fischen gegenüber verhältnismäßig anspruchslos, begnügen sich mit billigen Nahrungsmitteln, wachsen rasch und werden leicht feist: vereinigen also alle Bedingungen, die man an einen Zuchtfisch überhaupt stellen kann. Deshalb schlägt ihre Zucht auch selten fehl, und sie dürfen so recht eigentlich als der Fisch des Bauern gelten.
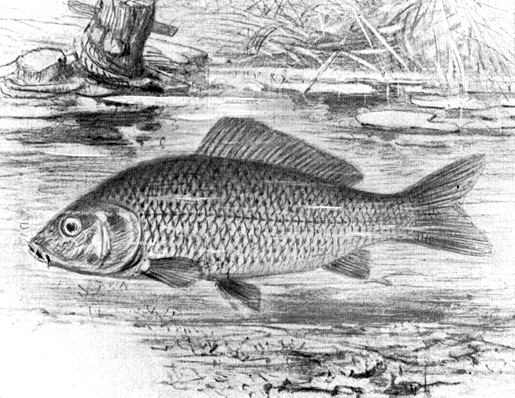
Karpfen ( Cyprinus carpio)
Die Karpfen im engeren Sinne ( Cyprius) kennzeichnen sich durch endständiges Maul und vier Bärtel an der Oberkinnlade, fünf Schlundzähne, die derartig in drei Reihen stehen, daß auf jedem Schlundknochen der ersten und zweiten Reihe je einer, in der dritten Reihe sich deren drei befinden, und die sehr stark nach rückwärts gezähnelten Knochenstrahlen, mit denen Rücken- und Afterflosse beginnen.
Der seit uralter Zeit bekannte und gepflegte Vertreter dieser Gruppe, unser Karpfen ( Cyprinus carpio), erreicht, abgesehen von einzelnen Riesen, die anderthalb Meter lang, sechzig Zentimeter breit und fünfunddreißig Kilogramm schwer geworden sein sollen, eine Länge von etwa einem Meter und ein Gewicht von fünfzehn bis zwanzig Kilogramm. Das Maul ist weit, mit dicken Lippen und starken, langen Barteln umgeben, die Schwanzflosse tief halbmondförmig ausgeschnitten, der starke Knochenstrahl der Rücken- und Afterflosse gezähnelt, die Färbung wie die Gestalt sehr verschieden, vom Goldgelben ins Blaugrüne spielend. Rücken und Flossen sehen gewöhnlich grau, Lippen und Bauch gelblich aus; die Flossen haben rötlichen Anflug; die Schuppen tragen in ihrer Mitte oft einen dunklen Fleck, auch nicht selten am Hinterrande einen schwärzlichen Saum.
Bis in die neuere Zeit hat man mehreren Blendlingen und Ausartungen des Karpfens den Rang von wirklichen Arten zugestanden; aus den eingehenden, sorgfältigen Untersuchungen Siebolds geht jedoch fast mit Gewißheit hervor, daß solche Ansicht unrichtig ist. »Daß man die in ihrer Beschuppung ausgearteten Karpfen«, sagt genannter Forscher, »nämlich den mit wenigen, unverhältnismäßig großen Schuppen besetzten Spiegelkarpfen und den von allen Schuppen entblößten Lederkarpfen nur als Spielarten und nicht, wie man früher glaubte, als besondere Arten zu betrachten habe, daran hat man sich lange gewöhnt; daß aber auch Karpfenrassen veränderte Körperumrisse, wie sie bei unseren warmblütigen Haustieren oft in ganz auffallender Weise vorkommen, an sich tragen können, das mögen selbst manche Fischkundige nicht einräumen. Es kann der Karpfen, dessen Körper in ursprünglicher Form länglich und etwas seitlich zusammengedrückt erscheint, unter gewissen Einflüssen sich länger strecken und auf dem niedriger gewordenen Rücken seitlich abrunden oder unter anderen Einflüssen verkürzen und einen steiler ansteigenden sowie noch mehr zusammengedrückten Rücken erhalten. Eine dieser Rassen, bei der die zuerst erwähnten Veränderungen sich in sehr großer Ausdehnung gesteigert finden, hat Heckel als besondere Art betrachtet und mit dem Namen See- oder Theißkarpfen bezeichnet. Eine Mittelform zwischen den weniger gestreckten Teichkarpfen und diesem stellt die von Bonaparte ebenfalls zu einer besonderen Art erhobene und als Karpfenkönigin bezeichnete Spielart dar. Eine zweite Reihe der Spielarten, zu denen der Teichkarpfen auf der anderen Seite ausarten kann, umfaßt die kurzleibigen, hochrückigen Formen, unter denen die von Heckel und Kner als Spitzkarpfen beschriebene als die kürzeste und am meisten hochrückige Spielart sich auszeichnet. Es bewohnt diese Rasse die Donau, den Neusiedler- und Plattensee.« Genau dasselbe gilt für die vielen sogenannten »Arten«, die von anderen Forschern aufgestellt wurden: auch sie sind nichts anderes als Spielarten.
Seichte, schlammige, möglichst wenig beschattete, hier und da mit Wasserpflanzen dichtbestandene Teiche oder Seen sagen ihm am besten zu; nicht minder gedeiht er in dem Altwasser der Flüsse oder in diesen selbst, wenn sie ruhig fließen und schlammigen Grund haben; schnellströmende, klare Gewässer meidet er gänzlich. Er verlangt zu seinem Weidegebiete schlammigen Grund und gedeiht nur dann, wenn sein Wohngewässer möglichst viel den Strahlen der Sonne ausgesetzt ist und weiche Zuflüsse hat. Während des Sommers und nach der Fortpflanzungszeit mästet er sich für den Winter und durchzieht zu diesem Zwecke, meist in dichten Scharen, die seichteren Stellen seiner Wohngewässer, zwischen den Wasserpflanzen nach Kerbtieren und Gewürm sowie nach Pflanzenstoffen verschiedener Art umherspähend oder den Schlamm nach ähnlichen Stoffen durchwühlend. Seine hauptsächlichste Nahrung besteht wohl in kleinem Getier, namentlich Würmern, Larven von Kerbtieren oder selbst Lurchen und ähnlichen Wasserbewohnern; er beschränkt sich jedoch keineswegs auf diese Nahrung, sondern frißt auch sehr gern Pflanzenstoffe, vermoderte Teile der Wasserpflanzen selbst, faulige Früchte, gekochte Kartoffeln oder Brot usw. In den Zuchtteichen pflegt man ihn mit Schafmist zu füttern, was, streng genommen, so viel sagen will, daß man durch den Mist Kerbtiere und Gewürm herbeilockt; denn diese, nicht aber der Mist, den er freilich auch mit verschluckt, geben ihm die geeigneten Nahrungsstoffe. Beim Wühlen im Schlamm nimmt er erdige Bestandteile mit auf, ja, diese scheinen für seine Verdauung notwendige Bedingung zu sein. Im Meere nährt er sich wahrscheinlich hauptsächlich von Würmern und kleinen Muscheltieren.
Bei genügender Nahrung wird der Karpfen schon im dritten Jahre seines Lebens fortpflanzungsfähig. Im fünften Lebensjahre legt, nach Blochs Untersuchungen, das Weibchen bereits gegen dreihunderttausend Eier ab; diese Anzahl kann sich aber später mehr als verdoppeln. Während der Laichzeit entwickeln sich bei den Männchen in dem schleimigen Hautüberzug auf Scheitel, Wangen und Kiemendeckeln viele kleine, unregelmäßig zerstreute weißliche Warzen, die in der Regel auch auf der inneren und vorderen Seite der Brustflossen sich zeigen. Sobald der Karpfen dieses Hochzeitskleid anlegt, wird er wanderlustig und versucht, soweit ihm möglich, im Flusse aufwärts zu steigen, überwindet dabei auch oft bedeutende Hindernisse. Zum Laichen erwählt er seichte, mit Wasserpflanzen dichtbestandene Stellen, und nur wenn er solche findet, hat die Fortpflanzung einen für den Züchter erwünschten Erfolg. Nicht alle Karpfen aber zeigen die erstaunliche Fruchtbarkeit, die sie vormals würdig erscheinen ließen, der Liebesgöttin geheiligt zu werden; viele bleiben gelte, und zwar, wie man annimmt, ihr Leben lang. Schon Aristoteles kannte diese Tatsache und wußte, daß diese gelten Karpfen an Fettigkeit und Güte ihres Fleisches alle übrigen übertreffen. Die Schriftsteller des Mittelalters nennen sie »Müßiggänger« und heben ausdrücklich hervor, daß sie vor allen zu loben seien. In England zerstört man Samengefäße und Eierstöcke, um solche Geltfische künstlich zu erzeugen und zarteres Fleisch zu erzielen.
In den Seen und in den Flüssen fängt man die Karpfen mit Zuggarnen, Netzen und Reusen, ködert wohl auch vorher gewisse Stellen mit gekochten Erbsen oder legt mit Würmern, kleinen Fleischstückchen oder dürrem Obst bespickte Grundangeln. Doch hat dieser freie Fang nirgends eigentliche Bedeutung, am wenigsten bei uns zulande, woselbst der Karpfen als der für die Teichwirtschaft wichtigste Fisch betrachtet werden muß.
Zur Karpfenzucht bedarf man mindestens zweierlei Teiche, flacherer und tieferer nämlich, sogenannter Zucht- oder Streckteiche und Winterungs- oder Kaufgutteiche. Erstere müssen eine kesselartige Austiefung haben, in denen die Fische, ohne vom Frost zu leiden, den Winter zubringen können, dürfen im übrigen aber nicht über zwei Meter tief sein. Noch flachere, mit Gras bestandene Stellen sind unumgänglich notwendig, weil auf ihnen die Zuchtkarpfen ihre Eier absetzen sollen. Regelmäßiger Zufluß von weichem Wasser ist ebenfalls Bedingung; denn in Teichen mit kaltem Wasser gedeiht der Karpfen nicht, am wenigsten in solchen, die starke Quellen besitzen oder den Zufluß von solchen empfangen. Hat man mehrere Teiche, so wählt man die flachsten unter ihnen zu Laichteichen, die tieferen und größeren zu sogenannten Streckteichen; immer aber ist darauf zu sehen, daß in jedem einzelnen Teich tiefe Stellen sich finden, die unter allen Umständen frostfrei bleiben, weil man sonst genötigt ist, gegen den Winter hin die Karpfen umzusetzen. Aus einen Brutteich von zweihundert Ar Fläche rechnet man gewöhnlich fünf vier- bis zwölfjährige Streichkarpfen, einen Milchner und vier Rogener, soll aber, wie auch leicht erklärlich, bessere Erfolge erzielen, wenn man das Verhältnis der Geschlechter mehr ausgleicht, also annähernd ebenso viele Milchner als Rogener einsetzt. Ungeachtet der außerordentlichen Vermehrungsfähigkeit gewinnt man doch nur unter günstigen Umständen zwanzig bis fünfundzwanzig Schock Brut von einem Laichkarpfen, wahrscheinlich deshalb, weil man bisher noch immer zu wenig Rücksicht auf Herrichtung geeigneter Laichplätze nimmt. Erfahrene Teichwirte, die aus Weiden geflochtene Matten oder Hürden zwanzig Zentimeter tief unter den Wasserspiegel wagerecht legten und auf der Oberseite mit sehr vielen kleinen Büscheln aus Fichtenzweigen versahen, erfuhren, daß die Karpfen diese Vorrichtungen zum Ablegen ihres Laiches benutzten, daß weit mehr von den Eiern befruchtet wurden und der Ertrag sich bedeutend vermehrte. Während der Brutzeit muß das Wasser des Zuchtteiches möglichst auf demselben Stande erhalten werden, damit die Eier nicht zeitweilig bloßliegen und verderben. Nach dem Ausschlüpfen der jungen Brut hat man sein Augenmerk hauptsächlich auf Abhalten der verschiedenen Fischfeinde zu richten. Bei günstiger, namentlich warmer Witterung wächst die Brut im ersten Sommer zu acht bis zwölf Zentimeter Länge heran; im nächsten Jahre kann sie, falls nicht die Teiche mit zu vielen Fischen besetzt oder letztere genügend gefüttert werden, dreißig Zentimeter und darüber an Länge erreichen; vom dritten Sommer an nennt man sie Kaufgut, bringt sie in die Haupt- oder Fetteiche und läßt sie hier noch einen oder zwei Monate stehen.
In den meisten Karpfenteichen pflegt man einen oder mehrere Hechte mit einzusetzen, von denen man annimmt, daß sie die trägen Karpfen in Regsamkeit erhalten und dadurch zu ihrem Gedeihen beitragen. Man hat sich aber bei der Wahl dieser Aufwiegler sehr vorzusehen, weil ein Hecht, der im Teiche reichliche Nahrung findet, binnen kurzem so heranwächst, daß er unter den Karpfen entsetzliche Verheerungen anrichten kann. Viele Züchter sehen streng darauf, daß außer den Karpfen keine anderen Fische im Teiche sich befinden, weil sie mit Recht behaupten, daß solche jenen immerhin einen Teil der Nahrung wegnehmen; sie befehden aus demselben Grunde auch die Wasserfrösche und sorgen durch Herauswerfen des Laiches dieser Lurche nach Kräften für deren Verminderung. Karpfen, die in kleineren Parkteichen gehalten und regelmäßig gefüttert werden, gewöhnen sich bald an ihre Futterstelle und an ihren Pfleger, lernen es, einem ihnen gegebenen Ruf oder Zeichen zu folgen, schwimmen zum Beispiel auf das Läuten einer kleinen Glocke oder auf einen gewissen Pfiff herbei und umstehen dann die Futterstelle, der voraussichtlich gespendeten Nahrung harrend.
Der endständige Mund ohne Bärtel, vier spatelförmige, in eine Reihe gestellte Schlundzähne jederseits und je ein rückwärts ausgesägter Knochenstrahl in Rücken- und Afterflosse gelten als die Kennzeichen der Karauschen ( Carassius), die in Deutschland durch die Karausche ( Carassius vulgaris) vertreten werden. Ihre Merkmale liegen in der sehr stumpfen, engmündigen, mit schmächtigen Lippen umgebenen Schnauze, der sehr breiten Stirne und schwach ausgeschnittenen Schwanzflosse. Die Färbung, die vielfach abändert, ist ein mehr oder minder dunkelndes Messinggelb, das auf dem Rücken ins Stahlblaue übergeht und auf den Flossen rötlichen Anflug zeigt. Eine bedeutende Größe erreicht die Karausche nicht; denn nur selten wird sie über zwanzig Zentimeter lang und über siebenhundert Gramm schwer. Eckström erhielt eine von einem Kilogramm und Yarrell eine von noch etwas mehr Gewicht, bei fünfundzwanzig Zentimeter Länge und elf Zentimeter größter Höhe. Auch die Karauschen erleiden als Zuchtfische auffallende Formveränderungen. So ist zum Beispiel die Karpfkarausche ein Blendling zwischen Karpfen und Karausche.
Der Verbreitungskreis der Karausche erstreckt sich über Mittel-, Nord- und Osteuropa. Sie ist häufig in Flüssen, Teichen und Seen des Rhein- und Donaugebietes, Ost- und Westpreußens, ganz Rußlands und Sibiriens, bevorzugt stehendes Wasser, namentlich Seen mit versumpften Ufern oder sogenannte tote Arme größerer Flüsse, kommt aber auch in kleinen Teichen, Pfuhlen, Tümpeln, Sümpfen und Mooren vor, ist überhaupt befähigt, in dem verschiedenartigsten und unreinlichsten Wasser auszuhalten und bei der schmutzigsten, schlammigsten Nahrung zu gedeihen. Auch sie nährt sich hauptsächlich von Würmern, Larven, faulenden Pflanzenstoffen und Schlamm, hält sich dementsprechend die längste Zeit ihres Lebens am Grunde auf, verweilt hier auch während der kalten Jahreszeit in Erstarrung, soll, laut Pallas, sogar in Eis einfrieren und später doch wieder aufleben können. Nur während der Laichzeit, die in Südeuropa in den Juni, in Nordeuropa in den Juli fällt, erscheint sie öfters an der Oberfläche des Wassers, insbesondere an seichten, mit Pflanzen bewachsenen Stellen, tummelt sich hier in Scharen umher, schnattert, mit den Lippen schmatzend, an der Oberfläche, jagt und spielt, bis das Eierlegen beginnt.
Nach angestellten Untersuchungen legt der Rogener bis zu zweihunderttausend Eier, erzeugt auch regelmäßig Blendlinge mit dem Karpfen und wird deshalb, und weil sie der jungen Karpfenbrut nachstellt, schon seit alter Zeit gemieden. Die Brut wächst langsam, ist jedoch im zweiten Lebensjahre bereits fortpflanzungsfähig und erreicht eine Lebensdauer von sechs bis zehn Jahren.
Für die Teichwirtschaft hat die Karausche nur in solchen Gegenden Bedeutung, wo die Gewässer für die Karpfenzucht zu moderig sind. Solches Wasser schadet dem Geschmack ihres Fleisches nicht, wogegen es das des Karpfens fast ungenießbar macht. Außerdem läßt sie sich mit Erfolg in Forellenteichen züchten, weil sie diesen edlen Raubfischen, deren hoher Wert mit dem ihrigen in keinem Verhältnisse steht, zur Nahrung dient, also mittelbar gut verwertet werden kann. Ihre außerordentliche Lebenszähigkeit gestattet weiten Versand zu jeder Jahreszeit. Sie lebt stundenlang außer Wasser und läßt sich, in Schnee gepackt oder mit feuchten Blättern umhüllt, weit versenden. Sehr geschätzt ist die Karausche in Rußland, woselbst sie alle Gewässer der Steppen in zahlreicher Menge bevölkert.
Der alte Kämpfer spricht zuerst von einem roten, am Schwanze schön goldgelben Zierfische, dem King-Jo, der in Japan und China in Teichen gehalten und gewissermaßen als Haustier betrachtet wird. Du Halde berichtet in seiner Geschichte Chinas später ausführlich über denselben. Die Fürsten und Großen des Himmlischen Reiches lassen in ihren Gärten für ihn eigene Teiche graben oder halten ihn in prachtvollen Porzellanvasen.
Der King-Jo, unser Gold- oder Silberfisch, gelangte von China aus wahrscheinlich zuerst nach Portugal und verbreitete sich, nachdem er sich hier eingebürgert, allgemach weiter über Europa. Das Jahr der Einführung wird verschieden angegeben. Einzelne Schriftsteller nennen 1611, andere 1691, wieder andere 1728. Gewiß ist, daß das Fischchen zur Zeit der berüchtigten Pompadour bereits in Frankreich vorhanden war, weil bestimmte Angaben vorliegen, daß man ihr Goldfischchen als etwas Außerordentliches schenkte. In England soll der Goldfisch erst im Jahre 1728 durch Philipp Worth eingebürgert worden sein. Gegenwärtig hat er sich über die ganze Erde verbreitet, soweit dieselbe von gebildeten Menschen bewohnt wird, und in den warmen Teilen des gemäßigten Gürtels wirklich heimisch gemacht. Auf der Insel Mauritius durch die Franzosen eingeführt, belebt er dort gegenwärtig alle Flüsse, Teiche und Seen, und genau ebenso soll er in Portugal als verwilderter Fisch vorkommen. Gezüchtet wird er in bedeutender Anzahl, namentlich im südlichen und westlichen Frankreich. Die Zucht geschieht im allgemeinen ebenso wie die des Karpfens, nur daß sie mehr und kleinere Teiche benötigt und strengere Aufsicht erfordert.
Der Goldfisch ( Carassius auratus) hat ungefähr die Gestalt des Karpfens, erreicht eine Länge von fünfundzwanzig bis dreißig, höchstens vierzig Zentimeter und zeigt auf zinnoberrotem Grunde einen prachtvollen Goldglanz. Es kommen jedoch sehr viele Spielarten vor, ja, man kann durch fortgesetzte Zucht mehr oder weniger ständige Rassen, wie z. B. die sogenannten Schleierschwänze und Teleskopfische, erzeugen, wie die Chinesen, hierin Meister, es schon seit Jahrhunderten tun.
*
Schleien ( Tinca) sind kleinschuppige Karpfen mit endständigem Maul, zwei Bärteln an den Mundwinkeln und keulenförmigen, in einfacher Reihe stehenden, zu vier und fünf auf der einen und anderen Seite angeordneten Schlundzähnen; ausgezeichnet noch durch eine sehr dicke, durchsichtige schleimige Oberhautschicht.
Der einzige in Europa vorkommende Vertreter dieser Sippe, die Schleie ( Tinca vulgaris), erreicht eine Länge von höchstens siebzig Zentimeter und ein Gewicht von drei bis vier, in seltenen Fällen wohl auch fünf bis sechs Kilogramm. Die Färbung ändert mehr ab als bei anderen Karpfen, je nach dem Aufenthaltsort. Gewöhnlich zeigt das Kleid der Schleie ein dunkles Ölgrün, durch das ein schimmernder Goldglanz hervorleuchtet; diese Färbung geht an den Seiten in Hell- oder Rötlichgrau mit violettem Schimmer über. Heller gefärbte Stücke mit schwachem Goldglanz kommen nicht selten vor; in einzelnen Gegenden aber, insbesondere in Böhmen und Oberschlesien, züchtet man eine prachtvolle Spielart, die unbedingt zu den schönsten aller europäischen Fische gezählt werden muß: die Goldschleie. Ihre Schuppen sind größer als bei der Teichschleie, dünn und durchsichtig, die Flossen zart und dünnhäutig; die Lippe ist rosenrot, die Färbung übrigens goldgelb oder rot; die Zeichnung besteht aus mehr oder weniger dichtgedrängten dunklen Flecken, die sich auch über die Flossen fortsetzen. Männchen und Weibchen unterscheiden sich durch die Bildung der Flossen und durch die Färbung. Erstere sind durchschnittlich Heller gefärbt, letztere, namentlich hinsichtlich der Bauchflossen, stärker entwickelt, vor allem der zweite Strahl in ihnen mehr verdickt und verbreitert.
Unter den europäischen Karpfen gehört die Schleie zu den verbreiterten. Sie bewohnt den größten Teil Europas, von Süditalien an bis Süd- und Mittelschweden und gehört auch in Rußland zu den gemeinsten Teichfischen. Flüsse liebt sie weniger als stehende Gewässer; unter diesen bevorzugt sie Seen, Teiche und Sümpfe mit schlammigem oder lehmigem Grunde, in denen Röhricht zwar vorhanden, aber doch nicht vorherrschend geworden ist. In den Flüssen zieht sie sich immer mehr nach solchen Stellen zurück, wo das Wasser langsam fließt und hinlänglichen Schlamm absetzt, denn aus ihm holt sie sich ihre Nahrung hervor. Ganz besonders soll sie in abgebauten und mit Wasser angefüllten Lehmgruben gedeihen. Sie ist ein träger und langweiliger Fisch, der sich fast stets nahe dem Boden aufhält, während des Winters hier im Schlamm vergräbt und bloß bei sehr gutem Wetter oder während der Fortpflanzungszeit an die Oberfläche heraufsteigt. Wie der Schlammbeißer befindet sie sich noch in Gewässern wohl, in denen andere Fische und selbst Karpfen abstehen, weil ihr Atembedürfnis, bezüglich der von ihr benötigte Verbrauch von Sauerstoff außerordentlich gering ist.
Während des Winters wühlen sich die Schleien nach Art anderer Familienverwandten in den Schlamm ein und verbringen so die kalte Jahreszeit in einem halb bewußtlosen Zustande. Ähnliches ereignet sich zuweilen auch im Sommer. Einige Schleien steckten, wie Siebold beobachtete, am hellen Tage auf dem Grunde des Teiches tief im Schlamm verborgen und ließen sich mit einer Stange aus ihrem Versteck hervorgraben, ohne daß sie sich rührten. Nachdem sie zu Tage gebracht waren, blieben sie fast wie tot auf der Seite liegen, bis sie, durch mehrere unsanfte Stöße mit der Stange endlich aus ihrem betäubten Zustande erweckt, davonschwammen, um sich wieder in der Tiefe des Schlammes zu verbergen. »Sollte dieses Benehmen der Schleien«, fragt Siebold, »nicht als eine Art Tag- oder Sommerschlaf bezeichnet werden können?«
Hinsichtlich der Nahrung kommt die Schleie in allen Stücken mit dem Karpfen überein.
Die Laichzeit fällt in die Monate März bis August. Um diese Zeit sieht man das Weibchen, gewöhnlich von zwei Männchen verfolgt, von einem Binsen- oder Rohrbüschel zum andern schwimmen, um hier die Eier abzugeben. Beide Geschlechter werden so von dem Fortpflanzungstrieb beeinflußt und beansprucht, daß sie alle Scheu vergessen und oft mit einem gewöhnlichen Hamen aus dem Wasser geschöpft werden können. Nach Blochs Schätzung setzt ein Rogener von zwei Kilogramm gegen eine halbe Million Eier ab; die Vermehrung ist also eine sehr starke. Die Jungen wachsen ziemlich schnell heran; doch vergehen immerhin vier Jahre, bevor sie fortpflanzungsfähig werden. Im ersten Jahre erreichen sie etwa zweihundert, im zweiten siebenhundertundfünfzig Gramm, im dritten ein bis anderthalb Kilogramm an Gewicht. Ihre Lebensdauer soll sich auf sechs bis zehn Jahre erstrecken: eine Schätzung, die gewiß zu niedrig gegriffen sein dürfte.
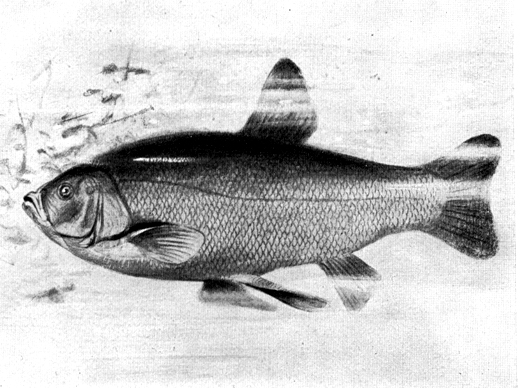
Schleie ( Tinea vulgaris)
Außer in Norddeutschland wird die Schleie bei uns zulande zu wenig gewürdigt. Ihr Fleisch erzielt kaum höheren Preis als das der Karausche, übertrifft das letztere jedoch unzweifelhaft in jeder Beziehung; sie selbst zählt zu den anspruchslosesten Fischen des Erdballes. Abgesehen vom Aale eignet sich kein anderer Fisch in demselben Grade wie sie zur Besetzung sumpfiger, sonst höchstens der wertlosen Karausche preisgegebener Gewässer; ihre Zucht verdient schon aus diesem Grunde die wärmste Empfehlung.
*
Die Barben ( Barbus), die die zahlreichste Sippe der Familie bilden, tragen vier Bartfäden an der oberen Kinnlade des unterständigen Mundes, haben kurze Rücken- und Afterflossen, in deren ersteren sich ein ziemlich starker Knochenstrahl befindet, und jederseits in drei Reihen zu zwei, drei und fünf gestellte löffelförmige, das heißt kegelige, nach hinten hakig umgebogene, auf der hinteren Seite löffelförmig ausgehöhlte Schlundzähne.
Unsere Barbe oder Flußbarbe ( Barbus fluviatilis), die eine Länge von sechzig bis siebzig Zentimeter und ein Gewicht von vier bis fünf, ausnahmsweise sogar neun bis zwölf Kilogramm erreichen kann, ist gestreckt gebaut, auf dem Rücken olivengrün, an der Seite und am Bauche lichter, nämlich grünlichweiß, an der Kehle weiß gefärbt; die Rückenflosse ist bläulich, die Afterflosse gleichfarbig, aber schwärzlich gesäumt; die übrigen Flossen sehen rötlich aus.
Die Flußbarbe bevölkert das Gebiet aller deutschen Ströme und verdient diesen Namen insofern, als sie stehendes Wasser meidet. Flüsse mit sandigem, kiesigem Grund sagen ihnen besonders zu. Während des Sommers halten sie sich gern zwischen verschiedenen Wasserpflanzen auf; sobald aber diese im Herbst absterben, suchen sie tiefere Stellen der Flüsse und wählen sich hier Zufluchtsorte unter und an Steinen, in Höhlungen und dergleichen, wühlen sich auch wohl am Uferrande ein, da sie, wie der alte Geßner sich ausdrückt, »graben wie ein Saw«. Unter solchen Umständen geschieht es, daß sie sich in besonders günstigen Versteckplätzen zuweilen haufenweise ansammeln, förmlich übereinanderlegen und in gewissem Sinne Winterschlaf halten. Im Jahre 1811 fand man, laut Schinz, die Einfassung des Wasserrades an der Röhrbrücke zu Zürich so voll Barben, daß binnen weniger Stunden über zehn Zentner gefangen wurden, die kleineren, die man wieder ins Wasser warf, ungerechnet: sie lagen meterhoch übereinander.
Unter den deutschen Karpfen gehört die Barbe zu den lebendigsten und regsten, obwohl auch ihr noch ein gut Teil Faulheit nicht abgesprochen werden kann. Tagsüber liegt sie gewöhnlich still; des Nachts dagegen ist sie viel in Bewegung, um Futter zu suchen. Dieses besteht aus kleinen Fischen, Würmern, Schlamm und tierischen Abfällen, so auch Menschenkot. Heckel erwähnt, daß sie sich scharenweise in der Nähe des Klosters Zwettel an solchen Stellen aufhalten, wo Aborte in den Kamp einmünden, und daselbst ausnehmend gedeihen.
Die Fortpflanzung fällt in die Monate Mai und Juni; einzelne laichen jedoch bereits im März und April und andere noch, vielleicht zum zweiten Male, im Juli und August. Um diese Zeit bilden die Barben Züge von hundert Stück und darüber, die in langer Reihe hintereinander herschwimmen, so daß die alten Weibchen den Zug eröffnen, die alten Männchen ihnen folgen, minder alte ihnen sich anreihen und die Jungen den Schluß bilden. Die Vermehrung scheint gering zu sein: Bloch zählte in dem Rogen nur etwa achtzigtausend Eier. Im Herbst haben die ausgeschlüpften Jungen eine Länge von etwa acht Zentimeter erreicht; im vierten Jahr sind sie bei einem Gewicht von sieben- bis fünfzehnhundert Gramm fortpflanzungsfähig geworden.
Das Fleisch der Barbe ist nicht nach jedermanns Geschmack und sehr mit Gräten durchwebt. Eigentümlich und bis jetzt noch unerklärlich ist, daß der Rogen giftige Eigenschaften hat. »Seine Eyer«, sagt schon Geßner, »sind gantz schädlich: dann sie führen den Menschen in gefahr Leibes vnd Lebens mit großer Pein und schmertzen: nemlich sie bewegen den gantzen Leib mit starckem treiben oben vnd vnden auß.« Das ist vollkommen richtig, mögen einzelne hierüber spotten wie sie wollen; ich selbst habe die Wahrheit an mir und meiner Familie erfahren.
Zur Teichwirtschaft eignet sich die Barbe insofern, als sie den »Hecht im Karpfenteich« ersetzen kann, das heißt die trägen Karpfen aufrührt, in Bewegung bringt und so, wie man annimmt, vor Krankheiten bewahrt. Im engeren Gewahrsam hält sie sich gut und erfreut durch ihre Beweglichkeit und Spiellust.
*
Von den Barben unterscheiden sich die Gründlinge ( Gobio) durch die langen Bärtel in den Mundwinkeln, die hochgestellten Augen, das Fehlen des Stachels in der Rückenflosse, die größeren Schuppen und die jederseits in zwei Reihen zu drei oder zwei und zu fünf geordneten hakenförmigen Schlundzähne.
Der Gründling, der auch Grundel oder Kresse heißt ( Gobio fluviatilis), erreicht eine Länge von zwölf bis fünfzehn, höchstens achtzehn Zentimeter und ist oben auf schwärzlichgrauem Grunde dunkelgrün oder schwarzblau gefleckt, besonders deutlich längs der Seitenlinie, unten silberglänzend mit mehr oder minder deutlichem rötlichen Schimmer; Rücken- und Schwanzflosse zeigen auf gelblichem Grunde schwarzbraune Flecke; die übrigen sind einfarbig blaßgelb oder rot.
Über einen großen Teil Europas und Westasiens verbreitet, herbergt der Gründling vorzugsweise in Seen, Flüssen und Bächen, findet sich jedoch auch in Sümpfen und selbst in unterirdischen Gewässern, wie zum Beispiel in der Adelsberger Grotte. In den deutschen Strömen gehört er zu den gewöhnlichen Fischen; in Großbritannien und Irland ist er ebenso häufig wie auf dem Festlande, in Rußland ebenfalls nicht selten, in Westsibirien und der Mongolei, nach eigenen Beobachtungen zum Beispiel im Altai, überaus gemein. Reines Wasser mit Sand- oder Kieselgrund zieht er jedem andern vor. Fast immer sieht man ihn in zahlreichen, dichtgedrängten Scharen. Seine Nahrung besteht aus Fischbrut, Würmern, faulendem Fleisch und Pflanzenstoffen. Wegen seiner großen Vorliebe für Aas sagt man, daß er ein Totengräber sei. Als man nach der Belagerung von Wien 1683 die erschlagenen Türken nebst den getöteten Pferden, um sie los zu werden, in die Donau warf, fand man später, wie Marsigli erzählt, sehr viele Gründlinge in der Nähe des Aases oder in den Leibeshöhlen desselben und bemerkte dabei, daß sie menschliche Leichen dem Aase der Rosse entschieden vorzogen.
Im Frühling steigt der Gründling massenweise aus den Seen in die Flüsse empor, um hier seinen Laich abzusetzen. Während der Fortpflanzungszeit dunkelt seine Färbung, und gleichzeitig entwickelt sich beim Männchen ein feinkörniger Ausschlag auf dem Scheitel, auf den Schuppen des Rückens und der Seiten und den Brustflossenstrahlen, außerdem eine eigentümliche Hautwucherung. Das Laichen erfolgt vom Mai an in Absätzen und währt etwa vier Wochen. Die kleinen Eierchen sehen blau aus und werden, da sie den belebenden Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, bald gezeitigt. Brut von zwei Zentimeter Länge gewahrt man im Anfang August oft in unglaublich dichten Schwärmen. Nach vollendeter Brutzeit kehrt der Gründling wieder in tiefere und in stehende Wässer, also auch in seine Wohnseen zurück.
In Nordostdeutschland wird unser Fisch im Spätherbst regelmäßig in bedeutender Menge gefangen. Während des Sommers betreibt man den Fang vorzugsweise mit der Angel, weil der Gründling zu denjenigen Fischen gehört, die auch das Vorhaben des ungeschickten Anglers lohnen. Die Engländer pflegen vor dem Fang mit der Angel den Grund mit einer eisernen Hacke aufzukratzen, weil der Greßling beim Vorüberschwimmen an derartigen Stellen zu verweilen Pflegt, um nach kleinem Getier zu suchen. Bei einiger Geschicklichkeit hält es nicht schwer, binnen kurzer Zeit mehrere Dutzend dieser niedlichen Fischchen zu erbeuten.
Das wohlschmeckende Fleisch macht den Gründling trotz seiner geringeren Größe überall beliebt. Außerdem läßt er sich als Futterfisch für bessere Edelfische mit Vorteil in der Teichwirtschaft verwenden. Eine verwandte Art, der Steingreßling oder Wapper ( Gobio uranoscopus), hat gestrecktere Gestalt, längere Bärtel und noch höher gegen die schmälere Stirn gerückte, schief gestellte Augen, ist auf Rumpf und Flossen völlig ungefleckt oder längs des Rückens und der Seitenlinie mit einer Reihe großer braunen Flecke und auf jeder Schuppe mit zwei schwarzen Punkten gezeichnet. Agassiz entdeckte den Steingreßling in der Isar; später hat man ihn in der Salzach, der Sau und der Idria gefunden.
*
Die Gestalt der Bitterfische ( Rhodeus) ist gedrungen, hochrückig, der Mund halb unterständig, ohne Bärtel; die über den Bauchflossen stehende, mit der Afterflosse gleichlange Rückenflosse beginnt mit glatten Knochenstrahlen; die Schlundzähne ordnen sich jederseits zu fünf in einfacher Reihe und haben seitlich zusammengedrückte, schräg abgeschliffene Kronen.
Wenige unserer Flußfische kommen dem Bitterlinge ( Rhodeus amarus) an Zierlichkeit der Gestalt und Schönheit der Färbung gleich; ja, man sagt schwerlich zu viel, wenn man behauptet, daß dieser etwa fünf Zentimeter lange zwerghafte Karpfen den berühmten Goldfisch an Pracht noch übertrifft. In der Gestalt erinnert der Bitterling an die Karausche. Die Färbung ist verschieden, je nach Geschlecht und Jahreszeit. »Außer der Laichzeit«, sagt Siebold, der dieses Fischchen neuerdings am ausführlichsten beschrieben hat, »erscheinen beide Geschlechter gleich gefärbt, nämlich mit graugrünem Rücken und silberglänzenden Seiten. Sehr bezeichnend ist ein grüner, glänzender Längsstreifen, der sich zu beiden Seiten des Leibes, von der Mitte desselben bis zum Schwanze erstreckt. Die Flossen sind blaßrötlich gefärbt und die Rückenflosse ganz, die Schwanzflosse am Grunde mit schwärzlichem Farbstoff bedeckt. Die einfache Färbung verschwindet zur Brunstzeit an dem männlichen Bitterlinge vollständig und macht einem prächtigen Hochzeitskleide Platz, dessen Farbenglanz sich schwer naturgetreu beschreiben läßt. Die ganze Körperoberfläche der brünstigen Männchen schillert in allen Regenbogenfarben, wobei sich Stahlblau und Violett besonders bemerklich machen und der smaragdgrüne Seitenstreifen noch glänzender hervortritt, während die Brust- und Bauchseite in einem schönen Orangegelb prangen; auch die Rücken- und Afterflosse zeigen sich hochrot gefärbt und schwarz gesäumt.
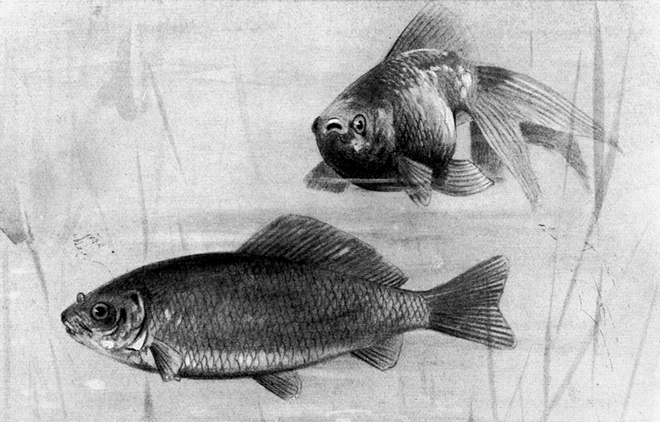
Goldfisch (
Carassius auratus)
Schleierschwanz (
Carassius auratus var. japonicus bicaudatus)
Mit der Entwicklung dieser Farbenpracht beginnt noch ein anderer Geschlechtsunterschied hervorzutreten, der sich auf eine Veränderung der Haut dicht über der Oberlippe bezieht. Hier erhebt sich an den beiden äußeren Enden der Oberkiefer allmählich ein rundlicher Wulst, der aus einem Haufen von acht bis dreizehn ungleich großen, kreideweißen Warzen besteht; zwei bis drei diesen ganz ähnliche Warzen kommen noch an dem oberen Rande der beiden Augenhöhlen zum Vorschein. Jede einzelne ist nichts anderes als eine Anhäufung von dicht über- und untereinander gedrängten Oberhautzellen. Nach Beendigung des Fortpflanzungsgeschäfts verlieren sie sich und hinterlassen bleibende Gruben, aus denen bei der Wiederkehr der Brunstzeit von neuem jene warzenähnlichen Gebilde hervorsprossen.
Obgleich die Weibchen der Bitterlinge auch während der Laichzeit ihre Farblosigkeit behalten und so von ihrem prächtig geschmückten Männchen auffallend abstechen, zeichnen sie sich doch während jener Zeit durch ein ganz eigentümliches äußeres Merkmal aus, das trotz seiner Augenfälligkeit erst vor kurzem durch Krauß bemerkt wurde. Es ist eine lange rötliche Legeröhre, die sich an dem weiblichen Bitterling bei Eintritt der Laichzeit allmählich entwickelt und, sowie die Eier im Eierstock ihre Reife erlangt haben, vor der Afterflosse fünf Zentimeter langer Bitterlinge als ein bis zu neunzehn Millimeter ausgewachsener wurmförmiger Strang frei am Hinterleib herabhängt. Ich habe diese Legeröhre bei größeren Bitterlingen vierzig bis fünfundfünfzig Millimeter lang entwickelt gesehen. Dieses Organ ragt dann mit seiner Spitze oft über das Ende der Schwanzflosse hinaus und verleiht dem Fischchen während des Schwimmens ein sonderbares Ansehen; man möchte glauben, es hinge ihm ein verschluckter Regenwurm oder der eigene Darm aus dem After hervor.« Die eigentümliche Bedeutung gedachter Röhre erkannte erst Noll. Mehrere Beobachter der letzten Jahrzehnte des vorigen und der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hatten in den inneren Kiemenfächern der Malermuschel bald mehr, bald weniger, in einzelnen Fällen bis vierzig Fischeier und aus diesen hervorgegangene Keimlinge in verschiedenen Zuständen der Entwicklung gefunden, ohne jedoch über die Art des Fisches und über die Weise, durch die dessen Eier in die Kiemen gelangten, sich klar geworden zu sein. Erst, nachdem Siebold die Bitterlingseier als gelbe, eiförmige Gebilde von etwa drei Millimeter Länge und zwei Millimeter Dicke beschrieben hatte, sprach Noll aus, daß unzweifelhaft der Bitterling derjenige Fisch sein müsse, »der der Malermuschel seine Eier zur Aufbewahrung, gewissermaßen zum Ausbrüten, unterschiebt.« Versuche, die der letztgenannte Forscher anstellte, bestätigten diese Behauptung, zuletzt auch die gleichzeitig ausgesprochene Vermutung, daß die beschriebene Legeröhre das Werkzeug sein müsse, mittels dessen der laichende Fisch die Eier bis in das Innere der Kiemenfalten einzuführen imstande ist. Mit Fischeiern behaftete Malermuscheln wurden in besonderen Beobachtungsbecken gehalten und erfüllten nach geraumer Zeit das Becken mit jungen, innerhalb ihrer Kiemen gezeitigten und bis dahin vor allem Schaden bewahrten Bitterlingen; gefangenen laichfähigen Fischen wurden im rechten Augenblick Malermuscheln zur Verfügung gestellt und deren Sitten und Gewohnheiten, deren Treiben und Gebaren bis zum Eierlegen beobachtet, bis jeglicher Zweifel geschwunden und die Frage vollkommen gelöst war.
Nach Nolls trefflichen Beobachtungen gewöhnt sich der Bitterling sehr bald in einem entsprechend hergerichteten Becken ein. Anfänglich verbirgt er sich zwar tagsüber soviel wie möglich unter der Decke der auf der Oberfläche schwimmenden Blätter und zeigt sich nur des Nachts munter und rege; schon nach wenigen Tagen aber erscheint er, durch Futter gelockt, auch bei Tage außerhalb seines Versteckes, verliert nunmehr binnen kurzem alle Scheu vor dem Menschen und gestattet diesem zuletzt allerlei störende Maßnahmen, ohne deshalb in Aufregung zu geraten. Gewandt und sicher bemächtigt er sich der ihm gereichten Flohkrebse, geschickt zieht er Bachwürmer aus dem Bodensatze seines Beckens hervor, ohne Umstände nimmt er aber auch mit Ameisenpuppen, Fleischbröcklein und Brotkrümchen vorlieb. Hunger verrät er durch anhaltendes und genaues Untersuchen aller nahrungversprechenden Teile seines Behälters; Futterneid äußert er, indem er andere seinesgleichen durch nach rechts und links geführte Schläge seines Kopfes abzutreiben sucht. Spielend jagen sich Männchen und Weibchen umher, und vergnüglich gefallen sie sich in munteren Sprüngen, die ihnen im unüberdeckten Becken manchmal freilich auch gefährlich werden können. Reges Leben beginnt mit Eintritt der Fortpflanzungszeit, deren Herannahen durch das geschilderte Farbenkleid des Männchens sowie Vollerwerden der Leibesseiten und Hervortreten der Legeröhre des Weibchens sich kundgibt. Die Legeröhre verlängert sich anfänglich sehr langsam, später rascher, zuletzt ungemein schnell und verkürzt sich nach dem Ablegen der Eier binnen wenigen Stunden bis auf einen geringen Bruchteil ihrer größten Ausdehnung. Für das Männchen ist die gewöhnlich jählings erfolgende größte Ausdehnung der Legeröhre stets Anlaß zu lebhafter Erregung, die sich, wie bei anderen Fischen, in erhöhter Färbung und lebhafter Unruhe betätigt. Erbost jagt es andere seines Geschlechtes umher; heftig treibt es aber auch das erkorene Weibchen, bis bei diesem die ihm sonst eigene gleichgültige Ruhe ebenfalls lebhafter Erregung weicht und es sich endlich zu der von dem Männchen erkorenen Muschel begibt, um die Eier abzulegen. Sobald das Ei in sie eintritt, steift sich die Legeröhre und verharrt in diesem Zustande, bis jenes ausgestoßen worden ist. Vor dem Laichen stellt sich das Weibchen senkrecht, mit dem Kopfe nach unten gerichtet, über die Muschel, betrachtet dieselbe längere Zeit und fährt in demselben Augenblick, in dem ein Ei blitzschnell in die Legeröhre einschießt und sie streckt, auf das als Amme dienende Weichtier herab, um die Spitze der Röhre in dessen Atemschlitz einzuschieben, das Ei abzugeben und die Röhre schleunigst wieder herauszuziehen. Nicht immer gelingt es dem Fischchen, seine Legeröhre einzuführen und das Ei abzulegen; dieses tritt dann wiederum in den Leib zurück, und es währt oft lange, bevor sich neue Erregung bemerklich macht und der Vorgang wiederholt. Das Männchen sieht letzterem aufmerksam zu, stößt unmittelbar, nachdem das Weibchen die Muschel verlassen hat, aus diese herab, bleibt, am ganzen Leibe zitternd und alle Flossen ausgespannt, einen Augenblick über ihr stehen und ergießt endlich den Samen über ihren Atemschlitz, um so das Ei zu befruchten. Nach vollendetem Laichen ziehen sich beide Geschlechter ermattet in das Gewirr der Pflanzen zurück und gebaren sich scheu und ängstlich; das Männchen verliert seine prachtvolle Färbung, und dem Weibchen schrumpft die Legeröhre zusammen; nach einiger Zeit, in Zwischenräumen von mehreren Tagen, wiederholt sich jedoch der Hergang, und so währt es fort, bis die Laichzeit vorüber ist. Im Freien fällt letztere in die Monate April bis Juni, in der Gefangenschaft beginnt sie in der Regel schon früher und pflegt eher beendet zu sein.
Soweit bekannt, erstreckt sich der Verbreitungskreis des Bitterlinges über ganz Mittel- und Osteuropa und ebenso über einen Teil Asiens. In der Donau und ihren Zuflüssen, im Rhein, dem Gebiet der Elbe und der Weichsel ist er stellenweise häufig, ebenso in Taurien da, wo sich Gewässer finden, wie er sie liebt. Er bevorzugt reines, fließendes Wasser mit steinigem Grund, nach Siebold insbesondere die sogenannten toten Arme der Flüsse und Bäche. Von der Ebene steigt er ins Hügelland und selbst zum Mittelgebirge auf. Ungewöhnliche Lebenszähigkeit gestattet ihm, der Kälte wie der Hitze zu trotzen. Jäckel sah ihn im März unter dem Eis eines seichten Grabens, der im vorigen Winter bis auf den Grund gefroren gewesen sein mußte, munter umherschwimmen und beobachtete ebenso, daß es ihm nichts schadete, als er an einem warmen Herbsttag ohne Wasser oder feuchtes Moos in einer Pflanzensammelbüchse eine Gehstunde weit getragen wurde.
Wegen des bitteren Geschmackes, der das Fleisch dieses Fischchens für uns fast oder wirklich ungenießbar macht, wird es wenig gefangen und gewöhnlich nur zum Ködern der Angeln benutzt. Wie sehr es als Zierfisch die Beachtung aller Liebhaber verdient, bedarf nach Vorstehendem nicht weiterer Auseinandersetzung.
*
Eine der zahlreichen Sippen der Karpfenfamilie umfaßt die Brachsen ( Abramis). Ihr Leib ist hoch, seitlich zusammengedrückt; der schiefgestellte Mund hat keine Bärtel: die Rückenflosse fällt von oben nach hinten steil ab; die Afterflosse übertrifft sie bedeutend an Länge: die Schwanzflosse ist ungleichlappig und tief gabelförmig ausgeschnitten; die Schuppen des Vorderrückens sind wirtelständig geteilt, sozusagen gescheitelt, indem die Mittellinie hier als schuppenlose Längsfurche erscheint und jederseits nur durch kleine Schuppen eingefaßt wird; die Unterseite kantet sich von den Bauchflossen bis zur Aftergrube scharf zu und bildet gleichzeitig eine ebenfalls schuppenlose Hautkante.
Als Urbild dieser Sippe betrachtet man die verbreitetste und häufigste Art derselben, den Blei, auch Brachsen und Brasser genannt ( Abramis brama), einen stattlichen Karpfen von sechzig Zentimeter bis ein Meter Länge und vier bis zehn Kilogramm Gewicht, durch seinen stark seitlich zusammengedrückten Leib und die ansehnliche Höhe desselben leicht kenntlich, auf Oberkopf und Rücken schwärzlich, auf den Seiten gelblichweiß mit Silberglanz, an der Kehle rötlich, auf dem Bauche weiß gefärbt, seitlich schwarz gepunktet, mit schwarzblauen Flossen. Auch die Männchen dieser Art erleiden während der Fortpflanzungszeit eine Veränderung, indem auf ihrer Hautoberfläche ebenfalls warzenförmige Gebilde hervorwachsen. Diese verdichteten und erhärteten Haufen von Oberhautzellen haben stumpfkegelförmige Gestalt und anfangs weißliche Färbung, die später zu Bernsteingelb dunkelt.
Ganz Mittel-, Nord- und Osteuropa ist die Heimat des Blei. Sehr häufig bewohnt er die Gewässer aller deutschen Hauptströme, insbesondere die mit ihnen in Verbindung stehenden tieferen Seen, und hier, wie schon Geßner wußte, solche Stellen, die lehmigen Boden haben; »dann solcher grund Wirt von jnen begert«. Nach Eckström fängt man ihn um Schweden und Norwegen auch im Meere; doch gehört ein derartiges Vorkommen zu den Ausnahmen. Während des Sommers verweilt er in der Tiefe, namentlich zwischen dem sogenannten Brachsengras, wühlt hier im Schlamm und trübt dadurch auf weithin das Wasser. Wahrscheinlich geschieht dieses Wühlen im Schlamm der Nahrung halber, die in Würmern, Kerflarven, Wasserpflanzen und Schlamm selbst besteht.
Fast immer trifft man diese Fische in starken Gesellschaften an; mit Beginn der Laichzeit, die in die Monate April bis Juni fällt, vereinigen sich diese Scharen zu unzählbaren Heeren. In der Nähe des Ufers, an seichten, grasigen Stellen, erscheinen zunächst mehrere Männchen und später die Weibchen. Erstere tragen ebenfalls ein Hochzeitskleid und werden dann in Bayern, ihrer dornigen Auswüchse halber, Perlbrachsen genannt. Eines von ihnen wird, laut Yarrell, gewöhnlich von drei oder vier Männchen verfolgt; die ganze Gesellschaft drängt sich aber bald so durcheinander, daß man zuletzt nur noch eine einzige Masse wahrnimmt. Das Laichen geschieht gewöhnlich zur Nachtzeit unter weit hörbarem Geräusch, weil die jetzt sehr erregten Fische sich lebhaft bewegen, mit den Schwänzen schlagen und mit den Lippen schmatzen, bevor die Weibchen ihre kleinen gelblichen Eierchen, etwa einhundertvierzigtausend Stück jedes einzelne, an Wasserpflanzen absetzen. Bei günstiger Witterung ist das Laichen binnen drei bis vier Tagen beendet; tritt jedoch plötzlich schlechtes Wetter ein, so kehren sie wieder in die Tiefe zurück, ohne den Laich abgesetzt zu haben. Wenige Tage nach dem Abzuge der Fische wimmeln die seichten Uferstellen von Millionen ausgeschlüpfter Jungen, die noch einige Zeit auf der Stätte ihrer Geburt sich umhertreiben und dann ihren Eltern in die Tiefe folgen. Wahrscheinlich bringen auch die Brachsen einen Teil des Winters im Schlamme ruhend zu.
Das Fleisch wird von einigen außerordentlich gerühmt, von anderen gering geschätzt. Jene sagen, daß der Blei nächst dem Karpfen unser bester Flußfisch wäre; diese meinen, daß sein Fleisch der vielen Gräten halber kaum genossen werden könne. Wahrscheinlich hängt das Urteil ab von der Größe der geprüften Fische und der Örtlichkeit, auf der sie lebten, weil das Fleisch von größeren Bleien besser ist als das von kleineren, und weil es einen Modergeschmack annimmt, wenn sich der Fisch vor dem Fange längere Zeit in sumpfigem oder stark schlammigem Gewässer aufhielt. Allerorts wird der Blei eifrig verfolgt. In Großbritannien ist er der Lieblingsfisch der Angler, weil er leicht anbeißt; im Norden und Osten unseres Vaterlandes betreibt man den Fang gewöhnlich mit großen Netzen und regelmäßig mit gutem Gewinn. Unter günstigen Umständen werden viele dieser Fische eingesalzen und geräuchert. In der Teichwirtschaft verwendet man sie ebensowenig wie andere Brachsen.
Zärthe, Blau- oder Meernase, Näsling ( Abramis vimba), nennen die Fischer einen Brachsen, der weit über Europa verbreitet ist, hauptsächlich dem Norden angehört und nicht bloß in süßem, sondern auch in brackigem und salzigem Wasser gefunden wird. Während sie in einzelnen Süßgewässern nicht zu wandern scheint, steigt sie vom Meere aus im Frühling in die Flüsse auf, um zu laichen, verweilt in denselben während des Sommers und kehrt dann nach tieferen Gewässern zurück, um hier den Winter zu verbringen. In den Seen hält sich die Zärthe gewöhnlich in einer Tiefe von zehn bis zwanzig Faden auf, regelmäßig da, wo der Grund schlammig ist; denn auch sie wühlt nach Art ihrer Verwandten nahrungsuchend im Boden und trübt dadurch das Wasser so, daß sie sich selbst verrät. Während der Laichzeit vereinigt sie sich zu sehr großen Scharen und gibt dann Gelegenheit zu ergiebigem Fang. So werden, laut Pallas, in allen russischen Strömen, die ins Schwarze Meer münden, alljährlich unschätzbare Mengen gefangen, eingesalzen, getrocknet und fuderweise in entfernte Teile des Reiches geführt. Ihr Fleisch wird dem des Blei gleichgeachtet. Nach Bloch legt jeder Rogener gegen dreimalhunderttausend Eier, und zwar auf seichten, steinigen oder kiesigen Stellen der Flüsse. Dies geschieht regelmäßig im Mai und Juni, und die fortpflanzungslustigen Fische gebaren sich dabei ganz wie die Bleie, indem sie sich heftig bewegen und lärmend im Wasser umhertoben.
An der verdickten und verlängerten, weit übergreifenden Nase, dem unterständigen Maul und der weit nach hinten angesetzten Afterflosse läßt sich die Zärthe leicht erkennen. Die Färbung des Scheitels und des Rückens ist ein unreines Braun oder Blau; die Seiten sind heller, die Unterseiten silberglänzend, die Rücken- und Schwanzflosse bläulich, die Bauch- und Afterflosse gelblichweiß, die Brustflossen an der Wurzel rotgelb. Ganz anders erscheint derselbe Fisch im Hochzeitskleid, das zu Ende Mai oder Anfang Juni mit dem Eintritt der Laichzeit angelegt wird. Oberleib, Schnauze, Kopf, Rücken und Seiten bis weit unterhalb der beiden Seitenlinien, sind dann, laut Siebold, mit tiefschwarzem Farbstoff bedeckt, und die dunkler gefärbten Leibesseiten haben einen eigentümlichen Seidenglanz. Von diesem Dunkel sticht die orangegelbe Färbung der Lippen, Kehle, Brust, Bauchkanten, eines schmalen Streifens unterhalb des Schwanzes sowie der paarigen Flossen lebhaft ab. »Die Farbenveränderung der Zärthen hält gleichen Schritt mit der Entwicklung der Fortpflanzungswerkzeuge und ist nicht etwa abhängig von dem mit der Brunstzeit eintretenden Wechsel ihres Aufenthaltsortes.« Während der Fortpflanzungszeit tragen beide Geschlechter dasselbe Kleid; die Männchen aber zeigen außerdem einen aus vielen, winzig kleinen Erhöhungen bestehenden körnerartigen Ausschlag. An Größe steht die Zärthe hinter dem Blei bedeutend zurück.
Einen der Zärthe sehr ähnlichen Fisch, den Seenäsling ( Abramis elongatus), der in der Donau und einigen oberbayerischen Seen lebt, sehen einige Fischkundige als Art, andere, wahrscheinlich mit Recht, nur als Abart der Rußnase an.
Den Pleinzen ( Abramis ballerus), einen Fisch von dreißig bis vierzig Zentimeter Länge und etwa einem Kilogramm Gewicht, kennzeichnen der kleine Kopf, das schief nach aufwärts gerichtete Maul und die große Afterflosse. Die Färbung ähnelt der der andern Arten. Der Pleinzen wird in allen Hauptflüssen Mitteleuropas, vornehmlich in der Nähe der Mündungen, seltener im oberen Lauf der Gewässer, gefunden. Besonders häufig bewohnt er die Gewässer längs der Ostseeküste, und zwar die Haffe ebensowohl wie die nahe dem Meere gelegenen und durch Bäche oder Flüsse mit ihnen in Verbindung stehenden Süßwasserseen. Die Lebensweise ähnelt der beider beschriebenen Verwandten.
Die Blicke, auch Blecke, Güster, Plieten und Rotplieten genannt ( Abramis bjoerkna), unterscheidet sich von andern Brachsen durch die in zwei Reihen zu zwei, seltener zu drei und zu fünf stehenden Schlundzähne, deren innere Reihe auf den Kronen schräg abgeschliffene, schmale und einfach gefurchte Kauflächen mit einer Kerbe vor der Spitze zeigt, und das endständige Maul. Sie erreicht eine Länge von zwanzig bis dreißig Zentimeter und ein Gewicht von höchstens einem Kilogramm und ist auf dem Rücken blau mit bräunlichem Schimmer, auf den Seiten blau mit Silberglanz, auf dem Bauche weiß gefärbt; After- und Schwanzflosse sehen graublau, Brust- und Bauchflossen an der Wurzel rötlich aus.
Die Blicke gehört zu den gemeinsten Fischen unserer Gewässer und bewohnt Seen und Teiche, Flüsse mit sanfter Strömung und Sand- und Tongrund. Sie hält sich gern in der Tiefe, frißt Gewürm, Fischlaich und Pflanzenstoffe und wühlt nach diesen ebenfalls im Schlamm. In den Monaten Mai und Juni nähert sie sich seichten Uferstellen, am liebsten solchen, die mit Riedgras bewachsen sind, in der Absicht, zu laichen, und zeigt nunmehr ein in jeder Hinsicht verändertes Betragen. Während sie sonst scheu und vorsichtig ist, bei der geringsten Störung davoneilt und sich im Grunde verbirgt, benimmt sie sich während des Laichens ebenso lebhaft wie unvorsichtig, läßt sich zuweilen sogar geradezu mit der Hand fangen. Siebold bemerkt, daß sich die Fortpflanzungsfähigkeit bei den Blicken sehr früh einstellt, da er dreizehn Zentimeter lange Rogener und Milchner, deren Geschlechtstätigkeit im vollen Gange war, gefunden hat. Bloch zählte den Rogen eines mäßig großen Weibchens und fand, daß derselbe über hunderttausend Eier enthielt. Die alten Blicken beginnen mit dem Eierlegen im Anfang Juni und beendigen dieses Geschäft binnen drei und vier Tagen, falls nicht kalte Witterung eintritt, die sie zu möglichster Eile veranlaßt. Etwa eine Woche später erscheinen die mittelgroßen und wiederum nach acht Tagen die kleinsten.
Nach Angabe Eckströms ist die Blicke der gefräßigste aller Karpfen, ihr Fang daher auch ungewöhnlich einfach und leicht, weil jeder Köder seine Dienste tut. In großartigem Maßstabe betreibt man diesen Fang übrigens nirgends; denn als Nahrungsmittel wird unser Fisch von niemandem geschätzt, schon weil ihn mehr als andere Riemenwürmer, deren oft sechs bis acht in seinem Bauche wohnen, plagen.
*
Mit dem Namen Messerkarpfen oder Sichlinge ( Pelecus) bezeichnet man die Sippschaft eines zu unserer Familie gehörigen, von den übrigen jedoch sehr abweichenden Fisches, der sich durch geradlinigen Rücken und stark ausgebogenen Bauch kennzeichnet.
Der Sichling, der auch Messerkarpfen und Dünnbauch genannt wird ( Pelecus cultratus), der einzige Vertreter dieser Sippe, hat gestreckten, seitlich zusammengedrückten Leib und ist im Nacken stahlblau oder blaugrün, auf dem Rücken graubraun, auf den Seiten mit silbernem Glanze, auf Rücken- und Schwanzflosse graulich, auf den übrigen Flossen rötlich gefärbt. Seine Länge beträgt vierzig Zentimeter, das Gewicht bis ein Kilogramm.
Die Verbreitung des Sichlings ist in mancher Beziehung eine eigentümliche. Er bewohnt im Norden Mitteleuropas nur die Ostsee und die mit ihr zusammenhängenden großen Süßwasserbecken und steigt von hier aus in den Flüssen empor, lebt aber auch im Schwarzen Meer und wird demgemäß regelmäßig in allen in dasselbe einmündenden Strömen bemerkt. Einen eigentlichen Meerbewohner kann man ihn nicht nennen, einen Flußwasserfisch ebensowenig; es scheint ihm ebensowohl in salzigem wie in süßem Gewässer zu behagen. Zu seinem Aufenthaltsort wählt er reines, bewegtes Wasser und die Nähe der Ufer. In seinem Wesen und Gebaren und in der Nahrung kommt er mit den andern Karpfen überein. Die Laichzeit fällt in den Mai, und die Fortpflanzung entspricht dem bereits von den Verwandten Gesagten; die Vermehrung aber scheint trotz der mehr als hunderttausend Eier, die man, nach Bloch, im Rogen eines Weibchens findet, nicht besonders stark zu sein, weil der Fisch, wenigstens in unseren Flüssen, verhältnismäßig selten ist.
Das Fleisch ist gering, weich und grätig, der Fang deshalb nicht lohnend, in manchen Gegenden Deutschlands, namentlich in Österreich, auch nicht einmal erwünscht, weil die Fischer unseren Sichling mit demselben Aberglauben betrachten wie die Vogelfänger den Seidenschwanz und auch von ihm sagen, daß er nur alle sieben Jahre erscheine und ein Vorläufer von Krieg, Hunger, Pest und anderen Übeln sei.
*
Bei den Lauben ( Alburnus) ist die gewölbte Rückenlinie weniger als die zugekantete des Bauches gebogen; die kurze Rückenflosse steht hinter den Bauchflossen, die lange Afterflosse hinter oder unter der Rückenflosse; die stark silberglänzenden, leicht abfallenden Schuppen zeigen erhabene, von einem Mittelpunkt ausgehende Strahlen; der Mund richtet sich nach oben, die etwas vorstehende Spitze des Unterkiefers greift in eine Vertiefung der Zwischenkiefer ein.
Wichtiger als alle übrigen Sippschaftsverwandten ist für uns der Ucklei, auch Weißfisch und Witing genannt ( Alburnus lucidus). Die stahlblaue Färbung der Oberseite geht auf den Seiten und dem Bauch in eine silberglänzende über; Rücken- und Schwanzflosse sind gräulich, die übrigen Flossen gelblich gefärbt. Genaueres läßt sich aus dem Grunde nicht angeben, weil der Ucklei, ebensowohl was die äußere Form als was die Färbung anlangt, vielfach abändert, ja fast in jedem Flusse, in jedem See ein anderes Aussehen hat. Mehrere dieser Abarten treten so ständig auf, daß man sich veranlaßt gesehen hat, sie als besondere Arten aufzustellen. Die Länge schwankt zwischen zehn und achtzehn Zentimeter.
In allen deutschen Strömen kommt neben dem Ucklei eine zweite Art der Sippe vor: der Schneiderfisch, auch Schneider, Schuster und Riemling genannt ( Alburnus bipunctatus). Er unterscheidet sich von jenem durch seine gedrungene Gestalt und die eigenartige Färbung. Die dunkelgraue Rückenfärbung geht an den Seiten in graulichsilberfarb, am Bauche in reinsilberfarb über; die Seitenlinie aber ist oben und unten schmal schwärzlich gesäumt, fällt daher gleich einer Naht ins Auge und hat dem Fisch zu seinem am meisten gebrauchten Namen verholfen. An Größe kommt der Schneider mit dem Ucklei ungefähr überein. In den meisten Flüssen und Seen Mitteleuropas, des Westens wie des Ostens, tritt er sehr häufig auf, vorausgesetzt, daß das Wasser derselben klar und nicht zu rauschend ist.
Geselliger als viele andere Fische, bilden die Lauben, und so auch beide beschriebenen Arten stets sehr zahlreiche, zuweilen unschätzbare Gesellschaften und tummeln sich bei warmer, windstiller Witterung nahe dem Wasserspiegel munter umher, Kerfe fangend und anderweitige Beute solcher Art aufnehmend. Sie sind, wie Heckel und Kner schildern, wenig scheu, aber neugierig und gefräßig, kehren deshalb, wenn in ihrer Nähe irgend etwas ins Wasser geworfen wird, nach augenblicklicher Flucht wieder zurück, um nachzusehen, was es war, schnappen sofort nach dem erspähten Gegenstand und geben ihn wieder von sich, wenn ihnen derselbe nicht behagt. In den Augen des Anglers, dem es nur darauf ankommt, viele Beute zu machen, gelten sie demgemäß als die dankbarsten aller Fische; denn sie beißen unter allen Umständen und nach jedem ihnen vorgeworfenen Köder. Ihre Fortpflanzungszeit fällt in die Monate Mai und Juni, kann jedoch bereits im März beginnen und bis zum August sich hinausziehen. Um diese Zeit sammeln sie sich zu dichten Scharen und steigen in den Flüssen empor, um geeignete Stellen zur Ablage der Eier auszuwählen. Zum Laichen selbst ersehen sie sich Stellen mit steinigem Grund oder zwischen Wasserpflanzen verschiedener Art, bewegen sich noch lebhafter als sonst, schnellen sich oft über die Oberfläche empor und zeigen sich überhaupt sehr erregt. Das Laichen erfolgt, nach Angabe unserer Gewährsmänner, in drei mehr oder weniger langen Zwischenräumen; die ältesten Weißfische machen den Anfang, die jüngsten den Schluß. Ihre Vermehrung ist außerordentlich stark, ihr Leben aber unverhältnismäßig kurz; denn die Art und Weise ihres Zusammenhaltens und der Bevorzugung der obern Wasserschichten macht sie zu einer häufigen Beute der Raubfische und Wasservögel, die ihren Schwärmen ununterbrochen folgen. Stürzt sich ein raubgieriger Barsch unter ihren Haufen, so pflegen sie sich außerhalb des Wassers eine Strecke weit fortzuschnellen und wissen so den Verfolgungen ihrer Feinde oft zu entgehen. Aber wie bei den Hochflugfischen geschieht es, daß dann Möwen oder Seeschwalben, ihre nicht minder wachsamen Feinde, von oben herab sich auf sie werfen und unter ihnen Beute gewinnen. »Dafür«, sagt Siebold, »behaften sie auch diese Wasservögel mit einem Bandwurm, der als Lingula simplicissima frei in ihrer Leibeshöhle vorkommt und durch sie in den Darm jener Vögel übergepflanzt wird.«
Als Nahrungsmittel gelten die Lauben insgemein, also auch unsere Weißfische, für wertlos; doch betreibt man hier und da regelmäßigen Fang, weil man sie doch genießt, als Köder für andere Fische und seit dem 18. Jahrhundert zur Herstellung der Essence d'Orient benutzt. Aus dieser fertigt man die falschen Perlen, die bekanntlich den echten täuschend ähnlich sein können und den Preis der letzteren wesentlich herabgedrückt haben. Die Erfindung, Glasperlen innerlich mit feingestoßenen Fischschuppen zu bekleiden und ihnen so jenen Perlenglanz zu verleihen, wurde vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts von einem französischen Rosenkranzverfertiger gemacht und seitdem in mehr oder minder großartigem Maßstabe betrieben. Man schuppt den Weißfisch ab, bringt die Schuppen in ein Geschirr mit Wasser und zerreibt sie hier so sein wie möglich. Das Wasser, das bald eine Silberfärbung annimmt, wird in ein großes Glas gegossen und letzteres zum Setzen der Masse mehrere Stunden lang an einen ruhigen Ort gestellt. Ist die Masse zu Boden gesunken, so gießt man das reine Wasser durch vorsichtiges Neigen des Glases ab, bis außer einem ölartigen, dicken Safte, der Essence d'Orient, nichts mehr zurückgeblieben. Die Benutzung gründet sich auf die Eigenschaft der abgeriebenen Silberglanzplättchen, in Ammoniak keine Veränderung zu erleiden. Nach den von Siebold am Mittelrhein eingezogenen Erkundigungen liefern fünfzig Kilogramm Weißfische zwei Kilogramm Schuppen und sollen zur Auswaschung von fünfhundert Gramm Silberglanz achtzehn- bis zwanzigtausend Fische erforderlich sein.
Für engeren Gewahrsam eignen sich die Lauben vorzüglich; denn sie sind die spiellustigsten und unterhaltendsten aller kleineren Fische, unablässig in Bewegung, auf alles aufmerksam, springen nach jeder kleinen Fliege oder nach jedem ins Wasser gebrachten Körper überhaupt und scheinen ebenso zufrieden wie unermüdlich zu sein.
Der Schiedling, auch Seelaube und Mairenke genannt ( Alburnus mento), übertrifft den Ucklei an Größe; seine Länge beträgt fünfzehn bis achtzehn, ausnahmsweise selbst zwanzig bis fünfundzwanzig Zentimeter. Der Leib ist gestreckt, seitlich wenig zusammengedrückt, die Mundöffnung nach oben gerichtet, das verdickte Kinn vorragend. Kopf und Rücken sehen dunkelgrün aus und schimmern stahlblau, die Seiten und die Unterseite glänzend silberfarben; Rücken- und Schwanzflosse sind schwärzlich gesäumt.
Von den bayrischen Seen verbreitet sich der Schiedling weit über das östliche Europa, bewohnt beispielsweise verschiedene Flüsse der Krim. In den stehenden Gewässern des Salzkammergutes ist er sehr häufig. Klares, kaltes Wasser mit steinigem Grund sagt ihm besonders zu. Hier steht er, laut Heckel und Kner, gegen den Strom gerichtet, lange Zeit still, gleich einer Forelle, und schießt dann plötzlich mit erstaunlicher Schnelligkeit weiter. Während der Laichzeit, die in die Monate Mai und Juni fällt, bildet sich auf der Haut des männlichen Schiedlings ein ähnlicher Ausschlag, wie er bei andern Karpfen zum Vorschein kommt. Rogener und Milchner sammeln sich, um zu laichen, in seichtem Wasser mit steinigem Grund, stellen sich dicht aneinander senkrecht auf die Köpfe, entledigen sich, mit den Schwänzen schlagend, des Rogens und der Milch und verlassen hierauf den Platz, den sodann ein zweiter und dritter Schwärm einnimmt, um dasselbe Geschäft zu vollziehen. Während der Begattung sind sie, wie die meisten übrigen Verwandten, auch weit unvorsichtiger als sonst und werden dann in zahlreicher Menge gefangen; da sie sich aber nur in solchen Gegenden vorfinden, die ohnehin reich an geschätzten Fischen sind, achtet sie niemand.
*
So harmlose Fische die Karpfen im allgemeinen sind: einzelne Räuber gibt es doch unter ihnen. Ein solcher ist der Rapfen, auch Rappe, Schied und Mülpe geheißen ( Aspius rapax), Vertreter einer gleichnamigen, artenarmen Sippe. Seine Kennzeichen liegen in dem gestreckten, seitlich etwas zusammengedrückten Leibe, der nach oben gerichteten Mundöffnung, dem vorstehenden Unterkiefer, der ebenfalls in eine Vertiefung der Zwischenkiefer eingreift, den kurzen, hinter den Bauchflossen beginnenden Afterflossen und den kleinen Schuppen. An Länge erreicht der Rapfen regelmäßig sechzig bis siebzig Zentimeter, an Gewicht bis sechs Kilogramm. Der Rücken ist schwarzblau, die Seite bläulichweiß, der Bauch reinweiß; Rücken- und Schwanzflosse sehen blau aus, die übrigen Flossen haben rötlichen Anflug.
Von Mitteleuropa an bis gegen Lappland hin hat man diesen Fisch in allen größeren Flüssen und Seen des Festlandes beobachtet; in Großbritannien dagegen scheint er gänzlich zu fehlen. Er bewohnt die bayrischen und österreichischen Seen in namhafter Menge, ist in der Donau häufig, kommt in ganz Norddeutschland vor und verbreitet sich von hier aus östlich bis nach Rußland, in dessen Gewässern er zuweilen eine riesige Größe erreicht. Reines, jedoch langsam fließendes Wasser beherbergt ihn regelmäßig, weil seine Nahrung ebensowohl in pflanzlichen Stoffen und Kleingetier wie in Fischen besteht. Die Lauben sollen von ihm oft heimgesucht und so heftig verfolgt werden, daß sie sich auf das Ufer zu retten suchen und er selbst in blinder Wut dabei aufs Trockene gerät. Gegen die Laichzeit hin, die in die Monate April und Mai fällt, jedoch auch bereits im März beginnen und bis zum Juni währen kann, beginnt auch er zu wandern, indem er aus den Seen in die Flüsse aufsteigt oder wenigstens von der Tiefe aus seichtere Stellen aufsucht. Die männlichen Rapfen zeigen dann ebenfalls einen Hautausschlag, der aus kleinen halbkugelförmigen Körnern besteht und hauptsächlich den Rücken, die Unterkieferäste, die Wangen, die Kiemendeckel, den Hinterrand der Rückenschuppen und die freie Fläche der Schwanzschuppen bedeckt. Das Laichen geschieht in Herden und währt, wie die Fischer sagen, drei Tage lang. Er wächst schnell heran, hat aber ein zartes Leben und läßt sich deshalb nicht versetzen.
Der Fang wird mit Netz und Angel betrieben und liefert namentlich zur Laichzeit reiche Ausbeute, weil sich der Rapfen dann minder furchtsam zeigt als sonst. Auch behauptet man, daß während der Fortpflanzungszeit das weiße und schmackhafte Fleisch nicht so leicht beim Kochen zerfalle, wie dies außerdem geschieht, wenn man die Fische nicht mit kaltem Wasser aufsetzt.
Der mäßig gereckte und nur wenig zusammengedrückte Leib, der breitstirnige Kopf, das endständige, schief gespaltene Maul, die hinter dem Ende der Rückenflosse beginnende Afterflosse und die beiderseits in drei Reihen zu drei und fünf geordneten Schlundzähne, deren Kronen seitlich zusammengedrückt und an der Spitze hakenförmig umgebogen sind, sind die Merkmale der Nerflinge ( Idus), deren bekanntester Vertreter der Aland, auch Rohrkarpfen und Döbler genannt ( Idus melanotus), ist. Auch dieser Fisch gehört unter die größeren Karpfenarten und kann fünfzig bis fünfundfünfzig Zentimeter Länge und mehr als drei Kilogramm an Gewicht erreichen, obschon er gewöhnlich kleiner bleibt. Seine Färbung ändert nach Aufenthalt, Jahreszeit, Alter usw. wesentlich ab. Im Frühling und während der Zeit der Fortpflanzung ist der Aland auf dem Rücken grauschwarz, goldig glänzend, an den Seiten heller, auf dem Bauch silberglänzend, auf dem Kopf und den Deckelstücken goldfarben; die Rücken- und Schwanzflosse spielen von Graublau ins Violette, die übrigen Flossen sind rot. Im Herbst wird die Färbung dunkler, die des Rückens geht von Blaugrün ins Schwärzliche über, und der goldige Glanz wandelt sich in Gelblichweiß um. Unter dem Namen Orfe oder Gold- und Rotorfe ( Idus miniatus) unterscheidet man schon seit Geßners Zeiten eine ständige Abart des Aland, die an Pracht der Färbung mit dem Goldfische wetteifern kann. Rücken und Seiten sind Hochorangegelb oder mennigrot, die untern Teile silberglänzend; eine breite, undeutlich begrenzte oder verschwimmende violette Längsbinde verläuft längs den Seiten und trennt das höhere Rot des Rückens von dem blässeren der Oberbauchgegend; die Flossen sind rot an der Wurzel und weiß an den Spitzen.
Der Aland findet sich in allen mittleren und größeren Seen Europas und Nordwestasiens, die Orfe als Zuchtfisch in mehreren Flüßchen, Bächen und Teichen, so in der Umgegend von Dinkelsbühl in Mittelfranken, außerdem noch hier und da am Rhein und Main, ist in Norddeutschland jedoch bis jetzt nicht gezüchtet worden. Jener soll, nach Eckström, auch im Meere, beispielsweise zwischen den Schären Norwegens, leben und hier ebenso gemein sein wie in den klaren Flüssen und Seen Skandinaviens. Reines, kaltes und tiefes Wasser scheint zu seinen Lebensbedingungen zu gehören.
Selten kommt er an das seichte Ufer, abends nur an die ruhige Wasserfläche. Während des Winters hält er sich auf tiefen Stellen der Gewässer auf. Seine Nahrung besteht aus Gewürm und Kerbtieren, vielleicht auch aus kleinen Fischen; ein Raubfisch wie der Schied aber ist er nicht. Gegen Anfang Mai kommt bei den Männchen der Hautausschlag zum Vorschein; bald darauf steigt der Aland aus den Seen in den einmündenden oder durchgehenden Flüssen auf und sucht sich hier sandige oder an Wasserpflanzen reiche Stellen zum Laichen aus. In günstigen Frühjahren geschieht dies früher, im April, zuweilen selbst im März, unter maßgebenden Umständen auch später, im Juni, Juli, sogar im August. Während dieser Zeit betreibt man seinen Fang mit Netz und Angel. Zum Köder für letztere wählt man Heuschrecken, Mistkäfer oder kleine Fischchen. Das Fleisch gilt für schmackhaft und wird trotz der vielen Gräten gern gegessen, nirgends aber hoch bezahlt. Auch die Orfe wird hier und da für die Küche, laut Jäckel, häufiger aber als »Karpfenwächter« benutzt, da sie gern in den obern Schichten des Wassers umherstreicht, deshalb eher als der Karpfen den über dem Weiher schwebenden Flußadler sieht und durch rechtzeitiges Tiefgehen jenen schreckt und warnt. Neuerdings verwertet man sie auch nach Art des Goldfisches, um Weiher und Springbrunnenbecken zu schmücken. Von Dinkelsbühl aus wird gegenwärtig ein ziemlich lebhafter Handel mit ihr getrieben und sie unter dem Namen »falscher Goldfisch« oder »Goldnerfling« auf weithin versendet.
*
Fast in allen Ländern Europas lebt das Rotauge, auch Rotkarpfen, Rotfeder und Rotflosser genannt ( Scardinius erythrophtalmus), Vertreter der Sippe der Rotkarpfen ( Scardinius), ein Fisch von fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter Länge und fünf- bis achthundert Gramm Schwere, dessen Färbung ebenfalls mannigfach wechselt. Gewöhnlich ist der Rücken braungrün, die Seite glänzend messinggelb, der Bauch silberweiß gefärbt, während Bauch- und Afterflosse, seltener auch die Rückenflosse, meist aber die Schwanzflosse an den Spitzen lebhaft blutrot aussehen.
Langsam fließende Gewässer oder Seen und Teiche bis zu sechzehnhundert Meter unbedingter Höhe werden von dem Rotauge vor andern Gewässern bevorzugt, weil es nicht allein nach Art der Karauschen und Schleien, sondern auch gern in deren Gesellschaft lebt. Es ist rasch in seinen Bewegungen, vorsichtig und scheu, nährt sich von Wasserpflanzen, Kerbtieren und Würmern und sucht diese zumeist aus dem Schlamm hervor. Während der Laichzeit dunkeln die Farben und bedecken sich Scheitel und Schuppen des Rückens der Männchen mit einer Menge kleiner, sehr dichtstehender Körner. Der Laich wird im April, Mai und Juni absatzweise an grasbewachsenen Stellen abgelegt; die Jungen schlüpfen nach wenigen Tagen aus.
*
Bis in die neueste Zeit hat man die Plötze mit dem Rotauge verwechselt. In der Tat haben beide Fische äußerlich große Ähnlichkeit miteinander, und der minder Geübte unterscheidet sie mit Sicherheit nur an den Schlundzähnen, die in einfacher Reihe stehen, und zwar auf dem linken Schlundknochen zu sechs oder fünf, auf dem rechten zu fünf. Die vordern Zahnkronen haben eine kegelförmige Gestalt, die hintern sind seitlich zusammengedrückt und auf der Kaufläche schräg abgeschliffen.
Die Plötze ( Leuciscus rutilus) vertritt die Sippe der Rohrkarpfen ( Leuciscus), hat einen seitlich etwas zusammengedrückten, mehr oder weniger gestreckten Leib mit endständigem Maul und großen Schuppen, ändert aber, je nach Aufenthalt und Nahrung, in den Leibesumrissen und in der Färbung vielfach ab und bildet Abarten, die mehr oder weniger Ständigkeit erlangen. Der Rücken ist gewöhnlich blau oder grünschwarz gefärbt, die Seite heller, gegen den Bauch hin silberglänzend; Bauch- und Afterflosse sehen oft fast ebenso rot aus wie die des Rotauges; die Brustflossen sind graulichweiß, die Rücken- und Schwanzflosse grau mit rötlichem Anflug. Die Länge beträgt selten über fünfzig Zentimeter, das Gewicht bis anderthalb Kilogramm.
Unter den Karpfen gehört die Plötze zu den verbreitetsten und gemeinsten. Ganz Mitteleuropa, einschließlich Großbritannien, und ein großer Teil des Ostens unseres heimatlichen Erdteiles sowie Nordwestasien bilden ihr Vaterland, Seen, Teiche, größere und kleinere Flüsse, ebenso schwachsalzige Meere ihren Aufenthalt. In der Nordsee tritt sie selten, in der Ostsee dagegen ungemein häufig auf. Ihre Lebensweise stimmt mit der des Rotauges fast in jeder Hinsicht überein. Sie hält sich stets scharenweise zusammen, nährt sich von Würmern, Kerfen, Fischrogen, kleinen Fischen und Wasserpflanzen, wühlt nach den ersteren im Grunde, schwimmt rasch, ist lebhaft, scheu, jedoch nicht besonders klug, und mengt sich, nicht immer zu ihrem Vorteil, gern unter andere Fische, so daß sie sogar zu Sprichwörtern Veranlassung gegeben hat. Den Hecht, ihren ärgsten Feind, kennt sie übrigens sehr wohl; denn so behaglich sie sich fühlt in Gesellschaft anderer Fische, so unruhig wird sie, wenn sie dieses furchtbarsten Räubers unserer süßen Gewässer ansichtig wird. Sie laicht im Mai oder Juni, manchmal auch schon im März und April und ebenso noch im Juli, und verläßt dann in dichtgedrängten Scharen die tieferen Seen, in denen sie den Winter verbrachte, steigt in den Flüssen empor und setzt auch an grasigen Plätzen unter lebhaftem Hin- und Herschwimmen, Plätschern und Aufspringen ihren Laich ab. Nach Lund soll sie in regelmäßigen Zügen auf den betreffenden Plätzen erscheinen, zuerst fünfzig bis hundert Milchner, sodann Rogener und hierauf wieder Milchner, worauf dann das Ablegen der Eier beginnt. Die Milchner tragen um diese Zeit ebenfalls auf Scheitel und den Schuppen vereinzeltstehende kleine, kegelförmige Knötchen von weißlicher Färbung. Die Vermehrung ist sehr stark, weil schon kleine, scheinbar noch nicht halb erwachsene, fortpflanzungsfähig sind.
Hinsichtlich ihres Fleisches und der Verwertung desselben läßt sich genau dasselbe sagen wie vom Rotauge. Das Fleisch wird nirgends geschätzt und das Kilogramm desselben höchstens mit einer Mark, durchschnittlich aber nur mit vierzig Pfennigen bezahlt; gleichwohl fängt man den allerorts gemeinen Fisch massenhaft, verzehrt ihn frisch oder gedörrt, führt ihn von Pommern aus ins Innere des Landes, selbst bis Russisch-Polen, und verwendet ihn endlich zur Fütterung anderer Fische oder der Schweine.
*
»Schuppenbedeckt erglänzt im grasigen Sande der Kühling,
Sonderlich zart von Fleisch, doch dicht mit Gräten durchwachsen.
Länger auch nicht als nur sechs Stunden der Tafel sich eignend.«
Mit diesen Worten besingt Ausonius unsern schon den Alten wohlbekannten Döbel, der auch Dübel, Alet, Elten usw. genannt wird ( Squalius cephalus), den gemeinsten Vertreter der in ganz Europa, in Asien und in Nordamerika vertretenen Sippe der Elten oder Eltfische ( Squalius), kenntlich an dem rundlichen Leib, dem verhältnismäßig großen Kopf, der kurzen Rücken- und Afterflosse, den ziemlich großen Schuppen und den in doppelter Reihe zu zwei und fünf gestellten Schlundzähnen, deren Kronen seitlich zusammengedrückt und an der Spitze hakenförmig umgebogen sind. Beim Döbel fällt die unverhältnismäßige Größe des Kopfes besonders auf. Die Schnauze ist niedergedrückt, das in die Breite gezogene endständige Maul sehr weit nach hinten gespalten, der Leib fast rund, der Rücken schwarzgrün, die Seite goldgelb oder silberweiß, der blaßrot schimmernde Bauch weiß gefärbt; Wangen und Deckelstücke zeigen auf rosenrotem Grunde Goldglanz; die Lippen sehen rötlich aus; Rücken- und Schwanzflosse sind auf schwärzlichem Grund rötlich überflogen, After- und Brustflossen hochrot, alle Schuppen am freien Rand und gegen ihre Mitte hin durch dunkle Farbstoffablagerungen getrübt. Die Länge kann bis sechzig Zentimeter, das Gewicht vier Kilogramm und darüber betragen.
In den Flüssen und Seen Mitteleuropas gehört der Döbel zu den gemeinsten Fischen. Solange er jung ist, hält er sich zumeist in kleineren Bächen oder Flüssen mit kiesigem und sandigem Grunde auf, hier an langsamen Stellen zu Hunderten sich tummelnd und bei jedem Geräusch pfeilschnell entfliehend; im Alter bewohnt er Flüsse und Seen, und zwar solche der Ebene ebensowohl wie die des Mittelgebirges. Anfänglich besteht seine Nahrung aus Würmern und aus Kerbtieren, die im Wasser schwimmen, auf der Oberfläche treiben oder niedrig über derselben hinziehen; später, wenn er mehr heranwächst und tiefere Stellen aufsucht oder in größere Flüsse und Seen wandert, wird er zu einem Raubfisch in des Wortes vollster Bedeutung und stellt kleineren Fischen, Krebsen, Fröschen, ja selbst Mäusen nach, weshalb er hier und da geradezu »Mäusefresser« genannt und mit einem Kater verglichen wird. Bei reichlicher Beute nimmt er sehr rasch, nach Angabe erfahrener Fischer jährlich wenigstens um fünfhundert Gramm zu. Die Laichzeit fällt in die Monate Mai und Juni und soll fast vier Wochen lang währen.
Wohl noch mehr verbreitet ist der ihm verwandte kleinere Häsling oder Hasel ( Squalius leuciscus), unterschieden durch seitlich etwas zusammengedrückten Kopf und Leib, unterständiges, enges Maul, Bildung der Schuppen und Färbung. Auf dem Rücken herrscht ein oft metallisch glänzendes Schwarzblau vor; die Seiten und der Bauch erscheinen bald gelblich, bald weißglänzend; die paarigen Flossen zeigen eine blaßgelbe oder orangerote, Rücken- und Schwanzflosse eine dunkle Färbung. Die Länge übersteigt wohl nur in seltenen Fällen fünfundzwanzig Zentimeter.
Das Verbreitungsgebiet des Häslings erstreckt sich über die verschiedenen Flußgebiete Mitteleuropas, einschließlich Großbritanniens. Er macht, wie sein Verwandter, zwischen fließenden und stehenden Süßgewässern keinen Unterschied, wählt sich die tieferen, ruhigeren Stellen zu seinem Aufenthalt, nährt sich von Würmern und Kerbtieren, jagt namentlich allen auf der Oberfläche des Wassers schwimmenden Fliegen und andern verunglückten Kerfen eifrig nach, beißt auch fast mit derselben Gier wie die Forelle nach ihnen. Seine Laichzeit, die sich bei den Milchnern durch häutigen Ausschlag bekundet, fällt in die Monate März und April; die Vermehrung ist sehr bedeutend. Das Fleisch wird nur von Anglern geschätzt, weil sich der Häsling als Köderfisch für die größeren Lachsarten bewährt hat, in der Küche jedoch wenig geachtet.
*
Zu den kleinsten Karpfen unserer Süßgewässer gehören die Pfrillen ( Phoxinus) kräftig gebaute, rundleibige, stumpfschnauzige, kleinmündige und kleinschuppige Fische, mit kurzer Rücken- und Afterflosse, deren erstere senkrecht hinter den Bauchflossen beginnt. Die Sippe wird vertreten durch eine allerwärts verbreitete, vielnamige Art. »Zu mercken ist, daß die Bambelen mit mancherley Namen genennet werden nach art vnd brauch frembder Nationen. Dann vmb Straßburg werden sie Willing, Mülling, Orlen, Erling, Hägener vnd die aller kleinsten Brechling genandt; die in Meissen vnd Sachsen nennen solche Elderitz, Elritz, Eldrich: Item Pfal, Ofrylls in Beyern; Butt, Bott, Baut, Bitzbaul, werden die glatten Bambelen genandt.« Fügen wir diesen schon unserem Geßner bekannten Bezeichnungen noch Pfell, Pfrul, Haber- oder Haberl-, Hunderttausend- und Sonnenfischl, Seidlfisch, Zankerl, Grümpel, Grimpel, Rümpchen, Gievchen, Maigänschen, Zorscheli, Riedling, Piere, Maipiere, Lennepiere, Pierling, Spirling, Erlkreß, Ellerling, Elring und Wettling hinzu, so haben wir wenigstens die deutschen Namen unserer Elritze ( Phoxinus laevis) aufgeführt. Ein derartiger Namenreichtum ist stets ein Beweis für die Volkstümlichkeit oder, was dasselbe sagen will, genaue Bekanntschaft und allgemeine Verbreitung eines Tieres. Die Elritze verdient diese Volkstümlichkeit; denn sie ist wirklich einer unserer ausgezeichnetsten und anziehendsten Fische. Ihre Färbung wechselt außerordentlich. Der Grundton des Rückens erscheint bald ölgrün, bald schmutziggrau und wird durch kleine dunkle Flecke mehr oder weniger getrübt, zuweilen, wenn die Flecke sehr dicht zusammengetreten, förmlich gezeichnet, so daß sich längs der Mittellinie des Rückens ein schwarzer, vom Rücken bis zur Schwanzflosse verlaufender, manchmal aus einer Längsreihe von Flecken bestehender Streifen bemerklich macht; die grüngelben Seiten haben stark metallischen Glanz; das Maul ist an den Winkeln karminrot, die Kehle schwarz, die Brust scharlachrot; außerdem bemerkt man einen goldglänzenden Längsstreifen, der hinter den Augen beginnt, zu beiden Seiten des Rückens verläuft und sich bis zur Schwanzwurzel erstreckt; die Flossen haben blaßgelbe Grundfärbung, die jedoch auf Rücken-, After- und Schwanzflosse durch dunkle Farbstoffanhäufung verdüstert wird und aufden paarigen Flossen und ausnahmsweise auch auf der Afterflosse in glänzendes Purpurrot übergehen kann. Nach Siebold ist diese Farbenpracht nicht von der Laichzeit abhängig, sondern kommt mitten im Winter bei männlichen wie bei weiblichen Stücken zum Vorschein, wogegen sich gegen die Laichzeit hin bei beiden Geschlechtern ein Hautausschlag in Gestalt von spitzigen Höckern auf der Oberfläche des Scheitels ausbreitet und sämtliche Schuppen an ihrem Hinterrande mit dichtgedrängten, einen Saum bildenden Körnchen bedecken. Einzelne Stücke erreichen eine Länge von höchstens zwölf, die Mehrzahl eine solche von kaum neun Zentimeter.
Klare Flüsse mit sandigem oder kiesigem Grund, von ihrem Ursprung im Gebirge an bis gegen die Mündung hin, gleichviel ob sie groß oder klein, beherbergen die Elritze, manche Bäche sie fast ausschließlich, da sie sich auch auf solchen Stellen, die von andern Fischen gemieden werden oder ihnen nicht zugänglich sind, noch regelmäßig aufhält und dem Anschein nach sehr wohl befindet. Einzeln bemerkt man sie höchst selten, im Gegenteil fast immer in starken Schwärmen, die sich nahe dem Wasserspiegel umhertummeln, äußerst behend auf- und niederspringen und scheu vor jedem Geräusch entfliehen. Bei großer Hitze verlassen sie zuweilen eine Stelle, die ihnen längere Zeit zum Aufenthaltsort diente, und steigen entweder in dem Flusse aufwärts dem frischeren Wasser entgegen, oder verlassen ihn gänzlich und wandern massenhaft in einem seiner Nebenflüsse zu Berge. Dabei überspringen sie Hindernisse, die mit ihrer geringen Leibesgröße und Kraft in keinem Verhältnis zu stehen scheinen, und wenn erst einer das Hemmnis glücklich überwunden, folgen die andern unter Umständen nach. Ein Cornelius befreundeter Beobachter hat diesem folgende Angaben über diese Wanderungen mitgeteilt. In den Rheinlanden werden die Elritze gewöhnlich Maipieren oder, der Lenne zuliebe, Lennepieren genannt, weil sie sich in diesem Flusse während der Laichzeit in großen Zügen einfinden oder zeigen. Sie erscheinen meist bei mittlerem Wasserstande und heiterem Wetter, weil bei niederem Wasser ihnen die vielen Fabrikanlagen zu große Hindernisse in den Weg legen. Zu genannter Zeit sind die Brücken belagert von der Jugend, die den Zügen dieser kleinen, hübschen Tiere mit Vergnügen zusieht. Ein einziger Zug mag etwa einen halben Meter breit sein; in ihm aber liegen die Fische so dicht neben- und übereinander wie die Heringe in einem Fasse. Ein Zug folgt in kurzer Unterbrechung dem andern, und so geht es den ganzen Tag über fort, so daß die Anzahl der in der Lenne befindlichen Fischchen dieser Art nur nach Millionen geschätzt werden kann.
Ihre Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen, Würmern und Kerfen, auch wohl aus andern tierischen Stoffen. So beobachtete ein Engländer einen Schwarm Elritzen, die ihren Kopf in einem Mittelpunkt zusammengestellt hatten und mit dem Wasser sich treiben ließen, und fand bei genauerer Untersuchung als Ursache dieser Zusammenrottung den Leichnam eines Mitgliedes des Schwarmes, der von den überlebenden aufgezehrt wurde. Die Laichzeit fällt in die ersten Frühlingsmonate, gewöhnlich in den Mai, hier und da wohl auch in den Juli. Um diese Zeit werden seichte, sandige Stellen ausgewählt und jedes Weibchen von zwei oder drei Männchen begleitet, die auf den günstigen Augenblick des Eierlegens warten, um sich ihres Samens zu entledigen. Aus Versuchen, die Davy angestellt hat, geht hervor, daß die Jungen bereits nach sechs Tagen aus dem Ei schlüpfen. Im August haben sie etwa zwei Zentimeter an Länge erreicht; von nun an aber wachsen sie sehr langsam; erst im dritten oder vierten Jahre sollen sie fortpflanzungsfähig sein.
Ungeachtet der geringen Größe der Elritze wird sie doch überall gern gefangen, weil ihr Fleisch trotz des bitteren Geschmacks viele Liebhaber und dementsprechend willige Abnehmer findet. In der Lenne fängt man sie nach Angabe des oben erwähnten Berichterstatters während der Monate Mai und Juni, wenn sie ihre Wanderzüge bildet, zum Teil mit sogenannten Tütebellen, einem Netz, das an zwei kreuzweise übereinander gebundenen und an dem Ende eines Stockes befestigten Tannenreisern ausgespannt ist. Dieses läßt man an Stellen, wo der Strom nicht zu heftig ist, ins Wasser und zieht es, wenn ein Schwarm sich gerade darüber befindet, rasch in die Höhe. Doch wird solche Fangart nur von der Jugend zum Zeitvertreib, der hauptsächlichste Fang aber mit Hilfe besonderer Fischkörbe betrieben. Diese Körbe haben vorn eine oder mehrere Öffnungen, die ähnlich wie die Drahtmäusefallen beschaffen sind. Die Spitzen der Weiden richten sich nämlich nach innen, so daß die Fische bequem einschlüpfen, aber nicht wieder heraus können. Solche Körbe, die von den gewöhnlichen Reusen wenig abweichen, befestigt man mitten in der Lenne an ruhigen Stellen, die Öffnung gegen den Strom gerichtet, und hebt sie, wenn sie sich gefüllt, von Zeit zu Zeit empor, um sie zu entleeren. Da mit der Elritze regelmäßig auch andere, zumal junge Lachsfische, erbeutet werden, schadet der sogenannte Rümpchenfang unserer Fischerei ungemein und sollte unbedingt verboten werden.
Abgesehen von der Küche dient die Elritze den Anglern als beliebter Köderfisch und in Zuchtteichen größeren Raubfischen zur Nahrung, hält sich auch in engerem Gewahrsam ein paar Jahre lang und erfreut hier durch ihre Anspruchslosigkeit, Gewandtheit und Beweglichkeit.
*
An das Ende der Karpfenfamilie stellt man die Knorpelmäuler ( Chondrostoma), die nur durch wenige Arten vertreten werden. Nase oder Näsling ( Chondrostoma nasus) heißt die in Süd- und Ostdeutschland häufige Art dieser Sippe. Die Nase ist langgestreckt, rundlich, seitlich wenig zusammengedrückt und mit kleinen Schuppen bekleidet, ihre Färbung außer der Laichzeit auf dem Rücken schwärzlichgrün, an der Seite und auf dem Bauche glänzend silberweiß, auf den Flossen, mit Ausnahme der dunklen Rückenflossen, rötlich. Gegen die Laichzeit hin nehmen alle Körperteile eine lebhaftere Färbung an, und es tritt namentlich auch in beiden Mundwinkeln und an den Brustflossengelenken ein schönes Orangegelb hervor; der Rücken wird dunkler und erhält ein schwarzstreifiges Ansehen. Die Länge kann bis fünfzig Zentimeter, das Gewicht bis anderthalb Kilogramm betragen; doch gehören so große Nasen zu den Seltenheiten.
Im Norden Deutschlands ist die Nase ein wenig bekannter Fisch, im Süden unseres Vaterlandes und in der Schweiz dagegen häufig; auch kommt sie in der Oder und in der Weichsel in namhafter Menge vor. Im Donau- und im Rheingebiet bevölkert sie fast alle Flüsse und Seen. Sie lebt gesellig, meist in großen Scharen beisammen, hält sich fast stets am Grunde, längere Zeit auf einer und derselben Stelle auf und wälzt sich hier, wie Schinz bemerkt, oft um und um, so daß man ihre silberglänzende Unterseite auf weithin schimmern sieht. Im Sommer nähert sie sich den Mauern, mit denen das Ufer eingefaßt ist, und wälzt sich hier über Steine, die kaum vom Wasser bedeckt sind, über die untern Stufen von Treppen, die ins Wasser führen, streicht sie in ähnlicher Weise mit so großer Regelmäßigkeit weg, daß die Katzen hierauf aufmerksam werden und an solchen Stellen einen mehr oder minder ergiebigen Fang betreiben. Die Nahrung besteht aus Pflanzenstoffen, namentlich verschiedenen Wasseralgen, die Steine und andere im Wasser liegende feste Gegenstände überziehen und von den scharfen, harten Kieferrändern der Nasen leicht abgelöst werden können. In Würzburg haben die Fische, wie Siebold mitteilt, den Namen »Speier« erhalten, weil sie, frisch eingefangen, stets vielen Schlamm ausspeien, wahrscheinlich eben jenen pflanzlichen Schleim, den sie im Augenblick des Gefangenwerdens noch in den Schlundzähnen festgehalten haben.
Gegen die Laichzeit hin, die in die Monate April und Mai fällt, versammeln sich die Näslinge und ziehen in zahllosen Scharen von dem Hauptstrome in die Nebenflüsse, von diesen aus in Zuflüsse und Waldbäche, auch selbst in solche, die trübes Wasser haben, suchen sich hier kiesige Stellen auf, über die der Strom schnell dahinfließt, und legen auf ihnen ihre zahlreichen Eier ab. Sie haben zu dieser Zeit ihr Hochzeitskleid angelegt und wie so viele andere Karpfen einen Hautausschlag erhalten, der namentlich den Scheitel und den oberen Teil der Kiemendeckel sowie die seitlichen der Schnauze und des Gesichtes bedeckt. Die Jungen sollen bereits nach vierzehn Tagen ausschlüpfen und dann nach und nach den größeren Flüssen zuschwimmen.
Mehr zum Vergnügen, als um sie zu benutzen, fängt man die Nase an Angeln, die mit Stubenfliegen geködert werden. Während der Laichzeit geben ihre Massenversammlungen zu reichem Fange Veranlassung. In der Wertach bei Augsburg werden, laut Grundauer, alljährlich innerhalb zwei bis drei Wochen gegen fünfzehntausend Kilogramm und darüber erbeutet. An der Mündung der Birs und am Eintritt der Glatte in den Rhein finden alljährlich ähnliche Fischzüge statt.
*
An die Karpfen schließen sich die Schmerlen ( Acantkopsidae) innig an. Die Gestalt ist langgestreckt, der Kopf klein, bis zur engen Kiemenspalte überhäutet; der Zwischenkieferknochen bildet allein den Rand der oberen Kinnlade; der untere Augenring, bei einzelnen auch die Deckelstücke laufen in einen oder mehrere Dornen aus; der Mund wird von Sauglippen und Bärteln umgeben, die kurze Rückenflosse hat nur weiche Strahlen; die Bekleidung besteht aus kleinen Schuppen. Die Familie hat ihre Vertreter in der Alten und Neuen Welt und tritt in Europa bloß in einer einzigen Sippe, den Bartgrundeln ( Cobitis), auf, deren Kunde uns genügen darf.
Die drei deutschen Arten dieser Sippe kommen auch im übrigen Mitteleuropa vor, eine von ihnen fehlt jedoch in Großbritannien. Die einen lieben schlammige und stehende, die anderen reine und fließende Gewässer. Alle halten sich für gewöhnlich auf dem Boden auf, ruhen, im Schlamme oder unter Steinen verborgen, tagsüber und beginnen mit Sonnenuntergang oder mit Eintritt trüber Witterung ihre Jagd auf Wassergewürm im weitesten Umfang. Zwei Arten sind sehr hinfällig, während die dritte ungünstigen Einflüssen, zumal Verderbnis des Wassers, mehr zu trotzen weiß. Hierzu befähigt sie die Möglichkeit, in anderer Weise als die meisten Fische zu atmen. Unter gewissen Verhältnissen sind sie imstande, anstatt der Kiemen sich des Darmes als Atmungswerkzeug zu bedienen. Sie begeben sich, laut Siebold, zu diesem Zweck an die Wasseroberfläche, verschlucken, indem sie die Schnauze aus dem Wasser hervorstrecken, eine gewisse Menge Luft, die sie unter starkem Zusammenpressen ihrer Kiemendeckel in den kurzen, geradeverlaufenden Verdauungsschlauch hinabdrängen, während sie gleichzeitig aus dem After eine Anzahl Luftperlen unter Geräusch hervorpressen. Nach Siebolds Beobachtungen können auch die übrigen Bartgrundeln in derselben Weise wie der Schlammbeißer ihren Verdauungsschlauch als Atmungswerkzeug benutzen. In frischem, an Sauerstoff reichem Wasser tun sie letzteres selten, im Freien namentlich hat man es noch nie von ihnen gesehen, wogegen sie in der Gefangenschaft, wenn man ihnen das Wasser nicht beständig erneuert, bald dazu gezwungen werden. Man hat vermutet, daß sie an ihrem natürlichen Aufenthaltsort nur dann sich der Darmatmung bedienen, wenn in ihrer Umgebung das Wasser sich verloren hat und sie genötigt werden, im Schlamm und Moder sich zu vergraben. Von Jäckel gepflegte Schlammbeißer starben auffallenderweise eher als Rotaugen und Schleien, wenn ihnen frisches Wasser vorenthalten wurde, und Schmerlen sowie Steinbeißer zeigten sich unter gleichen Umständen bei weitem hinfälliger als Bitterlinge. Mit letzterem stimmen meine Beobachtungen überein; hinsichtlich des Schlammbeißers dagegen verweise ich auf das bei seiner Schilderung Gesagte.
Ungeachtet der geringen Größe werden wenigstens zwei unserer Bartgrundeln sehr gern gegessen und sogar in besonderen Teichen gezüchtet. Ihr Fleisch darf auch wirklich ein wahrer Leckerbissen genannt werden, vorausgesetzt, daß man die Fischchen nach dem Fange sobald wie möglich über das Feuer bringt.
Beim Schlammbeißer oder Schlammpeitzger ( Cobitis fossilis) wird der Mund von zehn Barteln umgeben, von denen vier an der Oberlippe, sechs an der unteren stehen, und ist der Leib auf schwärzlichem Grunde mit fünf gelben und braunen Längsstreifen, der Bauch auf lichtem Grund mit schwarzen Tüpfeln gezeichnet. Die Länge beträgt etwa dreißig Zentimeter.
Der Schlammbeißer verbreitet sich über einen weiten Teil des nördlichen und östlichen Europa, findet sich jedoch nur in Flüssen und Seen mit schlammigem Grunde, eigentlich nirgends in Menge, verbirgt sich hier während des Winters im Schlamm und tut dasselbe, wenn bei heißem Sommer das Wasser seinen Aufenthaltsort vertrocknet. In dieser Lage kann er mehrere Monate ohne Schaden aushalten, sinkt auch keineswegs in schlafähnliche Erstarrung, sondern regt und bewegt sich, zeigt sich munter und vergnügt, sowie er ins Wasser gebracht wird, beweist also, daß ihn der gezwungene Aufenthalt in einem ihm anscheinend unnatürlichen Zufluchtsort nicht im geringsten anficht. Während des Sommers kann man auf moorigen Stellen, wo solche Fische vorkommen, sie genau ebenso wie die Singalesen ihre Schlangenfische, durch Aufgraben des Schlammes gewinnen. Schweine, die man in die Sümpfe auf die Weide treibt, halten oft an ihnen ein gutes Frühstück.
Sehr empfindlich scheint der Schlammbeißer gegen Einwirkungen der Elektrizität zu sein. Wenn ein Gewitter droht, gebärdet er sich höchst unruhig, kommt von dem schlammigen Grund in die Höhe empor und schwimmt hier anscheinend ängstlich unter beständigem Luftschnappen hin und her. Schon vierundzwanzig Stunden vor dem Ausbruch des Gewitters gebärdet er sich in dieser Weise, verdient also seinen Namen »Wetterfisch« mit Fug und Recht.
Die Nahrung besteht aus kleinem Gewürm aller Art, Wassertierchen und Fischlaich, ebenso vermoderten Pflanzenresten, also gewissermaßen wirklich Schlamm, weshalb denn auch der Name »Schlammbeißer« seine Berechtigung hat.
Obgleich dieser hübsche Fisch im April und Mai gegen einhundertundvierzigtausend Eier am Ufer ablegt, vermehrt er sich doch nicht stark, wahrscheinlich weil er den meisten anderen Flußfischen zur Nahrung dienen muß. Vom Menschen wird er wenig behelligt, weil man ihn seines Schleimes halber und das Fleisch des moderigen Geschmackes wegen nicht leiden mag.
Die Gefangenschaft im engsten Becken verträgt der Schlammbeißer besser als irgendein anderer Fisch. Ein Glas, auf dessen Grund eine zollhohe Sandschicht liegt, wöchentlich zwei-, selbst einmalige Erneuerung des Wassers und einige Semmelkrümchen genügen ihm vollkommen.
Die Schmerle oder Bartgrundel( Cobitis barbatula) erreicht eine Länge von zehn, höchstens fünfzehn Zentimeter und ist auf dem Rücken dunkelgrün, auf der Seite gelblich, auf der Unterseite hellgrau gefärbt und auf Kopf, Rücken und Seiten mit unregelmäßigen Punkten, Flecken und Streifen von braunschwarzer Färbung gezeichnet; Rücken-, Schwanz- und Brustflossen sind gefleckt, After- und Bauchflosse gelblichweiß und ungefleckt. Um den Mund stehen sechs Bärtel.
Wie die Verwandten verbreitet sich auch die Schmerle über einen großen Teil Europas. Besonders zahlreich bewohnt sie Sachsen, Brandenburg, Hessen, die Schweiz und Tirol, ohne jedoch in den übrigen Ländern nördlich von den Alpen selten zu sein. Abweichend vom Schlammbeißer hält sie sich, wenn auch nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise in Flüssen auf, am liebsten in seichten Bächen mit steinigem oder sandigem Grund und raschströmendem Wasser. Hier ruht sie tagsüber unter hohlliegenden Steinen verborgen; denn nur ausnahmsweise wagt sie sich freiwillig aus dem sicheren Schlupfwinkel hervor, um eine erspähte Beute wegzunehmen. Gegen Sonnenuntergang beginnt ihre Jagdzeit, und wahrscheinlich treibt sie sich von nun an während der ganzen Nacht umher. Sie schwimmt, entsprechend ihrer großen Schwanzflosse, sehr gut, jedoch immer nur absatzweise, und durchmißt ungern weitere Strecken. Hebt man einen Stein, unter welchem sie verborgen liegt, langsam auf, so verweilt sie noch einige Augenblicke ruhig, schießt dann wie ein Pfeil davon, macht eine plötzliche Schwenkung oder sinkt jählings auf den Boden herab und ist sofort wieder in eine ähnliche schützende Höhlung geschlüpft. Bei Annäherung eines Gewitters zeigt auch sie sich unruhig. Von dem Schlammbeißer unterscheidet sie sich durch ihre leichte Hinfälligkeit: schon wenige Minuten, nachdem sie aus dem Wasser genommen, verendet sie; einen weiten Versand verträgt sie also nicht. Ihre Nahrung besteht aus Wassergewürm, Kerflarven, Kerbtieren, Fischlaich und wohl auch Pflanzenstoffen; wenigstens füttert man die in besonderen Teichen gehaltenen Schmerlen mit Leinkuchen und Mohnsamen. Die Laichzeit fällt in die ersten Frühlingsmonate: im März und April strotzen die Eierstöcke von unzähligen kleinen Tierchen; von Mai bis zum Juli wimmeln gewisse Stellen der Gewässer von der ausgeschlüpften Brut. Das Männchen gräbt, nach Leunis, ein Loch in den Sand, in welches das Weibchen die Eier legt, befruchtet sie und hält dann bis zum Ausschlüpfen der Jungen Wache am Nest.
»Das fleisch dieser Fisch«, sagt Geßner, »behelt den Preiß vnd Lob in allen dingen: denn es ist lieblich zu essen.« Dieses in der Tat köstlichen Fleisches wegen legt man hier und da, beispielsweise in Böhmen, besondere Teiche an, meist kleine Löcher von drei Meter Länge, einem Meter Tiefe und entsprechender Breite, verkleidet sie mit einem Korbgeflecht und bringt Schafmist zwischen dieses und die Wände, um die Entwicklung von Kerbtierlarven zu befördern. Beständiger Zufluß von frischem Wasser ist unumgänglich notwendige Bedingung zum Gedeihen dieser halbgefangenen Schmerlen. Leider lassen sich Schmerlen eigentlich bloß an Ort und Stelle verwerten: man hält ihr Fleisch für schlecht, wenn sie auch nur wenige Minuten vorher abgestanden sind. Am besten sollen sie sein, wenn man sie in Wein oder Milch sterben läßt. Die Bereitung richtet sich nach dem Geschmack des Liebhabers. Hier und da schätzt man besonders die gesottenen und mit Weinessig gebläuten Schmerlen; an anderen Orten zieht man die gebratenen vor; auch macht man sie ein wie Neunaugen, um sie länger aufzubewahren.
Außer dem Menschen stellen der Schmerle Wasserspitzmäuse und Wasserratten, Enten und viele Sumpfvögel, insbesondere aber der Eisvogel nach, welcher sich wohl den größten Teil seiner Nahrung aus ihrer Mitte nimmt. Unter den Fischen werden ihr diejenigen Arten, die wie sie auf dem Boden leben, gefährlich.
In wohleingerichteten Behältern leben gefangene Schmerlen lange Zeit. Viel Unterhaltung gewähren sie freilich nicht. Sie liegen, wie in der Freiheit, so auch hier den größten Teil des Tages über auf dem Grunde des Gefäßes, kommen nur bei trübem Wetter zum Vorschein, steigen dann unter kräftig schlängelnden Bewegungen zur Oberfläche empor, atmen wohl auch einmal frische Luft und geben die eingenommene durch den Darm wieder von sich, halten sich geraume Zeit in der Höhe und lassen sich dann anscheinend schwerfällig der Länge nach wieder auf den Boden herabsinken, zuweilen so ungeschickt, daß sie von einem Stein zum anderen fallen. Von ihrer Gefräßigkeit gewinnt man erst, wenn man sie in solchen Becken hält, eine richtige Vorstellung. Sie vertilgen eine unglaubliche Menge von Würmern und dergleichen und gebärden sich dabei, als gelte es, eine ungeheure Beute zu bewältigen. Sobald sie nämlich ein Opfer gefaßt haben, rühren sie durch heftige Bewegungen ihrer Bauch- und Brustflossen den Grund, auf dem sie liegen, auf, trüben dabei ihre Umgebung so, daß es unmöglich ist, sie noch zu sehen, fressen die Beute und schießen plötzlich aus dem Trüben auf nach einem ihrer beliebten Versteckplätze zu.
Die kleinste unserer Bartgrundeln, der Steinbeißer ( Cobitis taenia), erreicht eine Länge von höchstens zehn Zentimeter und ist ungemein zierlich gezeichnet. Auf orangegelbem Grund stehen in Reihen geordnet rundliche Flecke von schwarzer Färbung; eine aus größeren Flecken bestehende Reihe verläuft in halber Körperhöhe, eine zweite kleinere zwischen ihr und der Rückenmitte; außerdem zieren kleine unregelmäßige Flecke und Punkte die Seiten und den Schwanz; Kehle, Brust und Bauch sind ungefleckt; über dem Auge gegen die Oberlippe zieht sich eine braunschwarze Linie, die nach hinten hin zur Spitze des Kiemendeckels sich fortsetzt, eine andere mit der ersten gleichlaufende geht über die Wangen weg. Über die Rückenflosse verlaufen in Längsreihen geordnete, über die Schwanzflosse in Querreihen stehende dunkle Punkte; Brust-, Bauch- und Afterflosse sehen blaßgelb aus.
Der Steinbeißer ist die einzige Art der Gattung, welche auch südlich der Alpen vorkommt und bis Dalmatien sich verbreitet. Nach Norden reicht sein Wohngebiet bis an die Küste des Meeres, nach Osten bis Rußland, nach Westen bis Großbritannien. Flüsse, Bäche und Wassergräben, Teiche und Seen bilden seinen Aufenthalt, Höhlungen unter Steinen seine Ruhesitze, Kerbtierlarven, Würmer und dergleichen seine Nahrung. Die Laichzeit fällt in die Monate April bis Juni; die Vermehrung ist gering. Das Fleisch wird wenig geschätzt, weil es mager und zähe ist, trotzdem vor der Laichzeit hier und da gegessen: zu regelrechtem Fang gibt dieser kleine Fisch jedoch nirgends Veranlassung.
Die Bedeutsamkeit der Fische für den Haushalt des Menschen läßt sich mit dem einzigen Wort Hering verständlich genug ausdrücken. Ohne den Stockfisch kann man leben; von den Schollen und den meisten anderen Seefischen haben meist nur die Küstenbewohner Genuß und Gewinn; die Fische des süßen Wassers gehören zu den selteneren Gerichten auf dem Tische des Binnenländers: der Hering und seine Verwandten aber bringen den Segen der Ernte des Meeres bis in die entlegenste Hütte. Wenn irgendein Fisch es verdient, Speisefisch des Armen genannt zu werden, so ist es dieser, der, auch dem Dürftigsten noch käuflich, in gar vielen Häusern die Stelle des Fleisches vertreten muß. Es gibt keinen, welcher uns unentbehrlicher wäre als er.
Die ihm zu Ehren benannten Heringe ( Clupeidae), eine über zweihundert Arten zählende Familie bildend, sind beschuppte Fische ohne Fettflossen, deren Maul in der Mitte vom Zwischenkiefer, an den Seiten vom Oberkiefer eingefaßt wird, und deren Kiemen besonders entwickelt sind, indem nicht allein die Kiemenöffnungen durch ihre Weite, sondern auch die Kiemenstrahlen noch ansitzende, seitlich wiederum verzweigte zahnartige Äste, welche einen trefflichen Seiher bilden, auffallen. Die Zahnbildung ändert je nach den Gattungen ab. Die gewöhnlich vorhandene Schwimmblase steht bei einzelnen durch luftführende Kanäle mit dem Labyrinth in Verbindung.
Nicht alle Heringe herbergen im Meere; die Familie hat auch Glieder, die vom Meere aus regelmäßig in den Flüssen aufwärts gehen, um hier zu laichen. Dementsprechend ändert die Lebensweise ab; für die wichtigsten Mitglieder der Familie aber läßt sich im allgemeinen sagen, daß sie im wesentlichen mit den Renken übereinstimmen und sozusagen für das Meer dasselbe, was jene für die Binnenseen sind. Alle, ohne Ausnahme, scheinen Raubfische zu sein, die sich nicht bloß an kleinem Wassergetier, sondern auch an Fischen vergreifen.
Der Hering ( Clupea harengus), Vertreter einer gleichnamigen Sippe ( Clupea), selten eine größere Länge als dreißig Zentimeter, hat kleine, schmale Brust- und Bauchflossen, eine mittelständige Rückenflosse, weit nach hinten gerückte, schmale Afterflosse, tief gegabelte Schwanzflosse, große, leicht abfallende Schuppen, sieht auf der Oberseite schön meergrün oder grünblau, auf der Unterseite und auf dem Bauche silberfarben aus und glänzt, je nach dem einfallenden Lichte, in verschiedenen Schattierungen; Rücken- und Schwanzflosse sind düster-, die übrigen lichtfarbig.
Der nördliche Teil des Atlantischen Weltmeeres, einschließlich der Nord- und Ostsee, und ebenso das Eismeer sind die Heimat des Herings. Früher glaubte man allgemein, daß er von letzterem aus alljährlich eine Reise antrete, die in unsere Gewässer führe. Schon Bloch gewann eine andere Anschauung, bezweifelte, daß die Heringe vom Frühjahr bis zum Herbst eine so ungeheure Reise auszuführen imstande seien, hob hervor, daß sie im hohen Norden weit seltener sind als in der Nord- und Ostsee, daß man sie in letzterer während des ganzen Jahres fange, und nahm an, der Fisch steige aus großen Tiefen zu den oberen Wasserschichten empor. Andere Forscher traten ihm bei, und gegenwärtig unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß Bloch vollkommen richtig geurteilt hat. »Auffallend ist es«, sagt Karl Vogt, »in welch sonderbarer Weise die Naturgeschichte des Herings, dieses in der Nordsee so allgemein verbreiteten Fisches, von Fischern und Romanschreibern verbrämt und verfälscht worden ist. Das plötzliche Erscheinen von ungeheuren Heringsschwärmen an den nördlichen Küsten Europas und Amerikas, das Auftreten dieser Schwärme zu einer bestimmten Zeit im Jahre, das geheimnisvolle Verschwinden von einzelnen Stellen, wo sie früher in Mengen sich aufhielten, hat zu Fabeln Veranlassung gegeben, die trotz der gründlichsten Beleuchtung von seiten der Naturforscher noch immer in volkstümlichen Schriften und Schulbüchern gang und gäbe sind.
»Der Hering lebt weder vorzugsweise im Polarmeere, noch macht er weite Reisen. Er bewohnt die Tiefen derjenigen Meere, an deren Küsten er laicht, wird dort zu allen Zeiten vereinzelt gefangen, namentlich mit solchen Gerätschaften, die in die größeren Tiefen reichen, und hebt sich aus diesen Tiefen nur zur Laichzeit empor, um der Küste zuzusteuern, an der er seine Eier absetzt. Die Laichzeit, während der der bedeutendste Fang geschieht, fällt in die Wintermonate, scheint aber je nach der Witterung und anderen, ziemlich unbekannten Einflüssen oft um Wochen und Monate abzuändern. Die Fischer haben verschiedene Anzeichen, aus denen sie das Herannahen der Heringsschwärme beurteilen; doch sind dieselben so ungenau, daß die Holländer sagen, sie gäben mit Vergnügen eine Tonne Goldes für ein sicheres Merkzeichen der Zeit und des Ortes, wann und wo die Heringe erscheinen sollen. Auch sind die Jahre sehr verschieden. In einem Winter erscheinen an einem gewissen Ort ungeheure Massen, während im nächsten Winter nur einzelne Fische in die Netze geraten.
»Der Beweis gegen die angenommenen großen Wanderungen der Heringe vom Polarmeere aus ist leicht zu führen und wohl unwiderleglich. Unter den Heringen unterscheidet man auch viele Rassen, wenngleich ein artlicher Unterschied nicht anerkannt werden kann. Der Hering der Ostsee ist der kleinste und schwächste, der holländische wie der englische Hering schon größer, während der Hering der Shetlandsinseln und der norwegischen Küste der größte und fetteste ist. Die Fischer an der Küste unterscheiden selbst ebensogut wie die Lachsfischer in den Flußmündungen den landstehenden Hering, der in der Nähe der Küste sich aufhält und gewöhnlich zwar fetter, aber nicht von so feinem Geschmack ist, von dem Seehering, der aus größeren Entfernungen an die Küste heranschwimmt. Wenn die Behauptung der wandernden Schwärme von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkt im Eismeer aus ihre Richtigkeit hätte, wie wäre es dann möglich, daß die verschiedenen Schwärme sich so genau nach Größe, Gestalt und inneren Eigenschaften abtrennen würden, daß sie wie Regimenter und Bataillone eines Heeres an ihren Sammelplätzen zu bestimmter Zeit sich einstellen, ohne daß die alles bezwingende Liebe eine Vermischung der Schwärme bedingt hätte? Was aber vollends dem Fasse den Boden ausschlägt, ist einerseits die verhältnismäßige Seltenheit in den nördlichen Gegenden, andererseits der Zeitunterschied in der Erscheinung an den verschiedenen Orten. Um Grönland herum, wo doch der eine Hauptstrom nach Amerika vorüberziehen soll, ist der Hering so selten, daß viele Naturforscher ihn gar nicht unter den Fischen des Landes aufführen. An den Küsten von Island, an denen der ganze Zug sich spalten soll, ist der Hering zwar bekannt, aber niemals so häufig, daß eine besondere Fischerei auf ihn angestellt würde, und das gleiche ist der Fall in den Finnmarken Norwegens, wo so wenige Heringe gefangen werden, daß man sich nicht einmal die Mühe gibt, sie zu salzen, während in der südlichen Hälfte, zwischen Trondhjem und Kap Lindesnäs, namentlich aber in der Umgegend von Stavanger und Molde-Fjorde, der Heringsfang fast die einzige Lebensquelle der Küstenbewohner bildet. Wie wäre eine solche Verteilung möglich, wenn der Hering vom Norden käme, wie behauptet wird? Wie wäre es auch möglich, daß er an den südlichen Küsten bei Holland und Stavanger früher erscheint als an den schottischen und irischen Küsten, wie dies doch häufig beobachtet wurde, wenn er in der Tat aus Norden käme? Wie wäre es endlich möglich, wenn man Heringe von allen Größen an den Küsten fängt zu allen Zeiten des Jahres, wenn sie nicht in der Nähe dieser Küste geboren würden, auswüchsen und stürben?«
Ungeachtet dieses wichtigsten Fortschrittes ist die Lebenskunde des Herings noch immer in vieler Hinsicht dunkel und unklar. Sein Erscheinen in den oberen Wasserschichten und an der Küste hat, wie gesagt, wenig Regelmäßiges, und nicht immer sind es Scharen fortpflanzungslustiger Fische, die sich zeigen, sondern es kommen auch alljährlich große Heere sogenannter Jungfernoder, wie die Holländer sagen, Matjes-Heringe aus ihrer heimatlichen Tiefe empor. Über das Leben in den tieferen Gründen wissen wir so gut wie nichts, und erst neuerdings hat festgestellt werden können, daß er, dem Wale vergleichbar, mehr oder weniger ausschließlich von kleinen, dem unbewaffneten Auge zum Teil unsichtbaren Krebstierchen sich nährt, sie aber in kaum berechenbarer Menge verzehrt. Eine bestimmte Laichzeit hat er nicht. Die richtige Erklärung dieser Tatsache kann wohl nur darin gefunden werden, daß ältere und jüngere Fische nicht zu derselben Zeit laichen; doch können die Untersuchungen hierüber durchaus nicht als abgeschlossen gelten. Im allgemeinen mag richtig sein, daß die Hauptzeit der Fortpflanzung in die Wintermonate fällt, vom Januar an gerechnet, und bis zum März oder April fortwährt; eine zweite Laichzeit beginnt dann im Juli und währt bis gegen den Dezember hin. Aus guten Gründen nimmt man an, daß auch die Heringe auf denselben Stellen laichen, auf denen sie selbst geboren wurden. Verschiedene Ursachen, Witterungseinflüsse und Strömungsänderungen z. B., können bewirken, daß sie in einzelnen Jahren auf bestimmten Stellen gänzlich ausbleiben, und ebenso zeigen sie sich gegen Veränderungen ihrer Laichplätze höchst empfindlich, meiden solche Plätze insbesondere dann oft jahrelang gänzlich, wenn die sie bekleidenden Tange und sonstigen Wasserpflanzen zerstört wurden. Hieraus erhellt, daß die Laichplätze wie die laichenden Fische zeitweilig unbedingter Schonung bedürfen.
Die Hauptmasse aller Heringe, die in den oberen Schichten beobachtet und bezüglich gefangen wird, erscheint hier unzweifelhaft in der Absicht, zu laichen. Die fortpflanzungslustigen Tiere erheben sich in unschätzbaren Massen, treiben sich zwei oder drei Tage lang nahe der Oberfläche des Meeres umher, drängen sich im bunten Durcheinander zu dichten Haufen, namentlich wenn stürmische Witterung herrscht, eilen vorwärts und lassen währenddem Eier und Samen ins Wasser fallen. Zuweilen wird Laich und Milch in solcher Menge ergossen, daß das Meer sich trübt und die Netze mit einer Kruste oder Rinde sich überziehen, daß ein widriger Geruch entsteht und auf weithin sich verbreitet, daß buchstäblich die obere Schicht des Wassers so mit Samen geschwängert ist, um den größten Teil der Eier befruchten zu können.
Von den Heringszügen macht sich der Binnenländer schwerlich eine Vorstellung, weil ihm die Berichte der Augenzeugen übertrieben und unglaublich zu sein scheinen. Aber die Augenzeugen stimmen so vollständig überein, daß wir nicht wohl zweifeln können. »Sachkundige Fischer« sagt Schilling, »die ich zum Fange begleitete, zeigten mir in der starken Dämmerung Züge von meilenweiter Länge und Breite nicht etwa auf der Meeresfläche, sondern am Widerschein der durch sie erhellten Luft. Sie ziehen dann so gedrängt, daß Boote, die dazwischen kommen, in Gefahr geraten; mit Schaufeln kann man sie unmittelbar ins Fahrzeug werfen, und ein langes Ruder, das in diese lebende Masse gestoßen wird, bleibt aufrecht stehen.« Ähnlich sprechen sich andere Beobachter aus; einzelne versichern sogar, die Boote würden durch die wimmelnden Fische, deren Zug jene kreuzen, in die Höhe gehoben.
Je nach der Wärme des Wassers schlüpfen die Jungen früher oder später aus; im Mai vielleicht nach vierzehn bis achtzehn, im August nach sechs bis acht Tagen. Die durchsichtigen und daher kaum erkennbaren Jungen haben beim Verlassen des Eies eine Länge von etwa sieben Millimeter, zehren innerhalb acht bis zehn Tagen den Inhalt ihres Dottersackes auf, beginnen dann sich zu bewegen und erfüllen, zu Myriaden geschart, noch lange Zeit die Gewässer ihrer Geburtsstätte. Man beobachtet sie während des ganzen Jahres in der Nähe der Küste, je nach dem Alter in verschiedener Tiefe, die noch ganz kleinen Fische, laut Schilling, im Brackwasser der in sie ausmündenden Flüsse oder mit ihr zusammenhängenden Binnengewässer, die größeren im Wasser des äußeren Strandes, kann also ein bestimmtes Vorrücken nach der Tiefe zu unmittelbar nachweisen. Im ersten Monat ihres Lebens erreichen sie, laut Widegren, durchschnittlich eine Länge von fünfzehn, im zweiten von fünfundzwanzig, im dritten von siebenunddreißig Millimeter; nach Ablauf eines Jahres sind sie ungefähr neun, noch ein Jahr später fünfzehn bis achtzehn Zentimeter lang geworden; im dritten Jahre werden sie, bei einer Länge von etwa zwanzig Zentimeter, fortpflanzungsfähig.
Unzählbar wie die Heere der Heringe ist auch die Anzahl der Feinde, die ihnen folgen. Solange sie in den oberen Wasserschichten sich umhertreiben, nähren sich alle hier lebenden Raubfische, alle Meervögel und fast sämtliche Meersäugetiere ausschließlich von ihnen. Die Norweger erkennen ihre Ankunft durch die sich sammelnden Wale, und nicht wenige von den dortigen Fischern glauben, in letzteren die Herbeitreiber der Fische erkennen zu müssen. Wie groß der Verlust ist, den die Räuber der See den Heringszügen beibringen, läßt sich selbstverständlich auch nicht einmal annähernd schätzen; wohl aber dürfen wir dreist behaupten, daß er in keinem Verhältnis steht zu den Verheerungen, die der Mensch unter jenen anrichtet.
Bis in das frühe Mittelalter zurück reicht die Kunde der Heringsfischerei. Altenglische Urkunden erwähnen ihrer, alte Gesetze regeln sie. Bis zur Zeit des Holländers Breukel oder Breukelsen, der zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts lebte, befand sich die Fischerei, obschon sie nicht unbedeutend genannt werden konnte, noch in den Zeiten der Kindheit; von nun an aber, nachdem man gelernt oder wiederum erlernt hatte, den bisher mehr oder weniger dem Verderben preisgegebenen Seefisch zu salzen und dergestalt ins Innere der Binnenländer zu versenden, gewann sie rasch außerordentlichen Aufschwung. Zuerst waren es die Holländer, die sie in großartiger Weise betrieben; später nahmen die Hanseaten und Norweger an ihr teil; aber erst seit etwa zweihundert Jahren begannen die Engländer, die gegenwärtig alle übrigen Völkerschaften überflügelt haben, auch ihrerseits Schiffe auf den Heringsfang zu senden.
Zur Fischerei bedient man sich in Norwegen außer den gewöhnlichen besonderer Netze, Wate genannt, die dazu dienen, Fjorde und Buchten abzusperren, nachdem die Heringe in sie eingedrungen sind, und erbeutet dann oft unglaubliche Massen mit einem Male. »Die Ausländer«, sagt Pontoppidan, »werden es kaum glauben können; allein ich, der ich dies schreibe, habe ganz Bergen zum Zeugen, daß mit einem einzigen Auswurfnetz im Sundfjord so viele Heringe sind gefangen worden, daß sie hundert Jachten, einige sagen hundertundfünfzig, aber ich will lieber die geringste Zahl rechnen, jede Jacht zu hundert Tonnen gerechnet, angefüllt haben. In den Buchten bleiben die Heringe, die man eingeschlossen hat, so lange stehen, bis man sie nach und nach bergen und einsalzen kann, worüber der Fisch doch zuletzt ganz ausgezehrt und verdorben wird. Oft bleibt der Hering wegen seiner Menge zwei bis drei Wochen eingeschlossen, da denn viele sich auszehren und viele umkommen, wodurch dann die Bucht mit Gestank angefüllt wird. Im Jahre 1748 trug es sich im Kirchspiele Svanöe zu, daß die Bauern eine unzählige Menge von Frühlingsheringen auf obige Art eingeschlossen hatten. Ein Bürger hier aus Bergen kaufte sie für hundert Reichstaler und eine Tonne Branntwein, worauf er, wie man sagt, achtzig Jachten voller Heringe aufzog und noch viel mehr auf dem Grunde umkommen ließ.« Heutzutage betreibt man in Norwegen, und zwar vorzugsweise längs der ganzen Küste zwischen Trondhjem und Lindesnäs, den Fang regelmäßiger, stellt große Netze aus, in denen man eine bis anderthalb Millionen Stück erhält, wendet aber immer noch mit Vorliebe die Wate an und sperrt, laut Blom, zuweilen noch mehrere tausend Tonnen Fische ab, zu vierundzwanzigtausend Stück jede einzelne gerechnet. Überhaupt zeigt es sich gerade beim Heringsfang, daß alle Völker gelernt und ihre Einrichtungen verbessert haben. Ebenso bedeutend wie die Fischerei der Norweger ist noch heutigentags die der Holländer, obgleich sie schon seit vielen Jahren stetig abgenommen hat und noch abnimmt, wie in demselben Verhältnis die Fischerei der Engländer zunimmt. Seither hat sowohl die Kenntnis des Herings und seiner Lebensweise, wie auch die Fischerei, in der heute die Fischdampfer die Hauptrolle spielen, beträchtlich zugenommen. Um die Erforschung des Herings hat sich besonders Heincke sehr verdient gemacht. Durch genaue statistische Untersuchungen hat er eine ganze Reihe von Heringsrassen unterscheiden können, die alle ihr bestimmtes Areal und damit auch andere verschiedene Eigenschaften haben. Herausgeber.
Der nächste Verwandte des Herings, der in den deutschen Meeren lebt, ist die Sprotte oder der Breitling ( Clupea sprattus), ein Fisch von etwa fünfzehn Zentimeter Länge. Der gekielte Bauch ist deutlich gezähnelt, der Rücken dunkelblau mit grünem Schimmer, der übrige Leib silberweiß gefärbt; Rücken- und Schwanzflosse sehen dunkel, Brust-, Bauch- und Afterflosse weiß aus.
Obschon die Bedeutung der Sprotte für den menschlichen Haushalt weit geringer ist als die des Herings, gehört sie doch zu den wichtigsten Fischen der Nord- und Ostsee, deren Küsten sie in zahlreicher Menge bevölkert. In ihrer Lebensweise ähnelt sie dem Hering, herbergt wie dieser in bedeutenden Tiefen und erscheint alljährlich in unermeßlichen Scharen in der Nähe der Küste oder in seichterem Wasser. Dieses Auftreten hängt jedoch nicht mit der Laichzeit zusammen, weil man nur selten solche fängt, bei denen der Laich in voller Entwicklung ist: ein Umstand, der die Ansicht der Fischer unterstützt, daß die Sprotte nur ein junger Hering sei. Wie dem auch sei, zweifellos werden bei der Sprottenfischerei wirklich Hunderttausende und Millionen von jungen Heringen gefangen.
Zum Fange wendet man feinmaschige Netze an, in denen sich alle Fische von geringerer Größe verstricken; was aber einmal in die Maschen geraten ist, wird auch unter dem Namen Sprotten mit verkauft, und sei es, wie in England oft geschehen, als Dünger für die Felder. An der britischen Küste beschäftigen sich während des Winters gewöhnlich viele hundert Boote mit dieser Fischerei, und viele tausend Tonnen werden gefangen. Im Winter von 1829 auf 1830 waren die Sprotten in solcher Menge vorhanden, daß London nur den geringsten Teil des Fanges bewältigen konnte und Tausende und Hunderttausende von Scheffeln auf die Äcker geworfen werden mußten. Auch an unseren Küsten, insbesondere an denen der Ostsee, werden alljährlich viele, bei Eckernförde allein durchschnittlich etwa sechzehn Millionen Sprotten gefangen, meist geräuchert und dann unter dem Namen »Kieler Sprotten« in alle Welt versendet, wogegen man denselben Fisch in Norwegen einmacht und unter dem Namen »Anchovis« in den Handel einbringt.
*
Von den in den europäischen Meeren lebenden Heringen erscheinen die Alsen ( Alausa) in den Flüssen, um zu laichen. Der Maifisch ( Alausa vulgaris) erscheint auch dem Unkundigen als naher Verwandter des Herings. Die Färbung des Rückens ist ein schönes, metallisch glänzendes Ölgrün; die Seiten glänzen goldig; ein großer, dunkler, verwischter Fleck, der am oberen Winkel der weiten Kiemenspalte steht, und drei bis fünf auf ihn folgende kleinere Flecke haben olivengrünen Schimmer; die Flossen erscheinen durch dunkelkörnige Farbstoffe mehr oder weniger schwärzlich getrübt. Die Länge beträgt sechzig Zentimeter und darüber, das Gewicht anderthalb bis dreieinhalb Kilogramm. Bedeutend kleiner ist die verwandte Finte ( Alausa finta), die sich vom Maifisch vorzugsweise durch die wenigen, einzelnstehenden, kurzen und dicken Fortsätze auf der ausgehöhlten Seite der Kiemenbogen unterscheidet, ihr in der Färbung jedoch fast vollständig gleichkommt.
In der Lebensweise ähneln sich beide Alsen. Sie bewohnen alle Meere, die die europäischen Küsten bespülen, halten sich hier in ziemlicher Tiefe auf, treten, je nachdem sich die Flüsse mehr oder weniger geklärt, früher oder später in diese ein und wandern in ihnen empor, um zu laichen. Auf diesen Wanderungen besuchen sie fast das ganze Gebiet eines Stromes, weil sie auch in den kleineren Flüssen so weit zu Berge gehen, wie sie können. Ihren Namen Maifische haben sie von dem regelmäßigen Erscheinen erhalten. Die Fischer kennen sie sehr gut, weil sie sich geräuschvoller bewegen als andere Fische, nahe der Oberfläche des Wassers fortwandern und zuweilen einen Lärm verursachen, »als befände sich eine Herde Schweine im Wasser«. Die Finte pflegt ihre Reise gewöhnlich vier Wochen später als der Maifisch anzutreten, benimmt sich aber auf der Reise ebenso wie dieser. Während des Lärmens, das dem Schweinegrunzen nicht unähnlich ist, aber von dem Schlagen mit dem Schwänze hervorgebracht wird, geben die fortpflanzungslustigen Fische in der Nähe der Oberfläche ihren Laich von sich und kehren, nachdem dies geschehen, langsam ins Meer zurück, die meisten in einem auffallend hohen Grade entkräftet und abgemagert, so daß man ihr Fleisch, das ohnehin wenig geschätzt wird, kaum noch genießen kann. Nicht wenige von ihnen erliegen der Anstrengung, und ihre Leichname treiben zuweilen massenhaft den Strom hinab. Junge von etwa fünf Zentimeter Länge beobachtet man im Oktober, solche von zehn bis fünfzehn Zentimeter Länge noch im nächsten Frühling in den Flüssen, von denen aus nunmehr auch sie sich ins Meer begeben. Ihre Nahrung besteht aus kleinen Fischen und weichschaligen Krebstieren.
Wichtiger als Maifisch und Finte ist eine andere Alse, der Pilchard oder die Sardine ( Alausa pilchardus), ein im Ansehen dem Hering ähnelnder, aber kleinerer und dickerer Fisch von achtzehn bis zwanzig, höchstens fünfundzwanzig Zentimeter Länge, auf der Oberseite bläulichgrün, auf der Seite und am Bauche silberweiß gefärbt, auf den Kiemendeckeln goldig schimmernd und dunkler gestreift.
Der Pilchard, der hauptsächlich dem Westen Europas angehört, findet sich häufig im Süden von England und längs der ganzen französischen und nordspanischen Küste bis gegen die Meerenge von Gibraltar hin. An der Küste von Cornwall hält er sich das ganze Jahr, jedoch bald in tieferem, bald in seichterem Wasser auf. Auch von ihm glaubte man früher, daß er nur ein Wanderfisch sei und aus den hochnordischen Meeren in die südlicheren ziehe, während man neuerdings durch sorgfältigere Beobachtungen seine Lebensweise besser feststellen konnte. Nach Couch leben die Pilchards im Januar verhältnismäßig vereinzelt auf dem Grunde des Meeres, vereinigen sich aber gegen den März hin in Heere, die sich bald auflösen, bald wieder sammeln und bis zum Juli in einer gewissen Verbindung bleiben. Die Fülle an Nahrung auf einer bestimmten Stelle des Meeres und die Fortpflanzung tragen zu diesen Vereinigungen und ebenso zu den wirklichen Bewegungen, die das Heer ausführt, wesentlich bei. Der Pilchard gehört zu den gefräßigsten Fischen, verzehrt jedoch fast nur kleine Kruster, vorzugsweise eine zwerghafte Garnele, von der man oft viele Tausende in dem bis zum Platzen gefüllten Magen findet. Ihr zu Gefallen hält er sich auf dem Boden des Meeres und durchsucht nach Art der Karpfen den Sand oder die Lücken zwischen Steinen in seichtem Wasser. Daß unser Fisch auch anderes Getier nicht verschmäht, läßt sich mit Bestimmtheit annehmen: er beißt an Angeln, die mit Würmern geködert wurden, oder läßt sich durch Auswerfen von Stockfischrogen herbeilocken. Seine Laichzeit fällt in die Herbstmonate; doch findet man in einzelnen Jahren bereits im Mai viele laichfähige Pilchards, kann also von einer streng bestimmten Fortpflanzungszeit eigentlich nicht sprechen.
An den britischen Küsten betreibt man eine bedeutende Fischerei auf den Pilchard. Zuweilen nimmt man mit einem großen Zuge unglaubliche Massen auf einmal aus dem Wasser. Ein Fischer erzählte unserem Gewährsmann von einem Fischzug, bei dem er zugegen gewesen war, und der zweitausendundzweihundert Oxhoft oder Tonnen Pilchards ergeben hatte; ja, man kennt ein Beispiel, daß mit einem Zuge zehntausend Oxhoft oder annähernd fünfundzwanzig Millionen dieser Fische gefangen wurden. Die Fischerei selbst hat vieles Eigentümliche, weil man nur die wenigsten Pilchards während der Laichzeit fängt, die größere Masse hingegen vom Grunde heraufholt. Es handelt sich also darum, auf das genaueste die Gegend zu erforschen, in der sich gerade ein Heereszug aufhält, und ihm nun den Weg abzuschneiden, ohne ihn zu verscheuchen. In gewisser Beziehung erinnert der Fang mit den großen Grundnetzen, die man mit bestem Erfolge anwendet, an die Tunfischerei; denn hier wie da hängt alles von der Geschicklichkeit und Einsicht des Fischers ab, und hier wie da muß dieser zu den verschiedensten Mitteln seine Zuflucht nehmen, um sich seiner reichen Beute zu versichern. Viele Pilchards werden eingesalzen, die große Mehrzahl aber, nachdem sie wenige oder geraume Zeit in der Sülze gelegen, noch in Öl gekocht, mit diesem in blecherne Büchsen gelegt und als Sardinen in den Handel gebracht.
Die Alten kannten weder den Hering noch den Pilchard, noch die Sprotte, wohl aber die Sardelle oder Anchovis ( Engraulis encrasicholus), die wegen ihres zusammengedrückten Leibes, der glatten Bauchkante, des weiten, bis hinter die Augen gespaltenen Maules, der in stumpfer Spitze vortretenden Schnauze, kleinen Augenlider, schmalen, geradlinigen Oberkieferknochen und sehr spitzigen Zähne auf den verschiedenen Knochen des Maules als Vertreter einer besonderen Sippe ( Engraulis) angesehen wird, höchstens fünfzehn Zentimeter an Länge erreicht und auf der Oberseite bräunlichblau, an den Seiten und dem Bauche weiß, am Kopfe goldig gefärbt ist.
In sehr zahlreicher Menge bewohnt die Sardelle das Mittelländische Meer, verbreitet sich aber von hier aus längs der europäischen Küsten im Atlantischen Weltmeere bis in den nördlicheren Teil der Nordsee, dringt auch in die Ostsee ein. Für die nördlichen Teile des Verbreitungsgebietes hat der Fang dieses geschätzten Fisches keine besondere Bedeutung. Aber schon in der Bretagne bringt die Sardellenfischerei Millionen ein; im Mittelmeere zählt das Fischchen zu den von den Anwohnern am meisten geschätzten Mitgliedern seiner Klasse. In Lebensweise und Betragen unterscheidet sich die Sardelle wenig von anderen Heringen. Auch die Sardellen treten in solchen Massen auf, daß man oft in einem einzigen Zuge mehr als vierzig Tonnen, zu je sieben- bis achttausend Stück, aus dem Wasser hebt. Man trennt ihnen nach dem Fange die Köpfe ab, nimmt die Eingeweide heraus und salzt oder macht sie ein. Letztere Arbeit wird hauptsächlich von den Weibern der Fischer betrieben, die eine erstaunliche Fertigkeit besitzen, mit ihrem sorgsam gepflegten Daumennagel den Kopf abzuschneiden, gleichzeitig die Eingeweide zu fassen und mit dem abgetrennten Kopfe beiseite zu werfen. Im Handel heißen die gesalzenen Fischchen Sardellen, die eingelegten Anchovis. Diese sind natürlich die echten Anchovis, während man das von den als »Anchovis« verarbeiteten Sprotten (S. 328) natürlich nicht sagen kann. Herausgeber.
Die Aalfische ( Anguillidae) bilden eine zahlreiche Familie und kennzeichnen sich durch schlangenartig gestreckten, mehr oder weniger zugerundeten, am Schwänze meist seitlich zusammengedrückten, nackten oder mit zarten, nicht sich deckenden, zickzackförmig abgelagerten Schuppen bekleideten Leib. Sie herbergen im warmen und gemäßigten Gürtel. Einzelne Arten überschreiten allerdings den Polarkreis, werden jedoch bald selten und verschwinden schon einige Breitengrade weiter nördlich gänzlich. Sie leben im Meere wie in den süßen Gewässern. Zu ihrem Aufenthalt erkiesen sie sich vorzugsweise Gewässer mit schlammigem Grunde, weil sie hier den Hauptteil ihrer Nahrung und vor größeren Raubfischen Zuflucht finden. Alle ohne Ausnahme zählen zu den Raubfischen, mehrere von ihnen zu den tüchtigsten und gefräßigsten, obgleich die meisten mit kleineren Tieren sich begnügen. Für den menschlichen Haushalt haben sie von jeher eine nicht zu unterschätzende Bedeutung gehabt; ihr Fang wird deshalb auch allerorten eifrig betrieben. Ihr Fleisch gilt allgemein als ausgezeichnete Nahrung; ihre Fruchtbarkeit, weite Verbreitung und Zählebigkeit, die Leichtigkeit, sie frisch oder in irgendeiner Art zubereitet zu versenden, erhöhen ihren Wert.
Der Aal ( Anguilla vulgaris), Vertreter der Sippe der Flußaale ( Anguilla), kennzeichnet sich durch die sehr engen Kiemenspalten vor den Brustflossen, die unmittelbar in die spitzige Schwanzflosse übergehenden Rücken- und Afterflossen und die Samtzähne, die Zwischen- und Unterkiefer nebst dem Pflugscharbeine besetzen. Die Kopflänge beträgt etwa ein Achtel der gesamten Leibeslänge; die Augen sind klein und mit Haut überzogen, die Lippen dick und fleischig, die Nasenlöcher einfach; die Kiemenöffnung bildet eine halbmondförmige, nach vorne gebogene Spalte; die zehn Kiemenstrahlen sind mit der den Kopf überkleidenden Haut verbunden; die Rückenflosse nimmt nahe an zwei Drittel der gesamten Länge ein, ist anfänglich niedrig, erhöht sich aber gegen das Ende des Schwanzes hin und setzt sich, da sie sich mit der Schwanzflosse verbindet, unmittelbar in die Afterflosse fort; die Brustflossen sind kurz und länglich eiförmig gestaltet. Die Beschuppung besteht aus äußerst zarten, dünnen, durchsichtigen, langen, schmalen Horngebilden, die in die dicke, schleimige Haut nach zweierlei Richtungen derart abgelagert sind, daß sie fast unter rechtem Winkel gegeneinander geneigt erscheinen, also freie Zwischenräume bilden, die von der hier zickzackförmig gerunzelten Haut ausgefüllt werden. Die Färbung der Oberseite ist dunkelgrünlich, auf dem Oberkopf am dunkelsten, ins Bräunliche spielend; die Unterseite sieht weiß aus und zeigt matten Silberglanz; Rücken-, Schwanz- und der Hinterteil der Afterflosse erscheinen noch düsterer als der Rücken; die Brustflossen sind bräunlichschwarz und tiefschwarz gesäumt. An Länge überschreitet der Aal nur in seltenen Fällen das Maß von einhundertdreißig Zentimeter, an Gewicht bloß ausnahmsweise sechs Kilogramm; doch erwähnt Yarrell zweier, die zusammen fünfundzwanzig Kilogramm gewogen hatten. Je nach den verschiedenen Lebens- und Alterszuständen ändert der Aal ab, hat deshalb auch einzelne Forscher veranlaßt, die verschiedenen Formen als Arten aufzustellen und zu beschreiben.
»Der Aal ist ein bekandt Thier dem ganzen, teutschen Landt, auch allen andern Landen. Allein ist das zu merken, daß sie in etlichen flüssen nit gefunden werden, dann in dem fluß Thonaw wirt keiner gefangen, mögen auch, wo sie in solchen geworffen werden nit geleben, sondern sterben zuhandt.« Hinsichtlich der Donau hat der alte Geßner vollständig recht. Dieser Strom und alle Zuflüsse desselben beherbergen keine Aale, und wenn solche wirklich einmal in ihm gefunden werden, darf man bestimmt annehmen, daß sie zufällig in das Stromgebiet geraten sind. Tiefes Wasser mit schlammigem Grund wird von dem Aal vor jedem anderen bevorzugt; doch bindet er sich keineswegs an derartige Gewässer, sondern besucht auch, wanderlustig wie er ist, solche von entgegengesetzter Beschaffenheit.
Während des Winters liegt er im Schlamm verborgen und hält Winterschlaf, treibt sich wenigstens nicht jagend umher; mit Beginn der warmen Jahreszeit fängt er sein Sommerleben an, schwimmt mit schlangenartiger Bewegung in verschiedenen Wasserschichten sehr rasch dahin, schlüpft mit bewunderungswürdiger Gewandtheit durch Höhlungen oder Röhren, kommt z. B. regelmäßig in den Wasserleitungen größerer Städte, die ihr Wasser nicht genügend klären, vor. Noch immer wird behauptet, daß er sich des Nachts auf das Land begebe, um in Erbsen- oder Wickenfeldern Schnecken und Würmern nachzugehen. Die Angabe war, wie Siebold bemerkt, bereits Albertus Magnus bekannt, der in seinem Tierbuche sagt: »Der Aal soll auch ettwan des nachts auß dem Wasser schlieffen auf dem feldt, da er linsen, erbsen oder bonen gesehet finden«, und mag sich überlieferungsweise fortgeerbt haben, da sie noch gegenwärtig fast mit denselben Worten wiederholt wird. An und für sich wären Landwanderungen der Aale nicht undenkbar, da ja, wie wir gesehen haben, auch andere Fische solche unternehmen; Bedenken aber erwachsen, wenn man sich vergegenwärtigt, wie selten jene ungeachtet der Häufigkeit des Aales geschehen müssen, da selbst die erfahrensten Fischer auf Grund eigener Beobachtungen davon nichts zu erzählen wissen; Bedenken ergeben sich ferner, wenn man erwägt, wie leicht Aale, die man auf dem Lande gefunden haben will, meinetwegen auch wirklich gefunden hat, durch vorher stattgefundene Überschwemmungen zurückgelassen worden sein können. Unterstützt werden solche Bedenken durch anderweitige Tatsachen. Spallanzani hat darauf aufmerksam gemacht, daß bei Comacchio, wo seit langer Zeit ein großartiger Aalfang betrieben wird, die Fischer noch niemals Aale auf dem Lande beobachtet haben, und daß, als die Aale in den Lagunen von Comacchio wegen Verderbnis des Wassers zu vielen Tausenden umgekommen waren, doch kein einziger den Versuch gewagt, über Land in das nahe gelegene Meer oder den benachbarten Po sich zu retten. Gingen die Aale viel geringerer Ursachen halber zuweilen an das Land, so würden sie angesichts solcher Gefahren unzweifelhaft, ebenso gewiß wie Labyrinthfische und Welse, ihrer Fähigkeit sich bedienen; es würde an Beweisen dafür nicht mangeln und man nach glaubwürdigen Augenzeugen nicht suchen müssen. Daß auch der Aal Luft atmen, demgemäß einen Tag und länger außerhalb des Wassers leben kann, ist allerdings sehr richtig, beweist aber das Ausführen der Wanderung noch keineswegs.
Zur Nahrung wählt sich der Aal hauptsächlich niedere Tiere, namentlich Würmer und Kruster; auch überfällt er Frösche, kleine Fische und dergleichen, soll sich sogar am Aase gütlich tun. Seine Gefräßigkeit ist groß.
So unvollkommen unsere Kenntnis der Fortpflanzungsgeschichte des Aales einstweilen noch ist, so können wir doch, dank den sorgsamen Beobachtungen neuzeitlicher Forscher, so viel mit Bestimmtheit behaupten, daß auch dieser Fisch durch Eier sich fortpflanzt. Über das Laichen selbst fehlt noch jede Kunde. Wir wissen bloß, daß die erwachsenen Aale die Flüsse verlassen und in großer Anzahl dem Meere zuwandern, dürfen auch dreist annehmen, daß sie hier laichen. Ihre Wanderungen finden, wie schon seit lange bekannt, im Herbst, vom Oktober bis zum Dezember, vorzugsweise während stürmischer und finsterer Nächte, statt. Sie sind, wie die genauesten Untersuchungen ergeben haben, um diese Zeit für ihr Fortpflanzungsgeschäft noch nicht vorbereitet; aber bereits zu Ende des April, spätestens im Mai, beginnt eine Rückwanderung in die Flüsse, und zwar sind es Junge von höchstens neun Zentimeter Länge und Wurmdicke, die zu Berge gehen, höchst wahrscheinlich also die kurz vorher von den im Herbst ausgewanderten Alten erzeugten Nachkömmlinge. Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, würde also der Beweis geliefert sein, daß die Laichzeit in die Monate Dezember bis Februar fallen muß. Ob einzelne Aale auch in Süßwasserseen laichen, wie von manchem angenommen wird, oder ob wirklich alle, die zur Fortpflanzung gelangen, in das Meer hinausziehen, wie die große Mehrzahl sicherlich tut, ob endlich, wie ebenfalls angenommen worden, die Laichfische, nachdem sie ihrer Eier sich entledigt, gar nicht wieder in die Flüsse zurückkehren, sondern im Meere absterben, muß alles einstweilen noch dahingestellt bleiben. Dank den Forschungen italienischer und dänischer Naturforscher ist das Rätsel der Aalfortpflanzung heute einigermaßen gelöst. Alle europäischen geschlechtsreifen Aale – sie sind dann 7 bis 11 Jahre alt – wandern, ohne weiter Nahrung aufzunehmen und mit bestimmten Änderungen ihrer Färbung und an ihren Augen ins Meer, und zwar weit in den Atlantik hinein und verschwinden westlich der Azoren halbwegs Amerika in der Tiefsee, wo sich ihr, uns immer noch unbekanntes Laichgeschäft vollzieht. Ebendort entwickeln sich auch die Aallarven zwei Jahre lang, um dann nach einem weitern halben Jahre an unsern Küsten in Form der sog. Glasaale zu erscheinen. Die ersten, glashellen, weidenblattförmigen Aallarven hat man früher für eine besondere Fischart ( Leptocephalus brevirostris) gehalten. In nach Millionen zählenden ungeheuren Massen kommen die Aale bei uns an, wandern in die Flüsse ein und reisen allmählich zu den richtigen Aalen heran. Die amerikanischen Aale laichen ebenfalls im Atlantik, aber westlich von unsern Aalen im Golf von Mexiko. Es sind außerordentlich mühsame und kostspielige Untersuchungen gewesen, die das Aalrätsel so weit gelöst haben. In eigenen Expeditionen ist der dänische Biologe Schmidt den Aalen gewissermaßen nachgereist. Sein Kompaß war das Immer-kleiner-werden der jungen Fische, bis er schließlich keine kleineren, aber leider auch noch nicht die kleinsten fand. Hier verschwanden sie in der unergründlichen Tiefe des Ozeans, die also noch das Hauptgeheimnis deckt. Herausgeber.
Das Aufsteigen der jungen Aale ist mehrfach beobachtet worden und findet in allen größeren Strömen statt. Bereits Redi erzählt. daß vom Ende Januar bis zu Ende April alljährlich Aalbrut den Arno hinaufwandert und daß um das Jahr 1667 bei Pisa an einer Stelle des genannten Flusses innerhalb fünf Stunden drei Millionen Pfund solcher Aale von drei bis zwölf Zentimeter Länge gefangen wurden. In den Lagunen von Comacchio werden, laut Spallanzani und Coste, vom Februar bis April gewisse Schleusen geöffnet, um den jungen Aalen den Eintritt in die abgedämmten Teiche zu gestatten, aus denen sie dann nach fünf- bis sechsjährigem Aufenthalt wieder ins Meer zu gelangen suchen und dabei gefangen werden. Auch im Orbitello-See wandern die jungen bindfadendicken Aale im Frühjahr, und zwar im März, April und Mai, bei stürmischem Wetter zu Millionen ein. »In den Monaten März und April,« sagt Karl Vogt, »steigen in den Nächten Myriaden kleiner, etwa fünf Zentimeter langer, durchsichtiger Fischlein durch die Fluhmündungen auf. An manchen Orten, wie zum Beispiel in französischen Flüssen, wo man diese Erscheinung › montée‹; nennt, bilden sie feste Massen, die man mit Sieben und Schöpfern ausschöpft und meist mit Eiern, als Pfannkuchen gebacken, verspeist. Dies sind junge Aale, die von den Laichplätzen flußaufwärts steuern und nach zwei Jahren etwa sechzig Zentimeter lang geworden sind.« Zuweilen schwimmen sie, ohne daß man einen Grund absehen könnte, von einem Ufer des Flusses quer über das Wasser nach der anderen Seite hinüber. An der Mündung eines Flusses teilen sie sich: ein Teil zieht in den Nebenflüssen hinan, der andere kämpft sich durch die Strömung des Einflusses und wandert an dem Ufer des Hauptstromes weiter. Auf diese Weise zersplittert sich das Heer nach und nach, bis es endlich an verschiedenen Orten ganz untergebracht worden ist. Alle Hindernisse werden überwunden, und den Milliarden, die wandern, tun die Hunderttausende, die dabei ihren Tod finden, keinen ersichtlichen Abbruch. Der Rheinfall bei Schaffhausen kann sie nicht verhindern, ihren Weg nach dem Konstanzer See fortzusetzen; der Rhônefall hält sie ebensowenig auf. Laut Nilsson konnten sie früher nicht über den Trollhätta-Fall emporkommen; als jedoch die Schleusen angelegt worden waren, die jetzt die Schiffahrt vermitteln, fanden sie sich auch im Wenersee ein und seitdem in allen Zuflüssen desselben. »Als wir eines Morgens zu Ende des Juni oder zu Anfang des Juli auf den unmittelbar an die Elbe stoßenden Deich des Dorfes Dreenhausen traten,« berichtet Ehlers, »sahen wir, daß entlang des ganzen Ufers ein dunkler Streifen sich fortbewegte. Wie für die Bewohner der dortigen Elbmarsch, was sich auf und was sich in der Elbe ereignet, teilnahmswert ist, so zog auch diese Erscheinung sofort die Aufmerksamkeit auf sich, und es ergab sich, daß dieser dunkle Streifen von einer unzähligen Menge junger Aale gebildet wurde, die dicht an der Oberfläche des Flusses stromaufwärts zogen und sich dabei stets so nahe und unmittelbar am Ufer hielten, daß sie alle Krümmungen und Ausbuchtungen desselben einhielten. Die Breite dieses aus Fischen bestehenden Streifens mochte an der Stelle, wo er beobachtet wurde, etwa dreißig Zentimeter betragen; wie groß die Mächtigkeit desselben nach unten sei, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. So dichtgedrängt aber schwammen hier die jungen Aale, daß man bei jedem Zuge, den man mit einem Gefäße durch das Wasser tat, eine namhafte Menge der Fische erhielt und diese für die Anwohner der Elbe insoweit lästig wurden, als letztere, solange der Zug der Fische dauerte, kein Wasser aus der Elbe schöpfen konnten, das nicht von den kleinen Fischen angefüllt gewesen wäre. Die Größe der einzelnen jungen Aale betrug durchschnittlich wohl acht bis zehn Zentimeter; die Dicke ihrer Leiber erreichte ungefähr die eines Gänsekieles. Vereinzelt schwammen Aale von bedeutender Größe dazwischen; doch mochte wohl keiner über zwanzig Zentimeter lang gewesen sein. Dieser wunderbare Zug der Fische dauerte ununterbrochen in gleicher Stärke den ganzen Tag hindurch und setzte sich auch noch am folgenden fort; am Morgen des dritten Tages aber war nirgends mehr einer der jungen Aale zu sehen.«
Alle größeren Fischfresser stellen den Aalen eifrig nach, haben aber oft ihre liebe Not mit ihnen. Ungemein drollig sieht es aus, wenn man einem gefangenen hungrigen Fischotter einige Dutzend kleiner lebenden Aale in sein Wasserbecken wirft. Er stürzt sich in sein Becken, holt einen Aal, beißt ihm den Kopf ein, legt ihn auf die Bank, fällt von neuem ins Wasser, packt einen zweiten, erscheint an der alten Stelle und sieht zu nicht geringer Überraschung, daß der vermeintliche Tote sich schon längst wieder fortgeringelt hat und im Wasser sich bewegt, als wäre ihm nichts geschehen. Darüber ärgerlich, versetzt das erboste Raubtier dem zweiten gefangenen mehrere Bisse und stürzt sich in die Fluten, um den ersten wiederzuholen; mittlerweile ist der zweite ebenfalls wieder entschlüpft, und so währt das Wechselspiel so lange, bis der Otter sich entschließt, schleunigst ein paar der nicht umzubringenden Wurmfische zu verzehren.
Die Zählebigkeit dieser Fische macht übrigens nicht bloß den Tieren, sondern auch den Menschen zu schaffen. Jede Fischfrau, jede Köchin weiß, was es sagen will, einen Aal umzubringen. »Ich habe«, erzählt Lenz, »in einer Seestadt, sooft ich die Fischmärkte besuchte, die großen Aale in Wasserkübeln gesehen, während die etwa sechzig Zentimeter langen massenweise auf großen Tischen lagen und daselbst in fortwährender Bewegung sich zusammendrängten. Waren die Fischweiber nicht gerade mit dem Verkauf beschäftigt, so nahmen sie einen der auf dem Tisch aufgepflanzten Aale nach dem anderen beim Kopfe, machten hinter diesem mit dem Messer einen ringförmigen Schnitt und zogen dann die Haut vom Halse bis zum Schwanze ab. Dabei und noch lange nachher krümmt sich das unglückselige Tier ganz jämmerlich.«
Die Aalfischerei wird überall eifrig betrieben. Das Fleisch zählt zu dem besten, das unsere Flußfische liefern können, findet daher auch stets viele Abnehmer. An unseren Küsten bildet der Aal, ebensowohl frisch wie geräuchert oder eingemacht, einen nicht unwichtigen Gegenstand des Handels.
*
Im allgemeinen den Flußaalen sehr ähnlich, unterscheiden sich die Meeraale ( Conger) durch die lange, fast die ganze Oberseite einnehmende, über oder dicht hinter den Brustflossen beginnende Rückenflosse, den über den unteren verlängerten oberen Kiefer und das Fehlen der Schuppen in der platten, schleimigen Haut. An den europäischen Küsten lebt der bekannteste Vertreter dieser Sippe, der Seeaal ( Conger vulgaris), ein sehr großer Fisch, der eine Länge von mehr als drei Meter und, laut Yarrell, zuweilen ein Gewicht von über fünfzig Kilogramm erreichen kann. Die Färbung seiner Oberseite ist ein gleichmäßiges Blaßbraun, das auf den Seiten lichter wird und unten in Schmutzigweiß übergeht; Rücken- und Afterflossen sind weißlich, schwärzlich gesäumt; die Seitenlinie tritt wegen ihrer lichteren Färbung deutlich hervor.
In der Nord- und Ostsee bevorzugt der Seeaal felsige Ufer und verbirgt sich hier in Höhlen und Ritzen derselben, während er auf sandigem Grunde durch Eingraben sich zu verstecken weiß. Er ist ein ungemein gefräßiges Tier, das nach Raubfischart auch schwächere seines Geschlechtes nicht verschont: aus dem Magen eines Stückes von zwölf Kilogramm Gewicht nahm Yarrell drei Schollen und einen jungen Seeaal von einem Meter Länge. Die Kraft seiner Kinnlade ist so bedeutend, daß er Muscheln mit Leichtigkeit zermalmt. Die Laichzeit fällt in den Dezember oder Januar. Junge von Fingerlänge sieht man an felsigen Küsten während des Sommers.
Obgleich das Fleisch des Seeaales nicht gerade in besonderer Achtung steht, wird sein Fang doch eifrig betrieben, weil jenes von Ärmeren als billige Nahrung gesucht wird. Früher trocknete man an den englischen Küsten viele dieser Fische zur Ausfuhr nach Spanien und Südfrankreich, zerkleinerte hier und dort das Fleisch zu einem groben Pulver und verwendete es zur Bereitung von Suppen und ähnlichen Speisen.
Gefangene Seeaale gewöhnen sich selbst in engen Becken binnen kurzem ein, wählen irgendeinen passenden Schlupfwinkel zu ihrem Aufenthalt, verbergen sich entsprechendenfalls auch unter einer lebenden Seeschildkröte und verweilen hier während des Tages in träger Ruhe, wogegen sie des Nachts fast ununterbrochen in Bewegung sind. Ihr ewiger Heißhunger befreundet sie bald so innig mit ihrem Pfleger, daß sie angesichts einer ihnen vorgehaltenen Speise auch bei Tage ihr Versteck verlassen und zuletzt das ihnen vorgehaltene Futter furchtlos aus der Hand nehmen. Bei reichlicher Nahrung wachsen auch sie ungemein rasch heran.