
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Fassen wir das Leben einer Fürstin von der Wiege auf, so empfing die Welt das neugeborene »Fräulein« schon damals nicht mit der Freude wie einen jungen Sohn. Wünschte man der Mutter von nahe und fern auch Glück »zu glückseliger Erlösung von der fraulichen Bürde und zu solcher gebenedeieten Gabe«, so versäumte man doch selten, den prophetischen Wunsch »eines Erben in Jahresfrist« hinzuzufügen. Desgleichen ward auch die Taufe des Fräuleins mit ungleich wenigerem Glanz gefeiert und selbst die fürstlichen Patengeschenke waren meist von geringerem Werte. Indes dankt doch die Herzogin Anna von Mecklenburg dem Herzog von Preußen bei der Taufe ihrer Tochter für das Patengeschenk mit den Worten: »es wäre wahrlich eines solchen tapfern und stattlichen Geschenkes unnöthig gewesen, denn daß wir Euer Liebden zu Gevatter gebeten, ist keiner anderen Ursache halber geschehen, als daß wir mit Euer Liebden und derselben herzlichsten Gemahlin alte Treue und Freundschaft wiederum erneuern wollten«.
Während der junge Prinz, zum Alter des Unterrichtes herangereift, der Pflege der fürstlichen Mutter entnommen und der Führung und Belehrung eines Hofmeisters übergeben ward, wuchs das Fräulein in der mütterlichen Umgebung zu einem höheren Lebensalter heran, ohne daß an eigentliche wissenschaftliche Ausbildung gedacht ward. Selbst im vorgerückten jungfräulichen Alter war von einem umfassenden Unterricht und einer auch nur einigermaßen gründlichen wissenschaftlichen Belehrung der fürstlichen Fräulein damals kaum die Rede. Lesen und Schreiben, Religion und eine Übersicht in der Geographie scheinen in der Regel die einzigen Gegenstände des Unterrichtes gewesen zu sein; aber auch hierin blieben die Kenntnisse mangelhaft.
Zuweilen kam noch einige Belehrung in der deutschen und wohl auch in der lateinischen Sprache hinzu. So erklärt der Markgraf Georg Friedrich von Brandenburg dem Hofmeister Heinrich Schröder in einem Zeugnis, »daß er den Töchtern des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen, Fräulein Anna und Eleonore, stets mit bestem Fleiße aufgewartet und dieselben in der lateinischen und deutschen Sprache treulich instituirt und unterwiesen, nun aber zur weiteren Fortsetzung seiner Studien nach seinem Wunsche seine Entlassung erhalten habe«. Sonach blieb die geistige Ausbildung der fürstlichen Fräulein in jeder Hinsicht unvollkommen, wovon auch die Briefe, welche sich aus ihren späteren Jahren von ihnen erhalten haben, redende Zeugen sind; denn sie verraten nie eine Spur von wissenschaftlichen Kenntnissen irgendeiner Art, und selbst die Sprache und Schreibart, in der sie abgefaßt sind, geben Beweis von ihrer mangelhaften geistigen Ausbildung.
Die eigentliche Erziehung des fürstlichen Fräuleins für das Leben und für seine weibliche Bestimmung erfolgte teils durch die fürstliche Mutter, teils durch den Unterricht der Hofmeisterin, der Obervorsteherin der Hofjungfrauen. Da ihr die nächste Aufsicht und Ausbildung des fürstlichen Fräuleins anvertraut wurden, so waren die Fürstinnen stets bemüht, Personen, die sich durch weibliche Tugenden, Anstand, feine Sitten und Gewandtheit im Umgang, aber zugleich auch durch Fertigkeit und Geschick in weiblichen feinen Arbeiten auszeichneten, als Hofmeisterinnen in Dienst zu nehmen. Man wählte sie gewöhnlich aus dem Adel. Es war indes nicht leicht, Personen zu finden, die alle Tugenden und Eigenschaften einer in allen Beziehungen brauchbaren Hofmeisterin vereinigten. Die Herzogin Dorothea von Preußen durchmusterte vergebens den gesamten weiblichen Adel ihres Landes, um eine geeignete Person auszusuchen, deren Führung sie ihre Tochter Anna Sophia anvertrauen könne. Sie mußte Auftrag geben, ihr eine solche aus Deutschland zuzusenden. Sie verhieß ihr einen jährlichen Gehalt von zwanzig Gulden, außerdem die Hofkleidung, wie man sie allen anderen Hofjungfrauen jedes Jahr zu geben pflegte, und stellte ihr die Aussicht zur Verbesserung ihrer Besoldung, wenn sie ihren Pflichten und Obliegenheiten fleißig nachkommen werde. Häufig entspann sich zwischen der Hofmeisterin und dem fürstlichen Fräulein eine vertraute, innige Freundschaft für das ganze Leben.
War das fürstliche Fräulein zu mannbaren Jahren gekommen, so suchten die fürstlichen Eltern gerne Gelegenheit zur Verheiratung. Mitunter aber traten beim Unterbringen der fürstlichen Töchter manche Sorgen und Schwierigkeiten ein. Nicht selten machte sich der damalige Religionszwist und die Spaltung in der Kirche auch in diesen Verhältnissen geltend, denn kein Fürst des altkatholischen Glaubens konnte sich überwinden, eine Tochter an einen Fürsten der neuen lutherischen Kirche zu vermählen und in gleicher Weise schreckte den evangelischen Fürsten das Bekenntnis des alten Glaubens von jeder solchen Verbindung zurück. So versuchte es im Jahre 1551 der Pfalzgraf Friedrich III., eine Verbindung zwischen seinem Vetter, dem Markgrafen Bernhard von Baden, und einer Tochter der Gräfin Elisabeth von Henneberg durch Vermittelung ihrer Tochter Elisabeth von Henneberg einzuleiten; er ließ ihr durch diese melden, daß der Markgraf an ihrer Tochter »Fräuchen Katharine Wohlgefallen gefunden« und daß, wenn sie nicht abgeneigt sei, er sich persönlich bei ihr einfinden wolle, um die Hand ihrer Tochter zu werben und »dann nach ihrem Gefallen es mit der Heirath richtig zu machen«. Als indes die Gräfin sich näher um des Markgrafen Persönlichkeit erkundigte und erfuhr, daß er des Markgrafen Karl von Baden rechter Bruder sei, schrieb sie dem Herzog Albrecht von Preußen: »der ist ein Papist; da habe ich kein Herz dazu«.

Unbekannter Meister des 15. Jahrhunderts, Der Falkner. Spielkarte
Lebten fürstliche Witwen mit ihren Fräulein von der Welt zurückgezogen auf dem einsamen Besitztum ihres Leibgedinges, so wußte die besorgte Mutter gemeinhin kein anderes Mittel zur Versorgung ihrer Töchter, als die Vermittelung eines verwandten oder befreundeten Fürsten anzusprechen. Hören wir, wie die Witwe des Herzogs Albert VI. oder des Schönen von Mecklenburg, Anna bemüht war, ihre Tochter Anna an den Mann zu bringen. Sie hatte ihr Auge auf den Herzog Magnus von Holstein geworfen, und schrieb deshalb dem Herzog Albrecht von Preußen: »Weil Euer Liebden selbst wissen, daß die Eltern nichts lieber sehen, denn daß ihre Kinder bei ihrem Leben möchten ehrlich und christlich versorgt werden und ich auch nichts lieber erfahren wollte, als daß meine freundliche herzliebste Tochter möchte bei meinem Leben fürstlich versorgt und ausgesteuert werden, so bitte ich Euer Liebden aufs freundlichste, Euer Liebden wollen als der Herr, Freund und Vater dazu helfen rathen, daß meine Tochter an die Orte kommen möchte, damit sie ihrem fürstlichen Stande nach versorgt werde und ich deß getröstet und erfreut wäre, wie ich auch nicht zweifele, Euer Liebden werden der Sache ferner nachdenken. Ich habe für meine Person bedacht, wenn Gott Friede mit Livland und dem Moskowiter gebe, ob es dann mit Herzog Magnus von Holstein gerathen wäre.« Herzog Albrecht billigte diesen Vorschlag nicht, gab jedoch der Herzogin den Trost, für ihre Tochter auf jede Weise zu sorgen. Einige Jahre nachher ward diese, nachdem sie schon das dreiunddreißigste Jahr erreicht, an den Herzog Gerhard von Kurland vermählt.
Noch größere Schwierigkeiten traten für solche fürstliche Fräulein ein, die sich früher dem Klosterleben gewidmet hatten, später aber, entweder gezwungen oder freiwillig, ins Weltleben zurückgekehrt waren; für sie boten sich fast nirgends Aussichten zu ehelichen Verbindungen dar; denn in solchen Fällen stellten selbst auch politische Rücksichten unüberwindliche Hindernisse entgegen. In dieser Lage waren der Graf Wilhelm IV. von Henneberg und dessen Gemahlin Anastasia mit ihrer Tochter, Fräulein Margaretha, die sie frühzeitig in ein Kloster gegeben hatten. Nachdem ihre drei anderen Töchter bereits glücklich vermählt waren, hatte der Herzog von Preußen in einem Briefe an die Gräfin im Spaße die Bemerkung fallen lassen: wenn sie noch eine Tochter übrig habe und sie verheiraten wolle, so möge sie sich nur an ihn wenden, er werde schon dafür sorgen, daß sie einen König bekomme. Die Gräfin in der bedrängten Lage, in der sich schon damals das Hennebergische Fürstenhaus befand, und überreich mit Kindern gesegnet – denn sie hatte deren ihrem Gemahl nicht weniger als dreizehn gebracht – nahm die Sache ernster als es der Herzog erwartet haben mochte. Sie faßte ihn beim Wort, indem sie ihm schrieb: Sie habe keine erwachsene und mannbare Tochter mehr außer einer, Margarethe genannt, die sie in früher Jugend, da sie erst neun Jahre alt gewesen, in ein versperrtes Kloster getan habe, in der Absicht, daß sie ihr Leben lang darin bleiben solle; sie sei deshalb auch geweiht und eingesegnet worden. »Da sind aber,« fährt sie fort, »im vergangenen Aufruhr die Bauern in dasselbe Kloster wie in mehre andere Klöster eingefallen und haben es schier gar verwüstet, so daß die Nonnen, die darin gewesen, alle verstöbert worden sind. Ein Theil haben Männer genommen; die Obersten darunter, nämlich die Aebtissin und Priorin, sind seit dem Aufruhr gestorben; ein anderer Theil sind wieder ins Niederland unter Köln hinabgezogen, von wo sie zuvor aus Klöstern heraufgekommen waren; die übrigen sind noch hin und wieder bei ihren Freunden. Nun ist aber bei uns umher mit den Jungfrauen in den Klöstern ein solches wildes Wesen, daß ich meine Tochter nicht gerne wieder in ein Kloster thun möchte, denn ich besorge auch bei dem jetzigen Wesen, sie würde doch nicht darin bleiben können, und ich müßte sie dann wieder herausnehmen. Also will ich sie lieber bei mir behalten und zusehen, was der liebe Gott mit ihr schaffen will. Wo aber Euer Liebden vermeint, daß es meiner Tochter annehmlich, nützlich und gut sein sollte, so würden mein Herr und Gemahl und ich in dem Fall unser Vertrauen ganz in Euer Liebden setzen, wenn Euer Liebden sie wohl mit einem Manne versorgen wollten, wo anderes keine Scheu daran sein sollte, daß sie eine Nonne gewesen ist. Sonst ist sie eine feine, redliche, fromme, züchtige Metz, der ich, ob sie gleich nicht meine Tochter wäre, doch nichts anders nachsagen könnte.« Merkwürdig aber ist, wie die Gräfin den Herzog auf die Gefahren aufmerksam macht, die für diesen Fall zu befürchten seien. »Ich will«, fährt sie fort, »Euer Liebden als meinem lieben Vetter nicht verschweigen, daß der Kaiser und sein Bruder, der König von Ungarn und Böhmen, einen großen Verdruß und Ungnade auf einen werfen, der eine Nonne nimmt oder der einer Nonne zum ehelichen Stande hilft; sie sprechen, derselbe sei gut lutherisch und dem sind sie dann, wie ich höre, sehr feind. Sollte also meinem Herrn und Gemahl, mir und meinen Kindern oder der Herrschaft Henneberg Ungutes daraus entstehen, so wäre uns allen das sehr beschwerlich, denn der kaiserliche Fiscal kann jetzt sonst nichts mehr, als daß er sich über die kleinen Herren legt, die nicht große Macht haben, und dieselben plagt. Die großen aber, die Gewalt haben, läßt er wohl sitzen.« Da die Gräfin besorgt, es könne aus dieser Angelegenheit für die Herrschaft Henneberg doch vielleicht ein Nachteil entstehen, so macht sie, wie sie sagt, »aus ihrem thörigten Kopfe« dem Herzog den Vorschlag: er möge, damit doch möglicherweise eine Verheiratung zustande kommen könne, das Fräulein Margarethe an seinen Hof in sein Frauenzimmer nehmen; man könne dann ja sagen, der Herzog habe darum gebeten, und auf diese Weise könnten sie und ihr Gemahl, was auch fortan mit dem Fräulein geschehen möge, sich gegen den Kaiser und andere hinlänglich verantworten. Dabei aber liegt der Gräfin noch eine andere Sorge auf dem Herzen. Sie gesteht dem Herzog, daß sie und ihr Gemahl mit großen Schulden beladen seien, mehr als sie gerne sagen möge; es dürfe also auf die Verheiratung des Fräuleins nicht zuviel verwandt werden; denn sonst würden die von Schwarzburg und ihre anderen Töchter auch um so viel mehr fordern, wenigstens doch verlangen, man solle einer so viel geben als der anderen. »Wo es also«, fügt die Gräfin hinzu, »Euer Liebden dahin bringen könnten, daß wir nichts zum Heiratsgut geben dürften als allein einen ziemlichen Schmuck und die Zehrung, um sie zu Euer Liebden hineinzubringen, so wollten wir Euer Liebden und Gott sehr danken, daß wir unsere Tochter so hoch und ehrlich versorgt hätten.«
So sehr indes die Gräfin bemüht war, um ihre gewesene Nonne mit einem Manne zu versorgen, so gingen doch mehrere Jahre dahin, ohne daß sich eine Aussicht eröffnete. Erst nach fünf Jahren fragte Herzog Albrecht bei der Gräfin wieder nach, ob das Fräulein noch außer dem Kloster sei und was man ihr etwa als Abfertigung oder Aussteuer geben könne; er wolle sich jetzt Mühe geben, sie mit irgendeinem reichen polnischen Herrn zu versehen. Hierauf antwortete ihm der alte Graf Wilhelm selbst: »Unsere Tochter hat gar keine Lust, wieder in ein Kloster zu kommen, wiewohl es uns den jetzigen Zeitläuften nach ganz beschwerlich ist, sie so lange sitzen zu lassen; denn Euer Liebden können selbst abnehmen, daß solches kein Lager-Obst ist. Wo wir nun aber und unsere liebe Gemahlin, da wir beide mit einem guten Alter und schweren Leib überfallen und oft auch viel krank sind, mit Tod abgingen, so wäre sehr zu bedenken, wie es dem armen Mensch dann gehen möchte, da wir hieraußen niemand für sie haben bekommen können, wäre es auch nur ein schlechter Graf oder Herr gewesen, der sie hätte nehmen wollen, weil sie eine Nonne gewesen ist. Wir haben deren keinen unter dem Kurfürsten von Sachsen oder dem Landgrafen von Hessen finden können. Wiewohl uns viele gerathen haben, sie nicht wieder ins Kloster zu thun, so haben sie doch alle Scheu, sie zu nehmen, weil sie eine Nonne gewesen ist. Darum, wo Euer Liebden etwas zu Wege bringen könnten, womit sie versorgt werde, wollten wir Euer Liebden gerne folgen.« Der Graf schlägt hierauf dem Herzog vor, ob er nicht vielleicht in Böhmen oder Schlesien, etwa durch den Herzog Friedrich von Liegnitz, wenn unter diesem irgend Grafen oder Herren seßhaft wären, eine Verbindung anknüpfen könne. »Was ihre Mitgift und Ausfertigung anlangt,« fährt der Graf fort, »so wollen wir Euch freundlicher Meinung nicht verbergen, daß wir von der Gnade Gottes nun fünf Söhne haben, die alle im Harnisch reiten mit sechs, acht und auch zehn Pferden. Dieselbigen an den Fürstenhöfen zu erhalten, geht uns des Jahres nicht ein Geringes auf. Wir haben auch noch eine erwachsene und unvergebene Tochter Walpurg bei uns im Hause, desgleichen eine bei unserer Muhme, der Herzogin von Cleve und Berg, welche auch etwas haben wollen. Wir sind überdies durch etliche Unfälle und Kriegsläufte, womit wir einige Zeit betreten gewesen, in Unrath kommen, so daß wir etwas viel schuldig geworden sind. Wir zeigen Euer Liebden alles darum an, ob uns dieselbe behülflich sein könnte, daß wir die Tochter solchem nach auch versehen und ausfertigen könnten, und ob dann das Heiratsgut wohl auf dreitausend Gulden gebracht werden möchte, in Betracht des weiten Weges und der großen Kost und Zehrung, die wir darauf verwenden müßten, sie so weit hinwegzuschicken, was sich auch nicht unter tausend Gulden belaufen würde, zudem was uns noch der Schmuck und die Kleidung kosten möchte.« Mit Rücksicht auf diese Umstände bittet endlich der Graf den Herzog: er möge darauf denken, daß er so leicht wie möglich in der Sache davonkomme, wiewohl er seinerseits alles tun wolle, was in seinem Vermögen stehe.
Herzog Albrecht, dem es Vergnügen machte, sich in Heiratsangelegenheiten seinen Freunden gefällig zu zeigen, erwiderte dem Grafen: wenn er früher gewußt hätte, daß der Graf seine Tochter einem Freiherrn geben wolle, so würde er sie längst mit einem solchen in seinem eigenen Lande haben versorgen können; da es indes jetzt vielleicht möglich sei, sie in Schlesien bei dem Herzog Friedrich von Liegnitz unterzubringen, so wolle er sich zuvörderst an diesen wenden, um zu sehen, ob sich dort etwas gutes ausrichten lasse. »Wo es aber«, fügt er hinzu, »an dem Orte nicht gelingen würde, wollen wir keinen Fleiß sparen, Rat, Mittel und Wege zu erdenken, ob wir sie in Polen, Litauen oder, wo sich die Fälle mit der Zeit zutragen würden, in unserem Lande versorgen könnten.« Der Herzog bittet daher den Grafen: er möge sich einen kleinen Verzug nicht beschwerlich fallen und sich auf keine Weise bewegen lassen, seine Tochter wieder ins Kloster zu stecken; wofern es ihm aber beschwerlich sei, sie länger bei sich zu behalten oder man vielleicht in ihn dringen werde, sie wieder in ein Kloster zu verstoßen, so möge er sie ihm lieber nach Preußen zuschicken; er wolle sie als Freund bei sich behalten, bis sich eine Gelegenheit finde.
Wie wir hier den Herzog Albrecht von Preußen bereitwillig finden, dem gräflichen Fräulein Margarethe irgendwie einen Mann zu verschaffen, so war er es auch, der dem jungen Markgrafen von Brandenburg, dem nachmaligen Kurfürsten Joachim II., mit dem er so befreundet war, daß er sich mit ihm duzte, eine Braut zu empfehlen suchte. Er leitete die Heirat zwischen ihm und seiner nachmaligen Gemahlin Hedwig, einer Tochter des Königs Sigismund I. von Polen, dadurch ein, daß er ihm die Prinzessin auf folgende Weise schilderte: »Ich will dir nicht bergen, daß sie nicht alt, sondern hübsch und tugendsam, auch gutes Verstandes, Geberde und Wesens ist, ungefähr um ihr zwanzigstes Jahr. In Summa, daß ich Dich mit langen Reden nicht aufziehe, so kann ich Dir sie nicht genugsam rühmen, und sage das bei meiner höchsten Treue und wahrem Wesen: wo ich diese jetzige fromme Fürstin, meine liebe Gemahlin nicht hätte und mir Gott ein solch Mensch, wie diese tugendsame Fürstin ist, von der ich schreibe, verliehe, so wollte ich mich selig schreiben und halten.«
Wie für den Herzog von Preußen, so war es, wie wir aus brieflichen Mitteilungen ersehen, auch für andere Fürsten eine Art Lieblingsgeschäft, Heiratsverbindungen zwischen verwandten Fürstenhäusern zustande zu bringen. So hatte der Landgraf Philipp von Hessen kaum erfahren, daß der Herzog von Preußen eine schöne mannbare Tochter habe, als er ihm durch den herzoglichen Rat Asverus Brandt das Anerbieten machen ließ, eine Verbindung zwischen dem Fräulein und einem jungen Pfalzgrafen zustande zu bringen. Albrecht nahm es mit außerordentlicher Freude auf. »Wir können daraus«, schrieb er ihm, »nichts anderes verspüren, als Euer Liebden freundwilliges, treues Herz, und haben auch darob um so viel mehr Frohlockung geschöpft, als wir bedacht, mit welcher hohen Freundschaft, auch Erbeinigungsverwandtnis die löblichen kurfürstlichen und fürstlichen Häuser Brandenburg und Hessen schon viele Jahre her einander verwandt sind; und dieweil wir denn solche treue Freundschaft, die Euer Liebden gegen uns tragen, befinden, mögen wir hinwieder in gleicher Treue und Vertrauen unangezeigt nicht lassen, daß wir nicht allein nicht ungewogen, sondern sehr begierig sind, da uns leidliche und ziemliche Wege vorkämen, unsere geliebte einzige Tochter einem frommen Fürsten ins heilige Reich deutscher Nation zu verheirathen.« Der Herzog ersucht darauf den Landgrafen, ihm über den Namen, die Verhältnisse, die Gesinnungen und den Charakter des jungen Pfalzgrafen nähere Nachrichten mitzuteilen, damit er die Sache weiter erwägen und mit seinen Freunden und Verwandten in Beratung ziehen könne. Wieviel dem Herzog daran gelegen war, eine solche Verbindung ins Werk gestellt zu sehen, gab er dadurch zu erkennen, daß er dem Landgrafen alsbald meldete, wie er seine Tochter auszustatten gedenke. Er schreibt ihm: »Wir wollen Euer Liebden als dem Freunde vertraulicher Meinung nicht verbergen, welcher Gestalt, wir unsere Tochter, wenn sie durch gnädige Schickung Gottes verheirathet wird, auf ziemliche und leidliche vorgehende Beredung nach altem Herkommen des Hauses Brandenburg auszustatten gesinnt sind. Wir sind nämlich bedacht, Ihrer Liebden zur Mitgift 20,000 Gulden neben ehrlicher fürstlicher Aussteuerung an Kleinodien, Kleidern, Geschmeiden und was dem anhängig, so daß verhoffentlich fürstlich vollfahren möge, nach unserem Vermögen zu geben und sie sonst nach Gelegenheit der Herren und Beredungen, die hierin aufzurichten, dermaaßen fürstlich zu versehen, damit, wo Ihre Liebden nach Schickung des Allerhöchsten den Fall des Todes an uns und der hochgeborenen Fürstin, unserer freundlichen herzgeliebten Gemahlin, erlebte, derselben an dem, was die Natur, Recht und Gerechtigkeit an Erbschaft und sonst giebt, nichts entzogen werden solle.« Der Wunsch des Herzogs wurde indes nicht sogleich erfüllt: seine Tochter Anna Sophia erhielt erst mehrere Jahre später den Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg zum Gemahl.
Hatte sich eine Aussicht zu einer Verbindung des fürstlichen Fräuleins eröffnet, so versäumten die Eltern nicht, zuvor die nahen Verwandten darüber zu Rate zu ziehen, und man fand es nötig, sich zu entschuldigen, wenn dies aus irgendeinem Grunde nicht hatte geschehen können. Als sich der Landgraf Georg von Leuchtenberg im Jahre 1549 mit seinem Sohne Ludwig Heinrich in den Niederlanden einige Zeit am Kaiserhofe aufhielt, gelang es dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg, eine Verbindung zwischen dem jungen Prinzen und der jungen Gräfin Mathilde von der Mark zustande zu bringen. Sie mußte aber aus mancherlei Gründen mit solcher Eile betrieben werden, daß es nicht möglich war, die nahen Verwandten erst darüber um Rat zu fragen. Die Landgräfin Barbara von Leuchtenberg, eine Schwester des Herzogs Albrecht von Preußen, bittet daher in dem Schreiben, worin sie diesem mit großer Freude das glückliche Verlöbnis ihres Sohns mit »der wohlgeborenen Jungfrau Mathilde, geborenen Gräfin zur Mark«, meldet, aufs dringendste um Entschuldigung, daß der Markgraf und ihr Gemahl in der Sache, in der sie unter anderen Umständen gewiß nichts ohne der anderen Herren Brüder und Vetter Wissen, Rat und Willen verhandelt und beschlossen haben würden, es diesmal hätten unterlassen müssen, um nicht in Gefahr zu kommen, die treffliche Partie aus der Hand gehen zu lassen; denn abgesehen von »der Jungfrau Frömmigkeit und ehrlichem Verhalten und daß sie fürstmäßigen Stammes sei, auch ein tapferes fürstliches Heiratsgut erhalten werde, ständen auch deren nächste Gesippte und Verwandte beim Kaiser in großem Einfluß und Ansehen, daß man von diesen sich manche Hülfe versprechen könne«.
Hatte ein junger Fürst noch nicht die persönliche Bekanntschaft einer Prinzessin, die man ihm zugedacht, gemacht, so sandte man ihm entweder ihr Porträt, eine Konterfeiung, wie man es damals nannte, oder man suchte eine persönliche Zusammenkunft beider an einem dritten Fürstenhofe zu veranstalten, um so »eine Besichtigung der Personen« möglich zu machen. So ließ es sich der Herzog Albrecht von Preußen im Jahre 1561 viele Mühe kosten, eine Verbindung zwischen dem Könige Erich XIV. von Schweden und einer Prinzessin von Mecklenburg einzuleiten. Er hatte dem Könige das Fräulein als so ausgezeichnet schön geschildert, daß dieser ihm erwiderte: er müsse nach solcher Schilderung wohl glauben, »daß die Person ihrem fürstlichen Stamme nach sehr schön und mit hochadeligen Tugenden geziert und begabt sei«. Er schlug mehrere Wege vor, wie es der Herzog möglich machen könne, daß eine gegenseitige Besichtigung zwischen ihnen stattfinde; »denn«, fügte er hinzu, »im Fall nach vorgehender Besichtigung wir an der Person, wie wir hoffen, einen Gefallen tragen würden, so wüßten wir nichts, was uns sonst an Vollführung solcher Heiratssache, sofern dadurch eine beständige, zuverlässige und vertraute Freundschaft zwischen uns und dem Hause zu Mecklenburg gepflanzt und aufgerichtet werden möchte, besondere Hindernisse entgegenstellen könnte, da wir in diesen christlichen Sachen nach keinem großen Brautschatz oder nach Reichthum, womit wir ohnedies von Gott reichlich begabt sind, sondern allein nach hochadeligem fürstlichen Stamm, Geblüt, Tugend und Schönheit der Person trachten«. Die Verbindung kam jedoch zum Glück des Fräuleins von Mecklenburg nicht zustande. Der König heiratete bekanntlich nachmals die Tochter eines Korporals, ward bald darauf vom Throne gestoßen und starb später im Gefängnis.
So gleichgültig gegen Brautschatz und Mitgift war man sonst in der Regel nicht; vielmehr wurden sie gewöhnlich als eine Sache von großer Wichtigkeit betrachtet und darüber oft lange diplomatische Verhandlungen gepflogen. Hatten zwei junge fürstliche Personen soviel Neigung zueinander gewonnen, daß sie sich zu einer gegenseitigen Verbindung entschlossen, so ernannten die Väter einen ihrer vertrautesten Räte zu Unterhändlern, die an einem dritten Orte zusammenkamen, um über die Ausstattung, den Brautschatz und die Mitgift des fürstlichen Fräuleins zu unterhandeln. Man nannte dies eine »Ehebeteidigung«; es dauerte oft mehrere Wochen, ehe man über alles aufs Reine kam; denn man ging dabei mit großer Sorgsamkeit zu Werke. Hatte man sich endlich verständigt, so wurde mit aller diplomatischen Förmlichkeit ein Ehekontrakt im Namen der fürstlichen Väter von den Gesandten abgeschlossen, der über die Ausstattung und Mitgift alles Nötige feststellte. Was dabei hauptsächlich zur Sprache kam, werden einige Beispiele erläutern.
Nachdem Herzog Albrecht von Preußen sich der Zustimmung des Königs Friedrichs I. von Dänemark wegen der Verbindung mit dessen Tochter, der Prinzessin Dorothea versichert, kamen die bevollmächtigten Räte beider Fürsten in Flensburg zusammen, und es wurden nach vielfachen Unterhandlungen folgende Bestimmungen als Ehekontrakt festgestellt: Im Namen des Königs ward versprochen: er werde der Prinzessin als Heiratsgeld 20 000 Gulden mitgeben, welches in zwei Hälften in den Jahren 1527 und 1528 zu Kiel in guter Silbermünze ausgezahlt werden solle; außerdem wolle er sie mit königlicher und fürstlicher Kleidung, Kleinodien und silbernem Geschirre, »wie es bei Königen, Fürsten und Herren gebräuchlich und Gewohnheit sei«, ausstatten und bis an das Fürstentum Preußen mit tausend Mann zum ehelichen Beilager einbringen und geleiten lassen. Der Herzog dagegen verpflichtete sich, seiner künftigen Gemahlin, »dem Fräulein von Dänemark«, eins der beiden Schlösser, Tapiau oder Labiau, welches später die dazu verordneten Räte des Königs wählen würden, zu »verleibgedingen« und die Fürstin in das gewählte Schloß mit allen seinen Zubehörungen, Städten, Märkten, Dörfern, Lehen, desgleichen auch auf den Adel und die Ritterschaft, die etwa in dem Amte gesessen seien, mit allen herrlichen Rechten, Freiheiten und Diensten in gewöhnlicher Weise einzuweisen. Werde die Fürstin des Herzogs Tod überleben, so solle sie auf dem gewählten Schlosse »wie eine Leibgedingsfrau« ihren Wohnsitz haben. Es werden ihr ferner auf 40 000 Gulden gewisse Renten in den Geldzinsen, Zöllen und sonstigen Nutzungen im Amtsbereiche des Schlosses verordnet und vermacht, wobei ausdrücklich noch bestimmt wird, daß das, was in den Einkünften und im Rentenertrage des Schlosses an der Rentensumme etwa fehlen werde, von den anderen naheliegenden Ämtern gedeckt werden solle. Alles, was von altersher an Scharwerk, hohen und niederen Gerichten, Fischerei und Holzung zum Schlosse gehört, solle dabei bleiben und ausschließlich zur Haushaltung der Fürstin verwandt werden. Was der Herzog an Morgengabe oder Erhöhung des Leibgedinges seiner Gemahlin noch zuwenden wolle, solle seiner Güte und Liebe anheimgestellt sein. Ferner verpflichtete er sich in einem besonderen Verzichtbriefe für sich, seine Gemahlin und ihre Erben allen weiteren Ansprüchen und Forderungen an die Reiche Dänemark und Norwegen, sowie an die Fürstentümer Schleswig und Holstein zu entsagen, nichts an väterlicher oder mütterlicher Erbschaft weiter zu verlangen und »mit solcher Ausstattung gesättigt zu sein«. Nur wenn der König ohne männliche Leibeslehenerben sterbe, solle es dem Herzog vorbehalten bleiben, für seine Gemahlin »als eine Tochter von Dänemark und Holstein zu fordern, was ihr von Rechtswegen gebühre«. Dieser Verzichtbrief solle dem Könige noch vor dem ehelichen Beilager eingehändigt werden. Endlich ward noch festgesetzt, daß, im Fall der Herzog von seiner künftigen Gemahlin keine Erben erhalten werde und diese vor ihm sterbe, alles, was das königliche Fräulein als Heiratsgut, Brautschatz und Kleinodien nach Preußen bringen werde, dem Könige oder dessen Erben wieder anheimfallen solle.
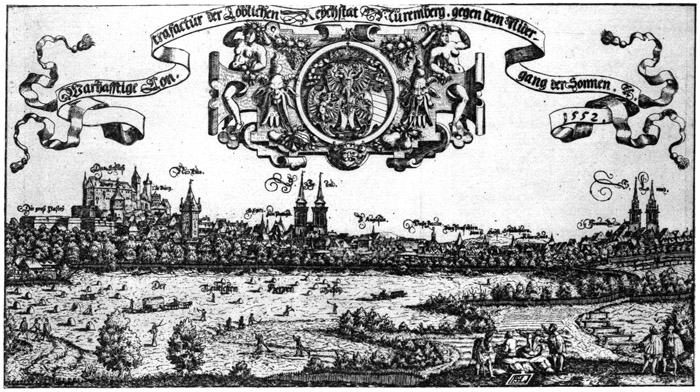
Lautensack, Nürnberg 1552. Kupferstich Teilaufnahme
Stellen wir diesem Ehekontrakt aus dem zweiten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts einen anderen aus einer späteren Zeit zur Seite, so finden wir in diesem die Bestimmungen etwas verändert. Bei der Eheverbindung des Pfalzgrafen Johann des Älteren von Zweibrücken mit dem Fräulein Magdalene, der Tochter des Herzogs Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg, im Jahre 1579, mußte der Pfalzgraf zuerst das Versprechen geben, daß er an einem bestimmten Tage mit dem Fräulein Magdalene das eheliche Beilager halten wolle. Dagegen sicherte ihm der Herzog nach solchem Beilager einen Brautschatz von 25 000 Goldgulden zu und versprach, solchen »zum rechten Heiratsgut gegen gebührliche Quittung« in Jahresfrist auszahlen zu lassen, auch seine Tochter »mit Kleinodien, Kleidern, Schmuck, Silbergeschirre, wie es einer Fürstin von Jülich wohl gezieme, ungefähr gleich den anderen Schwestern ehrlich abzufertigen«. Der Pfalzgraf verhieß, nach erfolgtem Beilager das Fräulein mit einer fürstlichen Morgengabe von 4000 Gulden zu versehen, »womit die Fürstin solle handeln, tun und lassen können nach ihrem besten Wohlgefallen und wie es Morgengabsrecht und Gewohnheit ist«. Da herkömmlicherweise die Verzinsung der Morgengabe mit 200 Gulden erst dann erfolgte, wenn die Fürstin ihren künftigen Gemahl überlebte, so versprach der Pfalzgraf, ihr, gleich nach dem Beilager, jährlich 400 Taler in vierteljährigen Zahlungen als »tägliches Handgeld« anweisen zu lassen. Sobald das Heiratsgut von 25 000 Gulden entrichtet sei, sollte der Pfalzgraf ohne Verzug das Fräulein auf sein Schloß und Amt Landsberg und einige andere genannte Besitzungen mit voller obrigkeitlicher Herrlichkeit »zu Widerlegung und Gegengeld des erwähnten Heiratsgutes« anweisen und sie ihm verschreiben lassen. An jährlichen Zinsen und Nutzungen sicherte er seiner künftigen Gemahlin eine jährliche Rente von 3800 Gulden, teils an barem Gelde zu 1525 Gulden, teils an Wein und verschiedenen Getreidelieferungen zu, mit dem Versprechen, daß, wenn das Schloß und Amt Landsberg und die übrigen Besitzungen den genannten Rentenbetrag nicht vollkommen abwerfen würden, der Abgang laut Wittumsverschreibung vom Pfalzgrafen aus dessen Rentkammer oder anderen Ämtern zugesteuert werden solle. Der Fürstin sollten in dem ihr zum Leibgeding zugeschriebenen Amte und Schloß »alle Obrigkeit, Gericht und Herrlichkeit, Fischerei, Jagd, Bau- und Brennholz und sonst alle Küchengefälle« zugehören, nur mit Ausnahme der hohen landesfürstlichen Obrigkeit, der Bergwerke, Ritterlehen, Reisegefolge, Steuer, Zoll und Ungeld, die der Pfalzgraf sich vorbehielt. Nach Erlegung des Heiratsgutes sollten alle Einsassen des erwähnten Amts und der übrigen Besitzungen der Fürstin eidlich geloben, nach ihres Gemahls Tod niemand anderem als nur ihr Gehorsam zu leisten. Sobald die Fürstin Witwe werde, sollten des Pfalzgrafen Erben ihr das Schloß Landsberg ohne weiteres übergeben und es mit Hausrat, Betten und Leinwand so zureichend versehen, daß sie ihrem fürstlichen Stande gemäß daran keinen Mangel leide. Fehle ihr selbst das nötige Silbergeschirr, so sollten des Pfalzgrafen Erben sie damit versorgen; nach der Fürstin Tod aber oder etwaiger zweiter Verheiratung solle es an das Fürstenhaus Zweibrücken wiederum zurückfallen. An diesem ihrem Wittum und Vermächtnisse solle die Fürstin sich genügen lassen und an das Land weiter keine Forderung machen. Der Pfalzgraf aber verzichtete gegen Empfang des erwähnten Heiratsgutes auf alle väterliche und mütterliche Erbgüter oder sonstigen elterlichen Nachlaß im Fürstentum Jülich, sowie auf alle weiteren Ansprüche und Forderungen. Endlich ward noch festgesetzt, daß, wenn die Fürstin nach des Pfalzgrafen Tod sich von neuem vermählen werde, dessen Erben verbunden sein sollten, sie in Jahresfrist aus ihrem Wittum mit der Summe des Heiratsgutes, 25 000 Gulden, auskaufen und ihr dann auch ihren Kleiderschmuck, ihre Kleinodien, ihr mitgebrachtes Silbergeschirr und ihren Hausrat ungehindert folgen zu lassen; sterbe sie aber vor dem Pfalzgrafen oder späterhin als Witwe, so solle jedenfalls, sie möge Kinder hinterlassen oder nicht, ihr Heiratsgut nebst aller ihrer »Fahrniß« an das Fürstentum Zweibrücken zurückfallen.
Aus diesen Ehekontrakten sehen wir also: es wurde bei der Vermählung einer Fürstin ein gewisses Heiratsgut als bleibendes Kapital an ihren künftigen Gemahl gezahlt, der ihr dagegen eine ländliche Besitzung verschrieb, aus der sie einen Ertrag an Geld und Naturalien für ihre Bedürfnisse und ihren eigenen fürstlichen Hofstaat bezog und auf der sie als Witwe ihren Witwensitz nehmen konnte. In dieser Besitzung stand sie unter gewissen Beschränkungen als selbständige Fürstin da. Die Einzahlung des Heiratsgutes trug zugleich den Charakter eines Zins- oder Rentekaufes, durch welchen die Fürstin Ansprüche auf bestimmte Einkünfte zu ihrem eigenen Unterhalt gewann. Die Morgengabe dagegen setzte der Fürst für seine künftige Gemahlin selbst fest. Sie bestand gleichfalls in einem für die Fürstin bestimmten Kapital, dessen Verzinsung aber erst nach des Fürsten Tod anhob, so daß also erst die fürstliche Witwe den Zinsertrag der Morgengabe zu genießen hatte. So lange der Fürst lebte, ward ihr ein gewisses Handgeld für ihre gewöhnlichen täglichen Ausgaben angewiesen.
Waren Brüder oder Verwandte vorhanden, die im Fall des Todes eines Fürsten erbliche Ansprüche auf ein zum Leibgeding verschriebenes Besitztum erheben konnten, so war erforderlich, daß solche zur Leibgedingsverschreibung noch vor der Vermählung ihre besondere Einwilligung erteilten, um die Fürstin nach ihres Gemahls Tod gegen Eingriffe in ihr Besitztum sicherzustellen. Wir finden Beispiele, daß man zur Sicherheit Leibgedingsverschreibungen vom Kaiser förmlich bestätigen ließ.
Erst wenn auf diese Weise der Ehekontrakt fest und förmlich abgeschlossen, von beiden Seiten genehmigt und die junge Fürstin in ihrem künftigen ehelichen Verhältnisse sichergestellt war, erfolgte das eigentliche feierliche Verlöbnis. Wir finden es bei der ehelichen Verbindung des Herzogs Albrecht Friedrich von Preußen mit Fräulein Maria Eleonore, ältester Tochter des Herzogs Wilhelm von Jülich, Cleve und Berg im Jahre 1572 auf folgende Weise vollführt. Der junge Fürst sandte seinen Hofmeister und einige seiner vornehmsten Räte mit diplomatischer Vollmacht und dem genehmigten Ehekontrakt an den Hof des Vaters der Prinzessin ab, wo sie, angelangt und feierlich empfangen, sofort beim Fürsten um Audienz baten. Sobald sie ihnen gewährt war, erschienen sie am Hofe, wo sie die nächsten Familienglieder und die Prinzessin im festlichen Schmuck versammelt fanden. Der Hofmeister setzte zuerst in einer Anrede an den Herzog den Zweck ihres Erscheinens, den Verlauf der Bewerbung um seine Tochter und den Abschluß der bisher geführten Verhandlungen laut seiner Instruktion auseinander. »Nachdem nun alles«, fügte er dann hinzu, »bis zum ehelichen Beilager verglichen und vollzogen ist, bleibt jetzt nur noch übrig, daß, nach allem fürstlichen, christlichen Brauch, in gegenwärtiger Versammlung das Jawort gegeben werde, indem das Fräulein sich gegen sie, die Gesandten, verbinde, die künftige Ehegemahlin des Fürsten zu sein, der um ihre Hand werbe«. Am Schlusse der Rede sprach er dann die Bitte aus: »der fürstliche Vater möge jetzt seine geliebte Tochter dahin berichten, daß sie ihr Jawort gebe und sich dergestalt auf gepflogene Tractation ehelich verbinde«. Darauf ließ der Fürst durch seinen Kanzler Antwort geben und in seinem Namen erklären, daß auch er den Abschluß der bisherigen Verhandlungen genehmige und es sein Wille sei, »daß jetzt der Abrede allenthalben nachgegangen werde und die Versprechung und das Handgelübde dermaßen von seiner Tochter im Namen der heiligen Dreifaltigkeit geschehen möge«. Nach solcher Erklärung des Herzogs wandte sich der Gesandte an die junge Fürstin mit der Frage, »ob ihre fürstliche Gnade, nachdem sie ihres Herrn Vaters gnädigen Willen vernommen und die Erlaubnis empfangen, den Fürsten, der um ihre Hand geworben, zu ihrem künftigen Ehegemahl zu haben begehre?« Die Fürstin zögerte mit der Antwort, bis der Vater sie dem Gesandten entgegenführte, worauf sie diesem die Hand reichte und die Erklärung gab: »weil es meinem gnädigen Herrn Vater also gefällt, bin ich es wohl zufrieden«. Der Gesandte versprach ihr dann im Namen seines Herrn, daß dieser sie als seine künftige Ehegemahlin halten und anerkennen und sich ihr zu aller gebührlichen Treue und Liebe aufs freundlichste erbieten und verbinden wolle.
War das Verlöbnis vollzogen, so erfolgte die Brautbeschenkung. Der Gesandte überreichte der fürstlichen Braut im Auftrage seines Herrn bald ein prachtvolles Brautkleid, bald auch kostbares Pelzwerk, künstlich gearbeitete goldene Geschmeide oder andere wertvolle Kleinodien. Auch die Eltern der Braut wurden mit Geschenken, Brüder und Schwestern gewöhnlich mit goldenen Ketten, kostbaren Ringen oder sonstigen Kleinodien erfreut. In der Regel bot auch der Gesandte seinerseits der fürstlichen Braut ein Geschenk entgegen. Wir finden, daß ein Gesandter der Braut ein schön gemaltes Lädchen von kostbarem Holze mit Elendsklauen und Bernsteinöl zum Geschenk überreichte. Das bedeutungsvollste Geschenk aber, welches damals gewöhnlich schon bei der Verlobung gewechselt wurde, war der Braut- und Bräutigamsring als symbolische Zusicherung gegenseitiger Treue. So schreibt eine fürstliche Braut an ihren fürstlichen Bräutigam im Jahre 1549: »Ich habe von Euer Liebden den spitzen Diamant-Ring zum Vermählungs-Ring empfangen, wodurch Euer Gnaden mir ihre stete Treue verheißet; dagegen schicke ich wiederum Euer Gnaden einen Saphir-Ring zu gleicher steter Treue und verspreche meine Zusage zu halten und nimmermehr zu brechen.«
Während der Brautzeit wurden zwischen Braut und Bräutigam fort und fort Geschenke gewechselt. Bald erhält diese eine schöne goldene Kette, an welcher des Bräutigams Namenszug in Edelsteinen gefaßt hängt und »die sie täglich auf der bloßen Haut tragen soll«, bald erfreut sie der Bräutigam mit einem prachtvollen Pelze; selbst »ein Spaniolisches Hündlein« wird von der Braut mit Freude aufgenommen, »damit sie sich bis zum baldigen Beilager hübsch fein und züchtig die Zeit vertreibe«. Sie erfreut dagegen den Bräutigam bald mit einem Perlenkranz oder mit einer Stickerei von ihrer eigenen Hand, bald selbst auch mit einem feinen Bräutigamshemd. Herzog Albrecht von Preußen überraschte einmal seine Braut, die Prinzessin Dorothea von Dänemark, »seine herzallerliebste Fürstin, Muhme und Buhle«, wie er sie nennt, mit etlichen »Pumberanzen« (Pomeranzen), um sich daran zu erfrischen; sie läßt dagegen ihrem Bräutigam durch den Bischof von Pomesanien als Geschenk einen Dornenkranz entgegenbringen, worüber der Herzog, seltsam genug, so erfreut ist, daß er seiner Braut schreibt: »Wiewohl der Kranz, den Euer Liebden mir sendet, von Dornen ist, so ist er mir doch lieber und soll mir auch lieber sein als alle Rosen- und Veilchenkränze und wenn sie auch mit den besten Cypressen vermengt wären.« Die Prinzessin aber erwiderte ihm: »er möge den Dornenkranz doch nicht so gar hoch anschlagen, denn es sei ja nur ein ganz nichtswürdiges Ding.«
Während Braut und Bräutigam sich auf solche Weise beschenkten und durch ihre Geschenke mitunter auch gegenseitig neckten, besorgten die fürstlichen Eltern die Ausstattung der Braut. Das Kostbarste waren in der Regel die Kleinodien, weshalb sie im Ehekontrakt jederzeit ausdrücklich als ein Teil der Aussteuer mit ausbedungen wurden. Als Beispiel diene, was das Fräulein Anna von Preußen bei der Vermählung mit Johann Sigismund, Sohn des Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg, im Jahre 1594 an Kleinodien zur Ausstattung erhielt. Ein goldenes Halsband mit achtzehn Rosen von Edelsteinen, darunter fünf Rubinrosen, vier Diamantrosen, und neun glänzende Perlenstücke, vom Meister Gabriel Lange in Nürnberg verfertigt, kostete 3750 Mark; ein anderes wurde mit 3115 Mark und ein drittes mit 32 Diamanten, Perlen und goldenen Rosen mit 1487 Mark bezahlt. Ein viertes Halsband, 3000 Mark an Wert, schenkte der Braut die fürstliche Mutter aus ihrem eigenen Kleinodienschatze. Dazu kamen ferner eine goldene Kette für 265 Mark, 36 goldene Ringe, darunter 24 mit Diamanten für 432 Mark, 60 Ringe mit Rubinen an Wert 360 Mark, 48 Kreuzringe, die man dem Augsburger Goldarbeiter mit 396 Mark bezahlte. Für Perlen zum Schmuck wurden 1745 Mark verwendet, so daß mit noch einigen anderen Kleinodien dieser Teil der Ausstattung des fürstlichen Fräuleins nicht weniger als 14 633 Mark betrug, nach damaligem Geldwerte schon eine sehr bedeutende Summe.
Die Ausstattung der Braut mit dem nötigen Silbergeräte kostete in der Regel den fürstlichen Eltern selbst keine so große Summe; denn man rechnete hierbei auf die Hochzeitsgeschenke. Sobald nämlich der Hochzeitstag bestimmt war, ward eine große Zahl von verwandten oder befreundeten Fürsten und Fürstinnen zur Hochzeitsfeier eingeladen. War die Braut mutterlos, so erging an eine befreundete Fürstin zugleich auch die Bitte, die Stelle und Geschäfte »der Brautmutter des Brautfräuleins« zu übernehmen. Wer dann von den geladenen fürstlichen Gästen das Hochzeitsfest durch seine Gegenwart verherrlichte, brachte der Braut irgendein wertvolles Geschenk, worauf der Name des Schenkers stand, einen silbernen Becher, eine silberne Schale, einen in Silber gefaßten Löffel von Meermuschel, venezianische Gläser mit Schalen, silberne Messer und Gabeln oder irgendein kostbares Kleinod zu Schmuck und Putz entgegen. Es geschah dies in der Regel am Morgen nach der Trauung. Man nannte es daher die Morgengabe. Hatten zur Darreichung dieser Weihgeschenke die Hochzeitsgäste sich im großen Versammlungssaale des fürstlichen Schlosses eingefunden und die Braut im festlichen Schmucke auf einem erhöhten Sitze sich niedergelassen, so nahte sich ihr zuerst der fürstliche Bräutigam selbst mit einem kostbaren Brautgeschenk; ihm folgten dann ihrem Range nach mit ihren Ehrengeschenken die Fürsten, Grafen und Botschafter, hierauf auch die Fürstinnen und Gräfinnen; selbst die Landesstädte sandten Abgeordnete, um der Braut Ehrengaben zu bringen. Waren Fürsten verhindert, dem Hochzeitsfeste beizuwohnen, so sandten sie einen ihrer vornehmeren Räte als Stellvertreter, die am Feste selbst, den Rang ihrer Fürsten einnehmend, der Braut ein Brautgeschenk im Namen ihrer Herren überreichen mußten.
Nach dem Hochzeitsfeste trat die fürstliche Frau am Hofe ihres Gemahls als Gebieterin der ihr zugeordneten Hofdienerschaft auf. Die Hofhaltung der Fürsten und Fürstinnen pflegte ziemlich bedeutend und zahlreich zu sein. Gewöhnlich entwarf der Fürst für seine junge Gemahlin eine Hofordnung oder, wie man es auch nannte, »eine Ordnung des Frauenzimmers«. Wir haben vier solcher Hofordnungen von Höfen des südlichen und nördlichen Deutschlands aus den Jahren 1526, 1535, 1547 und 1560 vor uns liegen. Da sie im wesentlichen miteinander übereinstimmen, so scheint man folgern zu dürfen, daß in der feststehenden Hofordnung ein gewisser Typus herrschte, der nur hier und da in unbedeutenden Veränderungen abwich:
An der Spitze des gesamten Hofpersonales der Fürstin stand der Hofmeister, dem als Ordner des Hofdienstes alle, die in der Fürstin Dienst standen, zum pünklichsten Gehorsam verpflichtet waren. Die Hofordnung gebot: »der Hofmeister solle alle diejenigen, welche der Fürstin zugeordnet seien, wer sie auch sein möchten, unter seinem Befehl streng in Gehorsam halten und sie zu regieren und zu bestrafen Vollmacht haben; er solle stets mit Fleiß darauf sehen, daß die Fürstin ehrlich, züchtig, getreulich, mit guter Ordnung und höchstem Fleiße wohl bedient und abgewartet werde.«
Der Hofmeister war der erste und vornehmste Leibdiener. Hielt die Fürstin eine Ausfahrt zur Kirche, irgendwohin zur Tafel oder einen Spazierritt zum Vergnügen oder ging sie auf Reisen, so mußte er sie begleiten, ihr dann in und aus dem Wagen oder auf und von dem Zelter helfen und überhaupt in allen Dingen der Fürstin zu Dienst stehen. Am Hofe selbst mußte er beständig in der Nähe der Fürstin sein; alles, was an sie gelangen sollte, nahm er zunächst in Empfang und erteilte im Auftrage der Fürstin Antworten und Bescheide. Die Hofordnung schrieb ihm daher ausdrücklich vor, daß er ohne vorherige Anzeige bei der Fürstin sich nie auf längere Zeit aus ihrer Nähe entfernen dürfe.
War der Fürst vom Hofe abwesend, so gingen manche Hofdienste seines Hofmeisters auf den der Fürstin über. Vornehmlich hatte er dann die Oberaufsicht über Küche und Tafel; in jener mußte er darauf sehen, »daß mit dem Essen sauber und reinlich nach fürstlicher Ordnung umgegangen werde«; an dieser hatte er darauf zu achten, daß die Speisen und Getränke fleißig und ordentlich kredenzt würden, auch »daß die Zugeordneten von Adel und andere ihren Dienst bei der Tafel fleißig und züchtig abwarteten«. Er war dafür verantwortlich, daß die Tafelordnung auf keine Weise verletzt oder gestört werde. Er hatte also darauf zu merken, daß im fürstlichen Speisesaal keiner von den Räten, Adeligen und Junkern sich an die Tische der Jungfrauen setze oder stelle oder über Tisch mit den Jungfrauen Gespräche halte. Nur die Zwerge der Fürstin und die zur Aufwartung bestimmten Diener durften sich am Jungfrauentische finden lassen. Jeder, der gegen die Tafelordnung handelte oder im Gespräch Sitte und Anstand verletzte, setzte sich einer Zurechtweisung des Hofmeisters aus und ward, wenn er sich nicht abwehren ließ, dem Fürsten zur Bestrafung angezeigt.
Der Hofmeister hatte ferner mit der Hofmeisterin die Oberaufsicht über die Ordnung im »Frauenzimmer«. Mit diesem Namen bezeichnete man das fürstliche Wohn- und Versammlungszimmer der den weiblichen Hofstaat der Fürstin bildenden Hoffräulein. Dies waren Töchter adeliger Familien des Landes, die man an den Hof brachte, um sie teils in feiner Sitte, Anstand und Lebensart ausbilden, teils auch in künstlichen Handarbeiten unterrichten zu lassen. Diesen Zweck finden wir ausdrücklich in mehreren Briefen ausgesprochen, in denen um die Aufnahme adeliger Fräulein ins fürstliche Frauenzimmer gebeten wird. Um unter diesen Hoffräulein gute Sitte aufrecht zu erhalten, waren in der Hofordnung gewisse Bestimmungen vorgeschrieben, auf deren Befolgung der fürstliche Hofmeister zu sehen hatte. Bevor um zwölf Uhr mittags das Morgenmahl gehalten wurde, durfte außer den mit besonderen Diensten beauftragten männlichen Personen niemand das Frauenzimmer besuchen. Erst mit der zwölften Stunde konnten Adelige, jedoch auch nur, wenn die Fürstin einheimisch war, ins Frauenzimmer gehen und dort bis zwei Uhr des Nachmittags verweilen, desgleichen des Abends von sechs bis acht Uhr. Sobald um zwei oder acht Uhr der Kämmerer dreimal mit dem Hammer an die Türe schlug, mußte jeder ohne Verzug das Frauenzimmer verlassen. Es hing von des Fürsten oder der Fürstin Befehlen ab, die Besuchszeit im Frauenzimmer zu verlängern oder zu verkürzen, auch wenn Anlaß gegeben war, diesem oder jenem den Besuch zu verbieten oder allen Besuch des Frauenzimmers ganz zu untersagen. In der Besuchszeit hielten gewisse Bestimmungen Zucht und Sitte aufrecht; es war den »Jungfern« alles Hin- und Wiederlaufen im Zimmer streng verboten; es stand eine gewisse Ordnung fest, nach der sie züchtig und ehrsam auf einer Bank sitzen mußten. Es war ihnen nicht erlaubt, stehend vor den adeligen Herren Gespräche zu halten; es hieß vielmehr in der Hofordnung: »die vom Adel sollen im Frauenzimmer stets züchtig sich neben den Jungfern niedersetzen und alle unzüchtigen Gebärden und Worte vermeiden, wie denn solches die adelige Zucht und der Gebrauch ehrlicher fürstlicher Frauenzimmer erfordert«.
Es war Pflicht des Hofmeisters und der Hofmeisterin, die vorgeschriebene Ordnung im Frauenzimmer aufrecht zu erhalten. Wer sich nicht anständig und ehrbar benahm oder die Ordnung störte, konnte vom Hofmeister daraus verwiesen und der fernere Besuch ihm verweigert werden. Der Hofmeister war daher verpflichtet, während der Besuchsstunden im Frauenzimmer anwesend zu sein oder sich durch den Kämmerer oder »eine andere angesehene Person, vor der man Scheu haben mußte«, in der Aufsicht vertreten zu lassen. Weil er für alle Unordnungen im Frauenzimmer verantwortlich war, so durfte ohne sein oder der Hofmeisterin Wissen weder eine Manns- noch Frauensperson, am wenigsten wenn sie unbekannt war, in dieses zugelassen werden; er durfte auch keine Verbindung mit dem Frauenzimmer erlauben, die dem guten Rufe nachteilig werden konnte. Was er anzuordnen für zweckmäßig fand, hing ganz von seiner Bestimmung ab. Damit die Zugänge zum Frauenzimmer zu gehöriger Zeit verschlossen werden konnten, schrieb ihm die Hofordnung vor, dafür zu sorgen, daß sowohl der Fürstin als den Jungfrauen im Frauenzimmer der sogenannte Schlaftrunk abends vor acht Uhr gebracht werde, denn bald nach dieser Zeit mußten die äußeren Zugänge zum Frauenzimmer verschlossen sein und durften ohne besonderen Befehl des Hofmeisters oder der Hofmeisterin nicht geöffnet werden.
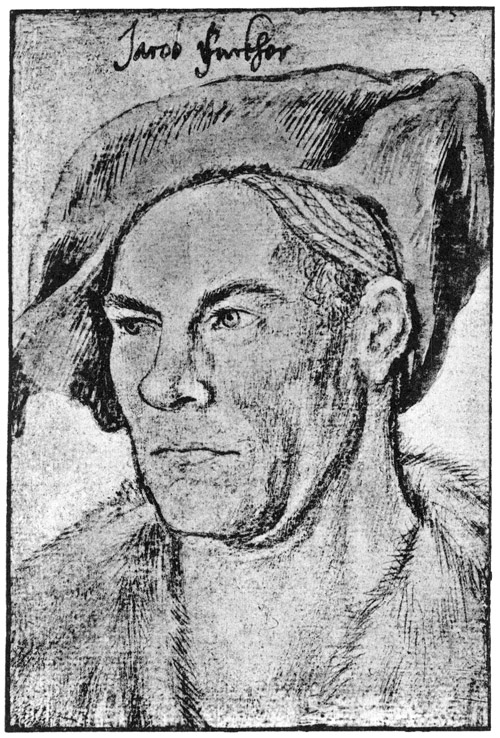
Hans Holbein d. Ält., Jakob Fugger. Silberstiftzeichnung. Berlin, Kupferstichkabinett
Die zweite wichtigste Person unter der Hofdienerschaft einer Fürstin war die Hofmeisterin, als nächste Vorsteherin und Vorgesetzte des Frauenzimmers in der Regel adeligen Standes. Man wählte dazu gern Witwen oder bejahrtere Personen. Über ihre Anstellung am Hofe bestimmte gewöhnlich die Fürstin selbst. Die Wichtigkeit ihrer Pflichten und ihrer Verhältnisse in der täglichen Umgebung der Fürstin brachte es mit sich, daß man bei der Besetzung dieses Hofdienstamtes stets mit großer Vorsicht zu Werke ging. Als die Herzogin Dorothea von Preußen ums Jahr 1541 ihre bisherige Hofmeisterin Lucia von Meisdorf wegen Altersschwäche aus dem Dienst entlassen mußte, gab sie nach mehreren Orten hin Aufträge, ihr eine brauchbare Person zu dem Amte in Vorschlag zu bringen, und da sie eine solche in Preußen nicht finden konnte, mußte sie sich an einige Bekannte in Deutschland wenden, mit der Bitte, ihr von dorther eine geeignete Person zuzuschicken, rät jedoch ausdrücklich, sie zuvor aufs allergenaueste zu prüfen, damit sie gut mit ihr versorgt sei. Sie verspricht ihr ein jährliches Gehalt von zwanzig Gulden und die gewöhnliche Hofkleidung, mit der Aussicht auf Verbesserung, sofern sie sich der Herzogin nach ihrem Gefallen verhalten werde.
In den Dienst der Fürstin wurde die Hofmeisterin mit dem eidlichen Gelöbnis aufgenommen: »Der Fürstin getreu und gewähr zu sein, die Tage ihres Lebens der Fürstin bereitwillig zu dienen, ihren Schaden zu warnen und zu offenbaren, auch nichts nachzureden, woraus der Fürstin oder dem Fürsten irgendwelcher Schaden, Unglimpf oder Nachteil erfolgen könnte, vielmehr alles, was ihr ratsweise anvertraut oder von der Fürstin angezeigt werde oder sie sonst von ihr in Erfahrung bringe, bis ins Grab zu verschweigen.« Sie mußte ferner eidlich versprechen, die ihr vom Fürsten übergebene Hofordnung nie zu übertreten, sich die Aufwartung der Fürstin stets aufs fleißigste angelegen sein zu lassen, »das Frauenzimmer pünktlich und treu zu regieren, etwaniger Zwietracht und Uneinigkeit der Jungfrauen und aller derer, die ins Frauenzimmer gehörten, nach allem Vermögen zuvorzukommen und, wofern sich eine der Jungfrauen eine üble Nachrede oder sonstige Verletzung guter Sitte und Zucht erlauben werde, sie mit Rath des Fürsten, der Fürstin und des Hofmeisters, wenn es diese nötig fänden, ernstlich zu bestrafen«.
Die Hofmeisterin war demnach die erste Dienerin der Fürstin und ihre beständige Gesellschafterin und Begleiterin. Hielt in des Fürsten Abwesenheit die Fürstin allein Tafel, so mußten nach Vorschrift der Hofordnung die Hofmeisterin und der Hofmeister nebst einigen Hoffräulein an ihrer Tafel speisen. In des Fürsten Anwesenheit dagegen saß die Hofmeisterin am Tische der Jungfrauen.
Als Obervorsteherin der Hoffräulein hatte sie die nächste Oberaufsicht und Verantwortlichkeit über Zucht und Ordnung im Frauenzimmer. Man war ihr zum strengsten Gehorsam verpflichtet; denn in der Hofordnung war ihr ausdrücklich als Pflicht vorgeschrieben, »sie solle die Jungfrauen im Frauenzimmer stets nach ihrem höchsten Vermögen zu Zucht, Ehre und Redlichkeit anhalten, dafür sorgen, daß dieselben der Fürstin zu behaglichem Willen ehrbar dienten, und darauf sehen, daß unter ihnen alles Gewäsche und Gezanke, was dem fürstlichen Frauenzimmer übel anstehe, vermieden werde«. Sie war außerdem verpflichtet, auch für die Ausbildung der Hoffräulein sowohl in feinem Anstand und gutem Benehmen, als im Geschick zu weiblichen Arbeiten Sorge zu tragen. Was sie daher im Frauenzimmer anordnete, um gute Sitte zu fördern oder Unordnungen vorzubeugen, mußte unbedingt befolgt werden. Ohne ihre Erlaubnis durfte keine fremde Person das Frauenzimmer betreten. Wir finden sogar in der Hofordnung die Vorschrift, daß, wenn einer der Jungfrauen im Frauenzimmer während der Nacht eine Schwachheit zufallen und die Hofmeisterin dazu gerufen werde, so solle sie sich zuerst wegen der Schwachheit nach höchstem Vermögen erkundigen und nur, wenn dann befunden werde, daß ein Doktor oder Barbier nötig sei, solle deren einer »aus Erfordern unvermeidlicher Not, sonst aber keine andere Mannsperson bei Tag oder Nacht ins Frauenzimmer zur Kranken eingelassen werden«.
Diese Hoffräulein oder, wie sie damals gewöhnlich hießen, Kammerjungfrauen, dienten der Fürstin als nächste weibliche Dienerschaft. Sie waren ausschließlich adeligen Standes und zwar in der Regel Töchter adeliger Familien des Landes. Nur ausnahmsweise kamen mitunter Fälle vor, daß Fürstinnen aus besonderen Rücksichten, bei höheren Verwendungen und Empfehlungen auch Töchter auswärtiger adeliger Familien als Kammerjungfrauen in ihr Frauenzimmer aufnahmen. Gewöhnlich mußten solche eine Art von Pension niederlegen und von den Eltern mit den nötigen Bedürfnissen ausgestattet sein. So verwandte sich einmal der König von Dänemark bei der Herzogin von Preußen um die Aufnahme der Tochter eines seiner Untertanen in ihr fürstliches Frauenzimmer. Sie erwiderte ihm darauf: Sie wolle ihm gerne in allen Dingen gefällig sein; er könne jedoch leicht selbst ermessen, daß sie ihren eigenen Untertanen darin nicht wenig zu tun schuldig sei und diese vor allen anderen fördern müsse und wolle. Um jedoch dem König und den Eltern ihren freundlichen Willen zu beweisen, sei sie es zufrieden, daß diese ihr eine ihrer Töchter zuschicken möchten, doch dergestalt, daß sie auch dasjenige bei ihrer Tochter tun und mitgeben, was sie oder andere Eltern, wenn sie eine Tochter ins Kloster stecken, zu tun pflegen. Als man indes der Herzogin bald darauf meldete: die Eltern wollten ihrer Tochter nichts als etwa hundert Mark und etliche Kleider mitgeben, schrieb sie dem Könige: unter solchen Umständen könne sie die Jungfrau nicht in ihr Frauenzimmer aufnehmen, zumal da »wir auch dieses Landes und Fürstentums Preußen Jungfrauen vor anderen zu helfen schuldig sind. Wo ihr aber die Eltern fünfhundert Mark mit einer ziemlichen Notdurft Kleider und Geschmuck mitgeben und solches so lange, bis sie ausgebracht wird, hinterlegen oder ihr zum Besten zu Zins machen wollen, soll alsdann an uns in dem zu freundlichem Gefallen nichts erwunden werden«.
Bei der Aufnahme in das fürstliche Frauenzimmer mußte jedes Hoffräulein sich »bei adeliger, ehrenreicher Treue« eidlich verpflichten, gewisse Bestimmungen pünktlich zu beobachten. Außer dem allgemeinen Versprechen eines treuen Dienstes mußte sie geloben, Tag und Nacht der Fürstin stets gewärtig zu sein, so oft und solange es diese verlange, morgens und abends ihr zum Dienst bereit zu stehen, darauf zu achten, daß die Fürstin ohne ihren Willen nie und nirgends allein gelassen werde, auch mit allem Fleiße auf Speisen und Getränke zu sehen, wenn sie der Fürstin in ihrer Kammer, auf Reisen oder sonst irgendwo gereicht würden, damit Gefahren, die daraus entstehen könnten, mit aller Sorgfalt vorgebeugt werde. Sie mußte mit darauf achten, daß alles unordentliche Aus- und Eingehen in der Fürstin Zimmer vermieden, auch daß ohne des Fürsten oder des Hofmeisters Wissen oder unangemeldet niemand außer der vereidigten Dienerschaft in die fürstlichen Zimmer zugelassen werde. Kein Hoffräulein durfte sich erlauben, irgend etwas von Kramwaren, Speisen, Getränken, Briefen und sonst etwas anzunehmen und in die Kammern der Fürstin zu tragen ohne deren Vorwissen und ohne sich zuvor erkundigt zu haben, von wem und von wo das Gebrachte komme. Die Hofordnung schrieb ferner vor: die Kammerjungfrauen sollten nicht minder wie die Hofmeisterin sich auch der Wartung und Reinigung der Kleidung, der Gemache der Fürstin und »was sonst zu ihrer zierlichen Notdurft gehört, mit allem Fleiße annehmen, damit dasselbe alles stets fürstlich gehalten werde«.
Gewann schon durch all' diese Bestimmungen das Leben der Hoffräulein einen fast klösterlich einsamen Charakter, so schrieb die Hofordnung überdies noch vor, daß sich kein Hoffräulein erlauben dürfe, Briefe, ohne Erlaubnis und Mitwissen der Hofmeisterin, anzunehmen oder wegzusenden. Briefe an Eltern, Geschwister und nahe Verwandte konnten nur dann »unbesichtigt aus dem Frauenzimmer ausgehen«, wenn sie etwaige notwendige Bedürfnisse betrafen; aber es hieß ausdrücklich: »es solle allwege in solchen Schreiben vermieden bleiben, irgendetwas anderes oder weiteres aus dem Frauenzimmer zu schreiben«. Wollten Freunde oder Verwandte ein Hoffräulein im Frauenzimmer besuchen, so durfte auch dieses nur im Beisein der Hofmeisterin geschehen, »damit diese, wie es heißt, jedesmal hören möge, was sie miteinander zu schaffen und zu reden haben«. Ebenso durfte kein Hoffräulein ohne der Hofmeisterin Erlaubnis irgendein Geschenk annehmen, von wem es auch kommen mochte; noch viel weniger war es einer Hofjungfrau erlaubt, ohne der Hofmeisterin Beisein die Straße zu betreten. Was auswärts zu besorgen war, mußte durch Knaben oder Diener geschehen, die zu diesem Zweck dem Frauenzimmer zugeordnet waren.
Trotz dieser Strenge aber in den Bestimmungen der Hofordnung galt es doch immer als ein Glück für ein adeliges Fräulein, an einem Fürstenhofe in ein Frauenzimmer aufgenommen zu werden, wie wir aus den häufigen Bittschreiben der Eltern ersehen, die um die Aufnahme ihrer Töchter nachsuchten. Gemeinhin fanden auch die Aufgenommenen von Seiten der Fürstin bei guter Führung eine freundliche Behandlung. So rühmt man der Kurfürstin Hedwig von Brandenburg ausdrücklich nach, daß sie mit ihren Hoffräulein stets im freundlichsten und herablassendsten Verkehr gelebt; die liebenswürdige Herzogin Dorothea von Preußen nannte gewöhnlich ihre Hoffräulein »meine liebe Töchter.«
Hatte ein Hoffräulein eine Anzahl von Jahren am fürstlichen Hofe zugebracht und das, was zur feinen Bildung gehörte, sich angeeignet, so knüpften sich dort auch leichter als anderswo Verbindungen für das künftige Lebensglück. War eine solche geschlossen, so sorgten der Fürst und die Fürstin für eine stattliche Aussteuer und Hochzeitsfeier. Wir finden in mehreren Hofordnungen die ausdrückliche Bestimmung: Wenn eine Jungfrau von Adel aus dem fürstlichen Frauenzimmer mit Rat und Einwilligung des Herzogs und der Herzogin sich zu verheiraten gedenke, so wolle der Herzog aus Gnaden sie mit hundert Mark an barem Gelde aussteuern. Geschehe es aber, daß eine zuvor, ehe sie in das Frauenzimmer käme, ehelich versprochen wäre oder unter einem Jahre sich verheiraten werde, so wolle der Herzog nicht verbunden sein, ihr ein solches Heiratsgeld mitzugeben. Geschah das eheliche Verlöbnis einer Hofjungfrau mit des Fürsten Vorwissen und Genehmigung, so übernahm dann die Fürstin die Ausrichtung der Hochzeit, sie bestellte ihr die »hochzeitliche Ehre«.
Einer der wichtigeren Hofdiener der Fürstinnen war außer dem Hofmeister der Kämmerer, auch der Hofkämmerer oder Leibkämmerer genannt, weil er »mit allem treuen Fleiß auf der Fürstin Leib aufwarten soll«. Er war ebenfalls adeligen Standes, weshalb es auch in seinem Amtseide hieß, er solle seinem Amte stets nachkommen, wie es einem ehrliebenden Diener von Adel ziemt und gebührt. In diesem Diensteide waren ihm zugleich seine wichtigsten Dienstpflichten vorgeschrieben: Er solle, hieß es, die tiefste Verschwiegenheit über alles beobachten, was er beim Ein- und Ausgehen in der Fürstin Kammer oder sonst heimlich oder öffentlich erfahre; er solle sorgsam darauf achten, daß das Frauenzimmer immer zur rechten Zeit geschlossen werde und keinen ungebührlichen Aus- und Eingang in dasselbe gestatten, überhaupt allen Unordnungen so viel als möglich zuvorkommen. In allem, was die Ordnung des Frauenzimmers vorschrieb oder die Fürstin und der Hofmeister ihm darüber anbefahlen, war ihm die pünktlichste Ausführung zur Pflicht gemacht. Sobald er im Frauenzimmer Unordnung oder etwas Ungebührliches bemerkte, was er nicht selbst abstellen konnte, mußte er dem Fürsten oder der Fürstin darüber schleunige Nachricht geben.
Unter dem speziellen Befehl des Hofkämmerers stand die ganze übrige Hofbedienung der Fürstin. Dahin gehörten die Kammerjunker, die Hoflakaien, die Kammermägde und der Türknecht. Die Kammerjunker oder Kammerjungen waren Edelknaben, die teils den Dienst an der Tafel oder im Gemach der Fürstin, teils auch verschiedene Dienste im Frauenzimmer zu verrichten hatten. Nach der Hofordnung mußten sie bei ihrer Aufnahme am Hofe das achte Jahr erreicht haben und wurden mit dem dreizehnten Jahre aus dem Dienst entlassen; denn es war ausdrücklich vorgeschrieben, daß kein Edelknabe über dieses Alter hinaus in das Frauenzimmer zugelassen werden dürfe. Der Hofkämmerer hatte stets darauf zu achten, »daß die Kammerjungen, die der Fürstin zu Dienst stehen sollen, sich stets reinlich, ehrbar und züchtig hielten und auch sonst ihrer Aufwartung Genüge täten; wofern sie etwas verbrechen würden, solle er sie mit einer ziemlichen Rutenstrafe zu züchtigen Macht haben und das zu tun auch schuldig sein«. Hatten jedoch solche Edelknaben sich redlich geführt, so sorgte die Fürstin, wenn sie aus dem Hofdienste entlassen wurden, auch für ihre fernere Ausbildung teils auf Reisen, teils auch durch Empfehlungen an andere Höfe. Außer diesen Edelknaben finden wir im Dienste der Fürstinnen noch »große Kammerjungen«, die vornehmlich zu Bestellungen außer dem fürstlichen Schlosse gebraucht wurden.
Mit Ausnahme der Edelknaben wurden alle am Hofe der Fürstin angestellten Diener, vom Hofmeister und der Hofmeisterin an bis zum Türknecht, Hofschneider und der Hofwäscherin herab durch einen Eid in Treue und Pflicht genommen. Dieser Eid enthielt teils allgemeine Bestimmungen in betreff der Verschwiegenheit, über alles, was am Hofe der Fürstin vorging oder die persönlichen Verhältnisse der Fürstin betraf, teils wurden in diesen auch die wichtigsten Dienstvorschriften aufgenommen. So war, um nur ein Beispiel anzuführen, im Diensteid der fürstlichen Hofwäscherin vorgeschrieben: Wenn sie Sachen der Fürstin in der Wäsche habe, solle sie Sachen keiner anderen Person in die der Fürstin untermengen, auch niemand über solche Sachen kommen, sie besichtigen und ebensowenig einen fremden Menschen auf derselben Waschbank waschen lassen ohne höhere Erlaubnis. Desgleichen mußte sie in ihrem Eide beschwören, daß sie zur Kleiderwäsche der Fürstin keine Weidasche gebrauchen, sondern sie mit Seife und wie sich's sonst gebührt, fleißig waschen wolle. Als einst die Herzogin von Münden, Gemahlin des Grafen Poppo von Henneberg, sich beim Herzog Albrecht von Preußen über die ungebührliche Behandlung, die sie von manchem ihrer Hofdiener erfahren müsse, beklagte, indem manche ihre mit dem Handschlag zugesicherte Treue brächen, andere trotzig sich weigerten, ihr einen förmlichen Diensteid zu leisten, gab er auf ihre Anfrage, wie er es damit an seinem Hofe halte, die Antwort: »Euer Liebden mögen wissen, daß wir es die Zeit unserer fürstlichen Regierung und auch jetzt noch also halten und auch nicht anders wissen, als daß es bei anderen Fürstenhöfen auch so gebräuchlich ist, nämlich, daß wir alle unsere Amtleute, Hofmeister, Kanzler, Marschälle und andere Räthe, ebenso andere Personen, die zum Regiment notwendig, desgleichen die Leibdiener, Kämmerer, Aerzte und dann auch die, welche auf unseren Tisch zu Truchseß-Aemtern, Küche, Keller, Silberkammer und überhaupt keiner ausgenommen zur Aufwartung unseres Leibes verordnet werden, mit leiblichem Eide in Dienst annehmen; dasselbe findet auch bei den Dienern und Dienerinnen unserer Gemahlin statt, es seien Hofmeisterinnen, Kammerjungfern oder andere. Es geschehe wohl,« fügt der Herzog hinzu, »daß zuweilen ein ehrlicher Mann sich durch einen leiblichen Eid beschwert finde und dann bitte, an Eides Statt Treue mit Handgelübde zusagen zu dürfen, daher er solchen ehrlichen Leuten den leiblichen Eid nachlasse, denn wenn einer solche verheißene Zusage nicht halten wolle, so werde er eben so wenig den Eid halten. Bei den Alten ist wahrlich ein solcher Handstreich oder Handgelübde in großem Ansehen gewesen und es wundert uns deshalb um so viel mehr, warum es die jungen Leute jetzt dahin spielen, zu meinen, solches Gelöbniß zu halten nicht schuldig zu sein.«
Von der Leistung eines solchen Diensteides waren die an den Höfen im fürstlichen Frauenzimmer angenommenen Zwerge und Zwerginnen ausgenommen. Wie es Zeiten gab, in denen ein Hofnarr oder Lustigmacher zur Komplettierung der Hofdienerschaft gehörte, so waren im sechzehnten Jahrhundert besonders Zwerge und Zwerginnen an den Höfen der Fürstinnen eine Art von Lieblingssache, so daß man sich alle Mühe gab, sich solche zu verschaffen. Wir haben eine Anzahl von Briefen verschiedener Fürstinnen an den Herzog von Preußen, worin er ersucht wird, solche Seltsamkeiten von Menschen diesem und jenem Hofe zuzuschicken. So schreibt ihm die Herzogin Barbara von Liegnitz, eine geborene Markgräfin von Brandenburg: »Euer Liebden geben wir freundlicher Meinung zu erkennen, daß wir gerne bei uns in unserem Frauenzimmer eine Zwergin sehen und haben wollten. Demnach bitten wir Euer Liebden ganz freundlich, Euer Liebden wollen uns, sofern sie jetzt keine an ihrem Hofe hätten, eine solche Zwergin in ihrem Lande zu Wege bringen helfen und uns dieselbe auf's eheste so es möglich ist allhier übersenden und zukommen lassen.« Der Gemahl der Fürstin, Herzog Georg von Liegnitz, spricht den Herzog Albrecht ebenfalls um einen Zwerg für seine Gemahlin an, mit der angelegentlichsten Bitte, ihm einen solchen auf's schleunigste zu verschaffen. Als vorläufiges Gegenpräsent überschickt er dem Herzog ein Paar englische Hunde und eine Hündin »von der Art, wie sie der Römische König habe«. Die Markgräfin Katharina, Gemahlin des Markgrafen Johann von Brandenburg, läßt es sich nicht verdrießen, die Markgräfin Anna Sophia von Brandenburg wiederholt zu bitten, doch ja nicht zu vergessen, ihr die versprochene Zwergin so bald als möglich zuzuschicken; und kaum hat die Landgräfin Barbara von Leuchtenberg gehört, daß Herzog Albrecht von Preußen ein äußerst niedliches Zwerglein an seinem Hofe habe, so quält sie diesen in ihren Briefen drei Jahre lang mit der Bitte, ihr das niedliche Ding doch abzulassen. Zuerst schreibt sie ihm im Jahre 1548: »Bitte Euer Liebden ganz freundlich, wo es anders Euer Liebden nicht zuwider ist, ihr Zwergle hinzugeben, daß Euer Liebden mir es doch schicke; ich wollte es halten, als wenn's mein Kind wäre; doch wenn es Euer Liebden zuwider wäre, so wollte ich es nicht begehren.« Der Herzog entschuldigt sich bei der Fürstin, daß er ihr das Zwerglein, weil es seiner verstorbenen Gemahlin zugehört und dieser besonders lieb gewesen sei, nicht ablassen könne. Er verspricht ihr aber, ein anderes Exemplar zu schicken. Darauf erwidert die Landgräfin: »So viel das Zwergle betrifft, so Euer Liebden bei sich haben und derselben geliebtester seliger Gemahlin zum Besten befohlen gewesen ist, so sind wir es wohl zufrieden, daß Euer Liebden es behalten, und müßte uns ja leid sein, dieweil es diese Gestalt hat, daß wir es begehren sollten. Daß aber Euer Liebden im Vorhaben stehen und verhoffen, an anderen Orten einen Zwerg an sich zu bringen und so Euer Liebden den erlangen, daß sie uns damit begaben wollten, das nehmen wir mit Dank an.« Der Herzog überschickte ihr darauf im nächsten Jahre eine Zwergin. Allein die Fürstin ist damit noch nicht befriedigt, sie will nun gerne ein Paar haben und schreibt daher von neuem: »Euer Liebden ist wohl noch gut wissen, daß sie mir geschrieben haben, Euer Liebden wollten mir einen Zwerg und eine Zwergin schicken; die Zwergin ist mir geworden, der Zwerg aber nicht, bitte daher ganz treulich, mir auch diesen zu Wege zu bringen.«
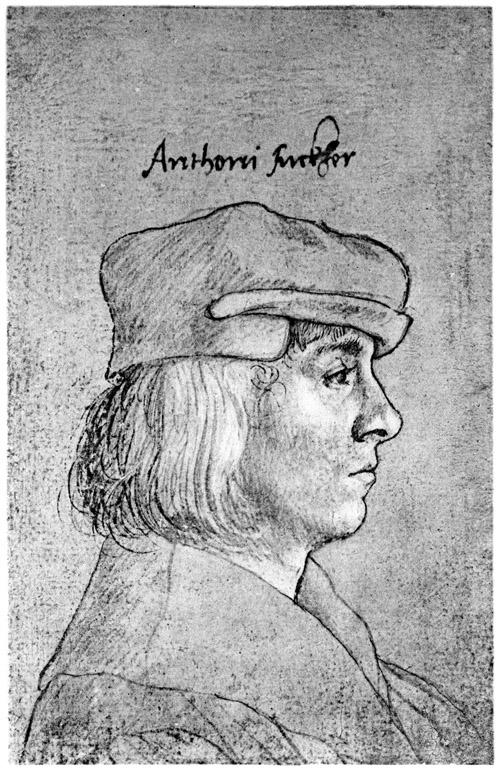
Hans Holbein d. Ält., Anton Fugger. Silberstiftzeichnung. Berlin, Kupferstichkabinett
Wenden wir uns jetzt zu den Beschäftigungen, womit sich die Fürstinnen in den stillen Tagen ihres Hoflebens die Stunden zu verkürzen pflegten, so tritt uns ein anderes Leben entgegen, als wir es heutigen Tages an fürstlichen Höfen finden. Mit Lektüre konnten sich damals bei der Seltenheit geeigneter Bücher die Fürstinnen wenig vergnügen, noch weniger gehörte Musik zum Zeitvertreib fürstlicher Frauen; wir haben wenigstens in allen Briefen, worin Fürstinnen über ihre Beschäftigungen sprechen, nicht ein einziges Mal der Musik und ebensowenig der Malerei erwähnt gefunden. Überhaupt war das Leben der Fürstinnen damals ungleich stiller, einfacher und freudenleerer. Schon die häufige lange Abwesenheit der Fürsten von ihren Höfen, wenn sie auf Reichstagen verweilen mußten, Fürstenversammlungen oder Kriegsverhältnisse sie beschäftigten, zwang die fürstlichen Frauen zu einem zurückgezogenen Leben. Ist der Fürst im Felde, so nimmt auch die Fürstin an Kriegsereignissen lebendigeres Interesse. Die Kurfürstin Hedwig von Brandenburg verrät als Politikerin in ihren Briefen häufig die regste Teilnahme an Welthändeln. Als ihr Gemahl Joachim II. im Jahre 1542 dem Türkenkrieg beiwohnte, erzählte sie dem Herzog von Preußen mit großem Interesse von diesem Kriegszuge; aber sie erkundigte sich zugleich auch mit eifriger Wißbegier, ob es denn wirklich wahr sei, daß sich die Könige von Frankreich und Dänemark mit den Türken gegen den Kaiser verbunden hätten, um dessen Vorhaben in Ungarn durch einen Angriff auf Mailand zu hindern. Wie sich diese Fürstin mit politischen Dingen beschäftigt, so studiert sich die Gräfin Elisabeth von Henneberg in theologische Streitigkeiten hinein; da sie aber in diesem Gezänke für ihre schwergebeugte Seele keinen Trost findet, so schreibt sie sich ein Gebetbuch zusammen, um in dem Worte Gottes Linderung ihres Kummers zu suchen. »Da Euer Liebden mich ermahnt haben,« schreibt sie dem Herzog von Preußen, »daß ich heftig im Glauben beten solle wider Gottes, Eurer Liebden und meine Feinde, so habe ich eine Zeitlang etliche Collecten aus dem ganzen Psalter, Daniel und Judith, aus dem Mose und Esther, aus dem Buche der Könige, aus den Evangelisten, den Büchern der Maccabäer und aus anderer göttlicher heiliger Schrift zusammengetragen, woraus Euer Liebden die Angst meines Herzens spüren können, auch wie ich jetzt getrost wider Gottes, meine und aller lieben Christen Feinde bete. Euer Liebden halten mir's freundlich zu gut; denn vor der Welt, bei den gottlosen Höfen, die Gott nicht erkennen wollen, wird das Beten für Thorheit geachtet. Aber kommt der Glaube dazu, Euer Liebden sollen erleben, was die Kraft des Gebetes vermag; denn es betet nicht ich oder Euer Liebden, sondern der Geist Gottes in uns. Es wird und muß Amen sein, deß bin ich gewiß.«
Andere Fürstinnen – und deren mochten in Deutschland damals viele sein – erscheinen mehr als fürstliche Hausfrauen, die sich um die Einzelheiten der fürstlichen Hauswirtschaft bekümmern. Ein schönes Bild davon gibt uns die Herzogin Dorothea von Preußen; denn in ihrer unermüdlichen Sorge um das fürstliche Hauswesen mochte sie, die Königstochter, wohl schwerlich von einer anderen Fürstin übertroffen werden. Sie macht es sich zur Pflichtsache, auf alle häuslichen Verhältnisse und Bedürfnisse ihres Hofes ein wachsames Auge zu haben. Schreibt ihr der Herzog auf der Reise, sie möge sich den Hofgarten und die Haushaltung empfohlen sein lassen, so erwidert sie ihm: »ich erkenne mich zu allem dem schuldig, wie Euer Liebden eigene und getreue Dienerin Euerem Gefallen allwege nachzukommen; aber ich kann Euer Liebden nicht verbergen, daß dieweil Euer Liebden weg gewesen ist, man nicht wohl Haus gehalten hat, wie ich selbst gesehen und mein Hofmeister mich berichtet hat«. Befindet sich ihr Gemahl auf einer Reise, so sorgt sie auf jede Weise, daß es ihm an nichts fehle. Wir finden, daß sie ihm selbst allerlei Lebensbedürfnisse, frische Butter, wohlschmeckenden Käse, Obst und Pfefferkuchen nachschickt, und sie bezeugt dem Herzog ihre herzinnige Freude, wenn er ihr meldet, daß ihm das Zugesandte wohl geschmeckt habe. Dann wiederum läßt sie ihm reine Hemden und andere Leibwäsche, ja sogar eine vergessene »Nachthaube« nachbringen, weil sie besorgt, er möge sich den Kopf erkälten. Schickt der Herzog aus Krakau Wein, Rheinfall und Malvasier, nach Königsberg, so trägt er in einem Schreiben der Herzogin auf, doch selbst wohl zuzusehen, daß der Wein nicht in fremde Hände komme. Fehlen in der Hauswirtschaft einzelne Bedürfnisse, so sorgt die Fürstin für ihre Herbeischaffung in der Regel selbst. Wir lesen noch, wie sie der Felicitas Schürstab in Nürnberg aufträgt, sie möge für sie ein Säckchen voll guter Linsen bestellen und ihr von dort zuschicken, »denn«, fügt sie hinzu, »solche bei uns allhie fast seltsam sind und wir sie hiesiges Landes nicht wohl bekommen können«; und nachdem sie die Linsen aus Nürnberg erhalten hat, dankt sie der Übersenderin äußerst freundlich, bestellt bei ihr, zugleich aber sie um Verzeihung bittend, daß sie ihr so oft beschwerlich falle, ihr etwa dreihundert Ellen von den allerbesten Überzügen zu Unterbetten zu besorgen, entweder aus Nördlingen oder sonst woher, wo man solche am besten und dicksten mache. Einer Königsbergerin, Hedwig Rautherin, die nach Deutschland reist, gibt sie den Auftrag mit, ihr draußen zu sechs großen Fürstenbetten und sechs Pfühlen, je auf ein Bett und Pfühl neunzehn Ellen, guten und kleinen, allerbesten Zwillich anzukaufen und nach Preußen zu schicken. Oft ist es spaßhaft, wie sehr sich die Herzogin um allerlei Dinge in der Wirtschaft bekümmert. Es wird ihr eine Probe Seife aus Marienburg zugeschickt, und sie meldet darauf, sie wolle es mit dem dortigen Seifensieder einmal versuchen und, wenn es trockene Seife sei, den Stein mit fünfzehn Groschen bezahlen. Bald darauf schreibt sie wieder: sie habe die neue Probe des Seifensieders erhalten, und die Seife sei an sich nicht schlecht; weil sie indes der venedischen nicht gleiche, auch an Geruch zu stark sei für ihre und des Herzogs Kleider, so müsse sie für die gehabte Mühe danken. Sie bestellt sich dann die nötige Seife aus Nürnberg. Auf die Leibwäsche des Herzogs verwendet sie selbst immer die größte Aufmerksamkeit. Sie schickt der Näherin eine Anzahl Hemden und den nötigen Zwirn zu, bestimmt selbst die Breite, Weite und Länge der Ärmel und Kragen, bittet aber zugleich, die Arbeit möglichst zu fördern, weil es mit den alten Hemden des Herzogs schon sehr auf die Neige gehe. Die Näherin ersucht die Fürstin, ihr die alten Hemden einstweilen zur Ausbesserung zuzuschicken; »denn«, fügt sie hinzu, »sie habe ja auch der Herzogin deren Kleider, wenn sie zerrissen gewesen, wieder mit allem Fleiße so zusammengenäht und unterhalten, daß sie dieselben noch jetzt trage; wenn sie das nicht getan, so würde die Herzogin sie haben ablegen und wohl dreißig Mark mehr für neue geben müssen«. Um sich Näherinnen für ihren Hof zu erziehen, gründete die Herzogin eine besondere Anstalt, worin sie eine Anzahl junger Bürgertöchter und Landmädchen von einer geschickten Näherin unterrichten ließ und für Lehrgeld und Kost jährlich fünfundzwanzig Mark zahlte.
Ebenso sorgt die Herzogin selbst häufig gerne für die Angelegenheiten der herrschaftlichen Küche. Es fehlt ihr eine tüchtige Köchin; sie kann aus ganz Preußen keine solche bekommen und schreibt daher nach Nürnberg an Felicitas Schürstabin: »Nachdem wir gerne eine gute Köchin, die uns für unseren Leib kochen und uns in unserem Gemache aufwarten thäte, haben wollten, so bitten wir mit allen Gnaden, Ihr wollet Euch befleißigen, ob Ihr uns eine gute Köchin überkommen könntet, denn wir einer solchen im Jahre gerne zehn Gulden geben wollen, und ob es sich schon um ein Paar Gulden höher laufen täte, läge uns auch nicht viel daran, zudem auch ein gutes Kleid, so gut wir's unseren Jungfrauen in unserem Frauenzimmer zu geben pflegen. Aber das müßtet Ihr von unseretwegen ihr hinwieder melden, daß ihr viel Auslaufens nicht gestattet würde, sondern sie müßte still, züchtig und verschwiegen stets bei uns in unserem Gemache sein und auf unseren eigenen Leib warten. Hätte sie dann Lust, bei uns hierin zu bleiben und sich alsdann etwan mit der Zeit in andere Wege zu versorgen, so sollte sie dazu von uns mit allerlei Gnaden gefördert werden. Was Ihr also von unseretwegen ihr versprechen und zusagen werdet, das soll ihr allhier durch uns überreicht und gehalten werden.« Die Köchin wird besorgt, und zum Zeichen der Dankbarkeit überschickt die Herzogin der Schürstabin bald nachher einen goldenen Schaupfennig. Auch in diesen Angelegenheiten erstreckt sich die Aufmerksamkeit und Sorgfalt der Herzogin bis in alle Einzelheiten. Naht Fastnacht, so bestellt sie selbst zwölf gute Lachse und etliche Schock Neunaugen für den herzoglichen Tisch; ein andermal läßt sie für zwanzig Gulden Lachs und Neunaugen aus Schleswig kommen. Die Aale, die ihr Hector von Heßberg besorgt, kommen ihr zu frisch und nicht genug getrocknet zu; sie schreibt ihm daher: »wenn Ihr wieder Aale, besonders große erhaltet, so wollet sie alsbald ausnehmen, ihnen ganz die Haut abstreifen, sie dann mit Nägelein bestecken, die Haut wieder überziehen und also vollends trocknen lassen«. Weil sie weiß, daß ihr Gemahl ein Freund von Kabliau ist, so schreibt sie bald dahin, bald dorthin, um sich solchen zuschicken zu lassen. Selbst bis nach Helsingör läßt sie an den dortigen Vogt Jasper Kaphengst das Gesuch ergehen, er möge jetzt, da die Zeit nahe, wo man in Dänemark Makrelen fange, ihr solche einkaufen und eingesalzen in einem Fäßchen zusenden, daneben ihr auch einige Schock Makrelen trocknen lassen. Die Herzogin will nach Memel verreisen; es fällt ihr aber ein, daß in ihrem Garten zu Fischhausen noch Weintrauben hängen, die sie nun nicht genießen kann; sie schreibt daher der Jungfer Röslerin, sie möge die Trauben abnehmen und eine Latwerge daraus machen, jedoch von den weißen und roten eine besondere und keinen Zucker dazu nehmen. Sie selbst bestellt für die herrschaftliche Küche bei den Amtleuten zu Tapiau und Neidenburg Rinderfleisch und Wildpret. Fehlt dies oder jenes am herzoglichen Tischgeräte, so ist es ebenfalls die Herzogin, die dafür Sorge fragt. Sie läßt sich silberne Trinkgefäße in Nürnberg, Tischmesser nach zugeschickten Mustern in Liegnitz oder Memel verfertigen und da die ihr zugesandten zu dünn und nicht recht passend scheinen, so schickt sie sie zurück und bestimmt aufs genaueste, was sie zu haben wünsche.
Nahen die Freuden der Hausmutter, so treten der Herzogin auch neue Sorgen entgegen. Fühlt sie sich von neuem als Mutter, so gibt sie ihrem Gemahl, wenn er auf Reisen ist, genaueste Nachricht, wie es mit ihr stehe, fügt dann aber hinzu: »Ich möchte Euer Liebden wohl gebeten haben, daß Euer Liebden diesen Brief ja verbrennen wolle, damit ihn niemand anders zu sehen kriegt, der meiner damit spotten möchte; denn zu Euer Liebden versehe ich mich es nicht und weiß es auch fürwahr, daß Euer Liebden mich meines Schreibens nicht verdenkt.« Rückt die Zeit näher, wo sie »ihrer fraulichen Bürde« entbunden werden soll, so sorgt sie selbst für eine geschickte Hebamme und gute Amme. Sie wendet sich dann an die Königin von Dänemark mit der Bitte, ihr die bewußte erfahrene Frau zu ihrer Entbindung zuzuschicken, »in Ansehung,« wie sie hinzufügt, »daß ich diesmal mit einer erfahrenen, ehrlichen Frau nicht versehen bin«. Ein andermal schreibt sie unter denselben Umständen an Felicitas Schürstabin in Nürnberg: »der barmherzige Vater hat es nach seinem göttlichen Willen abermals auf gute Wege mit uns gebracht. Dieweil nun aber in diesen Landen keine rechtschaffene gute Wehemutter, damit wir wohl versorgt sein möchten, zu bekommen ist, so ist unser ganz gnädiges Sinnen und Begehren an Euch, weil diese Sache unseren eigenen Leib, Gesundheit und Wohlfahrt betreffen thut, Ihr wollet neben Eurer Freundschaft Euch nicht beschweren, uns eine gute, verständige und rechtschaffene Hebamme, darauf wir uns verlassen dürfen, zu Wege bringen.« Die Herzogin fügt hinzu: man möge es mit der Hebamme so abmachen, daß sie für immer in Preußen bei ihr bleibe; sie solle so gehalten werden, daß sie sich nicht zu beklagen habe; wo nicht, so solle sie eine andere mit sich bringen, die sie selbst »nach ihrer Art und Kunst abgerichtet habe« und bleiben könne. Sie solle bei ihr auf jede Weise gut versorgt werden. Ebenso sorgsam bemüht sich die Herzogin selbst um eine tüchtige Amme. Sie wendet sich nach Danzig, wo ihr auch eine empfohlen wird, die einen Sohn »gut gemuttert« hat. Diese erbietet sich auch, für zwanzig Gulden Lohn, ein Lundisches Kleid und zwölf Mark für ihr anderwärts untergebrachtes Kind in den Dienst zu treten. Die Herzogin aber schreibt: ihr Schreiber müsse sich in der Angabe des Lohnes geirrt haben; eine Amme bekomme gewöhnlich nur zehn Gulden jährlichen Lohn und soviel habe sie auch dieser anbieten lassen; da ihr indes einmal zwanzig Gulden zugesagt seien, so wolle sie ihr solche auch geben und dazu noch den Gottespfennig. Nun ist die Herzogin wieder sehr besorgt, daß alles glücklich von statten gehen möge. Da erhält sie die Nachricht: »Heinrich von Baumgart zu Schönburg und dessen Frau sollten Wissenschaft haben, daß man schwangeren Frauen, wenn sie über die Hälfte gekommen seien, eine Ader lassen müsse; dadurch sollten die Kinder verwahrt werden, daß sie das Freischich (?) nicht bekämen.« Da sie nun aber in Zweifel ist, wie die Ader heiße, an welchem Orte und zu welcher Zeit man sie lassen müsse, so wendet sie sich selbst an den genannten Herrn mit der Bitte um nähere Belehrung. Dieser gibt sie und erhält dafür ein schönes Auerhorn zum Geschenk. Zu gleicher Zeit schickt ihr eine befreundete Fürstin für ihre Umstände auch gewisse Verhaltungsregeln und Indizien, wonach sie sich zu richten habe und auf die sie merken müsse. Wir enthalten uns, diese Indizien hier weiter mitzuteilen; sie sind zum Teil sehr sonderbar; es heißt darin auch, man müsse darauf achten, wie die Farbe unter dem Angesichte, ob sie bleich oder rot sei, welchen Fuß die Fürstin zuerst vorsetze, wenn sie aufstehe und gehen wolle. »Wenn ich«, fügt die fürstliche Freundin hinzu, »über diese Artikel kann berichtet werden, will ich Ihrer Liebden mit göttlicher Hülfe zuschreiben, was Ihre Liebden trägt, ob es ein Herrlein oder ein Fräulein sein würde.«
Die Fürstinnen verbrachten einen großen Teil der Zeit mit allerlei weiblichen Handarbeiten. Dahin gehörten Nähen, Stickereien und vorzüglich auch Perlenarbeit. Wir finden die Fürstinnen mit ihrer feinen Leibwäsche beschäftigt oder sie machten mit eigenhändig verfertigten Näharbeiten Geschenke an Freunde und Angehörige. Die Markgräfin Sabine von Brandenburg wünscht dem Herzog von Preußen Glück zum Neujahr und überschickt ihm zugleich als Neujahrsgeschenk ein von ihren eigenen Händen verfertigtes Hemd mit der Bitte, es von ihr als eine geringe Verehrung anzunehmen. Dieser Herzog hat die Herzogin Anna Maria von Württemberg mit einem Geschenk von Bernstein und Elendsklauen erfreut; sie überrascht dagegen den Herzog mit dem Gegengeschenk eines selbst genähten Hemdes, bittet aber zugleich um Entschuldigung, daß es noch nicht so weiß sei wie es eigentlich sein sollte, weil sie sich der eiligen Botschaft an den Herzog nicht vermutet habe. Wiederholt wird der Markgraf Wilhelm von Brandenburg, Erzbischof von Riga, von der Herzogin Dorothea von Preußen zum Neujahrsgruß mit »etzlichen schlechten Hemden«, die sie selbst verfertigt hat, beschenkt, und wie sie einmal den Herzog Johann von Holstein mit dem Geschenk eines Hemdes und eines Kranzes erfreut, so schreibt sie ein andermal dem Grafen Georg Ernst von Henneberg: »Damit Eure Liebden unsere Freundwilligkeit und mütterliche Treue spüren, so schicken wir derselben ein Hemd und einen schlechten Kranz. Wiewohl dasselbe nicht alles dermaßen von uns gemacht ist als es billig sein sollte, so bitten wir doch ganz freundlich, Euer Liebden wollen solches zu freundlichem Gefallen von uns aufnehmen und mehr unseren gewogenen Willen denn die Geringschätzigkeit der Gaben hierin vermerken, dasselbe auch von unseretwegen tragen und unserer allewege im Besten dabei gedenken.«
Mehr aber noch waren Stickereien und Perlenarbeiten eine stehende Beschäftigung der Fürstinnen. Vorzüglich werden gestickte Hauben, Barette, Kragen, Brusthemden, Koller, Halstücher und Halsbänder, Armbänder, Kissen auf Stühlen, überhaupt auch die Frauenkleider als die Hauptstickereiarbeiten der Fürstinnen erwähnt. Die Muster dazu, wenn sie sich durch Schönheit auszeichneten, schickten sie sich häufig gegenseitig zu, so daß ein schönes Modelltuch aus Nürnberg von der Herzogin Ursula von Münsterberg zur Herzogin Sophia von Liegnitz, von dieser zur Herzogin Dorothea von Preußen und von dieser endlich zur Königin von Dänemark wanderte. In der Regel waren die Stickereiarbeiten stark mit Gold und Silber geschmückt. Der Geschmack, den man darin am meisten liebte, war der italienische; man schätzte daher vor allen auch »die welschen Muster«, die man sich aus Nürnberg oder aus Leipzig von dem dortigen reichen italienischen Kaufmann Lorenzo de Villani kommen ließ. Auch diese künstlichen Stickereien dienten häufig zu fürstlichen Geschenken. Der König von Dänemark erhält sogar von der Herzogin von Preußen einmal »ein schlechtes Paar Handschuhe«, die sie für ihn gestickt hat, »damit«, wie sie sagt, »er daraus sehe, daß sie ihn noch nicht sogar vergessen habe«; der Königin macht sie sogleich ein gesticktes Halskoller und Halstuch zum Geschenk und erbietet sich, ihr nächstens neue Muster zu Hauben zu schicken.
Vor allem beliebt war die Perlenarbeit. Fast an jedem Fürstenhofe war ein sogenannter Perlenhefter angestellt. Sein Gehalt war in der Regel vierzig Gulden, Heizung, fürstliche Hofkleidung, Ausspeisung und freie Wohnung, wofür er alles verfertigen mußte, was ihm zur Verarbeitung übergeben wurde. Außerdem beschäftigten sich die Fürstinnen auch selbst mit künstlichen Perlenarbeiten. Es galt als ausgezeichneter Kopfschmuck, die Hauben von Gold- und Silberstoffen nebst deren Schlingen und Binden so geschmackvoll und reichlich als möglich mit den kostbarsten Perlen zu schmücken. Der häufige Gebrauch hatte sie im Preise bedeutend gesteigert. Wir finden, daß eine Fürstin sich bei dem Fuggerischen Faktor zu Nürnberg vier verschiedene Sorten bestellt; von der größten Sorte verlangte sie zehn Unzen, die Unze zu zehn oder zwölf Gulden, von der zweiten Sorte etwa vierzehn Unzen, die Unze zu zehn Mark, von der dritten ebensoviel, die Unze zu acht Mark, und von der vierten kleinsten Sorte fünfzehn Unzen, die Unze zu fünf Mark.
Welcher bedeutende Wert an Perlen, Gold und Silberstickereien darauf verwandt wurde, um Putz und Kleiderschmuck der Fürstin so prachtvoll wie möglich auszustatten, können wir sehen, wenn wir einen Blick auf die fürstliche Garderobe werfen. Es bietet sich uns dazu das Inventarium der Garderobe einer Herzogin aus dem Jahre 1557 dar, aus dem wir nur einen mäßigen Auszug geben wollen. Wir finden den fürstlichen Kleiderschmuck in drei Klassen geteilt. Die erste enthält »die weiten Röcke« in großer Zahl, darunter besonders glänzend ein leberfarbiger Atlasrock mit Hermelin gefüttert und sehr reich mit goldenen und silbernen Schnüren besetzt, ein Staatskleid, das die Fürstin schmückte, wenn sie außer ihrem Schlosse erschien. Den reichsten Kleiderstaat der Fürstin umfaßte die zweite Klasse, »gestickte, enge Kleider«. Unter ihnen stachen hervor, ein gestickter Rock von Goldstoff, aufs welsche Muster gemacht, mit einem eine halbe Elle breiten mit Perlen gestickten Strich, auch um die Ärmel und um den Hals nebst dem Brustlätzlein oder Brusthemden mit großen schönen Perlen gestickt; ein Kleid von Goldstoff, Gold übergoldet, die Ärmel oben mit Perlen verbrämt; zwei Kleider von grauem und braunem Karmesinatlas, mit vier Strichen von goldenem Tuch verbrämt, mit goldenen und silbernen Schnüren gestickt, oben um den Brustlatz mit einem Perlengebräme; ein anderes von grauem Damast mit silbernem Tuch und schwarzem Samt weinrankenartig gezäunt und aufs welsche Muster gemacht; dann ein Kleid von grauem Taffet mit schwarzem Samt, daran ein Strich mit goldenen und silbernen Schnüren und mit gelbem Kattune unterlegt, mit einem Brusthemde, das auf den Ärmeln mit Perlen gestickt den Buchstaben A hat und um die Arme mit Perlen und goldenen Schnüren besetzt ist. Die dritte Klasse enthielt die Brusthemden teils von schwarzem oder leberfarbigem Samt mit silbernen und goldenen Schnüren oder goldenen Borten, teils von rotem Atlas mit blauem Goldstück, teils von braungoldenem Damast oder schwarzgoldenem Tobin.
Neben der Kleidung gab überdies auch zahlreicher und mannigfaltiger Putz und Schmuck den Fürstinnen vielfältige Beschäftigung; denn auch darin besorgten sie in der Regel alles selbst. Der Pretiosenschatz der meisten Fürstinnen war mit einem großen Reichtum von Edelsteinen, Gold- und Silberarbeiten und anderen Kostbarkeiten angefüllt. Erschien daher die Fürstin bei hohen Festen im vollen Staat, so boten dieser Schatz und die Garderobe alles dar, was nur irgend Schmuck und Glanz heißen konnte. Auf ihrem Haupte glänzten bald zwei Papageienfedern oder schneeweiße Enten- oder Kranichfedern, bald ein Perlenkranz oder auch ein mit Gold und Perlen geschmückter, gewundener Kranz; bald schmückte das Haupt auch eine Haube von Gold- und Seidenstoff mit Perlensternen und goldenen Schlingen. Den Hals umgab ein Halsband mit Smaragden, Saphiren, Rubinen und Perlen verziert, daran ein anderes Kleinod mit verschiedenen Edelsteinen, oder auch ein von Diamanten und Rubinen eingefaßter Adler. Die Schultern bedeckte ein Koller bald von Goldstoff, bald von Samt mit Silber oder goldenen Borten verbrämt, zuweilen mit Hermelin oder Marder gefüttert oder auch von weißem, golddurchwebten Damast, mit Marder unterlegt. Auf der Brust hielt dieses Koller ein goldenes Heftlein zusammen, das immer reich mit Smaragden, Saphiren, Rubinen und Amethysten besetzt und mit irgendeiner Figur geschmückt war; bald sah man daran »einen Landsknecht und ein Weiblein«, bald »den Ritter St. Georg«, bald »ein Schweizer Weiblein, einen Schwan«, und auch diese reich mit allerlei Edelsteinen verziert. Zuweilen umschloß den Hals ein übergelegter feingestickter Hemdkragen mit goldenen Borten, auf welchem dann goldene Ketten ruhten, die zum Teil mit Mühlsteinen und Kampfrädern, Feuerhaken von Gold, goldenen Birnen oder anderen Früchten geschmückt waren. In Sommerszeit umschlang die Brust ein Brusttuch mit Perlenborten in Laubgewinden, bald mit dem Bilde einer Jungfrau, eines Phönix, eines Schwans, eines Herzens, bald mit einer anderen Ausschmückung versehen. Über dem Brusttuch hingen dann die goldenen Halsketten mit Edelsteinen, welche zuweilen goldene und silberne Bildnisse von Königen, Königinnen und verwandten Fürsten oder auch den ersten Namensbuchstaben des fürstlichen Gemahls, in Perlen gestickt, umfaßten. Häufig waren dies Pariser Arbeiten. Die Ärmel schmückten künstliche Perlenstickereien, die allerlei Figuren bildeten, wie eine solche »mit einem Vogelfänger, vier Saphiren, fünf Rubinen, einer Smaragdlilie, drei Rubinrosen und einem dreieckigen Diamant, unter dem Vogelfänger drei Rubin- und Diamantrosen«; ein anderes, mit einer Jungfrau und einem Gesellen, hatte Reime mit goldenen Buchstaben. Die Hände der Fürstin schützten gegen Kälte und Sonne spanische Handschuhe – sie waren die beliebtesten – oder auch solche von sämischem Leder. Die Finger schmückten goldene Türkis-, Diamant- und Rubinringe. Den Leib umschloß der Gürtel von sehr abwechselnder Farbe, immer mit Goldstoff und Perlenarbeit in Blumen- und Laubgewinden, Perlenbuchstaben und Perlenzügen aufs künstlichste verziert und am Schlusse mit goldenen Ringen und Stiften versehen. Von schwarzem Samt verfertigt trug er zuweilen auch die ersten Namensbuchstaben des Fürsten und der Fürstin neben zwei gekrönten goldenen Herzen mit Laubwerk umschlungen. Er umfaßte bald den fürstlichen weiten Atlasrock, mit Hermelin gefüttert und mit goldenen und silbernen Schnüren besetzt, bald das engere Kleid von Karmesinatlas, schwarzem Samt oder Damast, meist nach welscher Mode mit weiten Ärmeln, immer reich verbrämt und mit Stickereien geschmückt. Den Fuß bedeckte der gestickte, oben mit Perlen und Edelsteinen gezierte Schuh.
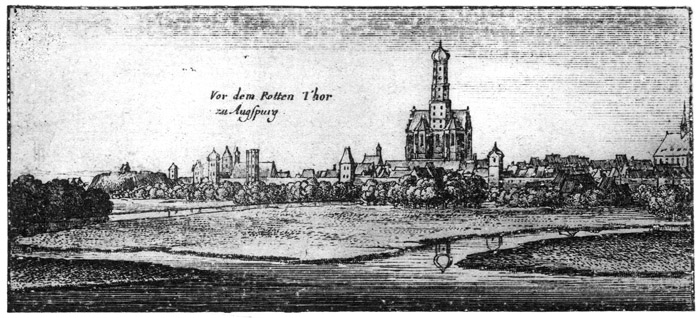
Hollar, Ansicht von Augsburg im 17. Jahrhundert. Kupferstich
Die schönsten und kunstvollsten Kleinodien wurden damals in Nürnberg verfertigt; wir finden daher die Fürstinnen mit den dortigen Pretiosenhändlern und Gold- und Silberarbeitern Arnold Wenck, Georg Schultheß, Rüdiger von der Burg und ebenso mit dem schon erwähnten Italiener Lorenzo de Villani in Leipzig in beständiger Korrespondenz. Eine Fürstin schickt einige Edelsteine, »weil sie etliche Krätze bekommen«, nach Nürnberg mit dem Auftrag, sie von einem Steinschneider rein und sauber auspolieren zu lassen; eine andere hat von einem Pretiosenhändler ein anscheinend schönes Kleinod zum Geschenk für einen Verwandten gekauft; allein die Billigkeit des Preises erweckt Verdacht; sie läßt es untersuchen und man findet, die Fürstin sei betrogen, es seien »Brillen« statt echter Edelsteine eingesetzt. Keine Fürstin war in ihren Bestellungen sorgsamer als die Herzogin Dorothea von Preußen; schickt sie dem Goldarbeiter in Nürnberg zwanzig ungarische Gulden und eine Anzahl Ringe, um sie zu einer Kette und einem Kleinod zu benutzen, so ordnet sie in einem langen Schreiben an, wie alles »aufs subtilste und mit Versetzung der Steine so künstlich als möglich verfertigt werden solle; oben in der Mitte solle ein Blümlein, nebenan Blätter und ein Stiel sein, die Spitzen aber so, daß man sich nicht daran reiße oder kratze.«
Auch die Gesundheitspflege nahm manche Stunden der Fürstinnen in Anspruch. Ein tüchtiger Arzt an einem Fürstenhofe war damals nicht allenthalben zu finden; die Apothekerkunst lag ebenfalls noch in ihrer Kindheit. Apotheken waren eigentlich mehr Zuckerbäckereien, die ihren größten Absatz in Zuckerwerk, eingemachten Früchten und Konfitüren fanden. Die Arzneimittelkunde befand sich daher meist in der Praxis der Laien. Man vertraute im Ganzen mehr auf die wirkende und abwehrende Kraft gewisser Stoffe aus der Tier- und Pflanzenwelt oder aus dem Mineralreiche als auf ärztliche Kunst. Fürstinnen, die am leichtesten in den Besitz solcher Stoffe und zur Kenntnis ihrer Anwendung in Krankheitszuständen kommen konnten, teilten sich solche gegenseitig mit. Unter die geschätzten Arzneimittel gehörten Klauen von Elentieren, Einhorn, Bibergeil, besonders auch Bernstein, zumal der von weißlicher Farbe. Da Preußen das Land war, woher man diese Stoffe am leichtesten erhalten konnte, so gelangten jährlich an die Herzogin von Fürstinnen aus Deutschland unzählige Gesuche um Mitteilung dieser Stoffe.
Es war bei manchen Fürstinnen eine Art von Lieblingssache, sich mit der Präparierung von allerlei Arzneimitteln zu beschäftigen, um nahe Verwandte und Freunde in nötigen Fällen damit zu beschenken. So kam die Mutter des Grafen Hans Georg von Mansfeld wegen ihrer Zubereitung von allerlei Arzneien in solchen Ruf, daß man sie die Mansfelder Doktorin nannte. Besonders wurden ihre stärkenden Wasser gerühmt, die bei Schlaganfällen gute Wirkung haben sollten. Sie schickte solche bis nach Preußen und schrieb dabei dem Herzog: »Euer Gnaden wollen das übersandte Wasser ja gebrauchen, weil's einen Menschen so sehr stärken soll; hin wieder wollen uns Euer Gnaden von dem gemeinen Bernstein etwas schicken; da will ich Euer Gnaden auch eine sonderliche Stärkung davon machen.« Auch die Herzogin Dorothea von Preußen beschäftigte sich viel mit Präparierung von allerlei Heilmitteln; bald sind es Heilsalben, die sie zu bereiten weiß, bald überschickt sie ihrem Vater, dem König von Dänemark, ihr erprobtes, wohltuendes Augenwasser, bald präpariert sie Pulver aus heilkräftigen Wurzeln und Kräutern für die fallende Seuche, bald wieder erfreut sie verwandte Fürsten und Fürstinnen mit ihren aus Kräutern, Blumen und Wurzeln zubereiteten stärkenden Wassern. So schreibt sie einmal dem Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, dem sie oft mit ihrem »Arznei-Dinglich«, wie sie es nennt, aushelfen mußte: »Hierbei übersenden wir Euer Liebden derselben Begehren nach etliche Gläser mit Rosen- und Lavendel-Essig, desgleichen Rosen- und Spiekenarden-Wasser, auch sonst noch ein gutes Wasser, das also überschrieben ist: Meiner gnädigsten Frauen Wasser, das aber Euer Liebden nicht in den Leib gebrauchen wollen, denn es allein darum, daß es die Hände, Angesicht und das Haupt damit zu frischen, gemacht ist; daneben auch etliche gute Rezepte für den Schwindel zur Stärkung des Herzens und für die Ohnmacht. Das Wasser für den Schlag wollen wir Euer Liebden auch gern schicken.« Die Arzneipräparate der Herzogin waren unter den Fürstinnen in Deutschland weit und breit berühmt. Die Landgräfin Barbara von Leuchtenberg, die viele Jahre lang mit dem Zipperlein an den Händen sehr geplagt war, erfährt kaum, daß die Herzogin von Preußen ein gutes Rezept zu einem sehr wirksamen Mittel gegen dieses Übel habe, als sie aufs dringendste bittet, ihr solches doch möglichst bald zukommen zu lassen. Ebenso nimmt die Fürstin Elisabeth von Henneberg, eine geborene Markgräfin von Brandenburg, die ärztliche Hilfe der Herzogin in Anspruch. Sie klagt ihr: »Mein Schenkel wird gar böse, hab' in vier Wochen nicht darauf getreten, bin auch mit dem Barbier nicht verwahrt, hab' keinen Doctor; der Barbier meines Herrn Gemahls weiß nirgend viel davon, ist ein zorniges Männlein und will niemand bei sich leiden.« Sie bittet daher die Herzogin um ihre berühmte Heilsalbe, die gegen solche Übel gut sein solle.
Statt der Arzneimittel selbst schickten Fürstinnen einander auch Rezepte. Die Herzogin Dorothea von Preußen war auch damit gegen ihre Freundinnen sehr freigebig. Bald sendet sie der Herzogin von Württemberg ein Rezept zur Verfertigung einer köstlichen Heilsalbe, bald überläßt sie dem Erzbischof von Riga ein Rezept zu Rosen- und Cordo-Benedikten-Wasser, »welches,« wie sie ihm schreibt, »für allerlei Krankheiten, sonderlich aber für Vergiftung sehr gut sein solle«. Die Doktoren sahen es indes nicht gern, wenn ihre Rezepte unter den Laien von einer Hand zur anderen wanderten. So hatte die Herzogin von Preußen einst viele Mühe, ein Rezept gegen den Schwindel, das ihr Bruder erbeten hatte, von ihrem Leibarzt zu erhalten. Endlich sandte sie es ihm zu, schrieb ihm aber dabei: »Wir haben es auch jetzund schwer von unserem Doctor erlangt, denn Euer Königliche Würde können wohl abnehmen, daß die Doctores ihre Künste, sonderlich in solchen Fällen, nicht gern anderen mittheilen.«
Einen anderen Teil der Zeit nahm die Korrespondenz der Fürstinnen hin, auf die wir einen Blick werfen müssen, weil sich auch in ihr Sitten und Bräuche der fürstlichen Höfe spiegeln. Wie die Fürsten, so faßten auch die Fürstinnen den größten Teil ihrer Briefe nicht eigenhändig ab, weil sie in der Regel eine schlechte, unleserliche Hand schrieben, und ihnen das Schreiben zu viel Anstrengung kostete. Geschäftsbriefe diktierten sie gewöhnlich ihren Sekretarien oder ließen sie durch diese entwerfen und unterschrieben eigenhändig nur ihre Namen und Titel und auch diese oft schwerfällig und unbehilflich. Schrieben sie ihre Briefe selbst, so finden wir in den meisten Sprache und Stil ungelenkig und voll Verstöße gegen die Grammatik. Vor allen zeichnen sich hierin die Briefe der Herzogin Dorothea von Preußen aus. Sie fühlt es selbst, wie dürftig und fehlerhaft ihre Schreibart ist, daher sie oft ihr Schreiben »ein ungeschicktes und närrisches« und sich selbst »eine schlechte, gar dumme, armselige Dichterin« nennt. Sie schämt sich dessen in dem Maße, daß sie in ihren Briefen wiederholt die Bitte hinzufügt: man möge ihre Briefe doch alsbald verbrennen, damit sie nicht in andere Hände kämen und sie »dadurch bei klugen Leuten zum Gespötte werde«.
Briefe von eigener Hand galten immer als Beweise von besonderer Freundschaft, von Huld oder auch von Artigkeit und wurden somit in manchen Fällen eine Pflicht. Daher verfehlte eine Fürstin selten, wenn sie von einer anderen ein eigenhändiges Schreiben erhalten, in ihrer Antwort für »das Schreiben mit eigener Hand« ihren besonderen Dank zu bezeugen. Ebenso unterläßt es eine Fürstin, wenn sie an eine Freundin oder einen Verwandten nicht mit eigener Hand schreibt, in der Regel nicht, sich deshalb zu entschuldigen. So heißt es in einem Briefe des Fräulein Kunigunde, der Tochter des Markgrafen Casimir von Brandenburg: »Ich bitte Euer Liebden zum freundlichsten, die wollen ohne Beschwerd seyn, daß ich mit eigener Hand nicht wieder schreibe, denn ob ich mich wohl meiner eigenen bösen und unleslicher Handschrift ohnedieß schäme, so hab' ich mir doch meiner gewesenen Schwachheit halben so viel zu schreiben nicht vertraut.« Die alte Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg, Joachims I. Witwe, entschuldigt sich in einem Briefe mit den Worten: »Wir bitten ganz freundlich, Euer Liebden wollen uns unseres nicht eigenen Schreibens, das wir wegen unserer großen Leibesschwachheit nicht vollbringen können, freundlich entschuldigt nehmen.« Aus demselben Grunde konnte sie in einem anderen Briefe (1552) nicht einmal ihren Namen eigenhändig mehr unterschreiben. Die Herzogin Dorothea von Preußen weiß immer eine neue Ursache, warum sie ihre Briefe nicht selbst geschrieben. Da heißt es in einem Briefe an die Fürstin von Liegnitz: »Wir sind nach Gelegenheit etwas schwach und mit der Hand, wie Euer Liebden wissen, zu schreiben nicht fast geschickt; zudem ist Euer Liebden unsere Sprache etlichermaaßen unbekannt. Derwegen und aus berührten Ursachen haben wir Euer Liebden aus der Kanzlei zu schreiben befohlen, freundlicher Zuversicht. Euer Liebden werden auf dießmal daran gesättigt seyn.« Bald wieder entschuldigt sie sich in ihren Briefen an ihren Bruder, den König Christian von Dänemark mit dringenden Geschäften oder »Ungeschicklichkeit ihres Hauptes«. Noch aufrichtiger ist sie in einem Briefe an den Markgrafen Wilhelm, Erzbischof von Riga, wo es heißt: »Euer Liebden wollen uns unseres eigener Hand Nichtschreibens freundlich entschuldigt wissen; denn Euer Liebden selbst wohl wissen, daß alte Weiber faul und träge und sonderlich mit der Feder nicht dermaaßen geschickt sind als die, so hochgelehrt.«
Auch in den eigenhändigen Unterschriften der Fürstinnen kommen mitunter manche Eigentümlichkeiten vor. Manche unterschrieben in der Regel ihre Briefe gar nicht oder doch nur selten mit eigener Hand. Andere schrieben ihre Namen abgekürzt, wie sie gewöhnlich genannt wurden. Manche Fürstinnen ließen ihren Namen und vollständigen Titel zuerst in der Kanzlei darunter schreiben und fügten dann eigenhändig ihren Namen hinzu, mit der Angabe ihrer eigenen Unterschrift. So lautet die Unterschrift Catharinas von Braunschweig: »Von Gottes Gnaden Catharina geborene Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg« und dann mit eigener Hand geschrieben: »Freulein Keitte mein eigen handt.« Dagegen schreibt sich die Herzogin Sidonie von Braunschweig eigenhändig: »Sydonia von Gottes Gnaden geborene zu Sachsen, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.« In einem lateinischen Brief der Herzogin Anna von Mecklenburg an den König von Polen finden wir die vollständige Unterschrift: Divina gratia Anna nata ex inclita Familia Marchionum Brandenburgensium, Ducissa Megapolensis, Principissa antiquae gentis Hennetae, Comitissa Suerini, Rostochiorum, Stargardiorum Domina. Dagegen pflegten andere Fürstinnen ihre Titel in eigenhändigen Unterschriften oft nur durch einzelne Buchstaben zu bezeichnen. So unterschreibt Catharina, die Gemahlin des Markgrafen Johann von Brandenburg, gewöhnlich nur: Katharina g. z. B. u. L. M. z. B. (geborene zu Braunschweig und Lüneburg, Markgräfin zu Brandenburg) und fügt hinzu: »Meine Hant.« Die Worte »von Gottes Gnaden« kommen selbst in Briefen von Töchtern an ihre Väter und Mütter vor, wenn sie in der Kanzlei abgefaßt wurden; dagegen erscheinen sie nie in eigenhändigen Briefen oder Unterschriften. Gemahlinnen der Kurfürsten nannten sich in ihren Briefen niemals als Kurfürstinnen. Die Gemahlin des Kurfürsten Joachims von Brandenburg unterschreibt sich also bloß: Elisabeth von Gottes Gnaden aus königlichem Stamme zu Dänemark geboren, Markgräfin zu Brandenburg, zu Stettin, Pommern usw. Herzogin; ebenso die Gemahlin des Kurfürsten Friedrichs III. von der Pfalz bloß: Maria Pfalzgräfin bei Rhein, Herzogin von Bayern, geborene Markgräfin zu Brandenburg. Auch die Benennung Prinzessin war damals noch ganz ungebräuchlich. Unverheiratete Fürstentöchter nannte man bloß Fräulein. Die Tochter des Markgrafen Casimir von Brandenburg Kunigunde unterschreibt sich daher auch selbst: Markgräfin zu Brandenburg und Fräulein in Preußen.
Im Briefstil der Fürstinnen herrschte steife Etikette, ein manieriertes höfisches Wesen, ein eigener in bestimmte Formeln gebannter kalter Hofton, zumal in solchen Briefen, deren Abfassung den an Kanzlei- und Kurialstil gewöhnten Sekretären überlassen war. Selbst in Briefen zwischen nächstbefreundeten Verwandten, sogar zwischen fürstlichen Eheleuten und Kindern durfte der steife Respektston mit seinen stereotypen Formeln und festbestimmten Höflichkeitsphrasen nie aus der Acht gelassen werden. Des traulichen »Du« bedienten sich in Briefen weder Eheleute noch Kinder. Wo es sich hier und da findet, war es ausnahmsweise gegenseitiges Übereinkommen, wie zwischen der Landgräfin Anna von Hessen und Herzog Albrecht von Preußen; und doch war dieser in seinen Briefen an sie in die gewöhnliche Anredeformel »Euer Liebden« zurückgekehrt, so daß ihm die Fürstin einst schrieb: »Euer Liebden tragen gut Wissen, wie unsere beide freundliche Unterrede hiebevor gewesen ist, daß unser kein Theil das andere in Reden und Schreiben »Ihr oder Euer Liebden«, sondern »Du« heißen soll und wie dasselbe höchlich verpönt worden. Da aber solches in Euer Liebden Schreiben mehr wenn zu einem Male gegen mich verbrochen und nicht gehalten ist, so will ich Euer Liebden derhalb bei einer Pön lassen und die von Euer Liebden fordern, der Zuversicht, sie werde mich derselbigen ihrer Bewilligung nach freundlich entrichten.«
Schreibt eine Fürstin an ihren Gemahl oder dieser an jene, so nennen sie sich gegenseitig »Euere Liebden« oder »Euere Gnaden«; ebenso reden Töchter ihren Vater mit der Höflichkeitsformel »Gnädiger Herr Vater« und »Euer Gnaden« oder »Euer Liebden« an. Selbst der fürstliche Titel wird in der Anrede nicht vergessen. So beginnen die Briefe des Herzogs Albrecht von Preußen an seine Gemahlin Dorothea gewöhnlich mit den Worten: »Hochgeborene Fürstin, freundliche und herzallerliebste Kaiserin, meine herzige Fürstin.« In ihren Briefen an ihren Gemahl lautet dagegen die Anrede: »Durchlauchtiger und Hochgeborener Fürst, mein Freundlicher und Herzallerliebster, auch nach Gott keiner auf Erden Lieberer, dieweil ich lebe, mein einziger irdischer Trost, alle meine Freude, Hoffnung und Zuversicht, auch mein einiger Schatz und aber- und abermals mein herzallerliebster Herr und Gemahl« oder sie nennt den Herzog: »Durchlauchtiger Fürst und Herr, mein allerliebster Schatz, Trost und Aufenthalt.« Dieser Herzenserguß in der Anrede war indes nur der überströmende Ausbruch der innigsten Liebe Dorotheas zu ihrem Gemahl. Die zweite Gemahlin Albrechts, Anna Maria, mit der er bei weitem nicht in so innigem ehelichen Glücke lebte, redet ihn gewöhnlich nur mit der kalten Formel an: »Durchlauchtigster Fürst, gnädigster Herr und Gemahl.« Selbst wenn Fürstinnen an ihre Söhne schreiben, wird neben der Anrede »freundlicher und vielgeliebter Sohn« der Titel »Hochgeborener Fürst« und die Formel »Euer Liebden« nicht unterlassen.
Mit Verwandtschaftstiteln waren die Fürstinnen gegeneinander sehr freigebig. Am allgemeinsten bedienten sie sich der Benennung »Muhme«, jedoch selten allein. Gewöhnlich folgen nach dem Titel »Hochgeborene Fürstin« noch die Benennungen »freundliche, vielgeliebte Muhme, Schwester und Geschwey« oder »freundliche, liebe Frau Muhme, Schwägerin und Tochter«. Unter nahen Verwandten war auch die Benennung »Buhle« in ihrer alten guten Bedeutung gebräuchlich. So nennt die Herzogin von Preußen ihren Bruder, den Herzog Johann von Holstein, »lieber Bruder und herzlieber Buhle«; den Markgrafen Wilhelm, Erzbischof von Riga, begrüßt sie ebenfalls mit »Herzgeliebter Herr und Buhle« und er entgegnet ihr mit der Anrede »Herzliebe Frau, Muhme und Buhle«. Selbst auf den Adressen der Briefe ward gewöhnlich dem Titel und Namen des Fürsten oder der Fürstin die Verwandtschaftsbezeichnung »unserem gnädigen und herzlieben Herrn Gemahl« oder »unserem freundlichen, herzgeliebten Sohn« oder »unserer lieben, freundlichen Muhme« noch besonders hinzugefügt. Nach der erwähnten Anrede im Briefe bildet den Eingang fast immer und ohne Ausnahme die feststehende Erbietungsformel: »Was wir in Ehren mehr Liebes und Gutes der freundlichen Verwandtniß nach vermögen, jeder Zeit zuvor« oder »Was ich in mütterlicher Treue mehr Ehren, Liebes und Gutes vermag, zuvor«.
Darf man von der Schreibart der eigenhändigen Briefe der Fürstinnen auf ihren Grad geistiger Ausbildung schließen, so fällt das Urteil nicht besonders günstig aus. An Gewandtheit und Abrundung im Stil ist bei den meisten nicht zu denken. Man fühlt es ihnen an der Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit ihrer Schreibart nach, welche Mühe es ihnen gekostet hat, einen Satz mit der Feder auf das Papier zu bringen. Doch bieten auch darin die Briefe der Fürstinnen ein gewisses Interesse dar. Sie schrieben gerade so, wie sie sprachen: Wie ihnen in ihrem Dialekte die Worte aus dem Munde rollen, so stehen sie auf dem Papiere da. Eine Herzogin von Mecklenburg also spricht und schreibt: »velghelevede Ohme, Hulpe, sust, Vroyde, Herscop (Herrschaft) velbether (viel besser) vorlene (verleihe)«. Wir hören die Kurfürstin Sybille von Sachsen selbst sprechen, wenn sie dem Herzog von Preußen schreibt: »Es geit uns noch mit allen unseren keynderen got hab lob wol dann weyr unsser sonne alle drey bey eynn ander habben und uns sust nycht velt dann das weyr den großen vatter auch bey uns hedden dor zü uns der lebe got frollich balde helffe mossen amen. Geschreben myt eylle datom Weymmer gegeben uff den donnersdach nach eleyssabeth ym 47 yar.«
Was den Inhalt der brieflichen Mitteilungen betrifft, so ist er ungleich einförmiger, unwichtiger und einfacher als wir in Briefen der Fürsten dieser Zeit ihn finden. Über politische Gegenstände und die großen Zeitereignisse schreiben die Fürstinnen selten. Sollte man nach den Briefen urteilen, so war die große Welt für sie gar nicht da. Sprechen sie zuweilen in ihren Briefen von den Erscheinungen der Zeit, so betreffen ihre Mitteilungen meist nur Glieder ihrer Familie oder Persönlichkeiten verwandter Fürstenhöfe. Auch über die kirchlichen Streithändel lassen sie sich selten aus oder es geschieht nur in beiläufigen Bemerkungen.
Ein großer Teil der Briefe sind bloße Musterbriefe, das heißt, sie enthielten nur Musterworte, worunter Versicherungen der Liebe, Freundschaft und Bereitwilligkeit zu allen möglichen Gefälligkeiten, Begrüßungen und Erkundigungen über Gesundheit und Wohlergehen der Familienangehörigen, Bezeugungen von Teilnahme an Familienangelegenheiten, freundliche Wünsche für das fernere Wohlbefinden des fürstlichen Hauses verstanden wurden. Diese immer in derselben Form wiederholten, stereotyp gewordenen Musterworte, geben den Briefen etwas unerträglich Langweiliges und Eintöniges. Diesen Eindruck machte das leere Etikettenwesen schon damals auf einzelne Fürstinnen selbst. So schrieb darüber die Herzogin Dorothea von Preußen an den Markgrafen Wilhelm, Erzbischof von Riga: »Unseres Erachtens ist zwischen wahren Freunden des vielfältigen und überflüssigen Erbietens gar nicht vonnöten; denn dieweil ja die Freunde im Grunde ihres Herzens gegeneinander in Liebe und getreuer Freundschaft unverrückt seyn und bleiben sollen, wie denn zwischen Euer Liebden und uns, ob Gott will, es ist, so achten wir solches Hocherbieten mehr überflüssig als nötig, und wollen's demnach mit unserem schwesterlichen, wohlmeinenden Erbieten gegen Euer Liebden bei dem lassen, wo wir Euer Liebden als unserem geliebten Herrn, Schwager und Bruder in allem Ziemlichen freundlich dienen können, soll die Freundschaft, ob Gott will, an uns nichts erwinden.«

Lucas Cranach d. J., Kurfürst Moritz von Sachsen. Holzschnitt
Zu einer großen Anzahl von Briefen gab die Sitte Anlaß, sich durch allerlei Geschenke zu erfreuen, durch Übersendung von Ehrengaben freundschaftliche Gesinnungen zu bezeugen oder was man gern zu besitzen wünschte, von einer befreundeten Fürstin als Geschenk zu erbitten. So war es damals Brauch, die Zimmer der Fürstinnen so zahlreich wie möglich mit den Porträts, den Konterfekten oder Konterfeiungen ihrer Verwandten oder befreundeter fürstlicher Personen zu schmücken. Da nun jeder bedeutende Fürstenhof seinen eigenen Porträtmaler oder Konterfekter hatte, so baten die Fürstinnen häufig um solche Familiengemälde. Hören wir die Fürstin Elisabeth von Henneberg in ihrer Bitte an den Herzog von Preußen: »Euer Liebden wollen auch ihrer Zusage nach die Conterfecten nicht vergessen; denn wiewohl ich der Ferne halber Euer Liebden Angesicht nicht wohl gehaben kann, so möchte ich doch gerne Euer Liebden Conterfect haben, denn ich Euer Liebden als meinen lieben alten Herrn und Freund immer gerne sehen möchte, wenn es die böse Zeit erleiden möchte.« Elisabeth dagegen macht zuerst die Konterfekte ihres Gemahls und ihres Vaters dem Herzog zum Gegengeschenk und einige Jahre später erfreut sie die Herzogin von Preußen mit ihrem eigenen Porträt als Neujahrsgeschenk.
Da es ferner Sitte war, daß sich Fürstinnen häufig sanfttrabender Pferde, die man Zelter nannte, zu Reisen oder Spazierritten bedienten, so gaben auch diese öfter Anlaß zu Bitten an solche Fürsten, von denen man wußte, daß sie damit versehen waren. So bedarf die verwitwete Herzogin Elisabeth von Sachsen, Gemahlin des Herzogs Johann von Meißen, eines guten Zelters. Sie wendet sich deshalb, weil sicher gehende Zelter in ihrer Gegend nicht zu erhalten seien, an den Herzog von Preußen. Ihre Bitte wird auch erfüllt; aber weil sie lange nicht an den Herzog geschrieben hat, so erhält sie dabei auch die Antwort: »Es ist wahr, wir sind etwas in Zweifel gestanden, daß Euer Liebden, dieweil sie mit ihrem Schreiben eine Zeitlang stille gestanden, unserer in Vergessen gestellt haben würden; so vermerken wir nun doch, daß Euer Liebden unserer, so sie vielleicht etwas bedürftig, noch eingedenk sind, nehmen aber Euer Liebden schriftliches Ersuchen doch zu hohem, freundlichen Dank an und sollen es Euer Liebden gewißlich dafür halten, daß wir nach Erlangung ihres Schreibens mit Fleiß getrachtet haben, ob wir irgend einen guten Zelter, damit Euer Liebden versorgt wäre, an uns hätten bringen mögen, haben aber keinen anderen bekommen, als den gegenwärtigen, den unser Diener Euer Liebden überantworten wird.« Die Herzogin aber war damit nichts weniger als gut versorgt; denn »als wir ihn haben versuchen und reiten wollen«, schreibt sie bald darauf, »hat er uns anfänglich nicht aufsitzen lassen und auch gar nicht zum Viertel gehen wollen, zudem ist er über die Maßen sehr scheu«. Sie ersuchte daher den Herzog um einen anderen, tat diesmal aber eine Fehlbitte; denn sie erhielt die Antwort: »Es ist uns nicht lieb, daß der übersandte Zelter die angezogene Unart an sich hat; wir wären auch aus freundlicher Verwandtniß nicht ungewogen, Euer Liebden ihrem Ansuchen nach mit einem guten, tüchtigen Zeller zu versehen. So haben wir alle unsere Zelter vertheilt, also daß wir jetzund selbst für unsere Person übel mit Zeltern versorgt sind.«
Außerdem erfreuten die Fürstinnen sich gegenseitig oder ihre Verwandten mit einer Menge anderer Geschenke, die, wenn sie uns befremdend erscheinen, damals doch sehr beliebt waren. Dahin gehören Leckereien, Konfitüren, eingemachte Früchte, mit deren Zubereitung die Fürstinnen sich oft selbst beschäftigten, oder auch sonstige seltene Eßwaren. So macht die Königin von Dänemark der Herzogin von Preußen mehrmals Geschenke mit Zucker, der König schickt ihr Rigaische Butten, die ein sehr beliebtes Geschenk waren; dagegen erfreut sie ihn bald mit Pfefferkuchen, eingemachten Kirschen, Äpfeln und Kriessen, bald mit einem Fäßchen eingemachter Krammetsvögel, womit sie auch oft den Herzog Johann von Holstein beehrt; bald überschickt sie ein Fäßchen mit Neunaugen, eingemachten Sachen, »die«, wie sie ausdrücklich hinzufügt, »sie mit eigener Hand selbst gemacht und zugerichtet habe«. Einmal sandte sie ihm ein Fläschchen mit einem Getränk zu und schrieb ihm dabei: »Wir überschicken Eurer Königlichen Würde auch zu einer Gesellschaft ein Fläschlein hiermit zu, sonderlich aus der Ursache, dieweil wir wissen, daß es bei Eurer Königlichen Würde ohne gute Trünke bisweilen nicht abgehe und auch Eure Königliche Würde sehen möge, wie eine große Trinkerin wir sind, die wir mit solchen Flaschen umgehen. Zudem schicken wir Eurer Königlichen Würde auch einen Fuß von einem Preußischen Ochsen, damit Eure Königliche Würde sehen mögen, ob die Dänischen Ochsen auch so einen großen Fuß haben wie die Preußischen.« Der König macht der Herzogin wiederum ein Gegengeschenk mit trockenen Fischen, nämlich Weichlingen, Schollen und zweihundert Stillrochen. Dieselbe Herzogin überrascht einmal den Markgrafen Wilhelm von Brandenburg mit einer Tonne voll großer Käse. Sie wird von der Herzogin von Holland mit einem Faß Wein beehrt und überschickt dieser dafür als Gegengeschenk ein Paar schöne Reitsättel.
Da es an fürstlichen Höfen Sitte war, zum Andenken verwandter oder befreundeter Fürsten und Fürstinnen Medaillen mit deren Bildnissen, die man gewöhnlich Schaupfennige nannte, am Halse und auf der Brust zu tragen, so dienten häufig auch diese als Gegenstände gegenseitiger Beschenkung. So überschickt die Herzogin von Preußen dem König von Dänemark im Jahre 1542 einen solchen Schaupfennig, worauf »ihre und ihres Gemahls Conterfeiung befindlich«, dabei dankt sie dem König für die ihr und ihrer Tochter verehrten Schaupfennige und verspricht, den ihrigen ihr ganzes Leben lang am Halse zu tragen. Ebenso trug der Markgraf Wilhelm von Brandenburg, Erzbischof von Riga, die ihm verehrte Schaumünze mit dem Bildnis der Herzogin von Preußen beständig auf der Brust.
Da die Herzogin von Preußen erfährt, daß die Gemahlin des Herzogs Christian von Holstein eine Freundin des Weidwerks sei, so überschickt sie ihr zum Neujahrsgeschenk ein sehr schön gearbeitetes Jagdhörnlein, dessen sie sich selbst bisher auf der Jagd bedient hatte; dem Herzog selbst aber, den sie ebenfalls als einen großen Jagdliebhaber kannte, verehrt sie ein mit vieler Kunst geschmücktes Auerhorn von einem Auer, den ihr Gemahl, Herzog Albrecht, mit eigener Hand erlegt hatte. Der König von Dänemark wird von ihr mit einem schönen Jagdpferd beschenkt. Sie sagt dabei, wie schwer sie sich von ihm trenne, da sie es selbst einmal vom Markgrafen Wilhelm zum Geschenk erhalten habe. Der König von Polen bat sich selbst von der Herzogin das Geschenk von einem Paar Leithunden zur Jagd aus. Da sie ihm gern gefällig sein wollte, solche Hunde aber in guter Art in Preußen nicht zu haben waren, so mußte sie den König von Dänemark bitten, ihr solche zwei Leithunde zukommen zu lassen. Als König Christian III. im Jahre 1533 den dänischen Thron bestieg, wußte ihn die Herzogin von Preußen, die ihm dazu aufs herzlichste Glück wünschte, mit nichts mehr zu erfreuen als mit einem Paar schöner Windhunde, die sie ebenfalls einst vom Markgrafen Wilhelm von Brandenburg aus Riga erhalten hatte und »die«, wie sie sagt, »so lange sie bei ihr gewesen, ihr sehr freudig zum Weidwerke gedient hätten«.
Auch zum bloßen Zeitvertreib machten Fürstinnen einander mit Hunden und Vögeln Geschenke. So weiß die Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg ihren Dank nicht verbindlich genug auszusprechen, als ihr einst der Hochmeister Albrecht von Brandenburg ein schönes weißes Hündchen zum Geschenk überschickt. Noch mehr freut sich die junge Herzogin Catharina von Liegnitz über »das Spaniolische Hündlein«, womit die Herzogin von Preußen sie »beehrt«. Diese will einmal auch die Königin von Polen mit einem Geschenk überraschen, allein sie kann lange Zeit »nichts Dienliches dazu« bekommen; endlich überschickt sie ihr ebenfalls zwei weiße Hündchen von der besten Art und rät, sie miteinander belegen zu lassen, damit sie die Rasse behalte. Papageien wurden sehr teuer bezahlt und dienten mitunter als fürstliche Geschenke. So erhielt das Fräulein Sophie von Liegnitz von der Herzogin von Preußen einen grauen Papagei, von dem die Herzogin ausdrücklich versichert, es sei »ein rechtschaffener, der da nicht gefärbt sey«, woraus man sieht, daß mit schön gefärbten Papageien Betrügereien getrieben wurden. Einer anderen fürstlichen Freundin schrieb dieselbe Herzogin: »Wir hätten auch gern einen Papagei geschickt, so ist derselbe doch so böse, daß niemand wohl mit ihm auskommen kann, wollen aber denselben auf eine andere Zeit, sobald er ein wenig abgerichtet ist, zu übersenden nicht unterlassen.«
Die Herzogin Anna Sophia von Mecklenburg macht ihrem Vater, dem Herzog Albrecht von Preußen, ein Geschenk mit zehn Tonnen Güstrowisches Bier, welches sie für ihn »mit sonderlichem Fleiße« habe brauen lassen; davon solle die Gemahlin des Herzogs zwei Tonnen und ihre ehemalige Kammerjungfer Anna Talau ebenfalls zwei Tonnen haben. Dem König von Dänemark überschickt die Herzogin Dorothea von Preußen zum Beweis, daß sie ihn noch nicht vergessen habe, bald ein Hemd oder einen Kranz, bald »ein schlechtes Paar Handschuhe«, bald zwölf Bernsteinlöffel, die sie für ihn »mit sonderlicher Kunst« hat machen lassen, und als sie erfährt, daß der König sämisches Leder zu Beinkleidern und ein Paar Stiefel, weil beides in Königsberg vorzüglich gut verfertigt wurde, bestellt habe, so kommt sie eilig dem Ankaufe zuvor und schickt beides dem König zum Geschenk, wobei sie ihm schreibt: »Dieweil wir uns denn je gerne gegen Eure Königliche Würde als die wohlmeinende, treuherzige Schwester erzeigen, wollten wir nicht unterlassen, zu mehrer Erweisung unserer schwesterlichen treuen Zuneigung, die wir zu Eurer Königliche Würde tragen, derselben etzliche Leder, als roth, leibfarbig, gelb, schwarz und geschmutzt, jeder Farbe zu einem Paar Beinkleider, daneben ein Paar gemachte Stiefel und noch zu einem Paar Leder zugerichtet, damit sie Eure Königliche Würde nach Ihrem Gefallen machen zu lassen, zu überschicken, freundliches und schwesterliches Fleisses bittend, Eure Königliche Würde geruhen solches von uns zu freundlichem Gefallen anzunehmen.« Ihre Mutter, die Königin von Dänemark, beschenkt dieselbe Herzogin einmal mit einem Paar Messer, »doch«, wie sie hinzufügt, »dergestalt, daß die zuversichtliche Liebe damit nicht soll abgeschnitten werden«.
Statteten Fürstinnen und Fürsten einander Besuche ab, so wurden die Besuchenden nebst ihrer Dienerschaft beim Abschied zum freundlichen Andenken beschenkt. Als der Markgraf Johann Georg von Brandenburg und dessen Gemahlin Sabine im Jahre 1564 den Herzog von Preußen mit einem Besuche beehrten, erhielt jener als Abschiedsgeschenk zwei Zimmer Zobeln, einen Ring mit einem Diamant und einer Rubin-Tafel, ein Reitpferd und Bernstein, die Markgräfin ebenfalls zwei Zimmer Zobeln, einen Ring wie ihr Gemahl, ein Kleinod oder Gehänge, einen Zelter und Bernstein. Da jedoch persönliche Bekanntschaften unter Fürstinnen damals seltener und mit ungleich größeren Schwierigkeiten als heutigen Tages verbunden waren, so knüpften Fürstinnen gern durch gegenseitige Geschenke untereinander nähere Bekanntschaft an. So übersandte im Jahre 1539 die Herzogin von Preußen der Herzogin Catharina von Sachsen, Gemahlin des Herzogs Heinrich von Sachsen, ein Bernstein-Paternoster und erhielt von ihr dagegen ein Geschenk »von Silber oder selbstgewachsenes gediegenes Erz«. Indem sie ihr dafür ihren Dank bezeugt, fügt sie hinzu, wie sehr sie bisher immer gewünscht habe, »mit ihr in Kundschaft zu treten, denn die Schickung des Paternosters von uns nicht anders denn zu Erkenntniß der Liebe, Freundschaft und zu Erlangung freundlicher Kundschaft gemeint und geschehen ist«.
Einen Fürsten um ein Geschenk zu bitten, trugen die Fürstinnen um so weniger Bedenken, da solche Bitten keineswegs als etwas Indezentes galten. Die Herzogin von Preußen bittet daher den König von Dänemark geradehin, er möge sie doch freundlich mit einer oder zwei Last guter Heringe bedenken. Hören wir, wie das Fräulein Helene, eine geborene Herzogin von Liegnitz, den Herzog von Preußen um ein ihr versprochenes Ehrenkleid mahnt, indem sie ihm schreibt: »Uns zweifelt gar nicht, Euer Liebden werden noch in frischem Gedächtniß haben, wasmaßen wir bei Euer Liebden verschienenes Jahr 1564 wegen eines Ehrenkleides, Bernsteins und Elendsklauen freundliche Ansuchung thun lassen; darauf sich auch Euer Liebden gegen uns mit Uebersendung etliches Bernsteins und einer Elendsklaue freundlich erzeigt. Das Ehrenkleid aber betreffend, haben sich Euer Liebden der damals eingefallenen Seuchen und gefährlichen Läufte halber, auch daß Euer Liebden in demselbigen gewöhnlichen Hoflager nicht gewesen, freundlich entschuldigt, daß Euer Liebden uns mit etwas hätten versehen können, uns aber zu erster Gelegenheit mit etwas, womit uns gedient werden möchte, zu versehen sich freundlich erboten. Demnach werden wir verursacht, Euer Liebden an die getane Vertröstung ferner zu erinnern, abermals freundlich bittend, Euer Liebden wollen uns mit dem Ehrenkleid in keine Vergessenheit stellen.« Die Äbtissin Ursula vom Kloster St. Clara, eine geborene Herzogin von Mecklenburg, wünscht sich einen gefütterten Mantel und schreibt daher dem Herzog Albrecht, dem sie ein Paar Zwirn-Handschuhe zum Geschenk überschickt: »Wir können Euer Liebden nicht bergen, daß wir glaubwürdig berichtet sind, daß in Euer Liebden Fürstentum und Landen viele Steinmarder gefangen werden sollen und wir derselbigen sechs Zimmer bedürftig sind, Mäntel zu füttern, da wir die Winterzeit inne mit Tag und Nacht zu Chor gehen möchten.« Mit weit größerer Dreistigkeit trat die Gräfin Georgia, eine Tochter des Herzogs Georg von Pommern, mit einer Bitte gegen den Herzog auf. Erst nach dem Tode ihres Vaters geboren, deshalb die Nachgeborene genannt und mit einem polnischen Grafen Stanislaus vermählt, lebte sie sehr einsam auf dem Schlosse zu Schlochau in Pommern. Es fast übel nehmend, daß der Herzog von Preußen nie mit einem Geschenk an sie denke, schrieb sie ihm zu Beginn des Jahres 1568 kurz vor seinem Tode: »Freundlicher lieber Herr Vater und Ohm. Ich hätte mich deß nicht versehen, daß ich im Sommer sogar eine Fehlbitte an Euer Liebden gethan hätte und daß ich so ganz eine abschlägige Antwort von Euer Liebden sollte bekommen haben, denn ich mich insonderheit viel Gutes zu Euer Liebden versehen habe als zu meinem lieblichen Herrn Vater. So gelanget nun nochmals an Euer Liebden meine freundliche und gar emsige und demüthige Bitte, Euer Liebden wollen mir sie nicht abermals abschlagen, denn ich würde hieraus nicht anders verstehen können, als daß ich gar kleine Gunst und Freundschaft bei Euer Liebden haben würde. Derhalben bitte ich Euer Liebden gar freundlich, Euer Liebden wollen mir bei diesem Boten eine fürstliche Verehrung schicken, dabei ich Euer Liebden gedenken möchte, denn es Euer Liebden ein kleiner Schaden ist und mir solches ein ewiges Gedächtnis seyn würde. Gott wird Euer Liebden solches reichlich wieder vergelten. Hiermit befehle ich mich in Euer Liebden Gunst. Euer Liebden wollen mich für Euer Liebden arme Tochter halten und meiner nicht vergessen; und ob Euer Liebden mir insonderheit günstig seyn werden, dasselbe will ich hieraus wohl ersehen und spüren, wo Euer Liebden mir etwas schicken werden.«
Wenn aus dem allen nun hervorgeht, daß das Leben der Fürstinnen gemeinhin still und ruhig hinging, so war für sie auch die Zahl der Vergnügungen sehr beschränkt. Fanden auch bei Hochzeiten oder beim Besuch fremder fürstlicher Gäste Hoffeste und Turniere statt, so kamen solche doch immer nur selten. Malerei betrieben die Fürstinnen zu ihrem Vergnügen gar nicht und auch Musik nur selten. Am meisten nahmen sie an Jagdvergnügungen Anteil, wobei sie auf ihren Zeltern im Jagdkleide mit dem Jagdhorn geschmückt erschienen.
Um sich stille Stunden zu verkürzen, hielten manche Fürstinnen ihre Hofnärrinnen, wie die Fürsten ihre Hofnarren. Eine solche wünschte sich auch die Herzogin Dorothea von Preußen und schrieb deshalb, als sie erfuhr, daß die Frau des Freiherrn Hans Kurzbach eine solche Närrin habe, an einen gewissen Sigismund Pannewitz: »Nachdem wir von Euerem Sohne verstanden haben, daß die edle und tugendsame, unsere liebe besondere Christina Kurzbachin eine feine Närrin bei sich haben soll, die sie uns zu überlassen nicht abgeneigt ist, so wollet Ihr für Euere Person allen möglichen Fleiß vorwenden, damit wir dieselbige Närrin als für eine Kurzweilerin von gedachter Kurzbachin bekommen mögen.« Ebenso wünschte einst die Königin von Dänemark eine solche Närrin an ihrem Hofe zu haben und wandte sich deshalb an die Herzogin von Preußen. Da diese indes in ihrem Lande keine auffinden konnte, so schrieb sie der Königin: »Hierneben thun wir unserer Zusage nach und aus besonderer Freundschaft und Zuneigung Eurer Königlichen Würde einen Knaben, der uns als für einen Zwerg gegeben ist, zuschicken. So er nun also klein und auch in seinen Geberden, wie er anfängt, bleibt, ist er nicht allein für einen Zwerg, sondern auch für einen Narren zu gebrauchen. So nun Eurer Königlichen Würde solcher gefällig, bitten wir aufs freundlichste, denselben in königlichen Befehl zu haben; da aber Eure Königliche Würde ein Mißfallen an ihm hätte, so wolle sie uns solchen wiederum zufertigen. Alsdann sind wir erbötig, Fleiß zu haben, ob wir einen besseren zuschicken möchten.«
Es gab auch damals an fürstlichen Höfen neben sehr glücklichen sehr unglückliche Ehen. Das Leben des Herzogs von Preußen weist beide nacheinander auf. Mit seiner ersten Gemahlin Dorothea lebte er in höchst glücklichen ehelichen Verhältnissen; sie war, man möchte fast sagen, eine wahrhafte Schwärmerin in ehelicher Liebe. Wir dürfen nur wenige Stellen aus ihren zahlreichen Briefen an ihren Gemahl ausheben, um zu zeigen, mit welcher innigen, sehnsuchtsvollen Liebe sie gegen ihn durchglüht war. Sie beginnt einen dieser Briefe mit folgenden Worten: »Durchlauchtiger und Hochgeborener Fürst, mein Freundlicher und Herzallerliebster, auch nach Gott keiner auf Erden Lieberer, dieweil ich lebe, mein einiger irdischer Trost, alle meine Freude, Hoffnung und Zuversicht, auch mein einiger Schatz und aber- und abermals mein herzallerliebster Herr und Gemahl. Euer Liebden, mein Allerliebster auf dieser Welt, seyen meine ganz freundliche, willige, hochbegierliche, verpflichtete, schuldige, gehorsame und eigenergebene, ganz freundliche und treuherzige Dienste zuvor, was ich auch mehr zu jeder Zeit ungespart Leibes, Blutes und Gutes, auch höchsten Vermögens vermag, sey Euer Liebden gänzlich und gar ergeben und zugesagt. Mein Herzallerliebster! Mit welch' herzlichen, begierlichen Freuden habe ich Euer Liebden Briefe in den heutigen Tagen empfangen, gelesen und verstanden, wie daß, Gott habe Lob, Euer Liebden noch in guter Gesundheit ist, welches mich (!) die größte Freude ist, die ich auf dieser Erde haben kann, und will auch Gott aus Grund meines Herzens danken für die große Gnade, die er mir armen Sünderin alle Wege bewiesen.« Dann fährt sie in ihrem Schreiben weiter fort: »Was großes, treuherziges Mitleid Euer Liebden mit mir trägt und sich selber wünschet, daß Euer Liebden wollte viel lieber selber krank seyn, als mich krank wissen und sich viel lieber selber den Tod wünschen als Euer Liebden mich wollte in einigerlei Beschwer wissen, so wäre Euer Liebden fleißige Bitte ohne Noth gegen mich, denn Euer Liebden weiß doch wohl, daß ich Euer Liebden eigenergebene Dienerin bin und mich schuldig erkenne, alles das zu thun, was Euer Liebden, meinem herzallerliebsten, einigen Schatz, Trost und all mein Hoffen, lieb ist. So tue ich mich auf das Erste ganz treuherzlich gegen meinen Herzallerliebsten bedanken der großen Treue, herzlichen Liebe und Mitleidung, die Euer Liebden mit mir armen Creatur hat, und ich weiß doch wohl, daß ich solch eine große Gnade um Gott nicht verdient habe, daß sich Euer Liebden um meinetwegen so hart bekümmert haben soll; auch weiß ich wohl, daß ich solch eine große herzliche Liebe und Treue nimmermehr wieder um meinen herzallerliebsten Herrn und Gemahl auf dieser Welt verdienen kann. Gott sey mein Zeuge,« fügt sie endlich hinzu, »daß ich viel lieber todt als lebendig seyn wollte, ehe ich wollte wissen, daß Euer Liebden sollte einigen Widerwillen meinethalben haben oder daß meinem Herzallerliebsten ein Finger wehe tun sollte.«

Monogrammist W. H. 15. Jahrhundert, Höfische Szene. Kupferstich
Bei weitem weniger glücklich und zufrieden lebte der Herzog mit seiner zweiten Gemahlin Anna Maria, der Tochter des Herzogs Erich des Älteren von Braunschweig. Zornig, leicht aufbrausend und hitzig, dabei verschwenderisch und leichtsinnig, machte sie dem Herzog oft schwere Sorgen und trübe Stunden. Es kam dahin, daß von ehelicher Liebe zwischen beiden kaum noch irgend die Rede war und sie meist getrennt von einander lebten. Diese unglücklichen Verhältnisse erzeugten aber in der Herzogin so düstere Schwermut, daß sie oft von allerlei finsteren und schreckhaften Phantasien gequält wurde. Ihre Mutter Elisabeth, welcher der Herzog sein trauriges Verhältnis schilderte, suchte sie zwar einigermaßen zu entschuldigen und versicherte, daß sie in ihrer Jugend nicht im mindesten eine Hinneigung zu einer solchen schwermütigen Stimmung gezeigt habe; sie schien indeß recht gut zu wissen, wo der Hauptgrund der Schwermut ihrer Tochter zu suchen sei, denn sie schrieb dem Herzog: »Ich gebe es vornehmlich dem Schuld, daß sie durch die großen Schulden, die sie gemacht haben soll, in die tiefen Gedanken kommt und sich doch vor Euer Liebden fürchtet, da sie nicht weiß, wie sie wiederum daraus kommen soll.« Sie fügte zwar noch den Rat hinzu, man möge ihr nicht viel Arznei geben, dagegen ihren Leib mit Öl, köstlichen Wassern und einer Kräuterlauge einreiben und waschen, sie vor hitzenden Gewürzen und starken Getränken hüten, da sie ohnedies von hitzigem Geblüte sei; allein als die Herzogin wieder genesen war, schien dem Herzog gegen den Rückfall doch ein ernsteres Mittel notwendig. Nachdem er nämlich früher schon die ansehnlichsten Schuldposten der Herzogin im Betrage von 19 000 Mark bezahlt hatte, tilgte er nun auch die übrigen Schulden zum größten Teil, legte aber zugleich ein Kapital von 4000 Mark als eine Art Vermächtnis für die Herzogin nieder, wovon sie die jährlichen Zinsen erhalten und mit diesen die noch übrigen kleinen Schulden bezahlen sollte. Es wurde bestimmt: es solle ihr außer diesen Zinsen noch ein jährliches Handgeld von 1200 Mark in Quartalzahlungen aus der Rentenkammer ausgezahlt werden; dagegen mußte sie versprechen, daß sie die Kammer mit keinen Forderungen mehr beschweren, auch nie ein Quartal voraus nehmen wolle. Weil die meisten Schulden durch leichtfertige Ankäufe entstanden waren, so schien es dem Herzog notwendig, hierin vor allem dem Leichtsinn seiner Gemahlin vorzubeugen. Er ließ daher von ihr durch eigenhändige Unterschrift das Versprechen geben, »daß sie hinfüro alle und jede Kaufmannshändel abschaffen, müssig gehen und durch Kaufen und Verkaufen durch sich oder andere in ihrem Namen ohne des Herzogs oder seiner Kammerräthe Wissen und Willen sich in nichts einlassen, viel weniger eine Verschreibung oder Handschrift auf getroffene Käufe, Gnadengeld oder anderes weder den Kammerjungfrauen, noch anderen Dienern oder Dienerinnen einhändigen und sich des überflüssigen und zum Theil unnötigen Verschenkens gänzlich enthalten wolle und solle.« Der Herzog fügte hinzu: »Die Herzogin soll auch hinfüro ohne unser Vorwissen keine Schulden machen oder hierüber uns und unsere Kammer mit Auslegung der Waaren oder anderswie belästigen; denn sollte es überschritten werden, so wollen wir die nicht bezahlen, viel weniger gestatten, sie vom Leibgut zu nehmen oder sie darauf zu setzen. Unsere geliebte Gemahlin soll und will auch ihr selbst zu Ruhm und Ehre auf unsere Ordnung des Frauenzimmers beständig halten und darob seyn, daß derselben in allen Punkten gemäß gelebt werde. Es soll hiermit abgeschafft seyn, daß keine Bürgerin, sie sey auch wer sie wolle, ohne unser Vorwissen mit unserer Gemahlin Gemeinschaft habe. Ihre Liebden haben sich auch derselben gänzlich zu enthalten verheissen und zugesagt.« In gleicher Weise fand der Herzog notwendig, zur Verminderung der Ausgaben der Herzogin ihren Hofstaat mehr zu beschränken. Sie durfte forthin keine Edelknaben oder Diener und Dienerinnen ohne sein Vorwissen annehmen; die bisher von ihr angenommenen wurden entlassen und die nötige Dienerschaft ihr vom Herzog zugewiesen. Ebenso wurde der Herzogin untersagt, »besondere Pfeifer, Organisten oder dergleichen Spielleute zu halten, weil wir«, wie der Herzog sagt, »unsere Musica ziemlicher Weise bestellt haben«. Er verordnete aber, daß seine Trompeter und Instrumentisten, so oft es die Herzogin verlange, zu ihrer Ergötzlichkeit ihr aufwarten sollten. Er fügte endlich auch noch die Bestimmung hinzu, daß der Herzogin für ihren Mund aus Küche und Keller die Notdurft, wie sie einer Fürstin gezieme, gereicht werden solle. »Dagegen aber«, hieß es, »soll Ihre Liebden sich des Überflusses gänzlich enthalten und keinen Wein, Gewürze, Zucker, Wildpret, Fische oder Fleisch ohne unser Vorwissen vergeben, verschicken oder verschenken; auch soll sich Ihre Liebden über das, was sie zu ihres Leibes Notdurft und für ihren Mund bedarf, weder in Küche noch Keller der Verschaffung nach oder sonst keine Regierung oder einen Befehl anmaßen, also auch sich aller anderen Händel, die zum Regiment gehören, sowohl jetzund als nach unserem Abschied von dieser Welt entäußern, weder Supplicationen noch anderes annehmen, sondern alles an uns oder unsere Räte verweisen.« ... Solche Maßregeln, wie sie der Herzog zu treffen genötigt war, dienen wohl hinlänglich als Beweis, daß sein eheliches Verhältnis nichts weniger als glücklich war.
Blicken wir in eine andere fürstliche Familie dieser Zeit, in die des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, so finden wir auch hier das eheliche Glück nicht ungetrübt. Gegen vierzehn Jahre lang hatte der Kurfürst mit seiner zweiten Gemahlin Hedwig, der Tochter des Königs Sigismund von Polen, in glücklichen ehelichen Verhältnissen gelebt. Nachdem sie aber im Jahre 1549 durch ein Unglück lahm und siech geworden war, so daß sie an Krücken gehen mußte und vom ehelichen Umgange mit ihrem Gemahl abgehalten wurde, hatte dieser die Bekanntschaft einer Frau gemacht, die, eine geborene Anna Sydow, früher an den kurfürstlichen Zeugmeister und Stückgießer Michael Dietrichs vermählt gewesen war. Seitdem war alles eheliche Glück vernichtet; denn das Verhältnis des Kurfürsten zur schönen Gießerin wurde ein so vertrautes, daß sie von ihm Mutter mehrerer Kinder ward. Je mehr aber der Kurfürst sich durch ihre Reize fesseln ließ, um so tiefer fühlte die Kurfürstin das Unglück ihres ehelichen Verhältnisses und um so mehr bot sie alle Mittel auf, ihren Gemahl aus den Banden, die ihn umschlangen, loszureißen. Das vertraute Verhältnis, in welchem der Herzog von Preußen bisher immer zum Kurfürsten gestanden hatte, gab ihr dazu einige Hoffnung. Sie wandte sich indes, um nicht Mißtrauen bei ihrem Gemahl zu erwecken, nicht unmittelbar an den Herzog selbst, sondern an den mit diesem sehr vertrauten Marienburgischen Woiwoden Achatius von Zemen, mit der Bitte, ihm ihre traurigen Verhältnisse vorzustellen und ihn zu bewegen, durch irgendein geeignetes Mittel auf ihren Gemahl einzuwirken. Hören wir sie selbst, wie sie über ihren Schmerz und ihre unglückliche Lage spricht: »Wir mögen Euch nicht bergen,« schrieb sie am Mittwoch nach Marci 1563 an Zemen, »daß es mit der bewußten Sache, als wir Euch vertraut haben, immer ärger wird und ist nie so arg gewesen als jetzt, denn wir mögen Euch mit Wahrheit schreiben, daß unser vielgeliebter Herr und Gemahl nicht eine Meile ziehen kann, dasselbige Weib muß mit ziehen; und ist an dem nicht genug; wenn seine Gnade schon hier ist, so sind sie selten eine Nacht von einander, denn seine Gnade schläft gar selten in unserer Kammer. Ist derhalb an Euch unsere freundliche Bitte, wollet uns guten Rath mittheilen, denn Gott weiß, daß wir der Sache halben ein großes Herzeleid haben. Wir bitten Euch lauter um Gottes willen, wollet Euch nicht beschweren und der Sache halben zum H. v. Pr., (Herzog von Preußen,) ziehen und mit seiner Liebden deshalb unterreden, daß wir seine Liebden lauter um Gottes willen bitten lassen, so es möglich ist, uns in unserer großen Not zu rathen, denn wir sind leider Gott geklagt in diesem Lande ganz trostlos und haben keinen Menschen, der uns in unserem großen Herzeleid raten will, und dürfen es auch nicht verdenken, denn wir besorgen, es bleibt nicht verschwiegen. Wir bitten deshalb noch, wollet allen Fleiß neben dem Herzog von Preußen anwenden, daß man dasselbige Weib wegbringen möchte, denn wir besorgen, wo das nicht geschieht, ist keine Besserung, denn sie hat es durch ihren Zauber arg und so weit gebracht, wo sie eine Stunde voneinander sind, so ist seine Gnade traurig. Lange ist es noch verborgen gewesen, aber jetzt ganz öffentlich und es stund darauf, daß sie mit auf die Krönung ziehen sollte. Gott aber gab, daß sie hart krank ward. Wir bitten derhalb, wollet dieß alles mit dem Herzog von Preußen reden und seine Liebden darneben bitten, er wolle sich jetzo der Sache halben gegen unseren vielgeliebten Herrn und Gemahl im Schreiben nichts merken lassen, denn es hilft ganz nichts. Es ist uns jetzt vor drei Tagen gesagt, daß sich seine Gnaden beklagt hat, wie daß der Herzog von Preußen an seine Gnade geschrieben hätte und der Sache gedacht, daß seine Gnade ganz böse ist auf uns gewesen und hat gesagt, es wäre durch uns geschehen, wir hätten Euch geschrieben und Ihr hättet es an den Herzog von Preußen gelangen lassen. Wir bitten auch daneben, wollet Euch jetzo gegen Kaspar Reibnitz nichts merken lassen, denn wir sind davor gewarnt, daß er nicht schweigen kann. Gott weiß, daß wir's nicht gerne thun, daß wir's von uns schreiben; aber die große Not erfordert es und bitten nach wie vor, wollet neben dem Herzog von Preußen rathen, daß sie möchte heimlich aus dem Lande kommen. Dies alles können wir Euch aus betrübtem Herzen nicht bergen und befehlen Euch in den Schutz des Allerhöchsten, der spare Euch lange gesund, mit Wünschung viel tausend guter Nacht. Wir bitten, wollet diesen Brief keinem Menschen sehen lassen als dem Herzog von Preußen.« – Am Schlusse ihres Briefes fügt die Kurfürstin in einer Nachschrift noch hinzu: »Wir mögen Euch aus betrübtem Herzen nicht bergen, daß heut Dato unser lieber Herr und Gemahl in desselbigen Weibes Hause bei ihr diese Nacht gewesen und da geschlafen und hat den Morgen da mit ihr gegessen. Das ist noch nie geschehen und ich besorge, daß es nun wohl mehr geschieht. Deshalb könnet Ihr wohl denken, was es uns für eine große Beschwer ist, daß es so öffentlich wird und daß uns der Schimpf widerfährt. Wenn sie mit auf die Jagd zieht, so fährt sie mit unserem lieben Herrn in seinem Wagen und hat sich angethan, wie eine Mannsperson, daß wir uns besorgen, daß wir's nicht länger im Haupte können vertragen und daß wir uns befürchten müssen, daß wir unserer Sinne beraubt werden, da ja der liebe Gott vor sey. Der liebe Gott weiß unsere Not, die wir darüber leiden.«
Wenn es hier Verletzung ehelicher Treue war, die alles häusliche Glück der Kurfürstin untergrub, so hatte in der Familie des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg, der auch in ehelicher Treue für seinen Sohn kein Muster war, religiöser Zwiespalt allen häuslichen Frieden zwischen ihm und seiner Gemahlin Elisabeth vernichtet. Während Joachim in der Lehre Luthers die Quelle alles Unheils für Kirche und Staat zu erkennen glaubte, war die Kurfürstin insgeheim eine entschiedene Anhängerin dieser neuen Glaubenslehre und sie wurzelte ihr um so tiefer ins Herz, je mehr sie ihre Gesinnungen in sich verschließen und vor ihrem Gemahl verbergen mußte. Aber um so mehr wallte auch in diesem der wilde Zorn auf, als sein lange gehegter Argwohn ihm endlich zur Wahrheit wurde und er in seiner Gemahlin eine Ketzerin erkannte. Schon im Herbst des Jahres 1525 war ihm über die Kurfürstin alles klar und im fürstlichen Hause herrschte der größte Unfriede. Wie sehr alles eheliche Glück zerstört und alle Bande ehelicher Liebe zerrissen waren, spricht sie selbst in einem Briefe an den zur Lehre Luthers offen übergetretenen Herzog Albrecht von Preußen aus: »Ich gebe Euer Liebden aus christlicher Liebe auf allem Vertrauen in großem Geheim zu erkennen, daß Euer Liebden Vetter, mein Herr mir ganz gefähr und feind ist um das Wort Gottes und muß dadurch viel Verfolgung und Schmachheit leiden. Könnte mich seine Liebe um Seele, Ehre, Leib und alle Wohlfahrt bringen, das täte seine Liebe von Herzen gerne und habe solches selbst aus seinem Munde gehört, daß er zu mir gesagt hat: ich solle mich hüten des Besten als ich kann; aber ich solle mich nicht so wohl können vorsehen, er wolle mir doch etwas beibringen lassen. Ich will auch wohl glauben, so es an ihm gelegen wäre, er würde seinen Worten in dem wohl nachkommen. Was Gott will, das geschehe. Ich fürchte mich nicht; mein Christus wird mich wohl bewahren. Ich will auch glauben, es geht meinem Sohn auch nicht viel anders; aber sie sind nun wieder Freunde miteinander. Sie haben nun beide eine Wahrsagerin, die soll ihnen Beiden alle zukünftigen Dinge sagen und was sie träumt, das muß alles wahr seyn; es muß sich kein Mensch verantworten und bringet manchen um Seele, Leib, Ehre und Gut. Noch ist es alles gut, fürchte mich aber, sie wird noch Vater und Sohn um den Hals dazu bringen. Bitte Euer Liebden durch Gott, Euer Liebden wollen als ein christlicher Fürst und als mein Vertrauen zu Euer Liebden ist, hierin handeln, damit es von mir nicht auskommt; es geht fast wunderlich und seltsam zu.«
Einige Wochen später schrieb die Schwerbekümmerte an denselben Fürsten: »Wollte Christus meinen Herrn erleuchten, daß seine Liebe zu rechter Erkenntnis Gottes und seiner selbst kommen möchte; das wäre mir die höchste und allergrößte Freude auf Erden. Können Euer Liebden dazu etwas Gutes tun oder raten, so wollen Euer Liebden nicht Fleiß sparen.« Dieser Wunsch indes wurde der Fürstin nicht erfüllt; vielmehr wie der Kurfürst, nach ihrem eigenen Zeugnis, von Vergiftung gesprochen hatte, so soll er ihr auch mit ewiger Einmauerung gedroht haben. Sie entwarf daher den Plan zur Flucht nach Sachsen und er wurde auch glücklich, wenngleich nicht ohne Gefahr ausgeführt. Sie schrieb darüber am 3. April aus Torgau an den Herzog von Preußen: »Euer Liebden ist unseres Erachtens ungezweifelt wohl bewußt, daß uns bisher eine Zeitlang von dem Hochgeborenen Fürsten Herrn Joachim Markgrafen zu Brandenburg und Kurfürsten, unserem Herrn und Gemahl, vielmals und durch manchfaltige Wege und Weise Beschwerung und merkliche Kümmerniß zugestanden und begegnet. Wiewohl wir aber allwege in guter Hoffnung gestanden, der allmächtige, ewige, gütige Gott werde dieselben Sachen bei unserm Herrn und Gemahl auf die Wege richten und verfügen, wodurch die drangselige Noth und Beschwerung, die durch seine Liebden gegen uns vorgenommen, zur Besserung gewandt und wir also bei einander der Gewissen halber einträchtig und friedlich, wie sich vor Gott und der Welt wohl gebührt, hätten bleiben und leben mögen, so haben wir doch vermerkt und endlich befunden, daß sich dieselben irrigen Sachen nicht geringert, sondern von Tag zu Tag je mehr beschwerlich gemehrt und dermaaßen zugetragen, daß wir daraus eigentlich verstanden, daß unsers Gemahls Gemüt und Wille dahin gerichtet und endlich auch entschlossen gewesen, vielleicht durch Anleitung vieler bösen Leute, mit uns dermaaßen zu handeln, daß unserem Gewissen, auch dem Heil der Seele und dazu unserer Ehre und Leib beschwerlicher, unverwindlicher und unerträglicher Nachtheil erwachsen und aufgelegt werden würde, unangesehen, daß wir uns vielmals zu öffentlichem Verhör erboten und auch mit höchstem Fleiß oft seine Liebden durch den Durchlauchtigsten König zu Dänemark, unseren einigsten, herzallerliebsten Herrn und Bruder, haben ersuchen und fürbitten lassen, welches aber alles bei seiner Liebden unangesehen und unfruchtbar gewesen. Aus dem allen und solcher vorfallender Noth sind wir zuletzt höchlich bedrängt und verursacht worden, zu Errettung unserer Seele, unseres Gewissens, Leibes und Ehre, auch aus menschlicher Furcht und mehr genügsamen Ursachen, uns von unserem Herrn und Gemahl, wiewohl mit hochbekümmertem Gemüte und Trübsal, auch von unseren beiderseits liebsten Kindern zu wenden und uns durch Hülfe, Rath und Förderung unseres lieben Herrn und Bruders zu dem Hochgeborenen Fürsten Herrn Johann Herzog zu Sachsen und Kurfürsten, als zu unserem Herrn Vetter, vertrauten Freund und nächsten Blutsverwandten zu begeben.« Sie bittet darauf den Herzog von Preußen, dies als die wahren Ursachen ihrer Flucht anzusehen und fügt endlich hinzu: »Wo Euer Liebden einige gute Mittel und Wege, die da christlich, ehrlich, löblich und gut, nicht wider Gottes Gebot und Gewissen wären, zu finden wüßten, damit diese Irrung freundlich, gütlich und friedlich beigelegt und endlich vertragen werden möchte, dazu erbieten wir uns alles dasjenige, so Euer Liebden neben anderen unseren Herren und Freunden, die wir auch zu ersuchen Willens sind, nach Gestalt und Gelegenheit der Handlung und Sachen erwägen, bedenken und für christlich, ehrlich, billig und gut ansehen, ohne alle Widerrede, Ausflucht oder einige Weigerung zu verfolgen und denselbigen nachzukommen.«
Auch dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung. Die Fürstin lebte sieben Jahre von ihrem Gemahl getrennt, bis sein Tod (1535) das unglückliche Verhältnis löste. Aber auch nachher leuchtete der frommen Dulderin kein freundlicher Stern im Leben wieder. Sie kehrte zwar, von ihren Söhnen, dem Kurfürsten Joachim II. und dem Markgrafen Johann eingeladen, in ihr Land zurück. Allein Kummer und Gram hatten nicht nur ihre Gesundheit untergraben, sie war fast ganz erblindet und mußte acht Jahre lang von einer Stelle zur anderen getragen werden, sondern sie lebte auch in den drückendsten Vermögensumständen, in einer Armut, die kaum glaublich sein würde, wenn wir nicht darüber ihr eigenes Zeugnis hätten. Sie schrieb dem Herzog von Preußen: »Wir zweifeln nicht, Euer Liebden haben längst wohl erfahren, daß uns der Schlag gerührt hat und so wir leben bis auf Ostern, so haben wir acht Jahre Nacht und Tag also gelegen und sind nicht ferner von der Stelle gekommen, denn so weit man uns hat tragen können. So haben wir seitdem dazu die Gicht, das Podagra und Krämpfe bekommen, daß wir solches Zahnreißen und Brechen haben, darob sich alle verwundern. Die mit uns umgehen, sagen, sie haben dergleichen Krankheit nie gehört. Wir vermerken an uns täglich wohl so viel, daß unseres Lebens nicht mehr ist. Wiewohl wir unseres Abscheidens täglich gewärtig sind, so haben wir uns in dem allem in den gnädigen Willen Gottes mit Leib und Seele ergeben. Dieweil wir uns haben unterstanden, die Haushaltung anzunehmen, so haben wir weder Heller noch Pfennig. Wir müssen auch nicht gebrauchen weder Schäferei noch Fuhrwerk, haben dazu weder Schloß, noch Stadt, weder Garten, Acker, noch Wiesen. Jetzt auf künftige Michaelis soll uns das erste Geld des Quartals verlassen werden, davon wir unsere Haushaltung und Nahrung einkaufen sollen, hat man uns aufgehoben und weggenommen und wir kriegen nichts davon; sollen jetzt Ochsen, Kälber, Hammel, Schweine, Gänse, Hühner, Butter, Käse, Wein und Bier, Würze und allerlei Notdurft haben, nichts davon wir's nehmen. Stube und Kammer haben wir und nichts mehr. Zwischen hier und Ostern haben wir in unsern Händen nicht so viel, daß wir ein Ei dafür kaufen mögen. So müssen wir sammt den Unseren, wo Gott uns nicht sonderlich hält, Hungers halber verschmachten und sterben. Das haben wir Euer Liebden nicht mögen verhalten. Doch mögen wir Euer Liebden mit Grund der Wahrheit anzeigen, daß es uns so hart und nahe zwei Jahre nach einander ergangen ist, daß wir Hungers halber erstorben und ganz und gar verschmachtet sind, davon nicht zu sagen ist. Es wissen's unsere Diener und Dienerinnen sehr wohl, die unsere Zeugen seyn sollen, daß dem also ist. Nun wollen wir Euer Liebden ganz demütig bitten um Gottes und seines heiligen Wortes Ehre willen, Euer Liebden wollen ihre Augen der Barmherzigkeit zu uns armen Wittwe wenden und doch womit nach ihrem Gefallen unsere hohe und groß dringende Notdurft freundlich bedenken und die Belohnung von Christo unserm treuen Heiland nehmen, bittend hierauf bei unserem Boten Euer Liebden freundliche Antwort, mit Bitte, Euer Liebden wollen dieses unser Schreiben bei sich behalten.«

Lucas Cranach d. J., Königin Maria von Ungarn. Holzschnitt
Sehen wir auf andere Fürstenhöfe dieser Zeit, so herrschte an ihnen zwar nicht solcher Unfriede und solche Störung alles ehelichen Glückes wie in den Familienverhältnissen des Kur-Brandenburgischen Hauses, allein häufig kämpften die Fürstinnen, während die Fürsten die besten Kräfte ihres Landes auf Kriegsrüstungen verwenden mußten, in der Heimat mit Kummer und Not. Die Pfalzgräfin Maria vom Rhein, Gemahlin des nachmaligen Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz, war schon im Jahre 1550 in solchen finanziellen Bedrängnissen, daß sie den Herzog von Preußen um eine Geldanleihe ansprechen mußte. Sie versprach die Summe möglichst bald wieder zu erstatten und erhielt sie. Allein es ging kaum ein Jahr vorüber, als neue Geldverlegenheiten sie abermals drangen, sich mit einer neuen Bitte an den Herzog zu wenden: »Ich klag' Euer Liebden als meinem herzallerliebsten Herrn Vater und Vetter, daß ich jetzt auf meines lieben Vetters des Landgrafen Ludwig Heinrich Heimführung etwas Unkosten mit Kleidung auf mich gewendet habe, daß ich ungefährlich zweihundert Gulden schuldig bin. Haben mir auch solche Leute zugesagt, mir zu borgen bis in die Herbstmesse, worauf ich mich verlassen; so haben sie mir ungefährlich vor drei Wochen solches Geld aufgeschrieben und weiß ich nun nicht, wo hinaus. Habe meiner Freunde etliche darum angesprochen und geschrieben, ist mir aber überall versagt worden, und ob ich schon meinen herzlieben Herrn und Gemahl anspreche, so hat es seine Liebe in der Wahrheit nicht, denn sein Herr Vater giebt ihm nichts, als was seine Liebe bedarf. Ist deshalb meine ganz freundliche und fleißige Bitte an Euer Liebden als meinen herzallerliebsten Herrn Vater und Vetter, wenn es ohne Euer Liebden Schaden seyn kann, daß mir Euer Liebden solche zweihundert Gulden wollen vorstrecken. Ich will es all' mein Lebenlang wieder um Euer Liebden verdienen, und bitte Euer Liebden wollen mir's nicht vor übel haben, daß ich also stets an Euer Liebden bettele. Ich will mein Lebenlang nichts mehr an Euer Liebden begehren, Euer Liebden helfen mir nur diesmal aus der Not. Ich habe meinen herzlieben Vetter Markgraf Hans Albrecht verloren, der ist mir sonst auch also zu Hülfe kommen. Ich bitte Euer Liebden auch ganz freundlich, wollen mir solches mein Schreiben nicht vor übel haben, denn es zwingt mich wahrlich die große Not dazu; das weiß Gott im Himmel wohl.«
Den Herzog Albrecht rührte die dringende Klage der verwandten Fürstin, er sandte ihr die zweihundert Gulden mit der Bitte, ihm dieselben zur nächsten Herbstmesse wieder zukommen zu lassen, »da er selbst mit großen Geldsplitterungen und Ausgaben beladen sey«. Allein es war kaum wieder ein Jahr vorüber, als Maria den Herzog von neuem um vierhundert Gulden bat, wobei sie bemerkte: Gott habe ihr zehn Kinder gegeben, sechs Söhne und vier Töchter, wovon noch vier Söhne am Leben seien; aber sie gehe jetzt wieder groß schwanger und werde auf Neujahr niederkommen. Der Herzog schlug ihr zwar diesmal die Bitte ab, sich entschuldigend, daß er gerade jetzt zu viele Ausgaben habe. Allein die Pfalzgräfin schrieb ihm von neuem: Sie und ihr Gemahl hätten zur Erledigung eines Teiles ihrer Schulden einen Ring verkauft, den ihr der Kaiser geschenkt und wofür sie 2000 Gulden erhalten habe; damit hätten sie ihre Schulden ein wenig bezahlt. »Aber,« fährt sie fort, »ich habe jetzt wahrlich wieder zweihundert Taler leihen müssen, habe ich anders zu meiner herzlieben Schwester, der Markgräfin zu Baden zu ziehen Zehrung haben wollen. Gott weiß, wo ich's noch überkomme, deß ich's bezahle. Man will mir auch nicht länger borgen denn bis auf Johannis des Täufers Tag des 1553sten Jahres, so soll ich's wieder erlegen.« Der Herzog Albrecht hatte ihr geraten, ihre traurige Lage ihrem Schwager anzuzeigen und ihn um Hilfe zu bitten. »Das hilft nichts«, antwortete sie ihm, »mein herzlieber Herr und ich haben es unserem lieben Bruder Markgraf Albrecht geklagt, wie es uns geht; so giebt er uns den Rath, wir sollen uns leiden, es werde etwa nicht lange werden. Aber lieber Gott, es geht dieweil seinen Weg dahin, daß, wenn er stirbt, wir zweimal mehr Schulden finden, als wir in unserem ganzen Fürstentum Einkommen haben. In Summa es geht uns wahrlich sehr übel. Wollte Gott, daß es Euer Liebden wissen sollte; es ist nicht möglich, daß es ein Mensch glauben kann, als der es sieht oder dabei ist. Ich hätte Euer Liebden viel davon zu schreiben, so ist's der Feder nicht zu vertrauen.« Nach dieser Schilderung ihrer Not bittet Maria nochmals aufs dringendste um Aushilfe mit zweihundert Talern, indem sie abermals versichert, sie wolle dann ihr ganzes Leben lang nichts mehr vom Herzog verlangen.
In einer nicht minder drückenden Lage befand sich der Fürstin Schwester Kunigunde, die seit dem Februar 1551 mit dem Markgrafen Karl von Baden vermählt war; denn dessen Vater, Markgraf Ernst von Baden, hatte ihnen so wenig zu ihrem fürstlichen Unterhalte zugesichert und verweigerte ihnen so ganz alle Beihilfe, daß sie, um sich und ihr Hofgesinde notdürftig zu unterhalten, Schulden auf Schulden häufen mußten. In gleicher Weise hören wir die Herzogin Ursula von Mecklenburg, Witwe des Herzogs Heinrich von Mecklenburg, über ihr großes Elend klagen, in dem sie sich kümmerlich behelfen müsse. Auch die Fürstin Katharina von Schwarzburg, eine geborene Gräfin von Henneberg, wußte sich in ihrer Not im Jahre 1560 nicht mehr zu helfen. Um ihre drei Töchter auszustatten, hatte sie vom Grafen von Solms, ihres Vaters Schwestersohn, ein Anlehen von 3000 Gulden aufgenommen und noch 1000 Gulden dazu geborgt. Die ganze Summe sollte zur Leipziger Ostermesse gezahlt werden. Die Zeit kam heran; allein sie sah keine Möglichkeit, die Schuld zu entrichten. Sie bat den Grafen um Aufschub; dieser wollte ihn nur gewären, wenn ihr Bruder Graf Ernst von Henneberg für sie gut sagen wolle, daß er die Schuld nach ihrem etwaigen Tod bezahlen werde. Allein der Bruder schlug dies ab unter dem Vorgeben, daß er sich in einem Vertrage gegen die Fürsten von Sachsen verbindlich gemacht habe, weder selbst zu borgen, noch für jemand Bürgschaft zu leisten. Nun wußte die Fürstin durchaus keinen Rat. Aus eigenem Vermögen konnte sie die Schuld nicht tilgen; denn sie hatte dieses bereits mit ihren Kindern geteilt, so daß sie, wie sie selbst erklärte, »ganz und gar in Unvermögen war«. Sie wandte sich daher unter jammervollen Klagen und flehentlichen Bitten an den Herzog von Preußen um wenigstens ein Anlehen von 3000 Gulden.
Auch des Herzogs eigene Tochter Anna Sophia, Gemahlin des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg, befand sich im Jahre 1564 in großer Not. Sie schrieb ihrem Vater: »Mein herzallerliebster gnädiger Herr und Vater, ich bitte Euer Gnaden auf das allerkindlichste, Euer Gnaden wollen mir aus Gnaden zu Hülfe kommen mit 300 Talern, daß ich doch möchte aus dieser Beschwer kommen. Die große Noth dringt mich dazu. Ich wollte Euer Gnaden sonst nicht damit beschweren; aber ich kann nichts in dieser Kriegsrüstung von meinem Herrn bekommen; er muß Alles dem Kriegsvolk geben. Wo Euer Gnaden mich verläßt, so weiß ich gar keinen Rat.«
Noch trauriger war das Los der Herzogin Katharina von Liegnitz, einer geborenen Herzogin von Mecklenburg. Ihr Gemahl, Herzog Friedrich von Liegnitz, saß in Breslau auf Befehl des Kaisers in strenger Gefangenschaft. Keiner seiner Diener durfte in seiner Nähe sein und niemand ihn besuchen; nur die Herzogin, ihre älteste Tochter und der jüngste Sohn konnten zuweilen zu ihm kommen. Da man den Herzog gezwungen hatte, der Herrschaft über sein Land zu entsagen, so lebten sie in drückender Not. »Die arme, betrübte und elende Fürstin«, wie sie sich selbst nennt, sah sich genötigt, sich an den Herzog von Preußen teils wegen Verwendung zur Befreiung ihres Gemahls beim Kaiser, teils um einige Unterstützung zu ihrem und ihrer Kinder Unterhalt zu wenden. Sie schilderte ihm ihre große Not mit dringender Bitte, sich ihrer zu erbarmen, schon im Sommer des Jahres 1559. Allein es gingen mehrere Jahre hin, ohne daß sich ihre trostlose Lage änderte. Auch im Anfange des Jahres 1562 schmachtete ihr Gemahl noch im Gefängnis; sie selbst lebte in den kümmerlichsten Verhältnissen in Liegnitz, von wo sie einst dem Herzog von Preußen schrieb: »Wir haben keinen Hofmeister und keine Hofmeisterin mehr, sondern nur noch eine Jungfer um uns. Wir hatten nur noch ein kleines Büblein um uns, das uns getreu war; das mußte aber auch weg, und so haben wir nun keinen getreuen Menschen mehr bei uns. Wenn Eure Liebden wissen sollten, wie es uns geht, es würde Euer Liebden erbarmen.« Sie ersucht den Herzog, er möge sie wo möglich bei sich aufnehmen, da sie so ganz und gar verlassen sei, und sich beim Kaiser für ihres Gemahls Freilassung eifrigst verwenden. Endlich bittet sie flehentlich, der Herzog möge ihr doch, um ihre schreiende Not einigermaßen zu mildern, wenigstens mit etwa hundert Talern aushelfen.
Ein nicht minder unglückliches Los ward auch der Herzogin Elisabeth von Braunschweig-Lüneburg, einer Tochter des Kurfürsten Joachim I. zuteil. Sie war bis zum Jahre 1540 die Gemahlin des Herzogs Erich des Älteren von Calenberg, dem sie einen Sohn, Erich II. oder den Jüngeren, geboren hatte. Nach ihres Gemahls Tod war sie seit dem Jahre 1546 mit dem Grafen Poppo von Henneberg vermählt und nannte sich seitdem auch meist Gräfin von Henneberg, obwohl man ihr auch häufig den Titel einer Herzogin von Münden gab, weil ihr von ihrem ersten Gemahl das Schloß zu Münden als Leibzucht verschrieben war. Sie lebte aber schon seit Jahren mit Herzog Heinrich dem Jüngeren von Wolfenbüttel in Zwiespalt, der endlich so weit getrieben wurde, daß der Herzog sich des Wittums der Fürstin bemächtigte und sie die Flucht ergreifen mußte. Sie fand weder Schutz und Rückhalt bei ihrem Bruder, dem Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg, noch Beistand bei ihrem Sohne Erich, der niemals Beweise besonderer kindlicher Liebe gegen seine Mutter gab und überdies mit Herzog Heinrich in einer Verbindung stand, die ihn an keine kindlichen Pflichten denken ließ. Schon im Jahre 1551 klagt sie dem Herzog von Preußen ihre große Not: »Ich kann nicht mehr,« schrieb sie ihm, »das weiß Gott, der mir so wahr helfe aus aller meiner Not. Ich bin ganz bestürzt darüber und bitte um Gottes willen, Euer Liebden helfe und rate mir daraus. Wo mich Gott und Euer Liebden darin verlassen, so bin ich ganz verlassen. Euer Liebden entziehe sich doch nicht von ihrem Fleisch und sey mir doch barmherzig darin. Hier ist wohl Mitleid zu haben. Gott hilf mir aus dieser Not. Ich weiß bei Markgrafen Hans von Brandenburg nichts zu erhalten. Hätt' ich's so wohl als er, ich wollt's ihm so sauer nicht machen.«
Herzog Albrecht hatte Mitleid mit der von Kummer niedergedrückten Fürstin. Da er hörte, daß sie in ihrem Haushalt oft Mangel an den nötigsten Bedürfnissen leide, so sandte er ihr im Herbst des Jahres 1552 zwei Faß Stör, zwei Faß Öl, ein Faß Lachs, zehn Stein Wachs und ein Fäßchen Muskateller, mit der Bitte, dies freundlich von ihm anzunehmen. Er schrieb ihr dabei: »Wir finden in Euer Liebden Schreiben, wie Euer Liebden durch Herzog Heinrich zu Braunschweig und seinen Sohn in ihrem Wittum und Morgengabe beschwert und aus derselben ganz und gar entsetzt worden, welche Beschwernis uns wahrlich zum herzlichsten mitleidig ist, und muß es den lieben Gott im Himmel erbarmen, daß solche unchristlichen Vornehmen unter den Christen, sonderlich Deutscher Nation, als die zuvor vor anderen Nationen ihres großen Bestandes wegen gerühmt worden, im Gebrauche sind und in unfriedlichen Zeiten selbst fürstliche Weibspersonen, welche wahrlich von den Alten mit hohen Freiheiten begabt wurden, nicht verschont werden sollen. Weil aber die Welt Welt ist und bleibt, kann es vielleicht wohl seyn, daß etliche meinen, der liebe Gott habe um deßwillen das Kreuz über Euer Liebden verhängt.«
Alle Versuche der Freunde Elisabeths, die Beraubte wieder zum Genuß ihrer Güter zu führen, blieben ohne Erfolg. Sie irrte unstät umher, bald in Schleusingen bei dem bejahrten Grafen Wilhelm, dem Vater ihres Gemahls, bald in Hannover, und überall begleiteten sie Not und Kummer. Es hatte auch wenig Erfolg, daß sich der Landgraf Philipp von Hessen beim Herzog Heinrich für sie verwandte, denn wenn ihr dieser, wie es scheint, auch einen geringen Teil ihres Leibgedinges zukommen ließ, so lebte sie doch noch im Jahre 1554 in so kümmerlichen Verhältnissen, daß sie dem Herzog von Preußen klagte: »Ihre Schreiber könnten vor Kälte nicht schreiben, denn sie hätten kein Holz; daraus könne man schließen, wie es ihr gehe.« Sie wandte sich auch an die Herzogin von Preußen mit der Bitte, bei dem Herzog durch ihr Fürwort für sie ein Anlehen von etwa 2000 Gulden auszuwirken. Allein der Herzog, damals eben bei der bevorstehenden Vermählung seiner Tochter mit großen Ausgaben beladen, mußte ihr diese Bitte abschlagen. Ganz trostlos über diese vereitelte Hoffnung schrieb sie ihm: »Ich armes, verjagtes und betrübtes Weib leide wahrlich allhier große Not, ich kann keine Woche (das ich mit Wahrheit schreibe) unter hundert Gulden Münz zukommen, denn Alles ist teuer und überteuer. Ich schäme mich, daß ich's klagen muß, daß ich solche Armuth leide, denn der Markgraf oder mein Sohn können mir jetzt nicht helfen, wie gerne sie es auch täten, denn ihre Liebden haben selbst großen Schaden und Verlust.« »Euer Liebden Schreiber,« heißt es in einem anderen Brief, »hat mein Elend so befunden, daß er selbst sagte: es sey nicht möglich, daß es einer glauben könne, wie er's befunden. Ich habe kein Feuer, kann am Tage vor eins oder zwei Uhr nicht zu essen kriegen, mangele Holz und Kohlen, niemand mag sie mir zuführen. Huren und Buben haben genug, aber ich leide Mangel. Ich verhoffe zu Euer Liebden noch alles Gute und daß Euer Liebden viel zu treuherzig sind, um mich ums Brot gehen zu lassen. Ich habe noch einen weiten Perlenrock mit gar großen Perlen. Den hat Euer Liebden Gemahlin wohl gesehen; ich gönnte ihn Euer Liebden Gemahlin und ihren Kinderlein am liebsten. Er hat 600 Loth Perlen, ist schön gemacht und wäre Schade, daß er zerschnitten werden sollte, kostet mich selber 6000 Thaler; den wollte ich Euer Liebden lassen um 4000 Thaler und zwei davon schenken. Will ihn aber Euer Liebden nicht haben, so schreibe mir's Euer Liebden sofort, so will ich ihn verkaufen, denn die Noth dringt mich dazu.« Ehe aber Elisabeth hierüber noch Antwort vom Herzog erhielt, bittet sie ihn in einem neuen Schreiben aufs flehentlichste, er möge ihr mit einer Summe von 5000 Thalern aushelfen, damit sie in Hannover ihre Schulden bezahlen und sich nach Ilmenau begeben könne, »denn hier dient es mir gar nicht; ich muß tote Fische essen, leide große Armut, Hohn und Spott, auch Frost, habe keine Unterhaltung und geht mir, wie man sagt: Klugemann Schademann. Gott bessere es!« Diese traurige Lage Elisabeths dauerte auch noch in den Jahren 1554 und 1555 fort. »Drei Wochen«, klagt sie einmal, »haben wir kein Fleisch in unserer Küche gehabt und haben an Holz empfindlichen Mangel leiden müssen«, und in einem anderen Brief schreibt sie: »Zwei Jahre haben wir hier in Hannover im Elend verlebt und das Angst- und Bettelbrot brechen müssen.«
Doch genug der Klagen von Fürstinnen, um zu zeigen, daß der Palast auch nicht immer vor Not und Kummer schützte; und – zugleich auch genug der Skizzen, Zeichnungen und Schattierungen zu einem Sittengemälde des sechzehnten Jahrhunderts; »die Palette zeigt die Farben bunt und grell, sanft und mild; ein künftiger Meister mag sie, wie ihm beliebt, zum Bilde mischen und ordnen.«