
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Daß Keime nicht zum Blühen kommen – ach, das kommt vor!
Daß Blüten nicht zu Früchten werden – ach, das kommt vor!
Spruch des Confucius (551–478 v. Chr.)
Den 12. September im Lager 88. – – Es ist vorbei, all mein Hoffen, alle die Träume sind zerronnen! Alle Vorsicht, alle Mühe, alles war umsonst. Ich bin beraubt. Ich stehe fast hilflos auf der öden Tschang tang. – Dutzende Male stellte ich heute meine unterwegs gezeichneten Kartenblätter zusammen, beriet meine englischen, russischen, Hedinschen Karten, um genauer festzustellen, wo wir sind, wie weit ab von Ts'aidam.
Gestern bin ich weich gegen mich gewesen und ließ am Morgen den Befehl zum Rasten geben, denn die Wade, in die drei Zähne des Bären eingedrungen waren, schmerzte, und mit dem Auf- und Absteigen vom Pferde wollte es schlecht gehen. Ich lag nach einer unruhigen Nacht am Morgen lesend auf meinen Pelzen. Plötzlich stürzten die Leute mit dem Schreckensruf ins Zelt: »Tschaba! Tschaba!« (Räuber! Räuber!).
Sofort springe ich auf und renne in meinen Pyjamas mit Mauserpistole und Karabiner, den Patronengürtel um den Hals, den Räubern entgegen. – Zu spät schon! – Die Entscheidung war bereits gefallen. Ich sah meine Tiere weithin zerstreut ganz am Fuße der Berge. Ich sah von links und rechts, aus allen Schluchten, hinter allen Felsgraten hervor Schwärme von Tibetern auf kleinen zähen Pferdchen mit gellendem Geschrei dahergaloppieren und meine Tiere einkreisen. Meisterhaft hatten sie ihren Plan ausgeheckt und ausgeführt, daß keiner auch nur einen Augenblick zu früh den scharfen Augen meiner Leute auffiel. Die Räuberbande hatte sorgsam einen Moment abgepaßt, in dem die Herdenwache, um ein Halfter zu holen, in das Lager zurückgegangen war und sich, meinem oft wiederholten Befehl zum Trotz, gerade wieder kein einziger Mann bei den Tieren befand.
Wir rannten, was wir konnten, auf die Herde zu, aber die Entfernung war zu groß, und wie läuft man in Montblanchöhe! Aus dem Sattel schossen die Reiter ihre Gabelflinten auf uns ab. Mit affenartiger Geschwindigkeit lösten sie die ledernen Koppeln meiner Pferde und Maultiere und trieben alles in die Berge hinein, auf deren Gipfel es jetzt mit einem Schlage von Feinden wimmelte. Es gelang uns nur noch, sechs Yak den Räubern abzutreiben. Wegen eines Pferdes stürzten noch einmal zwanzig Räuber aus einer Seitenschlucht heraus. Auch meine Leute hatte die Verzweiflung mutig gemacht. Sie wollten sich auf einen verwundeten, aus dem Sattel gestürzten Tibeter werfen; die Behendigkeit jedoch, mit der seine Freunde diesen auf dem Pferde festbanden, rettete ihn vor der Wut meiner Chinesen.
Noch hofften wir in einem Augenblick, die Schafe zu halten, allein von Westen her jagt ein neuer Haufe und greift die dummen Tiere, die den Yak nachrennen, auf. Auch unser lebender Proviant ist uns damit genommen. Auch sie verschwinden wie die Yak und die Pferde in einer tiefen Schlucht in den Bergen.
Eine kleine Felsrippe quert diese Schlucht nahe ihrer Mündung. Hinter ihr sind einige Feinde abgesessen und begrüßen uns mit surrenden Blei- und Kupferkugeln. Wir umgehen sie und klettern keuchend weiter den Hang hinauf. Mein Herz schlägt, daß mir fast schwarz vor den Augen wird. Kurz vor dem Gipfel des über 200 m hohen Berges breche ich kraftlos zusammen. Immerzu werden wir von oben beschossen. Mit bewunderungswürdiger Geschicklichkeit hatten sie dort aus herumliegenden Steintrümmern Masken errichtet, die einem liegenden Schützen täuschend ähnlich sahen, so daß wir auf diese mehrmals anlegten. Aber nur aus den Zwischenräumen zwischen den Masken wurde auf uns gefeuert, und nach jedem Schuß wechselten die Tibeter den Standpunkt. Für uns aber wollte sich keine Deckung zeigen; schon war Gu pai tse getroffen.
Als wir endlich doch die Höhe erreicht hatten, war meine Herde schon auf den nächsten Berg getrieben, und die Nachhut verschwand eben unten in dem dazwischenliegenden Talgrunde im toten Winkel. An eine weitere Verfolgung war nicht zu denken. Wir mußten rasch zurück in das leerstehende Lager, um wenigstens dieses zu sichern. Ich konnte nur noch feststellen, daß es über 120 Räuber waren, die uns angegriffen hatten. Sie zogen in südöstlicher Richtung ab, der Gegend zu, in die wir Ende August gekommen waren. Die Haartracht, die Kleidung und die Schuhform war ganz dieselbe wie die der Yüchü von damals.
Während des Rückzugs zum Lager hörten wir plötzlich einen dumpfen Knall. Wir konnten nicht entscheiden, woher er rührte, von Feinden war nichts zu sehen. Meine Chinesen aber riefen: »T'ien gu siang leao!« (Die Himmelstrommel hat geschlagen.) »Diese ist immer zu hören,« sagten sie, »wenn eine große Sünde begangen worden ist.« Im Jahre 1895 während des Mohammedaneraufstandes in Hsi ning fu sei auch öfters die Himmelstrommel zu hören gewesen, auch nachdem der Aufstand niedergeschlagen worden war. Daß sie nun wieder ertönt war, richtete meine Leute auf und ließ sie hoffen, daß wir noch nicht verloren seien, daß ihr »t'ien hwang ye« sie noch nicht ganz verlassen hatte.
Es dunkelte, als wir wieder im Lager waren. Kein Mensch sprach, aber jeder schluchzte. Die Nacht verging mir ohne Schlaf. Konnte ich vielleicht doch noch weiter vorwärts dringen? Kann ich nicht doch noch meinen ursprünglichen Plan ausführen und nach dem Selling ts'o und in die großen weißen Flecke Westtibets durchstoßen? Wenn ich dies trotz aller Unbill durchführe, kann ich dabei auch noch wissenschaftliche Resultate erhalten? Muß ich nicht allzuviel von der Ausrüstung, von den Instrumenten, von den photographischen Platten und Büchern zurücklassen? Und wenn ich mit den wenigen geretteten Tieren nicht so weit nach Westen ausholen kann, wo kann ich mir neue Yak, neue Pferde verschaffen? Ich war weit näher an dem zum Lhasa-Gebiet gehörenden Nag tschü ka als an Ts'aidam. Werden mir die Tibeter, wenn ich dort angekommen bin, Tiere verkaufen und zu welchem Preis? Sicherlich wird man meine Notlage ausnutzen. Ich überschlug mein kleines Kapital, das ich bei mir hatte. Es wäre mir nach dem Kauf der neuen Karawane für die weitere Reise zu wenig mehr übriggeblieben. Am Morgen stellte ich aber dennoch der Mannschaft die Frage und erklärte, weiterziehen zu wollen. Das Unglück aber hatte alle kleinmütig gemacht. Sie verzweifelten an meinem guten Stern, und kniend flehten sie mich an, den Rückzug nach Ts'aidam zu versuchen.
Sechs Tage blieben wir in dem mir unvergeßlichen Lager 88 (Tafel XVIII). Es galt auszusuchen, was wir mitnehmen konnten, was zurückgelassen werden mußte. Wir packten Kiste, um Kiste, Warenballen um Warenballen aus. Da waren noch für 45 Tael Messer aus Dankar – jeder bekam jetzt ein neues, das er sich auslesen durfte –, da waren noch ganze Seidenballen, Drellstücke in mehreren Farben, seidene Gürtel, Garne, Porzellannäpfe, Ziegeltee allein für 25 Tael, eine Last Kandiszucker, eine Last getrocknete Hamitrauben. Da kamen Spiegel heraus, Rosenkränze, Farbenschachteln und alles, was ich aus eigener Erfahrung und vom Hörensagen wußte, daß es in Tibet gangbarer sei als Geld und Barrensilber.
Was wir nicht mitnehmen konnten, warfen die Leute auf einen großen Haufen. Dreißig Pfund Pulver wurden dazugeschüttet und einige hundert Stück Jagdpatronen.
»Ach, was habe ich mich in Schanghai, in Lan tschou und Hsi ning und Kue de abgemüht!« schrieb ich am 15. September in mein Tagebuch. »Keine Zeit und kein Geld habe ich gespart, um mich so vollkommen als möglich für die große Reise auszurüsten. Umsonst war alles gewesen. Ein Tibetersturm hat die Tiere weggefegt: 19 Pferde und Maultiere in bestem Zustand, 41 rüstige Yak und 30 Ziegen und Schafe. Wir stehen jetzt weit, weit ab von jeder menschlichen Behausung in einem ungastlichen Hochtal von 4500 m. Und wo sind wir? Noch weiß ich es nicht genau und kann auf die ängstlichen Fragen meiner Begleiter nur unbestimmte Antworten geben. Ich hoffe aber, in den hohen Bergketten im Norden eine Lücke zu finden und durch diese in die Tädschinär-Gegend von Ts'aidam zu gelangen. Bei täglich 20 km könnten wir – so glaube ich – in zwölf Tagen dort sein.
Meine Leute passen nun scharf auf und treiben die sechs wiedereroberten Yak stets vom Berge ab zum Lager hin. Wenn sie es nur auch am 11. September getan hätten, als ich verletzt in meinem Zelte lag. Der Chinese wird sorglos, sobald sich ein paar Tage keine Gefahr zeigt. Jetzt geht es nach dem chinesischen Sprichwort: ›dsëi tso leao kwan men‹ (wenn die Diebe fort sind, schließt man die Tür).
Den ganzen Tag wird eifrigst genäht. Aus meinem bunten Drell werden Hosen und Jacken geschneidert. Wer meine Leute in Europa sehen würde, würde sie für verrückt halten. Sie haben nun knallrote Blusen mit grünen Kragen an, und zu blitzblauen Hosen trägt gar einer eine grasgrüne Jacke mit ockergelbem Kragen. Auch für die Hunde werden Sättel mit Taschen gemacht; in diesen sollen sie mir Patronen nachtragen. Aus den Ledersäcken, in denen der Proviant mitgebracht wurde, schneidern wir uns ›luo tse‹ zurecht, Bundschuhe, wie sie die Hsi ning-Leute zu Hause tragen. Sie sollen uns bei dem langen Fußmarsche das Gehen erleichtern, denn alle fürchten, in unserem bisherigen schweren Schuhwerk fußkrank zu werden.
Hartnäckig schlugen die Hunde heute nacht an, und schußbereit warteten wir, daß die Bande zurückkehre, um sich in den Besitz der Lasten zu setzen. ›Arro!‹ riefen wir in die Nacht hinaus. ›Tauscht unsere Tiere gegen Silber ein!‹ – ›Gebt Antwort, oder wir schießen!‹ Da aber zischten nur Kugeln an uns vorbei, und häßliche Verwünschungen und wüstes Lachen gellten uns in die Ohren. Auch am Tage war es nicht möglich, mit den Räubern zu unterhandeln. Sie saßen wie Aasgeier, die auf ihre sichere Beute warten, droben auf den Bergen.
Meine Mannen haben ein großes »sang«, ein Streuopfer, angezündet, um die Götter zu bewegen, uns eine glückliche Rückkehr nach Ts'aidam zu gewähren. Sie haben einen hohen Altar auf dem nächsten Hügelchen gebaut und auf ihm unter Anrufungen und Gebeten Thujazweigchen und Tsambakügelchen, Tsamba-ts'ats'a und Tsamba-smonlam hkor verbrannt. Dann, ehe wir abzogen, haben sie in heller Wut die sechzig ledigen Sättel aufeinandergetürmt und angezündet. Eine Kiste Stearinkerzen, eine Kiste Alkohol, Kampfer, Naphthalin, eine halbe Last botanisches Papier flog in das prasselnde Feuer. Hellauf loderten auch die Zelte und die Kisten. Zischend explodierten die Pulverbeutel. Goethes »Faust«, das Neue Testament, Nietzsches »Zarathustra«, Köppens »Buddhismus«, Richthofens »Führer« gingen in Flammen auf. 1500 Pfund Mehl, Gerste und Reis, chinesische Nudeln und ein Sack Zucker und Butter wurden teils verbrannt, teils in den Bach geschüttet. Als die Flammen nun auch auf meine Sammlungen und Sammelapparate und auf die Trophäen übergriffen, als sie die Insektenschachteln, die Schmetterlinge und Käfer, meine sorgsam präparierten Bärenhäute, meine Wildyak-, Ovis Poli-, Antilopenfelle versengten, nahm ich rasch mein schweres und ungewohntes Ränzel auf und kehrte dem Unglückslager den Rücken.
2 km lag das Lager hinter uns, da näherten sich ihm vorsichtig die tibetischen Hyänen. Zu Fuß, wie wir waren, konnten wir natürlich gegen sie nichts ausrichten. Sichtlich wichen die Tibeter jeglichem Zusammenstoß aus. Wir zogen nun genau nordwärts. Aber langsam, ach, erschreckend langsam ging es vorwärts, quer über die kaum merklich wellige, beinahe vegetationslose Talung. Jedes der kleinen Bächlein, das sich in zahllosen engen Mäandern durch diese Ebene zog, machte uns, die wir sie bisher hoch zu Roß gar nicht weiter beachtet hatten, langwierigen Aufenthalt. Was sind doch diese kleinen Bäche in Tibet eisig kalt! Um Mittag wateten wir durch drei Arme eines Flusses. Das Bett war 300 m breit, und das Wasser reichte uns an der tiefsten Stelle bis nahe an die Hüfte Es war der Oberlauf des Flusses, den wir in der Woche vor dem Überfall überschritten hatten. Er war inzwischen erstaunlich klein geworden. Erst jetzt merkte ich, daß es nicht der Yang tse kiang war, sondern der Naptschitai ulan muren der Ts'aidam-Mongolen und der tibetische Tschü mar.. Wir marschierten den ganzen Tag und waren mit einbrechender Dunkelheit doch erst auf der anderen Seite der Ebene, wo riesige Sandbarchane uns den Weg verlegten. Hier richteten wir uns, todmüde von dem ungewohnten Marsch und den schweren Lasten, ein Lager zurecht. Düstere Wolken schoben sich mittlerweile aus Westen zusammen, und bald peitschten die erbsengroßen Hagelkörner eines tibetischen Gewitters uns obdachloses Häuflein mit elementarer Gewalt. Und dann regnete es die ganze Nacht hindurch in Strömen. Nur ein dünner Filz war unsere Decke, unsere Unterlage ein Fell, ob es auch schneite, ob es regnete. Bis spät in die Nacht hinein sahen wir an dem Platz, wo der Überfall stattgefunden hatte, die zahlreichen Lagerfeuer der Räuberbande.
Am nächsten Tage stießen wir unversehens auf ungemein deutliche und breite Wegspuren, und kurz darauf erreichten wir zahlreiche alte Kochgräben, einen Lagerplatz, um den rings auf Hügeln Steinaltäre standen. Wir waren auf die Goba-Straße geraten, die hier nördlich des Kuku schili-Gebirges – in dem ich also überfallen wurde – in NO-SW-Richtung ihrem großen Ziele, Lhasa, zustrebt. Damit wurde für mich zugleich sicher, daß die hohe Schneegipfelreihe, die ich im Norden vor mir hatte, zum Marco-Polo-Gebirge gehörte, d. h. der östliche Teil des sogenannten »Arka tagh« oder »hinteren Gebirges« war, das uns durch den Schweden Hedin bekannter geworden ist.
Wir hatten noch viel Mut. Da im Norden die Gipfelreihe des Marco-Polo-Gebirges tiefe Einsattelungen zu haben schien, so verließen wir bald wieder die Straße der Goba, um einen direkten Weg nach Norden zu den Tädschinär-Mongolen zu finden. Umso vertrauensvoller schlug ich diese Richtung ein, da auf allen meinen Karten, selbst auf der aus dem Stieleratlas, in dieser Gegend ein Taldurchbruch durch das Gebirge – wenn auch gestrichelt, d. h. als unsicher – eingezeichnet war.
Das Marschieren wurde uns am zweiten Tage noch viel saurer. Auch die Wirkung der dünnen Luft, die wir reitend nie sehr empfunden hatten, machte sich jetzt unangenehm bemerkbar. Der größte Teil meiner Leute klagte über Schwindel und Kopfschmerzen, bei einigen trat die Bergkrankheit mit Erbrechen ein, und ich selbst brach einmal bewußtlos zusammen. Die wenigen Sachen, die sich meine Leute aus den Tauschartikeln, die wir nicht mitnehmen konnten, ausgesucht hatten, wurden wie Ballast eines Luftschiffers zu ersehnter Erleichterung weggeworfen und bezeichneten den Weg, den wir zogen. Wir hatten uns alle viel zu viel aufgebürdet.
Auch den dritten Tag des Rückzugs zogen wir langsam über Täler und Kalksteinplatten aufwärts. Alle paar hundert Meter blieben mir meine Leute liegen, um nach Luft zu schnappen. Die Höhen nördlich der großen Ebene waren erstaunlich sandig. Hänge wie Talsohlen waren mit Dünen bedeckt, und nur ein ganz dünnes Gräschen deckte wie ein spärlicher Flaum den Erdboden.
Kaum hatten wir am Abend Lager geschlagen, da begann es wieder zu regnen, bald ging der Regen in Schnee über, und schwerer und schwerer drückte die Schneelast auf unsere Decken. Maulwurfshügeln ähnlich lagen wir unter unseren dünnen Filzen im Schnee. Keiner mag mehr ein Glied rühren. Auch die Hunde, die tagsüber je ein paar hundert Patronen schleppen, haben sich im Schnee müde zusammengerollt und spüren wenig Lust, auf das heisere Maunzen einiger Wölfe zu antworten, die uns ganz nahe umkreisen. Die sechs Yak liegen unangepflöckt um uns her. Sie rühren sich nicht. Höher und höher schichtet sich auf ihnen wie auf uns der nasse kalte Schnee. Nur ein Seufzen unterbricht hier und da die Totenstille.
Am Morgen, am 19. September, maß ich 25 cm Schnee. Wir Menschen hatten kein Brennmaterial, und die matten Yak hatten vergeblich nach etwas Freßbarem gesucht. Sie liegen stumpfsinnig im Schnee neben uns am Bachrand. Durchfroren, zähneklappernd, völlig durchnäßt von dem durch die Körperwärme aufgetauten Schnee suche ich, sobald es endlich Tag geworden, meine Begleiter zum Weitermarsch zu bewegen. Doch vergeblich! »Mo fa!« (Nichts zu machen!) bekomme ich als einzige Antwort. Fatalistisch geduldig, stumpf hocken sie im Schnee und kochen endlich mit den paar Würzelchen, die noch vom Abend vorher übrig sind, ein paar Tassen lauen teeigen Wassers. Ich rechne ihnen vor, daß, wenn wir so langsam marschieren, wie wir in diesen zwei Tagen marschiert sind, wir unmöglich in einem Monat aus der Einöde hinausfinden. Und womit sollten wir denn dann in diesem kahlen, allen Lebens baren Hochland unseren Hunger stillen? Sie hatten ja von sich aus eine Last Lebensmittel weniger mitgenommen, als ich ursprünglich festgesetzt hatte.
»Ming t'ien dsai k'an« (Wir wollen morgen weiter sehen), war alles, was ich hörte, dann zog sich jeder unter seine Decke zurück. Anderthalb Tage blieben wir hier sitzen, so lange fiel immer wieder weißer, nasser Schnee auf uns und hüllte uns ein.
Am 20. September mittags marschierten wir endlich das flach ansteigende Tal weiter hinauf. Zum Glück war mittlerweile der Schnee gefroren, und wir brachen nicht bei jedem Schritte ein. Ein Marsch von ein paar Stunden brachte uns auf eine Höhe von 5030 m; von dort aus bot sich mir eines der schönsten Alpenpanoramen, das ich je in Tibet sah. In der klarsten tibetischen Höhenluft lag, unendlich weit nach West und Ost sich hinziehend, ein mächtiger Gebirgswall vor mir, in dem sich ein riesiger Schneedom an den anderen reihte, in strahlendstem Firnenglanz schimmernde Gipfel, die zwischen 6000 und 7000 m absoluter Höhe haben, und von denen sich heute kleine Gletscher bis wenig über 5200 m Höhe herabschieben (Tafel XIX).
Vor ihnen im Süden, wo ich stand, war eine etwa 10 km breite Fläche, die sich namentlich sehr weit gegen Westen hin ausdehnte. Es war ein mit Geschieben, mit Moränenschutt, mit Sand und erratischen Blöcken ausgefülltes Längstal.
Es war ein kritischer Moment dort droben beim Anblick dieser großartigen Natur. Wie unartige Kinder drängten meine Begleiter vorwärts. Ich hatte ihnen gesagt, daß im Norden die Behausungen der friedlichen Mongolen liegen, nun versperrte ein Schnee- und Eiswall den Weg und zeigte nirgends – wie ich doch nach meinen Karten versprochen hatte – eine passierbare Lücke. Schon wollten sie mir mit den elenden, halbverhungerten Yak, denen wir weit über ihre Kräfte gehende Lasten aufgeladen hatten, einfach die nächsten Gletscher stürmen. Es kostete mich einen harten Kampf, bis ich meine Chinesen wieder zur Vernunft gebracht hatte. Ich pries mich glücklich, als ich endlich mit meinem Häuflein in östlicher Richtung dem vor mir liegenden Marco-Polo-Gebirge entlang weitermarschierte. Auf den letzten Märschen vor dem Überfall hatte ich das Ostende der Schneegipfelreihe gesehen. Es galt nun, dieses zu finden, um von dort aus nach Ts'aidam zu kommen.
Kein Würzelchen zum Feuermachen, kein Hälmchen zum Fressen für meine Tiere, aber Schnee gab es auch an diesem Abend. Die Temperatur ging in der Nacht bis auf –6° und in der folgenden bis auf –9° zurück.

Tafel XIX
Aussicht von einem 5030 m hohen Punkt auf die Marco-Polo-Kette, Entfernung bis zum Fuß der Berge 10 km.
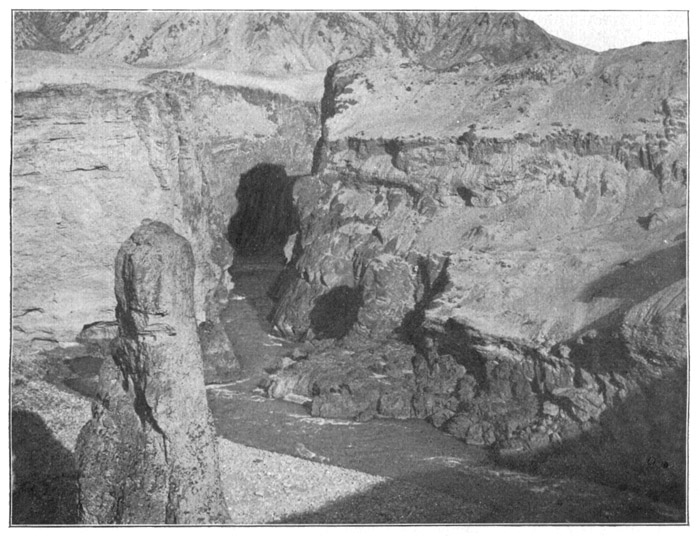
Tafel XX
Der Nätschi gol in seiner Felsklamm. Im Grunde verstecken soeben meine Begleiter die gerettete Reisekasse.
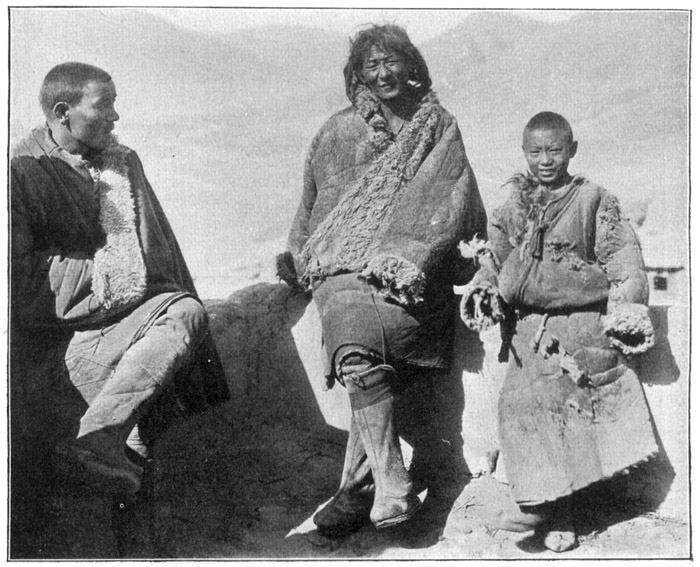
Tafel XX
Einer der Vornehmen von Dscherku ndo.
Drei lange Tage marschierten wir über die schwach gewellte Moränenfläche, stolperten wir über die durch den Spaltenfrost spitz gewordenen Steintrümmer. Bald wateten wir durch Sumpf, bald brachen wir bei jedem Schritt durch Eiskrusten und liefen uns die Sohlen auf dünnen und scharfen Schneeschollen wund. Immer noch wollte sich keine Lücke in der Firnkette zeigen. Immer wieder – alle paar hundert Schritte – blieben wir, nach Atem ringend, liegen und warfen die drückenden Bündel vom müden Rücken und den schmerzenden Schultern. Unsere Fortschritte, die ich mir täglich genau berechnete, gaben zum Verzweifeln geringe Resultate. Wir legten kaum 15 km zurück. Die meisten Leute husteten und litten an Nasenbluten, Mein Herz pochte so stürmisch, daß ich fürchtete, die Strapazen nicht mehr lange aushalten zu können. Lao Ma litt ständig unter Bergkrankheit und schleppte sich nur mühselig und taumelnd vorwärts. Wir mußten seinen Pack noch unter uns verteilen. Auch die Tiere kamen schwer vom Fleck. Ein Yak hinkte, ein anderer war an der Schulter gedrückt. Zwar wurden unsere Lasten immer leichter, erschreckende Mengen verzehrten wir von dem geringen Proviantvorrat, den wir mitgenommen; die Kräfte der Tiere hielten doch damit nicht Schritt. Noch einmal mußte in einem Lager energisch gesichtet werden, und manches zoologische Objekt, darunter auch meine drei schönsten Bärenfelle, blieb liegen. Auch einige der neu genähten Jacken wurden weggeworfen, und ich ließ alle meine europäischen Kleider zurück, da diese nicht den gleichen Schutz gegen die Kälte boten wie der große tibetische Pelzkaftan.
Noch trottete in diesen Tagen das Yakkälbchen uns nach. Wie ich, trauerte auch mein kleiner Milchbruder um die kräftige, fette Milch seiner Mutter, die zusammen mit den anderen Tieren geraubt worden war.
Wir teilten unseren Proviant sparsam ein. Gab es Dung am Lagerplatz, so hatte jeder Mann am Abend drei Tassen heiße Nudeln und morgens und mittags heißen Tee mit Tsambamehl, das im Unglückslager mit Tschürra und viel Zucker vermischt worden war. Konnten wir kein Feuer machen, so stand auf der Speisekarte morgens, mittags und abends: Tsambamehl, mit kaltem Wasser geknetet.
Unabsehbar, endlos schien die vegetationsarme Steinwüste nach Osten zu reichen. Um unsere armen Tiere auf ihr nicht Hungers sterben zu sehen, mußten wir sie verlassen und mußten noch einmal südwärts abbiegen.
An dem Marschtage darauf waren wir in 4600 m in einem breiten Tal mit einigen dünn gesäten Grasflecken. Und als wir in diesem über eine flache Wasserscheide gekommen waren, sahen wir in der Ferne zwei schwarze Punkte.
»Sind's Bären, wie wir schon mehreren in den letzten Tagen begegnet waren?« »Nein, es sind Wildyak.«
Wir vergessen darüber Erschöpfung und Bergkrankheit, Zwei Jäger werden abgesandt. Bereitwillig schleppen wir anderen noch ihre Lasten mit den unseren. Alle freuen wir uns aufs Sattessen. Vorsichtig pirschen sich die zwei an die Tiere heran. Jetzt – jetzt müssen sie anlegen. Doch wie? Mit lautem Hallo treiben sie die beiden schwarzhaarigen Tiere auf uns zu. – Es waren zahme Yak, die sich freilich fast wie wilde gebärdeten. Ihre langen Bauch- und Schwanzhaare waren ihnen ausgerissen, sie waren von ihren früheren Besitzern in erschöpftem Zustand aufgegeben worden. Was noch an ihnen zu gebrauchen war, die Haare, aus denen die Tibeter ihre schwarzen Zelte und ihre starken Stricke verfertigen, hatte man mitgenommen. Die Lhasa-Karawane, die sie verloren hatte, mußte schon vor längerer Zeit hier durchgekommen sein, denn die Tiere hatten sich trotz der spärlichen Weide gut erholt. Nichts kam uns willkommener als diese Hilfe. Die acht Yak, die wir nun hatten, erlaubten uns den Luxus, daß drei von uns ohne Rückenlast marschierten. So konnten wir in den nächsten Tagen mit Erfolg wilden Yak nachstellen und bewahrten uns dadurch vor allzu großer Schwächung durch Hunger.
Am selben Tage (23. September) trafen wir wieder auf die Spuren einer Straße. Indem wir dieser nach Nordosten folgten und aus dem Tal hinauszogen, kamen wir noch einmal auf die große Moränenfläche hinauf. Immer in nordöstlicher Richtung weiterreisend, querten wir am 25. und 26. September die vegetationslose Hochebene. Wir hatten tagsüber eine Temperatur von +8°, +9° bis +10°, jede Nacht aber – 6° bis – 8°. Bei Tage gab's Gewitter und Hagelstürme, fast jede Nacht aber Schnee, der uns wie ein großes Leichentuch zudecken wollte.
Die Leute schlafen auf originelle Weise. Sie legen sich paarweise zusammen, die Köpfe in entgegengesetzter Richtung, und drehen und winden ihre Körper so, daß die Füße je auf die Brust des Kameraden zu liegen kommen. Der Pelz- und Filzrock des einzelnen deckte im Liegen nicht den ganzen Mann, so aber, wie meine Begleiter sich legten, blieben die Füße warm und profitierte immer noch der eine vom Mantel des anderen.
An der Straße, die wir zogen, trafen wir zahlreiche Waka (Kochstellen) früherer Karawanen, wo immer etwas Weide sich zeigen wollte. Die Lagerplätze aber lagen so weit voneinander, daß wir zwei Tage von einem zum anderen brauchten. Der Weg dazwischen war wie gepflastert mit Skeletten und Kadavern von Yak und Pferden von diesem Jahr und von früheren. Die Fan tse-Karawanen reisen immer sehr rasch und rasten wenig, daher haben sie große Verluste.
Als wir bei einem Halt unseren Tee kochten, kam ein seltsames Kleeblatt einträchtiglich des Weges gezogen. Ein kleines Füchslein trabte plötzlich um die nächste Berglehne herum, hinter ihm her trottete ein großer gelber Wolf, und wenige Schritte zurück patschte plump Meister Braun daher. Fuchs und Wolf waren rasch im Bild und rissen spornstreichs aus, als sie unser Kochfeuer in die Nase bekamen und uns sahen. Der Petz aber ließ sich Zeit. Er hob sich auf die Hinterpranken, ließ sich wieder schwerfällig nieder und glotzte uns an, bis wir aufstanden, mit Steinen nach ihm warfen und unsere Hundeschar auf ihn hetzten. Da machte er schleunigst kehrt und holte in raschem Trott Reineke und Isegrim ein.
Am 27. September erreichten wir endlich einen Einschnitt, eine ganz flache Scheide (4870 m) im Zug des Marco-Polo-Gebirges, das sich von hier aus weiter nach Osten in nur wenig hohen Bergen fortsetzt. Wie ich später in Ts'aidam erfuhr, war es der Tschüm tsing-Paß. Von hier aus führte nach Norden ein steiler Abstieg in ein schon gegen Ts'aidam fließendes Bachtal. Kurz vorher sahen wir in der Ferne zur Rechten einen großen See, dessen blauer Spiegel 15 km weit nach Osten reichte und gar anmutig aus niederen Sandstein- und Tonschieferhügeln herausblinkte. Er lag vor dem östlichen Ende der großen Moränenfläche des Marco-Polo-Gebirges um wenig niederer als 4700 m.
Hier mußte unser Yakkalb sein junges Leben lassen. Es war aber eine große Sache, bis es geschlachtet war. Alle litten unter Hunger, aber keiner wollte ans Schlachten gehen. Vor allem erklärten die Dunganen, diese große Sünde nicht begehen zu können. Endlich überredeten ein paar Aufgeklärtere, insonderheit Da Tschang, den Ma, es zu schächten. Aber nur der Gedanke, daß der gemeinsame Kochtopf unkoscher für sie werde, wenn das Kalb nach Fan tse-Ritus erstickt oder von mir vielleicht erschossen würde, bewog ihn zu der Tat. Den ganzen Schluß des Tages bis in die Nacht hinein gab es noch eine große Erörterung über diese Sünde und über die tatsächliche oder nur eingebildete Notwendigkeit, sie zu begehen. In einer einzigen Mahlzeit wurde das ganze vier bis fünf Monate alte Kalb von uns verspeist, und doch war keiner satt geworden. Nicht einer meiner Begleiter hatte zuvor Kalbfleisch gekostet. Es war ein vorzügliches Fleisch, aber der Sünde wegen wollten sie nur ungern zugeben, wie gut es ihnen schmeckte.
Das Tal, das wir hinabzogen, war so öde und wüst, wie ich noch nie zuvor eines gefunden hatte. Immer wieder mußte ich mich wundern, wie die tibetischen Karawanen hier für ihre nach Tausenden zählenden Yakrinder genügend Futter zu finden vermögen. Man meint, am Wege jedes Grashälmchen zählen zu können, so spärlich ist die Vegetation.

Abb.9
Meine Erinnerung an den Rückzug
Die Bundschuhe, die »luo tse«, die wir uns nach dem Überfall angefertigt hatten, um leichter marschieren zu können, waren nur zu bald durchgetreten
In dem ersten Lager in diesem Tal drückte uns am Morgen ein Fuß tiefer Schnee. Lauter harte, runde Knöllchen, Hagelkörnern gleich, waren in der Nacht auf uns niedergeprasselt. Als ich vorsichtig unter meinem Filz vorlugte, lagen die Yakochsen bewegungslos wie große Steingötzen neben mir. Schon wollte ich sie für tot halten, da vernahm ich endlich doch noch ein Knarfeln und Knirschen ihrer Zähne. Zum Wiederkäuen hatten sie nichts mehr in ihrem Magen.
Um halb sieben Uhr in der Frühe klärte es sich etwas auf, bald aber kamen neue Wolken. Wir »machten Toilette« und hockten dann stumm um das Feuer, das das Teewasser in drei Viertelstunden kaum zum Sieden brachte. Ein eisiger West erkältete uns bis aufs Mark, er erhielt diesmal den Schnee, der sonst unter dem Einfluß der Sonne immer so rasch verdunstet. Dann stapften wir weiter das Tal hinab. Die »luo tse«, die Bundschuhe, die wir im Unglückslager genäht hatten, waren an den Fersen und am Ballen durchgescheuert (siehe Abb. 9). Die meisten Leute klagten über Fußsohlenbeschwerden. Auch die Yak humpelten mehr, als daß sie gingen. Ihre Hufe waren stark abgelaufen. Drei waren lahm, und fast alle waren gedrückt. Früher hatte ich stets solche Wunden mit Kalium permanganicum behandelt, was rasche Heilungen zur Folge hatte, jetzt mußte ich machtlos zusehen, wie die Wunden größer und größer wurden.
28. September. Wir folgen weiter dem Tal abwärts. Es ist ungemein dürr und trocken. Auch der Bach ist versiegt. Schon beginnt der wüstenhafte Charakter der zentralasiatischen Kamelsteppen. Oasenartig heben sich die als Lagerplätze der Karawanen benutzten Grasterrassen ab.
Wir schossen heute einen einsamen Wildyakbullen, ein uraltes, zähes Vieh. Der Körper war noch nicht erkaltet, da schnitten wir uns schon Fleischstücke herunter und aßen sie roh. Erst als der schlimmste Hunger gestillt war, suchten wir nach trockenem Dung, legten dann die Beefsteaks auf das glostende Häuflein und rösteten sie uns. Ganz wenig Fleisch haben wir gesotten, und dies nur ganz kurze Zeit, damit es nicht so hart wie Leder würde.
Endlich tauchte fern aus Dunst und Nebel, von Osten her, ein größerer Bach auf, die riesige Talung des Schogha gol, den einst Prschewalski entdeckt hat, und den ich schon lange herbeigesehnt hatte. Der in verschiedene Arme geteilte Fluß windet sich in großen Bogen und tritt dann da, wo wir ihn erreichten, in eine Enge zwischen hohe Kalkberge ein.
Wir waren nun auf 3980 m herabgekommen, und die Beschwerden, die wir durch die dünne Luft hatten, waren gewichen. Wohl gab es nun oft eine ziemlich reiche Vegetation, dornige, stachelige Büsche, ja Sträucher, die beinahe Manneshöhe erreichten, aber nirgends war mehr Gras für die hungerleidenden Tiere. Es war ganz schrecklich für mich, ihre Leiden mitanzusehen.
In dem Lager am Schogha-Fluß hatte ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Flußabwärts dem Schogha zu folgen – wie ich geplant hatte –, war ausgeschlossen. Der Fluß verschwand zwischen vollkommen vertikalen Kalkfelswänden. Wir waren in dem eiskalten Wasser ½ km abwärts gewatet, ohne das Ende der Klamm zu erblicken.
Sollten wir die Lhasa-Straße weiterziehen und dem Schogha-Fluß aufwärts folgen, oder sollten wir auf neuen Wegen das uns ganz unbekannte Felsgebirge vor uns im Norden queren?
Ich wog den Proviant ab. Kärglich zugemessen reichte er noch für acht Tage. In dieser Zeit aber konnten wir auf der Lhasa-Straße unmöglich in bewohnte Gegenden gelangen. Auf das Jagdglück zu bauen und durch Fleisch den Proviantvorrat zu strecken, war in der dürren Gegend so gut wie aussichtslos. Der Mut der Leute war gänzlich zusammengebrochen, als uns das neue Hindernis, die Schogha-Klamm, so unerwartet den Weg verlegte. Ich bekam bittere Vorwürfe zu hören, als hätte ich unser ganzes Unglück verschuldet. Wenn mir das Glück nicht bald wieder hold wurde, hatte ich noch eine schwere Meuterei zu gewärtigen. Trotzdem wagte ich es aber, die ausgetretene Straße, die meinen Leuten viel Vertrauen einflößte, zu verlassen. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!
So ziehen wir weglos ins Ungewisse weiter, und nach Überschreitung des Schogha-Flusses geht es zwischen kahlen Geröllhängen aufwärts. Nichts umgibt uns als steinige, trostlose Wüstenberge. Die Yak kommen fast nicht vom Fleck, nun es auch noch bergauf geht. Tschʿeng, Sung und Me lassen keine Minute vergehen, ohne ihre Gebete herzuplappern. Unausgesetzt drehen sie an ihren Rosenkränzen und schwingen ihre Gebetsmühlen. Langsam neigt sich der Tag. Immer halten wir noch vergeblich nach Gras und Wasser Ausschau. Unsere Not war groß. Doch wenn sie am größten ist, ist immer Hilfe am nächsten. Wir kamen noch spät am Abend zu einem kleinen Fleckchen Gras, wir kamen zu Schnee, den wir schmelzen konnten, und wir sahen ganz nahe vor uns einen flachen Paß, von dem uns von ferne schon ein Lab (r)tse entgegenwinkte Ich erfuhr dafür später den Namen Schohʿka kottel. Die ngGolokh sollen den Paß auf ihren Raubzügen benutzen.. Hier waren doch vor uns schon Menschen gewesen! Dies hob die Stimmung der Chinesen.
Langgezogene, flache Rücken zwischen vielen breiten Talrissen lagen in der klaren Abendluft mit purpurroten Farben vor uns. Sie dachten sachte gegen Süden zu, gegen das muldige Schogha-Tal ab. Aus diesen heraus reckten sich im Norden schwarzblaue Gipfel mit plumpem, schwerem Bau, gut 1000 m höher als unser Lagerplatz, der selbst wieder über 4500 m hatte. Nach Südwesten schweifte unser Auge über das Schogha-Tal hinweg, dort strahlten Schneegipfel aus viele Tagereisen weiter Ferne zu uns herüber.
Dem warmen Tag und herrlichen Abend folgte eine trübe Nacht. 18 Stunden kauerten wir unter unseren Filzstücken, während nimmer müde dichte Flocken vom Himmel wirbelten. Trotz langer Übung habe ich nie gelernt, auf steinigem Grund lange ruhig zu liegen. Immer mußte ich mich wieder auf eine andere Seite legen, um den schmerzenden Gliedern Erleichterung zu verschaffen. Nur ein wenig verschob sich hierbei einmal der Filz, und gleich drang Schnee ein, der rasch schmolz und einen kleinen See in meinem Nest bildete. Mehrere Tage blieb jetzt mein Quartier naß.
Endlich um drei Uhr nachmittags hellte es sich auf, und wir zogen weiter. Ich hatte am Tage vorher umsonst gejubelt. Als wir den Paß mit dem kleinen Lab (r)tse hinter uns hatten, häuften sich neue Berge in unserer angestrebten Richtung, und wir gerieten in eine Schlucht, die bald nach Süden umbog. Zum Glück aber fanden wir trotz dichtester Nebelschleier, die uns aufs neue einhüllten, einen begehbaren Felsriß, der von Norden herkam. In diesem verbrachten wir die nächste Nacht. Es war das schlimmste Lager meiner Reise. Wir steckten in dickem Nebel. Wieder fiel Schnee auf uns herab. Die Temperatur sank bis – 11º. Nirgends fand sich Dung. Wir haben nicht einmal Wasser und essen trockenes Mehl mit Schnee. Hungernd und zitternd hockten wir die lange Nacht auf dem hartgefrorenen Boden. Die Wölfe kamen so dicht an uns heran, daß wir sie mit Steinen trafen.
Endlich brach die ersehnte Dämmerung an, und mit ihr kam ein Westwind, der die Wolken etwas auseinandertrieb. Ich schrieb den 2. Oktober. Nicht fern von uns lag ein steiler, glatter Schneehang, der zwischen hohen Kalkklippen zu einem Sattel führte. Den trieben wir die Tiere im Zickzack hinauf. Es war gar nicht weit. Eine halbe Stunde Wegs für einen rüstigen Gänger. Aber Stunde um Stunde verrann, bis wir oben waren. Und nur drei Yak hatten ihn mit uns erreicht, die anderen hatte die Kraft verlassen, ihr Herz versagte den Dienst, regungslos lagen sie im knietiefen Schnee. Ihre Lasten hatten wir uns auf den Rücken laden müssen.
Dies war der letzte Paß vor Tsʿaidam (4655 m). Von seiner Höhe herab sah ich aber nach Norden zu nur wieder ein Meer von Gipfeln und Zacken. Ungläubig schüttelten die Chinesen den Kopf, als ich ihnen versprach, in längstens fünf Tagen bei Zelten zu sein. Nicht viel leichter als der Aufstieg war der steile Abstieg nach Norden. Auf unseren zerrissenen Bundschuhen glitten wir unsicher und alle Augenblicke mit den Lasten stürzend, den Hang hinab.
200 m tiefer, als der Sattel gelegen, trafen wir auf ein kleines Naka-Feld mit Gras und Binsen. Ein kleines Rinnsal entstand hier, versiegte aber nach kurzem Lauf. Im Weiterziehen wurde das Tal zur trostlosen Wüste. Immer öder und öder wurde es, und wir kamen so langsam vom Fleck! Beim letzten Schneefeld schlugen wir das Nachtlager und kochten uns mit schmutzigem Schnee unseren Tee.
Den ganzen 3. Oktober marschierten wir stumpf, ohne Wasser zu finden, das Tal hinab. Nur ein Gedanke beherrschte mich: den Nätschi gol, den Nätschi gol muß ich finden, sonst sind wir verloren! Unsere geschwächten Körperkräfte konnten zum Hungern nicht auch noch langes Dürsten aushalten.
Es war an diesem Tage der 15. des achten chinesischen Monats, ein großer Tag in Hsi ning, das sogenannte chinesische Mondfest, »ein Fest wie Neujahr, ja noch viel, viel schöner,« sagten mir meine Chinesen, »denn um diese Zeit ist die Ernte eingebracht. Es gibt viel süßes Obst, jeder hat Geld, und man muß nicht wie an Neujahr seine Gläubiger befriedigen.« An diesem Tage kneten die Hsi ning-Chinesen allerlei Tierformen aus Teig, setzen sie auf den Hausaltar und essen sie am Abend.
Sandiger Löß bedeckte das Tal und die Hänge. Nur kleine Holzsträucher, nur Büschelchen, die durch ihren Bau gegen Dürre gefeit sind, standen an dem trockenen Bachbett, das im Sommer nach heftigen Gewitterregen wohl Wasser führt. Fahl war den ganzen Tag der Himmel, gelblich verschleiert die Sonne. Kein lebendes Geschöpf, kein Mäuschen lief uns über den Weg, nur zwei Geier kreisten über unseren Köpfen. Sie hatten sich wohl gestern an unseren Yak, die wir am Passe hatten lassen müssen, gesättigt und hefteten sich jetzt vertrauensvoll an unsere Spuren.
Immer wieder kommt die Frage an mich: »Wie weit ist's noch?« Wir haben fast keine Mehlvorräte und gar kein Fleisch mehr, nur nagenden Hunger und Durst. Wo meine Leute ein kleines Mausloch sehen, wollen sie es, den Bären gleich, ausgraben. Das Gehen wird in dem weichen Boden schwer. Wir hoffen nur. Bangen und Hoffen ist Menschenlos!
Am Nachmittag brach Mensch und Tier ermattet unter der Last zusammen. Unmöglich war's, das Gepäck noch weiterzuschleppen. Später, wenn wir selbst nochmals aus dieser Öde zu Menschen gelangen sollten, wollten wir mit frischen Tieren zurückkehren und es holen. Wortlos wurden in einer Rinne der photographische Apparat, die Plattenkiste und die Patronen vergraben. Stumm schleppten wir uns dann weiter. Jeder Schritt kostete eine Überwindung.
Von links, von Süden her, gesellte sich jetzt zu meinem Tal ein zweites. Es ist eher schmäler als das unserige, gibt aber die weitere Richtung an und zeigt genau nach Norden, also Tsʿaidam zu. Meine Aneroide sagen mir etwa 3200 m an. Es kann also nicht mehr weit bis zu der Mongolenebene sein. Doch wo bleibt nur der Nätschi gol? Völlig steril und trocken ist auch das Tal aus Süden. Die Sandflächen des Talbodens ziehen sich ganz flach bis hinüber an den jenseitigen Bergfuß. Keine Spur eines Sommerregenbettes ist zu erkennen. – – Da – was höre ich? –
Was rauscht? – Ist es eine Sinnestäuschung? Saust mir nur der Wind so stark um die Ohren? Noch ein paar Schritte gehe ich vorwärts und stehe dicht vor dem gesuchten Flusse. Tief unten in einem schmalen Spalt wälzt ein mächtiges Wildwasser seine gelblichgrünen Fluten. Lotrecht und völlig unvermittelt war der nahezu 100 m tiefe Graben in die breite, sandige Talfläche eingelassen. Auf eine weite Strecke war kein Darandenken, zu dem Wasser hinabzugelangen. Auch da, wo wir endlich am Abend lagerten, konnten wir nur mit Händen und Füßen kletternd zum Wasser hinabkommen. Futter für die Tiere fand sich auch dort noch nicht. Ein paar Kyang – vielleicht waren es auch Reitpferde gewesen – hatten einmal in der Nähe eine Nacht zugebracht. Ihren alten, verrotteten Dung fraßen die Yak. Es war schändlich! Eines – das letzte von den zweien, die wir unterwegs aufgegriffen hatten – war am Ende seiner Kraft. Es war noch verhältnismäßig fett. Wir schlachteten es darum und sotten sein Fleisch die ganze Nacht hindurch. Mit Heißhunger verschlangen wir es am Morgen, aber es schmeckte noch immer abscheulich süßlich und wirkte erbrechenerregend.
4. Oktober. Wir haben in der Schlucht unten den Rest der Sachen vergraben. Auch das Barrensilber, die Reisekasse, blieb hier zum größten Teil zurück (Tafel XX oben). Nur die Notizen und Kartenskizzen wurden mitgenommen. Die zwei letzten Ochsen durften fast vollkommen leer weitertaumeln. Am kleinsten Hang aber, wo es nur ein wenig bergauf ging, wollten sie stehen bleiben und sich niederlegen. Ihr Herz konnte nicht mehr. Die Hochgebirgstiere, die kaum einmal unter 3000 m Meereshöhe herabgekommen sind, litten geradeso unter der Überanstrengung wie die Menschen, Wir zogen bis in die Dämmerung hinein auch an diesem Tag weiter. Das Tal des Nätschi gol war am Nachmittag immer breiter geworden. Der Fluß war ganz fern von uns weg, als wir uns niederlegten.
5. Oktober. Noch ehe es hell war, waren wir wieder auf den Beinen. Bald sind wir mitten in einer ganz flachen Kiesgeröllebene. Kein Halm, kein Busch, steinige »schala«, wie die Mongolen sagen, weit und breit. Und nur ein kleiner Pfad, wie ein Wildwechsel so schmal, führt direkt nach Norden in die unabsehbare, grenzenlose Weite. Es gehört Mut dazu, zu vertrauen, daß da draußen Menschen wohnen können. Was ist das »Golmo«, das ich auf der russischen Karte finde? Wohnen dort überhaupt Menschen, ist es vielleicht nur ein Lagerplatzname?
Kein lebendes Wesen will an unserem Wege sein Heim haben, kein Mückchen sehen wir fliegen. Nur Pferdegerippe bleichen im Sand, Yakmumien bezeichnen die Straße. Ständig haben wir Luftspiegelungen vor uns und glauben ganz nahe an Bäumen und Wasser zu sein. Der kleinste Kiesel wird in der Ferne, in dem zitternden Lichte, zur riesigen Pappel. Die Ochsen knarfeln fortgesetzt mit den Zähnen, daß es weithin zuhören ist. Sie sind am letzten. Sie stoßen mit den spitzen Hörnern nach uns, wenn wir sie antreiben. Es ist der siebente Tag ohne Futter. Ein trockener Kamelkadaver in vollkommen erhaltenem Fell liegt am Wege. Auch solche Tiere verenden hier. Valle del Morte möchte ich das Nätschi-Tal nennen.
Han und der kleine Go waren noch die lebendigsten von uns. Wir alle hatten betäubendes Kopfweh, die Fußsohlen brannten, und die Beinsehnen waren angeschwollen. Ich war im Leben noch nie so matt. Bei jeder kleinen Rast fallen wir sofort in Schlaf.
Ein wolkenloser Himmel spannt sich über uns. Wir leiden unter der Wärme des Tieflands. Die +16° empfinden wir schon als Hitze, und dazu haben wir seit dem Mittag des vorausgegangenen Tages nichts Flüssiges mehr über die Lippen gebracht. Der flimmernde Dunst, der aus den flachen Mulden aufsteigt, täuscht uns immer wieder Wasserspiegel vor, und wir Dürstenden fallen unzählbare Male auf die Täuschung herein.
Am späten Nachmittag erst führt uns der Weg wieder an das Ufer des Nätschi gol. Er floß in mehreren Armen zwischen flachen Ufern durch die Schala-Wüstenei.
Nach einer kurzen Teerast gelingt es mir am Spätnachmittag noch einmal, mein Häuflein weiterzutreiben. Wieder ging es nordwärts. Wir wollten für die zwei Tiere Gras suchen. Endlich sahen wir in der Ferne Dünen, sahen die Grenze der Piedmont gravels, und bei dem letzten Licht des Tages zeigte uns mein Triëder einige schwarze, sich bewegende Punkte – Rinder! – Neuer Lebensmut beseelt uns. Wir stapfen weiter. Es wird Nacht, aber heller Vollmond erleuchtet unseren Weg.
Endlich erreichen wir den Platz, wo ich die Rinder grasen sah, eine kleine Terrasse aus jungem Löß. Auf ihr hatte ein Pflug seine segenbringenden Furchen gezogen, und hier schlugen wir unser Lager. Bald loderte ein mächtiges Feuer aus Tamariskenstämmen, und meine Chinesen fühlten sich auf dem bebauten Boden schon wie in der Heimat.
Wir sind gerettet. Fünfundzwanzig Tage nach dem Überfall und dem Verlust der schönen, stolzen Karawane haben wir Tsʿaidam erreicht. Wir hatten zwar noch keine Menschen gesehen, aber die Besitzer der Rinder konnten nicht fern sein. An diesem Abend aßen wir unsere letzten Vorräte auf. Es reichte für jeden gerade noch eine Tasse voll Tsamba.
6. Oktober. Als wir uns die Augen wachrieben, sahen wir in nächster Nähe weidende Kamele, Pferde, Schafe, farbige Rinder, und keine halbe Stunde entfernt standen zwei weißliche Yurten. Frohen Muts ging's auf dieses Ziel zu. Doch kaum hatte man uns bemerkt, so stürzten Frauen auf die Herde los und trieben sie hastig und mit Gekreisch zusammen. Drei Männer stürmten auf die Pferde und ritten mit Musketen in der Hand in höchster Aufregung hinter den Dünen hin und her. Wir hatten auch hier ein ngGolokh-Fieber ausgelöst.
Erst ganz nahe vor den Zelten gelang es Han, dem einzigen von uns, der Mongolisch konnte, die Leutchen zu stellen und darüber aufzuklären, wer wir seien. Sie aber hilfsbereit zu machen, kostete noch viel Geduld und Mühe. Die Mongolen waren nichts weniger als gastfreundlich und suchten uns, auch nachdem sie unsere Geschichte des langen und breiten angehört hatten, abzuschütteln, ohne uns auch nur einen Bissen zu verkaufen. Sie seien arme Hirten, bekamen wir als Antwort. In »Nomochʿan«, gleich hinter den nächsten Dünen im Osten, würden wir alles Nötige bekommen. Zum Glück wußte ich aus der Karte, daß dieser Ort acht Reittage abliegt, und ließ mich nicht so leicht abweisen.
Nach vielen Geschenken und auch energischem Zureden verkauften sie schließlich am Nachmittag etwas Tsamba und Tschürra. Langsam nur überzeugte sie mein Silber, daß wir tatsächlich keine Räuber waren. Hätte ich bei dem Überfall auch mein Silber verloren, so wäre ich wohl nie aus dem Tädschinär-Lande hinausgekommen. Die Mongolen hätten kein Glied für uns gerührt. So aber versprachen sie mir noch am Abend fünf Pferde, mit denen zwei meiner Begleiter unsere vergrabenen Sachen abholen konnten. Freilich mußten wir noch einen ganzen Tag auf die Tiere warten, da diese nach Mongolensitte erst vierundzwanzig Stunden fasten müssen, ehe sie zu einem größeren Ritt verwendet werden.
Drei Tage dauerte es nur, bis die zwei Mann auf den frischen Pferden die zurückgelassenen Lasten aus den Bergen brachten. So lange blieb ich bei den Leuten und vertrieb mir die Zeit durch Besuche bei meinen unfreiwilligen Gastfreunden.
Es hausten in ganz Golmo – Golmo (Golmot) ist die Bezeichnung für eine Gegend – etwa sechs Familien, die alle untereinander verwandt oder verschwägert waren. Sie verteilten sich auf etwa 5 qkm. Erst eine Tagereise weiter im Westen sollten wieder zehn Familien beieinander wohnen. Geht man von Golmo genau nordwärts, so hat man nach den Mitteilungen meiner Mongolen nach fünf Tagen den menschenlosen Sumpf hinter sich und ist im Lande der Kurluk-Mongolen angelangt, die an dem Nordrande von Tsʿaidam sitzen. Der Südrand von Tsʿaidam bis an das Westende des großen Sumpfes bildet das Land des Tädschinär-Dsassak. Dieser Häuptling soll etwa tausend Familien unter sich haben. Hinter dem Dünenstreifen, der die Kieswüste begrenzt, folgt ein grüner Streifen mit guten Schilfweiden; aber dieser ist nicht breit. Nach Norden zu beginnen in geringer Ferne die Salzausblühungen des Tsʿaidam-Sumpfes.
Im Westen, hinter den drei Armen des Nätschi gol, eine kleine halbe Stunde von der Stelle, wo wir uns häuslich niedergelassen, unseren Kochtopf aufgestellt und unser Handgepäck abgelegt hatten, stand eine einsame Yurte, in der ich täglich auf Besuch war. Eine siebenzigjährige Frau hauste dort ganz allein. Sie sah wie die Hexe im Märchen aus, so runzlig und verwittert, so mager und wild; die alte Ani schien aber im weiten Umkreis sehr beliebt zu sein. So oft ich zu ihr kam, traf ich Gäste.
Kam ich in die Nähe, so stürzten alle Anwesenden aus dem Filzhaus heraus und luden mich unter vielen Bücklingen ein, als erster einzutreten und mich zu oberst und zunächst dem Heiligtum auf ein Stück Filz niederzuhocken.
Die Yurte war ganz wie in Barun oder in der Ordos und bei den Alaschan-Mongolen gebaut und hatte etwa 3½ m Durchmesser. Auch hier sah die doppelflüglige hölzerne Tür stets nach Osten. Die Filze aus Schafwolle sind aber bei den Tädschinär sehr locker und schlecht gepreßt, und die großen Filzstücke, die um das hölzerne Gitterwerk der Seitenwände und um das kuppelige Dach geschnürt werden, waren in der Yurte meiner Ani zerfetzt und zerschlissen, so daß der kalte Herbstwind schier ungehindert durchpfeifen konnte.
Der Hausrat der Ani war der denkbar einfachste und beschränkte sich auf die allernötigsten Gebrauchsgegenstände. In der Mitte stand der eiserne Dreifuß, eingefaßt von einem kunstlosen, niederen Lehmring, der die herabfallende glühende Asche zusammenzuhalten hatte. Hinten, der Holztür gegenüber, stand eine vom vielen Lagerwechseln halb auseinandergefallene Kiste, auf der einige Gebetsblätter eingewickelt lagen. Wenige Ledersäcke Zum Gerben von Schaffellen sah ich hier, wie im ngGolokh-Land Buttermilch verwenden. Die Felle werden damit durchtränkt und hierauf mit einem gezähnten Holzstock kräftig durchgewalkt. Der Kaseingehalt scheint die gewünschte gerbende Wirkung zu erzielen. mit Gerste und Tschürra, die runde, steinerne Handmühle von ½ m Durchmesser, große schwarze Krüge und Bottiche aus schwarzer Yakhaut, Spindeln und ein Garnhaspel und last not least der große eiserne Topf, der zur Schnapsdestillation aus Stutenmilch diente, waren an den Wänden verteilt. Der Schnaps, der hier gebraut wurde, war die große Anziehung dieser Hütte, und er schien unerschöpflich zu sein, denn meine Ani war sehr fleißig und zugleich wohlhabend; sie besaß allein sechs stattliche Kamele und vor allem über zwanzig Pferdestuten. Acht ihrer Stuten hatten Fohlen und wurden von ihr gemolken. Kein Wunder, daß die Nachbarn so oft kamen und sich angelegentlich nach dem Befinden der Alten erkundigten. Fragte man die Mongolen, was sie herführe, so hatte sich immer eines ihrer Kamele oder Pferde verlaufen, und sie hatten die Fährte bis in die Nähe der Yurte verfolgen können.
Die Ani bewirtete uns alle mit gegorener Stutenmilch (Kumys), »Tschüka« hier genannt, aus der der »Aker«, der Schnaps, bereitet wird. Sie hatte »Hala mogu« (chinesisch; der mongolische Name ist harmek) und Gu tschi tse (chin. oder mong.: mori [Pferde-]harmek), schwarze und rote Beeren, der Tschüka zugesetzt. Diese Beeren wuchsen rings um das Zelt auf 3 m hohen dornigen Sträuchern (Nitraria Schoberi) und waren im Geschmack und Aussehen etwa mit unseren Brombeeren und Heidelbeeren zu vergleichen.
Wie unter Tibetern, brachte man auch bei den Tädschinär das Eßgeschirr selbst mit. Die Gäste griffen unter ihren Pelzmantel, der blusig bis zur Hüfte herabfällt, wo er durch einen straffen Gürtel zusammengehalten wird. Aus der bauchigen Falte über den Lenden und dem Kreuz, aus dem sicheren Verwahr zwischen der nie gewaschenen Haut und dem nie gewaschenen Pelz, kam der Eßnapf heraus. Schien er dem Besitzer nicht rein genug, so nahm er von dem trockenen Kuhdung neben dem Feuer und scheuerte ihn damit aus. Der Dung schien den guten Leutchen etwas äußerst Reinliches zu sein. Die Alte sah ich die trockenen Fladen mit Vorliebe als Teller benutzen.
Als man satt gegessen und den Napf mit der Zunge reingeleckt hatte, begann erst die Gemütlichkeit. Aus einer Ecke des Zelts wurde ein kleiner hölzerner Mörser geholt und in ihm mit einem langen Kiesel Tabak und um ihn zu strecken, auch noch trockener Schafdung gestoßen. Jedes, auch die Ani, nahm sich davon eine gute Prise. Geschäftig ging dann die Alte an die Kiste unter den Gebetbüchern und nahm eine Steinkruke heraus, schmierte etwas Butter an deren Rand und bot jedem einzeln die Kruke mit einem Knicks an. Jedes tippte mit ernster Miene an die Butterflocke, murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin, und erst, nachdem so die Kruke reihum gereicht war, wurde sie geöffnet und ihr Inhalt, der Stutenmilchschnaps, in die vorgehaltenen hölzernen Eßnäpfe ausgeschenkt. Jedes machte noch in die vier Kardinalrichtungen einen Opferguß, wobei es die eingetauchten Finger abschnellte, und dann begann das Trinken und das Singen, das freilich nie allzu lange währte.
Die mongolischen Herren lieben den Schnaps gar sehr, aber sie sind erstaunlich wenig trinkfest. Alle waren immer bald erledigt, doch gab es dabei nie Zank und Streit. Die Mongolen wurden nur liebenswürdig und zärtlich. Wenn der Abschied kam, hatten sie große Mühe, auf ihre Ponys zu klettern. Waren sie aber einmal droben, dann ging es mit Joho und Juhu im tollsten Galopp über alle Löcher und Büsche der Steppe ihrer Yurte zu.
Ich suchte mir in Golmo vergeblich Pferde zu kaufen. Es wurden mir zwar gar viele angeboten, aber das Material war durchweg miserabel. Ich war schließlich froh, daß ich kein Pferd kaufen mußte, sondern die Tiere mieten konnte. Dreizehn Pferde stark ritten wir am 11. Oktober unter der Führung eines alten Mongolen und seiner fünfzehnjährigen Enkelin weiter. Wir machten täglich 30–40 km. Dabei gab es mancherlei Abenteuer mit den Pferden. Einzelne waren seit Jahresfrist nicht mehr geritten worden, und Da Tschang und auch die anderen wurden in den ersten zwei Tagen des öfteren höchst unsanft in den Sand gesetzt.
Der Ritt ging vier Tage lang genau ostwärts. Es war ein schmaler Pfad, der sich innerhalb der Dünenreihe einmal durch Busch und Steppe, ein andermal durch dichten Tamariskenwald durchwand. Zur Rechten begann bald die kahle Schala-Steinwüste, und in 12–15 km erhoben sich die nackten Felsberge, stieg der Gebirgsrand von Hochtibet mit tausend spitzen Zacken auf. Zu unserer Linken zogen sich in nicht allzu großer Ferne Schilfweiden hin, und dahinter und dazwischen glitzerte der Boden von Salzausblühungen wie Schnee so weiß. Nur selten kamen wir an Yurten vorüber, selten nur erblickte man Kamele, Pferde und Rinder.
Die Mongolen, Männer wie Frauen, denen wir in diesen vier Tagen begegneten – es waren kaum einige Dutzend – waren nach tibetischer Sitte gekleidet. Sie trugen, wie die Barun-Leute und wie alle Kuku nor-Tibeter, eine kleine, spitze, kokette Filzmütze mit roten Fransen an der Spitze und einem weißen Lammfellbesatz am Mützenrand. Hosen hatten sie keine an, nur lange, die Waden deckende, lederne Stulpenstiefel und den dicken Pelzmantel, der über die Knie hinabreichte, auf dem bloßen Leib. Die Männer trugen auffallend häufig Schnurrbärte und ließen sich außerdem eine kleine »Fliege« am Kinn stehen. Alle anderen Barthaare wurden mit der Pinzette ausgerissen. Die Haarfarbe war oft geradezu blond. Auch von Laien wurde der Kopf häufig rasiert getragen.
Das Leben der Tädschinär spielt sich gar einförmig ab. Die Yurten stehen meist allein, und von einer zur anderen ist es immer eine weite Strecke. Trotzdem ist die Aufsicht des Tädschinär-Fürsten, des Dsassak, sehr streng, und jede Familie wird alljährlich um mehr als den Zehnten besteuert. Die alte Ani mußte z. B. einen vierjährigen Wallach und sechs Ziegen abliefern. Der Dsassak bezahlt damit die Priester, die für sein Seelenheil Gebete lesen.
Mein Golmo-Führer war ein lederner Geselle. Den ganzen Tag betete er seine Litaneien herunter und wurde mürrisch, wenn ich ihn einmal unterbrach und etwas wissen wollte. Obwohl er mich vier Tage weit begleitete und der Ani die dreizehn Pferde wieder sicher zurückbringen mußte, hatte er nicht einmal ein kurzes Schwert als Waffe bei sich. Dagegen warf er jeden Abend, um den sichersten Weg herauszufinden, einige Schulterblätter von Schafen in das Lagerfeuer und konstruierte sich aus den durch die Hitze entstandenen Spalten die Zukunft. Er erfuhr so, welchen Weg wir einschlagen mußten, ohne angegriffen zu werden. Jeden Abend war er sehr zufrieden mit sich, weil seine Rechnung stimmte und wir keinen Räubern begegnet waren. Die Tädschinär-Mongolen sind heute ganz unkriegerisch. Von der alten mongolischen Waffentüchtigkeit ist hier rein nichts übriggeblieben. Wenn die ngGolokhs einen Streifzug in ihr Land machen, so ziehen die Tädschinär immer den kürzeren. Sie vertrauen auf die Abgeschiedenheit ihres Landes, auf die Wüsteneien, die sie rings umgeben. Drei Jahre vor meiner Ankunft in Golmo waren aber doch sechs tibetische Desperados dorthin gekommen. Diese konnten alles, was ihnen zu Gesicht kam, wegtreiben. Zehn Jahre vorher – erzählte mein Führer – hatten die ngGolokhs den Bergtädschinär viele tausend Schafe und Yak geraubt, und nie konnten die Mongolen ihr Eigentum wieder zurückerobern.
Am 13. Oktober kamen wir an den Lagerplatz Tengelik zu dem Hoschu dsangen (Oberst) Lama dyi. Zwei ärmliche Yurten lagen – nur für den Wissenden auffindbar – in dem niederen Buschwald, zwischen den Harmek-Sträuchern versteckt, die über und über mit roten Beeren beladen waren. Mein Golmo-Führer kehrte hier, kaum daß wir angekommen waren, mit den dreizehn Pferden wieder um, und ich war für die Weiterreise auf die Hilfe des Hoschu dsangen oder des Herrn Regimentskommandeurs angewiesen. Dieser ist nach dem Dsassak in Tädschinär einer der höchsten Beamten und verwaltet das Grenzland gegen den Dsun Dsassak als ziemlich unabhängiger Herr. Er ist Inhaber des roten Knopfes.
Ich sandte ihm sogleich einen Khádar und suchte ihn in seiner Behausung auf. Ein hagerer und groß gewachsener Mann mit auffallend intelligenten und entschlossenen Zügen empfing mich ziemlich freundlich. Sein Heim war in der gewöhnlichen Weise ausgestattet, nur waren darin auffallend viele Gewehre und Schwerter aufgehängt. Man sah, daß man es mit einem Kriegsmann und Grenzwächter zu tun hatte. Seine Frau, die bei meinem Eintritt sofort das Feuer anfachte und Tee kochte, entpuppte sich als Tibeterin aus Dscherku ndo und als eine alte, gute Bekannte meines Da Tschang. Sie trug aber jetzt in Tsʿaidam ihr Haar ganz in der Art der verheirateten Mongolinnen. Zwei dicke, schwarze Haarflechten hingen ihr vor den Ohren bis über die Brust und steckten am Ende in gestickten Zopftaschen. Auch der Hausherr selbst war meinem Tschang kein Fremder. Sie hatten in Kʿam im selben Hause gewohnt, als Tschang bei den Soldaten diente und zur Begleitmannschaft des Hsi ninger Kommissars gehörte. Der Hoschu dsangen war damals der Vertreter des Tädschinär-Dsassak der chinesischen Regierung gegenüber. Er hatte als solcher schon mehrere Male chinesische Steuerkommissionen nach Kʿam begleiten müssen. Von einer dieser Expeditionen hatte er auch seine jetzige Frau mitgebracht.
Der Hoschu dsangen Lama dyi und seine Frau waren in keiner geringen Aufregung. Eben hatten sie die Nachricht bekommen, daß der Dalai Lama aus Da kuren (Urga) in Hsi ning fu eingetroffen sei und sich auf den Weg nach Lhasa mache. Sechshundert Kamele und Tausende von Pferden sollten in allernächster Zeit von den Dam-Mongolen gestellt werden, um die vielen tausend Tael Silber, die ihm die Gläubigen geschenkt, und ungezählte Lasten europäischer Gewehre und Patronen, die von den Olosse, den Russen, stammen sollten, nach Zentraltibet zu tragen. Nicht mit Freude, sondern mit großem Kummer sahen die Leute dem Kommen »Seiner Göttlichkeit« entgegen. War es doch gleichbedeutend mit dem Verlust der Hälfte der Tiere, wenn wirklich der Dalai Lama, wie behauptet wurde, noch im Winter über die Tschang tang zog. Sie hatten ja dafür keinerlei Entschädigung, sondern nur den Segen zu erwarten. »Was nutzt der Segen, wenn die Tiere tot sind!« rief unter Schluchzen die nur halb bekleidete Frau, die neben Kinderpflege Wenn ihr Kleinster hustete, blies sie immer auf die Stelle der großen Fontanelle. und Teekochen an der Unterhaltung teilnahm.
Unter diesen Umständen zeigte der Hoschu dsangen nicht die geringste Lust, mir Pferde zu vermieten oder von seinen Untertanen mir vermieten oder verkaufen zu lassen. Ich konnte es ihm nicht verdenken, aber ich konnte auch nicht ewige Zeiten ohne Zelt im Freien leben.
»Ich habe einen großen Paß vom Selang amban, und ich bin ausgeplündert worden. Du, als Oberst, mußt mir helfen,« erklärte ich ihm.
»Der Paß geht mich nichts an. Ich kenne nur die Befehlsschreiben der Amban-Dolmetscher. Auch gibt es von hier an nach Osten zu zahllose Räuberbanden. Zumal jetzt im Herbst, wenn die Pferde fett sind, wimmelt es von bösen Gesellen auf allen Straßen Schon in den chinesischen Thronberichten von vor Christi Geburt ist zu finden, daß die »Kiang«, d. h. also die alten Tibeter, stets im Herbst, wenn ihre Pferde rund sind, Raubzüge unternehmen.. Es können hier nicht, wie zwischen Golmo und Tengelik, ein Greis und ein Kind die gemieteten Pferde heimbringen. Sie sind nur in den Händen von vielen Bewaffneten sicher.«
Der Tsamba, den wir aus Golmo mitgebracht, ging mittlerweile rasch zur Neige. Der Hoschu dsangen aber wollte uns neue Vorräte nur gegen ganz unverschämte Preise liefern. So wurde es für mich zur Lebensfrage, von hier fortzukommen. Nach Rücksprache mit Da Tschang versuchte ich es endlich mit grobem Geschütz. Ich streckte ihm meinen kleinen Finger ins Gesicht, was ungefähr der größten Beleidigung gleichkommt, die man ihm antun konnte. Was alles Bitten nicht fertiggebracht hatte, gelang meinen Drohungen in kürzester Frist. Plötzlich erklärte er sogar, den »großen Olosse Amban« in höchsteigener Person begleiten zu müssen, und er versprach, mich über Nomochʿan bis in das Herbstlager des Beïli der Kukut nor-Mongolen, die am Nordostrand des Tsʿaidam-Sumpfes sitzen, bringen zu wollen.
Am letzten Abend in Tengelik kampierte eine lustige Gesellschaft neben uns: Hädschir-Mongolen, die in Nomochʿan ihren Jahresbedarf an Gerste gekauft hatten. Es waren lauter junge Leute, fünf Männer und drei Mädchen, ein lustiges, leichtsinniges Völkchen. Die ganze Nacht drang Gekicher und Gelächter zu uns herüber, und bis Mitternacht sangen sie. Spät erst zogen sie am Morgen weiter. Die Mädchen saßen wie die Männer stramm zu Pferde. Sie hatten selbst ihre Reittiere, ja auch die Packpferde gesattelt und beladen. Ihr Reisegepäck war, abgesehen von ihren Gersteladungen, recht spärlich. Ein gemeinsamer Kochtopf und ein Blasebalg, etwas Butter und Tee und die Kleider, die sie auf dem Leibe trugen, war alles, was sie für ihre zweimonatige Reise mithatten, dabei ging die Nachttemperatur jetzt, um die Mitte des Oktober, auch in der Tsʿaidam-Ebene meist unter – 10° hinab, und ohne viel Unterbrechung blies ein kalter Wind aus Westen.
Hinter Tengelik ging es am ersten Tag mit Lama dyi und zwei Mongolen, die alle mit Gewehren bewaffnet waren, bis in die Nacht hinein durch dichten und hohen Wald.
Ich hatte bei dem Marsch durch den dichten Wald unser Häuflein nicht beisammenhalten können, und am Abend fehlten im Lager zwei Mann. Lama dyi und seine zwei Mongolen griffen zu ihren neun Würfeln und rechneten damit aus, ob die beiden beieinander seien, ob sie noch marschierten, oder ob sie gar von dem Bären, dessen frische Fußtapfen wir am Nachmittag im Staube unseres Pfades gesehen hatten, aufgefressen seien. Lama dyi hatte vor Bären große Angst und unterhielt die ganze Nacht rings um uns her lodernde Feuer. Die Bären, behauptete er, seien sehr erpicht auf Menschenfleisch und würden Menschen angreifen, wo sie sie treffen. Mit den Luntenflinten und den leichten Schwertern der Mongolen muß es freilich nicht leicht sein, einem Bären zu Leibe zu rücken. Die Mongolen hüten sich, in einen offenen Kampf mit den Tieren sich einzulassen. Jährlich wollen die Mongolen durch die Bären Menschenverluste haben. Dabei sollen jene erst im Herbste, wenn die Beeren reif werden, in die Ebene herabsteigen.
Am nächsten Morgen war Lama dyi sehr stolz. Er hatte aus den Würfeln gewahrsagt, daß die zwei Verlorenen noch am Leben seien und wieder zu uns stoßen würden. Wenige Stunden nach Sonnenaufgang fanden sich die beiden auch wieder zu uns. Tschaschi, der eine von ihnen, war die ganze Nacht umhergeirrt. Tschang hatte eine Mongolenyurte gefunden, angenehme Bekanntschaft darin angeknüpft und die Zeit vergessen.
Lama dyi war uns weiterhin ein recht guter Gesellschafter. Er verkürzte durch viele Geschichtchen den einförmigen Weg über die Sand- und Salzflächen.
Daß er und sein Begleiter (Tafel XXIII oben) – vom zweiten Tage an hielten sie es nur noch nötig, zu zweien zu sein – sehr »religiös« waren, brauche ich kaum noch zu erwähnen. Auf dem Marsche wurde auch von ihnen unausgesetzt laut gebetet, und jeden Abend bauten sie aus Erdschollen einen kleinen Altar, auf dem bei Sonnenaufgang Tamariskenzweigchen den Ortsgeistern verbrannt wurden. Sie weissagten bei jeder Rast aus Schafschulterblättern, aus neun Würfeln und aus den Rosenkränzen, was in den nächsten Stunden passieren würde. Als ein Rabe kam und mich krächzend umflog, sagten sie gleich, ich hätte großes Glück und würde noch sehr reich werden. Der Rabe ist in Tibet ein Glücksvogel. Auch bei den Lama gilt der Rabenruf für ein gutes Zeichen. Wenn er frühmorgens vor einer Priesterzelle ertönt, sagt sich der Insasse, man werde heute noch nach ihm rufen und ihn für Gebetelesen gut bezahlen. Schon unter den Chinesen in Hsi ning aber gilt der Rabenruf, zumal in Gegenwart von Kranken, für ein schlechtes Vorzeichen. Die Chinesen nennen den Raben »lao wa«, und er soll »Wa! wa!«, d. h. »Grab! grab!« (grab ein Grab!) rufen. Wenn er vor einem Krankenzimmer krächzt, werfen ihm die Chinesen ein Papier vor, worin Asche ist, und heben damit seinen Bann auf.
Lama dyi vergaß nie, wenn wir Tee gekocht hatten, über unsere Tardo (tab rdo), über die drei Steine oder Erdschollen, die das dreifüßige Gestell unseres Kochgeschirrs bildeten, die gebrauchten Teeblätter auszuschütten. Dies galt als Opfer für die Ortsgeister. »An der Feuerstelle«, sagte er, »ist die Wohnung unseres Schutzgottes (tab lha, entspr. dem chin. Tsʿao schen) und des Ortsgenius, die uns schaden oder nützen werden, je nachdem wir unser Tardo behandeln.« Die Tardo, die drei Steine unseres Waka, stellte auch Lama dyi wie mein Tschʿeng stets neu zusammen, aus Aberglauben benutzte man nie die einer früheren Reisegesellschaft. Beim Aufbruch sprach er immer die Worte über das Tardo: »Ich werde dich wiedersehen.« Das geschah in der Hoffnung, daß der an der Feuerstelle wohnende Gott, dem er zu essen gegeben hatte, ihn vor jeder Gefahr schützen und glücklich wieder bis an diesen Platz zurückbringen werde. Daß er mit den Worten: »mtschod bambel« von jeder Speise den Göttern einen Opferguß zuwarf, ehe er davon kostete, brauche ich nach früheren Erzählungen kaum noch zu erwähnen.
Meine Führer hielten auch immer sehr darauf, daß wir alle Knochen fein säuberlich abnagten. »Reisende, die nicht reinen Tisch machen,« bedeutete mir Lama dyi, »werden in Tibet sicher von allen Räubern überfallen; an ihrer Verschwendung erkennt man sie als Fremde und reiche Leute, und die Räuber stellen ihnen so lange nach, bis sich eine günstige Gelegenheit zu einem Handstreich bietet.« Alle Knochen wurden von ihm sorgfältig aufgeschlagen und das Mark herausgenommen. Nur die Tibia durfte nie geöffnet werden. Warum gerade diese, konnte ich freilich nie feststellen; es sei sehr gefährlich, wurde ich belehrt.
Wenn einer von uns niesen mußte, meinten sie, irgend jemand habe in der Ferne den Namen des Niesenden ausgesprochen; weiße Flecken auf den Fingernägeln bedeuteten, wie in China, daß irgendwo ein Verwandter gestorben sei, und wenn einer rote Ohren bekam, hieß es gleich, man habe zu Hause Schlechtes über uns gesagt. Wenn ein Schaf geschlachtet worden war, wurde immer der Milzrand betrachtet und daraus auf die Zukunft geschlossen.
Die Dam-Mongolen sind in ganz demselben Aberglauben befangen wie die Tibeter. Sie glauben auch, durch ein Haar oder durch ein Stückchen Fingernagel, das man in einen die betreffende Person vorstellenden Tonklumpen knetet, weiter durch ein Bild, durch eine Photographie einen Menschen mit Beschwörungen zu Tode hexen zu können.
Täglich wurden mit Lama dyi 50–60 km zurückgelegt. Nur zweimal wurde abgekocht und den ganzen Tag in flottem Schritt geritten. Am zweiten Tag hinter Tengelik ging es noch immer fast genau ostwärts weiter. Wir kamen bald aus dem großen Wald heraus. Der Piedmont gravel, der vom Fuß des Dsun mongu ula und Burkhʿan buda, einer kahlen und weit herausspringenden Bergmasse des Hochtibetrandes im Süden, zu uns herbeizog, grenzte jetzt hinter einer schmalen Dünenkette an Salzquellen und nackten Salzsumpf, der zum Glück ziemlich trocken war, so daß die Tiere nur selten einmal bis an die Knie einbrachen und mühevoll herausgehoben werden mußten.
Mitten durch diese Salzwüste geht die Grenze vom Tädschinär-Dsassak- und Dsun-Dsassak-Gebiet. Am Abend schlugen wir am Hʿara (Khara) usse gol unser Lager auf. Der Fluß wälzte dicke, braune Fluten in großen Mäandern nach Nordwesten. Er war 10 m breit, aber kaum über 1 Fuß tief und das Bett nur ganz wenig in die Ebene eingelassen. Im Oberlauf ist der Hʿara usse gol ein viel ansehnlicheres Wasser gewesen, ist es doch der Wulasetä gol, an dem ich im Juli gelagert hatte. Auch der Ikhe gol, Türketse gol und andere finden ihre Fortsetzung in diesem Hʿara usse (Schwarzwasser).
Durch die öde, völlig baum- und strauchlose Weite schob sich das trübe Wasser stumm, ohne jedes Geräusch. Vollkommen tot lag alles Land. Ohne ein Wölkchen zu zeigen, lastete der Winterhimmel Zentralasiens darüber. Und doch bot sich hier ein herrliches Bild. Wie ein reifes Kornfeld wogte das schmale Schilfband am Ufer – es war das einzige, was die Tiere zum Fressen fanden. Rings deckte die Ebene nur Salz und Salpeter. Das blendende Weiß des Salzes verfloß mit dem Weiß des Eises, das sich am Uferrand gebildet hatte. Nur als feine Linien hoben sich die fernen, fernen Berge, die diese lebensfeindliche Öde umsäumten, vom Himmel ab. Als die Sonne sich dem Horizonte näherte, legte sich über die Ebene ein grünlicher kalter Dunst, der uns bis ins Mark erschauern machte, tausend neue Reflexe hervorzaubernd. Und als es dunkel war und ich, wie rings die Männer, unter meinem Pelzmantel auf der Erde lag, auf das Geflüster des Schilfes horchend und auf die Salzkörner, die der leise Wind über mich rollte, da konnte ich kein Auge zutun. Kein Berg, kein Fels, kein Strauch warf eine ruhige Silhouette, an der das Auge haften konnte. Nur Millionen und aber Millionen Sterne flimmerten rings um mich her, noch am Horizont blitzten sie so hell durch die klare Hochgebirgsluft wie oben im Zenit. Mir schwindelte, und ich fühlte mich noch gegen Morgen in meinen Träumen mutterseelenallein auf der Oberfläche eines Ozeans treiben, willenlos, nicht wie es mir, nur wie es dem Fatum gefiel, und wie es Lama dyi mit seinen neun Würfeln im voraus berechnete.
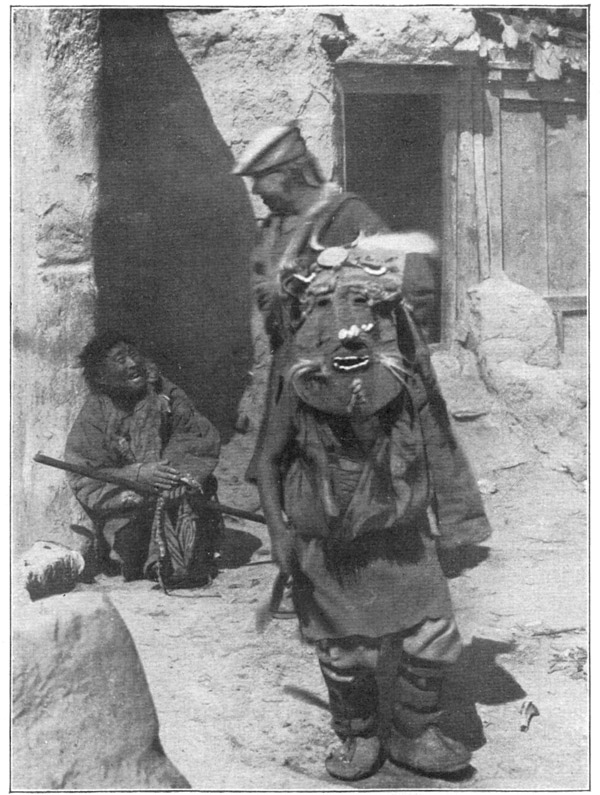
Tafel XXI
Bettler und Gaukler in Dscherku ndo.

Tafel XXI
Dyoba Dyentsen.

Tafel XXII
Ein Lab rtse (Obo) mit Pfeilen und Speeren zur Bekämpfung des Hagels (nördlich Karlong).

Tafel XXII
Bettelmönch aus Kʿam.
»Ja, wir lieben dieses Land, unser Heimatland«, sagten mir die Mongolen. Lama dyi konnte gar nicht verstehen, daß ich seine Heimat nicht herrlich fand, daß ich nicht am liebsten bei ihm geblieben wäre. Die Wüsten, die rings seine Heimat umgeben, wo die kleinen Erdgeister (gji bdag) den Boden nicht für die Menschen zurechtgerichtet haben, machten ihm sein Land ganz besonders anziehend, denn es ist durch sie vor Ketutse und Tangutse, vor Chinese und Tibeter geborgen.
Hinter dem Hʿara usse ging es in genau nordöstlicher Richtung weiter. Salz- und Salpeterflächen, mit Erde und Sand vermischt, selten aber rein auskristallisiert, machten sich überall breit. Wir querten mehrere Arme des Bayan gol, der in seinem Oberlauf den Namen Yoghore gol führt und von Lama dyi für den Lu scha ho der Tang sen-Sage gehalten wurde. Am Abend lagerten wir am Ufer des Bulungir gol. Wir hatten damit den Nordrand des Tsʿaidam-Sumpfes erreicht, denn der Bulungir gol empfängt sein Wasser bereits aus den Schluchten des Serluk (Sarlik) und Timurtu ula. Wir waren die ganze Strecke in den Fußtapfen vieler hundert Pferde geritten. Es waren die Spuren des »bu se«, des Almosens, das der Tädschinär-Dsassak dieses Jahr an das Kloster Gum bum gezahlt hatte. Vierhundert drei- bis vierjährige Tiere hatten die Lama von ihrer Sommerkampagne heimgetrieben.
Die beiden Mongolen wurden nun immer vorsichtiger. Sahen wir in der Ferne einige Kyang, so fürchtete Lama dyi gleich, es seien Reiter und Räuber. Am Abend des vierten Reittages kamen wir an Zelte, an die Yurten des Beïli, des Fürsten der Kukut-Mongolen, die zwischen Dünen von stattlicher Höhe versteckt lagen. Der Ort heißt Tsokhʿo und ist eine Oase, die jeden Herbst vom Beïli aufgesucht wird.
Hier in Tsokhʿo hoffte ich, vom Beïli neue Pferde mieten zu können. Wir trafen jedoch in den zehn bis fünfzehn Yurten nur zwei Priester und im übrigen Frauen an, die die Milchwirtschaft besorgten. Der Fürst war mit seinen Knechten 100 Li weiter im Süden am Tsaghan usse, um dort seine Gerstenfelder abzuernten.
Nicht einmal Tsamba war in Tsokhʿo aufzutreiben. Ohne die Erlaubnis ihrer Gatten wollten die zurückgebliebenen Frauen uns nichts verkaufen. Wir wären halb verhungert, wenn nicht auch bei den Kukut tse die Sitte bestände, daß innerhalb der Familie den Frauen und Kindern Ziegen und Schafe als Eigentum zugeteilt werden. So konnten wir uns wenigstens auf Fleischkost setzen, indem mir die Fürstin ein Schaf, das ihr persönlich gehörte, gegen zwei kleine Türkisen abließ.
Etwa 60 km östlich von Tsokhʿo lagern im Herbst die Untertanen des Kukut beïli an einem Dalan Turgan genannten Platz. Sie stehen unter der Aufsicht eines Meren, eines Beamten dritter Klasse, mit einem blauen Knopf, eines Taidschi, dem die Tsʿaidam-er Chronique scandaleuse intime Beziehungen zur Frau Fürstin nachsagte. Nach vielem Bitten und Versprechen brachten mich der Hoschu dsangen Lama dyi und sein Begleiter noch bis dorthin. Im letzten Lager reinigten sie ihre Gabelflinten mit großer Vorsicht. Sie scheuerten die Läufe mit Sand blitzend blank; schließlich rieben sie sich dann noch ihr Schießpulver zurecht, wobei Lama dyi mit großer Verachtung von dem schlechten Schwarzpulver sprach, das die chinesischen Soldaten, insbesondere die der Garnison von Hsi ning, verwenden. Mit einer langen Rede, mit vielen blumenreichen Lobsprüchen tauschten wir zum Abschied einen Khádar aus und gelobten uns ewige Freundschaft. Wenn ich wiederkomme, sollte ich Frau und Kinder mitbringen und mit ihm in seiner Yurte wohnen.
Der Meren der Kukut-Mongolen gab sich als ein trockener und einsilbiger Mann. Er lebte aber mit einer sehr hübschen, jungen, kräftig gebauten Frau zusammen, die mich in der engen Yurte bewirtete und so gut aufnahm, daß ihr Ehemann allen Grund hatte, eifersüchtig zu werden. Zum erstenmal seit dem Unglückslager droben hinter dem Tschü mar schlief ich wieder eine Nacht unter einem Zeltdach. Ich habe aber diese Nacht nicht einmal gut geschlafen, denn da die Temperatur in der Yurte, wo wir zu dreien auf dem Boden lagen, über den Gefrierpunkt stieg, wurde es mir viel zu heiß.
Hinter Dalan Turgan – von den Kukut-Mongolen zu den Wang ka-Mongolen – brauchten wir nur zwei Tage, um wieder zu Menschen zu kommen, freilich ritten wir immer von morgens bis abends. Der Weg blieb weiterhin trocken und wüstenhaft. Wir stießen wieder auf die große Straße, die die Lhasa-Karawanen von Hsi ning aus einschlagen, und kamen schon am ersten Tage, und ehe das Randgebirge erreicht war, über eine Wasserscheide, »chʿao torchʿä« genannt (3225 m hoch), auf der ein großes Steinobo stand, das unsere Führer umritten, mit voller Lungenkraft: »Lhá rdyalo! Lhá rdyalo ooo!« rufend. Von allen wurden neue Steine dem großen Steinhaufen des Obos zugefügt Auch die chinesischen Lastträger legen Steinbrocken auf die Pässe, wenn auch auf etwas andere Art. Sie werfen die Steine nicht auf einen Haufen, sondern stellen Kiesel und faustgroße Steinplatten aufrecht an den Rand des Weges.. Bald hinter dem Sattel senkte sich der Weg zwischen nackten Felsen immer tiefer, wir zogen durch das Domu gaschu-Tal zwischen wildzerrissenen Schluchten, bis wir bei Einbruch der Dämmerung das Ser uk- (zu deutsch: Yak-) Gebirge hinter uns gebracht hatten. Und wiederum lag ein riesiger Salzsumpf vor uns, der unabsehbare Kilometer weit nach Nordwesten sich hinzog. An seinem Ufer legten wir uns endlich zum Schlafen nieder. Unsere Führer banden die Nasenseile der drei alten Kamele, die man uns in Dalan Turgan vermietet hatte, eng zusammen, so daß keines von ihnen weiden, zugleich aber auch keines nach dem langen Tagesmarsch sich noch weiter seine Fußsohlen auf den vielen spitzen Steinen wundlaufen konnte. Außer den alten Kamelen hatte man mir in Dalan Turgan noch sechs wohl sechzehn- bis zwanzigjährige Ponys vermietet. Sie zeigten eine ganze Musterkarte von alten Huf- und Beinübeln. Man hatte mir erst 1 Tael für das Stück berechnet, und der Meren wollte behaupten, seine Mongolen hätten keine besseren, alle guten seien von den Tibetern gestohlen oder als Steuer an den Beïli bezahlt worden. Durch viele Kreuz- und Querfragen in die Enge getrieben, gestand er aber schließlich ein, daß es Tiere seien, die der »Wang«, der König, vom Kuku nor für sich gekauft habe, denn der habe ein »Geschäftchen« mit den Wan̂schdächʿe gehabt und müsse jetzt Blutgeld für einige erschossene Tibeter bezahlen. 120 Pferde seien von den Parteien als Sühne ausgemacht worden; da aber nicht festgesetzt worden sei, was für Pferde gezahlt werden müßten, so kaufe der Wang überall Pferde für 1–2 Tael (nach dem damaligen Kurse 3–5 Mark) das Stück zusammen. Was für eine stolze Kavalkade wir darum auf dieser Strecke gebildet haben, kann sich jeder leicht vorstellen.
Von dem langgestreckten Becken, in dem der flache Salzsumpf des Serkhe nor in einer Meereshöhe von 2950 m sich breitmacht, ging es unmerklich flach ansteigend auf eine breite Talmündung los und zum Dulan-Flüßchen, das von Nordosten hereinkommt. Weiter im Norden wie im Süden hoben sich hohe, aber ganz kahle, gelbe Felsgebirge aus der fahlfarbenen Steppenfläche. Die Landschaft machte keinen freundlichen Eindruck. Alles war trocken und dürr. Überall waren die Täler von Schuttmassen erfüllt, auf denen große Büsche einer harten Grasart (Cobresia) wuchsen, die kaum die Kamele anrühren mochten.
Etwa 6 km links von meinem Wege hob sich aus der flachen Ebene ein Baum und ein hofartiges Bauwerk heraus. Es war das frühere Kloster und Wohnhaus des Kukut Beïli, das seit 1896 verlassen ist. Fliehende Dunganen hatten es nach der Niederwerfung des Aufstandes um Hsi ning fu geplündert und niedergebrannt. Einige Kilometer rechts von uns lag, wie ein Würfel aus der Ebene herausschauend, ein altes chinesisches Fort und ein Exerzier- und Paradeplatz dabei, der auch seit jener Zeit verlassen und tot daliegt.
Als uns diese beiden Bauwerke zu Augen kamen, wurden alte Erinnerungen bei meinen Leuten wach. Mein Ma aus Bamba war unter den Mohammedanern gewesen, die die Häuser des Kukut Beïli angezündet hatten, Sung aus Kue de aber war unter den die fliehenden Mohammedaner verfolgenden chinesischen Soldaten und hatte einen vollen Monat lang mit dem chinesischen Generalissimus Yen in dem alten Fort gelegen.
Als damals, im Januar 1896, nach Hsi ning fu nur erst das Gerücht durchgedrungen war, daß General Tung fu hsiang aus dem Japanisch-Chinesischen Krieg von der Mandschurei aus mit seinen gefürchteten Bataillonen in Eilmärschen nach Kan su rücke, um die Rebellion der Mohammedaner zu unterdrücken, flaute diese rasch ab. Die Kan su-Generale vermochten noch vor dem Eintreffen Tung fu hsiang's das während viereinhalb Monaten belagerte Hsi ning fu ohne weiteren Schwertstreich zu entsetzen und sogar einen großen Teil der Dunganen mit ihren Führern zusammen in Doba einzuschließen, in einer Feste, die unterhalb Bamba, wenig nördlich der Straße Hsi ning–Dankar, liegt. Mein Diener Han war damals unter den in Doba Eingeschlossenen gewesen. Nach wochenlangen Kämpfen und Stürmen verzweifelten sie schließlich am Erfolg ihrer Sache. Unter dem Feuer der modernen Feldgeschütze, die die Chinesen auf die Lehmburg gerichtet hatten, schmolz der islamitische Fatalismus und Fanatismus der Dunganen dahin. Sie baten die Sieger um Gnade, und als die Chinesen den Kopf des Haupträdelsführers verlangten, entstand Zwietracht unter den Mohammedanern, und es kam so weit, daß mein Han und einige andere dem Dunganenführer, der nicht an Unterwerfung denken wollte, in seinem eigenen Hause den Kopf abschlugen, das noch bluttriefende Haupt in einen Sack packten und es den Belagerern von der Mauer herab zuwarfen.
Damit war aber nur erst die Möglichkeit geschaffen, daß sich die Chinesen überhaupt auf Verhandlungen einließen. Mein Han sagte, auch sie hätten nie daran gedacht, daß die Chinesen ihr Wort halten und sich mit dem Kopf des Führers begnügen könnten. Die Chinesen verlangten jetzt, achthundert Männer sollten von den Dunganen selbst ausgesucht und zur Enthauptung ausgeliefert werden. Sechs Tage lang wurde von den zwei Parteien von der Mauer aus hin und her gefeilscht und schließlich die Zahl auf dreihundert herabgehandelt. Herzzerreißende Szenen spielten sich in der Festung ab. Ein edler Wettstreit soll ausgebrochen sein. Alle die dreihundert sollen sich freiwillig gemeldet haben. »Ich habe bei der Rebellion dies und jenes ausgefressen«, sagten die einen; »ich bin alt, habe nur noch wenige Jahre zu leben«, die anderen; »nimm du oder du meine Frau, adoptiere du mein Kind, ich will mich enthaupten lassen«, ein dritter. Als die dreihundert beieinander waren, machte man zum ersten Male ein verrammeltes Tor auf, räumte den Leichenhaufen, der höher als die eisenbeschlagenen Torflügel aufgehäuft lag, ein wenig beiseite und ließ den Trauerzug hinaus. Die dreihundert fielen in den nächsten Tagen ohne Ausnahme unter den Händen der Henker. Dann kam ein neuer General ins chinesische Lager, der die Strafe noch zu leicht fand. Neue Hekatomben wurden gefordert, neue Hekatomben opferten sich und zogen der Schlachtbank zu Rev. Ridley, der die Rebellion in Hsi ning fu mitgemacht hat, erzählt, daß in der Stadt wochenlang tagtäglich unzählbar viele Rebellen geköpft wurden. Von anderen hörte ich die Zahl mit achttausend angegeben. Auf chinesischer und dunganischer Seite zusammen hat die Rebellion weit über hunderttausend Menschen, Männern, Frauen und Kindern, das Leben gekostet..
Jetzt sollten die eingeschlossenen Dunganen ohne Waffen, Mann hinter Mann, die Umwallung von Doba verlassen und nach dem wenige Li entfernten, gegenüber im gleichen Tale liegenden Tschen hai pu marschieren. Einige zehntausend Mohammedaner machten daraufhin einen verzweifelten Ausfall und entwichen nach Norden in das Bamba-Tal; bedrängt von der chinesischen Armee flohen sie nach Tibet hinauf. Die anderen – darunter mein Han – ließen sich im Gänsemarsche nach Tschen hai pu abführen. Den ganzen Weg entlang standen auf der einen Seite chinesische Infanteristen, Soldaten aus Hu nan und Hu pe, auf der anderen chinesische Bauern der Umgebung. »Das ist der Ma Soundso, der ist ein schlechter Kerl, den kenne ich«, brauchte nur irgendein Bauer zu rufen, und schon wurde der betreffende Mohammedaner von den Soldaten gepackt und auf die Seite geschleppt. »Er hatte nicht mehr nötig, etwas zu essen,« meinte trocken mein Han, »ehe er Hunger bekam, war schon sein Kopf weg.«
Die sich nicht hatten abführen lassen, flohen sinnlos in die Steppe hinein. In den ersten Tagen wurden sie von hohen Schneemassen, die das Frühjahr gebracht hatte, aufgehalten und oben am See unausgesetzt von tibetischen Reiterscharen bedrängt, die keinen schonten, der nicht in der Masse mitkam. Nördlich vom Kuku nor ging der Zug nach Westen zu, in der Richtung, wo die »Kerbe«, wo Mekka, wo »Lumu gue« Eigentlich: Rumi guo, das Römerland. Gemeint ist die heutige Türkei mit Stambul, der alten Hauptstadt des oströmischen Reiches. liegt, wo ihr Kaiser, der Kalif, wohnt, für den sie doch alle diese Leiden auf sich genommen, dessen Mollah sie gefolgt waren, als sie das Joch des ungläubigen gelben Kaisers abschütteln wollten. Durch die noch winteröden Weiden der Gan̂ tsʿa-Tibeter ging's und schließlich in das Tal des Dulan gol und an den salzigen Serkhe nor. Manchmal hatten Mongolen oder Tibeter Mitleid und nahmen den einen oder anderen Mohammedaner, in dessen Haus sie ehemals als Geschäftsfreunde abgestiegen waren, bei sich auf. Auf solche Weise retteten sich die Brüder von Han, die ich in Barun besucht hatte.
Am Serkhe nor sahen die Flüchtlinge ein, daß alle verdursten müßten, wenn sie weiter die eingeschlagene Richtung beibehalten würden. Sie wandten sich deshalb nordwestwärts, An si tschou zu. Dort aber wartete ein neues chinesisches Heer auf sie. Sie wurden aufs neue aufs Haupt geschlagen, und die traurigen Reste (etwa 8000), der vierte Teil von dem, was das Bamba-Tal hinaufgeflüchtet war, wurde zuletzt zwangsweise am Lob nor von den Chinesen angesiedelt.
Ich hörte später noch andere Mohammedaner darüber und erfuhr noch manches von Dienern, die als junge Bursche den ganzen Auszug miterlebt hatten. In der Lob-Gegend fühlten sich die unternehmungslustigen Dunganen sehr unglücklich. Ihren Handelssinn konnten sie dort nicht betätigen. Die Felder waren schlecht und wurden fortwährend von Wildschweinen verwüstet. Der größte Teil siedelte darum ums Jahr 1902 in die Provinz Ili und an die russische Grenze über, von wo sie vom Jahre 1905 an wieder allmählich in das Hsi ningsche Gebiet zurückkehren. Vor allem suchen sich die meisten mohammedanische Weiber aus der Heimat zu verschaffen, weil diese viel hübscher, hauptsächlich aber weit billiger als die von Ili und Turkistan seien. Eine Vermischung der Dunganen mit den turkistanischen Mohammedanern scheint selten zu sein.
Den dunganischen Flüchtlingen war von Dankar aus der General Yen da ren mit tausend mit Mauser- und Remingtongewehren bewaffneten Reitern nachgesetzt. Er konnte aber nichts gegen sie ausrichten, da er hinter den Flüchtlingen drein mit den allergrößten Verpflegungsschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Im Dulan-Tal angekommen, war bereits sein ganzer Proviant, zweihundert Maultierlasten Mehl, verzehrt, und nur durch weit ausgedehnte und gewalttätige Requisitionen bei den tibetischen und mongolischen Stämmen konnte er es verhindern, daß nicht auch seine Schar wie die der Mohammedaner durch Hunger gelichtet wurde. Die Requisitionen waren aber so wenig ergiebig, daß er es nicht wagen konnte, den Mohammedanern in die menschenleeren Wüsten zu folgen. Seine Soldaten zwangen ihn, am Serkhe nor halt zu machen und auf den Nachschub vom Hauptquartier zu warten.
Mein Sung, der vor dem Marsch in die Steppe wie mein Tschang in den Laufgräben der Belagerer vor Doba gelegen hatte, erzählte mir, daß am Ufer des Serkhe nor Hunderte von Frauenleichen lagen, die in ihren Durstqualen das Salzwasser des Sees hinabgewürgt hatten. Oft hielten die starren Finger noch die Trinkschale fest. Auch seien seine Kameraden in den Wäldern hinter dem Kloster Dulan beim Holzholen auf Frauenleichen gestoßen, die von den Wölfen halb abgenagt waren. Oft hingen nur noch die Oberkörper und die Arme im Gezweige. Herzzerreißend klang der Bericht von den Leiden und dem Ende der Frauen und Töchter des einstigen mohammedanischen Obersten in der chinesischen Armee, Ho. Sie flohen, wie alles floh, von Bamba vor der Soldateska Tung fu hsiang's. Auf ihren kleinen, zusammengeschnürten Humpelfüßchen konnten sie aber bald nicht mehr mit der fortdrängenden Masse Schritt halten und blieben ohne jede Nahrung zurück. Sie lebten von den Leichen am Wege. War an diesen kein Fetzen Fleisch mehr, so zerrieben sie die Knochen zwischen Steinen und aßen das Knochenmehl. Völlig entkräftet wurden sie von den chinesischen Reitern aufgegriffen und zum großen General geschleppt. Er ließ sie eine Weile herausfüttern, ehe er aber vom Serkhe nor aus weiterzog, wurden sie totgeschlagen.
Nach der langen Wartezeit erhielt General Yen einen Proviantzug von vierhundert Maultierlasten Mehl und Reis nachgesandt. Nun erst konnte er wieder an Verfolgung denken. Um diese Lieferung bewerkstelligen zu können, hatten Wei Fan tai und Tung fu hsiang siebenzig vermögende und einflußreiche Dunganen, die sich ihnen in Doba gestellt hatten, aufgefordert, auf eigene Kosten die Maultiere nebst Lasten auszurüsten und zu General Yen zu schaffen. Sie erhielten dafür nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr sonstiges Eigentum zugesichert. Prompt kam die Lieferung auch an. Eitel Freude herrschte unter den chinesischen Reitern und auch bei den siebenzig Mohammedanern. Wußten sich doch jetzt beide Teile gerettet. Einen Tag jedoch, nachdem die Proviantkolonne ihr Ziel erreicht hatte, übergab ein Kurier ein Schreiben Tung fu hsiang's an General Yen. Der Höchstkommandierende befahl darin kurz: »Tötet die siebenzig Rebellen, die das Getreide gebracht!« und gehorsam ließ Yen die siebenzig Köpfe in den Sand rollen. Dabei fiel auch Yi hsien scheng, der zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts den amerikanischen Botschafter in St. Petersburg, William Rockhill, auf seinen so erfolgreichen Reisen durch halb Tibet und China begleitet hatte
Einen gleichen Wortbruch beging der Präfekt von Hsi ning während der Belagerung der Stadt. Es kam zu seinen Ohren, daß einer seiner Soldaten, der die Wache auf der Mauer hatte, Mohammedaner sei. Der Präfekt versprach dem Manne, er mache ihn zum Offizier, wenn er ihm eröffne, was er von den Absichten seiner Glaubensgenossen wisse. Als dieser von einem Sturm auf die Stadt und noch anderem geredet hatte und nichts mehr wußte, sagte der Präfekt ruhig zu ihm: »Gui i chia!« (Knie nieder!), und sein Kopf fiel. Das Volk forderte allerdings damals diese äußerste Strenge gegen die Rebellen. Als der Amban und der Dao tai von Hsi ning nach der Niederwerfung mild verfahren wollten, zog eine Volksmasse nach ihrem Ya men und holte die alten Herren heraus; um ein Haar wären beide im Fluß ertränkt worden, weil sie durch ihre Milde sich der Bestechung verdächtig gemacht hatten.
Die Kan su-Chinesen halten ihrerseits die Mohammedaner für beispiellos wortbrüchig. Sie führen stets das Sprichwort im Mund: »Iß das Brot der Mohammedaner, aber höre nie auf das, was sie dir sagen.«.
Vom 23. bis 28. Oktober lag ich im Tale des Dulan gol zwischen dem Kloster Dulan gomba und dem alten Chinesenfort, worin General Yen auf seinen Proviant gewartet hatte. Wir lagen am plätschernden Bache wenige hundert Schritte von den Yurten des Wang ka-Mongolenstammes. Es waren aber kaum achtzig Stück davon im ganzen Tal zu zählen. Einige säuberliche, weiße Filzyurten bezeichneten den Sitz des Tschʿing hai tschün wang ye, des Königs vom Kuku nor. Schafe, Pferde, große Kamelherden und farbige Rinder weideten an den staubig trockenen Hängen, auf den nicht sehr hohen Felshügeln, die in zahllose trockene Risse und Felsschluchten zernagt waren. In dem breiten Tal sah man breite Geröllterrassen, in die sich der Bach aber nur wenig eingeschnitten hatte.
Gleich nach der Ankunft hatte ich meine chinesische Visitenkarte und eine Rolle Seidenzeug zum Wang ye gesandt, um eine Audienz zu erhalten. Mein Geschenk wurde zwar angenommen, aber den Wang ye bekam ich dafür nicht zu Gesicht, und niemand verkaufte oder vermietete mir Tiere, um meine Sachen weiterzuschaffen. Ich saß als geschlagener Flüchtling auf meinen paar Kisten am Bachrand, wo mich der Meren abgesetzt hatte, und konnte schlechterdings nichts anderes tun, als warten und immer aufs neue versuchen, vorgelassen zu werden. Ging ich zur Behausung des Wang ye, so ließ sich die Steppenmajestät immer krank melden oder antworten, sie sei durch die Vorbereitungen für einen großen Kamelprozeß in Anspruch genommen.
Zu meinem Glück erschienen am dritten Tage zwei chinesische Dolmetscher aus dem Amban-Ya men. Sie hatten die Streitsache zwischen dem Wang ye und dessen nächsten Nachbarn, den Nian̂er-Wan̂schdächʿe-Tibetern, zu schlichten. Die letzteren hatten dem Wang ye angeblich fünfzig Kamele gestohlen, wollten aber nichts davon wissen. Der Zufall wollte es, daß Schü der eine der Dolmetscher war. Dieser hatte mich und Filchner 1904 auf der Hoang ho-Reise begleitet und kannte mich daher. Überraschend schnell gelang es durch seine Vermittlung, den Wang ye zu sprechen.
Ein wenig kräftig aussehender, schmächtiger Mann, nahe an sechzig Jahre alt, empfing mich vor der Tür seiner Yurte. Ich hätte eher geglaubt, einen biederen Schneidermeister oder vielleicht einen kleinen Rentier vor mir zu haben als den König vom Kuku nor. Das kleine, dünne Manneken hatte auch schon gar nichts von einem wilden, asiatischen Despoten, obwohl er à la Fan tse in einen großen Pelzrock gekleidet war und ein schönes Schwert mit silberner Scheide horizontal in seinem Gürtel stecken hatte. Auch nicht eine Spur des Geistes der großen mongolischen Kriegshelden, eines Dschinggis Khan und Tamerlan, sprach aus den Zügen dieses Epigonen. Kein Zoll verriet den König! Nach einer zeremoniellen chinesischen Begrüßung führte er mich in seine Empfangsyurte, die neben einer Tempelyurte und einigen Wohn- und Wirtschaftsyurten stand. Nie hatte ich ein gleich wohnliches Heim bei den Dam-Mongolen gesehen. Die Yurte war viel größer als alle anderen und innen ganz mit grünem Wollstoff ausgeschlagen. Bunte Knüpfteppiche lagen auf dem Boden. Eine Art Pritsche, gleichfalls mit Teppichen belegt, und einige Truhen standen an der runden Wand. Bronzekannen und bronzene Herdgeräte, ein breiter Bronzereif mit getriebenen Svastika-Ornamenten rings um die Feuerstelle vervollständigten die Behaglichkeit der Nomadenwohnung des Steppenkönigs; alles atmete darin Wohlhabenheit.
Das Reich des Tschʿing hai tschün wang ist heute in drei Teile gespalten Als die Altai-Mongolen des Nordens unter ihrem Dschinggis Khan nach der Zerstörung des damals bestehenden Hsi Hsia-Reiches die Herren Innerasiens und kurz darauf die Herren des chinesischen Reiches geworden waren, wurden sie auch die nominellen Beherrscher und Beschützer des Kuku nor-Gebietes. Keine ihrer Familien hat sich aber damals hier niedergelassen. Sie waren dazu viel zu wenig volkreich. Erst lange nach der Vertreibung der Mongolendynastie aus dem eigentlichen China drang im Jahre 1509 ein Altai-Mongolenstamm in das Kuku nor-Land ein, warf die Tibeter, die dort Königreiche hatten, vertrieb sie aus der Seegegend und machte, was nicht nach Süden entfloh, zu Hörigen. In den folgenden Jahrzehnten wiederholten sich die Einfälle, sowohl der Ost- wie der Westmongolen, und in der Mitte des 17. Jahrhunderts errichtete Guschri Khan, der ein Nachkomme eines jüngeren Bruders von Dschinggis Khan sein soll, in Lhasa ein mongolisch-tibetisches Reich, das den ganzen Kuku nor, Amdo und Kʿam mit einbegriff. Er übernahm aber nicht selbst die Herrscherrolle in Lhasa, sondern er machte den Großabt der Gelug ba, den fünften Dalai Lama zum Gott und zugleich zum Beherrscher von Zentraltibet und schuf damit den Grund für das bis heute währende gelbe Priesterreich Lhasa. Er selbst behielt dort nur das Amt eines militärischen Oberbefehlshabers. Er und seine nächsten Nachkommen, die sich nach ihm in das Reich teilten, waren sowohl in Lhasa als am Kuku nor stets bestrebt, mit der in China eben auf den Thron gestiegenen Mandschu-Dynastie in guten Beziehungen zu stehen, und seit 1697 unterwarfen sich die Mongolen dem Kaiser Kang hi vollständig. Doch führte eine Erhebung eines Enkels Guschri Khans am Kuku nor im Jahre 1723 dazu, daß Kaiser Kang hi die Kuku nor-Mongolen in zahlreiche Formationen einteilte und diese verschiedenen Nachkommen Guschri Khans erblich unterstellte. So ist auch Tschʿing hai wang ein Nachkomme Guschri Khans, und mein »Kronprinz« (Tafel XIV oben) wäre der dreiundzwanzigste Urenkel des Khabutu Khasar, des Bruders von Dschinggis Khan. Den Mongolen wurde auch verboten, Volksversammlungen einzuberufen, und durch diese Maßregeln wurde ihr kriegerischer Sinn zerbrochen. Die Tibeter fingen im 19. Jahrhundert an, Einfälle ins Mongolenland zu machen, sie töteten ungezählte Massen der Bewohner, zerstreuten den Rest und nahmen mehr und mehr Land am Kuku nor in Besitz. So sind heute von dem stolzen Reich am Kuku nor nur noch Spuren vorhanden. Die Horde des Tschʿing hai wang, einst mehrere tausend Familien stark, zählt heute nur noch etwa dreihundertfünfzig Familien, und sein Land ging einst vom Bukhain gol im Norden bis zu den Wahong-Bergen und zum Tossun nor.. Er hat Untertanen in der Nähe des Klosters Dulan, andere sitzen in der Nähe von Gomba soma bei Dankar, wieder andere unweit Kue de ting. Alle sind Viehhirten, die mit ihren Herden in einem ganz bestimmten Umkreis hin und her ziehen. Der Tschʿing hai wang wohnt soviel wie möglich bei seinen Dulan-Leuten, denn, wie er mir klagte, lassen die frechen Tibeter diese nirgends und nie in Ruhe und Frieden leben. Er zieht mit ihnen jährlich fünf- bis sechsmal mit Sack und Pack um und macht außerdem in jedem Jahr eine vier- bis sechswöchige Pilgerfahrt nach Gum bum oder nach Kue de oder sonst einem heiligen Platz. Alle fünf Jahre mußte er nach Peking an den Hof und mit einem Ko tou dem Kaiser seine Unterwürfigkeit beweisen, was jedesmal mindestens drei Vierteljahre in Anspruch nahm. Jeden September zum achten Tag des achten Monats hatte er sich wie alle Kuku nor-Häuptlinge, Mongolen wie Tibeter, in Tsaghʿan tschʿeng bei Schara khoto einzufinden, um sich beim Amban-Bannergeneral zu melden und mit dem Amban zusammen den Gott des Kuku nor anzubeten.
Es ist ein gar bewegtes und aufreibendes Leben, das der Fürst führt, aber trotzdem machte er einen geradezu weichlichen Eindruck auf mich, der sich durch seine auffallend weiße Hautfarbe – er war heller als ich – noch verstärkte. Ich hatte ihn deshalb zuerst in dem falschen Verdacht, daß er Opiumraucher sei. Er war ein gemütlicher Unterhalter, der langsam und behäbig seine Worte setzte und dabei fortwährend – wie die vornehmen Chinesen es zu tun pflegen – zwei Metallkugeln in der hohlen Hand gegeneinander drehte, um seine Finger geschmeidig zu erhalten. Er sprach Dankar-Chinesisch und Kuku nor-Tibetisch so gut wie seine mongolische Muttersprache, welch letztere er wie alle mongolischen Adligen auch in der Schrift beherrschte.
Nachdem ich vollends den Tschʿing hai wang persönlich kennengelernt hatte, war ich nicht mehr erstaunt, daß die Tibeter den Mongolen alles Land um den Kuku nor hatten wegnehmen können, so daß man heute besser daran täte, den See auch bei uns »tsʿo ngombo«, d. h. mit dem tibetischen, nicht mehr mit dem mongolischen Namen zu benennen. »Die ›fan tse‹« – hörte der gute Wang ye nicht auf zu jammern – »werden frecher zu jeder Frist. Ich bin in dem Lande meiner Väter nicht mehr Herr.« Als demütig Bittende sollten die Tibeter in dieses Land gekommen sein und eine Zuflucht vor den Mahari (Mahʿahʿge), den mächtigen Stämmen jenseits (östlich) des Hoang ho, gesucht haben. Sie pachteten von den Mongolen einige Weideplätze, machten aber bald immer weitere Ansprüche.
Nur durch kleine Listen hält sich der Fürst noch. Die Wang ka-Mongolen bauen alle paar Jahre im Dulan gol-Tal etwas Gerste an. Wären sie aber nicht unvermutet wenige Wochen vor meiner Ankunft zur Stelle gewesen, so hätten die Wan̂schdächʿe, ohne zu fragen, alles Wintergras dortherum abgeweidet. Im nächsten Frühjahr hätten dann die Mongolen nicht zum Säen kommen können, weil ihre Tiere während des Anbaus der Gerste keinen Halm mehr vorgefunden hätten.
An den folgenden Tagen war ich noch mehrfach beim Wang ye zu Gast; dann machte die Fürstin mit dem Kronprinzen (Tafel XIV, oben) und mit einer drallen Magd Feuer in den offenen Eisenherd. Hellauf flackerten die Holzscheite. Mit kräftigen Armen ergriff Ihre Durchlaucht die Fürstin den mächtigen eisernen Kochtopf von der Größe eines Wäschekessels einer gutsituierten Familie bei uns. Seine Durchlaucht der Fürst hackte Schaffleisch zurecht und Speck nebst einigen Pfund chinesischer Makkaroni, und der Kronprinz schleppte Wasser herbei. Als das Mahl bereitet war, erhielt jeder sein Teil vorgesetzt. Es wird in den Rundhütten der alten Germanen nicht viel anders hergegangen sein. Durch das prasselnde Herdfeuer wurde es rechtschaffen warm trotz der weiten Öffnung des Rauchfangs, und die Fürstin und ihr Sohn trugen bei dem Geschäft die rechte Oberkörperhälfte entblößt und zeigten eine Haut, die vor Schmutz fast so schwarz war wie die eines Negers. Mit einer Art Worcestersoße, die in Dankar aus Kleie fabriziert wird, und mit Stutenmilchschnaps mundeten mir die Speisen, als hätte ich nie etwas Besseres gekannt.
Der Wang ye versprach endlich auch, meine Lasten und die Diener nach Dankar zu schaffen. In wenigen Tagen sollte eine Handelskarawane dorthin abgehen, die meine Sachen befördern konnte. Der Wang ye erklärte, daß er keinen Lastzug am Kuku nor vorbeibringen könne, ohne daß mindestens zwanzig seiner Mongolen ihn geleiten. Zum Schluß gelang es mir, um teuren Preis zwei leidliche Pferde aufzukaufen. Die Wang ka-Mongolen hatten durchgehends recht schlechtes Pferdematerial, dagegen waren sie gut bewaffnet. Eine Menge Mannlicher- und Mausergewehre und alte, ausrangierte Karabiner (Modell 71), die teilweise noch deutsche Regimentsstempel aufwiesen, zierten die Mongolenyurten. Einige hatte das Gefolge des Wang ye gelegentlich einer Tributreise an den Pekinger Hof von irgend einem chinesischen Winkelhändler erstanden, andere stammten aus der letzten Rebellionszeit, waren gefallenen chinesischen Soldaten abgenommen worden. Was für Schicksale mochten nur die zwei Karabiner gehabt haben, auf denen Ulanenregiment Nr. 19, und gar einer, auf dem Dragonerregiment 26, V. Eskadron, eingraviert war! In dieser Schwadron hatte ich meine Vizewachtmeisterübung abgedient. Unser guter alter Büchsenmacher Jung, der unsere Karabiner wie seine Kinder hütete, hätte sicherlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn er seinen alten Pflegling wiedergesehen hätte! Seitdem der Karabiner nach Asien gekommen war, hatte er keinen Tropfen Öl mehr schlucken dürfen. Er war nur immer mit Sand blankgescheuert worden. Als ich ihn ölte und seinen zu kurz gewordenen Schlagbolzen in einer Zeltschmiede wieder zurechthämmerte, war mir, als müßte ich einem kranken Landsmann aufhelfen.
Eines Tages kam ein Bi tieh sche, ein Kommissar aus dem Amban-Ya men, mit zehn Soldaten durch das Zeltdorf und kündigte die Ankunft des Dalai Lama mit dreihundert Begleitern an. Der Dalai Lama war in diesen Tagen von Urga her in Hsi ning fu eingetroffen. Er sollte von Dankar bis Tsʿaidam durch die Kuku nor-Bewohner, von Tsʿaidam bis Lhasa durch die Dam-Mongolen gebracht werden. Man verlangte vom Wang ye fünfzehnhundert Schafe und dreimal so viel Kamele, als er überhaupt besaß. Der bevorstehende Besuch des Dalai Lama verbreitete darum eitel Schrecken bei der Bevölkerung. Mit nur fünfzig Pferden war der unglückselige Tobden Dalai Lama im Sommer 1904 vor den Engländern über die Tschang tang nach Hädschir geflohen, war dort, vom Tädschinär-Dsassak unterstützt, wie ein Besessener weiter fortgeirrt, bis er sich endlich nahe der russischen Grenze, in Urga, sicher genug fühlte. Jetzt hatte er den Zeitpunkt für geeignet gehalten, in seine Residenz zurückzukehren.
Am 29. Oktober brachten sechs Kamele meine Sachen und Begleiter nach dem Kloster Dulan, das wenige Stunden weiter oben im Tal lag. Auch die Wang ka packten ihre Habe zusammen. Sie zogen näher an den Serkhe nor hinab. Ich selbst ritt mit Schü tung sehe nach Westen zu dem Oberhäuptling der Wan̂schdächʿe-Tibeter. Der Kamelprozeß war nicht entschieden worden. Die Nian̂er Wan̂schdächʿe, die die Tiere gestohlen hatten, gaben nicht klein bei. Ihre Unterhändler antworteten patzig, Räubern sei vielleicht eine Sünde, aber es stähle den Mut. Zum Schluß zogen sie vor unseren Augen ihre Schwerter, schwangen sich mit lautem »Dyi hu-u-u!« auf ihre Pferde und ritten auf und davon. Kein Mensch wagte sie aufzuhalten. Schü wollte aber noch einen letzten Versuch machen und die Nian̂er beim Wan̂schdächʿe-Oberhäuptling, dem Wan̂schdächʿe Tschabtsa Tsʿien hu, »dem Herrn der Tausendschaft« der Wan̂schdächʿe, dem mächtigsten Tibeterhäuptling am See, verklagen. Wenn auch dieses fehlschlug, sollten die Hsië dia von Dankar Siehe S. 113. die Sache in ihrer Weise austragen.
Der Weg, den mich der Dolmetscher Schü nach Westen führte, brachte uns über einige steinige, niedere Joche. Nach anderthalb Stunden schon trafen wir auf die ersten schwarzen Yakhaarzelte, die in Gruppen zu vieren und fünfen in windgeschützten Mulden sich an den Boden anschmiegten. Eine große Menge Pferde und Schafe sahen wir am Wege grasen. Unter den bewaffneten Hirten sprachen wir einmal einen sechzehnjährigen Jungen, den Sohn eines Hsië dia von Dankar, der von seinem Vater »au pair« in eine tibetische Familie gebracht worden war. Er sollte als Vorbereitung auf seinen künftigen Beruf gut Tibetisch lernen.
Gegen Abend kehrten wir beim Wan̂schdächʿe Tsʿien hu ein, wo zunächst freilich nur die Frau zu Hause, bzw. im Zelte war. Mit möglichst langsamer, chinesischer Gravität, mit unzähligen »da schaage da schaage ja ja ja ja!« folgten wir der Aufforderung, einzutreten.
Das Zelt war ein wahres Monstrum seiner Art. Es maß 12 auf 17 m im Innern. Mit den zahlreichen Stricken, die aus dem schwarzen Zeltkörper heraus nach allen Richtungen liefen und außerhalb des Zeltes über hohe Stangen gespannt waren, um erst 6 m davon entfernt mit Pflöcken am Boden befestigt zu werden, nahm es sich wie ein riesenhafter Tausendfüßler im Talgrunde aus. Mit den tibetischen Sitten allmählich vertraut, setzte ich mich auf den Gastplatz dicht an dem hinter dem eigentlichen Herd errichteten Dungkasten, auf dem zum Gebrauch bereit die Porzellantassen der Familie aufgestellt waren. Die Hausfrau kredenzte uns mit hoch erhobenen Händen Bei Mongolen wie Tibetern und Chinesen muß man jeden Gegenstand, den man einem anderen übergeben will, mit zwei Händen anfassen. Nur eine Hand zu gebrauchen, gilt als ungezogen und oft als Herausforderung. das Nationalgebräu, den Milchtee, mit einem Bodensatz aus Butter, Tschürra und Tsamba, und wir Gäste beschäftigten uns einstweilen damit, am Aschenloch des Herdes die glühenden Schafböllchen hervorzukratzen und über der ausgebreiteten Masse die Hände zu wärmen. Das eine und andere der Kügelchen diente auch dazu, die chinesischen Tabakpfeifen in Brand zu setzen, die bekanntlich einen Kopf von der Größe eines Fingerhuts haben, so daß man fortwährend in Arbeit ist.
Der Zeltherr hatte an diesem Abend und in der Nacht ein wichtiges Geschäftchen. Um Mittag waren plötzlich dreißig tibetische Kaufleute mit vierhundert Yakrindern angerückt und wollten mit dem Stamme Handel treiben. Sie gaben an, von Dergi zu sein, aber nur zwei von ihnen und nicht einmal die Sprecher trugen die langen, offenen Haare, die in Kʿam-Dergi bei den Männern Mode sind. Die meisten hatten das Haupthaar rasiert. Die Wan̂schdächʿe argwöhnten deshalb, daß die Kaufleute Horkurma-Leute vom oberen Hoang ho seien, und da Räuber von Horkurma einige Jahre zuvor mehrere Wan̂chdächʿe Tschabtsa, die nach dem Kloster Lab gomba an der Grenze von Dergi pilgerten, überfallen und ausgeplündert hatten, so verlangten meine Wan̂schdächʿe Tschabtsa von den Kaufleuten erst einmal dreißig Yak als Sühnegeld; dann wollten sie sich mit ihnen in Kaufgeschäfte einlassen.
Ganz atemlos und aufgeregt erschienen um sieben Uhr abends der Häuptling und sein besonders redegewandter Bruder, dem es durch sein fabelhaft geschmiertes Mundwerk, durch zahllose Irrwege, Einwürfe, Metaphern (gdam dbi auf tibetisch) gelungen war, die Sprecher der Kaufleute hereinzulegen und zu überführen, daß sie zu den übelbeleumundeten ngGolokh-Horkurma gehörten. Mein Besuch im Tsʿien hu-Zelte gestaltete sich auf diese Weise recht bewegt.
Nur auf einen Sprung blieben die beiden Männer im Zelt. Sangr, der Bruder des Tsʿien hu, brachte es aber in dieser kurzen Spanne Zeit fertig, dem Dolmetscher Schü die geringe Achtung der Horkurma-Kaufleute vor der chinesischen Macht in wenig schmeichelhaften Worten unter die Nase zu reiben, mich um einen Betrag von einigen hundert Tael, verzinslich zu 10 %, anzupumpen und zu guter Letzt auch noch seine Pferde in den Himmel zu loben; sie holten jeden Kyang ein, und im eiligsten Paßtrabe blieben die Rücken seiner Tiere so ruhig, daß ich noch den kleinsten Vogel treffen könnte. Sangr war ein wild aussehender Fan tse mit hoher, zerfetzter Fuchsfellmütze. Immer sein Schwert locker im Gürtel, wärmte er seine nackte bronzefarbene Brust an der Glut des ausgebreiteten Dungs, und wie eine Ratsche, schneller als ein Akka sein »Lama la sumptschiu ...« herunterschnurrt, ging sein Mundwerk. Seine schwarzen, lauernden, listigen Augen schweiften unausgesetzt von einem zum anderen seiner Hörer, und nichts schien ihnen zu entgehen. Beim Sprechen ließen seine feinen, dünnen Lippen für einen Tibeter sehr regelmäßig stehende, blitzblanke Zähne sehen. Er war der geborene Sprecher des Tsʿien hu. Große tibetische Häuptlinge benutzen für wichtigere Angelegenheiten meist einen »nirba« (gnyerba), einen Majordomus, d. h. einen Mann, der für sie spricht. Wenn dieser etwas gesagt hat, was sich nachträglich als unausführbar oder unklug herausstellt, so hat es noch nicht der Häuptling gesagt; die Abmachungen sind für diesen nicht verbindlich.
Als die zwei Männer wieder fortgestürzt waren, unterhielten uns die achtunddreißigjährige, leicht angerunzelte Frau und eine Tochter, eine rotbackige Maid von siebenzehn Jahren, die ein schweres, silbernes Rückengehänge im Wert von 400 Tael trug, durch Sologesänge, die sie mit einer Zupfgeige begleiteten. Das Instrument bestand aus einer roh gearbeiteten, dünnen Holzschachtel, einer darübergezogenen Schlangenhaut und einem daran befestigten Stock. Mit Hilfe eines Steges waren drei aus Pferdehaaren gedrehte Saiten darübergespannt.
Man legte sich zur Ruhe, ohne daß die Männer zurückgekommen waren. Das tibetische Zelt war, verglichen mit den Mongolenyurten, sehr luftig und kalt. Die ganze Nacht blieb die Tür weit offen und auch der breite, 4 m lange Spalt über dem Herd. Nur zwei vertikale Stangen standen im Innern des riesigen Zeltes. Diese trugen auf aufgesetzten Sakralwirbeln von Rindern einen langen Horizontalbaum, der als First von vorn nach hinten lief, und der die beiden großen, mit Stricken verbundenen Zelthälften gerade über dem Feuer hochhielt. Da die anderen Stützen außen um das Zelt herum so hoch waren, daß zwischen ihnen die Zeltdecke beinahe horizontal ausgespannt war, so bot das Innere ungemein viel Raum. Dabei war keine der vielen Stangen sehr dick und keine länger als 2½ m. Alle konnten also leicht auf Yaksättel gebunden und hin und her geschleppt werden. Der Schutz freilich, den die Behausung bot, war gering. Bei der kräftigen Nachtbrise schlugen die seitlichen Zeltwände, die in beinahe rechtem Winkel von der Decke herabhingen, immerzu Sand und Staub ins Innere.
Nach kurzem Schlaf schreckte uns lautes anhaltendes Hundegebell. Von einer nahegelegenen Anhöhe hörte man schrilles Pfeifen, und in nicht großer Ferne ertönten Schüsse und wilde Juchzer. Waren unsere Gastfreunde angegriffen worden? Griffen sie selbst an? Wir blieben auf Vermutungen angewiesen. Der vielköpfigen, bissigen Meute wegen konnten wir es nicht wagen, aus dem Zelte hinauszutreten. Die Frauen, die mit uns schliefen, blieben ruhig liegen. Auch von ihnen war nicht herauszubringen, was los sei. Stundenlang horchten wir gespannt in die Nacht hinaus. Schließlich schlief man eben wieder ein. Als Sangr am Morgen zurückkam, ließ er sich auf die Ereignisse der Nacht nicht weiter ein und führte mir sofort seine Pferde vor, die er noch weiter in den Himmel hob. Es waren aber die allerelendesten Mähren, die der Stamm besaß.
Vor dem Abschied machten wir noch lange Teesitzungen in den Nachbarzelten, dann zog ich weiter nach dem fünf Stunden entfernten Kloster Dulan se, während Schü weiter seinen Geschäften bei den Wanschdächʿe nachging.
Unterwegs begegnete ich dem Teetransport eines Schar ba-Händlers, den drei Wan̂schdächʿe Tschabtsa-Leute geleiteten. Der Besitzer, ein Mohammedaner aus Sung pan ting, traute sich nicht, selbst mit seiner Ware und seinen kostbaren Pien niu zu reisen. Er war am Tage zuvor im Kloster Dulan von dem Tung sche des Bi tieh sehe gestellt worden, und da er keine Ambanlizenz besaß, mußte er diesem eine Last Tee im Wert von etwa 20 Tael als Buße ablassen. Um nicht auch meinem Freunde Schü in die Hände zu fallen, ritt er jetzt nicht mit seinem Transport. Die erste Strafe bot ja keine Gewähr dafür, daß er nicht noch einmal Buße zahlen mußte, denn diese Bußen gehen nicht in den Säckel des Ya men, sondern in die Tasche des Tung sche und bilden einen Hauptteil seines Gehalts. Für die Sung pan-Teehändler ist es sehr schwer, ja unmöglich, sich eine Handelslizenz (Preis: 3 Tael 5 Mace) zu verschaffen, da diese immer nur für eine Reise gilt und ihr Weg ins Tsʿao ti sie nie über Hsi ning führt.
Einer der den Teetransport begleitenden Tibeter hielt mich wegen meines Anzugs für einen der ngGolokh-Horkurma-Kaufleute und verfolgte mich zu Pferde. Erst als ich mein Gewehr anlegte, brachte er seine lange Lanze in etwas respektvollere Entfernung. Wir unterhielten uns dann, und es bestätigte sich, daß die Wan̂schdächʿe unter der Führung meines Gastfreundes in der Nacht zuvor die Horkurma-Leute angegriffen und ihnen einen Teil ihrer Yak weggenommen hatten. Sechzig Wan̂schdächʿe hatten die dreißig Kaufleute überfallen, und auf beiden Seiten hatte es Verwundungen abgesetzt.
Das Kloster Dulan ist ein elendes Nest der Wang ka-Mongolen. Eine weitläufige Umwallung umschließt einige Höfe, den Ya men des Fürsten und das sogenannte Labrang oder Lawran̂ (bla bran̂), das eigentliche Kloster oder vielmehr die gelegentliche Wohnung und Stätte der »Retraite« für die Mina-Inkarnationen. Für gewöhnlich wohnen dort nur zwei Mönche, und diese hatten zur Zeit meines Besuchs ihr ganzes Allerheiligstes mit geschmuggeltem Sung pan-Tee vollgepfropft. Im äußersten Hof schlugen eben die Handwerker, die Zeltmacher, Schmiede, Büchsenmacher der Wang-Mongolen für den Winter ihre Yurten auf. Außer diesen wohnten hier nur noch ein paar Greise in ärmlichen Schuppen. Der Ya men ist in chinesischem Stil gehalten; chinesische Arbeiter haben ihn einst errichtet. Der jetzige Wang bewohnt ihn so gut wie nie. Die Ansiedlung liegt in einem breiten, muldigen Tal. Steil steigen aus ihm im Norden wie im Süden die Felsberge auf. Um die Hänge der südlichen Berge schlingen sich wie ein Band in einer Höhe von 3300–3500 m Wäldchen aus Thujen und Fichten. In diesen dünn bestockten Hainen gedeiht der offizinell verwendete Rhabarber (das Rheum tanguticum) auf das vorzüglichste, und deshalb kommen fast alljährlich einige mohammedanische Tschang gui de (Meister) hierher und lassen nach den Knollen (Rhizomen) graben. Sie haben dafür an den Fürsten je ein gutes Pferd als Entgelt zu bezahlen.
Während meines Aufenthalts in Dulan wohnte ich im Ya men des Wang. Hausrat gab es darin nicht, nur nackte Wände. Diese aber waren wie in chinesischen Gasthäusern mit Gedichten über und über bekritzelt. Chinesische Soldaten und Dolmetscher, Kaufleute und Goldsucher hatten Zitate und eigene Dichtungen mit Tusche an die Wände gemalt. Ich fand da manchen originellen Spruch, als blätterte ich an einem Regentage im Fremdenbuche irgend eines schweizerischen Aussichtspunktes. Da lobte einer die schönen Berge, das kostbare Gehörn der Hirsche, die er hier gesehen, den Moschus und das Gold in den Bächen. Ein Versemacher aber klagte also:
??? Tabelle »ren dsai wai bien fu mu t'ang tsien
sin dsai dia tsch'ang goa nien
tse wei yin ts'ien tschi dsai fang tschung
tsong t'ien ya schu deng hoa«,
was auf deutsch etwa lautet:
»Weit, ach weit zog ich von hinnen,
Ließ mein Herz im Heimatland,
Zog, mir Schätze zu gewinnen,
Bis zum fernen Himmelsrand.
Vater, Mutter vor der Hütte,
Schließen ihre Augen nicht,
Und in meines Hauses Mitte
Pflegt mein Weib (nur) den Docht am Licht.«
Ein echt und gut chinesischer Sohn, dachte der Schelm zuerst an seine alten Eltern, die sich seinetwegen die Augen aussehen, dann aber als Haustyrann an seine Frau, die er in sicherer schwiegermütterlicher Obhut weiß, und der an den langen Abenden nichts anderes zu tun übrigbleibt, als den Docht der schwelenden Hanfölfunsel wieder und wieder zu beschneiden.
In Dulan angekommen, wurde mir vom Nirba des Wang ye eröffnet, daß die Wang ka die Abreise ihrer Handelskarawane noch weiter hinausgeschoben hätten. Es war gar nicht abzusehen, wann der Wang ye überhaupt meine Sachen zurückbefördern würde. Deshalb mußte ich hier wiederum einige erzwungene Tage der Ruhe einlegen.
Am 3. November endlich kam Schü mit seinem Dolmetscherkollegen von den Wan̂schdäch'e. Sie hatten den Kamelprozeß nicht schlichten können, und auch in der ngGolokh-Horkurma-Affäre vermochten sie nichts auszurichten. Beide Dolmetscher waren trotzdem mit ihren Geschäften wohl zufrieden und wollten nun, so rasch es ging, nach Dankar zurückreisen. Sie ritten »Ula«, d. h. die Eingeborenen am Wege mußten sie von Stamm zu Stamm mit Pferden und Führern versehen. Sie rechneten, auf diese Weise bereits nach sechs Tagen in Dankar einzutreffen. Schü hatte vom Ts'ien hu ein gutes und junges Pferd geschenkt bekommen; dieses verkaufte er mir zu einem annehmbaren Preis, und damit konnte ich mich mit zweien meiner Diener den Dolmetschern anschließen. Ich nahm nur wenig Proviant und meine Notizbücher und Kartenskizzen mit mir, der übrige Troß und der Rest der Diener hatte auf die Wang ka zu warten. Gerade als wir abritten, kamen Tsch'eng und Me, die ich eine Woche zuvor auf ihren Wunsch entlassen und ausbezahlt hatte, heulend zu mir und klagten, daß die beiden Dolmetscher ihnen 10 Tael abgenommen hätten, weil sie ohne Lizenz in Tibet Geschäfte trieben. Tsch'eng hatte in der Zwischenzeit Geld für alte Stiefelschulden bei den Nian̂ern einkassiert. Natürlich blieb mir nichts übrig, als die ihnen auferlegte Buße auf mich zu nehmen. Wir folgten zuerst dem Tal des Dulan-Flusses aufwärts, dann ging es über einen flachen Paß nach der Tala-Fläche hinüber, in der als kleines blaues Auge der Salzsee Dabassu nor herausstach.
Mit der Dunkelheit ritten wir in einem Yurtendorf ein, wo die Meute uns fast von den Pferden riß. Wir hatten die kleine Gemeinde des Hartschiu (Kharatschut) Dsassak erreicht, bei der die beiden Dolmetscher ihre Ula und ihre Führer wechseln mußten. Da ich mit den zwei Tung sche zusammen reiste, so wurde ich, ohne ein Wort zu verlieren, in der Yurte eines Mongolen als Gast aufgenommen.
4. November. Am Morgen blieb es lange unentschieden, ob die Dolmetscher weiterreisen würden oder nicht; sie fanden einen Streit zum Schlichten und hofften auf größeren Verdienst. Wann sie weiterzögen, war nicht abzusehen. Ich beschloß daher um Mittag, allein mit meinen Leuten nach Dankar zu reiten.
Als wir sattelten, traten zwei junge Tibeter auf mich zu und baten, ihnen das zuletzt gekaufte Pferd abzugeben oder, wenn ich es nicht verkaufen wolle, wenigstens die eine oder andere ihrer Monturen dagegen zu tauschen. Erstaunt über das sonderbare Angebot, verlangte ich Aufschluß und brachte eine lange Diebsgeschichte heraus. Das junge Tierchen war vor Monaten bei dem Gan̂ ts'a-Tibeterstamm im Norden des Kuku nor gestohlen worden, und der Dieb hatte es an die Wan̂schdäch'-Tschabtsa verschärft. So war das Pferd an den Ts'ien hu und endlich durch Vermittlung des Ts'ien hu an Schü verschoben worden, der es wiederum mir in Dulan se verkauft hatte. Der frühere Besitzer von Gan̂ ts'a hatte den einen der beiden jungen Tibeter vom Stamme der Rengan, die unfern von den Hartschiu ihre Weideplätze haben, des Diebstahls bezichtigt und auf die Wahrheit seiner Bezichtigung zwanzig Yakrinder gesetzt, Der junge Rengan mußte nun wegen seines Ansehens beim Stamme entweder einen anderen als wirklichen Dieb ausweisen und dem Gan̂ ts'a den Gaul verschaffen oder ein Gottesurteil über sich ergehen lassen.
Als ich nicht sogleich auf den Handel eingehen wollte, machte er ein recht bekümmertes Gesicht. Er wird nun gleichfalls zwanzig Rinder stellen müssen. Nachdem die Parteien die Gleichwertigkeit der zweimal zwanzig Rinder anerkannt haben, wird ein großer Kessel voll Butter über einem Feuer erhitzt werden, und in das heiße Fett versenken die Unparteiischen einen weißen und einen schwarzen Stein von gleicher Größe, je in ein Stück Baumwollstoff eingewickelt und versiegelt. Erst wird er, dann sein Herausforderer, der, der das Pferd verloren hat, nach dem weißen Stein im heißen Fett greifen. Greift er den weißen – das heiße Öl dient dazu, daß keiner lange herumtasten und suchen kann – und ist seine Hand unversehrt geblieben, so gilt seine Unschuld als erwiesen. Wehe aber, wenn er den schwarzen faßt oder seine Hand verbrannt ist! Obendrein wird er noch die zwanzig Rinder abgeben müssen, auch können ihm noch als einem Dieb zur Strafe die Fußsehnen durchschnitten werden.
Hell leuchteten daher die Augen des jungen Spitzbuben auf, als ich mich bereit erklärte, gegen ein Draufgeld meinerseits das fragliche Tier gegen seine beiden Mähren einzutauschen, und kurz darauf verließ ich die Hartschiu mit meinem Tschang und Ma und mit einem nur leicht beladenen Handpferd, das meine kostbaren Notizbücher trug. Wäre ich auf den Handel nicht eingegangen, so hätte ich auch zwanzig Rinder wetten können, daß mir das Pferd in den nächsten vierundzwanzig Stunden unversehens abhanden gekommen wäre. Unser Weg war eine breit ausgetretene Yakstraße, die über einen 3700 m hohen Paß im Süd-Kuku nor-Gebirge, dann vorbei am Kuku nor in einer Entfernung von 1–2 km vom Südufer, immer geradeaus auf den chinesischen Grenzmarkt Dankar zusteuert.
Wie tibetische Räuber ritten wir. In flottem Schritt ließen wir Meile um Meile hinter uns, und nach weiteren sechs Tagen war die chinesische Zivilisation erreicht.
Am ersten Nachmittag blieben wir so lange im Sattel, bis ich in der Dunkelheit auf dem Zifferblatt meiner Uhr die Zeit nicht mehr ablesen konnte. Vor Sonnenaufgang wurde wieder aufgestanden und losgeritten. Ma mit dem Handpferd voraus, wir dicht hintendrein. Wenn die Sonne so hoch war, daß es uns nicht mehr fror, suchten wir nach Wasser und kochten Tee. Das Lastpferd wurde abgeladen, die Pferde zu zwei und zwei an langen Stricken angepflöckt. Ich sammelte in einer Falte meines Mantels Dung zusammen, und bald flackerte das Feuer unter dem Zischen und Pusten des Blasebalgs. Während die Tiere grasten, aßen wir unser frugales Frühstück, unsere dicke, salzige Teesuppe, unser Tsamba, halbrohes Fleisch, tibetische Würste. Nach anderthalb Stunden hasteten wir weiter bis zum Nachmittag, wo nochmals abgekocht wurde. Zum dritten Male wurden die Lasten aufgebunden, und bis in die Dunkelheit hinein ging's durch die Steppe. Plötzlich scharf abbiegend, bargen wir uns dann in einem Seitental, 1–2 km abseits von der Straße. Es ist mittlerweile stockfinster geworden. Die Pferde werden an einer Fessel festgebunden und grasen die Nacht über in der Länge ihrer Leine. Nur kurze halbe Stündchen halten die Tiere inne, legen sich nieder und schlafen. Wir suchten für sie immer ein Plätzchen mit möglichst gutem Gras und, wenn es irgend ging, geschützt gegen den starken Westwind. Bis wir uns niederlegten, waren Hände und Füße steif vor Kälte, und wie ein Wurm krümmte man seinen Körper zusammen, um nicht die letzte Wärme entfliehen zu lassen, ging doch das Thermometer in dieser Zeit bei Nacht bis –16°, einmal auf einem Paß bis –20° herab, und der Westwind wollte dabei nimmer aufhören. Das letzte gerettete Hemd war längst in Fetzen, die Hosen nur noch in Spuren vorhanden; ganz wie drei ngGolokhs, nur in schmierigen, wilden Pelzen und mit Schaftstiefeln ohne Strümpfe, ritten wir während dreier Tage an dem Blauen Meer, dem Ts'o ngombo, vorüber.
22 km vom südlichen Ufer entfernt tanzt wie ein Kahn auf den blauen, nie ruhenden Fluten das Ts'o ning, die heilige Insel, auf der die Akkas leben und beten, die nur im Winter, wenn der See zugefroren ist, mit der übrigen Welt in Verbindung kommen. Es ist ein felsig aufsteigendes Eiland mit Hügeln, die von Grasweiden bedeckt sind. In der klaren Winterluft schien die Insel ganz nahe zu sein, und ich glaubte von meiner Straße aus alles darauf erkennen zu müssen. Sie soll 8 Li Umfang haben.
9 km vom Südufer des Sees und 18 km westlich von der großen Insel Ts'o ning ragen noch weitere Felsklippen über die Seefläche heraus. Sie haben weiße Farbe und werden von den Mongolen Tsaghan khada genannt. Dort ist der Felsblock, von dem die Sage geht, daß damit ein böser Geist namens Tscheger sämo nach Ts'o ning geworfen habe, um die Insel wieder zu vernichten oder wenigstens von der Stelle zu rücken.
Es war – erzählt man – um die Zeit, als man in Lhasa umsonst versuchte, Tempel und Klöster zu errichten. Immer wieder stürzten dort die Gebäude in sich zusammen, und in alle Welt hatte der tibetische König deshalb seine Vasallen geschickt, um die Ursache dieses Unglücks ausfindig zu machen. Ein ausgesandter Lama traf in der Ebene, die heute der Kuku nor bedeckt, einen blinden, alten Heiligen, der in greisenhafter Schwatzhaftigkeit erzählte, dort, wo der König seine Tempel errichten wolle, liege ein großer unterirdischer See. Dieser werde, sobald ein Abgesandter des Königs davon erfahre, von Lhasa hierherfließen. Kaum war das Geheimnis ausgesprochen, so hörten sie beide schon das Tosen des Wassers, und mit knapper Not konnte sich der Sendling des Königs auf seinem Pferde noch retten, während der Greis von den Fluten verschlungen wurde. Das Wasser hätte auch alle Berge überschwemmt, wenn nicht eine Gottheit Erbarmen gefühlt, ein großes Felsstück genommen und damit das Loch, aus dem das Wasser herausquoll, verschlossen hätte. Dieses Felsstück ist die heilige Insel Ts'o ning. Den bösen Titanen aber ärgerte es, daß nicht mehr Unheil durch das Wasser angerichtet worden war, er wollte durch Steinwürfe Ts'o ning verrücken und die Öffnung wiederherstellen. Zum Glück für die arme Menschheit traf er jedoch Ts'o ning nicht. Seine Steine, mit denen er vom Strande aus nach Ts'o ning warf, fielen schon auf halbem Wege in den See, und dort sieht man sie noch.
Nach einer chinesischen Erzählung wollte einst eine Frau an der Stelle der heutigen Insel in einem Brunnen Wasser holen, vergaß aber den Deckel zu schließen. Da quoll das Wasser über und bedeckte die ganze Ebene. Ein Gott, Wo fo (Buddha), erbarmte sich endlich und warf einen Block, die Insel, auf den Zauberquell.
Herrliche Grasweiden bedecken das ganze Südufer des Sees vom Wasser an bis auf die weich geformten Gipfel hinauf, die ihn umsäumen. Die Weiden sind bei allen Nomaden berühmt, und viele tibetische Lieder singen von der Ts'o ngombo yung, der Ebene des Kuku nor, als dem Land, wo immer Milch und Butter in Hülle und Fülle vorhanden ist. Obwohl noch zum Bereich des abflußlosen Zentralasiens gehörig, wird dieser Landstrich während der Sommermonate noch so viel von Regenfällen benetzt, daß das Gras üppig gedeihen kann. Im Winter ist das Land für die Nomadensiedlungen günstig, weil hier sehr wenig Schnee fällt und die Herdentiere selten Schwierigkeit haben, ihr Futter unter der dünnen Schneedecke zu finden.
Ich erreichte am Nachmittag des 8. November den Ostrand des Sees. Unweit von der Stelle, wo mein jetziger Weg den Pfad kreuzte, den wir damals nach dem Januarüberfall eingeschlagen, fanden wir endlich wieder Leben. Es ist hier das Land der Tibdia-Tibeter. Bei diesen nächtigten wir. Es lag dort Schnee, und die Witterung war feuchtkalt.
Früh am Morgen des 9. November überschritten wir hierauf den Lala-Paß (3885 m), einen engen Sattel in den Felsbergen im Osten des Sees. Metertief lag daselbst der Schnee. Von ihm aus ging es sofort steil in ein buschbewachsenes Tal hinab, in dem wir um Mittag schon einige Häuser trafen, und um fünf Uhr abends ritt ich durch das Tor der Westvorstadt von Dankar – der lange, mühselige Rückzug hatte sein Ende. Ich fühlte mich schon wie geborgen in der Heimat.
12 km vor Dankar, bei einem Tibeterdorf Lala, steht ein einsamer Grenzstein aus dem einundfünfzigsten Jahr Kaiser Kien lung's (1786), der China und Tibet scheidet, aber bis kurz vor die Mauern der Stadt ziehen sich an den Bergen die Grasweiden. Etwa bei dem Grenzstein wurde die Luft merklich staubiger. Ein feiner Dunst legte sich über die in der hellen Wintersonne schimmernde Landschaft. An einer Talecke stellte sich ein dicker Lößwulst und dann ein Lößhöhlendorf ein. Endlich begegneten wir Chinesen, trafen einen Mann in indigoblauen Kattunkleidern, in der Hand ein Vogelbauer, in dem er seinen geliebten Piepmatz an die frische Luft spazieren trug.
Die erste Frage meiner zwei Begleiter war immer: Wie war die Ernte dieses Jahr? Wie teuer ist der Weizen? Wie teuer die Bohnen? Die Antwort lautete freudig: Es ist eine »Zehnzehntelernte« gewesen. Für das Pfund Weizen müssen wir nur 15 Cash (5 Pfennig) bezahlen. Sie konnte nicht besser ausfallen. – Mit einem Schlage war ich mitten in der Kultur Chinas, umgaben mich rein chinesische Züge und Bilder. Ein Bauer mit einer großen runden Brille vor den Augen pflügte am Wege. Kleine, entzückende Chinesenkinder spielten in dem dicken Staub der Straße vor dem Tor. Halbnackt ließen sie die Mütter der Winterkälte zum Trotz herumlaufen. Die Buben hatten ein eisernes Kettchen und ein Vorlegeschloß um den Hals, damit sie an die Familie angekettet seien und nicht von bösen Geistern weggeholt werden könnten. Andere Buben waren von ihren Eltern wie Mädchen frisiert worden, um die bösen Geister irrezuleiten. Um so ein wertloses Würmchen wie ein Mädchen schert sich in China ja nicht einmal ein Teufel. Für den Menschen und darum auch für die bösen Einflüsse handelt es sich nur um den Stammhalter, der Gebete und Opfer an dem künftigen Grabe des augenblicklich noch lebenden Vaters darbringt.
An Holzkästchen kamen wir vorüber, die an unsere europäischen Briefkasten erinnerten. An eine Post dachte aber damals in Dankar noch kein Mensch. Sie trugen die Aufschrift: »Gedenket des beschriebenen Papiers!« und waren – wie überall in dem Achtzehnprovinzenreich – nur aufgestellt, damit die Menschen nicht die Sünde begehen, beschriebenes oder bedrucktes Papier, das bekanntlich heilig ist, mit Füßen zu treten. Am ersten Chinesenhaus klebte eine riesige Bekanntmachung, die der Ting von Dankar unterzeichnet hatte, und in der er dem Volk zu wissen tat, daß der Dalai Lama von Urga nach Gum bum übergesiedelt sei. Die Leute sollten willig die verlangten Abgaben leisten, und wenn die den Lama begleitenden »Fan tse« unverschämt würden, sollten sie nicht sofort Gleiches mit Gleichem vergelten.
Das Leben in der Stadt Dankar war gegen früher sehr verändert. Es war nun die Zeit, in der die Nomaden ihren Jahresvorrat an Getreide einzuhandeln pflegen. Dazu hatten sich auf die Nachricht von der Ankunft des Dalai Lama Hunderte und Tausende von Pilgern eingefunden, die ihm nach Gum bum nachzogen. Täglich kamen die kopfreichsten Yak- und Kamelkarawanen in die Vorstädte und verließen wieder, so rasch sie nur konnten, den großen Marktort. Einmal marschierten sechzig Kamele Lhasawärts, die Geschenke trugen, welche der Hohepriester in der Mongolei bekommen hatte. Silber, Gewehre und Patronen bildeten die Hauptmasse. Lustig flatterte auf dem Rücken der Tiere eine gelbe Flagge mit den chinesischen Zeichen Hsi tien (westlicher Himmel), sollte heißen: Zentraltibet, und damit ging alles zollfrei über die Grenze. Der hohe Herr schien seine Zeit ausgenutzt zu haben.
Der Dalai Lama wohnte zwar in dem Kloster Gum bum, ein großer Teil seines Gefolges hielt sich jedoch in der Stadt Dankar auf, wo die Lhasa-Regierung schon sowieso immer Kommissionäre wohnen hat. Ob diese mehr kaufmännische oder mehr politische Interessen zu vertreten haben, ist allerdings schwer zu sagen.
Ein jüngerer Bruder des Dalai Lama starb während dieser Tage in Dankar. Sein Leichnam wurde in einer öden Bergschlucht im Norden der Stadt mit größtem Luxus wie der eines echten Prinzen verbrannt. Er war in hockender Stellung verschnürt und so in einen großen runden Scheiterhaufen gestellt worden. Viel Weihrauch, Butter und Honig und alle Arten Feldfrüchte wurden mitverbrannt. Die Asche wurde gesammelt, verpackt und nach Lhasa gesandt.
Nur wenige Tage hielt es mich in Dankar. Nachdem die nötigen Kleider gekauft waren, eilte ich nach Hsi ning fu hinab. Wie ich staubbedeckt von dem langen Ritt im Löß in die Wohnstube von Rev. F. Ridley trete, finde ich den Vater um sein sechsjähriges Söhnchen sorgend. Dieses war plötzlich krank geworden – an einem Sonnenstich, wie die Eltern dachten. Doch ein Hautausschlag auf dem Körper ließ bei mir keinen Zweifel aufkommen. Der Knabe hatte Scharlach, und ein Blick in den Hals zeigte, daß ihn auch noch Diphtherie, die Geißel des trockenen Zentralasiens, befallen hatte; und wir hatten ja kaum ein Linderungsmittel für die Leiden des armen Jungen. In ihrer Güte und Menschenliebe hatten Mr. und Mrs. Ridley das letzte Mittel aus ihrer Apotheke an arme Chinesen weggeschenkt, und was ich hatte, war in Tibet geblieben, selbst meine Kampferspritze lag damals noch in Dulan gomba. Freilich von Anfang an war nicht viel Hoffnung, den begabten Jungen durchzubringen. Sein Herz war zu schwach. Zwei Tage später starb er. Und als die bekümmerten Eltern mit ihren chinesischen Freunden den Sarg auf ein einige Meilen von der Stadt entferntes Grab hinaustrugen, setzte die entsetzliche Seuche bereits ihrem zweiten Knaben zu. Auch bei diesem wollte nichts, was wir versuchten, helfen. Er folgte seinem Brüderchen nach wenigen Tagen ins Grab.
Der Schmerz der armen Eltern war über die Maßen, als wir das tote Kind zum letzten Male wuschen und dann in sein Särgchen betteten und dieses schlossen. Nie habe ich gleichermaßen die Missionare bewundern müssen, die mit ihren Familien in die fernsten Länder ziehen, um anderen, dem alten Bibelwort folgend, die Segnungen des Evangeliums zu bringen, dafür aber zumeist nur Undank ernten und schließlich selbst ihre eigenen Familien opfern. Man mag über die Missionsfrage denken, wie man will, tiefen Respekt verlangt dieser Opfermut. Die China-Inland-Mission, der auch Mr. und Mrs. Ridley angehören, vereinigt in sich eine ganze Reihe von Sekten, High church und Lutheraner, Brethren, Methodisten, Angehörige der Heilsarmee u. a. m. Alle arbeiten gemeinsam und für einen Lohn, der gerade zum Leben ausreicht. Zu meiner Zeit hatte jedes aktive Mitglied, Mann oder Frau, etwa 20 Tael im Monat. Es galt da trotz der billigen Lebensbedingungen gut haushalten, um auszukommen.
Mr. und Mrs. Ridley warfen sich nach der schweren Prüfung mit doppelter Kraft auf ihr Werk. Es gab viel Krankenpflege in diesen Tagen. In ganz Kan su hatte es schon mehrere Monate nicht geregnet, und Scharlachfieber und Diphtherie hielten allenthalben grausige Auslese. Aus der doch kleinen Stadt Hsi ning fu trugen sie täglich achtzehn bis zwanzig Leichen. Viele Kinder warfen die Chinesen nur über die Mauer, wo wilde Hunde und Vögel sich um das Fleisch balgten.
Eines Nachts wurde ich in ein Haus geholt, wo in der Mittelhalle eine junge Frau in ihren besten seidenen Kleidern auf einer Pritsche lag und den Tod erwartete. Die taoistischen Priester hatten umsonst versucht, mit Glockenklang und Gong die Krankheit zu bannen, nun sollte der weiße Zauberer helfen. Schon stand der Sarg neben der Kranken, und keiner der Angehörigen wollte mehr in der Nähe der Frau weilen. Sie röchelte nur noch, als mir ein Diener mit der Kerze leuchtete.
Die Seuche traf alt und jung, und selten schlug ein Mittel an. Bäder und Abwaschungen, behaupteten die Leute, bedeuten den sicheren Tod. Es nahm mich nach dem hier Erlebten nicht wunder, daß die Eingeborenen die Kindersterblichkeit in und um Hsi ning fu auf 70 % schätzten; sonst nimmt man im allgemeinen in China eine Kindersterblichkeit von nur 50 % an. Und doch dringt auch hier das Chinesentum immer weiter und siegreich vorwärts. »Rdya sche sdong luch'!« (Schlägst du heute hundert tot, stehen morgen tausend dafür da!), so sprechen die Tibeter von ihren Nachbarn und Herren, den Chinesen. Eine kraftvolle Rasse braucht, um sich durchzusetzen, nicht den Schutz der europäischen Hygiene!

Abb. 10
Lung schda' (rlung'rta) (Verkleinerung eines Druckes aus Gum bum von 8x9 cm, wie solche zu Hunderten in den Wind gestreut werden)